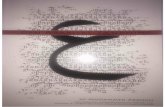Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen der Bestatteten in den...
-
Upload
ag-palaeopathologie -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen der Bestatteten in den...
431
Zusammenfassung
Obwohl sich die anthropologisch-paläopatho-logischen Untersuchungen aufgrund der Fundla-ge und den daraus resultierenden Vorarbeiten, wie beispielsweise Reinigung, Rekonstruktion und Zu-ordnung von Skeletelementen und deren Fragmen-ten sowie der erheblichen Größe des zu untersu-chenden Befundgutes, noch in einer relativ frühen Phase befinden, wurden zahlreiche Befunde erho-ben. Sowohl am Schädel als auch am Postcranium wurde eine Vielzahl krankhafter Veränderungen nachgewiesen, die auf die damaligen Umweltver-hältnisse und die sich daraus ergebenden Lebens-bedingungen schließen lassen. Bedingt durch das damalige Biotop finden sich am Schädeldach, in den Nasennebenhöhlen sowie dem Mittelohrbe-reich Spuren entzündlicher und hämorrhagischer
Prozesse. Auch Zahnstein, Karies, Parodontopa-thien, apikale Prozesse, extreme Zahnabrasion und transversale lineare Schmelzhypoplasien geben ei-nen Hinweis auf die damaligen Ernährungs- und Hygienegewohnheiten. Ausgeprägte arthrotische Veränderungen in den großen Extremitätengelen-ken und der Wirbelsäule sowie Muskel-Sehnen- und Bandzerrungen, die sich durch übermäßig aus-geprägte Muskel- und Bandmarken nachweisen lassen, belegen eine vermehrte muskuläre Bean-spruchung und häufig auch Überbelastung des Be-wegungsapparates wohl aufgrund intensiver kör-perlicher Arbeit. Gut verheilte Frakturen deuten auf eine gewisse Behandlung und Versorgung bzw. auf eine soziale Fürsorge in der damals lebenden spätneolithischen Population hin.
Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischenUntersuchungen der Bestatteten in den Galeriegräbern
von Erwitte-Schmerlecke
Susan Klingner und Michael Schultz
Abstract
The anthropological-paleopathological inves-tigations are still in a relative early stage, due to the specific find situation and the resulting neces-sary preparations such as cleaning, reconstruction and mapping of skeletal parts and their fragments as well as the substantial size of the material un-der investigation. Nevertheless, many results were already obtained. Both on the skulls as well as on the postcranium, a variety of pathological chang-es have been recorded that provide hints towards the former environmental conditions and may also indicate the resulting living conditions. As a re-sult of the former habitat, traces of inflammatory and hemorrhagic processes could be detected on the cranial roof, in the paranasal sinuses and in the
tympanic area. In addition, tartar, caries, parodon-topathies, apical processes, extreme tooth abrasion and transverse linear enamel hypoplasia indicate the former diet and hygiene habits. Severe arthritic changes to the joints of the limbs and to the spine, plus muscle-tendon and ligament strains, can be observed on the basis of pronounced muscle and ligament marks. These changes point towards in-creased muscular stress and often also towards an overload of the musculoskeletal system, most prob-ably resulting from intensive physical work. Well-healed fractures indicate a certain treatment and care, and social support among the Late Neolith-ic population.
In: M. Hinz/ J. Müller (Hrsg.), Siedlung, Grabenwerk, Großsteingrab.Studien zu Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
der Trichterbechergruppen im nördlichen Mitteleuropa.Frühe Monumentalität und soziale Differenzierung 2 (Bonn 2012) 431 – 441.
Klingner_Schultz.indd 431 03.09.12 19:16
432 Susan Klingner und Michael Schultz
Einleitung
Im Rahmen des von der DFG geförderten Pro-jektes „Genese und Struktur der hessisch – west-fälischen Megalithik am Beispiel der Soester Gruppe“ (im DFG-Schwerpunktprogramm 1400: „Frühe Monumentalität und soziale Differenzie-rung. Zur Entstehung und Entwicklung neolithi-scher Großbauten und erster komplexer Gesell-schaften im nördlichen Mitteleuropa“) werden zwei spätneolithische (3500 /3400 bis 2800 v. Chr.) Galeriegräber im Rahmen eines Kooperationspro-jektes von der Westfälischen Wilhelms-Univer-sität Münster, der LWL-Archäologie für Westfa-len, Außenstelle Olpe und der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen ausgegra-ben (Schierhold u. a. in diesem Band, Schier-hold /Klingner 2011). Alle geborgenen mensch-lichen Skeletfunde werden in der Arbeitsgruppe Paläopathologie am Zentrum Anatomie der Uni-versitätsmedizin Göttingen anthropologisch-pa-läopathologisch untersucht (Klingner u. a. im Druck). Die Knochenoberflächen, aber auch die Binnenstruktur des kompakten Knochengefüges haben sich bis in den Bereich ihrer Mikrostruktur sehr gut erhalten. Dies ist offenbar nicht nur auf die örtliche Eigenschaft des Erdbodens, sondern wohl hauptsächlich auf die beim Bau der Gräber ver-wendeten Kalksteinplatten zurückzuführen. So-mit kann ein umfassendes Spektrum an Untersu-chungsmethoden erfolgreich eingesetzt werden.
Im Rahmen der anthropologischen und paläopa-thologischen Untersuchungen werden der Perso-nalstatus (z.B. Bestimmung des Geschlechts, des Lebensalters, des Konstitutionstypus, der Händig-keit und der Körperhöhe) und der Krankheitssta-tus der in den Grabanlagen von Erwitte-Schmer-lecke bestatteten Individuen ermittelt. Auf diese Weise erhalten wir nicht nur Kenntnisse zur Ka-suistik, Ätiologie und Epidemiologie von Krank-heiten im megalithzeitlichen Westdeutschland, sondern auch individuelle Hinweise, die es häu-fig gestatten, eine biologische Biographie zu erstel-len (z.B. Schultz 2011). Ergänzend liefern diese Untersuchungen auch Informationen zur biologi-schen Herkunft, der Morbidität und der Mortalität dieser megalithzeitlichen Population. Bekanntlich stellen archäologische Skeletfunde bio-historische Urkunden dar, da sie es erlauben – wenn auch nur in Grenzen – die damals herrschenden Umwelt-verhältnisse (z.B. Ernährung, Wohn- und Arbeits-verhältnisse, geografisch-klimatische Gegebenhei-ten sowie sanitäre und hygienische Einrichtungen) und somit die Qualität damaliger Lebensbedin-gungen zu rekonstruieren. Unter Umständen kann somit auch auf die damaligen sozialen, öko-nomischen und politischen Gegebenheiten ge-schlossen werden (Klingner /Schultz 2009; Schultz 1982; Schultz /Schmidt-Schultz 2007; Schultz 2011).
Material und Methoden
Die hier in einer ersten Untersuchung vorgestell-ten menschlichen Skeletfunde entstammen zwei großen Kollektivgräbern, die sich auf einer seit Jahrhunderten landwirtschaftlich genutzten Flä-che in Erwitte-Schmerlecke mit bis zu 24 m Län-ge erstrecken. Das erste Grab (Grab III), das to-pografisch etwas höher im Gelände liegt als das zweite (Grab II), weist – wohl auch aufgrund der Bepflügung – hauptsächlich stark fragmentierte Knochen auf, die nicht mehr im anatomischen Ver-band aufgefunden wurden. In dem zweiten Grab ist die Fundsituation ähnlich. Auch hier ist ein ana-tomischer Zusammenhang zwischen den Kno-chen selten zu beobachten; allerdings sind hier die Einzelknochen besser repräsentiert. Neben stark fragmentierten Skeletelementen gibt es auch fast vollständig erhaltene Schädel und postcraniale Skeletabschnitte (Abb. 1).
Trotz der teilweise schlechten Repräsentanz der einzelnen Knochen ist die Erhaltung zum Großteil hervorragend. Die menschlichen Skeletfunde wei-sen nicht nur bei makroskopischer Begutachtung eine gute bis sehr gute Erhaltung auf. Auch histolo-gisch, bei der Betrachtung mit dem Lichtmikroskop
im polarisierten Durchlicht unter Verwendung eines Hilfsobjekts Rot 1. Ordnung (Quarz) als Kompen-sator, ist ein sehr guter Erhaltungszustand des Kno-chengewebes nachzuweisen (Abb. 2 und 3). Somit sind oft nicht nur die für eine paläopathologische Untersuchung so wichtige äußere Knochenschicht (Corticalis), sondern auch die innere Mikrostruktur des Knochens mit hervorragend konserviertem Kol-lagen noch vorhanden (Abb. 3).
Vor der anthropologisch-paläopathologischen Untersuchung der menschlichen Skeletfunde aus Schmerlecke finden verschiedene Vorarbeiten statt. Je nach Festigkeit der Knochensubstanz wer-den die Knochen vorsichtig trocken oder feucht ge-reinigt. Dabei ist darauf zu achten, dass eventuell vorhandene Spuren pathologischer Prozesse auf den Knochenoberflächen nicht zerstört werden. Aufgrund einer feuchten Lagerung im Erdbo-den konnten viele, teilweise auch sehr gut in ihrer Vollständigkeit repräsentierte Schädel, aber auch postcraniale Skeletelemente nur verdrückt und zum Teil stark fragmentiert geborgen werden. Der nächste Schritt nach der Fundreinigung ist die Re-konstruktion, d.h. das Zusammensetzen und Zu-
Klingner_Schultz.indd 432 03.09.12 19:16
433Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen
sammenkleben einzelner Knochen aus meist vie-len kleineren Knochenfragmenten mit Hilfe eines wasserlöslichen Holzleims. Oft wird bei diesem Arbeitsschritt aber auch erst ersichtlich, um wel-ches Skeletelement es sich handelt; bei paarigen Knochen wird häufig erst zu diesem Zeitpunkt die Seitenbestimmung möglich. Anschließend erfolgt eine Sortierung der Funde nach ihrer anatomi-schen Zugehörigkeit am Skelet; auf diese Weise ist auch eine Individualisierung der dislozierten Ske-letelemente möglich. Nicht in jedem Fall kann eine Individualisierung, also eine Zuordnung von Ske-letelementen zu einem speziellen Individuum vor-genommen werden. In der Regel müssen zuvor vie-le Einzelknochen untersucht werden, um weitere Hinweise auf eine eventuelle Zusammengehörig-keit zu erlangen.
Für alle Individuen – und in Grenzen auch erst einmal für jeden Einzelknochen – wird ein Perso-nalstatus erstellt. Dabei werden das Lebensalter, in welchem die Individuen verstorben sind, das Ge-schlecht, die Körperhöhe, die Händigkeit (Links- oder Rechtshänder), der Konstitutionstypus, die geografische Herkunft (morphologischer Typus) sowie epigenetische Merkmale (mögliche Ver-wandtschaft) – soweit dies möglich ist – bestimmt. Aufgrund des guten Erhaltungszustandes der Ske-
Abb. 1. Übersichtsfoto einer Knochenansammlung in Schnitt 3 (Grab II in Erwitte-Schmerlecke). Hier wird deutlich, dass die Knochen nach dem Zerfall der Weichgewebe an einen gemein-samen Platz verbracht und somit aus ihrem anatomischen Ver-band entfernt wurden. In dieser Ansammlung von Knochen sind sämtliche Skeletbereiche repräsentiert. Allerdings gibt es auch Schichtungen von Knochen, die in der Regel in Vertiefungen an den Längsseiten des Grabes liegen, und nur aus Langknochen be-stehen.
Abb. 2. Mikrofotografie des Querschliffs eines linken Femurs ei-nes subadulten Individuums (25fache Vergrößerung). Die innere und die äußere Generallamelle (Pfeile) sowie der Großteil des Os-teonenknochens sind sehr gut erhalten. Die äußere Randzone ist weniger „farbintensiv“. In diesem Bereich ist das Kollagen nicht so gut erhalten wie in den inneren zwei Dritteln des Knochen-querschnittes. Betrachtung mit dem Mikroskop im polarisierten Durchlicht unter Verwendung eines Hilfsobjektes Rot 1. Ordnung (Quarz) als Kompensator. Hier war eine mikroskopische Alters-bestimmung möglich. Für das Kind kann ein Lebensalter von 5-7 (8) Jahren angenommen werden.
Abb. 3. Mikrofotografie des Querschliffes durch ein linkes Femur eines subadulten Individuums (200 fache Vergrößerung, Aus-schnitt aus Abbildung 2). In dem Bild sind zwei komplette, gut er-haltene Osteone mit ihrem lamellären Aufbau sichtbar. Das Kol-lagen ist sehr gut erhalten. Die kleinen schwarzen Punkte stellen Osteozytenhöhlen dar. Betrachtung mit dem Mikroskop im pola-risierten Durchlicht unter Verwendung eines Hilfsobjektes Rot 1. Ordnung (Quarz) als Kompensator.
letelemente kann die Altersbestimmung nicht al-lein anhand der makroskopischen Begutachtung morphologischer Merkmale erfolgen. An Einzel-knochen und Knochenfragmenten kann zusätzlich eine histomorphologische und eine histomorpho-metrische Altersbestimmung vorgenommen wer-den (Abb. 2 und 3; Kerley 1965; Kerley /Ube-laker 1978; Nováček 2012). Dafür werden von
Klingner_Schultz.indd 433 03.09.12 19:16
434 Susan Klingner und Michael Schultz
den entsprechenden Knochen Proben genommen, Dünnschliffe angefertigt und mikroskopisch aus-gewertet. Durch die Erstellung eines vorläufigen Personalstatus an den Einzelknochen kann die Maximal- bzw. Minimalzahl der vor Ort bestat-teten Individuen geschätzt werden; dies und die Zusammenführung einzelner Skeletelemente zu einem Individuum ermöglicht dann erst die Erstel-lung eines vollständigen, d.h. auf ein Individuum bezogenen Personal- und Krankheitsstatus.
Für die paläopathologischen Fragestellungen kommt das gesamte Methodenspektrum von Un-tersuchungsmöglichkeiten zur Anwendung. So werden die Knochen makroskopisch, lupenmi-
kroskopisch, licht- und rasterelektronenmik-roskopisch, röntgenologisch und endoskopisch untersucht. Alle Funde – und besonders auch pa-thologische Veränderungen des Knochens – wer-den grafisch, fotografisch und metrisch dokumen-tiert. Je nach Möglichkeit werden alle äußeren und inneren Knochenoberflächen makroskopisch begutachtet und lupenmikroskopisch befundet (Schultz 1988 a): z.B. Schädel, Zähne und Kie-
Abb. 4. a Linkes Femur eines erwachsenen, wohl weiblichen In-dividuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) mit Nagespuren (Pfeil) auf der dorsalen Oberfläche (Fragmentlänge: 24,1 cm).b Der Ausschnitt zeigt die vergrößerte Ansicht der dorsalen Ober-fläche mit Nagespuren am linken Femur eines erwachsenen, wohl weiblichen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke).
Abb. 5. a Linkes Femur eines erwachsenen, wohl weiblichen In-dividuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) mit einer grünen Verfärbung (Pfeil) auf der ventralen Oberfläche (Fragmentlän-ge: 26,2 cm). Die durch Kupferionen verursachte Grünfärbung könnte von Kupferschmuck oder anderen Kupfergegenständen herrühren. b Der Ausschnitt zeigt die Vergrößerung der media-len Oberfläche des linken Femurs eines erwachsenen, wohl weib-lichen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) mit einer grünen Verfärbung (Pfeil). Durch die bakterizide Wirkung von Kupfer wurde die Oberfläche an dieser Stelle besonders gut er-halten, Spuren einer Periostreaktion (Pfeil), die offenbar aktivi-tätsbedingt oder entzündlichen Ursprungs sind, wurden so kon-serviert.
a a
b
b
Klingner_Schultz.indd 434 03.09.12 19:16
435Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen
fer, Extremitäten- und Wirbelsäulengelenke. Die Schädelinnenräume (z.B. Nase- und Nasenneben-höhlen, Paukenhöhle und Warzenfortsatzzellen des Schläfenbeins, Schädelinnenraum) werden en-doskopisch und röntgenologisch untersucht. Von pathomorphologisch auffälligen Strukturen wer-den – falls es für eine sichere Diagnosestellung un-abdingbar ist - Knochendünnschliffe und raster-elektronenmikroskopische Präparate (Schultz
1988 b) angefertigt und – nur nach besonderer Fragestellung - Proben für die Extraktion extra-zellulärer Knochenmatrixproteine (Schmidt-Schultz /Schultz 2004) entnommen. Bei einer kombinierten licht- und rasterelektronenmikros-kopischen Untersuchung ist, in der Regel, eine si-chere Krankheitsdiagnose und ihre Abgrenzung gegen die Spuren postmortaler Einwirkungen ge-währleistet.
Ergebnisse und Diskussion
Das bisherige Augenmerk der Untersuchungen lag auf den Schädeln und den Femora aus Grab II. Anhand der vorliegenden Schädel, Schädelfragmen-te, Femora und Femurfragmente ist für dieses Grab zum jetzigen Zeitpunkt der Untersuchung mit ei-ner Mindestzahl von 109 Individuen zu rechnen. Bei neun dieser Individuen konnten das linke und das rechte Femur bereits individualisiert, das heißt einander zugeordnet werden. Dabei handelt es sich um Individuen beider Geschlechter. Fünf der Indi-viduen sind wohl weiblich, zwei wohl männlich und zwei konnten nicht geschlechtsbestimmt werden. An mehreren Femora aus Grab II konnte Tierver-biss beobachtet werden. Dabei handelt es sich meist um die Zahnspuren von Nagetieren (Abb. 4 a und b). Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Toten aus Grab II noch für einen gewissen Zeitraum für Tiere zugänglich gewesen sein müssen. Entweder wurde das Grab nach dem Einbringen der Toten nicht so-fort wieder verschlossen oder die Verstorbenen wur-den eventuell nicht sofort in das Grab verbracht.
Ein linkes Femur eines erwachsenen wohl weib-lichen Individuums (Abb. 5 a und b) und ein linkes Os carpale, das Os capitatum, weisen in umschrie-benen Bereichen eine grüne Verfärbung bedingt durch Kupferionen auf. Somit kann angenom-men werden, dass diese Verfärbungen von Kup-ferschmuck – im Falle des Handwurzelknochens vielleicht Armschmuck – oder von anderen Kup-fergegenständen herrühren, welche die Toten am Körper trugen. An dem Femur ist durch die bak-terizide Wirkung der Kupferionen die Oberflä-che sehr gut erhalten geblieben und hat somit auch eine durch einen pathologischen Prozess verur-sachte Oberflächenveränderung konserviert. Die Oberfläche ist in diesem Bereich leicht ausgeprägt wulstig und vereinzelt feinporös und weist eine feinsträhnige Struktur auf. Diese Veränderungen sind Spuren einer verheilten Periostreaktion, die beispielsweise durch übermäßige Aktivität im Seh-nenansatzbereich der entsprechenden Muskulatur oder durch eine Infektion der Knochenhaut oder des Knochens verursacht wurde.
An den Schädeln konnten bislang zahlreiche Spu-ren von ernährungs- und biotopbedingten Erkran-kungen bzw. Veränderungen festgestellt werden.
Häufig wurden auf der Oberfläche des Endocrani-ums Spuren von entzündlichen Reizungen der Me-ningen (Dura mater) beobachtet. Aber auch Spuren von hämorrhagischen Geschehen sind auf der La-mina interna des Schädeldaches nachweisbar. Bei ei-nem erwachsenen, wohl männlichen Individuum aus Grab II zeigt die Lamina interna des Os frontale (nur dieses hat sich vom Schädel erhalten) eine ver-narbte Oberflächenstruktur, und die Tubera fronta-lia (Stirnbeinhöcker) sind mit einer Stärke von bis zu 14 mm nach innen verdickt (Abb. 6 und 7). Licht-mikroskopisch konnte der makroskopische Be-fund einer gut verheilten Pachymeningeosis haemor-rhagica interna verifiziert werden (Abb. 8 und 9), die offenbar durch ein Schädel-Hirn-Trauma, Vi-tamin B1-Mangel, Arteriosklerose oder eine chro-nische Nierenerkrankung entstehen kann (Berlit 2004) und in der Regel mit Blutungen einhergeht. Des Weiteren finden sich Spuren von zum Teil chro-nischen Entzündungsprozessen wie Otitis media (Mittelohrentzündung), Mastoiditis (Warzenfort-satzentzündung) und chronischer Sinusitis frontalis (Stirnhöhlenentzündungen; Abb. 10).
Am harten Gaumen vieler Individuen konn-ten Spuren einer chronischen Stomatitis beobach-tet werden. Außerdem finden sich an vielen Zähnen und alveolären Zahnbereichen Zahnstein (Abb. 11), vereinzelt auch Karies und Spuren apikaler Prozes-se bzw. von Wurzelspitzenabszessen (Abb. 12). Wei-terhin traten devitale Zähne, Hyperzementose, Se-kundärdentin, Spuren von Parodontose in Form atrophierter Alveolarränder, Spuren von Parodonti-tis in Form poröser und gezackt ausgebildeten Ale-volarrändern (palatinal und lingual), wulstartigen Neubildungen (fibroossäre Tumoren auf dem Bo-den der chronischen Entzündung entstanden) und atrophiertem Alveolarknochen als Folge von Zahn-fleischtaschen auf. Transversale lineare Schmelzhy-poplasien, die als unspezifische Stressmarker aus der Kindheit resultieren, wurden mehrmals an Ober- und Unterkierfrontzähnen nachgewiesen.
Auch an den Postcranien zeigen sich diver-se Krankheitsspuren und Veränderungen. Neben Spuren von Erkrankungen der oberen Atemwege – wie anhand der Veränderungen am Schädel auf-gezeigt – konnten auch Spuren von Erkrankungen
Klingner_Schultz.indd 435 03.09.12 19:16
436 Susan Klingner und Michael Schultz
Abb. 6. Innenansicht des Os frontale eines erwachsenen, wohl männlichen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) mit nach endocranial verdickten Tubera frontalia (Pfeile).
Abb. 7. Röntgenaufnahme des Os frontale aus Abbildung 8 (50kV, 5min). Die durch die Pachymeningeosis haemorrhagica interna verdickten Bereiche erscheinen im Röntgenbild strahlen-dichter (im Foto heller, Pfeile).
Abb. 8. Dünnschliff (70 µm) aus dem linken Bereich (Tuber frontale) des Os frontale aus Abbildung 6. Die Verdickung des Schädeldaches ist hier gut sichtbar. Am linken Rand des Kno-chendünnschliffes ist die ursprüngliche Dicke des Stirnbeines er-kennbar. Etwa in der Mitte befindet sich ein postmortales Arte-fakt in Form eines Risses, welcher im Zuge der Konservierung mit Holzleim verfüllt wurde.
Abb. 9. Mikrofotografie des Querschliffes (50 µm) durch das linke Tuber frontale aus dem Os frontale in Abbildung 6. In der lin-ken unteren Ecke des Bildes ist die neu gebildete Lamina interna des Schädeldaches zu erkennen. In der rechten oberen Ecke ist die alte Lamina interna (Pfeil) mit einem kleinen Rest der darüber liegenden ursprünglichen Diploë zu sehen. Dazwischen befindet sich das durch den Krankheitsprozess neu entstandene, diploëar-tig angebaute Knochengewebe. Es handelt es sich hier um einen gut ausgeheilten Prozess. Betrachtung mit dem Mikroskop im po-larisierten Durchlicht unter Verwendung eines Hilfsobjektes Rot 1. Ordnung (Quarz) als Kompensator (16 fache Vergrößerung).
Abb. 10. Os frontale des erwachsenen, wohl männlichen Individu-ums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke), das auch in den Abb. 6 – 9 zu sehen ist: mit Blick auf die hintere Wand der Sinus frontales. Die hintere Wand und der Boden der Stirnhöhlen zeigen eine wulsti-ge Oberflächenstruktur mit abgerundeten stippchenartigen Neubil-dungen, die durch eine chronische Sinusitis frontalis entstanden sind.
der unteren Atemwege beobachtet werden. Meh-rere Rippen zeigen auf den Innenflächen Verände-rungen, die auf eine verheilte Pleuritis (z.B. Rippen-fellentzündung) schließen lassen. Entzündungen der Pleura sind oftmals die Folge einer Lungener-krankung (z.B. Bronchopneumonie, Lungentu-berkulose), können aber beispielsweise auch das Ergebnis von Infektionen mit Viren oder von Sys-temerkrankungen (z.B. Rheuma) sein (Thomas 1996). An den Rippen finden sich zum Teil gut aus-geprägte Muskel- und Bandmarken.
Die großen Gelenke, bisher hauptsächlich das Hüft- und das Kniegelenk, zeigen teilweise stark ausgebildete degenerative Veränderungen in Form von Arthrose (vgl. Abb. 16). Da die Gelen-
Klingner_Schultz.indd 436 03.09.12 19:16
437Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen
Abb. 11. Frontalansicht des Unterkiefers eines früh- bis späta-dulten, männlichen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmer-lecke). An den Zähnen ist der Zahnstein (oberer Pfeil) erhalten geblieben und am Alveolarknochen sind Spuren einer Parodon-titis erkennbar (poröse Struktur und Atrophie des Knochens, un-terer Pfeil).
Abb. 12. Linke Oberkieferhälfte eines frühmaturen (oder älter als frühmaturen) Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke). Die erhaltenen Zähne sind weitgehend abradiert. An der Wurzel-spitze des ersten Prämolaren hat sich ein Wurzelspitzenabszess (unterer Pfeil) ausgebildet, den oberflächlichen Oberkieferkno-chen zerstört und die hier sichtbare Abszesshöhle hinterlassen. Die Wurzel des ersten Prämolaren weist – durch den entzündli-chen Prozess bedingt – eine Hyperzementose (oberer Pfeil) auf. Auch der Alveolarknochen im Bereich des ersten Molaren ist buc-cal nicht mehr vorhanden. Der erste Molar ging wohl als Folge ei-nes Entzündungsprozesses schon intravital verloren oder wurde nur noch durch das Weichgewebe gehalten (linker Pfeil).kabschnitte zum Untersuchungszeitpunkt noch
hauptsächlich isoliert vorlagen, also keine vollstän-digen Gelenke befundet werden konnten, ist zum momentanen Untersuchungsstand nicht automa-tisch von einer altersbedingten Arthrose auszuge-hen. Unter anderem muss auch eine Sekundärarth-rose – beispielsweise als Folge eines traumatischen Geschehens – differentialdiagnostisch in Betracht gezogen werden. Bei einem Individuum besteht aufgrund des morphologischen Befundes am di-stalen Gelenk des fünften Os metatarsale die Ver-dachtsdiagnose Gicht.
Im Bereich der Wirbelsäule finden sich ebenfalls degenerative Veränderungen (Spondylosis defor-mans und Spondylarthrosis deformans) verschiede-ner Ausprägungsgrade bis hin zur Ankylosierung (knöcherne Versteifung) der Wirbelkörper und der kleinen Wirbelgelenke sowie congenitale bzw. dysontogenetische Blockwirbel.
An den Postcranien wurden auch zahlreiche physische Stressmarker durch vermehrte Mus-kelbeanspruchung in Form von Myotendopathi-en (Muskel-Sehnen-Zerrungen; Abb. 13) und Liga-mentopathien (Bandzerrungen) festgestellt. Bisher fanden sich Muskel-Sehnen- und Bandzerrungen an Coxae, Femora, Tibiae und Humeri. Ein weite-rer Hinweis auf eine vermehrte Belastung des Be-wegungsapparates (beispielsweise durch körperli-che Arbeit) sind die häufig sehr stark ausgeprägten Muskel- und Bandmarken (Abb. 14). Diese konn-ten bisher an Langknochen wie Humeri, Radii, Fe-
mora, Tibiae, Fibulae und an Calcanei beobachtet werden.
In einigen Fällen zeigten die Hälse der Femo-ra angeborene „Reiterfacetten“ (epigenetisches Merkmal) und poröse Gruben im Sinne einer Allen’schen Fossa (Stressmarker).
An den Oberflächen der Langknochen der unte-ren Extremität (Femora und Tibiae) konnten häu-fig Spuren von Periostitis oder Periostosen (Kno-chenhautreizungen) angetroffen werden (Abb. 15). Hier liegen wohl hauptsächlich durch übermäßige Muskelbeanspruchung entstandene Veränderun-gen und somit Stressmarker vor; aber auch durch Infektionen hervorgerufene Veränderungen wur-den beobachtet.
Vereinzelt konnten Frakturen in verschiedenen Bereichen des Skelets festgestellt werden. So fand sich zum Beispiel an einem fünften rechten Os me-tatarsale eines erwachsenen Individuums im me-dialen Bereich der proximalen Gelenkfläche ein frakturbedingter Riss (dorsal–plantar ausgerich-tet), der nur am dorsalen und plantaren Rand Cal-lus zeigt. Dorsal finden sich auf der Oberfläche die-ses Knochens Spuren einer Hämorrhagie und im distalen Gelenkbereich knöcherne Neubildungen, die wohl auf eine unphysiologische Belastung der Bänder bzw. Gelenkkapseln zurückzuführen sind.
Klingner_Schultz.indd 437 03.09.12 19:16
438 Susan Klingner und Michael Schultz
Abb. 13. Linke Tibia eines erwachsenen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) in dorsaler Ansicht. Es sind zwei kleinere, grubenförmige Läsionen an der Ursprungstelle des Musculus ti-bialis posterior und eine längere grubenförmige Läsion (Pfeile) an der Ursprungsstelle des Musculus soleus zu erkennen.
Abb. 14. Linker Calcaneus eines erwachsenen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) in cranialer Ansicht. Der Ansatz der Achillessehne (Sehne des Musculus triceps surae) ist über die Norm vergrößert (Pfeile).
Abb. 15. Schaft der rechten Tibia eines erwachsenen Individu-ums aus Grab II (Erwitte-Schmerlecke) in medialer Ansicht. Die Schaftoberfläche zeigt eine ausgeprägt feinsträhnige, verein-zelt auch feinporöse Struktur die auf Vernarbungen hinweist. Als mögliche Ursache kommen hier sowohl eine muskuläre Überbe-lastung als auch eine Infektion in Frage.
Abb. 16. Proximales Gelenkende des rechten Femur eines erwach-senen, wahrscheinlich männlichen Individuums aus Grab II (Er-witte-Schmerlecke) in dorsaler Ansicht. Am Rand des Femurkop-fes befinden sich neu gebildete Randleisten (bis zu 6 mm breit; unterer Pfeil); auf der Fläche sind größere wulstartige Neubil-dungen erkennbar (oberer Pfeil). Dieses Individuum litt an einer stark ausgeprägten Hüftgelenksarthrose (Grad IV − V).
Klingner_Schultz.indd 438 03.09.12 19:17
439Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen
Des Weiteren konnten eine gut verheilte Rippen-fraktur einer rechten unteren Rippe eines erwach-senen Individuums und eine gut verheilte Frak-tur einer rechten Ulna eines erwachsenen, wohl männlichen Individuums (Abb. 17 und 18) nach-gewiesen werden. Die Ulna weist etwa im oberen Drittel des Schaftes starke Callusbildung auf und der darauf folgende distale Teil des Schaftes ist in Fehlstellung, nach medial abgewinkelt (Winkel 28°), mit dem oberen Schaftbereich verwachsen. Anhand der Röntgenaufnahme (Abb. 18) ist zu er-kennen, dass die Ulna komplett durchgebrochen war. Durch den starken Zug der Unterarmmuskeln wurde der distale Teil des Knochens nach proxi-
Abb. 17. Ventrale Ansicht der rechten frakturierten Ulna eines wohl männlichen Individuums aus Grab II (Erwitte-Schmer-lecke) im Vergleich mit einer physiologischen männlichen Ulna (Kāmid el-Lōz) ebenfalls in ventraler Ansicht. Der distale Teil der Ulna ist aufgrund ausgebliebener Reponierung in medialer Richtung abgewinkelt mit dem proximalen Schaftbereich ver-wachsen (Pfeil).
Abb. 18. Röntgenaufnahme der Ulna mit der verheilten Frak-tur aus Abbildung 17 in medialer Ansicht (45 kV, 6 min, m-l). Die knöchern verheilte ehemalige Frakturlinie (Pfeil) und die Verdi-ckung des Schaftes aufgrund der Callusbildung belegen einen sehr guten Ausheilungszustand.
mal gezogen und ist in der hier vorliegenden Posi-tion zusammengewachsen. Der proximale Teil der Ulna weist Spuren einer Muskel- und Bandüberlas-tung sowie einer Reizung der Gelenkkapsel auf, die wohl als Folge des Frakturgeschehens zu interpre-tieren sind. Vor allem der Ansatz des Musculus bra-chialis ist besonders kräftig ausgebildet. Der Margo interosseus (Ansatz der Zwischenknochenmebran zwischen Ulna und Radius) ist an dem nach medi-al gebogenen Schaftbereich stark ausgezogen. Die Gesamtheit dieser Befunde belegt, dass der Radi-us auch frakturiert war. Die Ulna wurde zwar nicht reponiert, aber die Fraktur muss versorgt worden sein, da sie sonst nicht so gut ausgeheilt wäre.
Klingner_Schultz.indd 439 03.09.12 19:17
440 Susan Klingner und Michael Schultz
Ausblick
Auch in Zukunft werden die Vorarbeiten, die für derartige anthropologisch-paläopathologische Un-tersuchungen an den menschlichen Skeletfunden von Erwitte-Schmerlecke nötig sind, einen großen Zeitaufwand erfordern. Schritt für Schritt sollen weitere Skeletelemente untersucht, ein Personal-status und – soweit wie möglich – ein Krankheits-
status einzelner Knochen erstellt werden. Erst da-nach wird über eine weitere Individualisierung versucht, möglichst viele Einzeldaten zu erhalten, die in der Summe ihrer Information eine relativ zu-verlässige Rekonstruktion damaliger Lebensver-hältnisse zulassen.
Danksagung
Die Autoren danken Frau I. Hettwer-Steeger und Herrn M. Brandt für die Vorbereitung der Pro-ben für die Rasterelektronenmikroskopie und die Dünnschliffherstellung.
Klingner_Schultz.indd 440 03.09.12 19:17
441Erste Ergebnisse zu den anthropologisch-paläopathologischen Untersuchungen
Literaturverzeichnis
Berlit 2004: P. Berlit (Hrsg.), Therapielexikon Neurologie (Berlin/Heidelberg 20041) 955.
Kerley 1965: E.R. Kerley, The Microscopic Determination of Age in Human Bone. Am. J. Phys. Anthropol. 23, 1965, 149 – 163.
Kerley/Ubelaker 1978: E.R. Kerley/D.H. Ubelaker, Revisi-ons in the Microscopic Method of Estimation Age at Death in Human Cortical Bone. Am. J. Phys. Anthropol. 49, 1978, 545 – 546.
Nováček 2012: J. Nováček, Möglichkeiten und Grenzen der makroskopischen Leichenbranduntersuchung (Dissertati-on Univ. Hildesheim 2012).
Klingner u. a. im Druck: S.Klingner/K. Schierhold/M. Baa-les/ M. Schultz, Die Toten von Erwitte-Schmerlecke – ers-te Erkenntnisse. Arch. in Westfalen-Lippe 2011 (im Druck).
Klingner/Schultz 2009: S. Klingner/M. Schultz, Paläopatho-logie als interdisziplinärer Arbeitsbereich zwischen Medi-zin, Anthropologie und Archäologie. In: S. Grunwald u.a. (Hrsg.), ARTeFACT. Festschrift für Sabine Rieckhoff zum 65. Geburtstag. Universitätsforsch. zur prähist. Archäolo-gie 172 (Bonn 2009).
Schierhold u. a. 2011: K. Schierhold/S. Klingner/E. Cichy/M. Baales, Häuser für die Toten – Die spätneolithischen Gale-riegräber in Erwitte-Schmerlecke. Arch. in Westfalen-Lip-pe 2010 (2011) 35 – 38.
Schmidt-Schultz /Schultz 2004: T.H. Schmidt-Schultz/M. Schultz, Bone protects proteins over thousands of years: extraction, analysis, and interpretation of extracellular matrix proteins in archaeological skeletal remains. Am. J. Phys. Anthropol. 123, 2004, 30 – 39.
Schultz 1982: M. Schultz, Umwelt und Krankheit des vor- und frühgeschichtlichen Menschen. In: H. Wendt /N. Loa-cker (Hrsg.), Kindlers Enzyklopädie. Der Mensch 2. (Mün-chen/Zürich 1982) 259 – 312.
Schultz 1988 a: M. Schultz, Paläopathologische Diagnostik. In: R. Knußmann (Hrsg.), Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen 1, Teil 1 (Stuttgart/New York 1988) 480 – 496.
Schultz 1988 b: M. Schultz, Methoden der Licht- und Elektro-nenmikroskopie. In: R. Knußmann (Hrsg.), Anthropolo-gie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen 1. Teil 1 (Stuttgart/New York 1988) 698 – 730.
Schultz 2011: M. Schultz, Paläobiographik. In: G. Jüttemann (Hrsg.), Biographische Diagnostik (Lengerich/Berlin/Bremen 2011) 222 – 236.
Schultz/Schmidt-Schultz 2007: M. Schultz/T.H. Schmidt-Schultz, Neue Methoden der Paläopathologie – New me-thods in paleopathology. In: C. Niemitz (Hrsg.), Brenn-punkte und Pespektiven der aktuellen Anthropologie – Focuses and perspectives of modern physical anthropo-logy. Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropo-logie, Ethnologie und Urgeschichte (Berlin 2007) 73 – 81.
Schultz u. a. 2003: M. Schultz /R. Walker /E. Strouhal /T.H. Schmidt-Schultz, Report on the skeleton of Jj-nfrt excava-ted from his mastaba in the north cemetery of Unis s py-ramid (5th Dynasty). In: N. Kanawati N /M. Abder-Raziq (Hrsg.), The Unis cemetery at Saqqara: The tombs of Iyne-fert and Ihy (reused by Idut) (Oxford 2003) 75 – 86.
Thomas 1996: C. Thomas (Hrsg.), Spezielle Pathologie (Stutt-gart /New York 1996) 149.
Susan Klingner, Michael SchultzUniversitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität
Zentrum Anatomie, Arbeitsgruppe PaläopathologieKreuzbergring 36
D-37075 Göttingen
Klingner_Schultz.indd 441 03.09.12 19:17