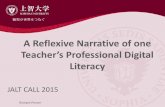Die erste Ölkrise (1973) Eine reflexive Analyse
Transcript of Die erste Ölkrise (1973) Eine reflexive Analyse
Die erste Ölkrise (1973)
Eine reflexive Analyse
Nicolas Berchten Matrikelnr.: 09-‐611-‐088
E-‐Mail: [email protected]
Jan Brecelj Matrikelnr.: 09-‐608-‐084
E-‐Mail: [email protected]
Universität St.Gallen Wirtschaftskrisen -‐ historische und theoretische Perspektiven
Prof. Dr. Rainer Metz FS 2014
02. Juni 2014
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- II -
Abstract Die Vorliegende Arbeit untersucht die Ursachen, Wirkung und Folgen der ersten Erdölkrise 1973. Während 1973/74 realisierten die Erdölförderländer des Nahen Ostens mehrfach Preiserhöhungen gegenüber den westlichen Erdölgesellschaften und setzten die Regulierung ihrer Fördermenge zur Durchsetzung politischer Interessen ein. Die Ursachen (Makro-, Meso- und Mikro-Ebene) und Folgen (Gesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch) sind dabei komplex und in der vorhandenen Literatur teilweise unterschiedlich stark gewichtet. Die Verfasser setzen den Fokus ihrer Analyse auf die Ausarbeitung der zum heutigen Zeitpunkt relevanten Ereignisse und Besonderheiten, um insbesondere die Frage zu beantworten, welche Lehren aus der Krisenbewältigung 1973 gezogen werden können.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- III -
Inhaltsverzeichnis
Abstract ........................................................................................................................................... II
Inhaltsverzeichnis ........................................................................................................................... III
Abbildungsverzeichnis .................................................................................................................... IV
Tabellenverzeichnis ........................................................................................................................ IV
1 Einleitung .................................................................................................................................. 1
1.1 Zielsetzung ........................................................................................................................ 1
1.2 Methodik & Themeneingrenzung ....................................................................................... 1
1.3 Darlegung der für die Krise relevanten Zeitumstände ....................................................... 2
2 Ausbruch und Verlauf der Krise ................................................................................................ 6
3 Ursachen der Krise ................................................................................................................... 9
3.1 Makro-Ebene ................................................................................................................... 10
3.2 Meso-Ebene .................................................................................................................... 10
3.3 Mikro-Ebene .................................................................................................................... 12
4 Folgen der Krise ...................................................................................................................... 13
4.1 Gesellschaftliche Folgen .................................................................................................. 13
4.2 Wirtschaftliche Folgen ..................................................................................................... 14
4.3 Politische Folgen ............................................................................................................. 15
5 Kritische Würdigung & zeitgenössische Kontroversen ........................................................... 17
5.1 Rolle der OPEC ............................................................................................................... 17
5.2 Rolle der USA .................................................................................................................. 17
5.3 Einfluss des Jom-Kippur Kriegs ....................................................................................... 18
6 Exkurs - 1973 eine Epochengrenze? ...................................................................................... 19
7 Fazit ........................................................................................................................................ 20
7.1 Zusammenfassung .......................................................................................................... 20
7.2 Ansatz für weitergehende Untersuchungen ..................................................................... 21
Literaturverzeichnis ....................................................................................................................... 22
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- IV -
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Methodik zur Erarbeitung der Forschungsfragen ....................................................... 1
Abbildung 2: Entwicklung des Erdölpreises ab 1970 ...................................................................... 8
Abbildung 3: Endenergieverbrauch der Schweiz nach Energieträgern ......................................... 13
Abbildung 4: Wachstumsraten im Zeitverlauf ................................................................................ 19
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Übersicht über die Ursachen der Erdölkrise 1973 .......................................................... 9
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
1 - -
1 Einleitung Eine Ideensammlung unter den Studierenden des Kurses „Wirtschaftskrisen - Historische & Theoretische Perspektiven„ an der Universität St. Gallen im Rahmen einer Präsentation vom 08. April 2014 der Autoren zum Thema „Die erste Erdölkrise 1973“ hat gezeigt, welche Begriffe die Studierenden mit der Ölkrise 1973 assoziieren: OPEC, Kartell, Geldgier, Abhängigkeit, Erdölknappheit und autofreie Sonntage. Die dargelegte Ideensammlung zeigt, dass Ursachen, Wirkung und Folgen der ersten Erdölkrise 1973 teilweise wohl bekannt sind, sich jedoch objektive Tatsachen mit der subjektiven Wahrnehmung in der breiten Gesellschaft teilweise vermischen.
1.1 Zielsetzung Die vorliegende Arbeit zielt auf die Darlegung der spezifischen Ursachen, Wirkung und wirtschaftlichen, sozialen als auch institutionellen Folgen der ersten Erdölkrise 1973 ab. Zudem richten die Autoren ein Augenmerk auf die Massnahmen im Umgang mit der ersten Erdölkrise 1973 durch politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger. Dabei sollen insbesondere folgende Fragen beantwortet werden: Was sollte der Leser zur ersten Erdölkrise 1973 heute unbedingt noch wissen? Warum ist die Geschichte dieser Krise heute noch interessant? Und was können wir aus der historischen Analyse der Krise lernen? Um dem Anspruch einer reflexiven Analyse gerecht zu werden, wird die Thematik aus einem objektiv-kritischen Blickwinkel betrachten. Ausgewählte Themen erfahren dabei vertiefte Erläuterung. Die Auseinandersetzung mit der Thematik hat gezeigt, dass beispielsweise die Beantwortung der Frage, ob die Erdölkrise 1973 eine Epochengrenze im Wachstumszyklus darstellt oder nicht, von grosser Relevanz ist. Diese Frage ist sowohl von einem wirtschaftshistorischen Standpunkt aus betrachtet (in Bezug auf die Entwicklung des Wirtschaftswachstums) als auch aus gesellschaftlicher Perspektive (in Bezug auf die Entwicklung der Gesellschaft) bedeutsam. Die Autoren legen auf die Beantwortung dieser Frage daher besonderes Gewicht.
1.2 Methodik & Themeneingrenzung Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit werden in drei Schritten bearbeitet.
Abbildung 1: Methodik zur Erarbeitung der Forschungsfragen (Quelle: Eigene Darstellung) Während in einem ersten Schritt die relevante Literatur zur Thematik recherchiert und analysiert wird, werden die Ergebnisse aus der Literaturrecherche in einem zweiten Schritt durch ein Experteninterview weiter vertieft. Abschliessend werden vorherrschende Standpunkte aus der Literatur und Expertenmeinung zusammengeführt und die Forschungsfragen beantwortet. Die Kapitel dieser Arbeit ergeben sich dabei aus den einzelnen Schritten eines Krisenprozesses. In Anlehnung an Krystek, Moldenhauer et al. (2007, Kapitel A) findet der Krisenprozess seinen
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 2 -
Ursprung in den Krisenursachen. Die daraus resultierende Krisensituation führt in der Folge die Krisenbewältigung sowie ein Ergebnis herbei, welches entweder durch Erfolg oder Misserfolg charakterisiert werden kann. Sowohl Erfolg als auch Misserfolg führen zu einem Lerneffekt auf individueller aber auch gesellschaftlicher Ebene. Dieser Lerneffekt kann nach Krystek, Moldenhauer et al. darauf angewendet werden, zukünftige Krisen vermeiden oder aus vorhergehenden Krisen gewonnene Erfahrungen auf die aktuelle Situation anzuwenden und so eine mögliche Verschlimmerung der Situation zu verhindern. Dass das Lernen aus einer Krise durch die Komplexität und Vielseitigkeit ihrer Ursachen häufig kein triviales Unterfangen ist, soll die Aufarbeitung der relevanten Geschehnisse um 1973 in der vorliegenden Arbeit dem Leser verdeutlichen. Die Arbeit schliesst mit einer kritischen Reflexion der erläuterten Inhalte unter Verwendung zeitgenössischer Kontroversen sowie einer Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse.
1.3 Darlegung der für die Krise relevanten Zeitumstände Im folgenden Abschnitt sollen die aus wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Perspektive relevanten Zeitumstände um 1973 aufgezeigt werden, um dem Leser die Einordnung der Geschehnisse während der ersten Erdölkrise 1973 zu ermöglichen.
- Wirtschaftlich -
Aus wirtschaftlicher Perspektive hebt Parra (2010, S.146) insbesondere den Kontrollwechsel über in der Erdölindustrie in den OPEC Ländern von den westlichen Erdölfirmen zu den Regierungen der Förderländern hervor. Im Zeitraum von 1971 bis 1973 kam es nach Para in vielen Förderländern zu Verstaatlichungen und Teilverstaatlichungen der Erdölfirmen: Verstaatlichungen der französischen Gesellschaften in Algerien 1971, Verstaatlichung der IPC im Irak 1972 sowie die Verstaatlichungen in Libyen 1973 (S.150). In weiteren Staaten erwarben die Regierungen massgebende Beteiligungen oder entzogen westlichen Erdölfirmen ihre Förderlizenzen, was schliesslich eine Verschiebung der Kontrolle über Preissetzung, Produktionsniveau als auch Investitionsentscheide hin zu den Regierungen der Förderländer bedeutete (S.146). Auch Hohensee (1996, S.27) verortet den Kontrollwechsel in die Zeit vor der ersten Erdölkrise 1973. Der vollständige „Souveränitätswechsel beim Erdöl“, so Hohensee, passierte zwischen 1967 und 1973. Dieser Souveränitätswechsel stellte eine fundamentale Abweichung der seit Beginn des 20. Jahrhunderts bestehenden Vorherrschaft der westlichen Erdölfirmen in der Erdölindustrie dar. Die Mitbestimmungsrechte der Förderländer waren zuvor für lange Zeit äusserst beschränkt (1996, S.17). Durch das im Erdölgeschäft geltende Konzessionssystem war der Konzessionär, die westlichen Erdölgesellschaften, berechtigt, die Höhe seiner Investitionen, den Förderort, die Fördermenge sowie die Erschliessung neuer Förderanlagen selbst zu bestimmen, so Aeschlimann (2004, S.10). Dem Emittent der Konzession, dem jeweiligen Förderland, blieben lediglich die Steuern, die auf den Ertrag aus dem Erdölgeschäft anfielen. Aeschlimann erkennt weiter, dass diese Konzessionen vor 1973 fast ausschliesslich in den Händen der führenden sieben Erdölgesellschaften (Seven Sisters) waren. Im Upstream-Bereich trat dieses Konsortium gegenüber den Förderländern als geschlossene Vertragspartei auf und regelte gemeinsam den Eintritt in neue Förderregionen. Parra (2010, S.146) stellt zudem fest, die vollständige Ablösung der Förderländer von den Heimatstaaten der Seven Sisters, USA,
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 3 -
Grossbritannien und die Niederlande, konnte erst erfolgen, als diese die Kontrolle über die hiesigen Wirtschaftszweige wiedergewinnen und wirtschaftliche Entscheidungen vollständig auf das nationale Interesse ausgerichtet werden konnten. Der Souveränitätswechsel im Erdölgeschäft wird für den Ausbruch und Verlauf der ersten Erdölkrise 1973 von grosser Relevanz sein, wie die Autoren im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit noch darlegen werden. Nicht weniger relevant war der Anstieg der globalen Nachfrage nach Erdöl im betreffenden Zeitraum. Zwischen 1970 und 1973 stieg die globale Nachfrage nach Primärenergie um 4.4 Prozent pro Jahr an. Die Kohleproduktion blieb zur gleichen Zeit auf einem konstanten Niveau, auch Erdgas und Atomstrom konnten die steigende Nachfrage nach Energie nicht decken. Folglich hatte das Erdöl den „Gap“ zu schliessen. Da die von den Importländern herbeigesehnten Öllieferungen aus Alaska ausblieben und die Fördermengen in der Nordsee sowie in Mexiko nur wenig zur steigenden Nachfrage beitragen konnten, verblieben einzig die OPEC Staaten, um Angebot und Nachfrage anzugleichen, was deren Verhandlungsmacht signifikant erhöhte (Parra, 2010, S.161). Ein Absenken oder der Ausfall von Erdöllieferungen an die westlichen Industriestaaten hätten erhebliche negative Auswirkungen für die Importländer gehabt, so Parra (S.148). Die bereits seit den 1960er Jahren stetig wachsende Nachfrage nach Erdöl brachte eine unvergleichliche Investitionswelle in die Erdölindustrie mit sich. Seit den 1960er Jahren bis 1981 stiegen die jährlichen Investitionen jährlich um bis zu 20 Prozent. Die hohen Investitionsraten spiegeln eindeutig die fehlenden Alternativen an Energieressourcen der damaligen Zeit wieder, die die steigende Nachfrage hätten decken können, schreibt Parra (S.149). Die steigende globale Nachfrage nach Erdöl war mitunter wesentlich durch den steigenden Konsum von Erdölprodukten in den USA beeinflusst. Mit Erreichen des Fördermaximums „Peak Oil“ der USA 1970 bei einer Förderrate von 9,4 Millionen Fass pro Tag gewannen die Erdöllieferungen aus dem Nahen Osten zusätzlich an Bedeutung, so Ganser (2013, S.179). Seit Beginn der industriellen Erdölförderung im Jahre 1859 wandelte sich die USA vom grössten Erdölexporteur zum grössten Erdölimporteur der Welt, führt Ganser weiter aus. Während die Deckung des inländischen Nachfrageüberschusses nach Erdöl ab 1950 (die USA wird 1950 zum Netto-Erdölimporteur) durch Importe zu Beginn noch unproblematisch waren, weil Erdöl aus dem Nahen Osten billig verfügbar war, führte die immer grösser werdende Schere zischen Erdölangebot und -nachfrage die USA immer mehr in eine Importabhängigkeit (S.177). Inwiefern die USA diesem Missstand mit geldpolitischen Mitteln entgegenwirkte, erfährt in Kapitel 3 „Ursachen der Krise“ detaillierte Erläuterung.
- Politisch -
Alle diese Begebenheiten ereigneten sich in einer Zeit, in der in der arabischen Welt Unzufriedenheit und in den USA eine innerstaatliche Krise vorherrschten. Die Relevanz des Erdöls aus politischer Perspektive wird ersichtlich, wenn man beachtet, dass die „Erdölwaffe“ tatsächlich bereits vor 1973 als politisches Druckmittel der Förderländer gegen die westlichen Industriestaaten eingesetzt, erstmalig 1956 durch Gamal Abdel Nasser, 1954 bis 1970 Staatspräsident Ägyptens. Im Mai 1967 erzwang Nasser den Abzug der seit 1956 am Golf von Akaba stationierten UN-Friedenstruppen durch eine Blockade des Suezkanals und damit der Verhinderung der Durchfahrt von Erdöltankern durch den Suezkanal ins Mittelmeer. Elf Jahre später, beschliessen die arabischen
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 4 -
Erdölförderländer am 1. Juni 1967 ein vorübergehendes Lieferembargo gegen Israel und später auch gegen die israelnahen Länder USA und Grossbritannien, der zweite Einsatz der „Erdölwaffe“ nach 1956 (Hohensee, 1996, S.27). 1973 war politisch stark geprägt durch den wiederaufkeimenden Konflikt zwischen Saudi Arabien und Israel (Parra, 2010, S.153). Es war also sehr unwahrscheinlich, dass das Öl nicht bald wieder zum Politikum werden würde, so Parra (S.162). Die westlichen Industrieländer verhielten sich gegenüber der Erdölindustrie und im Spezifischen gegenüber den Exportländern bis 1970 mehrheitlich passiv. Auch als sich die Organisation erdölexportierender Länder OPEC mehr und mehr zu einem einflussreichen Verbund entwickelte, blieb eine wirkungsvolle Reaktion der Importländer weitestgehend aus (Parra, 2010, S.166-167). William J. Casey, damaliger Staatssekretärs für Wirtschaftsangelegenheiten im Weissen Haus und späterer Direktor der CIA, äusserte sich zu den Politstrategien der Erdöl exportierenden Ländern folgendermassen: „[They] have moreover shown a considerable degree of solidarity in pursuing their joint goals of achieving ever-increasing revenues from their oil production [...] It is clear that we must design measures of international cooperation [...] which will bring about and sustain the willingness of the oil producing countries to produce the oil the consumers will require [...]“ (Parra, 2010, S.169). Doch die Rufe nach einer Vereinigung der Importländer verhallten bald ohne grössere Auswirkungen (S.167). Die westlichen Industriestaaten unternahmen bisweilen keine Anstrengungen, das OPEC Kartell zu bekämpfen oder sich vertieft mit der Suche nach alternativen Energiequellen auseinander zu setzen (S.174). Aus politischer Sicht ausserdem bedeutsam ist aus Sicht der Autoren die Aufhebung der Golddeckung des US-Dollars 1971 und die damit verbundenen Intentionen politischer Entscheidungsträger. Um den Effekt des Dollar-Zerfalls auf die Erdölindustrie zu verstehen, ist es unerlässlich zu wissen, dass Förderländer wie Saudi-Arabien oder der Iran von Importländern wie den USA, Deutschland oder Japan stets in US Dollar bezahlt wurden. Seit der Konferenz von Bretton Woods 1944 war der US-Dollar zu einem festen Wechselkurs von 35 Dollar pro Unze durch Gold gedeckt und diente weltweit als Leitwährung für alle relevanten Währungen. Der US Dollar erfreute sich in den 1960er Jahren daher grossem Vertrauen von allen Akteuren (Ganser, 2013, S.174). Mitunter auf Grund der hohen Ausgaben der USA ab 1964 im Vietnamkrieg sowie das steigenden Ausgaben für Erdölimporte, begann die amerikanische Zentralbank Federal Reserve (FED) die steigenden Ausgaben durch den Druck von zusätzlichen Dollars zu finanzieren. Die Goldreserven der USA reichten jedoch in der Folge nicht mehr aus, um die zusätzlich in Umlauf gebrachten Dollars zu decken, so Ganser (S.175). Schliesslich hob Präsident Nixon am 15. August 1971 auf Rat von Henry Kissinger, damaliger US Sicherheitsberater, George Schulz, damaliger Haushaltsberater und späterer Finanz- und Aussenminister der USA und Jack Bennett, dem späteren Vorstandsvorsitzenden des Erdölkonzerns Exxon, die Golddeckung des US Dollars auf und schaffte die Konvertibilität des Dollars in Gold mit sofortiger Wirkung ab - mit schwerwiegenden Folgen für den Ausbruch und Verlauf der ersten Erdölkrise 1973 (S.175). Auf diesen Sachverhalt werden wir in Kapitel 3 „Ursachen der Krise“ der vorliegenden Arbeit noch einmal zu sprechen kommen.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 5 -
- Gesellschaftlich -
Zu den relevanten Zeitumständen zählt Ganser (2014) auch den in der Nachkriegszeit vorherrschenden Erdölrausch. Er ist der Ansicht, der starke Anstieg des Erdölverbrauchs in den Industriestaaten nach 1945 habe das Leben in der westlichen Welt grundlegend verändert. In den 50er, 60er bis in die 70er Jahre war Erdöl in der westlichen Welt zu tiefen Preisen war. „Heute sind wir hochgradig süchtig und kommen nicht mehr so schnell vom Stoff [Erdöl, A.d.V.] weg“. Ebenso gesellschaftlich relevant war die zuvor beschriebene Aufhebung der Golddeckung des US-Dollars. Diese führte nach Ganser (2013, S.175) zu einem signifikanten Vertrauensverlust vieler Nationalbanken aber auch der privaten Haushalte in die Geldpolitik der FED und die Werthaltigkeit des US Dollars. Die Kritiker sollten recht behalten, denn als Frankreich 1969 seine Dollar-Reserven zum Wechselkurs von 35 Dollar pro Unze gegen Gold einlösen wollte, waren die USA nicht mehr in der Lage, dieser Forderung nachzukommen. Die Auslandschulden der USA waren 1971 effektiv nur noch zu einem Viertel durch Gold gedeckt. „Die Dollarkrise brachte die USA in grösste Verlegenheit“, so Ganser (2013, S.175). Letztlich bot die Intransparenz im globalen Erdölmarkt sowie Unverständnis der globalen Prozesse und Strukturen in der breiten Öffentlichkeit einen optimalen „Nährboden“ für die Hysterie der Konsumenten in den Importländern bezüglich Versorgungsknappheit, wie sie während der Krise 1973 zu beobachten war. „Wie viel Erdöl während der Krise wo auf welche Tanker gepumpt wurden wurde [...], wussten nur die Erdölgesellschaften“, so Ganser (2013, S.194). Auch der damalige Bundesrat Ernst Brugger äusserte sich zur fehlenden Transparenz im Erdölgeschäft: „Das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. [...] Da und dort komme ich auch nicht draus“, und fügte weiter an „Viel mächtigere Regierungen als wir kommen auch nicht draus, nicht einmal die Amerikaner“ (Ganser, 2013, S.196). Diese Aussagen Bruggers zeigen die schiere Unmöglichkeit, die Preisbildung und die Wettbewerbsverhältnisse im globalen Erdölmarkt zu durchleuchten.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 6 -
2 Ausbruch und Verlauf der Krise
- Der Ausbruch -
Der Ausbruch einer Erdölkrise war nach dem zuvor erläuterten Souveränitätswechsel und dem wiederaufkeimenden Konflikt zwischen Israel und den arabischen Staaten wenig überraschend. Was bisher für einen Ausbruch fehlte, war ein relevantes Ereignis, das den Stein ins Rollen brachte. Dieses Ereignis war mit Ausbruch des Jom-Kippur Kriegs schliesslich geschaffen. Denn, so Hohensee (1996, S.66), nun war die Gelegenheit gegeben, die im letzten Kapitel dargelegte Ölwaffe einzusetzen. Die Angriffsstaaten Ägypten und Syrien verfolgten mit dem Überraschungs-Angriff auf Israel primär das Ziel, die im Sechs-Tagekrieg 1967 an Israel verlorenen Gebiete zurückzuerobern (Ganser, 2013, S.180). Der überraschende Angriff von Syrien und Ägypten auf Israel am 6. Oktober 1973 führte bei vielen Israelis zu einer bis heute andauernden Angst von den Nachbarstaaten plötzlich überrollt zu werden und trägt mit dazu bei, dass der Nahe Osten zwar „zeitweise zu einer angespannten Ruhe, aber nie zu einem entspannten Frieden“, finden konnte, so Ganser. Inwiefern kann der vierte arabische Konflikt im Rahmen des Nahostkonflikts nun als Auslöser für die erste Erdölkrise 1973 gesehen werden? Wie zuvor erläutert, verlor der US-Dollar gegenüber dem Gold, dessen Mengen im gleichen Zeitraum nicht im selben Ausmass wie die Dollarmenge gesteigert werden konnte, ab 1971 stark an Wert (S.176). Bereits ab 1972 wurden seitens der OPEC Verhandlungen mit den Erdölgesellschaften aufgenommen, um die im Teheran Agreement festgelegten Richtpreise anzupassen (Parra, 2010, S.157). Die Drohung der OPEC Staaten war klar: „In case such negotiations fail to achieve their purpose, an extraordinary meeting of the Conference shall be called to determine such concerted action as necessary [...]”, so Parra. Bereits am 20. Januar 1972 mussten die Erdölgesellschaften eine Preiserhöhung um rund 8.5% hinnehmen (Abkommen „Geneva I“). Doch die neu entwickelte Preisformel war nicht von langer Dauer. Als der US-Dollar Anfangs 1973 abermals eine starke Abwertung erfuhr, standen die Förderländer der OPEC erst im Frühjahr 1973 (Abkommen „Geneva“ II) und erneut im Oktober 1973 in Verhandlungen mit den westlichen Erdölfirmen (S.160). In den Neuverhandlungen des Teheran-Tripolis Agreements zielten die Förderländer der OPEC einerseits darauf ab, die Dollarabwertung auszugleichen und andererseits stärker am Preisanstieg des Erdöls partizipieren zu können (S.177). Definiertes Ziel der OPEC-Vertreter war es, eine am Erdölpreis indexierte Steuerabgabe mit den Erdölgesellschaften zu vereinbaren, so dass für die Erdölfirmen eine fixe Gewinnmarge von rund 0.40 US-Dollar pro Barrel übrig bliebe. Diese Verhandlungen mussten am 14. Oktober 1973 auf Grund des Kriegsausbruchs zwischen Israel und den Angriffsstaaten Ägypten und Syrien jedoch unterbrochen werden (Ganser, 2013, S.182). Zwei Tage später wurde in Kuweit eine OPEC-Sonderkonferenz geführt. Bei diesem historischen Treffen beschlossen die OPEC Länder am 16. Oktober 1973 unilateral den Richtpreis für Erdöl um mehr als 100 Prozent auf 5,119 Dollar pro Barrel anzuheben. Dieser Akt kann als Beginn der ersten Erdölkrise 1973 bezeichnet werden.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 7 -
- Der Verlauf -
Obwohl der Preisanstieg für die Importländer von grosser Bedeutung war (1973 machten die Erdölimporte der USA fast einen Drittel des nationalen Erdölkonsums aus), konnten die westlichen Erdölgesellschaften dem Preisanstieg wenig entgegensetzen (Parra, 2010, S.169). Bereits am 17. Oktober 1973, ein Tag nach Bekanntgabe der Preiserhöhung, beschloss die Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC) zudem eine Kürzung der Erdölfördermenge im Vergleich zum Vormonat um 5% (Ganser, 2013, S.183). Die OAPEC drohte, die Fördermenge um weitere 5% pro Monat zu senken, sollte sich Israel nicht aus den 1967 besetzten Gebieten zurückziehen. Zusätzlich einigte sich die OAPEC auf ein Lieferembargo gegen die Israel-nahen Staaten USA und Niederlande sowie gegen weitere Industrienationen. Die Unterstützung Israels durch die USA im Sechstagekrieg konnte in der arabischen Welt nicht in Vergessenheit geraten, schreibt Parra (2010, S.162). Öl war das offensichtliche und einzige Druckmittel, das dem Zweck dienlich werden konnte, die Unterstützung der USA seitens Israel zu unterbinden. Bereits in den Verhandlungen vor Oktober 1973 kamen die Vertreter der OPEC zu Erkenntnis: „Security of supply mattered to the customers; price didn’t [...]“. Das Überraschungselement in den Angriffshandlungen Ägyptens und Syriens 1973 führte zwar kurzfristig dazu, dass Teile der von Israel besetzten Gebiete zurückerobert wurde. In der Folge erlangte Israel jedoch wieder die Überhand, sodass sich an der Gebiets-Verteilung über den gesamten Kriegsverlauf hinweg betrachtet wenig änderte (Ganser, 2013, S. 182). Schliesslich wurde am 24. Oktober ein Waffenstillstandsabkommen und am 11. November 1973 ein Truppenentflechtungsabkommen unterzeichnet, was die Lage in der Folge deutlich entspannte (Hohensee, 1996, S. 70-71). Die OAPEC konnte ihre Forderung nach einem Rückzug Israels unter Androhung der Förderkürzung nicht durchsetzen (Ganser, 2013, S.183). Die zuvor beschriebene Drohung entfaltete eine unglaubliche psychologische Wirkung unter der westlichen Bevölkerung und führte fälschlicherweise zur weitverbreiteten Meinung, die Importe von Erdöl seien zum Erliegen gekommen. So vermeldeten beispielsweise die Basler Nachrichten: „In allen westlichen Industrieländern werden Benzin und Heizöl knapp“. Die Wut der Bevölkerung richtete sich primär an die arabischen Exportländer, so Ganser. Nur zwei Monate nach der ersten signifikanten Preiserhöhung, einigten sich die Förderländer der OPEC nach intensiven Diskussionen auf eine erneute Anpassung des Ölpreises auf 11.65 Dollar pro Barrel (S. 184). Die Preissteigerung auf 11.65 US-Dollar pro Barrel bedeute einen Preisanstieg von mehr als 600% innerhalb von weniger als drei Monaten (Abbildung 2). Dabei gab es auch unter den Vertretern der OPEC Stimmen, die von einer noch stärkeren Preissteigerung abrieten. Der damalige saudische Erdölminister Yamani warte davor, dass ein übermässiger Anstieg der Erdölpreise die Industriestaaten in eine wirtschaftliche Krise treiben würde und erkannte darin eine grosse Gefahr für die eigene Wirtschaft. Dies hinderte die OPEC daran, den Erdölpreis noch weiter (auf teilweise geforderte 23 Dollar pro Barrel) anzuheben. Als Reaktion auf die Ereignisse im Nahen Osten und den Irrglauben, die OPEC Länder hätten die gesamte Erdölförderung eingestellt, wurden in den Importländern verschiedene politische Massnahmen eingeleitet. Diese werden in Kapitel 4 „Folgen der Krise“ detailliert erläutert. Auf eine spezifische Massnahme soll jedoch hier bereits kurz eingegangen werden.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 8 -
Abbildung 2: Entwicklung des Erdölpreises ab 1970 (Quelle: ZEIT, 2004)
Mit Hilfe autofreier Sonntage sollte Energie gespart und damit Erdölverbrauch reduziert werden. Wie Ganser (2013, S.186) schreibt, führten die vom OAPEC-Embargo betroffenen Niederlanden als erste autofreie Sonntage ein. Zudem wurden Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Autobahnen beschlossen, den Verbrauch noch weiter zu verringern. Für die Konsumenten waren die publizierten Meldungen in diesen Tagen verwirrend. Viele schlossen daraus, das Erdölangebot sei knapp, denn weshalb sollte es sonst zu einem Preisanstieg kommen (S.190)? Dies entsprach jedoch in keiner Weise der Realität, zumal die OPEC ihre Fördermenge wie oben dargelegt lediglich um fünf Prozent drosselte, also lediglich um 0,9 Mio. Barrel pro Tag (bei einem globalen Erdölverbrauch von 50 Millionen Barrel pro Tag) (S.185). Wie Ganser darlegt, kam es während der Krise zu keiner Zeit zu einem Rückgang der niederländischen Erdöllager (S.186). Nach den Niederlanden beschloss Mitte Dezember auch Deutschland (gefolgt von weiteren europäischen Ländern) autofreie Sonntage. In den USA löste die Erdölkrise in der Bevölkerung starke Spannungen und Unsicherheit aus (S.188). Durch den Anstieg der Benzinpreise um 40%, entstand eine Versorgungspanik unter der Bevölkerung, was zu Hamsterkäufen an Tankstellen führte. Yankelovich, damaliger Berater des Präsidenten Nixon beschrieb die Situation wie folgt: „Eine Verkettung von Umständen hat eine labile öffentliche Stimmung geformt, die aus Fehlinformationen, Misstrauen, Verwirrung und Angst zusammengesetzt ist“, so Ganser (2013, S.188). Da sich sowohl die Niederlanden als auch die USA auch über Nicht-OPEC-Produzenten versorgten kam es indes in beiden Ländern nie zu einem vollständigen Ausfall der Importe (S.185). Zum Jahresbeginn 1974 sollte sich die Lage allmählich zu beruhigen (S.193). Nur noch wenige europäische Länder hielten das Sonntagsfahrverbot aufrecht. Die Rohölfördermengen der OPEC-Länder wurden kontinuierlich wieder erhöht. Obwohl der Erdölpreis weiter anstieg, galt die Krise in vielen Ländern als überwunden. Schliesslich wurde am 17. März 1974 das OAPEC-Embargo gegen die USA und am 10. Juni 1974 jenes gegen die Niederlande aufgehoben.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 9 -
3 Ursachen der Krise Nachdem im vorhergehenden Kapitel Ausbruch und Verlauf der ersten Erdölkrise 1973 detailliert dargelegt wurden, soll in nachfolgenden Kapitel darauf eingegangen werden, welche Ursachen die benannte Krise herbeigeführt haben. Die vielfältigen Ursachen werden dabei in drei Betrachtungsebenen gegliedert: Makro-, Meso- und Mikroebene. Dabei setzt sich die Makro-Ebene spezifisch mit den Gegebenheiten auf Regierungsebene auseinander, während die Meso-Ebene auf die Eigenarten und Besonderheiten der relevanten Organisationen (Erdölgesellschaften, FED, OPEC, OAPEC etc.) fokussiert. Die Mikro-Ebene befasst sich schliesslich mit Ursachen auf der individuellen und gesellschaftlichen Stufe. Tabelle 1: Übersicht über die Ursachen der Erdölkrise 1973 (Quelle: Eigene Darstellung) Ebene Ursache für Erdölkrise 1973
Makro (Regierungen, Staaten)
§ Starke Abhängigkeit der Industrienationen von Erdöl. Die Förderung alternativer Energieträger fällt zu gering aus, da Erdöl billig verfügbar ist.
§ Fehlendes Mitspracherecht der Förderländer bezüglich der Erdölförderung. Bedürfnis der Förderländer, wirtschaftliche Entscheidungen vollständig auf das nationale Interesse auszurichten.
§ Erreichen des Fördermaximums Peak Oil in den USA bei steigender Nachfrage. Die Importabhängigkeit nimmt dadurch weiter zu.
§ Aufhebung der Golddeckung des US-Dollars 1971 und darauf folgende Dollar-Krise
Meso (Organisationen inkl. OPEC & OAPEC)
§ Gründung der OPEC und der OAPEC zur Verfolgung wirtschaftlicher (und politischer) Interessen
§ Dominanz des Erdölgeschäfts durch westliche Erdölgesellschaften vor 1970
§ Gleichzeitig schwache Verhandlungsmacht der Erdölgesellschaften § Unheilige Allianz zwischen Förderländern und westlichen
Erdölgesellschaften (beide profitieren von steigenden Erdölpreisen) § Expansive Geldpolitik der FED nach Aufhebung der Golddeckung des
US-Dollars 1971 und damit verbundener Wertzerfall des Dollars
Mikro (Individuen, Gesellschaft)
§ Stetiger Anstieg der globale Nachfrage nach Erdöl ab 1945 (Erdölrausch)
§ Intransparenz im globalen Erdölmarkt sowie Unkenntnis der globalen Prozesse und Strukturen
§ Angst vor Versorgungsengpässen § Reaktionen auf Gründung der OPEC & OAPEC bleiben weitgehend aus § Starker Einfluss von Lobbyisten auf politische Entscheidungsprozesse
(bspw. Jack Bennett, ehemaliger Vorstandsvorsitzenden des Erdölkonzerns Exxon und Mitglied der Bilderberger Gruppe auf den Entscheid, die Golddeckung des US-Dollars aufzuheben)
Auf ausgewählte Ursachen soll im Folgenden nun detaillierter eingegangen werden. Die Autoren erheben dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern fokussieren auf Ursachen, die in der Literatur als besonders bedeutsam betrachtet werden.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 10 -
3.1 Makro-‐Ebene Zu den Ursachen auf Makro-Ebene sind nach Ansicht der Autoren die fehlenden Mitbestimmungsrechte der Förderländer bezüglich der Ausgestaltung der Erdölförderung auf eigenem Territorium bis Ende der 1960er Jahren zu zählen. Nach Parra (2010, S.146) waren die Förderländer des Nahen Ostens und Nordafrika noch bis 1971 stark beeinflusst durch die Grossbritannien, USA und die Niederland. Damit war ein latentes Bedürfnis nach mehr Mitspracherecht der Förderländer gegeben. In der Folge kam es zwischen 1970 und 1973 eine Welle an Verstaatlichungen der internationalen Erdölgesellschaften, was Hohensee (1996, S.40) als „eine Vernichtung auf Raten“ der internationalen Erdölgesellschaften bezeichnete. Auf den Einfluss der OPEC und die einzelnen Schritte des Souveränitätswechsels wird in Kapitel 3.2 „Meso-Ebene“ detaillierter eingegangen. Nach Ganser (2013, S.180) sind die Wurzeln der Erdölkrise 1973 allem voran im Erreichen des Fördermaximums Peak Oil in den USA 1970, in der Aufhebung der Golddeckung des US-Dollars 1971 und der darauf folgenden Dollarkrise zu suchen. Die Recherche hat gezeigt, dass diese Ereignisse eng miteinander verknüpft sind. Wie einleitend beschrieben, sahen sich die USA um 1970 mit steigenden Haushaltsausgaben konfrontiert. Einerseits begründet durch den Rückgang der inländischen Fördermenge von Rohöl bei gleichzeitig steigender Nachfrage, was die Importabhängigkeit der USA weiter anhob und andererseits durch die hohen Ausgaben im Vietnamkrieg. Die in Kapitel 1.3 „Darlegung der für die Krise relevanten Zeitumstände“ bereits erläuterte Aufhebung der Golddeckung des US-Dollars und damit das Ende von Bretton-Woods, führte nach Ganser (S.175) zu einem signifikanten Vertrauensverlust vieler Nationalbanken in die Geldpolitik der FED und die Werthaltigkeit des US Dollars. Diese Nationalbanken sollten recht behalten, denn als Frankreich 1969 seine Dollar Reserven zum Wechselkurs von 35 Dollar pro Unze gegen Gold einlösen wollte, waren die USA nicht mehr in der Lage, dieser Forderung nachzukommen, so Ganser. Die Auslandschulden der USA waren 1971 effektiv nur noch zu einem Viertel durch Gold gedeckt. „Die Dollarkrise brachte die USA in grösste Verlegenheit“, (S.175). Ohne die Beschränkung der Dollarmenge durch die Goldreserven hatte die amerikanische Zentralbank FED die Möglichkeit, die Dollarmenge nach Belieben auszuweiten und so die steigenden Erdölimporte zu finanzieren, schreibt Ganser (S.176).
3.2 Meso-‐Ebene Wie Hohensee (1996, S.15) schreibt, gibt es zwei Ereignisse im 20 Jahrhundert, die den Preisanstieg von Erdöl und die weit verbreitete Hysterie entscheidend beeinflussten. Er nennt dabei einerseits das Abkommen zwischen der Anglo-Persian Oil Company, der späteren BP, der Royal Dutch Shell und der Rockefeller Gruppe im Jahr 1928 sowie der nachfolgenden Dominanz dieser Gesellschaften im Erdölgeschäft und andererseits die Gründung der Organisation oft he Petroleum Exporting Countries OPEC 1960. Beide Sachverhalte sind nach den Autoren auf Meso-Ebene einzustufen. Die oben genannten Erdölgesellschaften einigten sich auf eine gemeinsame, profitmaximierende, globale Erdölpolitik, die die Verkaufsquoten auf den einzelnen Märkten genau definierte (S.16). Damit wurde der globale Erdölmarkt (inklusive der Preispolitik) fortan durch einige wenige Gesellschaften, den „Seven Sisters“, beherrscht. Erst nach dem zweiten Weltkrieg konnte
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 11 -
die „koloniale“ Vormachtstellung der Erdölkonzerne gegenüber den Förderländern nicht mehr aufrechterhalten werden und es kam zu Neuverhandlungen der Teilung der Erdöleinnahmen, wie Hohensee ausführlich beschreibt (S.17). Doch auch nach der Einigung der Förderländer Venezuela, Irak, Kuweit und Saudi-Arabien, die Beteiligungsquote am Erlös aus Erdöleinnahmen der westlichen Gesellschaften auf 50 Prozent anzuheben, waren es nach wie vor die Erdölgesellschaften, die die Preispolitik im Erdölgeschäft bestimmten. Signifikante Erdölfunde auf der arabischen Halbinsel seit Beginn der 1950er Jahre sowie der Wirtschaftskrieg, auf den sich die Sowjetunion mit den USA im kalten Krieg einliess, veranlassten die westlichen Erdölgesellschaften dazu, den Richtpreis für Erdöl, auch „Posted Price“ genannt, zwischen 1958 und 1960 wiederholt zu senken, was auf Grund der zuvor erläuterten Teilungsregel zu erheblichen Einnahmerückgängen der Förderländer führte (S.17). Wie Hohensee erläutert, erkannten die Erdölförderländer, dass sie gegen die seit 50 Jahren bestimmenden Erdölgesellschaften nur mit vereinten Kräften wirksame Verhandlungserfolge erzielen konnten. In der Folge kam es an der Konferenz von Bagdad (10. Bis 14. September 1960) zur Gründung der Organisation oft he Petroleum Exporting Countries OPEC mit den Gründungsländern Iran, Irak, Saudi-Arabien, Kuweit und Venezuela und der Motivation, eine „Abwehrorganisation gegen die Preispolitik der internationalen Ölgesellschaften“ zu begründen und, wie aus den Statuten der OPEC ersichtlich wird, „Ein stabiles Einkommen für die Erdölförderländer, ein effizientes, wirtschaftliches und regelmässiges Erdölangebot für die Importländer sowie ein solidarisches Verhalten unter den Mitgliedern [...]“, sicherzustellen (S.19-20). Parra (2010, S.147) schreibt dazu, die OPEC Länder hätten durch den in Kapitel 3.1 „Makro-Ebene“ Kontrollwechsel im Erdölgeschäft hin zu den Förderländern Blut geleckt. Dennoch wäre nach Parra eine Anhebung des Ölpreises als Druckmittel gegen die westlichen Staaten wohl wenig wirksam gewesen. In den USA wurde teilweise sogar die Meinung vertreten, dass ein Anstieg der Ölpreise wünschenswert sei, da so die einheimische Erdölförderung wieder wirtschaftlicher würde, so Parra. Die Beziehung zwischen den westlichen Erdölgesellschaften und den Förderländern stellte auch Bestandteil eines Artikels von Amuzegar (1973, S.676) zum Thema Fakten und Fiktionen über die Ölkrise 1973 dar. Er beschrieb diese damals als eine „[...] unheilige Allianz zwischen den grossen Ölgesellschaften und der Organisation der Erdöl exportierenden Länder (OPEC) auf Kosten des Verbrauchers.“ Somit war für die OPEC Länder schnell klar dass nur eine Beschränkung der Fördermenge als wirksames Druckmittel gegen die westlichen Länder eingesetzt werden konnte (Parra, 2010, S.147). Um die Triebfedern zur Gründung der OAPEC 1968 zu verstehen, wird nachfolgend kurz auf den israelisch-arabischen Konflikt und den Einsatz der Ölwaffe 1967 eingegangen. Im Mai 1967 erzwang Nasser, damaliger ägyptischer Staatspräsident, den Abzug der seit 1956 am Golf von Akaba stationierten UN-Friedenstruppen und änderte somit den seit dem letzten Krieg geltenden Status quo (Hohensee, 1996, S.27). Wie Hohensee ausführt, fasste dies Israel als Angriffshandlung Nassers auf und besetzte im Juni 1967 Westjordanland, die Sinai-Halbinsel bis zum Suezkanal sowie die Golanhöhen. Die Besetzung der arabischen Gebiete durch Israel gab nun Anlass für eine ausserordentliche Konferenz der arabischen Erdölförderländer am 1. Juni 1967, an der ein vorübergehendes Lieferembargo gegen Israel und später auch gegen die israelnahen Länder USA und Grossbritannien beschlossen wurde. Ausserdem war durch die Israel-Offensive auch der Grundstein für den Gegenangriff der arabischen Staaten auf die von Israel besetzen Gebiete 1973 gelegt, der die Unterbrechung der Preisverhandlungen zwischen den Förderländern und den
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 12 -
Erdölgesellschaften zur Folge hatte, wie zuvor erläutert wurde (S.27). Doch nachdem die westlichen Staaten 1967 vom nahöstlichen Erdöl noch weitaus weniger abhängig waren als 1973, verblieb der Einsatz der „Ölwaffe“, auch durch Uneinigkeit der Förderländer bezüglich dem Einsatz der Ölwaffe, weitestgehend wirkungslos und fügte den Fördernationen selbst weitaus mehr Schaden zu als den westlichen Industriestaaten (S.27). Auf Seiten einiger Förderländer fand daraufhin ein Umdenken statt. Man erkannte, dass nur durch Einigkeit und Entschlossenheit ein wirkungsvoller Einsatz der Ölwaffe möglich sei. In der Folge gründeten die Förderländer Saudi-Arabien, Kuweit und Libyen die Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries OAPEC, die nun im Gegensatz zur OPEC „nicht nur um die Vertretung ökonomischer, sondern mindestens genauso sehr politischer Interessen“ bestrebt ist, so Hohensee (1996, S.35). Damit war neben der OPEC ein zweiter Machtfaktor im Ringen um die Souveränität mit den Erdölgesellschaften geschaffen. Zu einer erneuten realen Gefährdung der Erdöl-Einnahmen für die Förderländer nach den Preisherabsetzungen durch die Erdölgesellschaften um 1960 kam es nach der Auflösung von Bretton-Woods 1971. Die Aufhebung der Golddeckung des US Dollars, in der Wirtschaftsgeschichte auch als „Nixon-Schock“ bezeichnet, war von grosser Bedeutung für alle Akteure und insbesondere für die Erdölexporteure, die durch den realen Wertzerfall des Dollars ihre Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl dahinschwinden sahen, so Ganser (2013, S.176). „Die US-Notenbank FED produziert, wenn nötig, Dollarscheine wie die Firma Hakle Klopapier“, kritisierte der Schweizer Finanzexperte Professor Walter Wittmann der Universität Freiburg (Ganser, 2013, S.176). Der internationale Erdölhandel bestand im Kern nun nicht mehr im Austausch von Erdöl gegen Gold sondern im Austausch von Erdöl gegen Papier. In Anbetracht des Dollarzerfalls ab 1971 setzten die OPEC Länder Neuverhandlungen mit den westlichen Erdölfirmen um eine neue Preisformel an. Nach ausbleibender Einigung der Verhandlungspartner warnte der damalige Generalsekretär der OPEC, Abderrahman Khene, im Oktober 1973, dass die OPEC die Dollarabwertung nicht einfach hinnehmen werde und die Industrienationen „mit offenen Augen in die Öl-Katastrophe“, hineinlaufen werden (Ganser, 2013, S.179).
3.3 Mikro-‐Ebene Gesellschaftlich ist, wie Parra (2010, S.153) schreibt, insbesondere die Angst vor Versorgungsknappheit in der Bevölkerung der Importländer als Ursache für die Erdölkrise 1973 zu betrachten. Die Angst vor Erdölknappheit auf Grund gedrosselter Fördermengen war zu diesem Zeitpunkt weit verbreitet. Die Erdölförderung wurde immer mehr als politisches Druckmittel verwendet, so Parra. Die Nachfrager bezogen folglich jegliches vorhandene Erdölangebot, versuchten sich mit Hilfe langfristiger Verträge abzusichern und trieben damit die Preise in die Höhe. Die Tatsache, dass die Importländer viel eher die Versorgungssicherheit sicherstellen wollten und der Entwicklung der Erdölpreise eine sekundäre Bedeutung beigemessen wurde, sieht Para (2010, S.167), denn auch als Ursache dafür, dass Reaktionen auf den einsetzenden Preisanstieg lange Zeit verhalten ausfielen. „The unpleasant day may come when Arab states can double oil prices and get away with it.“, schrieb der Amerikanische Aussendienstmitarbeitende Richard Funkhouser bereits 1953 in einem internen Memorandum (Parra, 2010, S.175). Wie einleitend dargelegt, blieben solche Aufrufe jedoch ohne grössere Wirkung. Zu diesem Zeitpunkt konnte auch noch niemand ahnen, welches Ausmass der Preisanstieg von Erdöl nach Ausbruch der Krise noch annehmen würde.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 13 -
4 Folgen der Krise
4.1 Gesellschaftliche Folgen Wie in Kapitel 2 „Ausbruch und Verlauf der Krise“ eingeleitet, waren die gesellschaftlichen Folgen der ersten Erdölkrise 1973 weitreichend und basierten viel eher auf falschen Annahmen als realen Gegebenheiten. In breiten teilen der Gesellschaft verbreitete sich die Angst, auf Grund der Embargos und des steigenden Erdölpreises einen Teil ihrer Freiheit - die uneingeschränkte Nutzung von Energie - abgeben zu müssen. Folglich wurden die beschlossenen politischen Massnahmen zur Reduktion des Erdölverbrauchs zwar wiederwillig aber trotzdem erfolgreich hingenommen. Die Bemühungen um Energiesparmassnahmen und die Ökonomisierung des gesamten Energiehaushalts verbreitete sich und führte zu einem, zumindest vorübergehenden, gesellschaftlichen Wandel in ganz Europa (Hohensee, 1996, S. 229). So haben sich beispielsweise Architektur sowie Autodesign und -konstruktion nach der Krise markant verändert. Der Fokus wurde darauf gelegt möglichst effiziente und energiearme Immobilien zu fördern und Fahrzeuge mit tiefem Benzinverbrauch zu entwickeln. In den USA kam es, wenn auch nur kurzfristig, zu einem Umdenken in der Energieerzeugung. So wurden auf dem Dach des weissen Hauses kurzzeitig Solarzellen zur Stromgewinnung installiert. Langfristig hat sich dieser Sinneswandel jedoch nur begrenzt aufrecht erhalten, ein Lerneffekt blieb weitestgehend aus. Wie der heutige Energiemix der Schweiz in Abbildung 3 zeigt, ist die Abhängigkeit vom Erdöl nach wie vor hoch.
Diese Ansicht teilt auch Ganser (2014), wenn er in Bezug auf den Erdölverbrauch sagt: „Wir sind als Menschen nicht sehr vorausschauend.“ Wenn Erdöl verfügbar sei, fördern wir dieses, verbrennen es und kümmern uns nicht wesentlich darum, was für die nächste Generation bleibe, so Ganser. Dies ist aus Sicht der Autoren mitunter dadurch zu begründen, dass der breiten Gesellschaft die Folgen immer knapper werdenden Ressourcen noch nicht explizit vor Augen geführt werden und so der
Abbildung 3: Endenergieverbrauch der Schweiz nach Energieträgern (Quelle: SIPER, 2011; Datenquelle BFE, 2009)
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 14 -
Irrglaube entsteht, es sei noch genügend Erdöl für die kommenden Jahrzehnte vorhanden. So führte die Ausbeutung der Erdölreserven ihren Siegeszug auf Kosten einer nachhaltigen Energienutzung weiter fort. Verbrauchsseitig ist eine weitere Folge der Erdölkrise 1973 im Mobilitätsverhalten der Individuen zu beobachten. Vielerorts war ein Revival des Fahrrads zu beobachten. Der Umstieg vom Automobil auf das Fahrrad wurde mit Bundespreisen ausgezeichnet. Auch die Nahverkehrsverbunde verzeichneten nach der Krise eine erhöhte Nachfrage. Für längere Strecken jedoch, ist der individuelle Automobilverkehr klar präferiert geblieben. Wie Hohensee (1996, S. 231-231) schreibt, verzichteten auf Grund der hohen Benzinkosten viele gänzlich auf einen Ausflug, anstatt auf alternative Transportmittel umzusteigen. Neben den weitestgehend positiven Auswirkungen der Krise auf das Bewusstsein der Individuen in Bezug auf Energieerzeugung und -verbrauch, förderte die Krise teilweise bis heute bestehende Vorurteile und Ängste. So ist, nach Ansicht der Autoren, nach wie vor ein starkes Misstrauen der Gesellschaft gegenüber den Erdölkonzernen und den arabischen Förderländern gegenüber erkennbar. Dies zeigt beispielsweise ein Zitat des Nationalrats Oehler: „Mir scheint, dass wir in der jetzigen Zeit einer doppelten Erpressung unterliegen [...] Die integrierten Erdölkonzerne sind der Erpressung der arabischen Scheichtümer gleichzusetzten [...]“ (Ganser 2013, S.195). Die Erdölkrise 1973 hat das Bild der arabischen Golfstaaten als nicht-vertrauenswürdig und hinterrücks stark geprägt, so Ganser.
4.2 Wirtschaftliche Folgen
- Kurz- und mittelfristige Folgen -
Schon während der Krise haben sich die kurz- und mittelfristigen wirtschaftlichen Folgen des Ölpreisschocks bemerkbar gemacht. Die Wirtschaft reagierte in einzelnen Ländern sehr sensibel auf die Unsicherheit der Preissteigerung von erdölabhängigen Gütern. Dies führte bei vielen Unternehmen zur Förderung einer Sparkultur (Ganser, 2013, S.199-200). Gesamtwirtschaftlich gesehen führten der Spardruck der privaten Haushalte wie auch der Unternehmen zu teilweise starken Veränderungen. Zum einen verzeichnete die Realwirtschaft einen signifikanten Rückgang der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen. So wurde beispielweise in der Deutschen Automobilindustrie ein Produktionsrückgang von 20% verzeichnet, was einen Anstieg der Arbeitslosenrate zur Folge hatte, da insbesondere in Deutschland ein starker Fokus auf der Maschinenbau- und Fahrzeugindustrie lag (Hohensee, 1996, S. 218). Um Arbeitsplätze für Inländer zu schützen kam es in der Folge zu einem Anwerbestopp für ausländische Arbeitnehmer. Dies führte zwar zu einem Rückgang der Gastarbeiter, konnte aber den Anstieg von rund 250'000 Arbeitssuchenden im Jahre 1969 auf über 1.1 Millionen im Jahr 1975 nicht markant beeinflussen. Zum anderen war ein markanter Rückgang der Nachfrage im Tourismus zu verzeichnen, was Hohensee (1996, S.223) als eine logische Folge der Rezession beschreibt, die durch die Ölkrise ausgelöst wurde (Hohensee, 1996, S. 223). Dazu soll im Abschnitt „Langfristige Folgen“ noch detaillierter eingegangen werden. Doch wie wirkte sich die erste Erdölkrise 1973 aus wirtschaftlicher Sicht auf die Förderländer aus? Die OPEC-Staaten profitierten unmittelbar vom Preisanstieg des Erdöls. Obwohl der US-Dollar im
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 15 -
Zeitverlauf an Wert verlor, stiegen die Realeinnahmen der Förderländer für die gleiche Menge Öl innerhalb kurzer Zeit um mehr als das vierfache. Der Einnahmenwegfall auf Grund der zwischenzeitlichen Drosselung der Fördermengen war bei einem Preisanstieg in diesem Ausmass vernachlässigbar. Einige der Ölförderländer begannen daraufhin Devisen in westliche Industrienationen zurückzuführen, um möglichst viele US-Dollars in andere Vermögenswerte zu tauschen (Firmenanteile, Immobilien, Kunst etc.) (Hohensee, 1996, S. 224).
- Langfristige Folgen -
In der langen Frist sind weitere wirtschaftliche Veränderungen erkennbar. Vielfach war jedoch die erste Erdölkrise 1973 nicht ursächlich für diese Veränderungen, sondern hatte lediglich einen verstärkenden Charakter, sodass in einigen westlichen Nationen bestehende Probleme zusätzlich verschlimmert wurden. Bundesfinanzminister Franz Apel äusserte sich dazu damals wie folgt: „Alles den Ölpreisen zuschieben zu wollen, was wir an Problemen haben, scheint mir etwas zu einfach zu sein“. Wirtschaftlich angeschlagene Staaten (beispielsweise Italien, Grossbritannien und Frankreich) wurden durch hohe Inflationsraten und Energiepreise zusätzlich belastet. Die hohen Inflationsraten betrafen jedoch auch die weiteren europäischen Länder. Nationen wie die Schweiz, Österreich oder die Benelux-Staaten wiesen jedoch auch unter wideren Umstände keine signifikante Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage auf (Hohensee, 1996, S. 224-225). Wie bereits dargelegt, führte die Verstaatlichungswelle vor der ersten Ölkrise 1973 zu einem Kontrollwechsel über die Förderaktivitäten in den Förderländern des Nahen Ostens. Wie Campbell, Liesenborghs, Schindler und Zittel (2008, S.166) schreiben, besitzen die internationalen Erdölgesellschaften heute weniger als zehn Prozent der weltweiten Ölreserven. Nach anfänglich Einnahmesteigerungen kam es in der langen Frist jedoch auch für die OPEC-Staaten zu einer Abschwächung der Wachstumsraten. Dies kann insbesondere auf die westlichen Sparmassnahmen in Bezug auf Erdöl und Erdölprodukte zurückgeführt werden. In der Folge mussten einzelne arabische Förderländer gar eine Verschuldung in Kauf nehmen, was zeigt, dass die kurzfristig verfügbaren finanziellen Mittel nicht nachhaltig genug eingesetzt wurden. Andere Förderländer wiederum sicherten sich durch die gestiegenen Einnahmen den Zugang zu Investitionsgütern und technischem Know-how aus den westlichen Industriestaaten und damit die Quelle für künftiges Wachstum (Hohensee, 1996, 226).
4.3 Politische Folgen In der Politik herrschte, ähnlich wie in der Gesellschaft und Wirtschaft, eine hohe Unsicherheit in den Jahren nach der Krise. Insbesondere die Frage nach der Dauer und dem weiteren Verlauf der Krise war unklar. Kritische Stimmen sprachen gar vom Ende eines Zeitalters und dem Beginn einer neuen politischen Ordnung in der die demokratische Welt von autoritären Regimen abhängig ist. Diverse relevante politische Neuerungen waren die Folge. Die Gründung der IEA (Internationale Energie-Agentur) mit dem Ziel der Diversifizierung und Kontrolle der westlichen Energieversorgung darf wohl als wichtigste politische Massnahme bezeichnet werden. Des Weiteren wurde der EAD (Europäisch-arabischer Dialog) gegründet, welcher die Beziehung zwischen europäischen Verbraucherländern und den arabischen Erdölfördernationen intensivieren sollte. So versuchten sich die europäischen Politiker besser auf die Zukunft vorzubereiten: eine strategische Mischung aus Kooperation mit den
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 16 -
arabischen Nationen und einem Versuch, die Abhängigkeit von diesen Regimen zu verkleinern. Dieses Vorhaben sollte durch eine Intensivierung der Suche nach neuen Erdölvorkommen beispielsweise in Alaska und der Nordsee wie auch die Förderung alternativer Energieträger wie Solar- und Windkraftsysteme unterstützt werden, so Hohensee (1196, S. 193). Ex post betrachtet sollten Kritiker der damaligen Zeit Recht behalten, die in der Ablösung vom Erdöl einen langwierigen Prozess sahen: „Bis neue Energieträger das arabische Öl-Monopol brechen, vergehen nach Expertenschätzungen ungefähr 15 Jahre“, schreibt DER SPIEGEL 1973. Eine weitere relevante, in der Literatur noch nicht vollständig geklärte politische Folge, die sich primär auf die USA bezieht, war das Aufkommen von Erdölkriegen. Die geostrategische Ausrichtung Amerikas richtete sich fortan noch stärker auf eine aktive Machtgestaltung in erdölreichen Ländern.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 17 -
5 Kritische Würdigung & zeitgenössische Kontroversen Die Recherche hat gezeigt, dass einzelne Themen in der Literatur umstritten sind oder zumindest Anlass dazu besteht die vorherrschende Meinung zu hinterfragen. Demgemäss soll im Folgenden auf drei Teilaspekte vertieft eingegangen und Kontroversen aufgezeigt werden.
5.1 Rolle der OPEC Obwohl mit der OPEC eine Plattform geschaffen wurde, um dem Posted Price mehr Stabilität zu verleihen und damit Marktmacht auszuüben, ist die Frage, ob die OPEC ein funktionierendes Rohstoffkartell sei oder nicht, nicht eindeutig zu beantworten. Dagegen spricht ex-post betrachtet die Tatsache, dass es ab dem ersten Ölpreisschock bis heute vermehrt zu starken Schwankungen im Erdölpreis gekommen ist (Hohensee, 1996, S.22). Dies könne sachlich betrachtet nicht im Interesse der Förderländer liegen, so Hohensee, und hätte im Fall, die OPEC wäre ein funktionierendes Preiskartell, unterbunden werden können (S.23). Insofern ist es fraglich, welchen Einfluss die OPEC auf den Ausbruch der ersten Erdölkrise 1973 und den nachfolgenden Verlauf des Erdölpreises wirklich hatte.
5.2 Rolle der USA Auch Ganser (2013, S.181) widmet sich der Frage nach den treibenden Kräften hinter den Entwicklungen während der Krise, stellt dabei jedoch die Rolle der USA in den Fokus. In der historischen Forschung existieren unterschiedliche Thesen zur Erdölkrise 1973, so Ganser. Im Jahr 2000 verwies Scheich Ahmad Zaki Yamani, damaliger Erdölminister Saudi-Arabiens und zentraler Akteur innerhalb der OPEC während der Dollar- und Erdölkrise, für „die einzig zutreffende [...] Darstellung dessen, was mit dem Ölpreis im Jahre 1973 tatsächlich geschehen ist“, auf das Werk „Mit der Ölwaffe zur Weltmacht“ des amerikanischen Journalisten William Engdahl (Ganser, 2013, S.181). Darin wird die These vertreten, dass im Frühjahr 1973 eine Gruppe einflussreicher Vertreter aus Politik, Militär und Wirtschaft, bekannt unter dem Namen „Bilderberger“, die Folgen des Dollarzerfalls und des Anstiegs der Erdölpreise diskutierten und dabei ein Szenario erörterten, bei dem der Rohölpreis um 400 Prozent ansteigt – der während der ersten Erdölkrise tatsächlich eingetretenen Preiserhöhung. Engdahl zeigt in seinem Buch auf, dass ein Anstieg der Erdölpreise von den betreffenden Akteuren „geplant“ war und inwiefern dieser Anstieg die Dollarkrise entschärft hatte. „Ein globales Ölembargo sollte die Ölversorgung weltweit drastisch verknappen. Das würde die Weltölpreise dramatisch steigen lassen. [...] Mit dem Ölpreis musste also auch die Nachfrage nach US-Dollars ansteigen. Die steigende Nachfrage nach Dollars würde den Druck von ihm nehmen und seinen Wert stützen. [...] Die Volkswut sollte sich gegen die bösen ‚Ölscheichs’ richten [...].“ In diesem Kontext ist es aus Sicht der Autoren zudem interessant, das Verhalten des Schahs des Irans in den Verhandlungen der OPEC-Mitgliedsstaaten zur Festsetzung der Erdölpreise detaillierter zu betrachten. Nach Ganser (2013, S.184) soll Schah Pahlavi in den Debatten für eine besonders hohe Preissteigerung plädiert haben. Pahlavi, der nach dem Sturz Mossadeghs 1953 durch den amerikanischen und britischen Geheimdienst mit Unterstützung des Westens den Iran regierte, soll aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern auf Drängen von Henry Kissinger einen höheren Erdölpreis gefordert haben, so Ganser. Auf Basis der Erläuterungen von Engdahl und
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 18 -
Ganser, ist die in der Öffentlichkeit weit verbreitete Wahrnehmung der Förderländer als Verursacher und Auslöser sowie jene der USA als Geschädigte der ersten Erdölkrise 1973 nach Meinung der Autoren zumindest in Frage zu stellen.
5.3 Einfluss des Jom-‐Kippur Kriegs „Auf dem Terrain führte der Jom-Kippur-Krieg zu wenig Veränderung, aber sein Einfluss auf den Erdölpreis war enorm“, so Ganser (2013, S.182). Die Verhandlungen der OPEC Länder mit den Erdölfirmen mussten auf Grund des Kriegsausbruchs unterbrochen werden. Damit ist dem Jom-Kippur Kriegs eine entscheidende Rolle in der Erdölkrise 1973 nicht abzureden. Den Jom-Kippur Krieg als Verursacher für die Erdölkrise 1973 zu betrachten, wäre nach Ganser jedoch falsch (S.180). Viel eher seien die Wurzeln der Krise im Erreichen des Fördermaximums Peak Oil in den USA 1970, in der Aufhebung der Golddeckung des Dollars 1971 und der darauf folgenden Dollarkrise zu suchen. Dies werde insofern ersichtlich, als dass auch im Schweizer Parlament schon vor Ausbruch des Jom-Kippur-Krieges von einer Erdölkrise gewarnt wurde, so Ganser weiter. Der Zürcher CVP-Nationalrat Paul Eisenring äusserte sich dazu wie folgt: „Wegen des Drucks auf den Dollar“, seien die OPEC Staaten „geneigt, laufend weitere Preiserhöhungen durchzusetzen“. Eisenring sah dadurch die Versorgungssicherheit der Schweiz bereits vor Ausbruch der Krise gefährdet (Ganser, 2013, S.180).
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 19 -
6 Exkurs -‐ 1973 eine Epochengrenze? Im folgenden Abschnitt soll kurz auf die Frage eingegangen werden, inwiefern die Erdölkrise 1973 als Epochengrenze des Wachstums betrachtet werden kann. Aus gesellschaftlicher Perspektive kann diese Fragestellung durchaus bejaht werden, obschon der Epochenwechsel nach Ansicht der Autoren nicht strikt auf das Jahr 1973 begrenzt werden sollte. Vielmehr handelte es sich um einen seit Mitte der 1960er Jahre anhaltenden Prozess des gesellschaftlichen Wandels, der häufig mit den Begriffen „68er-Bewegung“ oder „Hippie-Zeit“ assoziiert wird. Während die Hippiebewegung insbesondere eine ausgeprägte Naturverbundenheit und Konsumkritik in den Vordergrund stellte, werden unter der 68er Bewegung meist linksgerichtete Studenten- und Bürgerrechtsbewegungen subsummiert, die sich unter anderem gegen den laufenden Vietnamkrieg, autoritäre Regime und für mehr sexuelle Freiheit richteten. Damit fällt die erste Ölkrise durchaus in eine Phase des strukturellen Umdenkens und kann daher als, wenn auch fliessende, Epochengrenze bezeichnet werden. In Bezug auf das Konsumverhalten der Nachfrager meint Borchardt, natürlich wäre es hilfreich, wenn sich der moderne Mensch angesichts vielleicht notwendiger Wachstums-Beschränkungen freiwillig zu Konservativismus entschliessen würde (Spiegel, 1975). Er lässt dadurch auch erkennen, dass die gesellschaftliche und wirtschaftliche Sichtweise nicht komplett losgelöst voneinander betrachtet werden können. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist die Frage, ob die erste Erdölkrise 1973 einen Epochenwechsel des wirtschaftlichen Wachstums darstellte nicht abschliessend zu beantworten. Zwar ist das starke Wirtschaftswachstum von 1968-1969 in den Folgejahren durchaus ins Stocken geraten (Abbildung 4), doch hätte diese Entwicklung durchaus auch als Bestandteil eines wiederkehrenden Konjunkturzyklus (ohne die Ölkrise 1973) stattfinden können.
Abbildung 4: Wachstumsraten im Zeitverlauf (Quelle: Metz, 2014)
Dass die Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums um 1970 Gegenstand politischer Diskussionen darstelle, zeigt sich unter anderem in dem in Deutschland 1967 in Kraft getretenen Stabilitätsgesetz (StabG). Es konkretisiert das Staatsziel des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts durch Preisniveaustabilität, hohe Beschäftigung, aussenwirtschaftliches Gleichgewicht und Wirtschaftswachstum. Wie in Kapitel 4 „Folgen der Krise“ dargelegt, waren diese vier Faktoren in der Bewältigung der Krise zwar relevant, doch, so die Ansicht der Autoren, hatte die erste Erdölkrise 1973 nicht ursächlichen sondern lediglich beeinflussenden Charakter.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 20 -
7 Fazit Die Autoren setzten sich zum Ziel, mittels der vorliegenden Arbeit die Ursachen, Wirkung und Folgen der ersten Erdölkrise 1973 darzulegen, um zu beantworten, inwiefern die Geschichte dieser Krise heute noch von Bedeutung ist und welche Lehren aus der historischen Analyse dieser Krise für die Zukunft gezogen werden können.
7.1 Zusammenfassung Der Ausbruch der ersten Erdölkrise ist am 16. Oktober 1973 anzusiedeln, als die OPEC nach Unterbrechung der Preisverhandlungen mit den westlichen Erdölgesellschaften eine unilaterale Erhöhung des Erdölrichtpreises veröffentlichte. Während diese und darauf folgende Preiserhöhungen nach Ansicht der Autoren primär zur Realisierung wirtschaftlicher Interessen geeignet waren, setzten die OPEC-Förderländer zur Durchsetzung politischer Standpunkte faktisch zeitgleich mit den Preiserhöhungen die sogenannte „Ölwaffe“, eine künstliche Verknappung der Erdöl-Fördermenge sowie Lieferembargos gegen ausgewählte Importländer, ein. Als unmittelbare Reaktion darauf, leiteten die Importländer ab November 1973 erste Erdöl-Sparmassnahmen ein. Das Ende der Erdölkrise 1973 kann mit der Aufhebung des Lieferembargos gegen die Niederlande am 10. Juni 1974 beziffert werden. Bereits ab Januar 1974 erhöhten die Förderländer, allerdings auf einem wesentlich höheren Preisniveau als vor Ausbruch der Krise, ihre Fördermengen wieder. Die Analyse hat gezeigt, dass der Erdölkrisen 1973 ein komplexes Geflecht staatlicher, organisatorischer aber auch gesellschaftlicher Ursachen zu Grunde liegt und sich die Krise in einer sowohl wirtschaftlich als auch politisch und gesellschaftlich ereignisreichen Epoche erfolgte. Nach Ganser (2012, S.212), gibt es gute Argumente dafür, die erste Erdölkrise habe eine Reaktion auf den Einbruch des US-Dollars darstellte. Aus Sicht der Autoren stellt die Aufhebung der Golddeckung des US-Dollars die relevanteste Ursache für die Erdölkrise 1973 dar. Auf Meso-Ebene konnten im Speziellen die langjährige Dominanz des Erdölgeschäfts durch westliche Erdölgesellschaften und dadurch motivierte Vereinigung erdölfördernder Staaten, insbesondere des Nahen Ostens, zur OPEC und OAPEC sowie die anschliessende Verfolgung wirtschaftlicher und politischer Interessen dieser Vereinigungen als relevant identifiziert werden. Schliesslich bildeten ein stetiger Anstieg der globale Erdölrausch ab 1945 sowie fehlende Transparenz im globalen Erdölmarkt den idealen Nährboden für die Entstehung der Erdölkrise 1973. Die Recherche der verwendeten Literatur hat ausserdem ergeben, dass die dargelegten Ereignisse zu einem Bewusstseinswandel der westlichen Gesellschaft hinsichtlich einem nachhaltigen Umgang mit Energieressourcen insbesondere in den Bereichen Architektur und Mobilität führte. Auf wirtschaftlicher Ebene sind die kurz- und mittelfristigen Folgen teilweise erhöhter Inflationsraten und steigender Energiepreise von grosser Bedeutung. Auf Seiten der Förderländer hingegen ermöglichte die Erdölkrise eine Erhöhung der finanziellen Mittel und damit den Zugang zu Investitionsgütern und technischem Knowhow. Schliesslich wirkt sich die erste Erdölkrise 1973 aus politischer Sicht primär in der Neuausrichtung der Energiepolitik vieler Importländer aber auch der geostrategischen Ausrichtung insbesondere der USA unter dem Standpunkt der aktiven Machtgestaltung bis heute aus.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 21 -
7.2 Ansatz für weitergehende Untersuchungen Die finale Auseinandersetzung der Autoren mit der Frage, ob die erste Erdölkrise 1973 eine Epochengrenze (wirtschaftlich und gesellschaftlich) darstellt, konnte nicht abschliessend beantwortet werden und bietet einen interessanten Ansatz für weitergehende Untersuchungen. Durch den Einbezug zeitgenössischer Kontroversen, beispielsweise zur Rolle der OPEC und der USA sowie zur Bedeutung des Jom-Kippur Kriegs auf den Ausbruch und Verlauf der Krise, sind auch in diesen Bereichen Ansätze für weitergehende Analysen gegeben wären. Ebenso wäre es aus Sicht der Verfasser interessant, die erste Erdölkrise 1973 mit derjenigen 1979/1980 zu vergleichen. Dabei wäre mit Blick auf die Krisenbewältigung vor allem wissenswert zu erfahren, inwiefern Lehren aus dem Umgang mit der ersten Erdölkrise 1973 in die Krisenbewältigung 1979/1980 mit eingeflossen sind. Zudem hat unsere Recherche aufgezeigt, dass sowohl Wirkung als auch Krisenpolitik in den einzelnen Länder unterschiedlich ausfielen. Insofern wäre auch hier Ansatz für eine vergleichende Analyse gegeben.
W i r t s c h a f t s k r i s e n | D i e e r s t e Ö l k r i s e ( 1 9 7 3 ) | N i c o l a s B e r c h t e n & J a n B r e c e l j
- 22 -
Literaturverzeichnis
Aeschlimann, S. M. (2004). Der Welterdölmarkt seit der 1.Ölkrise Mitte der 1970er Jahre Theorie und empirischer Befund. Bachelorarbeit. Universität St.Gallen
Amuzegar, J. (1973). The Oil Story: Facts, fiction and fair play. In: Foreign Affairs, 51(4), 676-689.
Campbell, J. C.; Liesenborghs, F.; Schindler, J. & Zittel, W. (2008). Ölwechsel! Das Ende des Erdölzeitalters und die Weichenstellung für die Zukunft. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
DER SPIEGEL (1975, 7. April). Politische Philosophie: Grenzen der Demokratie. Ausgabe 15, S.152. Abgerufen am 31. Mai 2014 von http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41533862.html
DER SPIEGEL (1973, 22. Oktober). Nahost-Öl: Die Krise dauert fünfzehn Jahre. Ausgabe 43, S.25. Abgerufen am 31. Mai 2014 von http://www.spiegel.de/spiegel/print/d841843107.html!
Engdahl, F. W. (2010). Mit der Ölwaffe zur Weltmacht: der Weg zur neuen Weltordnung. 4. Aufl. Rottenburg: Kopp
Ganser, D. (2014, 15. März). Interview: Peak Oil, Ressourcenkriege, Imperium USA
Ganser, D. (2013). Europa im Erdölrausch. Zürich: Orell Füssli.
Ganser, D. (2012). Die Erdölkrise von 1973. In Schweizerisches Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 27. Zürich: Chronos. S.207-227.
Hammes, D., Wills, D. (2003). Black Gold: The End of Bretton Woods and the Oil-Price Shocks of the 1970s. University of Washington Tacoma Working Paper. Abgerufen am 31. Mai 2014 von http://www.independent.org/pdf/tir/tir_09_4_2_hammes.pdf
Hohensee, J. (1996). Der erste Ölpreisschock 1973/74. Stuttgart: Franz Steiner.
Krystek, U., Moldenhauer R., et al. (2007). Handbuch Krisen- und Restrukturierungsmanagement. Stuttgart: Kohlhammer
Metz, R. (2014). Wirtschaftskrisen: Historische und theoretische Perspektiven FS 14. Vorlesungsunterlagen.
Parra, F. (2010). Oil Politics. New York: I.B. Tauris & Co Ltd.
SIPER (2011). Schweiz Endenergieverbrauch nach Energieträgern. Abgerufen am 31. Mai 2014 von http://www.siper.ch/de/energie/energie-wissen/infografiken/
ZEIT (2004). Lunte an der Weltwirtschaft. Die Angst vor neuen Attentaten treibt den Ölpreis. Ausgabe 24, 2004. Abgerufen am 31. Mai 2014 von http://www.zeit.de/2004/24/85lkrise