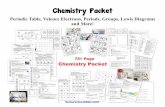Ennius in den Oden des Horaz. Dichterische Selbstbetrachtung im Spiegel der Ironie
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ennius in den Oden des Horaz. Dichterische Selbstbetrachtung im Spiegel der Ironie
Ennius in den Oden des Horaz
Dichterische Selbstdarstellung in c. 2,20 und c. 4,8
im Spiegel der Ironie
Zulassungsarbeit
Prof. Dr. Ulrike Auhagen
Wintersemester 2012/13
vorgelegt von:
Maximilian A. Loeper
E-Mail: [email protected]
Studienfächer: Geschichte (HF) / Latein (HF) / Politik(NF) nach WPO 2001Fachsemester: 8 / 8 / 2Matrikelnummer: 2760845
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung................................................2
II. Voraussetzungen..........................................8
II. 1. ridentem dicere verum quid vetat? - Charakter und Gebrauch von
Ironie bei Horaz............................................8
II. 1. a) Definition und Ausdruck...................................8II. 1. b) Leitmotive und Charakter..................................9II. 1. c) Anwendung und Gebrauch................................10
II. 2. ingenio maximus arte rudis – Das Enniusbild bei Horaz
außerhalb der Oden.........................................14
II. 3. Dichterische Selbstdarstellung im Vergleich.........18
II. 3. a) Ennius...............................................18II. 3. b) Horaz...............................................20
II. 4. Intertextualität und ihre Bedeutung bei Horaz.......23
III. Einzelinterpretationen.................................26
III. 1. Daedaleo notior Icaro - Aemulatio als Hybris in c. 2,20...26
1
III. 1. a) Inhalt und vordergründige Intention........................26III. 1. b) Ursprung und Vorläufer des Verwandlungsmotivs..............26III. 1. c) Deutungskontroverse...................................27III. 1. d) Unsterblichkeitsgedanke und Lächerlichkeit...................29III. 1. e) Einzelinterpretation c. 2,20...............................30III. 1. f) Ergebnisse der Einzelinterpretation..........................37
III. 2. Die Ironie des Vergleichs – Gedächtniskultur in c.
4,8........................................................38
III. 2. a) Inhalt und vordergründige Intention........................38III. 2. b) Deutungskontroverse...................................39III. 2. c) c. 4,8 im Spiegel der Ironie...............................40III. 2. d) Einzelinterpretation c. 4,8................................41III. 2. e) Ergebnisse der Einzelinterpretation.........................54
IV. Schlussbetrachtung......................................56
V. Bibliographie............................................61
2
I. Einleitung
dicar, qua violens obstrepit Aufidus
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos.
(Hor. c.
3,30,10-14)
Szenen der Selbstdarstellung in literarischen Texten sind in
der Regel kurze Abschnitte, in welchen der Autor seinen Lesern
ein bestimmtes Bild seiner Persönlichkeit vorstellt. Die
gegebene Information ist dabei Teil einer Charakterisierung,
welche sich wiederum in ein übergeordnetes Selbstkonzept fügt,
mit dem der Autor eine bestimmte Wahrnehmung seiner Person
durch das Publikum zu evozieren sucht. Dieser Vorgang war in
der römischen Antike umso bedeutender, da die Rezipienten in
Abwesenheit moderner Massenmedien allein auf die Angaben des
Schriftstellers angewiesen waren, wollten sie sich eine
Vorstellung von dessen Person machen.
Auf ähnliche Weise verfährt der augusteische Dichter Horaz
in seinen Oden (oder auch carmina), wie das vorangestellte Zitat
illustriert. Zwar rühmt er sich einerseits, als erster äolische
Lyrik nach sapphischem und alkäischem Vorbild in die
lateinische Dichtung eingeführt zu haben. Indem er aber seine
persönliche Errungenschaft lediglich in der Übertragung
griechischer Dichtkunst ins Lateinische sieht, stellt sich der
Dichter andererseits als sehr bescheiden dar. Es ist sicher,
3
dass Horaz nach 88 Gedichten im zitierten Epilog des Dritten
Odenbuches dennoch von Stolz auf die eigene Leistung erfüllt
ist. Gerade in diesem bedeutenden Moment entwirft er aber auch
ein ernstes und moderates Bild von sich, welches den Stolz
kontrolliert und klar von der Überheblichkeit abgrenzt.
Während es an dieser Stelle im feierlichen Epilog des dritten
Buches auf der Hand zu liegen scheint, wie Horaz von seinem
Publikum verstanden werden möchte, entfaltet sich um die
Deutung anderer Gedichte, die Szenen der Selbstdarstellung
beinhalten, aufgrund gewisser, als widersprüchlich empfundener
Elemente, eine wissenschaftliche Kontroverse1: Die Rede ist
hier vom Epilog des zweiten Buches (c. 2,20) und dem
Mittelstück des vierten und letzten Buches (c. 4,8).
c. 2,20 wurde vor allem aufgrund der drastisch dargestellten
Verwandlung des Dichters in einen Schwan, der sinnbildlichen
Identität des Dichters Pindar, und des anschließenden
Höhenfluges des nun geflügelten Dichters kritisiert. Die
Metamorphose, welche der Dichter am eigenen Leib vorführt,
erzeuge nach Meinung der meisten Kritiker ein Bild, das
entweder durch seine Plastizität lächerlich wirke, oder aber
aufgrund der metaphorischen Gleichsetzung mit Pindar eine
maßlose Art dichterischer Selbstdarstellung reflektiere. Beide
Deutungen führten die Mehrzahl der Wissenschaftler zu der
Auffassung, dass die Ode - wenn nicht sogar gänzlich
unhorazisch - als qualitativ minderwertig zu bewerten sei.
1 Um Wiederholungen zu vermeiden, sind an dieser Stelle nur diegrundsätzlichen Kritikpunkte genannt. Eine genaue Wiedergabe derForschungskontroverse zu dem jeweiligen Gedicht geschieht im Rahmen derfolgenden Einzelinterpretationen.
4
Auch die Ode 4,8 musste aufgrund ihres Mittelteils,
welcher der Interpolation verdächtigt wurde, der
Unanwendbarkeit der sogenannten, für alle anderen Oden gültigen
lex Meinekiana sowie historischen Ungenauigkeiten im Zusammenhang
mit Ennius und den von ihm beschriebenen Taten der Scipionen,
ähnliche Kritik entgegen nehmen. Zudem gerät die bei Horaz
sonst sehr intime Widmung der Gedichte im Laufe dieser Ode
völlig verloren, die letztlich in keinem Bezug mehr zu ihrem
eigentlichen Adressaten steht.
Obgleich eine einheitliche Interpretation der Gedichte
umstritten ist, kann es als sicher betrachtet werden, dass
Horaz in beiden Werken intertextuelle Verbindungen zu einem
dichterischen Vorgänger, dem vorklassischen Poeten Ennius,
konstruiert hat2. So ist es in der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung allgemein anerkannt, dass Horaz in c. 2,20
sowohl mit der Thematik als auch der Metaphorik des Gedichtes
auf das berühmte Grabepigramm des Ennius anspielt3. Auch lassen
sich inhaltliche Parallelen zum heute nur noch fragmentarisch
erhaltenen Annalenproömiums des Vorklassikers aufzeigen. In c.
4,8 findet sich in dem umstrittenen Mittelteil sogar ein
direkter Verweis auf die Dichtung des Ennius (v. 20 Calabrae
Pierides).
In Anbetracht der Aporie konventioneller Deutungsansätze im
Kontext der angesprochenen Gedichte auf der einen und den
nachweislichen literarischen Bezügen zu Ennius auf der anderen
Seite, scheint es zur Lösung des Interpretationsdilemmas2 Während an dieser Stelle nur erste Verweise gegeben werden, um in dieProblematik einzuführen, folgt eine eingehende Untersuchung derintertextuellen Bezüge im Hauptteil der Arbeit.3 Enn. frg. var. 17 (V).
5
sinnvoll, eine wichtige Dimension der horazischen Dichtung
einzubeziehen: Die Ironie. Dabei gilt es zunächst, sich einer,
nach Meinung des Verfassers, erkenntnishemmenden
interpretatorischen Auffassung entgegenstellen, wie sie unter
anderem der mit der Ehrendoktorwürde der Universität Oxford
ausgezeichnete Altphilologe Felix Jacoby ausgedrückt hat:
„Den Humor, meine Herren, verbannen Sie bitte ad inferos; ob Horaz Humor
gehabt hat, weiß ich nicht - das Eine nur weiß ich, dass Horaz die
humoristischen Erklärungen seiner Gedichte mit Backpfeifen beantwortet
hätte!“ 4
Nun ist die „überragende Rolle“ von Ironie in der
Sermonendichtung (Satiren, Episteln) des Horaz schon länger
erforscht und anerkannt5. Auch innerhalb der Oden sind
humoristische und ironische Tendenzen nachweisbar, wie die
Arbeiten von Antony und Connor darlegen6. Humor, dessen
modifizierter Standpunkt die Ironie ist, bei der Interpretation
von horazischen Texten einfach so zu ignorieren, erscheint also
äußerst fahrlässig. Wie schon seine Sermonendichtung
eindrücklich belegt, besaß der Dichter einen sehr feinfühligen
Sinn für das Komische. Die Komik findet, wie der Tübinger
Altphilologe Ernst Zinn eingeworfen hat, bei Horaz im Ernst
nicht ihr Gegenteil, sondern ihre Verklärung7. So schließen
sich die verschiedenen Stimmungslagen, die heute in der Regel
4 Zitiert nach: Zinn 1960, 49.5 Sack 1965, 165.6 Antony 1976, Connor 1987.7 Zinn 1960, 49.
6
als konträr empfunden werden, in seinen Werken nicht
gegenseitig aus.
Demnach sollte sich die Horazinterpretation nicht von der
scheinbaren Ausweglosigkeit konventioneller Deutungsmuster
beschränken lassen oder sich gar gezwungen sehen, horazische
Verse aufgrund gewisser Unstimmigkeiten, seien diese
sentimentaler Art oder nicht, aus dem Werk zu verbannen8.
Stattdessen erscheint es sinnvoller, die Fähigkeit zu Witz und
Ironie, die Horaz schon in anderen Teilbereichen seines Werkes
so deutlich bewiesen hat, nicht an die Grenzen des
literarischen Genres der jeweiligen Texte zu binden, sondern
sie vielmehr über ihren Verfasser zu definieren und sich bei
der Analyse der diskutierten Oden einer ironischen Lesart nicht
zu verschließen.
Ausgehend von dieser Prämisse und der oben erläuterten
Intertextualität lässt sich die These formulieren, dass die
Gedichte nicht, wie es auf unbefriedigende Weise versucht
worden ist, als Selbstdarstellung des Horaz, sondern vielmehr
als ironische Darstellung des Ennius durch Horaz zu
interpretieren sind.
Für eine solche Annahme spricht neben den bestehenden
Widersprüchlichkeiten und Bezügen zu Ennius in den Gedichten
sowie der Wahrnehmung des Horaz als Autor, welchem das
Stilmittel der Ironie durchaus vertraut ist, noch ein weiterer
Beweggrund. Dieser scheint in der Art und Weise zu liegen, in
welcher sich beide Dichter selbst darzustellen pflegten. Dabei8 So schlägt es beispielsweise Fuchs für c. 2,20 vor, Fuchs 1962, 152ff.Kiessling hält die diskutierten Verse in c. 4,8 für eine Interpolationeines „Ignoranten etwa des vierten Jahrhunderts“, Kiessling / Heinze 1955,432.
7
weicht das Bild, mit dem Horaz offenbar wahrgenommen werden
wollte, stark von dem seines vorklassischen Kollegen ab.
Während Horaz in seinen Werken vor allem eine (selbst-)
mäßigende Haltung propagierte, scheint der poetische Anspruch
des Ennius, welcher sich selbst auch als alter Homerus
apostrophierte, alles andere als bescheiden gewesen zu sein.
Diese Diskrepanz der dichterischen Selbstdarstellung böte
Horaz, der den Selbstvergleich (aemulatio) mit großen Vorbildern
als reine Überheblichkeit bewertete, eine ausreichende
Motivation, Ennius auf ironische Weise für dessen überzogenes
Selbstkonzept zu kritisieren.
Sofern sich die Ergebnisse einer solchen Interpretation
mit hinreichenden Argumenten stützen lassen, könnten sie als
Beitrag zu einem besseren Verständnis der problematisierten
Oden behilflich sein und gleichzeitig einen neue Aspekte im
Verhältnis des Horaz zu Ennius beleuchten. Dass diese
Interpretation den Texten nicht nur oktroyiert, sondern auch
anhand begründeter Argumente vertreten werden kann, gilt es im
Rahmen dieser Arbeit zu prüfen.
Dazu ist es notwendig, einige Grundvoraussetzungen zu klären,
auf welche dann in der Auswertung der diskutierten Gedichte
zurückgegriffen wird: Zunächst erscheint es im Sinne der
Fragestellung sinnvoll, den Charakter und die Verwendung von
Humor und Ironie bei Horaz im Allgemeinen – also auch außerhalb
der Oden – zu beleuchten. Dabei ist es besonders wichtig, den
Zweck und das Ziel der angewendeten Ironie herauszustellen.
Des Weiteren ist es nötig, die Meinung zu herauszustellen,
welche Horaz über seinen Vorgänger Ennius und dessen Dichtung
8
vertrat. Als einzige Quelle können dafür solche Stellen aus dem
horazischen Werk dienen, in welchen sich der Dichter auf
direkte oder indirekte Weise zu Ennius und oder dessen Dichtung
äußert. Diese gilt es also zu sichten und zu analysieren, um
schließlich den Versuch zu unternehmen, ein Gesamtbild der von
Horaz vertretenen Meinung zu rekonstruieren.
Da es sich bei den Einzelinterpretationen der
thematisierten Oden um problematische Szenen der
Selbstdarstellung handelt, ist es ebenso bedeutend, weitere
horazische Passagen, denen eine ähnliche Motivation zu Grunde
liegt, zu untersuchen. Gleichsam wird sich die Arbeit auch
Schlüsselszenen aus dem ennianischen Oeuvre widmen, um einen
wirksamen Vergleich der Selbstdarstellung beider Dichter zu
ermöglichen. Dabei wird der Fokus vor allem auf der Suche nach
Unterschieden in der Art der Selbstdarstellung beider Dichter
liegen. Gelingt es, hier eine deutliche Diskrepanz
herauszuarbeiten, kann diese als Motivation für eine mögliche
Karikierung des Ennius in den daraufhin zu besprechenden Oden
bewertet werden.
Als letzte Voraussetzung wird die Arbeit einen kurzen
Überblick über die Theorie leisten, welche in der heutigen
Sprachwissenschaft die Beziehung von Texten zueinander
untersucht und definiert. Hierbei ist es wichtig, auf die Frage
einzugehen, welche Voraussetzungen für eine tatsächliche
Intertextualität erfüllt werden müssen und welche Bedeutung ihr
bei Horaz zukommt.
Im Hauptteil wendet sich die Untersuchung der
Einzelinterpretation der Oden c. 2,20 und c. 4,8 zu. Unter
Einbeziehung der erarbeiteten Voraussetzungen wird versucht,
9
nach einer zusammenfassenden Darstellung des Inhalts sowie der
jeweiligen Forschungskontroverse, die Gültigkeit einer
ironischen Interpretation anhand der Fragestellung zu
überprüfen. Aufgrund der Menge an bereits vorhandenen
Interpretationen zu den Gedichten, wird der Schwerpunkt dieser
Arbeit darauf liegen, die widersprüchlichen und ironischen
Tendenzen jeweils herauszustellen und zu erklären. Auf andere
Aspekte, die im Rahmen dieser Untersuchung außer Acht gelassen
werden, verweist der Autor am Rande.
Abschließend werden die Ergebnisse der Untersuchung in
einem Fazit zusammengefasst und besprochen.
Neben der Legitimität einer ironischen Interpretation der
Gedichte geht diese Arbeit noch von einer weiteren Prämisse
aus: Da Horaz jede der behandelten Oden einem römischen
Zeitgenossen, höchstwahrscheinlich sogar einem ihm persönlich
eng vertrauten Individuum, mittels direkter Anrede widmet, ist
davon auszugehen, dass das lyrische Subjekt dieser Gedichte mit
dem Dichter selbst gleichgesetzt ist. Auch in Anbetracht des
intimen Vortrags innerhalb eines befreundeten Lesezirkels würde
die Extraktion der Person Horaz aus seinen Gedichten
befremdlich wirken. Freilich muss an den Umstand erinnert
werden, dass sich das in seinem Werk dargestellte Bild dieser
Person aus einer in höchstem Maße durchdachten und komplexen
Konstruktion ergibt. Der Rückschluss auf das tatsächliche Wesen
und den Charakter des Dichters würde daher, sowie aufgrund der
fragmentarischen Überlieferung von gesicherten Informationen,
zu autobiographistischen Deutungsansätzen einladen, denen schon
die antiken Interpretatoren oft verfielen. Denn auch wenn der
10
Poet sich mit der von ihm kreierten Figur durchaus
identifiziert haben mag und möglicherweise auch wollte, dass
dies von seinem Publikum so verstanden würde, so bleibt doch
immer noch das Problem der möglichen – und oftmals wohl auch
wahrscheinlichen – Diskrepanz zwischen Dichter und Figur
bestehen.
Ohne genaue Kenntnis der Persönlichkeit und der Biographie
des Horaz ist eine Überprüfung dieser Abweichung unmöglich. Der
moderne Wissenschaftler kann somit auf diese Weise keine
sicheren Informationen über die tatsächliche Person des
Dichters gewinnen. Was sich hingegen aus den Versen vermuten
lässt, ist die Art und Weise, in der Horaz auftrat, in welcher
er gerne von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen und in
welcher Beziehung zu Anderen er verstanden werden wollte. Und
eben das ist bei der Untersuchung des Verhältnisses zu Ennius
die vielleicht viel interessantere Erkenntnis.
Alle in dieser Arbeit verwendeten Zitate und Stellenangaben aus
dem horazischen Werk folgen der kritischen Edition von
Shackleton Bailey9. Für Textstellen aus den Annalen des Ennius
wird die Ausgabe von Skutsch verwendet10. Die übrigen
Enniusstellen werden nach der immer noch relevanten Edition von
Vahlen wiedergegeben11.
9 Q. Horatius Flaccus: Opera, edit. D. R. Shackleton Bailey, Berlin / NewYork 20084.10 The Annals of Quintus Ennius, edit. O. Skutsch, Oxford 1985.11 Ennianae poesis reliquiae, edit. J. Vahlen, Leipzig 1903.
11
II. Voraussetzungen
II. 1. ridentem dicere verum quid vetat? - Charakter und Gebrauch von
Ironie bei Horaz
II. 1. a) Definition und Ausdruck
Wenn wir davon ausgehen wollen, dass Horaz das Verhältnis,
welches er zu seinem Vorgänger Ennius besaß, in ironischen
Zügen darstellte, dann ist es unentbehrlich, zunächst den
Versuch einer Definition von Ironie zu unternehmen. Daraus
ergibt sich die Möglichkeit, das Ironieverständnis des Horaz
genauer zu bestimmen und dessen allgemeinen Umgang mit diesem
Stilmittel zu erläutern.
12
Dabei stellt sich zunächst das Problem, dass für eine
grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ernst und Komik in
literarischen Texten keine objektiven Kriterien existieren. Die
äußerliche Ausdrucksform beider Lesarten kann oft die gleiche
sein. Das fällt beispielsweise, wie Heinz Antony in seiner
Untersuchung des Humors in der augusteischen Dichtung
konstatiert, bei der Beobachtung auf, dass auf den ersten Blick
schwere und leidvolle Texte (z. B. Elegie) auch genauso gut mit
einem leisen Anflug von Ironie gelesen werden können12. Die
Form einer komischen Aussage, als welche die Ironie ja nun zu
verstehen ist, sei letztlich das Ergebnis der Spannung zwischen
dem dichtenden Subjekt auf der einen, und dem Objekt dieser
Dichtung auf der anderen Seite13.
Auch der Begriff „Ironie“ bringt gewisse Schwierigkeiten
mit sich, da er keine eindeutige etymologische Herleitung
zulässt. Das Wort geht über das lateinische ironia zurück auf
das Substantiv είρων mit der Bedeutung „Sager“ (derjenige, der
etwas nur meint, ohne es zu sagen) oder „Frager“. Die Ableitung
des Substantivs είρων ist aber umstritten und man geht in der
Regel von einem unbekannten Grundwort aus14. Deswegen ist die
Suche nach Belegstellen des Wortes notwendig, um die
Bedeutungsentwicklung des Begriffes in der Antike
herauszustellen. Daraus ergibt sich, dass Ironie in ihrer
ursprünglichen Bedeutung als Spott verstanden wurde, bei dem
die Rede selbst nicht mit dem Sinn der Rede übereinstimmt, also
das Gesagte nicht mit dem Gemeinten15.
12 Antony 1976, 1.13 ders., 5.14 Frisk, H.: Griechisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1960.15 Vgl. Sack 1965, 10; Für eine genaue Untersuchung der Belegstellen zuείρων siehe: ders., 8ff.
13
Um den Gebrauch von Ironie schließlich zu signalisieren,
verfügt die direkt vorgeführte Rede über die Mittel der
sogenannten actio, wie beispielsweise der Veränderung der
Tonlage oder –höhe oder der Auffälligen Gestaltung von Mimik
und Gestik des Sprechers. Bei literarischen Texten hingegen ist
zum Erkennen der Ironie eine Form sprachlicher Unstimmigkeit
als Ironiesignal notwendig16. Dabei lässt sich die Ironie nach
Jean Paul durch den „Ernst des Scheines“ noch weiter steigern.
Der Widerspruch, der durch die Präsentation von Ironie in
ernster Art und Weise entsteht wird, erzeugt und oder verstärkt
wiederum das komische Moment17. Der Würzburger Altphilologe
Volker Sack bemerkte in seiner Dissertation weitergehend, dass
der Ironiker, welcher im Gegensatz zum Nichtironiker
feinfühliger und hellhöriger sei, daher auch selbst auf
bewusste Weise im Widerspruch zu seiner Zeit lebe, in sich
schwankend zwischen echter Empfindung und kritischem
Verstand18. Somit kann Ironie in einem literarischen Kunstwerk
auch als Ausdruck einer ironischen geistigen Einstellung
aufgefasst werden. Eine weitere Grundvoraussetzung für das
Verständnis von Ironie in der augusteischen Epoche ist
sicherlich auch die Einbezugnahme des eher nüchternen
Lebensgefühls dieser Zeit sowie die Akzeptanz der Realität des
Todes als letzter Konsequenz19.
Bei der Differenzierung zwischen Ironie und Humor in
literarischen Texten gestaltet sich letzterer als Modifizierung
des ironischen Standpunktes und umgekehrt. Humor impliziere, so
16 Paul, J.: Vorschule der Ästhetik, hrsg. v. Miller, N., Bd. 5, München1963.17 Ders., § 38.18 Vgl. Sack 1965, 14.19 Antony 1976, 7.
14
Sack, eine freie, reine, wohl kritisierende aber gleichsam
liebevolle und heitere Betrachtung der endlichen Schwächen. Im
Gegensatz zur Ironie sei er von milder, gelassener,
versöhnlicher und oder sentimentaler Art20.
II. 1. b) Leitmotive und Charakter
Das angesprochene, nüchterne Lebensgefühl und die feinfühlige
Wahrnehmung zeigen sich auch in der Dichtung des Horaz. Und
wenn wir Ironie, wie oben erwähnt, als eine Ausdrucksform der
persönlichen Gesinnung des Dichters verstehen, dann scheint es
wichtig, entscheidende Faktoren dieser Geisteshaltung, die für
die horazische Komik mitbestimmend sind, in Grundzügen
herauszustellen: Der Poet konstruiert von sich ein beherrschtes
Bild, in dem er stets Kontrolle und Skepsis gegenüber den
Dingen behält. Horaz erscheint nicht „leidenschaftslos, aber
als Herr seiner Leidenschaft“21. Dabei folgt die dem
horazischen Oeuvre zugrunde liegende Philosophie dem
Eklektizismus ihres Verfassers. Horaz bekennt sich weder
eindeutig zur philosophischen Schule der Stoa, noch zum
Epikureismus22. Besonders bestimmend für sein Werk sind Staat
und Politik. Vom Republikaner wandelt er sich zum Freund und
Befürworter der augusteischen Reformpolitik. Dennoch bleibt
sein Verhältnis zur Gesellschaft vor allem von moralischen
Erwägungen geprägt. Das otium ernennt Horaz als Lebensziel,
wozu er sich dementsprechend stabile politische Verhältnisse
20 Sack 1965, 25.21 Schanz-Hosius, II, 146.22 Gewisse Präferenzen für die Philosophie Epikurs könnten durch dieAdressaten (Maecenas) und das Kernpublikum, welche als dem Epikureismusverbunden galten, bedingt sein, vgl. Antony 1976, 14.
15
wünscht. Im Gegenzug kann seine Dichtung, wie es der
Heidelberger Altphilologe Viktor Pöschl vorgeschlagen hat,
teilweise als Konzession an die Forderungen des Regimes
gedeutet werden, von dem sich Horaz diese Stabilität erhofft23.
Als Leitmotive der horazischen Geisteshaltung, auf welche
wir nur durch sein Werk schließen können, sind daher vor allem
Skepsis, Distanziertheit und Autarkie festzuhalten24. Auch kann
in seiner Dichtung oftmals das Gefühl des Schwankens zwischen
sittlichem Ernst25 und dem – teils sogar derben - Ausdruck
reiner Lebensfreude26 ausgemacht werden. Es scheint, als
bestimmten dieses Schwanken und die daraus resultierende
Ausweglosigkeit stets die Erscheinungsformen des Komischen bei
Horaz27. Dabei gibt sich der Poet selbst, welchen der ehemalige
Rektor der Universität Heidelberg und Mitherausgeber des
Gnomons, Karl Meister, als „einzigen Humoristen unter den
Römern“ apostrophiert hat, unvollkommen und als ein mit
Widersprüchen behafteter Mensch, der aber dennoch über sich
selbst zu lachen vermag28.
II. 1. c) Anwendung und Gebrauch
Kommen wir von den allgemeinen Gesichtszügen der horazischen
Ironie auf ihre tatsächliche Verwendung, so ist zu allererst
ihre überragende Rolle für die Sermonendichtung des Horaz23 Vgl. Pöschl, V.: Horaz und die Politik, Heidelberg 1963, 154.24 Vgl. Antony 1976, 17.25 epist. 1,2,40: sapere aude; epist. 1,1,52: vilius argentum est auro, virtutibus aurum.26 So z. B. in c. 2,11,21ff.: quis devium scortum eliciet domo Lyden? eburna dic age cumlyra maturet, in comptum Lacaenae more comam religata nodum.27 Beispielhaft in c. 4,12,27f.: misce stultitiam consiliis brevem: dulce est desipere inloco.28 Meister, K.: Die Tugenden der Römer, in: Oppermann, H. (Hrsg.): Wege derForschung, Bd. 34, Darmstadt 1967, 18f.
16
(Satiren und Episteln) anzumerken29. Die ständige Möglichkeit einer
ironischen Interpretation ist hier oft sogar Voraussetzung für
das Verständnis der Texte. Selbst in auf den ersten Blick
ernsthaften Passagen lässt der Dichter immer wieder Anzeichen
von Ironie anklingen und erzeugt auf diese Weise eine
spielerisch-unverbindliche Atmosphäre30. In den Episteln ist das
Stilmittel der Ironie noch vielseitiger vertreten als in den
Satiren. Auch erscheint die Ironie hier reifer und profunder,
was V. Sack zum einen auf die Gattung, zum anderen auf das
fortgeschrittene Alter des Horaz zurückführt31.
Als Funktionen von Ironie können nach Sack für die
Sermonendichtung, folgende Aspekte festgehalten werden:
Mittel der Diskussion (zur Ablehnung fremder, bzw.
Bekräftigung eigener Standpunkte; zur persönlichen
Aufforderung, Mahnung und Zurechtweisung).
Mittel der Selbstaussage (alle Arten der Selbstironie,
soweit sie primär die Selbstdarstellung des Dichters
bezwecken).
Mittel der dichterischen Gestalt (zur Auflockerung und
Ausgestaltung einer Aussage; als Legitimation des
Gedichts, wenn die Ironie das Wesen desselben ausmacht und
so Dichtung und Ironie eins sind) 32.
Der Fragestellung dieser Arbeit folgend, ist es interessant zu
beobachten, dass Horaz sowohl bereits in seiner frühen
Satirendichtung als auch in den, auf die ersten drei Odenbücher29 Vgl. Sack 1965, 165.30 Vgl. Sack 1965, 165.31 ders., 168.32 ders., 165ff.
17
folgenden Episteln Ironie in Szenen der Selbstdarstellung
anwendet. So dient die Ironie zum Beispiel in sat. 1,6 zur
Veranschaulichung seiner inneren Freiheit und Unabhängigkeit.
In sat. 1,9 nutzt Horaz das Stilmittel zur indirekten Andeutung
und gleichzeitigen Verhüllung seiner tatsächlichen Meinung im
Gespräch mit einem aufdringlichen Schwätzer. Als dieser sich
trotz seiner offensichtlich mangelhaften, beziehungsweise
völlig fehlgerichteten Qualitäten nicht davon abbringen lässt,
in den Dichterkreis des Maecenas gelangen zu wollen, gibt Horaz
die abweisenden Versuche auf und wehrt sich stattdessen durch
den Gebrauch von Ironie, indem er dem Schwätzer Mut zuspricht:
> velis tantummodo : quae tua virtus, (54)
expugnabis ; et est qui vinci possit, eoque
55
difficilis aditus primos habet. < > haud mihi dero :
muneribus servos corrumpam ; non hodie si
exclusus fuero, desistam ; tempora quaeram
occuram in triviis, deducam. nil sine magno
vita labore dedit mortalibus. < 60
Dass der Aufdringliche die horazische Ironie nicht erkennt,
sondern vielmehr mit ernsthafter Selbstsicherheit formuliert,
er werde Maecenas mit Hilfe seiner, offensichtlich unzumutbaren
Art für sich gewinnen, steigert die Komik noch weiter33.
Allerdings tritt Horaz für einen konstruktiven Humor ein34. Der
Witz dürfe nicht zur bloßen Posse verkommen und sollte demnach
33 Für eine ausführliche Untersuchung der genannten Stellen vgl. Sack 1965,63-68 bzw. 75-81.34 Vgl. Antony 1976, 20.
18
eine aufrechte Gesinnung zum Ausdruck bringen, wie aus dem, in
der Kapitelüberschrift zitierten Ausschnitt der ersten Satire
deutlich wird (ridentem dicere verum quid vetat?, sat. 1,1,23ff.).
Gleichzeitig dient Horaz, wenn er die Wahrheit (verum) sagt,
das Lachen (ridere) als eine Art verschleierndes Zwischenmedium.
Indem er etwas Wahres auf heitere Weise vorträgt, umgeht der
Autor die unmittelbare Konfrontation mit seinem Adressaten.
Dies führt auch dazu, dass, wie G. A. Seeck einwirft, die
Ironie die Aggressivität der horazischen Satire überdeckt und
dadurch als mildernder Faktor wirkt35.
In den Epoden, welche Horaz nach den Satiren
veröffentlichte, findet sich Ironie häufig gepaart mit einer
äußerst schmählichen, derben Komik. So beispielsweise in epod.
8,11ff., welche E. Zinn als eines der schlimmsten
Schmähgedichte antiker Dichtung bezeichnet36:
esto beata, funus atque imagines
(11)
ducant triumphales tuum
nec sit marita quae rotundioribus
onusta bacis ambulet.
quid, quod libelli Stoici inter Sericos 15
iacere pulvillos amant :
inlitterati num minus nervi rigent
minusve languet fascinum?
Aus der Kombination einer fast schon aggressiv anmutenden
Unmittelbarkeit mit der präzisen Beobachtung der alltäglichen35 Vgl. Seeck 1991, 535f.36 Zinn 1960, 50.
19
Widersprüchlichkeiten einer prätentiösen, augusteischen
Gesellschaft generiert Horaz eine beißende Ironie37.
In den Oden schließlich scheint sich eine Milderung des
Temperaments in Scherz und Humor des Autors vollzogen zu haben.
In Horazens lyrischer Dichtung kommt es zur Berührung und
gegenseitigen Durchdringung, ja sogar zur zeitweiligen Einheit
der Sphären von Ernsthaftigkeit und Heiterkeit38. Als für diese
Verbindung paradigmatisch erscheint besonders folgende Stelle
in c. 2,16:
laetus in praesens animus quod ultra est
25
oderit curare et amara lento
temperet risu : nihil est ab omni
parte beatum.
Als Leitmotiv des Lustigen scheinen Horaz nun pragmatischere,
lebensphilosophische Gründe vorzuliegen. Das Heitere (risus)
soll die Bitterkeit des Lebens ertragbar machen und sich mit
dem Schicksal, ungerührt (lentus) vom Zustand der persönlichen
Existenz, abfinden helfen39.
Als weitere Ausdrucksform der Ironie in den Oden stellt
sich bei Horaz die sogenannte recusatio dar. Das ablehnende
Gedicht widerspricht schon wegen seiner Existenz seinem Inhalt,
in dem der Dichter die Verfassung solcher Poesie zurückweist,
da er sich dafür nicht (mehr) imstande fühlt. Der durchaus37 Ein noch derberer Gebrauch von Ironie findet sich in epod. 12.38 Vgl. Zinn 1960, 51.39 lentus charakterisiert in der Regel eine Person, die von etwas ihrWidrigem ungerührt bleibt, vgl. Zinn 1960, 52; siehe auch Ovid am. 3,6,60.
20
provozierte Widerspruch erzeugt oft ein ironisches Moment, wie
es Horaz beispielsweise in c. 4,2 vorführt: Nachdem er
gravitätischem Ton verkündet, Iullus Antonius solle aufgrund
seiner höheren, dichterischen Qualifikation (v. 33 maiore poeta
plectro) die Lobeshymne auf Augustus schreiben, fährt Horaz
genau damit fort. Tatsächlich kommt Horaz seiner Empfehlung an
Antonius schon zuvor, indem er den augusteischen Sieg über die
Sygamber (v. 33-36) sowie die deswegen veranlassten
Feierlichkeiten (v. 41-44) selbst beschreibt. Die Ironie wirkt
umso stärker, als der Horaz anschließend das kleine, von ihm
geopferte Kalb mit der von seinem Dichterkollegen
durchgeführten Hekatombe vergleicht (v. 53-56). Auch deutet
diese Ironie, wie C. Martindale kommentiert, in Verbindung mit
der, hinsichtlich Komplexität und Umfang, pindarischen
Verkleidung des Gedichts, eigentlich das Gegenteil seiner
Eigenschaften an: Nämlich die horazische Vorliebe für
Simplizität40.
Horaz verwendet also in seinen unterschiedlichen Werken
unterschiedliche Arten und Leitmotive von Witz und Ironie.
Natürlich an die Bedingungen und Konventionen der jeweiligen
Gattung geknüpft, treten in seinen Texten sowohl
zurechtweisende und kritische, als auch derbe und schmähende,
sowohl gutmütige und selbstironische wie auch
lebensphilosophische Tendenzen in der Erscheinungsform des
Komischen auf. Es ist dabei m. E. nicht auszuschließen, dass
Horaz auch in den Oden Ironie als Mittel zur - wenn auch
spielerischen oder augenzwinkernden - Kritik einsetzt. Dies
40 Vgl. Martindale 1993, 14f. Weitere Beispiele für die ironische Anwendungder recusatio in den Oden sieht Martindale in c. 1,6 und c. 4,1; siehe ebd.
21
gilt es, in den folgenden Einzelinterpretationen zu c. 2,20 und
c. 4,8 begründet herauszustellen.
II. 2. ingenio maximus arte rudis – Das Enniusbild bei Horaz
außerhalb der Oden
Im Sinne der Fragestellung erscheint es grundlegend, die
Meinung herauszustellen, welche Horaz über seinen Vorgänger
Ennius vertrat. Dazu werden zuerst solche Horaz-Stellen in den
Blick genommen, aus denen sich eine negative Beurteilung
erkennen lässt. Anschließend werden Textpassagen mit positiver
Aussage untersucht. Dabei gilt es stets zu prüfen, was genau
Horaz an der Dichtung des Ennius lobt, beziehungsweise tadelt
und in welchem Kontext die jeweiligen Textstellen stehen.
Deutliche, direkte Kritik an der künstlerischen Fähigkeit
des Ennius äußert Horaz in seiner ars poetica (259ff.):
nobilibus trimetris apparet rarus et Enni
(259)
in scaenam missos cum magno pondere versus 260
aut operae celeris nimium curaque carentis
aut ignoratae premit artis crimine turpi.
Während er über Struktur und Vorteile der Dichtung in
iambischem Versmaß reflektiert, bemängelt Horaz, dass dieses in
der schwerfälligen trimetrischen Dichtung (v. 260 cum magno
22
pondere versus) des Ennius nur selten zu finden sei. Als Gründe
dafür sieht er entweder eine überhastete Arbeitsweise oder
künstlerische Unkenntnis (v. 262 ignoratae … artis). Ähnliche
Kritik zeigt sich auch in serm. 1,10,54f. Hier legt Horaz die
Kritik an der ennianischen Verskunst Lucilius in den Mund, der
diese Verse wohl belächeln würde41. Besonders interessant für
die Beurteilung des Ennius erscheint epist. 2,1,50ff.:
Ennius, et sapiens et fortis et alter Homerus, 50
ut critici dicunt, +leviter+ curare videtur
quo promissa cadant et somnia Pythagorea.
Die auf den ersten Blick als überschwängliches Lob erscheinende
Passage erweist sich bei genauerem Hinsehen als eine deutliche
Distanzierung von Ennius42. Durch die Feststellung, die
wiedergegebenen Apostrophierungen des Ennius (sapiens et fortis et
alter Homerus, v.50) seien Meinung gewisser critici43, impliziert
Horaz, dass sich sein persönlicher Standpunkt davon abhebe.
Dazu kommt, dass Horaz sich gerade in diesem Teil der Epistel
gegen die herrschende Vorliebe des Volkes und eben jener
Kritiker wendet, nur die alten Dichter zu würdigen, während die
Zeitgenössischen abgewertet würden44. So halte die Dichtung des
Ennius, trotz der ihm zugestandenen Auszeichnungen, einer
professionellen und zeitgemäßen Kritik – eben der des Horaz –
nicht stand.41 Näheres siehe Prinzen 1998, 108f.42 Vgl. Prinzen 1998, 25243 ut critici dicunt, zur näheren Bestimmung der critici siehe Brink 1982, 97, Anm.51. Brink schlägt den Kreis der Grammatiker um Varro zur Identifikation dercritici vor, so auch schon Suerbaum 1968, 99, Anm. 315.44 Vgl. Suerbaum 1968, 99.
23
Auch lässt sich aus den Versen eine gewisse Beanstandung
der Selbstdarstellung des Ennius deuten. Obgleich der
anscheinend großen, seinen Nachruhm betreffenden
Selbstgewissheit des Ennius (leviter curare videtur, v.51)45, lässt es
Horaz eben offen, ob dieser seinem somnium Pythagoreum46 gerecht
wird.
Neben der Tadelung findet sich im Werk des Horaz jedoch
auch eine gewisse Anerkennung des Ennius. So würdigt Horaz in
ars 55ff. die geistige Begabung des Ennius, indem er dessen
sprachschöpferische Kraft hervorhebt47.
Eine weitere, deutliche Auszeichnung des Ennius ist in serm.
1,4,42ff. zu lesen. An dieser Stelle zitiert Horaz Verse aus
den annales, um ein Beispiel für vorbildliche Dichtung zu
geben48. Selbst bei der Auflösung des Metrums durch Umstellung
der Wörter bliebe die Begabung des wahren Poeten noch zu
erkennen (disiecti membra poetae, v.62). Horaz geht sogar noch
weiter, indem er – zumindest für seine Satirendichtung - auf
die Auszeichnung des poeta verzichtet. Diese stehe allein
demjenigen zu, der seiner gottbegnadeten Begabung (ingenium)
auch durch angemessene Sprache (verba) und Inhalt (res) Ausdruck
verleihen könne49. Ein solcher Dichter sei weder in der Gattung
der Komödie noch der Satire zu finden. Stattdessen werden die
45 Zur Deutungskontroverse dieser Stelle siehe Prinzen 1998, 253f.46 Gemeint ist die bereits erwähnte Traumszene Proömium der annales desEnnius, in welcher die Metempsychose der Seele Homers in die des Enniusdargestellt wird.47 ars 55ff.: Ego cur, adquirere pauca, si possum, inuideor, cum lingua Catonis et Enni sermonempatrium ditauerit et noua rerum nomina protulerit?48 Hor. serm. 1,4,60f. = Enn. ann. 225 (Sk): postquam discordia taetra belli ferratospostes portasque refregit.49 putes hunc esse poetam. ingenium cui sit, cui mens divinior atque os magna sonaturum (serm.1,4,42ff.) und weiter: acer spiritus ac vis […] verbis […] rebus inest (v. 46f.).
24
Enniusverse als paradigmatisch für das Werk eines wahren poeta
angeführt. Selbst wenn es an dieser Stelle, wie der klassische
Philologe Herbert Prinzen in seiner Untersuchung der antiken
Enniusrezeption bemerkt, primär darum gehe, den hohen Stil des
Epos im Kontrast zum niedrigen Stil von Komödie und Satire zu
charakterisieren, die Dichtungsgattung also Vorrang vor einem
bestimmten Dichter habe50, so muss doch auch Werner Suerbaum
recht gegeben werden, der in der Zitation eine „unleugbare
Auszeichnung für Ennius“ sieht, wenn Horaz gerade aus den
Annalen ein Beispiel für ein wahres poema zitieren würde51.
Ein weiteres wichtiges Zeugnis für die Beurteilung des
Ennius ist die epist. 1,19. Zwar erscheint die Behauptung
Horazens, Ennius habe nur in betrunkenem Zustand gedichtet,
zunächst als Beleidigung und Abwertung des vorklassischen
Dichters. Bei differenzierterer Analyse wird jedoch vielmehr
eine Würdigung deutlich. Frei nach dem Spruch des
Komödiendichters Kratinos, dass wahre Dichtung nur in
Verbindung mit ausreichendem Weinkonsum entstehen könne, weist
Horaz zu Beginn allen nüchternen Wassertrinkern (v. 3 aquae
potoribus; v. 9 siccis) die öffentlichen Tätigkeiten auf dem Forum
zu. Für die Liebhaber des Weines sieht er die Dichtung vor52.
Dabei ordnet er Ennius (und auch Homer) zu der Gruppe der
Weintrinker. Interessant wird es, wenn Horaz darauf beklagt,
dass in Folge seines Edikts nun viele moderne Dichterlinge und
Poetaster diese Verordnung zu wörtlich genommen hätten. Durch
50 Prinzen 1998, 249.51 Suerbaum 1968, 229.52 Prinzen 1998, 250, weist darauf hin, dass sich in der Aufteilung in Wein-und Wassertrinker auch die bereits erläuterte Unterschied zwischenkallimacheischen Kunstprinzip (ars) auf der einen, und dem dionysischen(ingenium) auf der anderen Seite offenbare.
25
unablässigen Alkoholkonsum glaubten sie, wahre Dichter werden
zu können. Dadurch könne aber nach Horaz mangelndes ingenium
nicht kompensiert werden53.
Nachdem Horaz nun aber neben Pater Ennius (v. 7) auch vinosus
Homer (v. 6) als exempla für weintrinkende Dichter genannt hat,
und sich selbst durch seinen Erlass ja auch mit dieser Gruppe
identifiziert, fällt es schwer, an eine Karikierung oder gar
Verurteilung der Dichter aufgrund ihres Weinkonsums zu denken.
Vielmehr scheint hier ein Unterschied zwischen Horaz und den
genannten exempla auf der einen und den ständig betrunkenen
Dichterlingen auf der anderen Seite betont zu werden. Es muss
also, wie W. Suerbaum bemerkt, zwischen zwei Gruppen von
Weintrinkern unterschieden werden54. Dabei verstehen die
modernen imitatores das horazische Gebot wortwörtlich als Dichten
im Zustand der „Betrunkenheit statt Trunkenheit“55. Dagegen
sollen Homer, Ennius und schließlich Horaz selbst einen
Dichtertypus darstellen, der sich vom (maßvollen) Weingenuss
inspirieren und zu dichterischem Enthusiasmus hinreißen
ließe56. Dabei müsse „Wein“ hier vielmehr als Metapher für das
ingenium des Dichters verstanden werden57. Fast scheint es, als
trete hier - wie auch schon in serm. 1,4 - die sonst für Horaz
so wichtige ars hinter die Bedeutung des ingenium zurück. Daraus
lässt sich folgern, dass die durch Wein (= ingenium)
inspirierte Dichtung des Ennius in gewisser Hinsicht einen
Vorbildcharakter für Horaz besitze58.53 Vgl. Prinzen 1998, 252.54 Suerbaum 1968, 232.55 Vgl. ebd.56 Prinzen 1998, 251.57 Vgl. Suerbaum 1968, 233.58 Vgl. Suerbaum 1968, 236. Zudem zählt sich Horaz in seinen Oden (besondersc. 2,19 und c. 3,25) selbst zu den Anhängern des Bacchus / Libers. Seine
26
Eine weitere Parallele zu Ennius findet sich in dem in der
Epistel vertretenen Anspruch des Horaz, ein alter Archilochus zu
sein59. Ennius auf der anderen Seite steht für die Einführung
des Versmaßes des Hexameters in die römische Literatur und die
Ablösung des Saturniers, welchen sowohl er wie auch Horaz
verachtete60.
Es stellt sich also nach Analyse der relevanten
Horazstellen ein Enniusbild heraus, das den Dichter zwar als
einen, mit göttlicher Begabung (ingenium) gesegneten Poeten
charakterisiert, der aber über mangelhafte künstlerisch-
dichterische Fertigkeiten (ars) wie zum Beispiel Metrik
verfügt. Obwohl die in der Überschrift zitierte Aussage über
den Dichter Ennius nicht von Horaz, sondern von dem etwas
jüngeren Ovid stammt61, hat also auch Horaz dem vorklassischen
Dichter gegenüber eine ähnlich ambivalente Meinung vertreten.
An einer Stelle billigt Horaz Ennius zumindest indirekt die
Auszeichnung des poeta zu62, während der Kunstbegriff, den er in
seiner ars poetica postuliert jedoch von einem sowohl durch
ingenium als auch durch ars sich auszeichnenden Dichter
ausgeht63.
Mit der Aufteilung der Voraussetzungen für einen
erfolgreichen Dichter in ingenium und ars gibt Horaz auch den
eigene Meinung im Bezug auf die richtige Kunstauffassung ist zwischen denbeiden Extrempositionen zu finden, vgl. ars, 410ff. So bedingen sich für ihnnatura (= ingenium) und ars des Dichters gegenseitig, beziehungsweise sindfüreinander unverzichtbar.59 So postuliert Horaz in epist. 1,19,23ff., er habe als Erster die durchArchilochus bekannten, parischen Iamben in lateinischer Sprache gebildetund somit nach Rom gebracht.60 Siehe Enn. ann. 206f. (Sk): versibus quos olim Faunei vatesque canebant sowie Hor.epist. 2,1,157f.: horridus ille […] numerus Saturnius.61 Ov. trist. 2, 424.62 Vgl. serm. 1,4,42ff.63 ars, 410ff.
27
Kontrast zwischen zwei verschiedenen Kunstauffassungen wieder:
Auf der einen Seite steht die dionysisch geprägte Vorstellung
vom Dichten im göttlichen Rausch, welcher dem ingenium des
Künstlers freien Gestaltungsraum lasse64. Auf der anderen Seite
vertritt das strenge Kunstprinzip des alexandrinischen Dichters
und Gelehrten Kallimachos die Auffassung, dass die ars des
Dichters bestimmend sei für sein Schaffen65.
Auch von der Selbstdarstellung des Ennius scheint sich
Horaz distanzieren zu wollen. Für ihn ist, wie H. Prinzen
kommentiert, Ennius kein alter Homerus66. Trotzdem muss Ennius von
Bedeutung für die Dichtung des Horaz gewesen zu sein, da er
gerade in solchen Passagen des Augusteers Erwähnung findet, in
denen dieser über seine eigene Dichtung reflektiert67.
II. 3. Dichterische Selbstdarstellung im Vergleich
II. 3. a) Ennius
Auf der Suche nach Szenen der Selbstdarstellung im Werk des
vorklassischen Dichters rückt gleich zu Beginn des Epos Annales
ein interessantes Beispiel in Augenschein. Im somnum Ennii
begegnet dem träumenden Dichter das Bild Homers und erklärt ihm
unter Einbeziehung der pythagoreischen Lehre von der
64 Bei Horaz am deutlichsten vertreten durch die „Weintrinker“ in epist.1,19.65 Vgl. Prinzen 1998, 250.66 Prinzen 1998, 255.67 Vgl. Suerbaum 1968, 227.
28
Seelenwanderung (metempsychose), dass seine, Homers, Seele in
den römischen Dichter übergegangen sei68.
Lässt man nun einmal die Implikationen und Assoziationen
des metempsychose-Motivs außer Acht, so stellt doch die
Tatsache, dass Ennius sich in der Einleitung seines
historischen Epos nicht etwa bloß als Nachfolger Homers sondern
als dieser selbst (homer redivivus) sieht, eine geradezu vor
Selbstbewusstsein strotzende, literarische Selbstauffassung
dar. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass es sowohl vor, als
auch nach Ennius kein Dichter gewagt hat, die gleiche Aussage
über sich selbst zu machen69. Bei der Frage nach der genauen
Intention des Dichters hinter einer solchen Selbstaussage
stehen viele Antwortmöglichkeiten offen70. Wichtig für diese
Untersuchung ist jedoch allein das in diesen Versen
ausgedrückte, dichterische Selbstbewusstsein des Ennius. Sowohl
für den eigenen dichterischen Anspruch, als auch die
Erwartungen des Publikums hätte Ennius mit der Gleichsetzung
seiner Person und der Person des Homers, welcher zu seiner Zeit
als größter Dichter überhaupt galt, den Maßstab nicht höher
anlegen können71.
Ein weiteres Fragment, das einen Einblick auf die
Selbstdarstellung des Ennius und das damit verbundene
Selbstbewusstsein des Dichters gewährt, ist das sogenannte
Grabepigramm72:68 Vgl. ann., 2ff.69 Suerbaum 1968, 103.70 Für eine ausführliche Auswertung der Szene siehe: ebd., 46-113.71 Wie schon die Handlung des Traumes vermuten lässt, bestand in der Antikenoch kein Zweifel an der Historizität der Person Homers.72 Zwar besteht für dieses Fragment der von Dahlmann geäußerte Verdacht,dass es evtl. von Varro fingiert worden ist. Die Mehrheit der Forscher aufdiesem Gebiet hält jedoch die Echtheit der Stelle für wahrscheinlich, vgl.hierzu Suerbaum 1968, 169, Anm. 515.
29
Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu
Faxit. Cur? Volito vivos per ora virum.73
Das im elegischen Distichon verfasste Epigramm zeigt einen
klaren Aufbau. Der für den Leser auf den ersten Blick paradoxen
Aussage des ersten Verses, welche durch das darauffolgende Cur
noch einmal unterstrichen wird, folgt die pointierte Auflösung.
Auch hier wird der Rezipient Zeuge eines ausgeprägten,
dichterischen Selbstbewusstseins. Ennius geht davon aus, dass
nach seinem Tod seine Dichtung fortbestehen wird, indem sie
weiterhin von vielen Menschen rezipiert wird74. In dieser
Überlegung wird die Trauer um den Verstorbenen letztlich
obsolet, da dieser ja durch seinen dichterischen Ruhm
literarische Unsterblichkeit erlangt75.
Deutet man, wie vielfach angenommen, das Grabepigramm als
Reaktion auf das von Gellius überlieferte Elogium seines
(Ennius) Vorgängers Naevius, dann wird die getroffene
Selbstaussage umso provokanter und umso selbstbewusster.
Immortales mortales si foret fas flere,
flerent divae Camenae Naevium poetam.76
73 Enn. frg. var. 17 (V).74 Sprichwörtlich: „von Mund zu Mund geht“. Das fliegende „Ich“ istzweifelsfrei mit der Dichtung des Ennius gleichzusetzen, volito vivos per oravirum.75 Vgl. Suerbaum 1968, 169.76 Gell. noct. att., 1,24,2.
30
Das ennianische Grabepigramm stellt somit die Steigerung der
überlieferten Selbstaussage des Naevius dar. Während Naevius
geradezu erwartet, dass sogar die Götter seinen Tod beklagen
würden, erklärt Ennius diesen Wunsch für unwichtig. Er
verdankt, seiner Meinung nach, die Unsterblichkeit allein
seiner Dichtung. Zwar lässt sich eine direkte Beziehung
zwischen den beiden Fragmenten nicht einwandfrei beweisen77.
Die Aufnahme und Verarbeitung des gleichen Motivs bei Ennius
legen doch zumindest einen gewissen intertextuellen Bezug der
beiden Texte in den Bereich des Wahrscheinlichen78.
Auch an dieser Stelle entwirft der Dichter also ein sehr
selbstbewusstes Bild von sich, das - wie es der anschließende
Vergleich illustrieren wird - dem horazischen Selbstkonzept
sehr fern scheint.
II. 3. b) Horaz
Um ein mögliches Bild von dem, in den Oden formulierten,
literarischen Selbstbewusstsein des Dichters Horaz zu
rekonstruieren, widmet sich die Untersuchung einer Stelle aus
der gemeinsam publizierten Edition der ersten drei Bücher und
einer Stelle aus dem vierten Buch. Beide Texte können zu diesem
Zwecke äußerst exemplarisch wahrgenommen werden. Zudem ist es
durch den längeren zeitlichen Abstand zwischen der Publikation
der ersten drei Bücher und des vierten Buches möglich, eine
profundere und weiter reichende Vorstellung von der
Selbstdarstellung des Horaz zu erhalten.77 So wäre es sicherlich auch möglich, dass Ennius sich hier nicht direktauf Naevius bezieht, sondern schlichtweg eine gängige Formulierungpointiert.78 Vgl. Suerbaum 1968, 168, Anm. 514.
31
Exegi monumentum aere perennius
regalique situ pyramidum altius,
quod non imber edax, non aquilo impotens
possit diruere aut innumerabilis
annorum series et fuga temporum.
5
non omnis moriar multaque pars mei
vitabit Libitinam : usque ego postera
crescam laude recens, dum Capitollium
scandet cum tacita virgine pontifex :
dicar, qua violens obstrepit Aufidus 10
et qua pauper aquae Daunus agrestium
regnavit populorum, ex humili potens
princeps Aeolium carmen ad Italos
deduxisse modos. sume superbiam
quaesitam meritis et mihi Delphica
15
lauro cinge volens, Melpomene, comam.
Im berühmten Epilog des dritten Odenbuches (c. 3,30) zeichnet
Horaz das Ergebnis und den Verdienst seiner bisherigen Dichtung
nach. Mit Sicherheit ist das Gedicht, wie Adolph Kiessling in
seinem Kommentar verzeichnet, als Gegenstück zum Anfangsstück
c. 1,1 zu deuten, wie auch das gleiche, asklepiadische Versmaß
nahe legt79. War die Haltung des Dichters zu Beginn seines
Werkes in der Ansprache an Maecenas noch von Bescheidenheit und
Erwartung geprägt, so sprechen aus den Versen des Epilogs nun
Selbstsicherheit und Stolz. Seine Dichtung wird zum Monument,
79 Vgl. Kiessling / Heinze 1955, 382. Dieses Metrum findet sich neben c. 1,1und c. 3,30 bei Horaz sonst nur in c. 4,8, siehe unten.
32
das materielle Denkmäler in ihrer Qualität zur Immortalisierung
des jeweiligen Empfängers bei weitem übertrifft (v. 2 perennius;
v. 3 altius). Aufgrund der nachhaltigen Wirkung seines Werkes
erreicht der Dichter also selbst Unsterblichkeit.
Und dennoch klingen auch in diesen stolzen Zeilen des
Selbstlobes gewisse Aspekte der von Horaz so gewohnten moderatio
an. Zum einen zeigt sich diese (selbst-)mäßigende Haltung in
der Erkenntnis des Dichters, dass nur ein Teil von ihm –
gemeint ist natürlich seine Dichtung – dem Tod entgehen wird
(v. 6f. non omnis moriar multaque par mei vitabit Libitinam). Hält man
diese Aussage dem besprochenen Grabepigramm des Ennius
entgegen, dessen Werk Horaz in seinem Epilog mit Sicherheit
verarbeitet hat80, so stellt sich doch ein großer Unterschied
in der Deutlichkeit der Formulierung heraus. Zwar postulieren
beide Dichter ihren Anspruch auf die Unsterblichkeit durch ihre
Dichtung. Horaz schlägt jedoch eine deutlich zurückhaltendere
Tonlage an. Während bei Ennius das Lebendige (volito vivus) im
Vordergrund steht, fokussiert Horaz zunächst den Tod (moriar;
Libitinam), dem er sich – trotz seiner Leistung – auch nur
teilweise (pars mei) entziehen kann.
Zum anderen zeigt sich die Bescheidenheit des Dichters in der
schlichten Darstellung seiner persönlichen Leistung. In etwas
mehr als einem Vers fasst Horaz das Programm der von ihm bis
dahin abgefassten 88 Gedichte auf knappe Weise zusammen (v.
13f. princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos). Die Darstellung
wirkt umso genügsamer, als dass sich der Dichter bloß als
verknüpfendes Medium zwischen griechischer Lyrik und römischer
80 Hierzu vor allem: Suerbaum 1968, 165ff.
33
Ausführung versteht. Seinen persönlichen Verdienst zeigt er als
bloße Zusammenführung schon vorhandener Elemente.
Trotzdem verbleibt Horaz im letzten Stück seiner drei
Gedichtbände natürlich in der stolzen Stimmung einer gewissen
Selbstzufriedenheit (v. 14f. superbiam quaesitam). Dabei scheint
der Dichter allerdings immer noch eine Legitimation für seine
Auszeichnung zu benötigen, wie meritis (v. 15) andeutet. Den
Preis, als poeta laureatus die Unsterblichkeit zu erlangen81, habe
er sich erst durch seine dichterischen Leistungen verdient.
Als zweite Stelle zur Untersuchung der Selbstdarstellung
des Horaz soll c. 4,2 in den Blick genommen werden. In dieser
Ode, bei der sich die Analyse auf die Verse 27-32 konzentriert,
setzt sich Horaz mit der Bedeutung der Dichtung für die
Unsterblichkeit des Besungenen auseinander. Nachdem Horaz die
Kunst seines griechischen Vorbildes Pindar, des Dircaeus cygnus
(v. 25), in den höchsten Tönen gelobt hat, kontrastiert er
dieses Bild mit einer Beschreibung seiner eigenen Arbeit:
ego apis Matinae
(27)
more modoque,
grata carpentis thyma per laborem
plurimum, circa nemus uvidique
30
Tiburis ripas operosa parvos
carmina fingo.
81 Die Bezeichnung des poeta laureatus ist im Übrigen eine Erfindung des Horazselbst, die sich an die Tradition des römischen Triumphators anlehnt, vgl.Kiessling / Heinze 1955, 385.
34
Im Gegensatz zu Pindar, der elegant und mühelos zugleich
Gedichte von ungekannter Qualität verfasst82, zeigt sich Horaz
als Dichter, der in akribischer Kleinstarbeit mühevoll neue
Gesänge formt. Das Tierbild der Biene ist dem Augusteer dabei
von mehrfachem Nutzen: Einerseits gelingt es ihm durch den
Vergleich seiner Kunst mit der angestrengten Arbeitsweise (v.
31 operosa) des Insektes, die im starken Kontrast mit der
vorangegangenen Beschreibung Pindars steht, den großen Respekt
vor seinem Vorgänger auszudrücken. Zudem zeigt der Bezug zur
Arbeitsweise aber auch die bereits in c. 3,30 angeklungene
Bescheidenheit des Dichters auf. Dies wird schon an der
Selbstcharakterisierung deutlich (v. 31 parvos = parvus). Den
qualitativen Unterschied zur Dichtkunst Pindars kann Horaz
seiner Meinung nach nur durch scharfe Disziplin und große
Sorgfalt in seiner Vorgehensweise ausgleichen. Gleichzeitig
dient die Biene Horaz aber auch als passendes Bild, um das von
ihm vertretene, kallimacheische Kunstprinzip zu verkörpern.
Neben der beschriebenen Arbeitsweise bildet die Biene - schon
aufgrund ihres Äußeren - die „Kleinheit der Form“ ab, der sich
Horaz mit seiner Dichtung verschrieben hat83.
Rufen wir uns an dieser Stelle noch einmal die thematisch
ähnliche Passage des Annalen-Proömiums bei Ennius ins
Gedächtnis – denn in beiden Stellen nehmen die Dichter Bezug
auf das Verhältnis zu einem, aus ihrer Sicht wichtigen Vorbild
–, so offenbart sich doch eine klare Diskrepanz in der
Ausgestaltung dieses Verhältnisses. Während Horaz nur mit82 vgl. c. 4,2,10-12: seu per audacis nova dithyrambos verba devolvit numerisque fertur legesolutis.83 Vgl. Warmuth 1992, 92. Auch ist der Vergleich zwischen Dichter und Bienenicht allzu ungewöhnlich, für Vorläufer siehe ders., 191, Anm. 370.
35
großer Mühe dem poetischen Niveau Pindars nahekommen kann84,
zeigt sich hingegen Ennius als der wiedergeborene Homer, dessen
Seele und implizit auch dessen literarische Fähigkeit in ihn
übergegangen sind. Die vor Selbstüberzeugung strotzende
Selbstdarstellung des Ennius scheint der des Horaz also
deutlich zu widersprechen. Zwar kennt die Letztere ebenfalls
den Stolz über und die Zufriedenheit mit dem Geleisteten, ist
aber zu jedem Zeitpunkt in einer bescheidenen Stimmung der
(Selbst-)Mäßigung gehalten.
II. 4. Intertextualität und ihre Bedeutung bei Horaz
Aufgrund der Tatsache, dass sich die These, die dieser
Untersuchung zu Grunde liegt, auf die Beziehungen
unterschiedlicher Texte zueinander konzentriert, erscheint es
unbedingt notwendig, Grundzüge der sog.
Intertextualitätstheorie darzustellen. Auch muss überprüft
werden, ob sich diese der modernen Philologie entstammende
Methodik überhaupt auf das Werk des Horaz adaptieren lässt.
Die Intertextualitätstheorie widmet sich der Untersuchung
des Verhältnisses von Texten zu anderen Texten und macht
Aussagen über dieses Verhältnis. Dabei sei jeder Text als
mosaique de citations zu verstehen, wie Julia Kristeva, eine der
Begründerinnen der Theorie, bemerkt85. Demnach besteht jeder
84 Die Vorstellung mit seinem Vorläufer in qualitativer Hinsichtgleichzuziehen oder diesen gar zu übertreffen, stellt sich für Horaz alsschiere Hybris dar, vgl. c. 4,2,1-4.85 Kristeva, J.: Σημειωτική. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969,85ff.
36
Text aus einem Bündel verschiedener Zitate, er ist ein
Kreuzungspunkt anderer Texte und Ausgangspunkt für deren
Permutation und Transformation (Umstellung und Umwandlung) unter
dem Einfluss seiner ideologischen Voraussetzungen. Dabei
umfasst der Begriff „Text“ nicht nur geschriebene Texte,
sondern kulturelle Phänomene überhaupt, insofern sie Elemente
einer Struktur sind. Ein solcher „Text“ ist somit nie eindeutig
definiert und fest umrissen sondern offen für Interpretationen,
von denen keine ultimative Geltung beanspruchen kann. Bedeutung
kann damit nicht mehr von einem Autor bzw. Schöpfer in einen
Text hineingelegt werden, sondern wird erst von der
Interpretation hervorgebracht, wobei der Interpret seinen
eigenen Text natürlich genauso wenig kontrollieren kann wie der
Verfasser des Ausgangstextes. Auf diese Weise gestaltet sich
der Prozess der Semiose prinzipiell unendlich, ein Standpunkt
außerhalb des Textes wird unmöglich. Eine erste, wichtige
Systematisierung ihrer Begrifflichkeit erfuhr die
Intertextualitätstheorie schließlich durch Gérard Genette.
Zudem gab dieser die von Kristeva geforderte Universalität von
Intertextualität auf und legte stattdessen verschiedene
Kategorien für diese fest86.
Nun bliebe in unserem Fall einzuwenden, dass gerade die
lateinische Literatur nach Genette quasi von Natur aus eine
Literatur zweiter Stufe sei, da sie einerseits mit der
griechischen Literatur verwandt sei, oder aber sich stark an
diese anlehne. Die Klassische Philologie beschäftige sich also
ohnehin schon mit der Analyse des Verhältnisses dieser Texte86 Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, Frankfurt amMain 1993.
37
untereinander. Dennoch bietet die moderne
Intertextualitätstheorie eine neue, systematische Methodik zum
Verständnis von Texten. Besonders entscheidend ist hier die
klare Definition des Unterschiedes von Intertextualität von
Texten und Textgruppen87 und Allusion, die schon von antiken
Philologen intensiv untersucht worden ist. Während sich bei der
Allusion eine Anspielung auf der privaten Ebene des Verfassers
entwickle, sei hingegen die Intertextualität öffentlicher
Natur, weil sie auch dem Publikum zugänglich ist88.
Intertextualität kann also nur dort bestehen, wo die
Rezipienten diese auch erkennen.
Folglich ist die Bedeutung der Intertextualität als
„unverzichtbarer, ja sogar sinnstiftender Bestandteil eines
literarischen Textes“89 auch für das horazische Opus sehr groß.
Zum einen gibt Horaz selbst an, Werke und Gattungen aus der
griechischen Dichtung ins Lateinische übertragen zu haben90. Er
stellt auch negative Bezüge zu anderen Autoren her, indem er an
der mangelhaften formalen Qualität älterer römischer Dichter
Kritik übt91. Zum anderen ist für das zeitgenössische Publikum,
an welches sich die Dichtung des Horaz primär richtete,
anzunehmen, dass intertextuelle Phänomene erkannt worden sind.
Dafür spricht zunächst das Faktum, dass die Texte üblicherweise
in Lesezirkeln präsentiert und diskutiert wurden, dessen
Mitglieder wohl genaue Kenntnis der griechischen und87 Vgl. Breuer 2009, 45.88 Vgl. Fowler, D.: On the Shoulders of Giants. Intertextuality andClassical Studies, in: Materiali e discussioni per l'analisi dei testiclassici, 1997, Issue 39, S. 13-34.89 So Breuer 2009, 46.90 Zum Beispiel in c. 3,30,13f.: princeps Aeolium carmen ad Italos deduxisse modos;epist. 1,19,23ff.: Parios ego primus iambos ostendi Latio, numeros animosque secutusArchilochi, non res et agentia uerba Lycamben.91 So in sat. 1,4,8ff.; sat. 1,10,56ff.; epist. 2,1,64ff.
38
lateinischen Literatur besaßen92. Des Weiteren scheint auch der
rege Austausch und die Freundschaft mit anderen Dichtern als
Basis der horazischen Dichtung gedient zu haben93. Abgesehen
von diesem eher exklusiven Kernpublikum ist aber auch zu
beachten, dass es zur Schulpraxis der augusteischen Zeit
gehörte, längere Passagen der Literatur auswendig lernen zu
lassen, wie D. Gall bemerkt94. Somit könnte auch einer
breiteren Gruppe von Rezipienten die Identifikation
intertextueller Bezüge in der Dichtung des Horaz gewesen sein.
Wir können abschließend also davon ausgehen, dass Horaz in
seiner literarischen Produktion gezielt Bezüge zu anderen
Autoren hergestellt hat und dass zumindest ein Teil seines
Publikums diese Bezüge auch erkannte und das horazische Werk
vor diesem Hintergrund beurteilt hat. Es muss sich jedoch um
spezifische und prägnante Bezüge handeln, damit von einer
tatsächlichen Intertextualität gesprochen werden kann95. Im
Verlauf der folgenden Untersuchung sollen derartige
Zusammenhänge zwischen den Texten des Ennius und denen des
Horaz herausgestellt werden. Gleichzeitig ist es für die
Bestätigung der These unerlässlich, zu zeigen, dass diese
Zusammenhänge von Horaz gezielt konstruiert worden sind.
92 Das belegt vor allem die häufige Widmung und Apostrophierunghochgestellter Persönlichkeiten und Kunstkenner, bei denen ein solchesWissen wohl vorausgesetzt werden darf. So z. B. Augustus (epist. 2,1),Maecenas (c. 1,1; sat. 1,1 ; epist. 1,1), Asinius Pollio (sat. 1,10,85; c. 2,1)und Tibull (c. 1,3; epist. 1,4).93 Vgl. sat. 1,5,39f.; sat. 1,10,81ff.94 Vgl. Gall, D.: Die Literatur in der Zeit des Augustus, Darmstadt 2006,24.95 Pfister, M.: Konzepte der Intertextualität, in: Broich, V. u. Pfister, M.(Hrsg.): Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien,(Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft 35), Tübingen 1985, 1-30,15ff.
39
III. Einzelinterpretationen
III. 1. Daedaleo notior Icaro - Aemulatio als Hybris in c. 2,20
III. 1. a) Inhalt und vordergründige Intention
Der Gedanke der Unsterblichkeit durch literarischen Nachruhm
tritt in c. 2,20 auf interessante Weise in Erscheinung. Horaz
benutzt hier das Motiv der Metamorphose zur Verkündung seines
Anspruches auf ewigen Ruhm. In dem Gedicht verwandelt sich die
Person des Dichters vor ihrem Tod in einen Schwan, der
daraufhin die Welt bis hin zu entfernten Gebieten überfliegt,
während deren Bewohner ihn kennenlernen. Deswegen, so verordnet
der Dichter, sei es unnötig, nach dem Ende seiner menschlichen,
irdischen Existenz, um ihn zu trauern.
Als Intention des Gedichts wurde in der Forschung vor
allem die Erklärung des Dichters gesehen, dass er sich des
unvergänglichen Ruhmes, welchen er durch seine Dichtung
erwerbe, auch nach seinem Tod gewiss sei96. Schon in
spätantiken Horaz-Scholien, welche fälschlicherweise dem
römischen Grammatiker Helenius Acro zugeschrieben wurden,96 So vor allem Kiessling 1955, 244, sowie Nisbet 1978, 332. Eine ähnlicheAuffassung vertreten auch Abel 1961, 83f. und Schwinge 1965, 459.
40
deutete man die Verwandlung in einen Schwan als Zeichen für
dichterische Immortalität, aufgrund dessen wohlklingender
Stimme und seiner Verbindung zum Gott Apoll97.
III. 1. b) Ursprung und Vorläufer des Verwandlungsmotivs
Es ist ebenso festgestellt worden, dass sich Horaz mit dem
verwendeten Motiv der Metamorphose in einen Vogel in eine lange
dichterische Tradition stellt98. So hatten bereits die
archaischen griechischen Dichter Alkman99 und Theognis100 zur
Darstellung literarischen Ruhmes auf eine ähnliche Flug-
Metaphorik zurückgegriffen. Pindar charakterisierte zum einen
seine Dichtung als „geflügeltes Werk“101, zum anderen versah er
aber auch den in seinen Hymnen gepriesenen Personen gerne
Flügel102 und stellte bisweilen sogar sich selbst als Vogelwesen
dar103.
Als erster lateinischer Vertreter, der sich zu gleichem
Zwecke des Vogelmotivs bedient, gilt schließlich Quintus
Ennius104. In seinem bereits besprochenen Grabepigramm knüpft97 Vgl. Pseudo-Acro, 2,20: „Allegoricos significat se in cygni figuram mutandum et carminasua totum orbem impletura; unde et se immortalem futurum promittit. Avis enim, in quam setransfigurandum dicit, canora est, ut poetae merito conveniat, et Apollin consecrata”.98 Vgl. Nisbet 1978, 334.99 Alkman 148 = Aristides, orat. 28,54. Auch wenn Alkman das Fliegen nichtdirekt erwähnt, so wird doch aus dem Kontext deutlich, dass hier einähnlicher Anspruch wie bei Horaz postuliert wird, Näheres vgl. Nisbet 1978,332f.100 Theognis, frg. 237-254. Theognis behauptet, dass er seinem GeliebtemKyrnos durch seine Lobpreisungen „Flügel“ (πτέρα) verliehen und ihn somitunvergesslich gemacht habe.101 Pindar, isth. 5,63: πτερόεντα […] ύμνον, siehe auch: Pindar, nem. 7,22.102 Pindar, pyth. 8,33f.103 Als Adler, Pindar, nem. 3,80f.; als Biene, Pindar, pyth. 10,53f.Allerdings bemerkt Nisbet, dass oft nicht eindeutig geklärt ist, ob andieser Stelle der Dichter oder der im Lied Gepriesene gemeint sind, vgl.Nisbet 1978, 334f.104 Vgl. Schwinge 1965, 440.
41
der vorklassische Dichter an seine griechischen Vorläufer an,
indem auch er mit der Metapher des Vogelfluges auf
Unsterblichkeit verweisen will105. Jedoch unterscheidet sich
Ennius von seinen Vorgängern, da er, so E. R. Schwinge in
seiner Interpretation, das Motiv erstmals auf seinen
persönlichen dichterischen Anspruch beziehe106.
In einer weiteren, ebenfalls bereits angesprochenen Stelle
seines Werkes, dem Proömium des historischen Epos annales,
beschreibt Ennius zum Zwecke der Postulierung seines
dichterischen Anspruchs den Übergang der Seele Homers in seine
eigene Person107. Eine Art Zwischenstation für diese
Metempsychose soll dabei ein Pfau gewesen sein. Auch hier
spielen zum einen die Verwandlung in einen Vogel, zum anderen
die Demonstration literarischer Verbundenheit mit einem für den
Autor wichtigen, als dichterisches Vorbild empfundenen
Vorgänger, eine entscheidende Rolle für die Charakterisierung
des dichterischen Selbstverständnisses. Dass nun für Horaz vor
allem die genannten Enniusstellen als Prätexte aufgefasst
werden müssen, ist in der wissenschaftlichen Diskussion
weitgehend akzeptiert108.
III. 1. c) Deutungskontroverse
Bei der inhaltlichen Betrachtung der Ode 2,20 hat gerade die
Deutung der Metamorphose, welcher schon aufgrund ihrer Stellung
in der Mitte des Gedichts eine zentrale Bedeutung zukommt, eine
105 Ennius, frg. var. 17 (V): nemo me lacrimis decoret nec funera fletu faxit. cur? volito vivosper ora virum.106 Vgl. Schwinge 1965, 441.107 Vgl. Ennius, ann. 2-8 (Sk).108 Vgl. Kiessling 1955, 244, sowie auch Nisbet 1978, 336.
42
Kontroverse ausgelöst. Die bizarre, detailliert beschriebene
Verwandlung des Dichters in einen Schwan wird als paradox zum
durchaus ernsthaften Thema des Gedichtes, eben der Postulierung
ewigen Nachruhmes, empfunden.
Zudem schwingen auch in der Wortwahl des Horaz gewisse
Widersprüchlichkeiten mit der stolzen Aussage über das
dichterische Selbstbewusstsein an. Schon T. E. Page äußerte
deswegen in seiner Horaz-Edition Kritik und sprach dem Gedicht
die Qualität des restlichen horazischen Oeuvres ab109. In der
Folge kritisierte besonders E. Fraenkel den angesprochenen
inhaltlichen Widerspruch110. Hinzu komme außerdem die
Lächerlichkeit einer bildhaften Darstellung der Verwandlung des
den Römern als plump und kahlköpfig bekannten Horaz in den
edlen Körper eines Schwans111. H. Fuchs ging sogar soweit, der
dritten Strophe, in welcher die Metamorphose beschrieben wird,
die Echtheit abzusprechen und sie aus dem Gedicht zu
verbannen112.
Im Gegensatz dazu fasst W. R. Johnson das Gedicht als
horazischen Scherz auf. Zum einen weise die, aus dem Fehlen
jeglicher, sonst von Horaz so gewohnten moderatio und die aus
der Überspannung des Verwandlungsmotivs resultierende,
offensichtliche Prahlerei des Gedichts auf eine apotropäische
Parodie früherer Dichter hin, die ihren Nachruhm auf eben
109 Horatii Flacci Carminum Libri IV, edit. T. E. Page, London 1895, 295:„the whole ode […] clearly bears the stamp of having been writtencarelessly or before Horace’s powers had reached maturity”.110 Fraenkel, E.: Horace, Oxford 1957, 301: „the lofty idea of thetransfigured vates leaves no room fort he crude zoological precision inresidunt cruribus pelles“.111 Ebd.112 Fuchs, H.: „O Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein“. ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ, in:Edgar Salin zum 70. Geburtstag, Tübingen 1962, 149-166, 152ff.
43
solche Weise darstellten113. Zum anderen könne die in c. 2,20
dargestellte Extravaganz als Kontrastfolie zum stolzen decorum
in c. 3,30 funktionieren und somit das stolze aber dennoch
maßvolle Aufzeigen der dichterischen Verdienste dort, durch
ironische Präsentation des Gegenteils hier, unterstreichen114.
Auch der britische Horazkommentator Robin G. M. Nisbet
gesteht, zumindest in dem inhaltlichen Widerspruch einen
„ironischen Unterton der Selbstschmälerung“ zu erkennen115. Als
Basis der Metamorphose identifiziert Peter Connor nicht etwa
eine selbstzufriedene Aussage über die persönlichen
dichterischen Errungenschaften, wie es an solch prominenter
Stelle im Epilog des zweiten Buches durchaus zu erwarten wäre.
Stattdessen provoziere der schiefe Ton des Humors eine
säuerliche Atmosphäre sowie eine aggressive Wahrnehmung der
dichterischen Ziele und Sehnsüchte116. Weitergehend erkennt
David A. West in c. 2,20 das Bemühen des Horaz, das Risiko
eines anmaßenden Vergleiches mit Pindar, welchen Horaz selbst
in c. 4,2,1-4 als Hybris charakterisieren wird, durch das
Stilmittel der Ironie zu vermeiden, bzw. erträglich zu
machen117. Einen ähnlichen Gedanken verfolgt der Latinist Mario
113 „But Horace evades all “so to speaks“ and all transitions – what wassimile in Theognis, Ennius and Vergil is here stark metaphor“, Johnson, W.R.: The boastful bird. Notes on horatian modesty, in: CJ 61, 1966, 272-275,273.114 Vgl. Johnson 1966, 275.115 Vgl. Nisbet 1978, 337; Humor in c. 2,20 vermuteten auch schon Oesterlen,T.: Komik und Humor bei Horaz, Stuttgart 1886, 35ff.; Connelly, C. Enemiesof promise, London 1951, 51; MacKay, L. A.: Horace airborne. Exercise onOdes 2,20, in: Arion 3, no. 4, 1964, 125.116 „It seems rather to be an aggressive sense of the poet’s aims or desiresand a sourness is hinted at by the wryness of the humour”, Connor, P.:Horace’s lyric poetry. The force of humour, Berwick 1987, 7.117 Vgl. West 1998, 145, so auch Günther, der in der Verwandlung eine„heimliche Ironie“ des Dichters bemerkt, vgl. Günther, H.-C.: Pindar,Kallimachos und Horaz, in SIFC, Serie 17, 1999, 145-161, 160.
44
Erasmo von der University of Georgia. Allerdings versucht
Erasmo zusätzlich die enge Verbindung des Verwandlungsmotivs
zum Annalen-Proömium des Ennius herauszustellen. Während Ennius
durch das Mittel der Seelenwanderung (metempsychose) die
tatsächliche Identität Homers annehme, verwandele sich Horaz
bloß in die symbolische Identität Pindars. So scheine es, als
ob Horaz und Pindar in Bezug auf die Nachwelt auch gemeinsam
fortexistieren könnten, Ennius sich jedoch als Homer darstelle
und somit auch seinen Platz in der Erinnerung der Nachwelt
einnehmen würde118 119.
III. 1. d) Unsterblichkeitsgedanke und Lächerlichkeit
Im Rahmen der Suche nach ironischen Tendenzen im Verhältnis
zwischen Horaz und Ennius innerhalb der Oden müssen die in c.
2,20 bestehenden inhaltlichen und interpretatorischen
Widersprüche einen geeigneten Ansatzpunkt für unsere
Untersuchung darstellen. Es ergibt sich daraus die folgende
Fragestellung: Lässt sich aus der Verbindung zwischen dem
durchaus ernsthaften und sublimen Thema des Gedichts von der
Unsterblichkeit durch literarischen Ruhm auf der einen Seite,
welches wiederum eng mit der bekannten Ennius-Vorlage verknüpft
ist, und den „selbstschmälernden“ Tendenzen der Verse, mit
denen sich der Dichter der Lächerlichkeit preiszugeben scheint,
auf der anderen Seite, der Schluss ziehen, Horaz habe mittels
der intertextuellen Bezüge anstatt einer Huldigung des Ennius
118 Vgl. Erasmo 2006, 373.119 Besonderen Fokus auf die Metapher des Schwans legt Warmuth, derbesonders einen autobiographischen Aspekt der Verwandlung herauszustellenversucht, vgl. Wahrmuth, G.: Autobiographische Tierbilder bei Horaz,Hildesheim 1992, 88.
45
vielmehr eine ironische Wiedergabe seines literarischen
Vorläufers und dessen dichterischen Selbstverständnisses
bezwecken wollen?
Aufgrund der zahlreichen bereits existierenden
Untersuchungen des Gedichts, wird sich die folgende
Interpretation vordergründig der Suche nach den beschriebenen
ironischen Tendenzen im Zusammenhang mit den Prätexten widmen.
Auf andere Aspekte der Ode kann in diesem Fall nur verwiesen
werden.
III. 1. e) Einzelinterpretation c. 2,20
Die Ode bildet den Abschluss des zweiten Odenbuches. Sie
besteht aus 24 Versen aufgeteilt in sechs Strophen. Als Versmaß
verwendet Horaz die alkäische Strophe. Betrachtet man den
eingangs beschriebenen Inhalt des Gedichtes, so lässt es sich
in Einleitung (Strophe I und II), Mittelteil (Strophe III, IV
und V) und Schluss (Strophe VI) gliedern120. Das Gedicht ist
Horazens Freund und Unterstützer Maecenas gewidmet:
Non usitata nec tenui ferar
penna biformis per liquidum aethera
vates neque in terris morabor
longius invidiaque maior
urbis relinquam. non ego pauperum 5
120 Vgl. Abel 1961, 90.
46
sanguis parentum, non ego quem vocas,
dilecte Maecenas, obibo
nec Stygia cohibebor unda.
In der Einleitung wird zunächst das Motiv der Unsterblichkeit
des Dichters vorgestellt (neque … morabor, v.3; non … obibo nec
Stygia cohibebor unda, v.6ff.). In der Art und Weise der
Immortalität (ferar penna … per liquidum aethera, v.1ff.) wird der
erste Bezug zum Grabepigramm des Ennius deutlich121.
Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu
faxit. cur? volito vivos per ora virum.122
Im Gegensatz zu Ennius entzieht sich Horaz jedoch der den
Menschen zugänglichen Sphäre, während er allerdings für sie
sichtbar bleibt (und hörbar wie die folgende Metapher des
Schwans andeutet). Außerdem wird aus der Verwendung des Futurs
deutlich, dass der Dichter eine Erwartung beschreibt. Ennius
hingegen sieht seinen Erfolg aufgrund des Präsensgebrauches
bereits als Faktum an.
Horaz charakterisiert sich selbst als biformis vates (v.2f.).
E. R. Schwinge interpretiert biformis nicht als äußerliche
Doppelgestalt des Dichters, oder als Vorahnung auf die folgende
Metamorphose, sondern als die innerliche Zweiheit in „irdisches121 Jedoch übernimmt Horaz, anders als Vergil in Verg. georg. 3,9, nur dieinhaltliche Thematik, nicht die Sprache der Ennius-Vorlage. Zudem meintSchwinge in per liquidum aethera eine Intertextualität zu Euripides, fr. 911 N²zu erkennen, vgl. Schwinge 1965, 441. Das Motiv der tragenden Schwinge alsSymbol für den Nachruhm erinnert auch an Theognis, fr. 237-254. DieseMetaphorik findet sich bei Horaz zum gleichen Zweck auch in c. 2,2,7f. undc. 3,2,21-21.122 Enn. fr. var. 17 (V).
47
und überirdisches Ich“123. Anders als Ennius, der sein Fortleben
für selbsterklärend hält, versuche Horaz, so Schwinge, seine
Unsterblichkeit durch die Aufteilung seines Wesens in einen
vergänglichen (körperlichen) und einen unvergänglichen
(geistigen) Teil zu erklären124. Voraussetzung dafür sei der
Status des vates, welcher ein klar definiertes Bild des
augusteischen Dichters impliziere125. Eine Unterstützung der
Verbindung der ersten beiden Strophen findet sich im
Enjambement von Vers 4 zu Vers 5.
iam iam residunt cruribus asperae
(9)
pelles et album mutor in alitem 10
superne, nascunturque leves
per digitos umerosque plumae.
iam Daedaleo notior Icaro
visam gementis litora Bosphori
Syrtisque Gaetulas canorus 15
ales Hyberboreosque campos;
me Colchus et qui dissimulat metum
Marsae cohortis Dacus et ultimi
noscent Geloni, me peritus
discet Hiber Rhodanique potor. 20
123 Schwinge 1965, 442. Gestützt wird diese These dadurch, dass Horaz seinSelbst auch an anderer Stelle als aus vielen Teilen zusammengesetztversteht, vgl. c. 3,30,6f (multa pars mei). Ähnlich auch Ovid, amor. 1,15,41f.124 Vgl. Schwinge 1965, 442.125 Zum vates-Ideal in augusteeischer Zeit vgl. ders.: Zur Kunsttheorie desHoraz, in: Philologus 107, 75-96, 87ff.
48
Der Mittelteil des Gedichtes ist durch das Motiv der
Schwanenmetamorphose gekennzeichnet. Im Kontrast zur „Höhenlage
des Stils“ der ersten beiden Strophen126 folgt nun die bildliche
Beschreibung der Verwandlung des Dichters in einen Schwan
(album mutor in alitem, v.10)127. Der Bruch zum Anfang der Ode
zeichnet sich auch durch einen Tempuswechsel in ein von der
Anadiplosis iam iam (v.9) noch verstärktes Präsens ab128. Kritik
erfuhr das Gedicht vor allem aufgrund der dritten Strophe, in
welcher die Verwandlung des Körpers eindringlich beschrieben
wird (residunt cruribus asperae, v.9; nascunturque leves per digitos
umerosque plumae, v.11f)129. Es war die als unschön empfundene
Detailliertheit dieser Beschreibung, die Wissenschaftler wie H.
Fuchs zu der Aussage veranlasste, die dritte Strophe stelle
eine „Verunzierung“ des horazischen Werkes dar130. Auch die
bildliche Vorstellung, wie sich Horazens Körpers, der den
Zeitgenossen als füllig und kahlköpfig bekannt war, in die
grazile Gestalt eines Schwanes verwandelt, muss den Rezipienten
grotesk anmuten.
Um dieses Problem zu lösen, haben sich diverse
Interpretatoren des Gedichts auf das oben erwähnte biformis
berufen. Der anschließende Schwanenflug beziehe sich, wie Hans
Peter Syndikus kommentiert, nicht mehr auf die persona des
Horaz, sondern allein auf seine Dichtung. Dies ließe sich durch
den Gebrauch der Verben noscere (v.19) und discere (v.20) im
folgenden Mittelteil des Gedichts stützen, mit denen die126 Abel 1961, 84.127 Dass der albus ales als Schwan zu identifizieren ist, wird im Zusammenhangmit dem folgenden canorus (v.15) sowie der mit dem Schwan assoziiertenBedeutung als Vogel Apollos offensichtlich.128 So auch durch iam (v.13).129 Siehe Anm. 18 u. Anm. 19, S. 3.130 Vgl. Schwinge 1965, 447, Anm. 3.
49
Wahrnehmung des Flugs durch die Menschen beschrieben wird, die
offensichtlich eine literarische Auseinandersetzung dieser
Menschen mit Horaz andeuten131.
Jedoch ergibt sich aus diesem Erklärungsversuch m. E. ein
Widerspruch mit den Angaben, die Horaz in der zweiten Strophe
zu seiner Person macht. Mit dem Verweis auf seine niedrige
Abstammung (pauperum sanguis parentum, v.5f.) und die enge
Freundschaft zu Maecenas (quem vocas, dilecte Maecenas, v.7)
zeichnet Horaz zwei für seine Selbstdarstellung äußerst
wichtige Punkte seines Lebenslaufes nach, die er an markanten
Stellen seiner Dichtung immer wieder hervorhebt132. Horaz
spricht hier also sehr wohl von seinem physischen Selbst. Dies
lässt sich auch durch ego (v.6) unterstreichen. Insofern muss
auch biformis (v.2) wortwörtlich im Sinne einer tatsächlichen
Doppelgestalt zwischen Sänger und Schwan verstanden werden.
Eine transzendente innerliche Zweiheit, wie Schwinge und
Syndikus sie vorschlagen, wäre mit den Charaktermerkmalen,
welche Horaz von sich zeigt, nicht vereinbar. Zusätzlich stände
eine solche Deutung in krassem Kontrast zu der detaillierten
Beschreibung der physischen Verwandlung in der dritten Strophe.
Der Widerspruch zwischen dem Inhalt und der Thematik des
Gedichts lässt sich auf diese Weise also nicht lösen.
In der vierten Strophe charakterisiert sich der Dichter
als Daedaleo notior Icaro (v.13). Inhaltlich fungiert diese
Beschreibung als vorgezogene Folge des anschließend
beschriebenen Höhenfluges des verwandelten Dichters zu vielen
entfernt gelegenen Völkern und Gegenden. Diese scheinen131 Vgl. Syndikus 1972, 488f.132 Über seine niedrige Abstammung spricht Horaz auch in sat. 1,6,6 u. 45f.;c. 3,30,12; epist. 1,20,20. Maecenas wird apostrophiert in sat. 1,1; c. 1,1;epist. 1,1.
50
stellvertretend für die vier Himmelsrichtungen zu stehen, so
dass Horaz schließlich den gesamten orbis terrarum überfliegt133.
Bei der Interpretation der Selbstzuschreibung Horazens,
bekannter als Ikarus zu sein, fällt jedoch folgende
Widersprüchlichkeit auf: Zunächst benutzt der Dichter die
mythologische Figur des Ikarus hier als Metapher, um sich
selbst darzustellen. Fasst man notior Icaro als einen in der hohen
Dichtung der Zeit des Horaz äußerst gängigen ablativus comparativus
auf134, so ergibt sich für das Subjekt (in diesem Fall Horaz)
eine Übersteigerung des Objekts Icaro in der Eigenschaft notior,
die auch schon beim Objekt vorhanden gewesen ist. Nun sind aber
maßlose Selbstüberschätzung und das daraus folgende Scheitern
die Eigenschaften, welche den mythologischen Ikarus bekannt
gemacht haben. Es bestünde natürlich die Möglichkeit, dass
Horaz bloß den zukünftigen Bekanntheitsgrad seiner Person
andeuten will und dabei die inhaltliche Bedeutung des Mythos
außer Acht lässt135. Dem ist jedoch einzuwenden, dass jeder
sonstige Bezug zum Ikarusmythos, den Horaz innerhalb der Oden
herstellt, mit einer deutlich negativen Konnotation versehen
ist136. Zudem bliebe die Frage, warum Horaz - ginge es ihm
einzig um den Ruhm - gerade diesen Mythos zum Vergleich gewählt
hat.
133 Vgl. Schwinge 1965, 457. Dabei steht hyperboreosque campos (v.16) fürNorden, Syrtisque Gaetulas (v.15) für Süden, Hiber Rhodanique (v.20) für Westen undColchus et … Dacus et … Geloni (v.17ff.) für Osten.134 Vgl. Nisbet 1978, 344, siehe auch c. 1,24,13; c. 3,9,8; Ov. trist. 3,4,21.Daher muss auch von der durch Bentley vorgeschlagenen Konjektur tutiorabgesehen werden, weil Ikarus in einem solchen Fall bereits als tutusgegolten hätte, was in Anbetracht seines Schicksals jedoch wenig Sinnergäbe.135 So Breuer 2009, 77, Anm. 38.136 c. 1,3,34f.; c. 4,2,1-4. Diese Stellen werden im Folgenden noch genauererläutert.
51
Es ist also durchaus anzunehmen, dass sich Horaz auch in
c. 2,20 nicht allein auf den Bekanntheitsgrad des Ikarus
bezieht, sondern ebenso auf dessen Hybris anspielt, die
letztlich für sein Schicksal verantwortlich war. Das impliziert
jedoch für die eigentliche Aussage des Horaz, dass auch er für
sein Scheitern bekannt sein wird und dass die Ausmaße dieses
Scheiterns das Schicksal des Ikarus sogar noch übertreffen
werden. Wir stoßen hier auf einen weiteren inhaltlichen Punkt,
der mit der Thematik des Gedichts von der Verkündung des
eigenen Nachruhmes nach genauerer Beurteilung nicht vereinbar
ist. Besinnen wir uns zurück auf die Fragestellung und
versuchen die angesprochenen Stellen ironisch zu deuten, lassen
sich die Widersprüchlichkeiten aufheben, wie in der Folge
gezeigt werden soll.
In der ansonsten sehr gründlichen Interpretation von Schwinge
wird die Frage nach der Verwendung des Ikarusmythos leider
vernachlässigt, bzw. nur unbefriedigend beantwortet137. Nisbet
bemerkt in seinem Kommentar immerhin den „schwierigen Umstand“,
dass Ikarus mehr für seinen Fall als für seinen Flug berühmt
gewesen sei, was ihn einen ironischen Unterton des Gedichts
feststellen lässt138. Hinzu komme, dass notus auch häufig in der
Bedeutung von „berüchtigt“ gebraucht werde. Dennoch müsse der
Vers insgesamt als ernsthaft aufgefasst werden, was dem137 So sieht Schwinge in notior eine Abgrenzung des Horaz von Ikarus unddessen Scheitern. Horaz sei bekannter, weil er nicht wie Ikarus als Mensch,sondern wie Pindar als „göttlich begnadeter vates“ fliege, für den dieNaturgesetze ihre Gültigkeit verloren hätten, Schwinge 1965, 451. Zwarfasst Breuer in seiner Analyse mythologischer Motive in den Oden dieVerwendung des Ikarusmythos in c. 1,3,34f. und c. 4,2,1-4 als Verweis aufdie menschliche und oder dichterische Hybris auf. In c. 2,20 spiele dieinhaltliche Bedeutung und der damit verknüpfte Symbolcharakter des Ikarusjedoch keine Rolle, vgl. Breuer 2009, 74ff.138 Nisbet 1978, 344, „Horace is wryly aware of the danger of appealing tothe general judgement of mankind”.
52
Gedanken an eine Ironie dichterischer Selbstdarstellung
widerspräche139.
Dagegen muss jedoch angebracht werden, dass Horaz später
in c. 4,2,1-4 das gleiche Motiv benutzt hat, um den Versuch,
auf literarischer Ebene Pindar gleichzukommen, als vergebliches
Unternehmen darzustellen140:
Pindarum quisquis studet aemulari,
Iulle, ceratis ope Daedalea
nititur pinnis, vitreo daturus
nomina ponto. (4)
Die Hybris des Ikarus wird hier deutlich mit der Gefahr
dichterischer Selbstüberschätzung in Verbindung gebracht141.
Zwar wurde in der Vergangenheit unter anderem von Fraenkel
eingewendet, dass Horaz mit dem angewendeten Vergleich freilich
das Risiko der Pindarnachahmung hervorhebe, im Grunde aber auf
deren zumindest ruhmreiches Ergebnis ziele; Ikarus sei ja
gerade durch seinen Sturz berühmt geworden142. Dem ist aber
entgegenzuhalten, dass, auch wenn Ikarus durch sein
spektakuläres Ende zu Nachruhm gelangt ist, Horaz aber doch
unmöglich vorschlagen kann, jeder Beliebige (quisquis, v.1)
könne, ungeachtet seiner poetischen Fähigkeiten, durch eine
auch noch so misslungene imitatio Pindars zu Geltung gelangen143.
139 Ebd.140 Die einzige weitere Stelle, in dem das Ikarus-Motiv bei Horaz nocherwähnt wird, findet sich in c. 1,3,34f. Auch hier steht Ikarusstellvertretend für die Gefahr menschlicher Hybris.141 In c. 1,3,34f.142 Vgl. Fraenkel 1957, 510, Anm. 4.143 Vgl. Perret, J.: Horace, Paris 1959, 173f.
53
Der Fokus liegt also klar auf der Vergeblichkeit eines solchen
Versuches.
Eine ebenso negative Konnotation erfährt der Vergleich mit
dem Mythos aber auch schon im ersten Odenbuch in c. 1,3,34ff.:
expertus vacuum Daedalus aera
pinnis non homini datis;
35
perrupit Acheronta Herculeus labor.
nil mortalibus ardui est :
caelum ipsum petimus stultitia neque
per nostrum patimur scelus
iracunda Iovem ponere fulmina 40
Anders als in c. 4,2,1-4 geht Horaz in dieser Passage nicht auf
die Gefahr dichterischer Überheblichkeit im Speziellen ein,
sondern kritisiert den menschlichen Hang zur Hybris im
Allgemeinen. Die deutliche Kritik zeigt sich vor allem in v. 38
(caelum ipsum petimus stultitia). Horaz lässt auch an dieser Stelle
keinen Zweifel an dem für ihn äußerst negativen Symbolcharakter
des Mythos144.
Dieses Verständnis erlaubt auch eine Erklärung des
Vergleiches in c. 2,20. Der Dichter ist deswegen bekannter,
oder vielmehr - nach Nisbet - berüchtigter als Ikarus, da er genau
das tut, was er zu Beginn von c. 4,2 als waghalsigen Größenwahn
definiert hat: Horaz apostrophiert sich durch die Annahme der
144 Auch wenn hier der Vater Daedalus als Negativbeispiel genannt wird, soist dies für die Konnotation des Ikarus gleichbedeutend – schließlich ister es, der das Werk seines Vaters ausführt.
54
„symbolischen Identität“ Pindars145 - dem Schwan - als dieser
selbst. Die Metamorphose des Horaz wird zur aemulatio mit Pindar
und muss daher als (selbst-)ironische Charakterisierung zu
großer dichterischer Ansprüche verstanden werden. Horaz stellt
sich mit Pindar auf eine Stufe, nur um wenige Zeilen später mit
dem Verweis auf Ikarus zu beweisen, dass er mit diesem Vorhaben
seine dichterischen Fähigkeiten überschätzt und deswegen
scheitern wird.
Verstärkt wird die ironische Tendenz des Gedichts noch
durch die andere, oben angesprochene Widersprüchlichkeit des
Gedichts: Die beinahe naturalistisch anmutende Schilderung der
Verwandlung, die den Vergleich mit Pindar schließlich zur
Lächerlichkeit werden lässt. Meiner Meinung nach ist diese
Lächerlichkeit von Horaz durchaus intendiert. Nimmt man nun
hinzu, dass im Poömium der annales des Ennius sowohl das Motiv
der Verwandlung in einen Vogel, als auch die literarische
Gleichstellung mit einem anderen großen Dichter, nämlich Homer,
stattfindet, dann entwickelt sich die angenommene Deutung der
Selbstironie des Horaz hin zu einer Parodie der dichterischen
Selbstdarstellung des Ennius.
In der bereits behandelten Enniusstelle, die so zentral
für dessen poetisches Selbstbewusstsein zu sein scheint,
fungiert ein Pfau als eine Art Zwischenstation der
Metempsychose der Seele Homers in Ennius. Ennius formuliert
damit gleich zu Beginn seines Werkes seinen dichterischen
Anspruch, als alter Homerus zu dichten146. Dabei ist das
145 Vgl. Erasmo 2006, 373.146 Vgl. Enn. ann. **ii - **ix (Sk), somno leni placidoque revinctus / visus Homerusadesse poeta / etsi praeterea tamen esse Acherusia templa Ennius aeternis exponit versibus edens,quo neque permanent animae neque corpora nostra sed quaedam simulacra modis pallentia miris.unde sibi exortam semper florentis Homeri commemorat speciem lacrumas salsas coepisse et rerum
55
Verhältnis Ennius – Homer sicherlich mit dem Verhältnis Horaz –
Pindar vergleichbar. Wir finden jeweils einen jüngeren Dichter,
der sich selbst in der Nachfolge des älteren Dichters sieht,
was auch am jeweiligen Werk offensichtlich wird: Die mit dem
Namen Homers in Verbindung gebrachten Texte stehen zu allererst
für die Gattung des Epos, an welcher sich auch Ennius in seinen
annales versuchte.
Für Horaz auf der anderen Seite fungiert Pindar, der in
seinen Epinikia bei Wettkämpfen erfolgreichen Sportlern durch
Lobeshymnen zu ewigem Ruhm zu verhelfen suchte, zugleich als
archaischer Vorgänger und großes Vorbild147. Die horazischen
Oden können sehr oft als in dieser Tradition stehend aufgefasst
werden148. Aber anders als Ennius, der sich wie gesagt in seinem
Epos als alter Homerus apostrophiert, gibt Horaz sogar offen zu,
dass es für ihn, wie auch für alle anderen Dichter, unmöglich
sei, mit der eigenen Dichtung die Qualität Pindars zu
erreichen, geschweige denn, sie zu übertreffen.
Wenn wir nun auf unsere Argumentation zurückkommen, dann
lässt sich genau an dieser Stelle die Motivation finden, mit
welcher der Horaz die ennianische Selbstdarstellung parodiert:
Sie ergibt sich aus dem starkem Kontrast zu der eigenen
moderatio, in dem die prahlerische Selbstdarstellung des Ennius
zu stehen scheint. Horaz parodiert diese Prahlerei in c. 2,20,
während er genau die Szene, in welcher sie deutlich wird,
anhand seiner Person nachahmt. Aufgrund der zur Lächerlichkeit
naturam expandere dictis. / O pietas animi / memini me fiere pavom.147 Natürlich dienten Horaz auch Alkaios und Sappho als literarischeVorbilder für die Oden, was auch an der Wahl des Metrums der meistenGedichte deutlich wird, vgl. Fuhrmann 1999, 224.148 So evoziert beispielsweise c. 1,12,1f. gezielt die zweite Olympische OdePindars, vgl. Holzberg 2009, 122.
56
provozierten Metamorphose sowie der durch den Vergleich mit
Ikarus in der imitatio bereits implizierte Hinweis auf die
Vergeblichkeit des Unterfangens, bewegt sich der Ton des
Gedichts zu jedem Zeitpunkt in einer Sphäre der Ironie – auch
wenn dieser ein durchaus mahnender Charakter innewohnt.
Mit dem Schluss des Gedichts wird ein erneuter Bezug zu
Ennius hergestellt:
absint inani funere neniae (21)
luctusque turpes et querimoniae;
compesce clamorem ac sepulcri
mitte supervacuos honores.
In der sechsten Strophe der Ode finden wir den ersten Teil des
ennianischen Grabepigramms inhaltlich wiedergegeben. Ebenso wie
Ennius fordert auch Horaz, dass bei seinem Begräbnis nicht
getrauert werden solle. Weil das Grab leer sei, erscheinen auch
Klagerufe verkehrt (v. 22 turpes) und sinnlos (v. 24 supervacuos).
In Anbetracht der herausgestellten parodistischen Intention des
Mittelteils des Gedichts scheint die Intertextualität zum
Ennius-Epigramm die Ironie noch zu steigern. Es wirkt fast so,
als karikiere Horaz sogar noch im letzten Moment des Gedichts
die dichterische Selbstauffassung des Ennius, indem er ihn auch
in seinem ultimativen Wunsch imitiert.
III. 1. f) Ergebnisse der Einzelinterpretation
57
Nach der eingehenden Untersuchung der Ode 2,20 ist die anfangs
aufgestellte These nicht auszuschließen. Es scheint in
Anbetracht der Ergebnisse der vorangegangenen Argumentation
sogar glaubhaft, dass Horaz, anstatt der stolzen Formulierung
seines Nachruhmes, mit der beschriebenen Metamorphose das
dichterische Selbstverständnis seines Vorgängers parodiert.
Ausschlaggebend für diese Interpretation waren folgende Punkte:
Zum einen wird durch die starke Intertextualität des
Gedichts mit dem Werk des Ennius (Grabepigramm und
Annalen-Proömium) die Dichtung des Ennius fühlbar in den
Deutungszusammenhang der Ode 2,20 gerückt.
Die zu Beginn der Untersuchung herausgestellte Ambivalenz
des Enniusbildes im horazischen Opus lassen eine Deutung
der Ode im Kontext einer kritischen Reflektion des Ennius
und der von ihm vertretenen Kunstauffassung als denkbar
erscheinen.
Zum anderen erzeugt die drastische Beschreibung der
Metamorphose des Dichters eine ironische Atmosphäre, die
mit dem ursprünglich angenommenen Thema der
Unsterblichkeit durch literarischen Ruhm im Widerspruch
steht.
Entscheidend für die These scheint der allegorische
Vergleich mit dem Ikarusmythos zu sein. Dieser
symbolisiert im horazischen Werk stets das durch
Selbstüberhöhung hervorgerufene Scheitern des Menschen –
und speziell des Dichters, wie sich in c. 4,2 zeigt. In
diesem Motiv scheint der Schlüssel zu einer ironischen
Auslegung des Gedichts zu liegen. In einer solchen stellt
58
Ennius für Horaz das Negativbeispiel für zu große
dichterische Ansprüche, beziehungsweise maßlose
Selbstüberhöhung, dar. Horaz entwickelt eine Parodie
seines Vorgängers, indem er in der Ode durch die
Metamorphose in einen Schwan eine aemulatio mit Pindar
vorführt und so die Vorgehensweise des Ennius, der das
Gleiche mit Homer tat, persifliert. Durch den Vergleich
mit Ikarus, der gewissermaßen als Pointe des Gedichts
fungiert, weist er gleichzeitig auf den anmaßenden,
hybriden Charakter einer solchen aemulatio hin. Wenn Ikarus
einem Meer seinen Namen gegeben hat149, so könnte man
analog für Ennius verstehen, dass auch er sein
persönliches Ziel verfehlt habe, wie ein alter Homerus zu
dichten150. Oder anders gesagt, habe gerade sein überhöhter
dichterischer Anspruch zu seinem Scheitern geführt. Und
nach Horaz, so scheint es, werde er vor allem für diesen
verfehlten Selbstanspruch in die Geschichte eingehen.
III. 2. Die Ironie des Vergleichs – Gedächtniskultur in c. 4,8
III. 2. a) Inhalt und vordergründige Intention
Für einen weiteren Beleg der Ironisierung Horazens seines
Verhältnisses zu Ennius wendet sich die Untersuchung der
Interpretation der donarem pateras-Ode (c. 4,8) zu. Auch dieses149 Vgl. c. 4,2,3f.150 Was auch mit der herausgestellten Distanzierung des Horaz von derpreisenden Apostrophierung des Ennius übereinstimmt. Vgl. „ut critici dicunt“, S.5f.
59
Gedicht, welches sich an zentraler Position innerhalb des
vierten Odenbuches befindet151, setzt den Gedanken fort, dass
Dichtung die Taten verdienter Menschen verewigt und auf diese
Weise auch die Besungenen unsterblich macht. Im Unterschied zu
c. 2,20 konzentriert sich Horaz hier aber auf die Wirkung der
Poesie auf ihr Objekt und nicht, wie zuvor, auf das dichtende
Subjekt. Der bekannte Horazforscher Eduard Fraenkel
kommentiert, dass der Anspruch, lyrische Dichtung könne
menschlichen Errungenschaften Unsterblichkeit verleihen, in c.
4,8 überhaupt zum ersten Mal in der römischen Literatur in
Erscheinung tritt152. Das im Gedicht angesprochene Objekt
scheint zunächst ein gewisser Censorinus zu sein, den die
neuere Forschung mit Vorbehalten als C. Marcius Censorinus,
Konsul des Jahres 8 v. Chr., identifiziert153.
Der Inhalt des Gedichtes stellt sich wie folgt dar: Horaz
würde seine Gefährten (sodales), zu denen der Dichter Censorinus
anscheinend zählt, gerne reich beschenken. Da aber Letzterer
wohl weder Bedarf an materiellen Kunstwerken habe, noch Horaz
imstande sei, solche zu beschaffen, bietet er ihm Lieder
151 Zur Struktur des vierten Odenbuches kürzlich Holzberg 2009, 177.152 Vgl. Fraenkel 1957, 423. Holzberg hingegen verweist auf c. 3,25, wo Horazdie Apotheose des Augustus durch seine Dichtung ankündigt, vgl. Holzberg2009, 179. Zudem scheint durch die fast vollständige Übereinstimmung von c.3,25,20 und c. 4,8,33 (viridi tempora pampino) ein gewollter Zusammenhangzwischen den Gedichten zu bestehen - vorausgesetzt c. 4,8,33 stellt keineInterpolation dar, wovon Kiessling in seinem Kommentar ausgeht, vgl.Kiessling / Heinze 1955, 435.153 Zur Wahl stehen dabei entweder L. Marcius Censorinus (cos. 39 v. Chr.)oder der erwähnte G. Marcius Censorinus (cos. 8 v. Chr.). Für den Letzterenspricht sich vor allem Harrison 1990, 32ff. aus. Diese Auslegung ist jedochkeinesfalls eindeutig, wie Thomas resumiert: „As Harrison and others havenoted, the younger Censorinus would be more appropriate in view of theother youthful addresses of the book. […] On the other hand, if […] theTorquatus of 4,7 is an elderly man, […] then it might be that the centraltriad of the book (7-9) concerns itself with older addresses, Thomas 2011,187f.
60
(carmina) an, an denen Censorinus ohnehin großen Gefallen
finde. Zudem könnten, so fährt der Dichter fort, materielle
Güter (incisa notis marmora) den von einem Mann erworbenen Ruhm
nicht deutlicher anzeigen (non clarius indicant) als die Dichtung.
Zur Unterstützung dieser These benutzt Horaz als exemplum nobile
die Figur des Scipio Africanus, dessen Taten dank der Dichtung
des Ennius auf ewig in Erinnerung bleiben würden. Abschließend
nennt er weitere Beispiele aus dem griechisch-römischen Mythos,
die ebenso durch die Fähigkeit machtvoller Sänger (potentes vates)
Unsterblichkeit erlangt hätten und unterstreicht so die
Überlegenheit der Dichtung über stoffliche Güter, wenn es um
die Erzeugung von Nachruhm oder sogar um die Apotheose des
Besungenen geht, wie die letzteren Beispiele (Herakles, Kastor
und Pollux) nahe legen. Im Kommentar von Kiessling und Heinze
wird das Gedicht daher als „Verherrlichung der Poesie als
Ruhmeskünderin, die dem Besungenen Unsterblichkeit, ja selbst
Göttlichkeit zu verleihen vermag“ apostrophiert154.
III. 2. b) Deutungskontroverse
Im Laufe der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem
Gedicht hat sich, wie bei dem schon besprochenen c. 2,20, eine
Forschungskontroverse entwickelt. Der Ausgangspunkt des
Streites ist die Versanzahl 34. Das Gedicht widerspricht damit
als Einziges der Odensammlung der sogenannten lex Meinekiana.
Dieses von Meineke und Lachmann aufgestellte Gesetz geht von
der Teilbarkeit der Gesamtverszahl einer jeden Ode durch die
Zahl Vier aus155. Zur Lösung dieser Unregelmäßigkeit schlugen154 Kiessling / Heinze 1955, 428.155 Vgl. Lachmann 1876, 84-86.
61
spätere Interpreten die Tilgung von zwei, beziehungsweise sechs
Versen vor, die angeblich Ergebnis einer Interpolation seien.
Vor allem die Passage im Mittelteil des Gedichtes, in der die
Taten des Scipio Africanus und das Verdienst der ennianischen
Dichtung behandelt werden (vv. 15b – 19a), wurde oft als
nachträgliche Veränderung des Textes gedeutet156.
Bereits A. Elter argumentierte jedoch dagegen, die lex
Meinekiana sei für c. 4,8 nicht zwingend anwendbar, weil das
Gedicht in seiner Form und Gestalt sowie seinem Inhalt nicht
rein lyrisch sei157. Außerdem fügt R. Thomas in seinem kürzlich
erschienenen Kommentar des vierten Odenbuches hinzu, dass der
in der Regel vorgeschlagenen Tilgung der der Verse 15b – 19a
widersprochen werden müsse, da die Ode auf diese Weise viel von
ihrer pindarischen Ausstrahlung verlöre. Zudem würde der
anschließend hergestellte Bezug zu Ennius schwer
verständlich158.
Entschließt man sich zur Beibehaltung der Verse, so ergibt
sich jedoch ein weiteres Problem: Horaz schreibt in Vers 17
Scipio Africanus die Niederbrennung Karthagos zu, die
allerdings von dem jüngeren Scipio Aemilianus befehligt wurde.
Außerdem ereignete sich die Zerstörung der Stadt erst im Jahr
146 v. Chr., Ennius aber, der die Tat nach Horaz in seiner
Dichtung verewigte, starb bereits 169 v. Chr.159. Der Vorschlag,
Horaz hätte an dieser Stelle neben dem älteren auch den
jüngeren Scipio – der später ebenfalls den Beinamen Africanus
erhielt – als Beispiel anführen wollen, gerät durch das
156 Für genauere Angaben zu den jeweils zu Tilgung vorgeschlagenen Verse undLiteratur, siehe Thomas 2011, 186.157 Vgl. Elter 1907. So später auch Putnam 1986, 147, Anm. 1.158 Vgl. Thomas 2011, 186.159 Putnam 1986, 150, Anm. 6.
62
folgende eius (v. 18) sowie den expliziten Hinweis auf Ennius
fraglich160.
III. 2. c) c. 4,8 im Spiegel der Ironie
Anstatt eine Tilgung gewisser Verse vorzuziehen, versucht diese
Untersuchung der von Elter aufgestellten These zu folgen, dass
das Gedicht durchaus in seiner Ganzheit genuin und horazisch
sei. M. E. scheint es möglich, die bei dieser Auffassung
auftretenden Probleme zu vermeiden, indem der Versuch
unternommen wird, die oben dargestellten Widersprüchlichkeiten
durch eine ironische Interpretation des Gedichts aufzulösen.
Von grundsätzlicher Bedeutung ist dabei die Annahme, dass Horaz
die Widersprüchlichkeit des Gedichts selbst intendiert hat.
Dazu geben uns vor allem zwei Gesichtspunkte Anlass:
Erstens lässt der von Horaz angestrebte Vergleich zwischen
stofflichem und literarischem Gedenken nicht eindeutig auf eine
Höherstellung des Letzteren schließen. Durch die negative
Komparation (non clarius indicant quam) ergibt sich beim wörtlichen
Verständnis der Verse vielmehr eine Gleichstellung der
verglichenen Objekte. Zweitens scheint, abgesehen von den
bereits angesprochenen Problemen, ein Umstand verdächtig, der
bisher nur von P. R. Hardie gewürdigt worden ist. Gemäß der
Überlieferung wurde die posthume Ehrung des Ennius, der im
Gedicht als Vertreter der Dichtung präsentiert wird, in
materieller Form, durch eine Statue auf dem Scipionengrab,
gesichert. Der Nachruhm des Dichters wurde also durch genau
diese Art der Gedächtniskultur verkörpert, welcher die
160 Vgl. Kiessling / Heinze 1955, 432.
63
ennianische Dichtung in c. 4,8 entgegengestellt wird161. Könnte
diese Tatsache162, die schon der literarischen Postulierung des
Ennius in Bezug auf seine dichterische Unsterblichkeit163
widerspräche, Horaz Anlass dazu gegeben haben, seinen Vorgänger
auf geschickte und unterschwellige Weise zu parodieren?
Die Untersuchung wird sich daher auch mit der Frage
auseinandersetzen, ob die scheinbare Diskrepanz zwischen
ideeller und reeller Selbstdarstellung des Ennius als Grundlage
für die horazische Motivation zur Ironisierung des Gedichts
fungieren kann. Dabei schließt die Analyse an die Ergebnisse
der Einzelinterpretation des bereits besprochenen c. 2,20 an.
Natürlich gilt es hier zu beachten, dass Horaz das vierte
Odenbuch mehrere Jahre nach der Veröffentlichung der ersten
drei Bücher herausgegeben hat. Der chronologische Abstand
erlaubt uns zu prüfen, ob sich an dem Verhältnis, welches Horaz
zu Ennius hatte, mit fortgeschrittenem Alter und höherer Reife
des Dichters eine Entwicklung oder Veränderung feststellen
lässt.
III. 2. d) Einzelinterpretation c. 4,8
Während das Gedicht aufgrund seiner 34 Verse der lex Meinekiana
widerspricht, findet sich mit dem asklepiadeischen Versmaß auch
ein bei Horaz äußerst seltenes Metrum, das er sonst nur in c.
1,1 und c. 3,30 verwendet – also in den beiden, die erste
161 Vgl. Hardie 1993, 135.162 Wie glaubhaft die antiken Quellen über die Ennius-Statue auf demScipionengrabmahl sind, wird im Rahmen der anschließendenEinzelinterpretation geprüft werden.163 Vgl. Nemo me lacrimis decoret nec funera fletu faxit. Cur? Volito vivos per ora virum, frg.var. 17 V.
64
Odenedition einrahmenden Gedichte. c. 4,8 stellt nun genau die
Mitte des vierten Buches dar. Dabei entsteht durch den
Rhythmus, bei dem der gleiche metrische Vers für das gesamte
Gedicht wiederholt wird, eine gravitätische Atmosphäre. Des
Weiteren evoziert der Asklepiadeus durch seine
dodekasyllabische Ordnung, d. h. durch eine natürliche Pause
nach der sechsten von zwölf Silben und damit zwei metrisch
identischen Vershälften, eine geradlinige Direktheit, wie
Putnam ausführt164.
Neben dem Versmaß lässt sich mit Sicherheit eine weitere
Parallele zu den beiden früheren Gedichten ausmachen. So
reflektiert Horaz in c. 1,1 und c. 3,30 über den Wert seiner
Dichtung für sich selbst; in c. 4,8 steht die Bedeutung für
diejenigen im Vordergrund, die von seiner Dichtung behandelt
werden.
Versucht man unter Beibehaltung aller Verse, die Ode
einzuteilen, so bietet sich eine inhaltliche Aufteilung in
Einleitung (v. 1 – 12), Hauptteil (v. 13 – 20) und Schluss (v.
20b [neque] – 34) an.
Donarem pateras grataque commodus,
Censorine, meis aera sodalibus,
donarem tripodas, praemia fortium
Graiorum, neque tu pessuma munerum
ferres, divite me scilicet artium 5
quas aut Parrhasius protulit aut Scopas,
hic saxo, liquidis ille coloribus
sollers nunc hominem ponere, nunc deum:
164 Vgl. Putnam 1986, 149.
65
sed non haec mihi vis, nec tibi talium
res est aut animus deliciarum egens : 10
gaudes carminibus ; carmina possumus
donare, et pretium dicere muneri.
Im ersten Teil des Gedichts schlägt Horaz Censorinus, einem
seiner Gefährten (v2. meis sodalibus), lyrische Gedichte (v. 11
carmina) als würdige Geschenkgabe vor, da er weder in Lage
wäre, ihm materielle Ehrungen (v. 3 tripodas; praemia) Kunstwerke
(v. 5 artium), wie sie bildende Künstler kreieren, zu schenken.
Noch habe Censorinus an solchen Dingen Bedarf oder größere
Freude als an Gedichten.
Es fällt auf, dass die Einleitung sehr ebenmäßig gegliedert
erscheint. Wir finden sechs Distichen, die bis auf die Ausnahme
ferres (v. 5) in sich abgeschlossen sind165. Es herrscht eine
insgesamt heitere Tonlage vor, die zum einen durch die
Vorstellung erzeugt wird, der Dichter Horaz hätte tatsächlich
originale Werke der genannten Künstler zu verschenken, zum
anderen durch die abschließende, scherzhafte Selbstironie (v.
11f.)166.
Dabei bereitet Horaz schon in der Einleitung des Gedichts
den im Mittelteil folgenden Vergleich von literarischem und
materiellem Gedenken vor, auf welchen wir uns anschließend
konzentrieren werden. Bevor zum direkten Vergleich übergeht,
erzeugt der Dichter einen Dualismus der Künste167. Indem er
zunächst die Auszeichnungen griechischer Athleten (v. 3f.
165 Vgl. Kiessling / Heinze 1955, 429.166 Vgl. ebd.167 Vgl. Putnam 1986, 148.
66
praemia fortium Graiorum), dann Skulpturen und Bilder (v. 5ff.
artium […] saxo, […] coloribus) berühmter römischer Künstler als
kostbare Geschenke anführt, schafft Horaz eine Ebene der
konkreten, physisch erfahrbaren Kunst. Dieser Kunst kommt
aufgrund ihrer hohen materiellen Kosten und ihrer komplizierten
Herstellung – Faktoren, die dem Dichter ihre Beschaffung
unmöglich machen – ein besonderer Wert zu. Ganz im Gegenteil
dazu scheint die Dichtung (v. 11 carmina) auf leichtem Wege zu
verschenken zu sein, da sie keinen Wert im materiellen Sinne
besitzt. Ihre Erfahrung, welche für den Beschenkten trotzdem
gewinnbringend sein kann, ist abstrakt und spirituell.
Besonders interessant scheint die nähere Betrachtung der
beiden exempla nobilia, die Horaz in seiner Argumentation nennt:
Parrhasius war nach Plinius dem Älteren ein äußerst begabter
Maler aus Ephesus Ende des fünften Jahrhunderts v. Chr..
Plinius schreibt, dass er bekannt dafür gewesen sei, als Erster
in der Malerei Proportion (symmetria), Gesichtsausdruck (argutiae
vultus) und Eleganz der Haare (elegantia capilli) ausgedrückt zu
haben. Gleichzeitig habe er unter Zeitgenossen jedoch als
arrogant und selbstsüchtig gegolten168. Scopas wiederum wird von
Plinius als aus Paros stammender Bildhauer und Architekt der
vierten Jahrhunderts v. Chr. genannt169. Viele seiner Werke
gelangten wohl auch nach Rom, wie sein Apollo Citharoedus im
palatinischen Apollo-Tempel. Dieser war Horaz mit Sicherheit
bekannt170.
168 Plin. maior, N. H. 35,67ff.: Parrhasius Ephesi natus et ipse multa contulit. primussymmetrian picturae dedit, primus argutias voltus, elegantiam capilli, venustatem oris, confessioneartificum in liniis extremis palmam adeptus. haec est picturae summa suptilitas. […] ostendebatnamque varium: iracundum iniustum inconstantem.169 Plin. maior, N. H. 36, 25ff.170 Vgl. Thomas 2011, 188f.
67
Bei der Frage, warum Horaz in seinem Gedicht genau diese
beiden Künstler anführt, lässt sich sicherlich zunächst
festhalten, dass Beide hervorragende Vertreter der
herausgestellten, physisch-konkreten Kunstgattungen waren.
Nehmen wir aber die anschließende Referenz zu Ennius vorweg (v.
20), die sowohl wegen ihrer Position als auch ihrer Bedeutung
zweifelsfrei im Zentrum des Gedichts steht, so lassen sich
zumindest zwischen der Figur des Parrhasius und Ennius ein paar
vorsichtige Parallelen ziehen: Auch Ennius schuf in der von ihm
betriebenen Kunst als Erster etwas Neues. Mit der Einführung
des Hexameters als neuem Versmaß des römischen Epos galt der
vorklassische Dichter in Rom lange Zeit als Archeget.
Gleichzeitig fällt die arrogante, selbstüberhebliche
Einstellung ins Auge, die Plinius dem Parrhasius attestiert. In
Verbindung mit den aus der Analyse von c. 2,20 gewonnenen
Erkenntnissen, scheint es denkbar, dass Horaz in c. 4,8 über
die Figur des Parrhasius aber auch indirekt auf die
kritisierte, überladene Selbstdarstellung des Ennius anspielt.
Auch deckt sich das gespaltene Bild des berühmten Malers mit
der ambivalenten Meinung, die Horaz über Ennius vertritt, in
der sich Lob und Kritik vereinen.
Neben Ennius, auf den später noch zurückzukommen ist,
spüren wir in der Ode aber noch den Bezug zu einem anderen
Vorgänger Horazens: Wie S. J. Harrison kommentiert, strahlt
Pindar schon aufgrund der Thematik des Ruhmes, der einem
verdienten Menschen durch Poesie verliehen wird, in c. 4,8 –
wie schon in c. 2,20 – eine konstante Präsenz aus171. Eine
deutliche Verbindung zum griechischen Dichter findet sich
171 Vgl. Harrison 1990, 35.
68
bereits in den ersten Zeilen des Gedichts, die stark an die
Erste Isthmische Ode Pindars erinnern172.
Auch wenn sich die Ode in Stimmung und Vokabular durchaus
an die preisende, widmende Lyrik Pindars annähert, so ist doch
zu beobachten, dass sich Horaz im Laufe des Gedichtes
sukzessive von seinem Adressaten, Censorinus, entfernt. Obwohl
dieser noch im Anfangsteil der Ode noch direkt angesprochen
wird, da er für seine anscheinenden Verdienste als sodalis
belohnt werden soll, kommt der Grund, mit dem er sich die
Widmung tatsächlich verdient hat, im Gedicht nicht zur Sprache
- stattdessen folgt der Exkurs über die exempla nobilia. Die
Distanz wächst bis zu dem Punkt, an dem die Verben der Zweiten
Person nur noch in einer allgemeinen Funktion verwendet werden
und sich nicht mehr direkt auf Censorinus beziehen (vgl. v.
21f.). Die anscheinende pindarische Aura des Gedichts wirkt
zwar zunächst nach außen hin, aufgrund der Form und des
Vokabulars der Ode. Inhaltlich besitzt das Gedicht jedoch durch
die völlige Vernachlässigung des Adressaten nur geringe
Ähnlichkeit mit der Dichtung des griechischen Vorläufers.
Zusammen mit den eingangs erwähnten Schwierigkeiten, den
Adressaten überhaupt genau zu identifizieren, ergibt sich ein
fragwürdiges Bild der Widmung. In unserer Interpretation wollen
wir jedoch darauf verweisen, dass der mangelnde Bezug zum
Adressaten eventuell als Indiz aufgefasst werden kann, dass der
Dichter die Ode eigentlich, oder vielleicht auch zusätzlich, an
seinen Vorgänger Ennius richtet, zu dem im folgenden Hauptteil
ein deutlicher Bezug hergestellt wird.
172 Vgl. c. 4,8,1–4: donarem pateras […] tripodas u. Pindar Isthm. 1,19f.: καίτριπόδεσσιν εχόσμησαν δόμον καί λεβήτεσσιν φιάλαισί τε χρυσου.
69
non incisa notis marmora publicis,
per quae spiritus et vita redit bonis
post mortem ducibus, [non celeres fugae
15
reiectaeque retrorsum Hannibalis minae,
non incendia Karthaginis impiae
eius qui domita nomen ab Africa
lucratus rediit] clarius indicant
laudes quam Calabrae Pierides ;
20a
Hatte der Dichter bereits im ersten Teil des Gedichts eine
Unterscheidung von physisch-konkreter und literarisch-
abstrakter Kunst zur Ehrung eines verdienten Menschen
eingeleitet und jeweils mit Beispielen belegt (v. 3 tripodas; v.
5ff. artium […] saxo, […] coloribus versus carmina v.11f.), so
gestaltet er diese Differenzierung im Mittelteil weiter aus.
Dabei spricht Horaz der literarisch-abstrakten Kunstebene auf
den ersten Blick eine höhere Qualität bei der Verbreitung und
Erhaltung des Ruhmes des jeweils Geehrten zu, was aufgrund
seiner eigenen Profession nicht verwunderlich scheint.
Zu diesem Zweck vergleicht der Dichter öffentliche, mit
Inschriften versehene Grabmähler (v. 13 incisa notis marmora publicis)
mit der Dichtung des Ennius, wie durch die Allusion Calabrae
Pierides (v. 20) unmissverständlich klar wird. Zum einen wird
damit die auf den Heimatort des aus Rudiae in Kalabrien
stammenden Dichters angespielt173, zum anderen auf dessen
173 Vgl. Thomas 2011, 192. Ähnlich geht Horaz auch in c. 4,6,27 vor, wo ermit Daunia Camena auf seine eigene Dichtung anspielt, in c. 2,1,38 mit Ceaeneniae auf die des Simonides, vgl. Kiessling / Heinze 1955, 422.
70
Verbundenheit mit der griechisch-hellenistischen Dichtung174.
Noch deutlicher wird der Bezug zu Ennius durch den Verweis auf
die Taten des Scipio Africanus (v. 15b – 19a), deren
effektivere Verkündung (v. 19f. clarius indicant laudes) Horaz als
Vergleichspunkt dient. Ennius hatte sowohl in seinem Epos
Annales als auch in einem weiteren Gedicht Scipios Ruhm
verkündet175.
Bei näherer Beobachtung dieses Vergleichs ergibt sich durch die
negative Art der Komparation jedoch keine Favorisierung eines
der beiden verglichenen Objekte. Bei wörtlicher Auslegung von
‚non […] clarius indicant laudes quam’ wird vielmehr eine
Gleichstellung von Grabmählern und der ennianischen Poesie
erreicht. Während schon Lachmann in der Gleichstellung beider
Objekte eine gewisse Herabwürdigung der Dichtkunst des Ennius
wahrnahm176, hielten spätere Forscher diese Interpretation für
eher abwegig177.
Das Problem des negativen Vergleichs wird aber noch
deutlicher, wenn man die prominenteste Stelle innerhalb der
Oden betrachtet, an denen Horaz über das Ergebnis der eigenen
Dichtung reflektiert:
Exegi monumentum aere perennius (1)
regalique situ pyramidum altius
174 Diese Verbundenheit sagte man Ennius unter anderem aufgrund einer durchGellius 17,17,1 überlieferten, angeblichen Selbstaussage des Dichters nach:Quintus Ennius tria corda habere sese dicebat, quod loqui Graece et Osce et Latine sciret.175 Kiessling / Heinze 1955, 433.176 Vgl. Lachmann 1876, 98f.177 Stellvertretend vor allem: Suerbaum 1968, 186, Anm. 555.
71
Zu Beginn des berühmten c. 3,30 geht der Dichter einen
ähnlichen Vergleich zwischen materieller und literarischer
Gedächtniskultur ein. Allerdings ist er hier, anders als in c.
4,8, wo er über das eigene Werk reflektiert, weitaus
deutlicher. Seine Dichtung wird zum Monument, das sowohl
eiserne wie auch steinerne Kunstwerke in Dauer und Größe
übertrifft. Auch hier findet sich der vergleichende Komparativ
(v. 1 perennius; v. 2 altius), jedoch in positiver Form. Somit wird
die Dichtung eindeutig höher als die materiellen Güter
bewertet.
Auch im später veröffentlichten vierten Odenbuch weicht
Horaz von dieser Einstellung nicht zurück, wie sich in c.
4,2,17ff. bestätigt:
sive quos Elea domum reducit (17)
palma caelestis pugilemve equomve
dicit et centum potiore signis
munere donat 20
An dieser Stelle wird das Verhältnis des Wertes von materiellem
und literarischem Andenken mit großer Klarheit zu Gunsten des
Letzteren entschieden. Das Werk des Dichters beschenke den
Besungenen reicher als hundert Statuen. Dabei spricht Horaz an
dieser Stelle nicht von seiner eigenen Dichtung, sondern von
der seines großen Vorbildes Pindar. Das horazische Werturteil
scheint also nicht nur für ihn selbst zu gelten. Er räumt auch
dem Werk anderer Poeten die gleiche Wirkung ein.
72
Der Gedanke, dass durch Dichtung eher als durch stoffliche
Güter oder Bauwerke die Unsterblichkeit der jeweils gefeierten
Person garantiert werde, findet sich nicht nur bei Horaz. Auch
andere Dichter der augusteischen Zeit maßen ihrer Kunst einen
ähnlichen Wert zu. Eine besonders deutliche Parallele zu dem
untersuchten Vergleich zeigt sich in der Properz-Elegie 3,2,17-
26:
fortunata, meo si qua es celebrata libello!
(17)
carmina erunt formae tot monumenta tuae.
nam neque Pyramidum sumptus ad sidera ducti,
nec Iovis Elei caelum imitate domus, 20
nec Mausoleo dives fortuna sepulchre
mortis ab extrema condicione vacant.
aut illis flamma au timber subducet honores,
annorum aut ictu, pondere victa, ruent.
at non ingenio quaesitum nomen ab aevo
25
excidet: ingenio stat sine morte decus.
Zwar ist mittlerweile weitgehend akzeptiert, dass Properz, wie
sich schon am Vokabular des Gedichts zeigt (v. 18 monumenta;
v. 19 Pyramidum), mit seiner Elegie wohl eine offensichtliche
Nachahmung von Horazens c. 3,30 unternommen hat178. Allerdings
führt der Elegiker die von Horaz im Epilog des dritten
Odenbuches formulierte Auffassung, lyrische Dichtung mache den
Dichter unsterblich, weiter aus. Unsterblichkeit erhält neben
dem Dichter selbst (v. 25f.) vor allem die von ihm besungene178 Vgl. Kiessling / Heinze 1955, 383.
73
Person, in diesem Fall seine Geliebte (v. 17 si qua es celebrata).
Dabei gilt es als gesichert, dass das properzische Gedicht vor
der Herausgabe des vierten Band der Oden erschienen ist, in dem
sich diese Überzeugung erstmals auch bei Horaz zeigt (siehe
oben zu c. 4,2)179. Da die Elegie wohl eher der Lyrik als dem
Epos zuzuordnen ist, scheint es durchaus möglich, dass Properz
Horaz mit der spezifischen Postulierung des Anspruches der
gemeinsamen Kunstgattung, sie mache nicht nur den Dichter,
sondern darüber hinaus auch den Gepriesenen unsterblich, zuvor
kam, wie Suerbaum annimmt180.
Indes ist dieser Anspruch innerhalb der römischen Literatur
kein Novum. Denn es war gerade Ennius, der bereits lange zuvor
in dem bereits angesprochenen Grabepigramm behauptet hatte,
dass ihn seine Dichtung unsterblich mache. Weiterhin wird aus
der von Otto Skutsch unternommenen Rekonstruktion des Proömiums
des 16. Annalenbuches deutlich, dass der Gedanke, stoffliche
Monumente seien der Dichtung hinsichtlich der Sicherung des
Nachruhmes einer Person unterlegen, ebenfalls schon bei dem
vorklassischen Dichter auftaucht181. Suerbaum vermutet in den
von Skutsch zusammengestellten Annalenfragmenten sogar einen
möglichen Prätext für Horazens c. 3,30182. Der einzige
Unterschied ist, dass Ennius sich mit seinem Anspruch auf die
dichterische Gattung des Epos, nicht der Lyrik, bezieht.
Kehren wir nun zu c. 4,8 zurück, überrascht es umso mehr,
dass Horaz im Zusammenhang mit Ennius plötzlich die
Deutlichkeit in der Unterscheidung der Objekte vermissen lässt,179 Suerbaum 1968, 194, Anm. 573.180 Vgl. Suerbaum 1968, 197.181 Skutsch 1985, 564.182 Suerbaum 1968, 165ff.
74
die wir bei ihm an anderer Stelle so deutlich gefunden haben.
In Anbetracht der plötzlichen Zurückhaltung, was die eindeutige
Positionierung der Dichtung des Ennius angeht, scheint es
durchaus legitim, anzunehmen, dass Horaz seine eigene Kunst
anders bewertet als die seines Vorgängers. Und bezieht man
wiederum die von Horaz im Allgemeinen vertretene (und wie in c.
3,30 klar postulierte) Auffassung von der Überlegenheit des
Poetischen gegenüber dem Materiellen mit ein, dann resultiert
aus ihrer Missachtung in dieser Ode eine bewusste Abwertung der
ennianischen Dichtung.
Nun stellt sich natürlich die Frage, mit welcher
Motivation Horaz zu einem solchen Urteil gelangen könnte. Es
scheint, als ließe sich aus der eingangs geschilderten
Problematik im Kontext der Scipio-Passage (v. 15b – 19a) eine
Antwort gewinnen. Zwar ist es bekannt, dass Ennius in seinen
Annalen über den älteren Publius Cornelius Scipio Africanus
(235 – 183 v. Chr.) schrieb, der vor allem dafür berühmt war,
Hannibal in der Schlacht von Zama 202 v. Chr. besiegt und somit
die karthagische Bedrohung zurückgeworfen zu haben (v. 16
reiectaeque retrorsum Hannibalis minae). Es ist hingegen unmöglich,
dass Ennius – wie Horaz andeutet (v. 17 incendia Karthaginis impiae)
– auch über die Zerstörung Karthagos dichtete. Diese wurde von
dem jüngeren Publius Cornelius Scipio Aemilianus (185 – 129 v.
Chr.) befehligt und ereignete sich erst 23 Jahre nach dem Tod
des Dichters. Es ist jedoch ausgeschlossen, dass in der Passage
die Taten von verschiedenen Personen beschrieben werden, wie
aus den Versen 18-19 hervorgeht (eius qui domita nomen ab Africa
lucratus rediit).
75
Diese offensichtlichen, chronologischen Unmöglichkeiten lassen
nur zwei mögliche Erklärungen zu183: Entweder sind die
diskutierten Verse tatsächlich, wie Kiessling und Heinze
meinen, auf die Interpolation eines „Ignoranten etwa des
vierten Jahrhunderts“ zurückzuführen184. Oder aber der Autor
hatte bewusst gar keine historische Korrektheit im Sinn. Wir
wollen prüfen, ob die besagten Probleme als vorsätzliches,
ironisches Spiel verstanden werden können. Es bestünde die
Möglichkeit, dass Horaz mit einer Widersprüchlichkeit innerhalb
seines Gedichts auf eine andere im Zusammenhang mit den
Scipionen und Ennius anspielen wollte.
Anlass dazu gibt uns eine Statue des Ennius, die auf dem
Grabmahl der Scipionen in Rom vermutet wurde. Die antiken
Autoren, die die Existenz der Statue belegen, lassen sich in
zwei Gruppen einteilen: Die Älteren, Cicero185 und Livius186,
scheinen das Dichterbildnis eher für ein Gerücht zu halten
(putatur; dicuntur). Spätere Quellen, darunter Ovid187, Valerius
183 Dass sich Horaz als aufgeklärter Römer wohlmöglich selbst geirrt habenkönnte, erscheint bereits recht unwahrscheinlich. Die Vorstellung aber,dass niemand den Dichter auf ein derart blamables Versehen aufmerksamgemacht habe, macht diese Option zur völligen Absurdität und kann daher andieser Stelle wohl mit Recht außer Acht gelassen werden.184 Kiessling / Heinze 1955, 432.185 Cic. Arch. 22: Carus fuit Africano superiori noster Ennius, itaque etiam in sepulcro Scipionumputatur is esse constitutus ex marmore.186 Liv. XXXVIII 56: Vtrobique monumenta ostenduntur et statuae; nam et Liternimonumentum monumentoque statua superimposita fuit, quam tempestate deiectam nuper uidimusipsi, et Romae extra portam Capenam in Scipionum monumento tres statuae sunt, quarum duae P. EtL. Scipionum dicuntur esse, tertia poetae Q. Ennii.187 Ov. ars am. III 409f. : Ennius emeruit, Calabris in montibus ortus, Contiguus poni, Scipiomagne, tibi.
76
Maximus188, Plinius der Ältere189 und Hieronymus190 sind trotz des
größeren zeitlichen Abstandes zuversichtlicher und gehen
teilweise sogar von einer Bestattung des Dichters in der
Familiengruft aus (Contiguus poni), obwohl oder gerade weil sie
sich auf Cicero und Livius beziehen191. Plinius und Hieronymus
geben sogar an, dass die Ehrung des Dichters in Form einer
Statue noch auf den persönlichen Befehl des Scipio Africanus
erfolgt sei, der etwa 14 Jahre vor Ennius gestorben war.
Das Grabmahl an der Via Appia gilt heute als Beispiel für
den im 2. Jahrhundert v. Chr. einsetzenden Trend, Grabbauten zu
architektonisch aufwendigen Anlagen zu gestalten. Die
wirtschaftliche Prosperität, die nach Ende des Zweiten
Punischen Krieges aufkam, änderte das Erscheinungsbild der
aufblühenden Städte hin zu einer neuen Monumentalität192. Als
einfache, in den Felsen getriebene Kammerfolge existierte die
Scipionengruft wohl schon im 3. Jahrhundert v. Chr. Nach dem
Sieg im Zweiten Punischen Krieg, an dem die Scipionen
bekanntlich großen Anteil trugen, wurde eine großzügige Fassade
geschaffen. Aus dem anstehenden Fels arbeitete man dazu ein
188 Val. Max. VIII 14,1: Superior Africanus Enni poetae effigiem in monumentis Corneliaegentis conlocari uoluit, quod ingenio eius opera sua inlustrata iudicaret, non quidem ignarus, quamdiu Romanum imperium floreret et Africa Italiae pedibus esset subiecta totiusque terrarum orbissummum columen arx Capitolina possideret, eorum extingui memoriam non posse, si tamenlitterarum quoque illis lumen accessisset, magni aestimans, uir Homerico quam rudi atque inpolitopraeconio dignior.189 Plin. N. H. VII, 114 : Prior Africanus Q. Ennii statuam sepulcro suo inponi iussitclarumque illud nomen, immo vero spolium ex tertia orbis parte raptum, in cinere supremo cumpoetae titulo legi.190 Hieron. chron. a. Abr. 1849 = Ol. 153,1, p. 140 H = 168 v. Chr. : Enniuspoeta septuagenario maior articulari morbo perit sepultusque in Scipionis monumento via Appiaintra primum ab urbe miliarum. quidam ossa eius Rudiam ex Ianiculo translata adfirmant.191 Dass Ennius im Grab der Scipionen nicht nur eine Statue besessen,sondern dort auch beigesetzt worden sein soll, kann jedoch ausgeschlossenwerden, da nur Angehörige derselben gens in einem gemeinsamen Familiengrabbestattet werden durften, vgl. Cic. log. 2,55.192 Vgl. Hesberg 1992, 22.
77
Podium heraus, worüber sich wahrscheinlich eine aus Quadern
gestaltete Halbsäulenfront ionischer oder korinthischer Ordnung
befand. Diese in das Felsmassiv getriebene und von großen
Leerflächen an den Seiten gerahmte Architektur muss sich den
aus Rom über die Via Appia kommenden Passanten eindrucksvoll
dargeboten haben. Der Prunk wurde noch gesteigert durch die
Bemalung der Podienfläche mit Szenen aus kriegerischen Erfolgen
der Familie. Welche Bedeutung ihr im Aufbau zugemessen wurde,
lässt sich an ihrer stetigen Erneuerung erkennen. Statuen zur
Ehrung der Verstorbenen hatten ihren Platz in Nischen zwischen
den Säulen. Sowohl erzählende Bilder als auch preisende
Inschriften kündeten von den Taten der Familie. Zudem führten
einzelne Ehrenstatuen ihre prominenten Mitglieder und, wie die
Quellen behaupten, Ennius als einen befreundeten Dichter vor,
ähnlich wie es in einem öffentlichen Bau oder auf dem Forum
geschehen konnte193.
Abb. 1: Rekonstruktion der Fassade des Grabmahls der Scipionen nach Coarelli 2000.
193 Vgl. Hesberg 1992, 22f.
78
Wirkliche Hinweise auf eine Statue des Ennius, wie sie die
Quellen beschreiben, konnten bei den Grabungen und
Sanierungsmaßnahmen im 19. und 20. Jahrhundert jedoch nicht
gefunden werden. Einzige Ausnahme bildete der Fund eines
hellenistischen Porträtkopfes des späten 2. Jahrhunderts v.
Chr., der offensichtlich einmal Teil einer Statue gewesen
war194. Dieser, jetzt im vatikanischen Museum auf dem Sarkophag
des L. Cornelius Scipio Barbatus stehende Kopf mit Lorbeerkranz
wird aber in der Regel nicht als Abbild des Ennius gesehen,
weil er aus Tuffstein und nicht, wie in den Quellen behauptet,
aus Marmor ist195.
Zwar ist also, wie es scheint, kein gesicherter Beweis für
die Verbindung des Dichters mit dem Grabmahl der Scipionen
vorhanden. Trotzdem spiegeln allein die Vermutungen von Cicero
und Livius wieder, dass die Existenz der besagten Statue wohl
ein Gerücht war, welches weite Verbreitung innerhalb der
römischen Gesellschaft besaß. Wenn schon diese beiden,
bedeutenden Autoren der Anekdote über den Dichter soviel Wert
beimessen, dass sie in ihrem Werk Erwähnung findet, so kann im
Kontext der Ennius-Statue zumindest von einer sicherlich
vorhandenen Assoziation vieler Zeitgenossen des Horaz
ausgegangen werden. Auch die Möglichkeit, dass Ennius eventuell
selbst gar keinen Einfluss auf die Aufstellung der Statue
besessen haben könnte, da dies natürlich auch erst nach seinem
Tod passiert sein könnte, spielt in sofern keine Rolle, da
194 Amelung 1908, 8 Kat. Nr. 2a, Taf. 1.195 Vgl. Speier 1963, 73f. So auch Dahlmann 1963, 81, Anm. 2, der diePräsenz einer Ennius-Statue im Grab der Scipionen für eine „bloße Vermutungder ciceronisch-augusteischen Zeit“ hält. Dagegen sind sowohl Hardie 1993,135 als auch Coarelli 1972, 70f. der Meinung, dass den Vermutungen durchausGlauben zu schenken ist.
79
Horaz sich in seiner Anspielung allein auf das Gerücht bezieht,
dass eine solche Statue des Dichters existiert haben mag, die
im Widerspruch mit der Selbstdarstellung des Ennius stände.
Der Augusteer Horaz provoziert im Mittelteil des Gedichts durch
die Anspielung auf Ennius und die inkorrekte Wiedergabe der
historischen Begebenheiten im Zusammenhang mit Scipio Africanus
diese Assoziationen bei seinem Publikum. So müssen die Verse 15
– 19 beim römischen Leser doch ein Moment der Irritation
ausgelöst haben, das zur anschließenden Erinnerung an die dem
Ennius nachgesagte Statue geführt haben mag. Hinzu kommt, dass
nach Kiessling mit incisa marmora neben Ehrendenkmälern und
Weihungen eben speziell auch beschriftete Bildsäulen und
Statuen gemeint sein können196. Des Weiteren könnte auch das
Material Vorstellungen von der angeblichen Ennius-Statue
geweckt haben, die ja laut Cicero ex marmore bestand.
Diesem Gedanken ausgesetzt, wird der Rezipient im
Schlussteil noch einmal mit dem übergreifenden Thema der Ode
konfrontiert, der Überlegenheit der Dichtung gegenüber jeder
Art materieller Güter bei der Sicherung des Nachruhmes einer
verdienten Persönlichkeit. Die suggerierte Gegenüberstellung
dieses Leitgedankens mit der hervorgerufenen Vorstellung von
einer Ennius-Statue widerspricht geradezu diametral dem
Anspruch des vorklassischen Dichters, welcher ebenfalls die
literarische der stofflichen Gedächtniskultur vorzog, wie aus
dem bereits erwähnten Grabepigramm und dem von Skutsch
rekonstruierten Proömium des 16. Annalenbuches deutlich
hervorgeht. Sofern der herausgestellte Widerspruch zwischen
196 Vgl. Kiessling / Heinze 1955, 432.
80
literarischem Anspruch und reellem posthumen Andenken des
Dichters denn tatsächlich vom aufmerksamen Publikum
wahrgenommen worden ist, muss er eine grazile, aber nicht
minder schlagfertige Ironie der Selbstdarstellung des Ennius
generiert haben.
Hinzukommend lässt sich daraus eine weitere Auszeichnung
der Dichtung im Allgemeinen extrahieren: Fast klingt es, als
sei die Dichtung neben der Immortalisierung verdienter
Persönlichkeiten auch dazu in der Lage, historische Fakten den
persönlichen Belangen des Poeten unterzuordnen und sie
dahingehend zu verändern. Horaz tut dies mit Scipio, Ennius –
vorausgesetzt die posthume Ehrung fand nicht gegen seinen
vorherigen Willen statt - vielleicht mit seiner eigenen Person,
wie der von Horaz ironisierte Widerspruch nahelegt.
neque
(20b)
si chartae sileant quod bene feceris,
mercedem tuleris. quid foret Iliae
Mavortisque puer, si taciturnitas
obstaret meritis invida Romuli ?
ereptum Stygiis fluctibus Aeacum
25
virtus et favor et lingua potentium
vatum divitibus consecrat insulis.
[dignum laude virum Musa vetat mori]
caelo Musa beat. sic Iovis interest
optatis epulis impiger Hercules, 30
clarum Tyndaridae sidus ab infimis
81
quassas eripiunt aequoribus ratis,
[ornatus viridi tempora pampino]
Liber vota bonos ducit ad exitus.
Nachdem Horaz den Exkurs zur Dichtung des Ennius abgeschlossen
hat, fasst er noch einmal das Thema der Ode zusammen (v. 20b –
22a). Abschließend ergeht sich das Gedicht in weiteren
Beispielen aus dem römisch-griechischen Sagenkreis, die den
Verdienst der Dichtung für die Unsterblichkeit dieser Figuren
illustrieren. Anders als das vorangegangene Exempel des Scipio
Africanus, sind die mythischen Beispiele jedoch sehr vage und
allgemein gehalten. So werden Romulus, Aiakos, Herakles und die
Söhne des Tyndareos, Kastor und Pollux als durch die Dichtung
bekannte exempla nobilia angeführt, die Gründe für ihre
literarische Erwähnung aber außer Acht gelassen. Mit der
Nennung des Aiakos (v. 25) findet sich mit Sicherheit eine
weitere Allusion zu Pindar, der den Ruhm der Aiakiden besang.
Dabei deuten die Beispiele neben der Unsterblichkeit sogar die
Apotheose ihrer Helden durch die Dichtung an197.
Während aber die eigentlichen Taten der besungenen Helden
übergangen werden, fokussiert Horaz stattdessen die notwendigen
Fähigkeiten des Schöpfers ihres Ruhmes. Die machtvollen Sänger
(v. 26f. potentium vatum) sind es, die für die Verbreitung der
Taten verantwortlich sind. Während diese Dichter gewisse,
notwendige Qualitäten zu besitzen haben (v. 26 virtus; lingua),
ist es an den Helden, sich die Gunst (v. 26 favor) derselben zu
verdienen (v. 28 dignum). Es scheint also fast, als verkehre
Horaz hier die vorgegebenen Machtverhältnisse zwischen
197 Vgl. Putnam 1986, 153.
82
Dichtendem und Bedichtetem. Ersterer ist es, der schon aufgrund
der großen Menge an Menschen, die besondere Taten vollbringen,
gezwungen ist, selektiv zu arbeiten. Erst durch seine Arbeit
wird die Tat des Helden vor dem Vergessen bewahrt und für die
Ewigkeit konserviert (v. 22ff.). Horaz räumt also letztlich
nicht nur der Dichtung – wie in c. 3,30 und c. 4,2 - eine
überlegene Position ein, auch ihr Erzeuger besitzt eine höhere
Gewalt als die Vollbringer der Taten, da der Dichter über ihr
Nachleben entscheidet. Wir finden diesen Gedanken in c. 4,9
fortgesetzt, wenn Horaz erneut die Abhängigkeit der Helden von
ihrem vates sacer bemerkt, der sie als Einziger vor der langen
Nacht des Vergessens schützen könne198.
Es scheint abschließend fast wie eine weitere Ironie, dass
zu Censorinus, dem ursprünglichen Adressaten, auch im
Schlussteil der Ode kein Bezug mehr auszumachen ist und dass
auch dessen Taten in Vergessenheit geraten sind, wie die
angesprochenen Schwierigkeiten bei der historischen Einordnung
dieser Person nahelegen.
III. 2. e) Ergebnisse der Einzelinterpretation
Nach der ausführlichen Untersuchung der donarem-pateras-Ode ist
festzuhalten, dass auch in c. 4,8 gewisse ironische Tendenzen
im Zusammenhang mit Ennius enthalten sind. Auch wenn sie198 c. 4,9,25-28: vixere fortes ante Agamemnona multi; sed omnes inlacrimabiles urgenturignotique longa nocte, carent quia vate sacro.
83
schwerer greifbar und noch graziler als im vorangegangenen c.
2,20 zu sein scheinen, hat diese Arbeit den Versuch
unternommen, die Indizien für die Rechtfertigung einer solchen
Interpretation auf stets begründete Weise herauszustellen.
Zusammenfassend lassen sich folgende Gründe vortragen:
Insgesamt wird die Ode von einer heiteren, humorvollen
Tonlage bestimmt, wie schon Kiessling kommentiert199.
Nichts spricht dafür, dass diese Stimmung im Mittelteil
des Gedichts gebrochen wird, welche vor allem durch die
Vorstellung erzeugt wird, Horaz würde seinen Kameraden
tatsächlich wertvolle Kunstwerke schenken - was er in
scherzhafter Selbstironie verneint.
Die Figur des Parrhasius, die Horaz als Vertreter der
bildenden Künste anführt, lässt vorsichtige Parallelen zu
Ennius erkennen. Während sich die positiven Eigenschaften
des Malers auch beim Dichter in ähnlicher Weise nachweisen
lassen, scheint es, als hätten sich beide auch in ihrer,
von sich selbst überzeugten Darstellung geglichen.
Der eigentliche Adressat, Censorinus, wird im Verlauf der
Ode völlig außer Acht gelassen. Dadurch distanziert sich
das Gedicht von der anfangs scheinbar pindarischen Ehrung
des Besungenen und es deutet sich an, dass Horaz hier wohl
einen profunderen Zweck verfolgt.
Beim Vergleich der Dichtung des Ennius mit stofflichen
Monumenten hinsichtlich ihrer Effektivität bei der
Verbreitung des Nachruhmes des jeweiligen Widmungsträgers
ist Horaz merkwürdig unpräzise, was die Bewertung angeht.
199 Vgl. Kiessling / Heinze 1955, 429.
84
Im Gegensatz zu anderen Stellen, an denen er die eigene
Dichtung (c. 3,30), oder die anderer Poeten (c. 4,2) dem
materiellen Gedächtniskult vorzieht, stellt er in c. 4,8
durch die negative Komparation (non clarius indicant quam)
keines der verglichenen Objekte höher als das andere.
Wenn Horaz - wie auch andere Dichter, was sich aus der
Analyse der Properz-Elegie 3,2 gezeigt hat – von einer
klaren Überlegenheit der Dichtung in dieser Hinsicht
ausgeht, er aber bei Werk des Ennius auf eine derart
eindeutige Positionierung verzichtet, erschließt sich
daraus eine indirekte, „höfliche“ Abwertung der
dichterischen Qualitäten seines Vorgängers.
Vom römischen Leser könnten die Unstimmigkeiten im
Zusammenhang mit Ennius und seiner Ehrung des Scipio
Africanus als Anspielung auf das aus republikanischer Zeit
stammende Gerücht von einer Ennius-Statue im Grabmahl der
Scipionen verstanden worden sein. Diese materielle Ehrung,
ob im Einverständnis des Dichters oder nicht, erzeugt
durch ihre Konstatierung einen starken Widerspruch mit der
Selbstdarstellung des Dichters (Grabepigramm) sowie dem
Anspruch, den er an seine Dichtung stellte (ann. 16), was
wiederum durch das Rahmenthema der Ode gespiegelt wird.
Horaz könnte das ironische Moment dieses Widerspruches
genutzt haben, um, wie schon in c. 2,20, auf indirekte
Weise die Selbstdarstellung des Ennius zu kritisieren.
Hierin fände sich zudem eine Motivation für die
vorangegangene Herabwürdigung seines Werkes.
Wie in den Voraussetzungen der Untersuchung erwähnt worden
ist, kann eine tatsächliche Intertextualität nur dann
85
bestehen, wenn diese sowohl dem Verfasser des Textes als
auch seinen Rezipienten bewusst ist, beziehungsweise von
diesen erkannt wird. In diesem Fall bestünde eine solche
Verbindung des Gedichts wohl zum einen mit den Texten des
Ennius, die den besagten Anspruch von der Überlegenheit
der Dichtung erstmal für die Gattung des Epos verkündeten,
zum anderen mit dem von Cicero und Livius tradierten
Gerücht der Ennius-Statue. Entscheidender wäre jedoch der
wahrscheinliche Umstand, dass ein Großteil der horazischen
Leserschaft sowohl das Werk des Ennius und dessen
Selbstdarstellung als auch das Gerücht seiner posthumen
Ehrung kannte. Die Voraussetzungen für eine eventuelle,
intertextuelle Beziehung wären also durchaus gegeben.
IV. Schlussbetrachtung
86
Nach eingehender Untersuchung und Interpretation der Oden 2,20
und 4,8 kommt die vorliegende Arbeit zu dem Schluss, dass eine
ironische Auslegung der Gedichte gerechtfertigt ist. Zunächst
ließen sich die zur Bestätigung notwendigen
Grundvoraussetzungen allesamt erfüllen:
Die Analyse zur Funktion und Verwendung von Ironie in der
Dichtung des Horaz hat gezeigt, dass dieser in seinem gesamten
Werk unterschiedliche Formen der Komik benutzt, die nicht
zwingend an die jeweilige Gattung gebunden sind. Darunter
findet sich auch die Ironie zum Zwecke der Selbstdarstellung
sowie als Mittel der Kritik. Um den Gebrauch von Witz und
Ironie anzuzeigen, bedient sich der Dichter gewisser, stets
kontextabhängiger Signale200.
Das Bild, welches Horaz von Ennius besaß, war
offensichtlich von einer starken Ambivalenz geprägt. Wie die
Untersuchung sämtlicher Textstellen aus dem horazischen Opus,
in denen es zu einer Erwähnung des Ennius kommt, ergeben hat,
schwankt die Bewertung des vorklassischen Dichters zwischen dem
Lob seiner geistigen Begabung (ingenium) und dem Tadel seiner
anscheinend mangelhaften, dichterischen Fertigkeit (ars). Es
ist ebenfalls aufgefallen, dass Horaz zur Art und Weise der
Selbstdarstellung seines Vorgängers offenbar eine distanzierte
Position einnimmt201.
Dementsprechend ergab der Vergleich der Selbstdarstellung
der Dichter, welcher anhand exemplarischer Textstellen beider
Interpreten durchgeführt wurde, eine starke Diskrepanz in
Anspruch und Formulierung. Wenn Horaz, wie besonders in c.200 Vgl. S. 8ff.201 Vgl. S. 17f.
87
3,30, Stolz und Selbstzufriedenheit aufgrund seiner
literarischen Errungenschaften zeigt, dann verbleibt er doch
stets in einer, durch Mäßigung geprägten Tonlage. Ennius
hingegen wartet mit einer beinahe schon angeberisch wirkenden
Selbstdarstellung auf, die nicht auf Zurückhaltung bedacht
ist202.
Auch die Bedingungen für eine mögliche Intertextualität
der untersuchten Gedichte können als erfüllt angesehen werden.
Es ist, wie die Untersuchung gezeigt hat, einerseits davon
auszugehen, dass Horaz bewusst solche Bezüge konstruiert hat.
Auf der anderen Seite ist im Falle des Ennius auch anzunehmen,
dass derartige Verbindungen aufgrund des hohen
Bekanntheitsgrades seiner Literatur auch vom horazischen
Publikum wahrgenommen wurden203.
Bevor nun die Ergebnisse der Einzelinterpretationen besprochen
werden, scheint es angebracht, sich einmal mit dem thematischen
Hintergrund der untersuchten Gedichte auseinanderzusetzen:
vixere fortes ante Agamemnona
multi; sed omnes inlacrimabiles
urgentur ignotique longa
nocte, carent quia vate sacro. (c.
4,9,25-28)
Auf diese Weise drückte Horaz in den Oden seine Auffassung von
der Fähigkeit des Poeten aus, einer durch seine Dichtung
202 Vgl. S. 18ff.203 Vgl. S. 23ff.
88
gefeierten Person, dank der fortwährenden Rezeption seines
literarischen Werkes durch die Nachwelt, zur Unsterblichkeit zu
verhelfen. Gleichzeitig schenkt die Dichtung auch ihrem
Verfasser ewigen Nachruhm, wie Horaz im berühmten Epilog des
dritten Odenbuches formuliert (c. 3,30). Dieser Gedanke,
welcher ursprünglich in der griechischen Panegyrik entstanden
ist, war der römischen Literatur bis dahin nicht unbekannt.
Bevor Horaz den genannten Anspruch in den Oden erstmals für die
lyrische Dichtung behauptete, hatte bereits Ennius ähnliche
Ambitionen für seine, größtenteils epische Poesie gehegt204.
Beide Dichter verflechten diesen Anspruch in solche
Textpassagen ihrer Werke, die notwendigerweise der
Selbstdarstellung dienen. Aufschlussreich ist dabei die Art, in
welcher der Anspruch formuliert wird. Sowohl Horaz als auch
Ennius greifen in den Szenen der Selbstdarstellung gerne auf
das Mittel des Vergleichs mit, oder Bezugs auf einen früheren
Dichter zurück, welcher in der Regel aufgrund dessen Vorbild-
und oder Vorläuferfunktion eine wichtige Rolle für die eigene
Dichtung einnimmt. Gleichzeitig werden so Ziel und
dichterisches Programm der eigenen Poesie definiert und die
Leistungen des Vorläufers anerkannt sowie geehrt.
Horaz stellt in der Ode 4,2, die sich sowohl mit dem Thema
der literarischen Unsterblichkeit als auch mit dem vom Dichter
vertretenen Kunstprinzip auseinander setzt, einen direkten
Bezug zu seinem großen Vorbild Pindar her. Ähnlich verfährt
Ennius, wenn er sich im Proömium seines Hauptwerkes, dem Epos
annales, in direkter Nachfolge Homers positioniert205.
204 So vor allem in dem ihm zugeschriebenen Grabepigramm, Ennius frg. var. 17(V).205 Enn. ann. **ii - **ix (Sk).
89
Die Bedeutung der Dichtkunst - sowohl für den Ruhm ihres
Dichters, als auch für das durch sie gepriesene Individuum -
stellt auch in den untersuchten Oden das übergeordnete
Leitmotiv dar. Jedoch setzt sich Horaz in c. 2,20 und c. 4,8
auf eine kritische und vor allem ironische Weise mit diesem
Thema auseinander, wie es diese Arbeit zu zeigen versucht hat.
Er stößt bei der Bewertung des Ennius, welcher Vorgänger und in
mancher Hinsicht sicherlich auch Vorbild gewesen ist, auf
Diskrepanzen zwischen dichterischem Anspruch und tatsächlicher
Qualität, beziehungsweise Darstellung des Dichters. Der
Vorklassiker unterscheidet sich in diesen Kategorien zudem von
der persönlichen Auffassung Horazens. Nach der vorangegangenen
Untersuchung scheint es, als habe Horaz in seinen Gedichten
versucht, durch konstruierte Widersprüche auf diese Divergenz
anzuspielen:
Dies vollzieht in Bezug auf den dichterischen Anspruch
seines Vorgängers in c. 2,20. Horaz verbindet hier das von
Ennius wohlbekannte Motiv des Dichterfluges zur Postulierung
poetischer Unsterblichkeit mit der aemulatio an ein persönliches
Vorbild. Auch letzteres erinnert durch die überlieferte
Selbstbezeichnung des Ennius als alter Homerus an den
Vorklassiker. Gleichzeitig wird spätestens, so hat es die
Untersuchung gezeigt, an dieser zweiten Anspielung deutlich,
dass Horaz das Gedicht nicht wirklich auf sich selbst bezieht,
sondern eine ironische, den angeblichen dichterischen Anspruch
des Ennius imitierende Tonlage anstimmt. Denn eine derartige
Selbstdarstellung ist dem augusteischen Dichter ansonsten sehr
fremd und wird an anderer Stelle sogar von ihm verurteilt (c.
90
4,2). Der anschließend in der Ode angebrachte Vergleich mit dem
Ikarusmythos lässt die Ironie nur noch weiter zum Vorschein
treten: Durch seinen Flug bekannter als der gefallene
Dädalussohn zu sein, kann in diesem Sinne nur auf noch größere
Ausmaße des eigenen Scheiterns verweisen. In Verbindung mit der
starken Intertextualität des Gedichts entsteht so eine
indirekte Kritik an Ennius206.
In c. 4,8 lässt sich eine Auseinandersetzung mit den
anscheinenden Unterschieden in Darstellung und Selbstdarstellung
des Ennius erkennen. Ausgehend von der Fragestellung und im
Rückgriff auf die erarbeiteten Voraussetzungen erscheint hier
die von Horaz ungewohnte Undeutlichkeit bei der vergleichenden
Bewertung der Dichtung und materieller Güter hinsichtlich ihrer
Bedeutung für den Nachruhm ihres Besitzers als verdächtig. Im
Vergleich mit anderen Textstellen, die eine klare Favorisierung
eigener und fremder Dichtkunst belegen, setzt Horaz die
Dichtung des Ennius bei wörtlicher Auslegung der Ode auf eine
Stufe mit den stofflichen Andenken. Außerdem wäre es möglich,
dass Horaz durch die fehlerhafte Wiedergabe Taten der
Scipionen, die von Ennius bedichtet worden waren, auf ein bei
seinem römischen Publikum bekanntes Gerücht einer Statue des
vorklassischen Dichters in der Familiengruft der Scipionen
anspielen wollte. Hierin fände sich eine weitere Abweichung der
ennianischen Selbstdarstellung und den tatsächlichen Umständen
im Umgang mit seinem Nachruhm – denkt man nur an das berühmte
Grabepigramm des Dichters. Diese Divergenz gäbe Horaz
zusätzliche Motivation zur Kritik seines Vorgängers207.
206 Vgl. S. 37f.207 Vgl. S. 54f.
91
Die von Horaz angewandte Ironie, in deren Spiegel sich ein von
Überheblichkeit verzerrtes Bild des Ennius zeigt, gestaltet die
Kritik weniger direkt und entwickelt den Eindruck einer
sozusagen „augenzwinkernden“ Zurechtweisung. Es ist darauf zu
verweisen, dass Horaz sicherlich nicht die Parodie oder gar
Bloßstellung des Ennius vor Augen hatte. Denn die horazische
Komik ist, wie wir herausgestellt haben, stets konstruktiv und
darf nicht zur bloßen Posse verkommen208. Vielmehr scheint es
ihm darum zu gehen, auf pointierte und dem Dichterkollegen
gegenüber respektvolle Weise seine persönliche Kritik an dessen
Selbstdarstellung und Ansprüchen auszudrücken (ridentem dicere
verum). Horaz kreiert somit eine feinfühlige Art der
Beurteilung seines Vorgängers, die zu keinem Zeitpunkt die
Grenzen der gegenseitigen Anerkennung verletzt und überhaupt
auch nur vom aufmerksamen Rezipienten wahrgenommen wird.
Die Tatsache, dass er dieses Kunststück in c. 2,20 anhand
seiner eigenen Person vorführt, ermöglicht Horaz einerseits die
indirekte Kritik des Vorgängers, andererseits deutet diese Art
der Darstellung auch Horazens eigene Verwundbarkeit gegenüber
der reizvollen Selbstbehauptung allzu überladener, poetischer
Ansprüche an. So wie Ikarus die dem Menschen vorenthaltene
Möglichkeit des Vogelfluges reizte, ergibt die horazische
Allusion, dass es auch für den Poeten schwer sei, sich den
Sehnsüchten und Wunschvorstellungen von dichterischer
Untersterblichkeit in angebrachter Weise zu entziehen.
Dass Horaz schließlich dennoch in der Lage ist, diese
Ansprüche für sich selbst zu formulieren, zeigt er zum
Abschluss der ersten drei Odenbücher eindrucksvoll in c. 3,30.
208 Vgl. S. 12.
92
Zwar offenbart der augusteische Dichter hier in ernsthaftem und
feierlichem Ton den Stolz und die Zufriedenheit mit seinen
literarischen Errungenschaften. Doch im Gegensatz zu den
besprochenen Selbstansprüchen des Ennius oder dem Epilog des
zweiten Odenbuches schlägt Horaz eine sehr nüchterne, moderate
Tonlage an, die sich in jeder Zeile des Gedichtes äußert. Die
Vermutung, dass Horaz auch in c. 3,30 auf einen ennianischen
Prätext zurückgriffen hat, verbietet jedoch m. E. keineswegs
eine ironische Interpretation der intertextuellen Referenzen an
anderer Stelle. Vielmehr deckt sich die unterschiedliche
Behandlung der Dichtung des Ennius mit der ambivalenten
Meinung, die Horaz über ihn vertreten hat.
Abschließend scheint es fast wie eine Ironie des
Schicksals, dass es der doch so von seinem Nachruhm überzeugte
Ennius war, der letztlich aus der Rezeption verdrängt worden
ist. Zwar passierte dies nicht durch Horaz, sondern durch die
Aeneis Vergils, womit die annales als römisches Nationalepos
abgelöst wurden. Das Werk des Ennius ging schon kurze Zeit
später zu großen Teilen verloren und ist heute nur noch
fragmentarisch überliefert.
Es könnte zudem als Anzeichen für den, wie D. West
kommentiert, zarten und bedachten Humor des Horaz209 verstanden
werden, dass eine ironische Interpretation des Gedichts in der
Forschung auch bis heute nur von wenigen Wissenschaftlern
ernsthaft in Erwägung gezogen wurde. Dabei handelt es sich doch
um den Dichter, welchen E. Zinn als einen der „ganz seltenen,
echten Ironiker der europäischen Geistesgeschichte“
apostrophiert hat210.209 West 1998, 145.210 Zinn 1960, 53.
93
Der Verfasser der vorliegenden Untersuchung möchte abschließend
darauf verweisen, dass er die dargelegte Interpretation
keineswegs als einzige Deutungsmöglichkeit des Gedichtes
erachtet. Der Sinn der Arbeit soll vielmehr darin bestehen,
neue Perspektiven in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit den Oden des Horaz zu unterstützen und eventuell auch zu
erweitern. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Untersuchung
wäre es ausblickend interessant, mögliche Bezüge zu Ennius in
anderen Oden des Horaz zu prüfen und im Hinblick auf ihre
Bewertung des Vorklassikers zu analysieren.
V. Bibliographie
Editionen
o Ennius, Qu.: Annales, edit. v. Skutsch, O., Oxford 1985.
o Ennius, Qu.: Ennianae poesis reliquiae, edit. v. Vahlen, J.,
Leipzig 1903.
94
o Horatius Flaccus, Qu.: Opera, edit. v. Shackleton Bailey,
D. R., Berlin / New York 2008.
Kommentare
o Kiessling, A. / Heinze, R.: Oden und Epoden, m. Nachwort
v. E. Burck, Berlin 81955.
o Nisbet, R. G. M. / Hubbard, M.: Odes. Book 2, Oxford 1978.
o Page, T. E.: Horatii Flacci Carminum Libri IV, London 1895.
o Skutsch, O.: The Annals of Quintus Ennius, Oxford 1985.
o Thomas, R. F.: Odes book IV and Carmen saeculare, Cambridge
2011.
Sekundärliteratur
o Abel, K.: Horaz. c. 2,20, in: Rheinisches Museum für
Philologie 104 (1961), 81-94.
o Amelung, W.: Die Sculpturen des Vaticanischen Museums, Bd.
II, Berlin 1908.
o Antony, H.: Humor in der augusteischen Dichtung. Lachen
und Lächeln bei Horaz, Properz, Tibull und Vergil,
Hildesheim 1976.
o Breuer, J.: Der Mythos in den Oden des Horaz. Praetexte,
Formen, Funktionen, Göttingen 2009.
o Brink, C. O.: Horace on Poetry. Epistels Book II. The
Letters to Augustus and Florus, Cambridge (1982)
o Coarelli, F.: Il sepulchro degli Scipioni, in: Dialoghi di
Archeologica 6, 1972, 36-106.
95
o ders.: Rom. Ein archäologischer Führer, bearb. v. Gabucci,
A., Mainz 2000.
o Connelly, C. Enemies of promise, London 1951.
o Connor, P.: Horace’s lyric poetry. The force of humour,
Berwick 1987.
o Dahlmann, H: Studien zu Varro de poetis, Mainz 1963.
o Erasmo, M.: Birds of a Feather? Ennius and Horace. Odes 2,
20, in: Latomus 65 (2006), 369-377.
o Fowler, D.: On the Shoulders of Giants. Intertextuality
and Classical Studies, in: Materiali e discussioni per
l'analisi dei testi classici, 1997, Issue 39, S. 13-34.
o Fraenkel, E.: Horace, Oxford 1957.
o Frisk, H.: Griechisches etymologisches Wörterbuch,
Heidelberg 1960.
o Fuchs, H.: „O Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein“.
ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ, in: Edgar Salin zum 70. Geburtstag, Tübingen
1962, 149-166.
o Fuhrmann, M.: Geschichte der Römischen Literatur,
Stuttgart 1999.
o Gall, D.: Die Literatur in der Zeit des Augustus,
Darmstadt 2006.
o Genette, G.: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe,
Frankfurt am Main 1993.
o Günther, H.-C.: Pindar, Kallimachos und Horaz, in SIFC,
Serie 17, 1999, 145-161.
o Hills, P. D.: Ennius, Suetonius and the Genesis of Horace,
Odes 4, in: The Classical Quarterly, New Series, Vol. 51,
No. 2 (2001), 613-616.
96
o Hardie, P.: Vt picture poesis? Horace and the Visual Arts, in:
Rudd, N. (Hrsg.): Horace 2000. A celebration. Essays for
the Bimillenium, London 1993, 120-139.
o Harrison, S. J.: The Praise Singer. Horace, Censorinus and
Odes 4,8, in: JRS 80 (1990), 31-43.
o Holzberg, N.: Horaz. Dichter und Werk, München 2009.
o Johnson, W. R.: The boastful bird. Notes on horatian
modesty, in: CJ 61, 1966, 272-275.
o Kristeva, J.: Σημειωτική. Recherches pour une sémanalyse,
Paris 1969.
o MacKay, L. A.: Horace airborne. Exercise on Odes 2,20, in:
Arion 3, no. 4, 1964, 125.
o Martindale, C.: Introduction, in: Martindale, C. u.
Hopkins, D.: Horace made new. Horatian influences on
British writing from the Renaissance to the twentieth
century, Cambridge 1993, 1-27.
o Meister, K.: Die Tugenden der Römer, in: Oppermann, H.
(Hrsg.): Wege der Forschung, Bd. 34, Darmstadt 1967, 1-26.
o Oesterlen, T.: Komik und Humor bei Horaz, Stuttgart 1886.
o Paul, J.: Vorschule der Ästhetik, hrsg. v. Miller, N., Bd.
5, München 1963.
o Perret, J.: Horace, Paris 1959.
o Pfister, M.: Konzepte der Intertextualität, in: Broich, V.
u. Pfister, M. (Hrsg.): Intertextualität. Formen,
Funktionen, anglistische Fallstudien, (Konzepte der
Sprach- und Literaturwissenschaft 35), Tübingen 1985, 1-
30.
o Pöschl, V.: Horaz und die Politik, Heidelberg 1963.
o Prinzen, H.: Ennius im Urteil der Antike, Stuttgart 1998.
97
o Putnam, M. C. J.: Artifices of Eternity. Horace’s Fourth
Book of Odes, New York 1986.
o Sack, V.: Ironie bei Horaz, Würzburg 1965.
o Schanz, M. / Hosius, C.: Geschichte der römischen
Literatur bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian,
Bd. 2, München 31911.
o Schwinge, E. R.: Horaz. Carmen 2,20, in: Hermes Bd 93, H.
4 (1965), 438-459.
o ders.: Zur Kunsttheorie des Horaz, in: Philologus 107, 75-
96.
o Seeck, G. A.: Über das Satirische in Horaz’ Satiren. Oder:
Horaz und seine Leser, z. B. Maecenas, in: Gymnasium 98
(1991), 534-547.
o Speier, H.: Die päpstlichen Sammlungen im Vatikan und
Lateran, in: Helbig, W. (Hrsg.): Führer durch die
öffentlichen Sammlungen klassischer Altertümer in Rom,
Vol. I², Tübingen 1963.
o Suerbaum, W.: Untersuchungen zur Selbstdarstellung älterer
römischer Dichter. Livius Andronicus, Naevius, Ennius,
Hildesheim 1968.
o Syndikus, H. P.: Die Lyrik des Horaz. Eine Interpretation
der Oden, Bd. 2, Darmstadt 1972.
o Wahrmuth, G.: Autobiographische Tierbilder bei Horaz,
Hildesheim 1992.
o West, D. A.: Horace Odes II: Vatis Amici, Oxford 1998.
o Zinn, E.: Elemente des Humors in augusteischer Dichtung,
in: Gymnasium 67, 41-56.
98