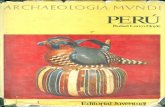Nachdenken auf der Karte. Mappae Mundi als Spiegel spätmittelalterlichen Weltwissens
-
Upload
fernuni-hagen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Nachdenken auf der Karte. Mappae Mundi als Spiegel spätmittelalterlichen Weltwissens
Periplus 2013
JAHRBUCH FÜR AUSSEREUROPÄISCHE GESCHICHTE
23. Jahrgang
herausgegeben von Christoph Marx
in Verbindung mit Helmut Bley,
Sabine Dabringhaus, Bernhard Dahm, Gita Dharampal-Frick,
Andreas Eckert, Ulrike Freitag, Mark Häberlein, Christine
Hatzky, Hermann Kulke, Roderich Ptak, Dietmar Rothermund,
Birgit Schäbler, Eberhard Schmitt und Susanne Weigelin-
Schwiedrzik
Redaktion: Nicole Wiederroth, Felicitas Solbrig
Herausgeber des Thementeils
„Weltwissen vor Kolumbus“:
Justus Cobet
www.periplus-jahrbuch.de
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar
© LIT VERLAG Dr. W. Hopf Berlin 2013 Auslieferung/Verlagskontakt:
Fresnosstr. 2, D-48159 Münster
Tel, +49 (0) 251 / 620320 Fax +49 (0) 251 / 231972
E-Mail: [email protected] http://www.lit-verlag.de
i
INHALT
THEMA: WELTWISSEN VOR KOLUMBUS
Justus Cobet Weltwissen vor Kolumbus ..................................................................................... 1
Justus Cobet Die Horizonte der antiken Oikumene: eine Vorgeschichte zu Kolumbus .......................................................................... 7
Eckart Olshausen Der Periplus zwischen Seehandbuch und Literatur ......................................... 35
Johannes Engels Strabons Weltbild, seine Horizonte und die Ränder der Oikumene .............................................................................. 58
Klaus Geus „… wie man beim Fehlen einer Kartenvorlage nur an Hand des Textes eine Weltkarte sehr leicht herstellen kann“: Die Darstellung der Oikumene bei Klaudios Ptolemaios ........................................................................................ 76
Michael Rathmann Die Tabula Peutingeriana und die antike Kartographie ..................................... 92
Michael Oberweis Die mittelalterlichen T-O-Karten ....................................................................... 121
Brigitte Englisch Alia pictura, in qua erat imago terrae in modum orbis comprehensa. Topographische „Realität“ und geographisches Wissen in den Mappae mundi des frühen und hohen Mittelalters ............................... 135
Thorsten Fischer Europa und der ferne Norden. Wahrnehmungen und Vorstellungen im frühen und hohen Mittelalter .................................................................................................. 166
Hannes Möhring Interesse und Desinteresse mittelalterlicher Muslime an Land und Leuten in Europa .......................................................................... 183
ii
Detlev Quintern Die Weltkarte der Ma’am ūn-Geographen ....................................................... 231
Felicitas Schmieder Nachdenken auf der Karte. Mappae Mundi als Spiegel spätmittelalterlichen Weltwissens ................................................. 236
BLICK IN DIE FORSCHUNG
Hennig Melber UNO Generalsekretär Dag Hammarskjöld und der Kongo (1960/61) ............................................................................................. 258
REZENSIONEN
Emily S. Rosenberg (Hg.), Geschichte der Welt, Band 5: 1870-1945. Weltmärkte und Weltkriege, München, Cambridge 2012 (Dietmar Rothermund) ............................................................. 268
Monika Kirloskar-Steinbach, Gita Dharampal-Frick, Minou Friele (Hg.), Die Interkulturalitätsdebatte – Leit- und Streitbegriffe. Intercultural Discourse – Key and Contested Concepts, Freiburg 2012 (Wolfgang Reinhard) ................................ 272
Benedikt Stuchtey, Die europäische Expansion und ihre Feinde. Kolonialismuskritik vom 18. bis in das 20. Jahrhundert, München 2010 (Jörg Fisch) ..................................................... 274
Ramon Leemann, Entwicklung als Selbstbestimmung. Die menschenrechtliche Formulierung von Selbstbestimmung und Entwicklung in der UNO, 1945-1986, Göttingen 2013 (Reinhart Kößler) ..................................................... 276
Michael Borgolte, Matthias M. Tischler (Hg.), Transkulturelle Verflechtung im mittelalterlichen Jahrtausend. Europa, Ostasien und Afrika, Darmstadt 2012 (Wolfgang Drews) ..................................................................... 279
Karl R. Wernhart (Hg.), Christoph Carl Fernberger. Der erste österreichische Weltreisende 1621-1628, Münster 2012 (Tilman Frasch) ............................................................................. 280
Pierre-Yves Manguin, A. Mani, Geoff Wade (Hg.), Early Interactions between South and Southeast Asia. Reflections on Cross-Cultural Exchange, Singapur 2012 (Tilman Frasch) ..................................................................................................... 281
iii
Eugene Rogan, Die Araber. Eine Geschichte von Unterdrückung und Aufbruch, Berlin 2012 (Werner Ende) ............................ 283
Thomas Kiefer, Die britischen Kolonien Kenia, Nord- und Südrhodesien in der Entkolonialisierung 1945-1965. Politische Strukturen von Siedlergesellschaften in der Krise, Berlin 2012 (Reinhart Kößler) ......................................................... 286
Ulrike Lindner, Koloniale Begegnungen. Deutschland und Großbritannien als Imperialmächte in Afrika 1880-1914, Frankfurt am Main, New York 2011 (Benedikt Stuchtey) ................................. 287
Lloyd Sachikonye, When a State Turns on its Citizens: Institutionalized Violence and Political Culture, Harare 2011 (Rita Schäfer) .................................................................................... 289
Carolyn Hamilton, Bernard K. Mbenga, Robert Ross (Hg.), The Cambrige History of South Africa, Volume 1: From Early Times to 1885; Robert Ross, Anne Kelk Mager, Bill Nasson (Hg.), The Cambridge History of South Africa, Volume 2: 1885-1994, Cambridge 2011 (Christoph Marx) ................................ 291
Nigel C. Gibson, Fanonian Practices in South Africa. From Steve Biko to Abahlali baseMjondolo, Scottsville 2011 (Christoph Marx).................................................................................................... 297
Daniel Conway, Masculinities, Militarisation and the End Conscription Campaign: War Resistance in Apartheid South Africa, Manchester 2012 (Rita Schäfer) .................................................. 299
Alice L. Conklin, Sarah Fishman, Robert Zaretsky, France and Its Empire Since 1870, New York, Oxford 2011 (Felicitas Solbrig) ............................................................................. 302
Ulrike Schmieder, Katja Füllberg-Stolberg, Michael Zeuske (Hrsg.), The End of Slavery in Africa and the Americas. A Comparative Approach, Berlin 2011 (Jörg Nagler) ..................................................................................... 304
Roquinaldo Ferreira, Cross-Cultural Exchange in the Atlantic World. Angola and Brasil during the Era of the Slave Trade, Cambridge 2012 (Hanna Sonkajärvi) ................................. 308
Ulrike Schmieder, Hans–Heinrich Nolte (Hg.), Atlantik. Sozial- und Kulturgeschichte in der Neuzeit, Wien 2010 (Horst Pietschmann) .............................................................................................. 311
iv
Stephen J. Hornsby, Surveyors of Empire. Samuel Holland, J. F. W. Des Barres and the Making of the Atlantic Neptune, Montreal 2011 (Benedikt Brunner) ........................... 313
Susan Schulten, Mapping the Nation. History and Cartography in Nineteenth-Century America, Chicago 2012 (Ute Schneider) .............................................................................. 315
Tim Wätzold, Vom kaiserlichen zum nationalen Koch. Ernährungsgeschichte des brasilianischen Kaiserreichs, Mettingen 2011 (Reinhardt Wendt) ..................................................................... 318
Jessica Stites Mor, Transition Cinema. Political Filmmaking and the Argentine Left since 1968, Pittsburgh 2012 (Christine Hatzky) ..................................................................... 320
Johannes H. Voigt, Geschichte Australiens und Ozeaniens. Eine Einführung, Köln, Weimar, Wien 2011 (Ewald Frie) ............................... 322
ANSCHRIFTEN DER AUTOREN
236
Nachdenken auf der Karte. Mappae Mundi als Spiegel spätmittelalterlichen Weltwissens
Felicitas Schmieder
"Ich sah beim Großkhan auch Boten [... aus ...] Indien […]. Als ich sie fragte, wo es von jenem Ort aus liege, zeigten sie [...] gen Westen", berichtet der franziskanische Missionar Wilhelm von Rubruk, der um 1250 in das Kern-gebiet der Mongolen gereist war und sich dort „orientieren“ wollte.1 Da im oriens, ganz im Osten der Welt, aber nach dem traditionellen Weltbild der Lateineuropäer, Indien lag, hätte die Befragung indischer Boten diesem Zweck am ehesten dienen sollen. Doch angesichts ihrer Antwort fand sich Rubruk unversehens jenseits des äußersten Ostens wieder – nicht die einzige Verwirrung, auch nicht die einzige geographischer Art, in die er auf seiner weiten Reise gestürzt wurde.
Zugleich ist diese Reise aber auch Beleg von einer großen Offenheit Neuem gegenüber, die sich im Lateineuropa des 12. Und 13. Jahrhunderts breitgemacht hatte.2 Im Verlauf der Kreuzzüge war man aufgebrochen, die eigenen Grenzen zu verlassen, auch wenn man sich im Heiligen Land noch auf Christi Spuren und damit auf bekanntem Boden wähnte. Als dann 1241 die Mongolen, von den Lateineuropäern und anderen Opfern ihrer Erobe-rungen Tartaren genannt (nicht zuletzt weil das nach dem Tartaros, der Hölle klang – doch gewiss auch weil eines der früh unterworfenen Völker den Namen Tatar trug), vernichtend in Mitteleuropa eingefallen waren, zu-
1 Wilhelm von Rubruk, Itinerarium, ed. Anastasius van den Wyngaert, Sinica
Franciscana Bd. I: Itinera et Relationes Fratrum Minorum saeculi XIII et XIV, Quaracchi 1929, Buch XXXVI, Kap. 3, S. 306; The Mission of Friar William of Rubruck. His Journey to the Court of the Great Khan Möngke 1253–1255, transl. and notes by P. Jackson, D. Morgan, London 1990, S. 247.
2 Zusammenfassend zu diesem Phänomen jetzt Thomas F. X. Noble, John Van Engen (Hg.), European Transformations. The Long Twelfth Century, Notre Dame 2012; vgl. aber noch Robert L. Benson, Giles Constable (Hg.), The Renaissance of the 12th Century, Oxford 1983. Zur Bedeutung des Aufbruchs im Zusammenhang mit den Mongolen vgl. Felicitas Schmieder, The World of the Codex Cumanicus – The Cumanicus in its World, in: dies., Peter Schreiner (Hg.), Il Codice Cumanico e il suo Mondo, Rom 2005, S. XIII-XXXI, und dies., Der mongolische Augenblick in der Weltgeschichte oder: Als Europa aus der Wiege wuchs, in: dies. (Hg.), Das Mittelalter 10, 2, 2005, S. 63-73.
237
gleich aber auch den Weg ins ferne Ostasien geöffnet hatten, ergriffen eine ganze Reihe von Lateineuropäern die Gelegenheit zur Erforschung. Wilhelm von Rubruk (gereist 1253–1255) gehörte zu den ersten, noch früher (1245–1247) war sein Ordensbruder Johannes von Plano Carpini mit einige Ge-fährten bis ins mongolische Heimatgebiet gelangt, und auch im Vorderen Orient und westlichen Eurasien fanden sich nach und nach mehr und mehr Lateineuropäer; deren berühmtester ist der Kaufmannssohn Marco Polo ge-wesen (gereist um 1270).3
Sie alle trafen auf ähnliche Probleme wie Rubruk, auch wenn nicht alle in einer Form davon berichteten, die für uns heute noch nachvollziehbar ist. Und manche sprachen ihre neuen Vermutungen und Überzeugungen nicht ganz so deutlich aus. Als einige Jahrzehnte nach Rubruk der Franziskaner Johannes von Monte Corvino (der 1307 von Clemens VII. zum ersten Erzbi-schof von Peking geweiht werden sollte) 1305 aus Ostasien nach Europa schrieb, da charakterisierte er seinen Standort: „In dieses Land [...] gelangte weder irgendein Apostel noch ein Schüler der Apostel.“4 Er formulierte da-mit den Anspruch, selbst ein Apostel zu sein (und konnte im 15. Jahrhundert auch als solcher angesprochen werden).5 Doch er sagte damit auch, dass sich das Land außerhalb des bisher Gekannten befinde – hatten doch die Jünger Jesu sich gemäß dem Aussendungsbefehl zu Pfingsten in alle Länder und zu allen Völkern begeben. Und eine Version der Weltkarte, die den Apokalypsekommentar des Beatus von Liébana begleitet, zeigt seit Ende des
3 Vgl. Peter Jackson, The Mongols and the West 1221–1410, Harlow 2005; Felicitas
Schmieder, Europa und die Fremden. Die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert, Sigmaringen 1994.
4 Johannes von Monte Corvino, Briefe, ed. in: Sinica Franciscana Bd. I, Brief II, Kap. 1, S. 347. Eine ähnliche Erkenntnis von Neuheit liegt vielleicht in der Äußerung eines Franziskaners 1323 aus Caffa, Krim: Das Land, in dem er lebe, gehöre zu keinem der bekannten Klimata: De duabus Epistolis Fratrum Minorum Tatariae Aquilonaris an. 1323, ed. Michael Bihl, Arthur Christopher Moule, in: Archivum Franciscanum Historicum 16, 1923, S. 89-112, hier S. 110.
5 Vgl. Jean Germain, Le discours du voyage d'oultremer au très victorieux roi Charles VI, prononcé, en 1452, par J. G., évêque de Châlon, ed. Charles Schefer, in: Revue de l’Orient Latin 3, 1895, S. 303-42, hier S. 319, S. 322; ders., Mappemonde
spiritelle, BN Paris fr. 13235, fol. 20b-20va.
238
11. Jahrhunderts genau dies: Apostelgräber sind über die gesamte Welt ver-teilt.6
Das waren irritierende Feststellungen angesichts der Tatsache, dass die Lateineuropäer ihr Weltbild eigentlich für vollständig hielten: biblische und heidnische antike Tradition, Kirchenväter und Legenden hatten dafür ge-sorgt, dass von Gottes gesamter Schöpfung in den Büchern zu lesen war. Viel zitiert ist die nachdenkliche Formulierung des englischen Benediktiners Matthäus Parisiensis um 1250 (der im königsnahen Kloster Saint Albans über alle möglichen Informationen über die so plötzlich aufgetauchten Mongolen verfügte):
„ [...] die ganze Welt umfasst sieben Klimata, nämlich das der Inder, der Äthiopier oder Mauren, der Ägypter, der Jerusalemitaner, der Griechen, der Römer und der Franken, und in unserer ganzen be-wohnbaren [Welt] ist keines davon so weit entfernt, dass es die Kauf-leute nicht zu Schiff aufsuchen würden, weshalb der Dichter Horaz sagt: 'rührig fährst Du, Kaufmann, bis ins äußerste Indien': Wo haben sich so viele und solche [Menschen] bis heute verborgen?“7
Aber auch wenn die Reisenden angesichts der angetroffenen Diskrepanzen nicht mehr schweigen mochten, so war diese Korrektur des Erlebens den Daheimgebliebenen nicht gegeben – und es dauerte lange, bis im festgefüg-ten und gottgegebenen Weltbild die Erwartung von Erweiterbarkeit oder prinzipieller Veränderbarkeit des Wissens von der Welt Platz fand. Nur ganz allmählich setzte man sich mit der Existenz von Diskrepanzen grund-sätzlich auseinander – noch langsamer war man bereit, den neuen Erkennt-
6 Aussendungsbefehl Mt. 28, 19/20 Euntes ergo docete omnes gentes; vgl. Mk.16, 5 Lk.
24, 47. Zum Beatus-Corpus und den Karten vgl. John Williams, The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apokalypse, 5 Bde., London 1994–2003; hier die Osma-Weltkarte von 1086, Bd. 1, S. 51, Abb. 21. Ähnlich die Beatus-Karte Biblioteca Ambrosiana in Mailand (ms. F. 105. SUP, Ende S. XII, fol. 71v-72v). Zu den Beatuskarten Brigitte Englisch, Ordo orbis terrae. Die Weltsicht in den Mappae Mundi des frühen und hohen Mittelalters, Berlin 2002; sowie dies. in diesem Band. Ingrid Baumgärtner, Visualisierte Weltenräume. Tradition und Innovation in den Weltkarten der Beatustradition des 10. bis 13. Jahrhundert, in: Hans Joachim Schmidt, Tradition, Innovation, Invention. Fortschrittsverweigerung und Fortschrittsbewußtsein im Mittelalter, Berlin 2005, S. 231-76.
7 Matthäus Parisiensis, Chronica maiora, ed. Henry Richards Luard, 7 Bde. = Rerum Britannicarum Scriptores 57, 1-7, London 1872–83, Bd. IV, S. 120.
239
nissen prinzipiell den Vorrang vor dem Altüberkommenen zu geben. All das allerdings sollten letztlich gedankliche Vorarbeiten sein: Als Ende des 15. Jahrhunderts neue Entdeckungen das alte Weltbild endgültig sprengten, konnten Geo- wie Kartographen innerhalb weniger Jahre reagieren. Doch vorerst war das Überlieferte das Gesicherte: Als eines der Mitglieder der Gruppe um Johannes von Plano Carpini, der Franziskaner Benedikt von Polen, auf der Rückreise 1247 durch Köln kam und dort von seinen Erlebnis-sen berichtete, schrieb diese ein sonst unbekannter Kölner Kleriker nieder. Immer wieder versuchte er dabei, sich ein Bild zu machen von dem, was er da hörte und aufschrieb: So berichtet er, die Reisenden „fanden ... [an der Grenze von Kumanien] viele Sümpfe ..., von denen wir glauben, es seien die Mäotischen Sümpfe“. Und im Lande der Karakitai „fanden sie ein Meer zur Linken, das wir für das Kaspische Meer halten“. Johannes von Plano Carpini selbst, höchst vorsichtig mit Urteilen und eher dazu neigend, Fremdartiges unkommentiert darzustellen, beschrieb die geographische Lage des Ortes, bis zu dem die Reisenden gelangt waren, „wo sich ... der Osten mit dem Norden vereinigt“.8 Darüber hinaus nannte er die Namen der angrenzenden Gebiete: Im Osten liegt das Gebiet der Kitai und das der Solangi, im Süden das der Sarazenen, im Südwesten das der Huii und im Westen das der Naimani; im Norden schließlich wird das Tartarenland vom Oceanus umge-ben.9 Diese Beschreibung einer Region durch die umliegenden Gebiete ist eine ganz übliche Methode der mittelalterlichen Weltbeschreibung, doch er-klärt sie in diesem Falle Unbekanntes weitgehend mit Unbekanntem. Zwar sind der nördliche Ozean und die Sarazenen ein Begriff, dafür aber fehlen andere Namen aus der traditionellen Geographie Asiens, die die abendlän-dischen Zuhörer und Leser des Johannes wohl eigentlich erwartet hätten.
8 Johannes von Plano Carpini, Ystoria Mongalorum, Buch V, Kap. 24, vgl. Buch III,
ed. Paolo Daffinà, Claudio Leonardi, Maria Cristina Lungarotti, Enrico Menestò, Luciano Petech, Storia dei Mongoli, Spoleto 1989 (ed. Sinica Franciscana Bd. I, S. 3-130); vgl. Kunde von den Mongolen (1245–1247), eingeleitet, übersetzt und erläutert von Felicitas Schmieder, Sigmaringen 1997, S. 72; dazu Einleitung S. 24f. Wahrscheinlich unabhängig der Anm. 4 zitierte Franziskaner in Caffa 1323, de duabus: inter orientem vergens et aquilonem, S. 110.
9 Vgl. Johannes von Plano Carpini, Ystoria Mongalorum I 3, deutsche Übersetzung S. 41.
240
Der Historiograph Thomas von Split holte das Versäumnis nach und er-gänzte: „man sagt aber, dass ihr Land an das äußerste Indien grenze".10
Doch allmählich änderte sich das Weltbild. Der Erfahrungsdruck, den die Reisen erzeugten, war allzu groß. Zudem hatte sich bereits seit dem 12. Jahrhundert zunehmend die Hochschätzung des Experimentes und der Autopsie verbreitet, und mit ihr die Bereitschaft, auch Autoritäten zu ver-werfen.11 Als Wilhelm von Rubruk über das Kaspische Meer sprach – von dem seit der Antike die Meinung verbreitet war, es handele sich um eine Ausbuchtung des Ozeans, der die Landmasse der Erde umgab, und diese Ausbuchtung läge ganz im Nordosten dieser Erde (eine Überzeugung, deren mittelalterliche Gültigkeit sich beim ersten Blick auf vielen hoch- und spät-mittelalterlichen Weltkarten feststellen läßt), bemerkte er:
„Wir kamen also an den Strom Volga […] der in einen See oder ein Meer fließt, das manche das Meer Sircan nennen […] Isidor aber nennt es das Kaspische Meer. Denn es hat die Kaspischen und die persischen Berge im Süden […] Dieses Meer ist also an drei Seiten von Bergen umgeben, im Norden aber hat es eine Ebene. Bruder Andreas hat selbst zwei seiner Seiten umrundet, ich aber die anderen beiden. Und es ist nicht wahr, was Isidor sagt, dass es nämlich eine Ausbuchtung des Ozeans sei.“12
Rubruk verwarf hier ausdrücklich eine der zentralen Wissensquellen des lateinischen Mittelalters, Isidor von Sevilla, der um 600 lebte und zu den wichtigsten Übermittlern und Systematikern von Wissen gehört.13 Er ver-traute auf seine eigene Erfahrung und auf die seiner Zeitgenossen, die ihrer-
10 Thomas de Spalato, Historia Pontificum Salonitanorum et Spalatinorum, ed.
Georg Waitz u.a., Monumenta Germaniae Historica Scriptores XXIX, S. 568-98, hier S. 590 Z.39. Z.37f zitiert Thomas wohl die Lokalisation des Johannes: regio illorum in ea parte orbis sita, ubi oriens coniungiur aquiloni.
11 Vgl. Jürgen Sarnowsky, Expertus experientia experimentum: Neue Wege der wissenschaftlichen Erkenntnis im Spätmittelalter, in: Das Mittelalter 17, 2, 2012, S. 47-59; Jeremiah Hackett, Scientia experimentalis. From Robert Grosseteste to Roger Bacon, in: James McEvoy (Hg.), Robert Grosseteste, Turnhout 1995, S. 89-119.
12 Wilhelm von Rubruk, Itinerarium, XVIII, 5, S. 211; engl. komm. Übersetzung (wie Anm. 1), S. 129.
13 Zu ihm Michael Herkenhoff, Isidor von Sevilla, in: Ulrich Knefelkamp (Hg.), Weltbild und Realität: Einführung in die mittelalterliche Geschichtsschreibung, Pfaffenweiler 1992, S. 15-24.
241
seits gereist waren (wie hier den Franziskaner Andreas von Longjumeau). Und mehr als einmal muß er sich an den überkommenen Autoritäten, seien die nun christlich oder antik-heidnisch, stoßen: „Ich fragte nach den Wun-dergestalten und den monströsen Menschen, von denen Isidor und Solinus erzählen. Sie [die befragten Zeugen] antworteten mir, sie hätten niemals dergleichen gesehen. Und ich war sehr verwundert, ob das wahr sei.“14
Ähnlich weiß fast hundert Jahre nach Rubruk, um die Mitte des 14. Jahr-hunderts, sein Ordensbruder Johannes von Marignolli ausdrücklich mehr als selbst der Kirchenvater Augustinus:
„Die monstra, die Bücher und Geschichten gestalten oder ausmalen und von denen man sagt, es gebe sie in Indien, erwähnt auch der Hei-lige Augustinus in Buch 16 de civitate Dei [16, 8]. [...] Über sie alle schließt der Heilige Augustinus: Entweder gibt es sie gar nicht, oder wenn es sie gibt und sie vernünftig handeln oder vernunftbegabt sind, sind es alles Menschen aus dem Stamme Adams. [...] Ich aber habe mit höchster Neugier alle Provinzen der Inder durchwandert. Ich war oft eher neugierig als tugendhaft, weil ich wenn möglich alles wissen wollte. Ich wandte, wie ich glaube, mehr Mühe auf als irgendwer, von dem man liest oder weiß, um die Wunder der Welt, die mirabilia mundi, zu untersuchen. Ich durchquerte die wichtigsten Weltgegenden [...] Nirgends konnte ich als wahr finden, dass es solche Völker in der Welt gibt [....]“15
Gegen Ende des 14. Jahrhunderts ist dieser Umgang mit den Autoritäten auch bei den Daheimgebliebenen angekommen. In seiner enzyklopädischen Schrift De insulis et earum proprietatibus berichtet der Florentiner Domenico Silvestri um 1385/1406 von einer Insel im Indischen Ozean, auf der nach Auskunft des Marco Polo Menschen lebten, die auch Menschenfleisch äßen. Sollte man Marco Polo, praktisch einem Zeitgenossen, das nun glauben? Ja – denn „erzählt uns etwa nicht Isidor in De Ymagine Mundi, dass es in Indien Kenokephali gebe, die Hundsköpfe und gebogene Krallen und die Stimme
14 Wilhelm von Rubruk, Itinerarium, XXIX 46, S. 269; engl. komm. Übersetzung S.
201; vgl. XIX 1 S.211f; an andere Wundergeschichten glaubt er auch nicht: XXIX 47-49, S. 269f.
15 Johannes von Matignolli, Cronica Boemorum, Teiled. mit den Passagen über Asien in: Sinica Franciscana I, S. 545 (c.6).
242
von Hunden hätten – und wenn wir ihm glauben, warum sollten wir dann dem Marco aus Venedig nicht glauben?“16
Gleichzeitig allerdings bildet sich mit dem einsetzenden Humanismus ein Gegengewicht wieder verstärkter Hochschätzung gerade der Antiken, zugleich kann aber auch all das Neue nicht ignoriert werden. Das war ein Dilemma, das Entscheidungsdruck erzeugte, und zumindest diesen formu-liert Anfang des 15. Jahrhunderts der französische Kardinal Pierre d’Ailly, ein einflussreicher Mann europäischer Politik und Gelehrsamkeit, dessen Imago Mundi zu den Werken gehört, die Columbus auf seiner Suche nach dem Seeweg nach Indien beeinflussten. Er radikalisiert die von Domenicos formulierte Einzelfall-Erkenntnis durch Verallgemeinerung:
„Vom Kaspischen Meer lesen wir, dass es zweimal existiere ... und manche meinen, dass die Nachlässigkeit der Autoren aus einem zwei gemacht habe. Denn die Moderni, die die skythischen Reiche bereist haben, sagen, dass das Kaspische Meer zwischen den Hyrkanischen und den Kaspischen Bergen einen riesigen Raum einnehme und in der Art eines Sees geschlossen sei. Die Alten aber sagen, dass das Kaspi-sche Meer aus dem Okeanos in Form einer engen Flussmündung weit ins Land hineinreiche .... Welche von diesen Ansichten aber die wahre ist, ist nicht an mir zu entscheiden. Denn den Alten den Glauben zu entziehen, wage ich nicht – ihn den Moderni, die nach Augenschein zeugen, verweigern kann ich nicht.“17
Veteres oder antiqui und moderni standen einander grundsätzlich und unab-hängig von der Person auf Augenhöhe gegenüber – gleichzeitig allerdings setzte Pierre d’Ailly sie noch parataktisch als nicht entscheidbar nebenei-nander.
16 Domenico Silvestri, De insulis et earum proprietatibus, ed. Carmela Pecoraro, in:
Atti della Academia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo Bd. IV, 14, 2, 2, 1954, S. 38. Domenico verwechselt allerdings regelmäßig mit De Ymagine Mundi des Honorius Augustonunensis (Valerie I. Flint, Honorius Augustodunensis Imago mundi, in: Archives d'histoire doctrinale et littéraire du moyen âge 57, 1982, S. 1-153) aus dem 12. Jahrhundert, was aber am Kern der Sache nichts ändert. Vgl. Felicitas Schmieder, Paradise Islands in the East and West – Tradition and Meaning in Some Cartographical Places on the Medieval Rim of the World, in: Gerhard Jaritz, Torstein Jørgensen (Hg.), Isolated Islands in Medieval Mind, Culture and Nature, Budapest 2011, S. 3-22.
17 Pierre d’Ailly, Ymago mundi, ed. et trad. Edmond Buron, 3 Bde., Paris 1930, S. 452-454.
243
Zwischen Augenzeugen und Rezipienten anzusiedeln sind nun die spät-mittelalterlichen lateinischen Kartographen. Ob wir die Autoren der Mappae
Mundi, der Weltkarten, nun mit konkreten Personen in Verbindung bringen können oder nicht, sie entstammten offenbar Milieus, in denen man weit reiste und in denen entsprechendes Erfahrungswissen kursierte: den mit-telmeerischen Handelsstädten Genua, Pisa oder Venedig sowie dem katala-nischen Raum einschließlich Mallorca.
Bevor ich nun endlich die Frage nach der Reflexion jenes spätmittelalter-lichen Erfahrungsdrucks auf den und mit Hilfe der Mappae Mundi aufgreife – auf denen Diskrepanzen wie die geschilderte ja eigentlich sofort ins Auge springen müssten –, sei noch kurz diese Quellengattung vorgestellt. Es gibt von diesen Mappae Mundi eine ganze Menge, deutlich mehr, als gemeinhin bekannt ist.18 Viele sind sehr klein und stereotyp, doch eine ganze Reihe von ihnen ist sehr unterschiedlich, und nicht alle sind gleich geeignet für meine heutige Frage. So einfach Karten, mit denen wir umzugehen gewohnt sind, haben wir da nämlich nicht vor uns. Am bekanntesten dürfte die Ebstorfer Weltkarte aus der Zeit um 1300 sein, die immer wieder gezeigt und sogar ausgestellt wird, obgleich sie seit dem Zweiten Weltkrieg materiell nicht mehr existiert.19 Sie ist groß und rund (3,6 m im Durchmesser), bunt und „typisch mittelalterlich“: Je nachdem, was man gerade mit dem Mittelalter verbinden möchte, ist sie wirr und abergläubisch oder aber faszinierend in ihren Möglichkeiten, auf Entdeckungsreise zu gehen und alle möglichen Dinge wiederzuerkennen, die zwar nichts mit Geographie im modernen landläufigen Sinne zu tun haben, dafür aber mit einer Ansammlung von biblischen, antiken, mittelalterlichen kulturellen Erinnerungen. Es ging aber dem Maler der Ebstorfer Karte und anderer ihresgleichen auch gar nicht um
18 Die Karten oder doch die wichtigsten finden sich in mehreren umfangreichen
Werken zusammengestellt. Der Klassiker ist nach wie vor Konrad Miller, Mappae
Mundi: die ältesten Weltkarten, 6 Bde., Stuttgart 1895–98; dazu John B. Harley, David Woodward (Hg.), The History of Cartography I. Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago 1987; Evelyn Edson, The World Map, 1300–1492: The Persistence of Tradition and Transformation, Baltimore 2007, sowie Peter Barber, Medieval Maps of the World, in: P. D. A. Harvey (Hg.), The Hereford Map. Medieval World Maps and Their Context, London 2006, S. 1-44.
19 Hartmut Kugler (Hg.), Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte Neuausgabe in zwei Bänden, Berlin 2007.
244
Geographie in unserem eingeschränkten Sinne. Mappae Mundi haben die Aufgabe, Geographie in einem umfassenderen, mehrdimensionalen Sinne zu zeigen – und nicht zuletzt die Erde als Schauplatz der Heilsgeschichte, als einmal geschaffener Lebensraum der Menschen, den Gott mit Strafen über-zog, in den aber auch Christus geboren wurde und den seine Apostel heils-bringend durchzogen hatten, in dem seit Anfang der Schöpfung bis zu deren Ende das Irdische Paradies, den Menschen unzugänglich, weiterbestand, und der schließlich einst enden würde, wenn der auferstandene Christus zu-rück auf die Welt käme im Himmlischen Jerusalem. Mittelalterliches Verste-hen, mittelalterliche Hermeneutik war vom vierfachen Schriftsinn geprägt. Neben dem buchstäblichen Sinn gab es auch den allegorischen, den morali-schen und den anagogisch-endzeitlichen. Idealerweise sind all diese Be-deutungsebenen in einem Werk vereint – die Mappae Mundi sollen Heilsgeo-graphie sein. Sie verweisen auf die Ewigkeit, doch sie sind im Jetzt verortet; die Zeitgenossen sollten ihre eigene Realität wiederfinden können – aber deshalb mussten die Darstellungen auch geographisch stimmen.
Diese letzte Charakterisierung überrascht normalerweise ein wenig, wirft sie doch die Frage auf, weshalb es dann überhaupt zu jener „falschen“ Ge-samtdarstellung gekommen sein könne, sehr oft in Kreisform. Doch sie ist gar nicht falsch. Mittelalterliche Weltkarten-Maler wollten die Erdkugel dar-stellen; dass es sich bei ihrem Darstellungsobjekt um eine Kugel handele, war entgegen seit dem 19. Jahrhundert verbreiteter Darstellungen im Mittel-alter allen klar.20 Das kann man für unser Verständnis besser tun als mit Hilfe eines Kreises, und wir kennen schon seit dem Frühmittelalter Versu-che, durch ovale Darstellungen den Ausmaßen der Kontinente gerechter zu werden. Auch die Mercator-Projektion des 16. Jahrhunderts würde, wie wir wissen, noch eine keineswegs vollkommene Darstellungsmethode sein, die Kugel auf die Fläche zu projizieren. Warum also nicht einfach einen Kreis zeichnen, zumal wenn man die genauen Maße doch nicht kennt. Und die mittelalterliche Darstellung Jerusalems normalerweise so ziemlich im Zent-rum der Welt ist zweifellos einer ideologischen Ebene des damaligen Welt-bildes geschuldet, doch für die Entscheidung, Europa oder den Atlantik ins
20 Vgl. Felicitas Schmieder, Der Fall von der Erdscheibe, oder: Wie begrenzt war die
Welt im Spätmittelalter?, in: Achim Landwehr u.a. (Hg.), Grenzerfahrungen in Mittelalter und Renaissance, Düsseldorf (im Druck).
245
Zentrum unserer Karten zu rücken, gilt genau dasselbe.21 Objektive, gar naturwissenschaftliche Richtigkeit kann keines von beiden für sich bean-spruchen. Ob nun also Darstellung der Herrschaft der Europäer über alles oder Heilsgeographie: Beide Darstellungen sind auf derselben ideologischen Ebene verzerrt oder ein graphischer Kompromiß mit den Naturgesetzen. Übrigens haben auch die mittelalterlichen Kartographen schon früh mit der Darstellung der Welt auf einer tatsächlichen Kugel experimentiert. So offen-bar schon um die Jahrtausendwende in Sankt Gallen und immer wieder, bevor aus dem Ende des 15. Jahrhunderts der erste Globus – noch ohne grö-ßeren Landmassen zwischen Europa und Afrika einerseits und Ostasien an-dererseits – erhalten ist.22
Weil aber die Geographie als Rahmen der Heilsgeschichte stimmen mußte, waren auch die Mappae Mundi als Darstellungen traditionellen geo-graphischen Wissens im Spätmittelalter dem wachsenden Erfahrungsdruck ausgesetzt, der sich aus den Asienreisen ergab. Dies führte zu Wandlungen, doch es führte kein geradliniger Weg von „noch mittelalterlichen“ zu „schon moderneren“ Karten. Diese Wandlungen geschahen mit Verzögerung von wenigstens zwei, meist aber noch mehr Generationen – die Ebstorfer Welt-karte und andere ihres Typs entstanden um 1300 und zeigen noch keine Spur davon. Diese spätmittelalterlichen Wandlungen sorgten aber dafür, dass der gesteigerte Erfahrungsdruck, den die Entdeckungsfahrten des 15. und 16. Jahrhunderts auslösten, sich innerhalb viel kürzerer Zeit auf den Karten ausdrücken ließ – so vergingen eben seit des Columbus Fahrt nach Westindien/Amerika keine zehn Jahre, bis die alten/neuen Inseln das erste Mal dargestellt und benannt wurden. Die Wandlungen ergaben sich im
21 Vgl. zum Problem nur John B. Harley, Silences and Secrecy. The Hidden Agenda
of Cartography in Early Modern Europe, in: Imago Mundi 40, 1988, S. 57-76. 22 Schon um die Jahrtausendwende gibt in Sankt Gallen eine spera, auf der die
gestelle zu finden seien allero gentium, die Stellen also, an denen die Völker zu finden seien: Cod. Sang. 8125 (Kommentar Notkers des Deutschen zu Boethius Consolatio Philosophiae
S. 97 =http://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0825/97/small). Doch Patrick Gautier Dalché macht zu Recht auf die wahrscheinlichen Funktionen solcher frühen Experimente aufmerksam, die der Darstellung kosmologischer Zusammenhänge dienten und weniger der geeigneteren Darstellung der Erdoberfläche: Patrick Gautier Dalché, Avant Behaim: Les globes terrestres au XVe siècle, in: Humanisme et découvertes géographiques, Médiévales 58, 2010, S. 43-61.
246
Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts aus unterschiedlichen Einflüssen und Lösungsansätzen, die an die Heilsgeographie herangetragen wurden.
• Spätestens im Laufe des 13. Jahrhunderts entwickelten sich als Hilfs-
mittel der mittelmeerischen Küstenschifffahrt der italienischen und katalanischen Kaufleute die so genannten Portulane.23 Sie sollten Richtungen und Entfernungen der Häfen und anderer Landmarken zu- und voneinander angeben und ergeben als Gesamt ein auch in unseren Augen bemerkenswert naturgetreues Abbild zunächst des Mittelmeeres, dann vor allem angrenzender Zonen wie des Schwar-zen Meeres und der afrikanischen Atlantikküste (im 15. Jahrhundert mit den portugiesischen Fahrten und Messungen nach Süden wach-send). In die meisten spätmittelalterlichen Mappae Mundi drangen diese Küstenlinienkarten mit deutlicher Zeitverzögerung von we-nigstens zwei Generationen ein, vermutlich in dem Moment, in dem die Zeichner der Weltkarten und der Portulane dieselben Personen wurden.
• Seit dem 12. Jahrhundert stand dem lateinischen Westen prinzipiell
die arabische Geographie einschließlich deren graphischer Reprä-sentation zur Verfügung.24 Im frühen 14. Jahrhundert dann nahm dieses Wissen sichtbar Einfluss auf lateinische Mappae Mundi. Um diesen Schritt und die anscheinende Verzögerung beurteilen zu können, seien einige Dinge unterstrichen. „Zur Verfügung stehen“ meint, dass auf Sizilien al-Idrisi am Hofe Rogers II. erstmals, soweit
23 Tony Campbell, Portolan Charts From the Late Thirteenth Century to 1500, in:
Harley, Woodward, History of Cartography I, S. 371-463 (http://press.uchicago.edu/books/HOC/HOC_V1/HOC_VOLUME1_chapter19.pdf; Zugriff: 07.04.2013); Philipp Billion, Graphische Zeichen auf mittelalterlichen Portolankarten. Ursprünge, Produktion und Rezeption bis 1440, Marburg 2011; Ramon J. Pujades i Bataller, Les cartes portulanes. La representació medieval d’una mar solcada, Barcelona 2007; zu den letzten beiden Patrick Gautier Dalché, Les cartes marines: origines, caractères, usages. Ápropos de deux ouvrages récents, in: Geographia Antiqua 20-12 (2011–2012), S. 215-227.
24 Vgl. Evelyn Edson, Emilie Savage-Smith, Anna-Dorothee von den Brincken, Der mittelalterliche Kosmos. Karten der christlichen und islamischen Welt, Darmstadt 2005.
247
wir wissen, arabische Kartographie und darunter auch die Darstel-lung der Welt in den lateinischen Bereich gebracht hatte, allerdings noch in arabischer Sprache.25 Auf diese Weise zur Verfügung gestell-tes arabisches Wissen musste auf einen Bedarf auf der lateinischen Seite stoßen, um weiter verarbeitet zu werden – und der war im 12. Jahrhundert anders als auf anderen Wissensgebieten noch nicht ge-geben. Dies könnte allerdings damit zusammenhängen, dass die arabischen Regionalkarten wie die Mappae Mundi praktisch nicht verwertbar waren und sie dem Weltdeutungszweck der lateinischen Mappae Mundi ganz offensichtlich keine maßgebliche Anregung zu bieten hatten.26 Sie boten allerdings Alternativen der geographischen Darstellung von Regionen, die um 1300 von Lateinern nun immer öfter erreicht wurden, und dies dürfte der Anknüpfungspunkt ge-wesen sein, sie zu rezipieren.27
• Einzelne typische Formen der arabischen Mappae Mundi dringen bei
dieser Gelegenheit in den Formenbestand der lateinischen Mappae
Mundi ein, die wir heute als typisch ptolemäisch erkennen. Und mit dem antiken Geographen Klaudios Ptolemaios sind wir beim dritten Ansatz von Darstellungswandlung angekommen. Unabhängig da-von, ob es zum antiken Werk des Ptolemaios je Karten gegeben hat oder nicht (das ist keineswegs sicher), beschreibt er doch die geo-graphischen Orte in einer Weise, die die graphische Umsetzung er-laubt28. Die Geographie des Ptolemaios war allerdings im lateini-
25 Zu al-Idrisi vgl. Edson, Savage-Smith, von den Brincken, Der mittelalterliche
Kosmos, vor allem S. 100-102. 26 Vgl. hierzu nur Yossef Rapoport, Reflections on Fatimid Power in the Map of
Island Cities in the „Book of Curiosities“, in: Ingrid Baumgärtner, Martina Stercken (Hg.), Herrschaft verorten. Politische Kartographie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Zürich 2012, S. 183-210.
27 Das tut offenbar Pietro Vesonte, siehe unten. Ob es allerdings genau die Idrisi-Weltkarte war, die rezipiert wurde, oder andere arabische Exemplare der Mappae
Mundi, die insgesamt recht gleichförmig daherkommen, müsste näher untersucht werden, doch dazu sind Arabisch-Kenntnisse erforderlich, über die ich leider nicht verfüge; vgl. aber schon Tadeusz Lewicki, Marino Sanudos Mappa Mundi und die Weltkarte von Idrisi, in: Rocznik Orientalistyczny 38, 1976, S. 169-98.
28 Kai Broderssen, Terra cognita. Studien zur römischen Raumerfassung, Hildesheim, 2. Aufl. 2003.
248
schen Westen vor 1400 nur mittelbar bekannt; in Byzanz sind karto-graphische Umsetzungen aus dem 13. Jahrhundert erhalten, und der Einfluß auf die arabische Kartographie wurde schon erwähnt.29 Um 1400 wurde des Ptolemaios Geographie ins Lateinische übersetzt und kam sozusagen als neue alte Autorität auf den Markt des geo-graphischen Wissens. Im Grunde ist die Rezeption der Geographie des Ptolemaios und besonders die Umsetzung seiner kartographisch relevanten Angaben im 15. Jahrhundert ein ganz eigenes Kapitel des von Pierre d’Ailly formulierten Problems „was mache ich nur mit den Antiqui, von deren Schriften ich eigentlich nicht mehr so restlos überzeugt bin“. Denn zu dem Zeitpunkt, als Ptolemaios rezipiert wurde, kannten die Lateineuropäer die Welt vielfach schon besser.
Von unterschiedlichen Seiten, aus unterschiedlichen Quellen kam also Be-wegung auch in die Welt-Kartographie jener Zeit, in der immer mehr autoptisches Wissen zumindest über Asien nach Europa eindrang. Sie verlor noch lange nicht ihren heilsgeographischen Charakter, auch wenn es sicher richtig ist, dass der Aspekt der geographischen Naturnähe bei vielen (nicht bei allen) Karten ein immer stärkeres Gewicht bekam. Doch sei noch einmal betont, dass sich beides so wenig grundsätzlich ausschloss, dass wir bis weit in die Frühe Neuzeit hinein Darstellungen des Irdischen Paradieses und ähnlicher uns geographie-fern erscheinender Details auf Weltkarten finden, die auf dem je neuesten Stand kartographischer Technik gezeichnet sind. Deshalb sollte man hier auch nicht „realistisch“ gegen „traditionell“ oder ähnliches setzen: Denn im Denkrahmen des mittelalterlichen Weltbildes war zum Beispiel das Irdische Paradies eine durchaus „reale“ Gegebenheit der Schöpfung.
Doch zurück zu den spätmittelalterlichen Mappae Mundi, in denen sich der beschriebene Wandel mehr oder weniger deutlich abzeichnete. Welcher Art waren die Wandlungen, die wir feststellen können? Und konnten auch die Mappae Mundi Raum für Reflexionen der Art bieten, wie sie für die geo-graphischen Schriften dargestellt wurden? Anders gefragt: Wenn Verände-rungen feststellbar sind, können wir dann feststellen, ob sie einfach so ein-drangen, oder ob die Kartographen um die korrekte Darstellung rangen?
29 Patrick Gautier Dalché, La Géographie de Ptolémée en Occident (IVe – XVIe
siècle), Turnhout 2009.
249
Wenn, wie eingangs zitiert, manch ein Daheimgebliebener die vielen frem-den Namen, die die Reisenden mitbrachten, mit bekannten identifizieren wollte, dann war das im Grunde dasselbe, wie die Weltkarten zu lassen, wie sie waren, weil keine Notwendigkeit für Wandel gegeben schien. Doch nicht alles ließ sich so ohne weiteres identifizieren (und manch ein Reisender wird gerade dadurch zu immer intensiveren Nachforschungen getrieben worden sein). Hatten die oben zitierten, der Kölner Kleriker oder Thomas von Split, noch identifiziert, so wählten die Rezipienten zu Beginn des 14. Jahrhun-derts die Parataxe. Der Franziskaner Paulinus Minorita aus Venedig setzte in seiner Schrift „Über die Weltkarte“ (De mappa mundi, um 1320/30) zwei ganz unterschiedliche Beschreibungen Zentralasiens unter der Sammelüber-schrift Skythien nebeneinander. Die Neuerung sei notwendig geworden „wegen der Reichsbildung der Mongolen“.30 Die eine ist voller alt-überkommener, meist antiker Namen, die andere gleicht in vielem der Be-schreibung, wie sie oben von Johannes von Plano Carpini zitiert wurde, und ist damit ganz auf der Höhe zeitgenössischen Reisewissens:
„Über die andere Einteilung von scithia. Heute unterteilt und benennt man scithia anders (moderni scithiam aliter dividunt et nominant) wegen der Herrschaft der Tartaren. Als erstes nämlich setzt man das Reich cathay, in dessen Osten der Ozean liegt, im Süden die Inseln des Oze-ans, im Westen das Reich tarse, im Norden die Wüste von beliam. Dann kommt das Reich tarse, das in seinem Osten das Reich cathay hat, im Süden eine ungeheuer reiche Provinz, genannt sym, im Westen das Reich turquesten und im Norden eine Wüste. Das Reich turquesten aber hat im Osten das Reich tarse, im Süden das Ende der indischen Wüste, im Westen das Reich persia, im Norden das Reich corasmie. Das Reich corasmie hat im Osten eine Wüste, die sich hundert Tagereisen aus-
30 Hierzu samt Edition der anderen Skythienbeschreibung Anna Dorothee von den
Brincken, „... ut describeretur universus orbis". Zur Universalkartographie des Mittelalters, in: Albert Zimmermann (Hg.), Methoden in Wissenschaft und Kunst des Mittelaters, Berlin 1970, S. 249-78. Eine Neuedition von „De mappa mundi“ wurde von Michelina di Cesare unter dem Titel „Paulinus Venetus, De Mappa Mundi, introduzione ed edizione critica“ erstellt und soll 2014 bei den Monumenta Germaniae Historica erscheinen (Titel und Einleitung in deutscher Übersetzung). Vgl. auch Michelina die Cesare, Il sapere geografico di Boccaccio tra tradizione e innovazione: L’imago mundi di Paolino Veneto e di Pietro Vesconte, in: Roberta Morosini (Hg.), Boccaccio geografo. Carnet di viaggi ed esplorazioni, Florenz 2010, S. 67-87 u. 257-258.
250
dehnt, im Süden das Reich turquesten, im Westen das Kaspische Meer, im Norden das Reich cumania. Im Osten aber des Reiches cumania liegt das Reich Corasmie, im Süden ein Fluß mit Namen Maius, im Westen das mare maius, das Schwarze Meer, und der Tanaïs, der Don, im Nor-den das Reich russia; der Sitz des Reiches aber ist in sara.“31
Eine Variante des Textes des Paulinus Minorita umgibt in einer vatikani-schen Handschrift seines Werkes eine Weltkarte aus der Feder des Petrus Vesconte aus Genua.32
31 De mapa mundi, Vat.Ms.lat.1960 fol.17ra. Antike Beschreibung vor dieser Passage,
fol.16vb/17ra: "21. Über Skythien von Seres aus. Scythia erstreckte sich einst vom äußersten Osten [...], wo der Oceanus sericus liegt, bis an die Grenzen Germaniens [...] im Westen bis zum Kaspischen Meer, im Süden bis an den Kaukasus, und subiacet ea yrcania...Über Seres [...]" im Folgenden verarbeitet und zitiert: Isidor, Solinus, Orosius; 22. über Baktrien, 23. über Hyrkanien, 24. über Armenien, 25. über Kappadokien.
32 Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2972 fol. 112v-113r; diese Analyse auch Felicitas Schmieder, „Den Alten den Glauben zu entziehen, wage ich nicht ...“. Spätmittelalterliche Welterkenntnis zwischen Tradition und Augenschein, in: Gian Luca Potestà (Hg.), Autorität und Wahrheit. Kirchliche Vorstellungen, Normen und Verfahren (XIII.–XV. Jahrhundert), München 2012, S. 65-77, hier S. 73.
251
Die Vescontekarte aus der Bibliothèque National Paris ms. lat.4939.
Der Kartograph nun muss – will er nicht zwei Weltkarten nebeneinander zeichnen, wie es Petrus Vesconte nicht tut – viel eher eine Autoritätskritik offensichtlich machen. Denn er unterliegt ganz anderen Entscheidungs-zwängen, ob zwei Begriffe das Gleiche bedeuten oder nicht. Es gibt keine zwei unabhängig voneinander vorgeschlagene Beschreibungen ein und des-
252
selben Gebietes, und ein „vielleicht“ gibt es im Grunde ebenfalls nicht. Ob die Kartographen einen Namen durch einen gleichbedeutenden ersetzten, zwei Namen auf der Karte gleichsetzten oder unverbunden nebeneinander-stellten, also verdoppelten (was bei hinreichend Platz möglich war und wo-mit sie der Entscheidungsverweigerung noch am nächsten kamen): In jedem Fall legten sie ihren Wissensstand auf den ersten Blick offen – ganz im Sinne des Paulinus Minorita, der bemerkt, dass erst die Kombination von Text und Bild zu wirklicher Übersicht führe, dass die Karte den Text ergänze, weil sie „wie im Flug des Vogels“ Einblicke verschaffen könne – ein Beleg übrigens (über den Titel der Schrift hinaus) für die absichtsvolle Verschränkung von Text und Karte, die deshalb auch eng aufeinander bezogen interpretiert werden dürfen, obgleich die hier gezeigte enge visuelle Verschränkung in anderen Überlieferungen der Weltkarte (die ungewöhnlich zahlreich ist) unüblich ist.
Die Karte des Petrus Vesconte selbst, rund und geostet wie viele mittel-alterliche Mappae Mundi, ist insgesamt sehr wortkarg und liefert dadurch ihre Version des Ausweichens. Die Beschreibung de Asia des Paulinus ist links und rechts oberhalb der Karte verteilt, links die altmodische, rechts die moderne. Auf der Karte selbst finden sich überhaupt nur einige wenige der genannten Namen, und sie scheinen wie aus beiden Abteilungen zusam-mengestellt: so cathay ebenso wie yrcania und albania, um nur wenige Bei-spiele zu nennen. Und Unklarheiten werden in der Tat evident: Die Verwir-rung, die um das Kaspische Meer herrschte, trieb dementsprechend für die Gattung symptomatische Blüten: Es ist zwei-, ja eigentlich sogar dreimal ein-gezeichnet und benannt, davon zweimal nach neuerer Erkenntnis als Bin-nenmeer. Das östlichere (und damit auf der geosteten Karte weiter oben be-findliche) heißt mare caspium und ist zusätzlich von den montes caspii umgeschlossen, beim westlicheren (das sich an der Stelle befindet, wo sich das fragliche Meer nach heutigen Kriterien befinden müsste und wo auch die tatsächlich dort befindlichen „Eisernen Tore“ von Derbend eingezeichnet sind, eine Information jüngeren Datums) sind die drei Namen dieses Meeres explizit parallel gesetzt (mare caspis/mare yrcanum/mare de sara): Namen, die deshalb in Umlauf waren, weil Asien-Reisende ebenso wie Rezipienten zu Hause während des 13. und 14. Jahrhunderts auf unterschiedliche Lösungen verfallen waren, mit dem Widerspruch zwischen Tradition und Augen-schein umzugehen. Hatte Rubruk das Binnenmeer, das er vorfand, mit dem eigentlich ganz anders überlieferten Kaspischen Meer identifiziert (vermut-
253
lich, weil er den Namen tatsächlich vor Ort hörte), waren andere zögerlicher. Entweder wurde die Identifikation verweigert und ein neuer Name gewählt, denn Mar de Sara bezieht sich auf eine der mongolischen Herrschaftssitze, Sarai an der unteren Wolga (die von Norden ins Kaspische Meer fließt). Oder aber eine alternative Identifikation mit antikem Wissen wurde bevor-zugt, denn Mare Yrcanum leitet sich von den Hyrkanischen Bergen ab, die man seit der Antike im Nordosten wusste. So etwas Ähnliches tut Petrus Vesconte, der die nordöstliche Ausbuchtung des Okeanos, die er auf prak-tisch allen älteren Mappae Mundi finden konnte und die er offenbar nicht aufgeben und zudem benennen wollte: sie ist umschlossen von den montes
sitie, den Skythischen Bergen. Zugleich bleiben bestimmte Lokalitäten, die im Wissen nicht allein der Lateineuropäer mit dem Kaspischen Meer ver-bunden waren, bei dieser Ausbuchtung stehen, so die Eingeschlossenen Völker Alexanders des Großen und die Endzeitvölker Gog und Magog.33 An beiden Stellen setzt sich Petrus Vesconte mit der heilsgeographischen Tradi-tion seines Mediums auseinander. Es gibt eine ganze Reihe höchst interessanter spätmittelalterlicher Mappae
Mundi, und das Ergebnis einer Untersuchung auf den Umgang mit wider-sprüchlichen Informationen hin wäre bei einigen dasselbe wie bei der Vesconte-Karte, bei anderen eher vage bis nicht sonderlich aussagekräftig. Denn es kommt immer auf die Intention des jeweiligen Kartographen an, ob er seinen Fokus eher auf die heilsgeographische Aussage der Mappa Mundi legt oder eher auf die naturgetreue Darstellung der Geographie: Denn auch wenn beides immer in Gemengelage vorliegt, sind die Gewichte doch sehr unterschiedlich gelagert. Daher erscheinen hier diejenigen am ehesten inte-ressant, die sich explizit mit der neu aufgetauchten antiken Autorität auf diesem Gebiet auseinandersetzten, der Geographie des Klaudios Ptolemaios. Man könnte die so genannte Genuesische Weltkarte von 1457 betrachten, die sich in weiten Bereichen der Zeichnung der ganzen Welt und in vielen De-
33 Vgl. Andrew Gow, Gog and Magog on Mappemundi and Early Printed Maps:
Orientalizing Ethnography in the Apocalyptic Tradition, in: Journal of Early Modern History 2, 1, 1998, S. 61-88; Felicitas Schmieder, Gogs und Magogs 'natürliche Milde'? Die Mongolen als Endzeitvölker im Wandel von Wissen und Wünschen, in: Rebekka Voss, Wolfram Brandes, Felicitas Schmieder (Hg.), Völker der Endzeit. Apokalyptische Vorstellungen und politische Szenarien; Peoples of the Apocalypse. Eschatological Beliefs and Political Scenarios (im Druck).
254
tails besonders eng an den Griechen anlehnt, ihn aber auch durchaus kriti-siert.34
Doch an einem Ort wie diesem sei die berühmteste Mappa Mundi des 15. Jahrhunderts ausgewählt, die in Sachen Autoritätskritik neue Maßstäbe setzte, regelrecht mit Ptolemaios auf der Karte diskutierte, „the debate on the map“, um die einschlägige Kapitelüberschrift einer der jüngeren Kartographiegeschichten zu zitieren.35 Anhand ihrer ist das Nachdenken auf der Weltkarte unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten des Mediums beson-ders gut nachvollziehbar. Zwischen 1448 und 1459 erstellte der Camaldulensermönch und Cosmographus Incomparabilis Fra Mauro für seine Heimatstadt Venedig und für den portugiesischen Hof eine Mappa Mundi von 1,96 m Durchmesser, die neben Bildern und üppigen kartographischen Signaturen wie Flüssen, Bergen, Städten extrem viele Texte unterbringt und das auf dem alleraktuellsten Stand des Wissens, nicht zuletzt der portugiesi-schen Entdeckungen an der Atlantikküste.36 Bei alledem ist die Karte eine großartige Symbiose früh- und hochmittelalterlicher Tradition, neueren Er-fahrungswissens, arabischer Einflüsse und eben der Geographie des Ptole-maios. Die Karte ist rund wie eine Mappa Mundi, sie ist gesüdet wie eine arabische Karte, sie ist voller Bilder und Texte, und wenngleich das Irdische Paradies bei ihm aus der Karte selbst in die Randbemalung verdrängt ist, so zeichnet er doch noch immer die vier Paradiesflüsse Euphrat, Tigris, Gion und Phison, die als Nil und Ganges identifiziert sind, als einzige durch gol-dene Beschriftung aus. Mittelmeer und europäische wie afrikanische West-küste sind, soweit bekannt und daher möglich, in der Form der Portulane gezeichnet. Die Bestandsaufnahme des Wissens über den Indischen Ozean und seine afrikanischen und asiatischen Küsten ist enorm und zeigt, was die
34 Vgl. Gerda Brunnlechner, The So-Called Genoese World Map of 1457: A Stepping
Stone Towards Modern Cartography?, in: Peregrinations. Journal of Medieval Art & Architecture 4, 1 (Spring 2013), S. 56-80, online (im Druck).
35 Edson, World Map (wie Anm. 18), überschreibt so ihr Fra Mauro-Kapitel. Hier auch der Verweis auf die Ehrung des Kartographen durch die Serenissima.
36 Vgl. Edition Piero Falchetta, Fra Mauro’s World Map, Turnhout 2006, mit CD-ROM-Faksimile, das sich ausgezeichnet „erforschen“ lässt; Angelo Cattaneo, Fra Mauro's Mappa Mundi and Fifteenth-Century Venice, Turnhout 2011; Ingrid Baumgärtner, Kartographie, Reisebericht und Humanismus. Die Weltkarte des venezianischen Kamaldulensermönchs Fra Mauro (gest. 1459), in: Das Mittelalter 3, 1998, S. 161-97.
255
Portugiesen wussten und erwarten konnten, als sie schließlich am Ende des 15. Jahrhunderts den Seeweg dorthin erschlossen.37 Dabei nimmt der Karto-graph oftmals kein Blatt vor den Mund, gerade weil er durch das Medium zu Entscheidungen gezwungen wird und sich ihnen stellt. Er geht jenes Wagnis ein, das kaum ein halbes Jahrhundert vorher Pierre d’Ailly scheute, und widerspricht offen den Alten.
Wir finden einige äußerst langlebige Probleme wieder, zu denen sich Fra Mauro eine Meinung gebildet hat.38 So kartiert er das Kaspische Meer an der uns gewohnten Stelle. Er zeichnet aber auch die bekannte Ausbuchtung des Ozeans im Nordosten der Erde ein, umgeben von Bergen, denen er nicht einfach einen neuen Namen gibt, sondern zu denen er schreibt: „Einige glauben, diese Berge seien die Kaspischen Berge, aber diese Meinung ist falsch.“39
Ortskenntnis aus Erfahrung, Autopsie ist ihm ein gewichtiges Argument für das Verwerfen traditioneller Nachrichten. So kennt er natürlich die alte und weitverbreitete Legende, wonach Alexander der Große die Endzeit-Völker Gog und Magog im Kaukasus eingeschlossen habe. „Aber diese Mei-nung ist offensichtlich irrig und kann in keiner Weise aufrechterhalten wer-den. Man weiß nämlich von einer großen Vielfalt von Völkern, die um diese Berge leben, so dass es nicht möglich ist, dass eine so große Zahl von Men-schen unbekannt geblieben wäre, weil dieses Gebiet recht gut bekannt und vielbesucht ist von uns und anderen Völkern.“40 An der Länge des Textes allerdings lässt sich ablesen, wie viele Gedanken wer sich macht.
Eine ganze Reihe altüberkommener Namen, die Fra Mauro auch bei Ptolemaios vorfand, verwirft er, nicht ohne selbstbewusst zu ergänzen: „Man merke, dass Ptolemaios einige Provinzen hier in Asien nennt, nämlich Albania, Iberia, Bactriana ... die ich alle nicht erwähne, weil die Namen ver-
37 Marianne O'Doherty, The Indies and the Medieval West: Thought, Report,
Imagination, Turnhout 2013. 38 Diese Aufschlüsselung der Karte auch in Schmieder, „Den Alten den Glauben zu
entziehen ...“, S. 75-77. 39 Ed. Falchetta nr. 2750. 40 Ed. Falchetta nr. 2403. Zum Hintergrund der weitläufigen und weitverbreiteten
Geschichte der eingeschlossenen Völker Gog und Magog sowie zu dieser Geschichte und ihrer möglichen Veri- oder Falsifizierungen im Zuge der spätmittelalterlichen Asienreisen und ihrer Rezeption vgl. Schmieder, Europa und die Fremden, S. 29, S. 207, S. 258ff.
256
ändert oder verdorben sind. Dazu kann man aber bemerken, dass ich andere Provinzen nenne, von denen Ptolemaios nicht spricht.“41 Selbstbewußt auch erklärt er manche altüberkommene Diskussion – so jene um die Frage, wo denn die Abgrenzung der Erdteile voneinander verlaufe – für langweilig (tediosa).42
Mit Ptolemaois argumentiert Fra Mauro für die Überprüfung und gege-benenfalls Abweichung von Autoritäten:
„Wenn jemand mein Werk angreift, weil ich nicht Klaudios Ptolemaios gefolgt bin, weder in der Form noch in den Maßen nach Länge und Breite, will ich das nicht umständlicher verteidigen, als er selbst sich verteidigt. Er sagt im 2. Buch, Kapitel 1, dass man nur exakt über Ge-genden sprechen könne, die regelmäßig besucht würden, doch bei de-nen, die nicht regelmäßig besucht würden, solle niemand denken, dass er über sie korrekt sprechen könne. Wenn er damit meinte, dass er seine Kosmographie nicht gänzlich selbst verifizieren konnte, weil das eine langwierige und schwierige Angelegenheit ist und das Leben kurz ist und die Erfahrung trügerisch, gibt er zu, dass in längerer Zeit ein solches Werk verbessert werden und man genauere Kenntnisse als er haben kann. Deshalb sage ich, dass ich mich zu meiner Zeit bemüht habe, die Schriften über lange Jahre durch Erfahrung und mit der Hilfe glaubwürdiger Leute zu überprüfen, die mit eigenen Augen gesehen haben, was ich hier getreu berichte.“43
Fra Mauro weiß genau, wie viel er den Alten verdankt, doch ebenso sind nach seiner Überzeugung in der langen Zeit, die vergangen ist, viel mehr Er-fahrungen gesammelt worden und viel dazugelernt worden, was die Alten noch nicht wissen konnten. Fra Mauro hat diese und insbesondere Ptole-maios in vielen Details kritisiert und erklärt, weshalb sie irren konnten.
41 Ed. Falchetta nr. 1405. 42 Ed. Falchetta nr. 2489. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass er an die irdische
Existenz von Gog und Magog als solche nicht glaubt. Kurz zusammengefasst zur Entwicklung der Legende um die eingeschlossenen Völker vgl. Schmieder, Europa und die Fremden, S. 29.
43 Ed. Falchetta nr. 2834. Der Ptolemaios-Verweis dürfte sich auf die Aussage beziehen, die in der Übersetzung von Edward Luther Stevenson (Claudius Ptolemy, The Geography, Neudruck New York 1991, S.47) im Prolog des zweiten Buches zu finden ist: „... as to the degrees ascribed to localities not as yet thoroughly explored, because of the incomplete and uncertain knowledge we have of these places, they should be computed rather from their nearness to the localities already laid down, and the more thoroughly explored.”
257
Trotz aller Mühe aber ist auch seine Mappa Mundi nicht vollständig. Auch er selbst gesteht sich die Möglichkeit des Irrtums und der nicht hinreichenden Kenntnis, des unzureichenden Überblicks zu. Nicht zuletzt deshalb behält er auch die alte runde Form der Weltkarte bei, obgleich den Zeitgenossen längst deutlich geworden war, dass sie den Ausmaßen Asiens nicht gerecht wurde (und obgleich, wie zitiert, Ptolemaios eine andere Form und andere Maße angab) – in dem oben von mir bereits angedeuteten Sinne: „Warum nicht einfach einen Kreis zeichnen, zumal wenn man die genauen Maße doch nicht kennt“. Doch über die gesamten Ausmaße der Erde gebe es zahl-reiche „Überlegungen oder Meinungen, die alle nicht sehr authentisch sind, weil sie nicht durch Erfahrung überprüft wurden ... Deshalb lasse ich dem Ewigen Gott die Vermessung seines Werkes.“44 Welches die richtigen Ge-samtmaße seines Schöpfungswerkes sind, weiß allein Gott – wir können sie nicht sicher wissen, weil wir sie nicht im Experiment erfahren können.
Damit legt Fra Mauro eine Maxime zugrunde, der die Zukunft gehören sollte – denn die Lateineuropäer ruhten nicht mehr, schließlich alles durch Erfahrung und nicht mehr nach der Tradition zu ermessen. Zugleich geht Fra Mauro einen entscheidenden Schritt weiter als der etwa eine Generation ältere Pierre d’Ailly noch nicht gehen mochte. Er betrachtet es durchaus als seine Aufgabe zu entscheiden, welches von beiden – Autorität oder Autop-sie – Recht hat, und es spricht einiges dafür, dass es das Medium der Mappa
Mundi ist, das ihn immer wieder zu jenen Entscheidungen zwang, zu denen er sich dann offen, selbstbewusst, ja geradezu offensiv bekannte.
44 Zur Unvollkommenheit vgl. das vorhergehende Zitat, und dann: Ed. Falchetta nr.
2828. Zu den tieferen Gründen und zu einer weitergehenden Lesart dieser Überzeugung, Gott das Ermessen des Ganzen zu überlassen vgl. auch Felicitas Schmieder, Anspruch auf christliche Weltherrschaft. Die Velletri /Borgia-Karte (15. Jh.) in ihrem ideengeschichtlichen und politischen Kontext, in: Baumgärtner, Stercken, Herrschaft verorten (wie Anm. 26), S. 253-271.