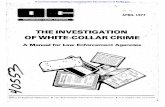Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen als Bestattungen und...
Transcript of Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen als Bestattungen und...
It�’s a Long Way to a Historiography of the Early Dynastic Period(s)
Edited by Reinhard Dittmann and Gebhard J. Selz
in collaboration with Ellen Rehm
Altertumskunde des Vorderen Orients Archäologische Studien zur Kultur und Geschichte
des Alten Orients
Band 15
herausgegeben von Manfried Dietrich �— Reinhard Dittmann �— Ellen Rehm
It�’s a Long Way to a Historiography of the Early Dynastic Period(s)
Edited by Reinhard Dittmann and Gebhard J. Selz
in collaboration with Ellen Rehm
2015 Ugarit-Verlag Münster
It�’s a Long Way to a Historiography of the Early Dynastic Period(s) Edited by Reinhard Dittmann and Gebhard J. Selz in collaboration with Ellen Rehm
Altertumskunde des Vorderen Orients 15 © 2015 Ugarit-Verlag, Münster
www.ugarit-verlag.de All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. Printed in Germany ISBN 978-3-86835-139-2
Printed on acid-free paper
INHALTSVERZEICHNIS Gebhard J. Selz / Reinhard Dittmann Vorwort ....................................................................................................................... i Hans J. Nissen Die ältere Frühdynastische Zeit als Forschungsproblem ............................................ 1 Joachim Bretschneider Seals, Tablets and Bricks: Fine-tuning of Early Dynastic Chronology in Syria....... 33 Petr Charvát O tempora, o mores? The Sumerian city of Ur before, and after, 3000 B.C............. 51 Reinhard Dittmann Genesis and Changing Inventories of Neighborhood Shrines and Temples in the Diyala Region. From the Beginning of the Early Dynastic to the Initial Akkadian Period............................................................................................. 71 Martin Gruber �“�… somewhat smaller and shallower�”. The development of Conical Bowls in third Millennium Mesopotamia .......................................................................... 129 J. Cale Johnson Late Uruk bicameral orthographies and their Early Dynastic Rezeptionsgeschichte.............................................................................................. 169 Camille Lecompte Untersuchungen zu den Siedlungsstrukturen und ländlichen Siedlungen in der FD-Zeit. Auf der Suche nach den verlorenen Dörfern in den altsumerischen Urkunden ....................................................................................... 211 Marta Luciani Some Methodological Remarks on Stratigraphic and Chronological Issues in Third Millennium Central and South Mesopotamia ........................................... 247 Hana Mayerová The queens of Lagash in the Early Dynastic Period; especially the last three royal couples ........................................................................................... 259 Susan Pollock Abu Salabikh: History of a Southern Mesopotamian Town ................................... 267
vi Vorwort
Licia Romano Holding the Cup: Evolution of Symposium and Banquet Scenes in the Early Dynastic Period ................................................................................... 289 Ingo Schrakamp Urukagina und die Geschichte von Laga�š am Ende der präsargonischen Zeit ....... 303 Gebhard J. Selz (with the collaboration of Daniela Niedermayer) The Burials After the Battle. Combining textual and visual evidence.................... 387 Stefano Seminara Die Rede des Königs. Die sogenannten �‚Reformen�‘ UruKAginas zwischen Politik und Theologie.............................................................................. 405 Marcos Such-Gutiérrez Der Übergang von der frühdynastischen Zeit in die altakkadische Periode anhand der Adab-Texte .......................................................................................... 433 Giuseppe Visicato An Unpublished Archive from ED IIIb Umma before Lugalzagesi ....................... 453 Helga Vogel Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen als Bestattungen und Mitbestattungen im Royal Cemetery in Ur ........................... 461 Index....................................................................................................................... 509
BRIM-STIRNKETTEN-TRÄGER, MUSIKERINNEN UND DOG-COLLAR-TRÄGERINNEN ALS BESTATTUNGEN UND MITBESTATTUNGEN
IM ROYAL CEMETERY IN UR
Helga Vogel / Berlin 1. EINLEITUNG1
Der vorliegende Artikel will zur aktuellen Diskussion über die Identität der im Roy-al Cemetery in Ur Mitbestatteten und den Sinn und Zweck der Mitbestattungen bei-tragen, indem exemplarisch die bislang wenig beachteten Bezüge zwischen den Be-funden der Royal Tombs (RT.) und denen der Private Graves (PG.) anhand von drei spezifischen Personengruppen thematisiert werden, die, wenn auch unterschiedlich gut nachweisbar, sowohl als �‚normale�‘ Bestattungen in Private Graves als auch als Mitbestattungen in Royal Tombs begegnen, den so genannten Brim-Stirnketten-Trägern (vgl. Abb. 1), den Musikerinnen und den Trägerinnen eines besonderen Halsbandes, welches Woolley als Dog-Collar bezeichnete (vgl. Abb. 2). Alternativ hätte man auch die Gruppen der mit Waffen bestatteten und mitbestatteten Männer untersuchen können,2 die hier nur insofern beachtet werden, als dass Brim-Träger sowohl in Private Graves als auch als Mitbestattung in einer Royal Tomb regel-mäßig mit Waffen angetroffen wurden. Im ersten Abschnitt stelle ich die wichtig-sten Eckdaten zum Royal Cemetery in Ur vor. Die problematische Frage der Datie-rung der Gräber wird nicht diskutiert.3
1 Sehr herzlich danke ich Reinhard Dittmann und Gebhard Selz für die Aufnahme dieses doch recht langen Artikels in den vorliegenden Band. Mein sehr herzlicher Dank geht ebenso an Ingo Schrakamp, der mir seine bisher nicht publizierte Dissertationsschrift zur Verfügung stellte (sie wird 2014 in IMGULA erscheinen), und an Paul Christoph Zimmerman, der mir ein PDF seiner 1998 verfassten Masterarbeit zukommen ließ.
Die hier aufbereiteten Daten habe ich zuerst in meiner Dissertation (2008) besprochen. Für den vorliegenden Artikel habe ich das Material überprüft und gegebenenfalls ergänzt. Die entsprechenden Abschnitte meiner Dissertation sind hiermit hinfällig. Als ich an meiner Dis-sertation schrieb, arbeitete Amy Gansell in USA ebenfalls mit dem Material des frühdynas-tischen Gräberfeldes in Ur mit dem Schwerpunkt auf den Royal Tombs. Sie publizierte ihre Ergebnisse 2007 in Cambridge Archaeological Journal 17/1, 29 46. Von ihrer Arbeit erhielt ich erst weit nach Abgabe der Dissertationsschrift Kenntnis. Die in diesem Beitrag verwende-ten Daten basieren auf meinen eigenen Recherchen. Farbig präparierte Pläne und Tabellen findet man als PDF-Datei unter meinem Namen auf academica.edu. Ich danke den Herausge-bern herzlich für ihr Entgegenkommen in diesem Punkt. 2 Vgl. hierzu Rehm 2003, 58 75. 3 Vgl. hierzu Woolley 1934, 208 227; Nissen 1966; Pollock 1983, 125 144; Pollock 1985, bes. 143 146; Zimmerman 1998; Reade 2001. Zimmerman plädiert dafür RT.800 in Schacht
462 Helga Vogel
Abb. 1 Brim-Stirnketten
Abb. 2 Dog-Collar In den folgenden Abschnitten wird das relativ umfangreiche und schwierig zu deu-tende Material zu den Brim-Stinketten-Trägern und zusammenfassend zu den Musi-kerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen vorgestellt und erörtert; eine ausführliche Darlegung der Materialbasis zu den zuletzt genannten Personengruppen erfolgt an anderer Stelle. In der abschließenden Diskussion werden unterschiedliche Aspekte der Identität der Mitbestatteten und die sich hieraus ergebenden Konsequenzen für die vorliegenden Interpretationen zur Erklärungen der Mitbestattungen in den Royal Tombs in Ur behandelt. 2. DER ROYAL CEMETERY IN UR
Als Royal Cemetery wird in der Vorderasiatischen Archäologie ein ca. 70 m x 55 m großes Gräberfeld in der alten Stadt Ur (Tell el-Muqejjir) im heutigen Südirak be-zeichnet, das unter der Leitung von Charles Leonhard Woolley beginnend im Früh-
(RT.800a) und Grabkammer (RT.800b) zu trennen, da es sich seiner Meinung nach um zwei getrennte Anlagen handelt. Auch die verschiedenen architektonischen Komponenten von RT.1050 und 1054 sind seiner Meinung nach zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden und gehören nicht unbedingt zu einer Anlage. Momentan gilt folgende Abfolge der Royal Tombs als soweit gesichert: zuerst angelegt RT.777. 779. 1236 �– danach 1054 (lt. Zimmer-man: Grabkammer) �– zuletzt RT.789. 800 und 1237 (Vorschlag Nissen, Pollock). RT.1050 und 337 datieren lt. Nissen und Pollock in den mittleren Bauhorizont der Royal Tombs; Zim-mermann hält RT.1050 für jünger. Für alle anderen Royal Tombs liegen keine oder ebenfalls abweichende Datierungen vor. Für die Datierung der Privatgräber vgl. Woolley 1934, Kata-log; Nissen 1966, Gräberkatalog und Pollock 1985, bes. 148 158.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 463
jahr 1927 in sechs Grabungswintern ausgegraben wurde.4 Das Areal liegt am südöst-lichen Rand des erhöht liegenden Tempel- und Palastbezirkes der Stadt, teilweise unter und zum Teil außerhalb der späteren Temenosmauer Nebukadnezars II., in einem zur Stadt hin mit unterschiedlichem Gefälle abfallenden Schuttabhang, in dem schon in der emdet-Na r-Zeit ein Friedhof angelegt worden war. Die Frei-legung des Royal Cemetery geschah im Rahmen der 12jährigen Grabungstätigkeit (1922�–1934) Woolleys in Ur, deren Kosten gemeinsam vom British Museum (Lon-don) und dem University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropo-logy (Philadelphia, USA) getragen wurden. Die Funde aus dem Royal Cemetery wurden zwischen dem Iraq Museum (Baghdad) und den beiden vorgenannten Insti-tutionen aufgeteilt.
Im Laufe von sechs Grabungswintern konnten insgesamt ca. 1850 mehr oder we-niger gut erhaltene Gräber freigelegt werden. Von zahlreichen Artefakten, die ge-sondert im Erdreich zwischen den Gräbern angetroffen wurden, schloss Woolley auf weitere 2000 bis 4000 Gräber.5 Von den ausgegrabenen Gräbern datierte er aufgrund stratigrafischer und typologischer Erwägungen 660 Gräber in die Frühdynastische Zeit (FD III), unterteilt in Gräber, die einer frühen Phase des frühdynastischen Grä-berfeldes zugerechnet werden können (Period A) (389 Gräber) und solche, die über-haupt in die frühdynastische Zeit datieren (Period B) (271 Gräber). Die Gräber der Period A markieren den Beginn des Gesamt-Friedhofes, der bis in die Zeit der III. Dynastie von Ur um 2000 v. Chr. genutzt wurde. Den Nucleus des frühdynastischen Gräberfeldes der Period A erkannte Woolley in sechszehn besonderen Grabanlagen (Abb. 3). Woolley nahm an, dass es sich bei diesen besonderen Gräbern um die Royal Tombs der I. Dynastie von Ur handelte;6 die Bezeichnung des gesamten Fried-hofes als Royal Cemetery (dt. Königsfriedhof) leitet sich von diesen Gräbern her.
Anthropologische Untersuchungen wurden zur Zeit der Grabung nur an sehr we-nigen Skelettresten durchgeführt. 7 Zuletzt konnten in London die Knochen von sieben Individuen aus Gräbern der Period A (FD IIIA) und von drei Individuen aus Gräbern der Period B (FD III) des frühdynastischen Friedhofes nochmals anthropo-logisch bestimmt werden8 (vgl. Tab. 1). Hinzu kommen die stark fragmentierten Schädel von insgesamt zehn Mitbestattungen aus RT.789 und 1237, die Woolley in
4 Katharine Woolley arbeitete seit 1924 als Zeichnerin und im Feld an Woolleys Seite. Im letzten Grabungswinter leitete sie die Ausgrabung des Tiefschnittes Pit X. Woolleys Vorar-beiter Hamoudi und seine beiden Söhne führten die oft über 300 Mann starke Ausgrabungs-mannschaft an. Grabungsassistent war von 1925�–1931 Max Mallowan. Es ist folglich reine Konvention, wenn im Folgenden Woolley als das handelnde Subjekt der Ausgrabung vorge-stellt wird. 5 Woolley 1934, 16. 6 Vgl. Woolley 1934, 15 16. Communis opinio ist, dass die Royal Tombs FD IIIA datieren. Eine hiervon abweichende Meinung vertreten Marchesi / Marchetti 2011, 51 65, bes. 64 65: �„To conclude, the royal tombs of Ur seem to fall either immediately before or during the dynasty that ran from Aya�’u êdug to Aya�’anepadda and they therefore appear, contrary to common opinion, to date entirely within Early IIIb�“. Diskussion an anderer Stelle. Zumindest RT.1236 gründet aber zweifelsohne in SIS 4�–5 = Übergang FD II�–FD IIIA. 7 Vgl. Keith 1934. Insgesamt wurden 21 Skelette aus dem frühdynastischen Friedhof nach London verschifft. 8 Vgl. Molleson / Hodgson 2003, 92.
464 Helga Vogel
Abb. 3 Ur vor Ort in Wachs gießen und je samt Helm oder Kopfschmuck und eventuell vorhandener Ketten als Block konservieren ließ. 9 Weitere Skelettreste für den früh-dynastischen Belegungszeitraum des Friedhofes sind nicht vorhanden. Die Bestim-mung des Geschlechts einer bestatteten oder mitbestatteten Person und die Fest-stellung ihres sozialen Status bleibt im Rahmen des Royal Cemetery folgerichtig abhängig von der Interpretation der Artefakte, die bei einem Skelett oder als Beiga-ben im Grab angetroffen wurden.
9 Zwei der Assemblagen befinden sich heute im Irak Museum in Bagdad, zwei weitere im PENN Museum in Philadelphia, die restlichen gehören zum Bestand des British Museum in London; vgl. Baadsgaard et al. 2012, 140.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 465
Tab. 1 Ergebnisse der neueren anthropologischen Untersuchungen
Dabei wird grundsätzlich akzeptiert, dass Waffen, Wetzsteine und so genannte Ra-siermesser (engl. razor) sowie die Brim-Stirnketten von Männern gehandhabte Arte-fakte vorstellen, wohingegen bestimmte Schmuckstücke wie Schmuckkämme, Haar-
466 Helga Vogel
bänder aus Edelmetallen, Haarkränze, große Mondsichelohrringe oder Kleiderna-deln mit Schmuckköpfen weibliche Bestattungen oder Mitbestattungen anzeigen.10 Den sozialen Status einer Bestattung respektive einer Mitbestattung versucht man, wie in der Archäologie in solchen Fällen üblich, anhand der Anzahl, Verschiedenar-tigkeit und der Qualität von aus unterschiedlich wertvollen Materialien gefertigten Gegenständen, die beim fraglichen Skelett und im Grab lagen, einzuschätzen. We-gen des generell schlechten Erhaltungszustandes der Gräber im Royal Cemetery fällt nur bei reicheren Bestattungen respektive ausreichend ausstaffierten Mitbestattun-gen die Befundsituation spezifisch genug aus, um weiterführende Identifizierungen vornehmen zu können. 2.1. DIE SOGENANNTEN PRIVATE GRAVES
Normalerweise erfolgte eine Bestattung im frühdynastischen Gräberhorizont des Royal Cemetery in einem mit Matten ausgelegten Erdgrab. Sehr viel seltener ließen sich Bestattungen in Holz-, Ton- oder Flechtsärgen nachweisen.11 Viele der Gräber waren teilweise oder ganz zerstört. Eine Tote oder ein Toter wurde bekleidet und ge-gebenenfalls geschmückt und mit statusbezogenen Artefakten (Siegel, Waffen) be-stattet. Eine spezifische Ausrichtung der Toten ließ sich nicht feststellen. In aller Re-gel hat man die Toten auf der linken oder rechten Seite liegend in Hockerstellung angetroffen. Die Arme waren so arrangiert, dass die Hände ungefähr in Höhe des Mundes zum Liegen kamen.12 Da bei den gut erhaltenen Bestattungen bei den Hän-den öfters ein Gefäß lag, könnte man annehmen, dass der Gestus eine potentielle Be-reitschaft des Toten oder der Toten zur Nahrungsaufnahme signalisieren sollte. Ei-ner toten Person wurden Beigaben mitgegeben, in erster Linie Gefäße aus Materia-lien unterschiedlicher Wertigkeit (Gold- und Silbergefäße, Steingefäße, Kupferge-fäße und Keramik), ansonsten lassen sich öfters noch Muschellampen, Herzmu-schelschalen mit Pigmenten, seltener Bestandteile von Kosmetiksets, kleinere Werk-zeuge, Spielbretter, Gefäße aus Straußeneiern und noch seltener �‚individuelle�‘ Ge-
10 Vgl. Pollock 1983, 150 168; dies. 1991a, 372 379; Gansell / Winter 2002, 3 4; Gansell 2007, 31 sowie Woolley 1934, 238 245. 303 310. Orientierungspunkte liefern die schon erwähnten in Wachs gegossenen Schädel, die Woolley übrigens herstellen ließ, um die Ge-nauigkeit und Richtigkeit seiner Rekonstruktionen zu beweisen, die Ausrüstungsgegenstände von Bestattungen, die relativ sicher als männliche oder weibliche Bestattungen bestimmbar waren, etwa weil ein beschriftetes Siegel oder ein anderer beschrifteter Gegenstand im Grab vorhanden war, sowie die einschlägigen Informationen, die sich zeitgleichen Bildwerken und Texten entnehmen lassen (Aussehen, Geschlechterrollen u.a.). Kritik an diesem Vorgehen formulierte Dickson 2006, 128 und ausführlicher (bezogen auf die Situation in RT.1237) Vi-dale 2011: �„Woolley�’s identification of the skeletons as female solely on the basis of their costume and accessories, and not on physiological measurements, is open to serious question-ing�“ (ebenda, 432). Auch Cohen 2005, 80 81 zweifelt die Identität der Stadtfürstin Pû-ab (RT.800) an und argumentiert, dass es sich bei dem Skelett lediglich um die zuletzt in der Grabkammer bestattete Person handele. Er argumentiert, dass es unwahrscheinlich sei, dass eine Person mehrere Siegel eignete (ebenda, 81). Dagegen spricht, dass Woolley für die Be-stattungen in den folgenden Private Graves mehr als ein Siegel notiert: PG.31. 33. 35. 227, 543 544. 559. 677. 689. 697. 791. 796. 861. 867. 1081. 1130. 1173. 1276. 1374. 1381 1382. 11 Vgl. Woolley 1934, 135 139; Nissen 1966, 91. 12 Vgl. Woolley 1934, 139 141; zusammenfassend Vogel 2013, 424 429.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 467
genstände beobachten.13 Wenige Gräber erbrachten Gegenstände oder Ansammlun-gen von Gegenständen, die eine gegengeschlechtliche Person dort bewusst niederge-legt hatte.14 Nahrungsmittelreste in Gefäßen machen es wahrscheinlich, dass den Toten eine letzte Mahlzeit im Grab hingestellt wurde.15
Wegen des generell schlechten Erhaltungszustandes der Gräber und anderen Schwierigkeiten bleibt die Stratigrafie des Friedhofes ein Problem. Eine Überprü-fung der von Woolley, Nissen und Pollock vorgeschlagenen Datierungen hat ge-zeigt, dass kein Grab eines Brim-Trägers und einer Dog-Collar-Trägerin oder ein anderes Private Grave, welches im Rahmen dieses Beitrages beachtenswert ist, zwingend später als FD III datiert werden muss. 2.2. DIE ROYAL TOMBS
Die sechzehn von Woolley ausgesonderten Royal Tombs unterschieden sich allesamt von den Private Graves, aber auch untereinander deutlich (vgl. Abb. 3). Woolley rechnete dann ein Grab den Royal Tombs zu, wenn er in ihm auf Mitbestattungen, eine Grabkammer, auf die Reste von Zugtieren und Fuhrwerken und auf besonders kostspielige und zahlreich vorhandene Artefakte stieß.16 Im Gegensatz zu den Privat Graves wurden die Anlagen der Royal Tombs wesentlich tiefer in den Abhang ge-graben. Der Zugang zu den Schächten konnte über Rampen erfolgen. Zehn Royal Tombs erbrachten zum Teil unvollständige architektonische Strukturen, die sich durch ihre Größe und Bauweise deutlich voneinander unterschieden.17 Die ein- oder mehrkammerigen Grabkammern konnten den ausgehobenen Schachtraum ganz oder nur teilweise ausfüllen. War ein Vorhof zu einer Grabkammer vorhanden, befanden sich hier in der Regel zahlreiche menschliche Skelette und im Schachtzugang auch die Überreste etwaig vorhandener Zugtiere von Fuhrwerken. In den verbleibenden sechs Royal Tombs konnten nur Reste von Lehmziegelstrukturen weiter oben im Schacht oder keine architektonischen Strukturen nachgewiesen werden.18 Woolley
13 Einen Überblick liefern die in Tabellenform vorgelegten Analysen der Gräber; vgl. Wool-ley 1934, 412 481. 14 Beispielsweise lag im Sarg des Meskalamdug (PG.755) in Höhe des Oberkörpers des Be-statteten eine Menge weiblicher Schmuck, inklusive eines Dog Collars; vgl. Woolley 1934, 158 und Tab.6 (Diskussion Punkt 4.). Desgleichen fand Woolley im Sarg einer reichen Brim-Träger-Bestattung (PG.1312) vor dem Oberkörper und in Höhe der Hände des Bestatteten den Schmuck und das Siegel(?) einer Frau; vgl. Woolley 1934, 173 und Tab.3. Im Grab einer u.a. mit einem Dog-Collar geschmückten Frau lag vor dem Sarg eine Bronze-Axt (PG.1130); wahrscheinlich waren auch die in der Nähe der Axt freigelegten schmalen Goldbänder Toten-gaben von Männern; vgl. Woolley 1934, 165 166. Auch der weiblichen Hauptbestattung in RT.1054 hatte man einen Dolch und einen Wetzstein sowie ein goldenes Stirnband und viel-leicht auch eine Brim-Stirnkette hinterlassen; vgl. Woolley 1934, 106 107 und Tab. 4 sowie im Punkt 3.2.b. Erwähnenswert sind in diesem Zusammenhang auch die vier Brim-Stirnketten, die Männer beim Leichnam der Stadtfürstin Pû-ab (RT.800) niederlegten; vgl. Woolley 1934, 89. 15 Vgl. Ellison et al. 1978. 16 Vgl. Woolley 1934, 33 35. 17 RT.337 (?) 777. 779. 789. 800. 1050/Fundament aus Lehmziegeln(?) 1054.1236.1631. 1648. 18 RT.580. 1157. 1232. 1237. 1332. 1618.
468 Helga Vogel
charakterisierte die Royal Tombs ohne vorhandene Grabkammer als Death Pits, so bezeichnete er aber regelmäßig auch die Schächte mit Mitbestattungen in Royal Tombs mit erhaltener oder teilweise erhaltener Grabkammer. Bei drei Death Pits handelte es sich um Massengräber im eigentlichen Sinn.19 Sie unterschieden sich von allen anderen Death Pits dadurch, dass bei den in ihnen angetroffen mensch-lichen Skeletten kaum noch Schmuckstücke oder andere Artefakte lagen und man die Toten auch nicht sinnstiftend arrangiert hatte wie dies in den Schächten der Roy-al Tombs RT.789 und 800 bzw. im Death Pit RT.1237 noch beobachtet werden konnte. Die Mehrzahl der Royal Tombs war sehr schlecht erhalten. Die meisten Grabkammern hatte man schon in der Antike wieder ausgeräumt oder geplündert. Unversehrt angetroffen wurde allein die Grabkammer einer unbekannten Frau (RT. 1054), die Grabkammer der Stadtfürstin Pû-ab (RT.800b) und der traditionell mit ihrem Grab assoziierte Schacht (RT.800a), weiterhin der Schacht von RT.789, der Death Pit RT.1237 sowie die kleinen Anlagen RT.1618 und 1648 (Sarg eventuell geplündert).
Hauptbestattungen konnten in einem Sarg erfolgen,20 der Leichnam konnte aber auch auf einer Bahre platziert21 oder auf dem Boden der Grabkammer im Zentrum22 hingelegt werden. Die Toten wurden wahrscheinlich wie üblich auf die Seite gelegt, ihre Beine zur Stabilisierung der Lage angewinkelt und ihre Hände in Höhe des Mundes abgelegt.23 Die Stadtfürstin Pû-ab hat man allerdings auf dem Rücken liegend auf die Bahre gebettet, ihre Hände wurden ihr auf dem Bauch gelegt. Ein goldener Becher und ein goldenes Trinkröhrchen in Höhe ihres Kopfes bezeugen die allgemeine Vorstellung der Zeit, dass ein Toter oder eine Tote so herzurichten war, dass sie in der Totenwelt Nahrung und Flüssigkeiten empfangen konnte. 24 Der Schmuck und die Beigaben der beiden ungestörten Bestattungen von Frauen in den Grabkammern in RT.800 und 1054 dokumentieren den materiellen Aufwand, der bei ihrem Tod geboten war. Rückstände von Nahrungsmitteln in Gefäßen zeigen wie in den Private Graves an, dass der oder die Tote mit einer letzten Mahlzeit versorgt wurde. Gelegentlich vorhandene Tierknochen von Schaf und Ziege könnten auf Tieropfer hindeuten.
Die Mitbestattungen traf Woolley auf dem Boden von Kammern, in den Schäch-ten und im Zugang zum Schacht an. Die von Woolley in UE II publizierten Lage-pläne deuten an, dass man versuchte, die normale Position von Toten auch bei den
19 RT.1050/Grube. 1157. 1332. 20 Beispielsweise RT.1618. 1648, wahrscheinlich auch 779 Kammer A und C. Im Schacht in RT.1050 stand auf einer 50 cm dicken Lehmziegelmauer ein Holzsarg (mit einer weiblichen Bestattung?). Eine sehr flache Vertiefung in der Grabkammer in RT.789 könnte ebenfalls auf eine Sargbestattung hindeuten. 21 Nachgewiesen nur für den Leichnam der Pû-ab in RT.800. 22 Nachgewiesen für die weibliche Bestattung in RT.1054/Grabkammer; wahrscheinlich auch für die (weibliche?) Bestattung in RT.777 und die Bestattung in RT. 1631. 23 In dieser Haltung aufgefunden wurden die Hauptbestattungen in RT1054/Grabkammer, in 1618 und 1648. 24 Die Hauptbestattung in RT.1054/Grabkammer hielt ein Goldgefäß in ihren Händen. In Höhe ihres Kopfes lagen Gefäße und ein silbernes Trinkröhrchen mit einem Mundstück aus Gold; vgl. Woolley 1934, 107.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 469
Mitbestattungen herzustellen. 25 Ob Mitbestattungen tatsächlich regelmäßig mit Trinkgefäßen versorgt wurden, bleibt undeutlich. Die Befunde im Schacht RT.800a und im Death Pit RT.1237 bestätigen Woolleys Annahme eher positiv. Mitbestat-tungen in Grabkammern hatte man gelegentlich mit eigenen Beigaben versorgt.26 Der Schmuck, die Trachtelemente und andere Gegenstände der Ausstattung zeigen üblicherweise die Gruppenzugehörigkeit einer Mitbestattung an. Bei den Frauen lassen sich die eingangs erwähnten Musikerinnenverbände und die beiden unter-schiedlich geschmückten Gruppen der Dog-Collar-Trägerinnen unterscheiden. Im RT.1237 können zudem Subgruppen festgestellt werden, die sich durch das Tragen eines besonderen Perlenarmbandes (so genanntes Bead Cuff) oder goldener Steck-rosetten oder durch Muschelapplikationen auf dem Gewand zu Erkennen geben (vgl. Abb. 4).
Im RT.789 fällt eine gleich geschmückte Frauengruppe auf, die sich von den schon erwähnten Frauengruppen durch ihren Schmuck unterscheidet (vgl. Abb. 5).27 Einzelne weibliche Mitbestattungen führten Siegel mit sich, manchmal trugen diese Frauen im Tod auch eine reichere Schmuckauswahl.28
Auch ansonsten können gruppenbezogene Rangunterschiede festgestellt werden, beispielsweise zählten zu jeder Gruppe Personen, die kaum Schmuck trugen und wahrscheinlich Hilfsdienste leisteten. Die in der Grabkammer der Pû-ab mit-bestattete Frau (am Fuß der Bahre angetroffen) hatte man mit einzelnen wertvollen Schmuckgegenständen bedacht;29 ihre Ausstattung blieb aber weit hinter der Auf-machung der weiblichen Mitbestattungen in den Schächten zurück.
25 Dies gilt aber nur bedingt für die schon erwähnten Massengräber. In RT.1050/Grube lagen auf 1,25 m x 12,00 m (15 m2) die Skelettreste von ca. 40 Personen mehr oder weniger ordent-lich hintereinander aufgereiht. In RT.1157 wurden in einer 5,00 m x 3,25 m (16,25 qm2) großen Grube 58 menschliche Skelette ausgegraben. Die 43 Skelette in RT.1332 lagen in einer 4,30 m x 2,40 m (10,32 m2) großen Grube relativ ungeordnet in zwei Schichten neben- und aufeinander. Die Skelettschichten trennte eine 1,10 m dicke Erdschicht. Für RT.789/ Schacht verzeichnet der Plan in den meisten Fällen nur die Schädel der Mitbestatteten. Die tatsächliche Situation im Schacht nach der Tötung der Mitbestatteten wird vom Zustand des Grabes, der durch die Zeichnung suggeriert wird, deutlich abgewichen sein. 26 Beispielsweise Mitbestattung A in RT.777 und eine gesondert liegende Mitbestattung in RT.1054/Kammer. In beiden Fällen handelt es sich um die Mitbestattung eines Brim-Stirn-ketten-Trägers; vgl. im Punkt 3.2.b 27 Vgl. weiter unten im Punkt 4. 28 Siegelführende mitbestattete Frauen in RT.789: Nr.13. 30. 31; in RT.1237: Nr.7. 17. 25. 60. 61. 69. Im Massengrab RT.1332 entdeckte Woolley insgesamt noch drei sehr schlecht erhal-tene Siegel aus Muschel. Die Siegel in RT.789 und 1237 waren, bis auf eine Ausnahme, aus Lapislazuli und sowohl mit Bankettszenen als auch/und/oder mit Tierkampfszenen dekoriert. Diskussion an anderer Stelle. 29 Ihren Skelettresten rechnete Woolley ein Paar goldene Mondsichelohrringe, eine Silber-nadel mit Lapislazuli-Kopf und Goldkappe, eine Kupfernadel und eine Kette aus doppel-konischen Gold-, Lapislazuli- und Karneol-Perlen zu; vgl. Woolley 1934, 89 90.
472 Helga Vogel
Bei den zahlenmäßig weitaus seltener angetroffenen männlichen Mitbestattun-gen überwiegen waffentragende Männer. Funktional bestimmen lassen sich männli-che Mitbestattungen in den Zugängen zu den Schächten, die wohl als Wache fungie-ren sollten, Wagenführer und das Personal bei den Zugtieren. Selten finden sich die Mitbestattungen einzelner Männer inmitten der erwähnten mitbestatteten Frauen-gruppen, wohingegen man aber weibliche Mitbestattungen niemals im Bereich der männlichen Mitbestattungen antraf. In den Grabkammern hat man männliches und weibliches Personal mitbestattet; es überrascht, dass in RT.1054/Grabkammer nur Männer mitbestattet wurden. 30 Männliche Mitbestattungen, die durch besondere Schmuckstücke, etwa Golddiademe, eine größere Anzahl von Waffen oder durch ihre abgesonderte Lage auffallen, findet man nur in Grabkammern; es handelt sich bei ihnen soweit die Befunde reichen immer um Brim-Stirnketten tragende Männer. Diese wurden aber, wie schon erwähnt, ansonsten auch in Schächten mitbestattet.31
In Tab. 2 habe ich die noch ermittelbaren Zahlen der Mitbestattungen in den Royal Tombs verzeichnet. Es bleibt undeutlich, ob im Laufe der Zeit die Mitbestat-tungen tatsächlich in den Umfang zunahmen, wie es die notierten Zahlen suggerie-ren. Wäre dem so, dann hätte man aber ausschließlich immer mehr Frauen mitbe-stattet. Die Anzahl der mitbestatteten Männer blieb über die Jahrzehnte ungefähr dieselbe; ihre Mitbestattungen waren offensichtlich ausschließlich funktional be-dingt (im Wesentlichen Wach- und Schutzfunktion und Begleitung der Zugtiere und des Fuhrwerkes). In jedem Fall muss man davon ausgehen, dass zu den bekannten zwei �‚großen�‘ Death Pits (RT.789/Schacht und RT.1237) drei weitere hinzuzurech-nen sind, denn die wenigen Dinge, die man in den Massengräbern RT.1050/Grube RT. 1157 und 1332 noch angetroffen hat, entsprechen ganz den Artefakten, die uns sonst von den Mitbestattungen in den erhaltenen Schächten her bekannt sind. Hin-sichtlich der jeweils noch rekonstruierbaren Anzahl der Mitbestattungen können unterschiedliche Faktoren eine Rolle gespielt haben: in erster Linie wohl der Status einer Hauptbestattung, möglicherweise ihr Geschlecht, vorhandene oder nicht vor-handene Zugriffsmöglichkeiten auf für eine Mitbestattung in Frage kommende Per-sonen, der Umfang der Verfügungsmöglichkeiten über die Ressourcen, die für den Bau großer Grabanlagen und die notwendige Ausstattung der Mitbestattungen auf-gebracht werden mussten sowie die �‚Normalität�‘ der Idee, dass beim Tod bestimm-ter Leute Mitbestattungen erfolgen sollten.
In RT.1236. 337. 789. 800 und 1237 fanden sich im Zugang zum Schacht oder in teilweise kaum noch erhaltenen Lehmziegelgebäuden oberhalb der Grabkammern Hinweise auf Libationsvorrichtungen mit deren Hilfe man auch die Mitbestattungen kultisch versorgt haben könnte.
30 Vgl. Woolley 1934, 107. 31 Vgl. die Diskussion im Punkt 3.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 473
Tab. 2 Anzahl der Mitbestattungen in den unterschiedlichen Bereichen der Royal Tombs 3. MÄNNER MIT BRIM-STIRNKETTEN
Nimmt man die vier Brim-Stirnketten, die dem unbekannten Jungen im PG.1133 in den Sarg gelegt wurden, als Prototypen, dann besteht eine Brim-Stirnkette idealer-weise aus drei großen, dattelförmigen, facettierten Perlen, die auf einer goldenen Kette aufgefädelt wurden.32 Im besten Fall saß mittig eine große dattelförmige, häu-fig facettierte Goldperle, flankiert von zwei ebenso gestalteten Lapislazuliperlen. Kleine Ringe aus Karneol dienten als Abstandhalter zwischen den Perlen (vgl. Abb. 1). Zahlreiche Variationen der Grundform ließen sich sowohl bei den Brim- 32 Vgl. Woolley 1934, 167 168.
474 Helga Vogel
Stirnketten-Funden in den Private Graves (Tab. 3) als auch bei denen in den Royal Tombs (Tab. 4) beobachten. Sie betreffen das Material der zentralen Perle, das Ma-terial der beiden anderen Perlen, die Perlenform, die Perlenanzahl, die Form und das Material der kleinen Perlen, die als Abstandhalter dienten, sowie das Material der Kette. 3.1. BRIM-STIRNKETTEN-TRÄGER-BESTATTUNGEN IN PRIVATE GRAVES
Im Folgenden konzentriere ich mich zunächst auf die 28 Private Graves in denen Woolley 29 Brim-Stirnketten oder einzelne Elemente von Brim-Stirnketten bei den Resten der Skelette von erwachsenen Männern freilegen konnte; im PG.1195 fanden sich zwei Brim-Stirnketten (vgl. Tab. 3). Dass es sich dabei um die Gräber von Männern handelt, wird durch das Vorhandensein von Waffen, Wetzsteinen, Rasier-messern oder Meißel im Grab ausreichend belegt. Dass die Brim-Stirnketten von den Männern als Kopfschmuck getragen wurden respektive dass diese Funktion des Schmuckstückes durch seine Platzierung auf dem Schädel des Leichnams angezeigt werden sollte, geht aus den vorhandenen Fundbeschreibungen Woolleys hervor.33 Die geringe Anzahl von Brim-Träger-Bestattungen in Private Graves deutet auf eine exklusive Männergruppe hin. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass die Brim-Stirnketten einen Beruf anzeigten, bestenfalls einen von wenigen Männern ausge-übten. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Brim-Stirnketten einen außergewöhn-lichen Rang oder eine spezifische Funktion von Männern anzeigen. Im Folgenden soll eine gesellschaftliche Verortung dieser Personengruppe versucht werden, auch in Hinblick auf die Mitbestattungen von Brim-Trägern in den Royal Tombs.
Es ist besonders auffallend, dass in 22 von 28 möglichen Gräbern von Brim-Trägern Waffen angetroffen wurden; für drei weitere Gräber (PG.1195. 1702 und 1750) ist es, wegen des Vorhandenseins eines Wetzsteines im Grab, wahrscheinlich, dass zur Ausstattung des Bestatteten ursprünglich ebenfalls eine Waffe rechnete (wahrscheinlich ein Dolch).34 Regelhaft sollte ein Brim-Träger folgerichtig mit Waf-fen bestattet werden. Die in den Gräbern der Brim-Träger ausgegrabenen Waffen entsprechen dabei dem Sortiment, das als typisch für frühdynastische Waffengräber gelten kann: Dolch und Axt überwiegen bei weitem, Lanzen respektive Speere oder andere Waffentypen wie etwa Schaftlochhacken ließen sich hingegen weitaus selte-ner nachweisen.35 Auffallend ist, dass belegbar elf in Private Graves bestattete Brim-Träger sowohl einen Dolch als auch eine Axt mit sich führten; im frühdynasti-schen Gräberfeld des Friedhofes trat diese Kombination insgesamt nur in 57 Grä-bern auf.36 Des Weiteren fällt auf, dass aber in keinem Grab eines in einem Private Grave bestatteten Brim-Trägers eine Waffe aus Edelmetall vorhanden war.37 Insge-
33 Vgl. Woolley 1934, 173 174 (PG.1312); gelegentlich macht Woolley im Katalog nähere Angaben zur Lage einer Brim-Stirnkette bei einer Bestattung in einem Private Grave. Vgl. auch die Lage der Brim-Stirnketten in RT.1648 und 1618 (auf dem Schädel der Sargbestat-tung). 34 Rehm 2003, 11 notiert, dass Dolch und Wetzstein häufig zusammen in Gräbern auftreten. 35 Vgl. Rehm 2003, 9 12 und ebenda Tab.1. 36 Vgl. Rehm 2003, Tab.2.1. 37 Allerdings notiert Woolley für PG.1407 einen Kupferdolch mit einem Griff aus Silber / Silberbeschlag.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 475
samt fanden sich nur in drei Private Graves Edelmetallwaffen: in PG.250 lag ein silberner Kopf einer Axt beim Toten; in PG.560 fand man eine im kleineren Maß-stab gefertigte Silberaxt; Meskalamdug (PG.755) hatte man hingegen mit einer Vielzahl von Waffen aus Edelmetallen (Gold, Elektron) bestattet.38 Da in den Royal Tombs, trotz des allgemeinen schlechten Erhaltungszustandes, noch wenige Waffen aus Edelmetall oder mit Goldbändern dekorierte Speere ausgegraben werden konn-ten,39 lässt sich schlussfolgern, dass diese kostbaren Waffen, die, wenn die Klinge aus Gold, Silber oder Elektron gefertigt war, keinen praktischen Zweck dienten, der obersten Elite Urs vorbehalten blieben, die über die entsprechenden Ressourcen und über den Zugang zu Gold- und Silberschmieden verfügte.40 Zu diesem Kreis zählten die Brim-Träger offensichtlich nicht.
Ausgehend von in frühdynastischen Bildwerken dargestellten Waffen, wurde verschiedentlich argumentiert, dass Dolche keine eigentlichen Kampfwaffen vor-stellen, sondern alltäglich gebrauchte Werkzeuge. Dolche gelten gemeinhin aber als Stichwaffen, die eine deutlich geringere Schneidleistung als Messer erbringen. Auch wenn Dolche in der �‚Standarte von Ur�‘ oder in der �‚Stele des E�’annatum�‘ (Geierste-le) nicht neben Äxten, Lanzen, Beilen oder Speeren als Bewaffnung von Kämpfern gezeigt werden, handelt es sich bei ihnen trotzdem um Nahkampfwaffen, die dem Schutz ihres Trägers oder der gewaltvollen Durchsetzung seiner Ambitionen dienen sollten.41
38 Im Sarg entdeckte man eine Doppelaxt aus Elektron, den Kopf einer weiteren Axt aus Elektron, einen Dolch, dessen Klinge man aus Gold geschmiedet hatte, das Querstück war ebenfalls aus massivem Gold und zusätzlich mit Goldkügelchen dekoriert, das Griffstück und den Knauf hatte man aus Holz gefertigt, mit Silber überzogen und mit Goldkügelchen verziert (vgl. Woolley Pl. 152, U.10014); zum Dolch gehörte wohl eine Scheide aus Silber. Im ausge-hobenen kleinen Schacht fand man u.a. einen Speer, dessen Schaft mit Goldbändern verziert war, vier Dolche mit bronzenen Klingen, aber mit Griffen, deren Heftzwingen zum Teil aus Gold geschmiedet waren, mit hölzernen Griffen mit Silber- bzw. Goldauflagen, neben fünf Bronzeäxten, zahlreichen Speerspitzen, einen weiteren Dolch, kupfernen Pfeilspitzen und vier Harpunen; vgl. Woolley 1934, 156 160. 39 Vgl. Woolley 1934, 303 und zusammenfassend Weber / Zettler 1998 (mit sehr guten Auf-nahmen der Waffen). 40 Auch das Siegel des Königs Meskalamdug �‚bestattete�‘ man im Lehmziegelbau in RT.1054 in einer kleinen Holzschachtel mit zwei Dolchen, deren Klingen und Heftzwingen aus massi-vem Gold und deren Griffe aus Holz mit Goldauflagen bestehen; vgl. Woolley 1934, 98 99. Das Kästchen war an drei Seiten umgeben von Gefäßen aus Stein, Kupfer und Ton, zusätzlich hatte man eine Axt niedergelegt. Woolley notierte zu den Edelmetallwaffen: �„These are of course State or �‚parade�’ weapons such as would be carried by the king himself, possibly by his bodyguard, and by officers of high rank for whom they would serve as insignia�“ (Woolley 1934, 303). 41 Für die genannten Bildwerke vgl. im gegebenen Kontext Rehm 2003, 14 15. Rehm eben-da, 29 weist darauf hin, dass in frühdynastischen Bildwerken aber der �„Kahlköpfige Mann�“, der �„Sechslockige Held�“ und der �„Stiermensch�“ den Dolch als Kampfinstrument benutzen.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 477
Tab. 3 Brim-Träger-Bestattungen in Private Graves
478 Helga Vogel
Ein Blick in die Kunstbücher der Vorderasiatischen Archäologie verdeutlicht, dass Waffen aller Art im 3. Jt. v. Chr. nur im Zusammenhang von Jagd- oder Kriegssze-nen dargestellt wurden; sehr selten entdeckt man das Bild eines waffentragenden Herrschers außerhalb des Schlachtfeldmotivs.42 In zivilen oder in kultischen Szenen oder als rundplastisches Bildwerk begegnen waffentragende Männer nicht.43 Des-gleichen tritt niemals eine Frau zusammen mit Waffen gleich welcher Art im Bild auf. Die eindeutig männlich konnotierten Waffen verweisen folgerichtig auf kriege-rische Handlungen oder zumindest auf die Bereitschaft, Ansprüche gleich welcher Art gewaltvoll durchzusetzen. Die überdurchschnittlich häufig mit Waffen bestatte-ten Brim-Stirnketten-Träger lassen sich dementsprechend als eine Männergruppe bestimmen, bei deren Bestattung durch ihre Aufmachung im Tod ein martialisch gefärbtes Männlichkeitsideal zum Ausdruck gebracht wurde.
Diese Feststellung ist umso interessanter, da in der frühdynastischen Zeit, so je-denfalls die Auskunft philologischer Quellen, vom Palast noch kein stehendes Heer unterhalten wurde und sich die Kriegssaison im Normalfall auf zwei Monate im Jahr beschränkte.44 Das Aufgebot bestand zu dieser Zeit in der Regel aus wehrpflichtigen Tempelbeschäftigten. Schrakamp hat jüngst gezeigt, dass wehrpflichtig aber nur die Oberschicht der Tempelbeschäftigten war, nämlich die �„Leute, die ein Versorgungs-los übernommen haben�“ (sum. lú �šuku dab5-ba), wozu Angehörige von Handwerks-berufen sowie in zweiter Linie die Gruppen der Fischer und Hirten rechnen konn-ten.45 Diese Personen erhielten von der Institution, für die sie arbeiteten, nicht nur Naturalrationen, sondern auch ein Stück Ackerland (das �‚Versorgungslos�‘), welches sie bewirtschaften (lassen) konnten. Den Kern des wehrpflichtigen Tempelpersonals und seine Elite stellten Männer vor, die in den Texten aus Laga�š als RU-lugal oder àga-ús firmieren und aus dem Kreis der lú �šuku dab5-ba/Wehrpflichtigen rekurriert wurden.46 Von den ca. 1200 Beschäftigten des Baba-Tempels in Laga�š gehörten zu dieser Personengruppe etwa 200 Männer (von ca. 400 überhaupt wehrpflichtigen Männern). Vom Wehrdienst ausgenommen waren Priester, andere im Kult beschäf-tigte Personen, Halbfreie, Hilfsarbeiter und andere am unteren Ende der sozialen Leiter Angesiedelte, wahrscheinlich aber auch die höchsten Tempelfunktionäre.47 Laut Schrakamp waren die RU-lugal und àga-ús relativ wohlhabende Leute, was besonders für die Hauptmänner (gal-ù ), die Abteilungen von rund 100�–200 Mann anführten, gegolten haben wird.48 Das Zentrum der Militärverwaltung war der Pa-last, dem auch die Wehrpflichtigentruppen der Tempel eines Stadtstaates unterstan-den.49
42 Ein seltenes Beispiel ist ein reliefierter Sockels aus Tello, dessen Dekor u.a. zwei Gruppen von Männern zeigt, die aufeinander zugehen. Der Anführer der einen Gruppe trägt einen Speer, der der anderen Gruppe einen Krummstab; vgl. Strommenger 1962, Abb. 44. 43 Welche Schlüsse können aus dieser Beobachtung gezogen werden? 44 Vgl. Schrakamp 2010, 9. 45 Vgl. Schrakamp 2010, 6 8 (Laga�š), 10 (Umma), 11 sowie Prentice 2010, 69 82. 46 Vgl. Schrakamp 2010, 7 8; für àga-ús ebenda, 20 21 bes. [5]. 32.33 und für RU-lugal ebenda, 170 190. 47 Vgl. Schrakamp 2010, 7. 184 48 Vgl. Schrakamp 2010, 20 [5]. 187 [13]�–190 [15]. 49 Vgl. Schrakamp 2010, 9; ders. 2013, 450 451.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 479
Tab. 4a Mitbestattungen von Brim-Stirnketten-Trägern oder Hinweise auf
Brim-Stirnketten in Grabkammern
Tab. 4b Mitbestattungen von Brim-Stirnketten-Trägern oder Hinweise auf
Brim-Stirnketten in Schächten
480 Helga Vogel
Tab. 4c Weitere Hinweise auf Brim-Stirnketten-Träger
Im Kriegsfall wurden an die Wehrpflichtigen Äxte, Lanzen, Helme und Schilder ausgegeben, die nach dem Einsatz in die staatlich kontrollierten Waffenlager zu-rückgegeben werden mussten; die Metallwaffenproduktion unterlag der Kontrolle des Palastes.50 Im Palast war höchstwahrscheinlich zum Schutz eine kleine Garde-truppe professioneller Soldaten stationiert, die dem Herrscher unterstand.51 Bemer-kenswert ist in diesem Zusammenhang, dass in den Urkunden über �‚ma�šdaria-Liefe-rungen�‘ (Kultabgaben zu den Festen der Gottheit Nan�še) aus dem Archiv des Baba-Tempels in Laga�š und in Urkunden über �‚Schenkungen von reiner Milch und reinem Malz�‘ eine Reihe von Hauptmännern (gal-ù )52 als Angehörige der höchsten Funkti-onärsschicht des Stadtstaates genannt wird; 53 zu dieser gesellschaftlichen Ober-schicht rechnen ansonsten u.a. noch Generalverwalter (NU-banda), Handelsbeauf-tragte des Stadtfürsten (dam-gàra), Hausverwalter (agrig) oder Tempelverwalter (sa a) und die Ehefrauen.54
Nimmt man für das FD IIIA-zeitliche Ur eine ähnliche gesellschaftliche Schich-tung und eine ähnlich aufgebaute Wehrpflichtigenarmee wie für das FD IIIB-zeit-liche Laga�š an, dann sind die folgenden Überlegungen zur sozialen Stellung der Brim-Träger möglich: Die ca. 33,1% dokumentierten frühdynastischen Waffenträ-ger-Gräber im Royal Cemetery55 könnten (größtenteils) die Gräber von Wehrpflich-tigen sein, denen ihre Waffen vom Palast dauerhaft überlassen wurden (also ein Per-sonenkreis, der den laga�šitischen RU-lugual und àga-ús entsprochen haben könnte)
50 Vgl. Schrakamp 2010, 8. 78 [9]; Schrakamp 2013, 449 450. 51 Vgl. Schrakamp 2010, 9. 52 Vgl. Schrakamp 2010, 110 119. 53 Vgl. Schrakamp 2010, 113 [8]. Die meisten in den präsargonischen Urkunden aus Laga�š erfassten gal-ù können dem Herrscherhaushalt zugeordnet werden; vgl. Schrakamp ebenda, 115. 54 Vgl. für die vorgenannten Schenkungen und die daran beteiligten Personen auch Prentice 2010, 181 185 und 189 198 und zuerst Selz 1995, 73 [155] 78 [161] und 203 [71] 205 [76]. 202 [70] sowie Beld 2002, 127 136 und ebenda Tab. 3-3. 55 Vgl. Rehm 2003, Tab. 2.1. und 2.2.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 481
oder die von anderen hohen Funktionären.56 Die überdurchschnittlich oft mit Waffen im Grab angetroffenen Brim-Träger könnten mithin Personen vorstellen, die im Kriegsfall militärische Führungsaufgaben übernahmen; die Brim-Stirnketten könn-ten in diesem Fall ihren spezifischen Rang anzeigen. Alternativ ist auch denkbar, dass die Brim-Stirnketten-Träger besondere (militärische) Aufgaben im Palast wahr-nahmen und die Brim-Stirnketten ihren spezifischen Einsatzort signalisierten. Leider enthalten die in den Gräbern der Brim-Träger gefunden Siegel keine Namensin-schriften oder Hinweise auf einen Beruf.57 Es lassen sich aber weitere Argumente anführen, die meine Vermutung, dass es sich bei ihnen um ranghohe Militär- und / oder Palastfunktionäre handelte, unterstützen: die häufig beobachtbare Bestattung von Brim-Trägern in einem Holzsarg, die sonst noch erhalten Trachtelemente oder Beigaben und die Art des Schmuckes, den eine Frau im PG.1312 beim Leichnam ihres Mannes(?) im Sarg niederlegte.
Wie eingangs erwähnt, hat man Personen im frühdynastischen Friedhof in Ur auf unterschiedliche Art und Weise bestattet. Die feststellbaren Zahlen habe ich in Tab. 5 notiert. Besonders auffällig ist nun, dass ein hoher Prozentsatz von Brim-Trägern in Holzsärgen bestattet wurde, wohingegen im Gesamt der Gräber des Friedhofes eine Holzsargbestattung eher selten erfolgte. Woolley notierte: �„ (...) they [die Bret-ter für die Holzsärge; HV] must have been cut from large trees and were probably comparatively expensive, which would agree with the greater wealth of offerings usual in a grave with a wood coffin.�“58 Die Bestattung in einem Holzsarg funktio-nierte mithin als soziales Distinktionsmerkmal, allein aus Kostengründen. In diesel-be Richtung deuten Holzsargbestattungen von Personen, die zweifelsohne gehobene soziale Positionen bekleideten, etwa die des Meskalamdug (PG.755), die eines Mannes in RT.1618 respektive in RT. 1648 sowie die Bestattung in RT.1050/ Lehm-ziegelschicht; auch für RT.779/Kammer A und C und RT.789/Grabkammer sind Holzsargbestattungen wahrscheinlich. Es könnte sich dabei mehrheitlich um männ-liche Bestattungen gehandelt haben, eine Beobachtung, die eine entsprechende Durchsicht aller im Katalog in UE II aufgelisteten Holzsargbestattungen von der Tendenz her bestätigt. Bei den einzigen sicher erkennbaren Ausnahmen handelt es sich um die Bestattungen von drei sehr reich ausgestatteten Dog-Collar-Trägerinnen (PG.1130. 1315. 1421). Allerdings erfolgten auch in Erdgräbern sehr reich ausges-tattete Bestattungen. Woolley bemerkte: �„Although the poorer graves were most often of this sort [mit Matten ausgelegte Erdgräber; HV], yet it by no means follows that a mat-lined grave contained little of value; there seems to have been no rule in the matter and, while the wooden coffins were on the whole the richest, the different
56 Wie schon erwähnt, wurden Waffen im Kriegsfall ausgegeben und Beendigung des Krieges zurückgegeben; vgl. Selz 1989, 507�–508 (Nik 281). 526�–527 (Nik 298). Metalle wurden vom Palast erworben,; vgl. etwa Moorey 1994, 24�–5�–248 und Schrakamp 2013, 449; �„Metall, das gegen Getreide, Wolle oder Silber meist in Delmun erworben wurde, war �‚Eigentum�‘ (u2-rum) von Herrscher oder Herrschergemahlin, wurde diesen zugeleitet (�…) oder von ihnen im Palast gewogen (�…) oder aus dem Palast ausgegeben. Fertige Metallprodukte wie Waffen wurden an das Herrscherpaar ausgeliefert�“. Es stellt sich deswegen im Grundsätzlichen die Frage, wie Männer im Frühdynastikum dauerhaft in den Besitz einer Waffe kamen. 57 Vgl. die entsprechenden Einträge in der Spalte �„Siegel�“ in Tab. 3. 58 Woolley 1934, 137.
482 Helga Vogel
types of burial do not correspond to any recognizable difference of cast or wealth.�“59 Trotzdem handelt es sich bei einem Holzsarg um ein zusätzliches, durchaus auch geschlechtlich konnotiertes Mittel zur sozialen Unterscheidung, das wie auch andere seltene und wertvolle Artefakte auf Ausdifferenzierungsprozesse innerhalb der hö-heren und höchsten sozialen Schichten Urs verweist.
Tab. 5 Grabformen im frühdynastischen Gräberhorizont des Royal Cemetery Wendet man sich der Ausstattung der bestatteten Brim-Träger und dem Grabzube-hör zu (vgl. Tab. 3), dann fallen zunächst die regelmäßig bei den Skelettresten ange-troffenen kleinen Schmuckstücke auf, zumeist Ohrringe und Haarringe aus Gold und seltener Silber, (fragmentierte) Bändchen aus Silber, die Woolley als Gürtel deutete; ferner fanden sich in verschiedenen Gräbern noch eine Goldnadel, ein Fingerring aus Gold, eine Silbernadel und silberne Fingerringe.60 Es kann angenommen wer-den, dass diese Artefakte im Alltagsleben den höheren sozialen, sozioökonomischen Status der Bestatteten signalisierten und sie überdies als Angehörige der oberen Schichten Urs auswiesen, die Zugang zu den importierten Edelmetallen, Halbedel-steinen oder anderen Luxusgütern hatten.61 Zu nennen wären in diesem Zusammen-hang auch die in vier Gräbern angetroffenen Silbergefäße (PG. 317. 429. 1181. 1195), insbesondere aber zweckungebundene Luxusgüter wie das Straußenei im PG. 1312 oder das Toilettenset aus Silber in PG.389 sowie persönlich gestaltete Gegens-
59 Woolley 1934, 136. 60 Die häufig bei männlichen Bestattungen angetroffenen spiraligen Haarringe, zumeist lag nur ein einziger bei den Schädelüberresten, überraschen, da in der �‚sumerischen�‘ Bildkunst Männer aller sozialen Schichten gemeinhin mit rasiertem Schädel vorgestellt werden. Auch in den sehr seltenen Fällen, in denen eine Herrscherfigur mit einem bauschigen Nackenknoten gezeigt wird (etwa E�’annatum von Laga�š in seiner Stele), wird der Nackenknoten von einem schmalen Kopfband und nicht von Haarringen gehalten (geradeso hat man den Goldhelm des Meskalamdug [PG.755] gestaltet). Eventuell zeigt aber die Statuette von Lamkimari, König von Mari, den Einsatz eines Haarringes zum Zusammenhalten von langen, zum Nacken-knoten frisierten Haaren; exemplarisch führt dies dann der akkadzeitliche Bronzekopf aus Niniveh vor (vgl. beispielsweise Strommenger 1962, Abb. 100, respektive Abb. XXII). 61 In diesem Zusammenhang sollte man sich vergegenwärtigen, dass die übergroße Mehrheit der mesopotamischen Bevölkerung keinen Zugang zu Metallen, Halbedelsteinen und ähn-lichen Produkten hatte. Tatsächlich besaßen die Arbeiterinnen und Arbeiter, die von den gerade existenzsichernden Rationen lebten, nur ein einziges Gewand, welches sie (mindes-tens) ein Jahr lang tragen mussten; vgl. Waetzoldt 1988, 36 Anm. 34; Waetzoldt 1984, 24 25 und den Übersichtsartikel zu Rationen von Stol 2008.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 483
tände wie ein Lapislazuli-Amulett (PG.1195) oder Kettenanhänger aus Gold oder Silber, die überdies in einer aufwendigen Technik gestaltet wurden (PG.317. 1195), ferner die kupfernen Toilettensets. Auch der im PG.1312 im Sarg bei den Händen des Leichnams niedergelegte Frauenschmuck deutet den hohen sozialen Rang an, den Brim-Träger im frühdynastischen Ur erlangen konnten. Bei den einzelnen Schmuckteilen der Frau handelt es sich offensichtlich um deren persönlichen Besitz; sie scheint zudem eine Funktion ausgeübt oder eine Stellung inne gehabt zu haben, die ihr das Führen eines Siegels erlaubte. Ihr Haarkranz und ihre Silbernadel mit Lapislazulikopf und Goldkappe entspricht zwar Artefakten, die auch in den Royal Tombs Hauptbestattungen und Mitbestattungen schmückten, ihr fehlen aber ein Schmuckkamm, die silbernen Haarringe (ihre sind aus Gold) und vor allem die gro-ßen goldenen Mondsichelohrringe, die im Kontext des frühdynastischen Gräber-feldes den institutionellen Charakter eines Schmucksets anzeigen. Auch das andere Material ihres Haarbandes (Silber anstelle von Gold) sowie ihre �‚nur�‘ aus Lapis-lazuli- und Karneolperlen, aber mit einer seltenen Jasperperle als Anhänger gestalte-te Kette, beschreiben die relative Eigenart ihres Schmuckes. 62 Der im PG.1312 bestattete Brim-Träger und seine Frau rechneten sicherlich zur Oberschicht Urs, die über entsprechende Mittel und/oder Beziehungen verfügte, um sich einen gehobenen Lebensstil leisten zu können.
Woolley nahm seinerzeit an, dass die Abwandlungen der Grundform der Brim-Stirnkette Hinweise auf die soziale Binnengliederung der Brim-Träger-Gruppe lie-fern. Brim-Stirnketten mit einer Goldperle hielt er für die kostbarsten, �„worn by men at court,�“63 die mit einer Silberperle hätten Männer mit einer weniger herausragen-den Stellung getragen, gefolgt von auf der sozialen Leiter noch weiter unten ange-siedelten, deren Brim-Stirnkette nur Perlen aus Halbedelsteinen aufwies. 64 In Hin-blick auf Woolleys These lässt sich zunächst festhalten, dass in den Private Graves die Anzahl der mit einem �‚Gold-Brim�‘ ausgestatteten Toten die der mit einem �‚Sil-ber-Brim�‘ oder mit einer Brim-Stirnkette ohne Edelmetallperle versorgten Toten bei weitem übertrifft. Jedoch lässt sich im Grundsätzlichen kein gravierender Unter-schied in der Behandlung und Ausstattung der mit unterschiedlichen Brim-Stirn-ketten geschmückten Toten feststellen. Sowohl �‚Gold-Brim�‘-Träger als auch �‚Silber-Brim�‘-Träger wurden in Erdgräbern, in Tonsärgen und in Holzsärgen bestattet. Es bleibt offen, ob die weniger umfangreichen Grabinventare, die Woolley für die �‚Sil-ber-Brim�‘-Träger-Bestattungen notierte, dem Zustand der jeweiligen Gräber zu Schulden sind. Zu den beiden nachgewiesenen Holzsarg-Bestattungen von Männern, die man �‚nur�‘ mit Brim-Stirnketten aus Halbedelsteinen geschmückt hatte (PG.1407. 1412), gehörten jeweils Siegel, Dolch und Axt, wobei bei der Bestattung in PG.1407 ein Dolch mit einem Silbergriff oder versilbertem Griff lag.65 Auch die anderen noch vorhandenen Trachtbestandteile oder Beigaben (beispielsweise Steingefäße)
62 Vgl. Woolley 1934, 173 174. 63 Woolley 1934, 243. 64 Vgl. Woolley 1934, 243 244. Woolley deutete die Brim-Stirnketten funktional als Halte-schnur für die Befestigung eines Tuches, das ähnlich einer Kufiya den kahlen Kopf der �‚Su-merer�‘ vor der Sonne geschützt hätte. Die ärmeren Männer hätten anstelle einer Brim-Stirnkette eine Schnur gebraucht. 65 Vgl. Anm.37.
484 Helga Vogel
machen es unwahrscheinlich, dass ihre Brim-Stirnketten einen prinzipiell den Gold-Brim-Stirnketten- oder Silber-Brim-Stirnketten-Trägern nachgeordneten sozialen Status anzeigen.
Es fällt aber trotzdem auf, dass man besonders auffällige Bestattungen von Brim-Trägern in Private Graves stets mit einem �‚Gold-Brim�‘ ausgestattet hat. Silberge-fäße, die insgesamt ausgesprochen selten aufgefundenen Schaftlochhacken, beson-dere Schmuckstücke aus Gold, Silber oder Lapislazuli, das silberne Toilettenset, silberne Stirnbänder und die weitaus repräsentativeren �‚Golddiademe�‘ fanden sich, so der vorliegende Befund, ausschließlich bei �‚Gold-Brim�‘-Trägern. Dass die Ver-wendung einer Gold- oder Silberperle bei der Zusammenstellung der Perlen für eine Brim-Stirnkette nicht zufällig, sondern absichtlich erfolgte, belegen am Eindeutigs-ten die beiden dokumentierten �‚Ersatzperlen�‘, die in den Brim-Stirnketten, der in PG.1314 und 1420 bestatteten Brim-Träger verarbeitet wurden. Aus welchen Grün-den auch immer man zu �‚Ersatzperlen�‘ griff, ihre Herstellung erfolgte intentional im Rahmen eines spezifischen Werte- und Bedeutungssystems, in dem Silber als weni-ger kostbar als Gold galt. Man könnte also vermuten, dass �‚Gold-Brims�‘ innerhalb der Gruppe der Brim-Träger einen Mann tatsächlich mehr Status, Prestige oder Au-torität zuwiesen, einigermaßen sicher behaupten lässt sich dies aber nur dann, wenn noch andere Indizien für eine hervorgehobene Stellung des Bestatteten sprechen.
In diesem Zusammenhang möchte ich zuletzt auf die drei �‚Golddiademe�‘ verwei-sen, die in PG.1312 und 1750 zusätzlich zum �‚Gold-Brim�‘ die Bestatteten schmück-ten; für PG.389 muss dies vorausgesetzt werden.66 Es handelt sich dabei um oval-förmige, zu den Seiten schmaler werdende Stirnbänder aus Gold, die mit einem Bändchen am Kopf befestigt wurden. Mittig sind sie mit eingravierten Rosetten ver-ziert. Stirnbänder aus Gold hat Woolley äußerst selten als Ausstattung von in Private Graves bestatteten Personen verzeichnet (insgesamt 9 Gräber).67 Mir sind zwei Grä-ber bekannt, in denen Stirnbänder aus Gold einer Bestatteten als Totengabe hinter-lassen wurden: Im PG.1130 hat man zwei mit Punkten dekorierte Stirnbänder aus Gold bei einer Axt vor dem Sarg der Bestatteten zurückgelassen.68 Im RT.1054 lag auf der Stirn der in der Grabkammer Bestatteten zusätzlich zu ihrem Goldschmuck ein ovales Stirnband aus Gold, das, wie im Falle der Stirnbänder der drei in Private Graves bestatteten Brim-Träger, mit einer (8-blätterigen) Rosette dekoriert ist.69 Da in der Nähe des Kopfes der Toten ein �‚Gold-Brim�‘ entdeckt wurde, könnte man ver-muten, dass diese beiden Schmuckstücke ihr von einem Brim-Träger hinterlassen wurden, der in einem engen Verhältnis zur ihr stand, denn sonst hätte er seine ihn
66 Vgl. Tab. 3 Anmerkungen zum Grab. 67 Neben den erwähnten drei ovalförmigen Stirnbändern mit Rosetten-Dekor, verzeichnet Woolley vier relativ schmale, an den Enden abgerundete Bänder aus Gold, die zwischen 23 und 35 cm lang und mit Punkten entlang der Kanten dekoriert sind: PG.55 (ein sehr reiches Grab ohne Waffen, Wetzstein; vielleicht gehört das Stirnband hier auch zu einer weiblichen Bestattung oder wurde dieser überlassen); PG.1065 (Geschlecht der toten Person unklar). PG.1266 (männliche Bestattung). PG.1625 (männliche Bestattung); in einem weiteren Fall (PG.1267) blieb das Stirnband ohne Dekor (männliche Bestattung). Hervorzuheben ist das längliche, am Rand mit Punkten dekorierte Goldband aus PG.153, das Rosetten und Männer, die mit Tieren agieren, zeigt (L.: 32 cm; B.: 2,8 cm; Geschlecht der toten Person unklar). 68 Vgl. Woolley 1934, 165 166 und Tab. 6. 69 Vgl. Woolley 1934, 106 (U.11906; L.: 11 cm; B.: 5,5 cm).
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 485
identifizierenden Schmuckstücke nicht direkt auf ihren Schädel gelegt (sondern etwa neben ihren Körper wie das bei den Brim-Stirnketten, die man der Stadtfürstin Pû-ab daließ, der Fall war).70 Innerhalb der Gruppe der Brim-Träger signalisierte die Kombination von �‚Gold-Brim�‘ und den mit einer Rosette dekorierten ovalen Gold-stirnbändern die hervorragende soziale Stellung der fraglichen Individuen. Beach-tenswert ist deswegen, dass eine im RT.777 in ungestörter Lage angetroffene Mitbe-stattung diesem elitären Kreis angehörte.
In summa: Es wurde argumentiert, dass die in Private Graves bestatteten Brim-Träger nicht zur absoluten Spitzengruppe der sozialen Pyramide im frühdynasti-schen Ur rechneten, immerhin aber mehrheitlich ranghohe Militär- und/oder Palast-funktionäre vorstellen. Dabei wurde einerseits auf die geringe Anzahl von Gräbern mit Brim-Träger-Bestattungen, andererseits auf ihre regelmäßige Bestattung als �‚Waffenträger�‘ verwiesen. Der relative soziale Rang eines brim-Stirnkette-Trägers ergibt sich aus der Kombination von Merkmalen wie Auswahl der Perlen für eine brim-Stirnkette, Bestattungsart, die Häufigkeit von Gold- und Silberartefakten in einem Grab, den Besitz von Luxusgütern und von individuell gestalteten Schmuck-stücken, eines Amuletts oder eines Siegels. Als herausragendes Status- und Rang-merkmal konnte die Kombination von �‚Gold-brim�‘ und Goldstirnband bestimmt werden. Abgesehen von der Brim-Stirnkette, die auf die institutionelle Zugehörig-keit ihres Trägers und dessen Rang/Funktion oder Autorität verweist, erforderten die anderen in den Gräbern bei den Brim-Trägern angetroffenen Artefakte, dass sie (und ihre Angehörigen) Zugang zu importierten Ressourcen (Metallen; Halbedelsteinen u.a.) und Luxusgütern hatten, entweder aufgrund eigener �‚finanzieller�‘ Mittel oder/ und durch ihre gesellschaftlichen Beziehungen oder ihre Stellung am Palast. 3.2. BRIM-STIRNKETTEN-TRÄGER-MITBESTATTUNGEN IN ROYAL TOMBS
Mitbestattungen von Brim-Stirnketten-Trägern lassen sich über die gesamte Laufzeit der Royal Tombs verfolgen. 71 Brim-Stirnketten-Träger gehören demzufolge vom Anfang bis zum Ende der Royal Tombs zu dem kleinen Kreis von Männern, die als Mitzubestattende überhaupt in Frage kamen. Hierzu zählen ansonsten noch, wie schon bemerkt, bewaffnete Männer, die in schützender oder bewachender Funktion mitbestattet wurden, Wagenlenker und Hilfspersonal(?) sowie andere mit unbe-stimmbarer Funktion, auch wenn sie mit einer Waffe angetroffen wurden72. Brim-
70 In Höhe der Taille der Toten entdeckte Woolley außerdem einen Dolch und einen Wetz-stein. Der Befund gab Anlass zu allerlei Spekulationen über das Geschlecht und die Rolle der Toten im Leben; vgl. zuletzt McCaffrey 2008. Eine Diskussion dieses Grabes erfolgt an anderer Stelle. Woolley rechnete den �‚Gold-Brim�‘ allerdings der in abgesonderter Lage an der Kammerwand liegenden männlichen Mitbestattung zu; vgl. Woolley 1934, 107. Dem folge ich im weiteren Verlauf der Diskussion. 71 Beginnend mit RT.1236. 777 über RT.1054. 337 bis zu den zuletzt angelegten Anlagen RT.789. 800 und 1237. In der Füllung des Schachtes von RT.580 entdeckte Woolley außer-dem noch eine Goldkette von einem Brim. Vgl. zu den Brim-Trägern auch Gansell 2007, 34 36 sowie Tab. 4. 72 Letzteres trifft beispielsweise auf die mit einer Axt ausgestatteten Mitbestattungen Nr. 33 in RT.789 und Nr. 21 in RT.1237 zu, die inmitten von Frauengruppen aufgefunden wurden.
486 Helga Vogel
Stirnketten-Träger hat man sowohl in Grabkammern als auch in Schächten mitbe-stattet. Für die in den Schächten mitbestatteten ergibt sich zunächst das Folgende:
a) in Schächten In den soweit erhaltenen Schächten der spät angelegten Anlagen RT.789. 800 und 1237 hat Woolley insgesamt neun Mitbestattungen von denkbaren Brim-Trägern ausgegrabenen: in RT.789 drei, in 800a fünf und in 1237 eine Brim-Träger-Mit-bestattung (vgl. Tab. 4b). Für sieben der neun potentiellen Brim-Träger-Mitbestat-tungen ist durch die bei ihnen angetroffenen Waffen, Wetzsteine oder Rasiermesser soweit garantiert, dass es sich bei ihnen tatsächlich um Männer handelte. Da die Mitbestattung Nr. 23 in RT.789 einen typischen �‚Silber-Brim�‘ getragen hat, dürfte auch sie eine männliche Mitbestattung gewesen sein, auch wenn die ihr zugeordne-ten Dinge ebenso gut zur Ausstattung einer weiblichen Mitbestattung zählen könn-ten. Die Mitbestattung Nr. 11 in RT.800 lässt sich aber weder durch ihre Ausstat-tung noch durch ihre Lage im Schacht eindeutig geschlechtlich bestimmen; bei ihr muss man sich ganz darauf verlassen, dass eine Brim-Stirnkette eine männliche Be-stattung oder Mitbestattung anzeigt.
Bei der Bewaffnung der mitbestatteten Brim-Stirnketten-Träger fällt nun auf, dass diese deutlich hinter der aus den Private Graves von Brim-Stirnketten-Trägern bekannten zurückbleibt; keiner von ihnen war mit einem Dolch und einer Axt ausge-rüstet, Wetzsteine oder Rasiermesser führten nur einige mit sich, Meißel oder andere kleine Instrumente fehlen ganz. Bemerkenswerterweise wurden waffenführende Mitbestattungen aber schlechterdings in den Schächten der Royal Tombs in aller Regel nur mit einer Waffe angetroffen; Wetzsteine oder Rasiermesser, Toilettensets und Ähnliches hat Woolley ihnen nur in seltenen Fällen zugerechnet. Die mitbestat-teten Männer besaßen folglich diese persönlichen Artefakte, die in den Private Gra-ves durchaus zur �‚normalen�‘ Ausstattung eines Brim-Stirnketten-Trägers oder waf-fenführenden Mannes zählten, 73 nicht; auch hatten weder die Institutionen oder Personen, die sie als Mitzubestattende bestimmt hatten, noch ihre Angehörigen sie im Tod damit versorgt. Der Befund überrascht besonders hinsichtlich von siegel-führenden Mitbestattungen wie Nr. 19 in RT.800/Schacht, denn man erwartet, dass beispielsweise dieser Mann, dessen Muschelsiegel zudem seinen Namen trägt, all-täglicher Weise eine gewisse soziale Position einnahm und ihn weitere statusbe-dingte Artefakte, zusätzlich zu seinem Siegel, gehörten. An Schmuckstücken sind lediglich zumeist silberne, nur im Ausnahmefall goldene Ohrringe oder Haarringe dokumentiert, die allerdings auch in den Private Graves öfters das einzige persönli-che Schmuckstück eines Mannes vorstellen. Individuell gestaltete Anhänger, Finger-ringe oder Amulette fehlen ganz. Wegen der ihnen zugeordneten Trachtelemente, kann eine Sonderstellung für die Mitbestattung Nr. 23 in RT.789 und für die Mitbe-stattung Nr. 11 in RT.800 angenommen werden, die beruhend auf den vorhandenen Daten aber nicht erklärt werden kann.
In diesem Zusammenhang ist auch auffällig, dass nur zwei Mitbestattete Brim-Stirnketten trugen, deren Perlen man in der üblichen Weise kombiniert hatte (Nr. 21 und Nr. 23 in RT.789). Alle anderen hier fraglichen Stirnketten weichen von der Grundform eines �‚Brims�‘ ab, häufig durch die Anzahl der Perlen oder seltener durch
73 Vgl. Rehm 2003, Katalog 2 und auch Katalog 3 (Pit X).
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 487
das Fehlen einer Edelmetallperle. Nur zwei der zu besprechenden Brim-Stirnketten weisen aber Goldperlen auf (die von Nr. 23 in RT.789 und Nr. 19 in RT.800), wo-hingegen bei den Brim-Stirnketten der in Private Graves bestatteten Brim-Stirn-ketten-Träger, aber auch bei in den Grabkammern mitbestatteten Brim-Stirnketten-Trägern �‚Gold-Brim-Stirnketten�‘ überwiegen, so jedenfalls die Befundlage. Die schon erwähnte Mitbestattung Nr. 19 in RT.800 hat Woolley als �„Keeper of the wardrobe�“ der Stadtfürstin Pû-ab identifiziert;74 es könnte sich bei ihm aber auch beispielsweise um einen �‚Angestellten�‘ im Rang eines Hausverwalters oder so Ähn-lich, aber auch um den Führer des Schlittens gehandelt haben. Der generellen Linie folgend, signalisierte seine Brim-Stirnkette einen höheren sozialen Rang; dies deutet auch sein Ohrring aus Gold an.
In summa: Vorläufig lässt sich festhalten, dass innerhalb der Gruppe der männlichen Mitbestattungen in den Schächten, sich die Brim-Stirnketten-Träger gemeinhin nur durch ihre besonderen Stirnketten auszeichnen, ansonsten entspricht ihre noch re-konstruierbare Erscheinung aber im Grundsätzlichen der der anderen mitbestatteten Männer.75 Die bei ihnen angetroffenen Artefakte bringen gleichzeitig einen gewis-sen sozialen Abstand zu den in Private Graves bestatteten Brim-Stirnketten-Trägern zum Ausdruck; schwerlich lassen sie sich als Männer identifizieren, die (militäri-sche) Führungsaufgaben ausgeübt haben könnten wie dies bei den in Private Graves bestatteten Brim-Stirnketten-Trägern der Fall war. In RT.800 führten die bei den Zugtieren aufgefundenen Brim-Stirnketten-Träger diese offensichtlich in den Schacht. Ansonsten aber kann die Anwesenheit der Brim-Stirnketten-Träger in den Schächten nicht zufriedenstellend erklärt werden. Es lässt sich nur postulieren, dass sie institutionelle Aufgaben wahrnahmen, die sie für eine Mitbestattung qualifizier-ten.
b) in Grabkammern Obgleich sich Brim-Stirnketten oder einzelne Elemente von Brim-Stirnketten vom Anfang bis zum Ende der Laufzeit der Royal Tombs in Grabkammern nachweisen lassen, ist die Materialbasis sehr schmal (vgl. Tab. 4a). Ungestörte Befunde liefern allein RT.777 und 1054. In der Grabkammer in RT.800 entdeckte Woolley zwar dattelförmige Silber- und Lapislazuliperlen zusammen mit Knochenresten, es bleibt aber unsicher, ob die Perlen tatsächlich zu einer Brim-Stirnkette rechneten.
In den Fällen, in denen zusätzlich zu einer Brim-Stirnkette noch andere Artefakte den vorhandenen Knochenresten zugeordnet werden konnten, handelte es sich in erster Linie um Waffen, Wetzsteine und Rasiermesser. Die Ausrüstung der ungestört angetroffenen Brim-Stirnketten-Träger in RT.777 und 1054 entspricht dabei der in Private Graves bestatteten. Bei der Mitbestattung A in RT.777 lagen eine Axt und ein Rasiermesser, bei der in RT.1054 ein Dolch, eine Axt und ein Wetzstein, ein zweiter Dolch fand sich in Höhe der Taille des Mitbestatteten. Die in Grabkammern mitbestatteten Brim-Stirnketten-Träger hatte man, so die vorhandenen Befunde,
74 Vgl. Woolley 1934, 74. 75 Deutliche Unterschiede im äußeren Erscheinungsbild könnten sich beispielsweise auch bei männlichen Mitbestattungen durch die Art der Bekleidung, durch die ausgewählten Stoffe (Farbe, Webearten) oder durch den Frisurenstil ergeben haben.
488 Helga Vogel
regelmäßig mit Gold-Brim-Stirnketten versorgt.76 Weitere Schmuckstücke erwähnt Woolley nicht. Auf dem Schädel der Mitbestattung in RT.777 lag allerdings zusätz-lich zum �‚Gold-Brim�‘ das ovale Stirnband aus Gold mit eingravierter Rosette, wel-ches uns schon in den Private Graves in Kombination mit einem �‚Gold-Brim�‘ als Zeichen des außerordentlichen Rangs eines Brim-Stirnketten-Trägers begegnete (PG.1312 sowie 1750 und ferner 389). Diese Mitbestattung lässt sich deswegen der Elite der Brim-Träger zurechnen.
Es fällt auf, dass man die in Grabkammern mitbestatteten Brim-Stirnketten-Trä-ger mit eigenen Kupfer- und Tongefäßen ausgestattet hatte; man schuldete diesen Mitbestattungen demzufolge eine �‚normale�‘ Versorgung im Tod.77 Besonders die nicht gestörten und in abgesonderter Lage angetroffenen Mitbestattungen der Brim-Stirnketten-Träger in RT.777 und 1054 erwecken den Eindruck �‚normaler�‘ Bestat-tungen. Es ist durchaus vorstellbar, dass diese Mitbestattungen nach ihrer Niederle-gung in den Grabkammern von Familienangehörigen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten mit dem Notwendigsten für ihr Nachleben ausgestattet wurden. Da-gegen spricht wiederum das Fehlen von persönlichen Dingen, die in den Private Graves regelmäßig zur Ausstattung hochrangiger Brim-Stirnketten-Träger gehör-ten.78
In summa: Die beiden uns bekannten Mitbestattungen von Brim-Stirnketten-Trägern in Grabkammern lassen sich wegen ihrer Waffenausstattung und der Machart ihrer Brim-Stirnketten direkt an die in Private Graves bestatteten Brim-Stirnketten-Träger anschließen. Das goldene Stirndiadem des in RT.777 mitbestatteten Brim-Stirnketten-Trägers signalisiert seine Zugehörigkeit zur Elite der Brim-Stirnketten-Träger. Über die �‚Gold-Brims�‘ und das �‚Golddiadem�‘ hinausgehende statusbedingte Gegenstände fehlen aber ebenso wie persönliche. Im Gegensatz zu den in den Schächten mitbestatteten Brim-Stirnketten-Trägern hat man die in Grabkammern mit Gefäßen für Trank- und Opferspenden versorgt oder ihnen eine letzte Verpfle-gung hingestellt.
Die Funktion, die die in Grabkammern mitbestatteten Brim-Stirnketten-Träger im Nachleben für die bestatteten Personen erfüllen sollten �– in den beiden dokumen-tierten Fällen handelt es sich zufällig um Frauen �–, kann aus den vorhandenen Daten nicht deduziert werden, trotz der Bewaffnung der Männer. 76 Ich gehe momentan davon aus, dass der in RT.1054 gefundene �‚Gold-Brim�‘, der zwischen dem Schädel der Hauptbestattung und dem der abgesondert liegenden Mitbestattung aufge-funden wurde, zur Mitbestattung rechnet; so auch Woolley 1934, 107. Wie bereits bemerkt, könnte der �‚Brim�‘ aber auch zu den Totengaben der Frau rechnen. Dagegen spricht, dass man in RT.800/ Bahre Pû-ab , in RT.1618 und in PG.1133 jeweils vier Brim-Stirnketten bei der Toten respektive bei den Toten niederlegte. 77 Aber auch bei den anderen Mitbestattungen in soweit noch intakten Grabkammern lagen oft Gefäße, wobei öfters undeutlich bleibt, ob sie der Versorgung des oder der Mitbestatteten dienen sollten oder zum Inventar der Grabkammer zählten. Die in RT.1054 hinter dem Ein-gang niedergelegten Leichname von drei mit Dolchen bewaffneten Männern hatten gewiss für sie bestimmte Tongefäße bei sich. Auch den Mitbestattungen A und B in RT.337 hatte man Tongefäße hingestellt. Für die beiden Mitbestattungen in der Grabkammer der Pû-ab erwähnt Woolley hingegen keine eigenen Versorgungsgefäße. 78 Allerdings könnte der Mitbestattung in RT.777 ein mit silbernen Plättchen dekorierter Gegenstand zuzurechnen sein; vgl. Woolley 1934, 56.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 489
4. MUSIKERINNEN UND DOG-COLLAR-TRÄGERINNEN
Ebenso wie im Falle der Brim-Stirnketten-Träger lassen sich Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen sowohl als Bestattungen als auch als Mitbestattungen nach-weisen, wenn auch unterschiedlich gut. Das charakteristische Schmuckset der Mit-glieder einer Musikerinnengruppe bestand normalerweise aus:
einem Schmuckkamm aus Silber, bekrönt von drei Blüten, deren einzelne Blät-ter aus anderen Materialien farbig gestaltet wurden
einem Haarband aus Gold einem Haarkranz aus Lapislazuli- und Karneolperlen mit goldenen Anhängern
in Blattform einem Paar silberner Haarringe einem Paar großer goldener Mondsichelohrringe
Zur Tracht rechneten regelmäßig auch eine Kleidernadel, oft aus Silber, manchmal mit einem Schmuckkopf aus Lapislazuli und Ketten, die Edelmetallperlen aufweisen konnten.79 Mit der gleichen Schmuckausstattung konnten auch Dog-Collar-Träge-rinnen geschmückt sein.80 Hiervon verschieden war das Schmuckset einer anderen Gruppe der Dog-Collar-Trägerinnen, die im Tod �‚lediglich�‘ die goldenen Ohrringe in Mondsichelform und Haarringe aus Silber trugen81; ihre Kleidernadeln bestanden manchmal aus Silber, eventuell mit Lapislazuli-Schmuckkopf dekoriert, ihre Ketten konnten ebenfalls Edelmetallperlen aufweisen.82 Auf der Basis der Quantität und Qualität der variablen Elemente der Schmucksets83 und gegebenenfalls zusätzlich vorhandener statusbedingter oder funktionsbedingter Gegenstände kann man einzel-nen Gruppenmitgliedern einen höheren oder weniger hohen Status zuschreiben84 oder ihre besondere Aufgabe im Rahmen der Bestattungs-/Mitbestattungszeremonie definieren, etwa eine Harfe spielen oder eine Lampe oder einen anderen Gegenstand
79 Entspricht der Kategorie �„Wreath-based adornement�“ bei Gansell 2007, 31 34 (in meiner Auffassung aber ohne Dog-Collar). 80 Gansell 2007, 31 differenziert nicht zwischen �‚Musikerinnen�‘ und �‚Dog-Collar-Musike-rinnen�‘, weswegen sich unsere Zuordnungen in diesem Punkt unterscheiden. 81 Entspricht dem �„Choker-based-adornement�“ bei Gansell 2007, 31, 34 35. 82 Das Schmuckset der von mir behelfsmäßig �‚Palastfrauen�‘ genannten Frauengruppe in RT.789 besteht nur aus silbernen Haarringen, Ketten mit Edelmetallperlen und Kleidernadeln aus Silber oder Kupfer, manchmal mit Lapislazuli-Schmuckkopf. Von der Idee her identisch mit Gansells �„Hair ring based adornement�“; vgl. Gansell 2007, 31. 37. Unsere Identifika-tionen unterscheiden sich im Detail; hierzu an anderer Stelle ausführlicher. 83 Vgl. hierzu auch Gansell 2007, 39. 84 Vgl. hierzu auch Gansell 2007, 40.
490 Helga Vogel
tragen.85 Manchmal wurden statushöhere weibliche Mitbestattungen von einer As-sistentin, einer Helferin, einer Freundin oder Magd begleitet.86
In den Private Graves lässt sich die Bestattung einer Musikerin ohne Dog-Collar nicht einwandfrei nachweisen. Bei den wenigen Bestattungen, die mit einzelnen Elementen des Schmucksets angetroffen wurden,87 kann es sich auch um die Grab-legungen mehr oder weniger hochrangiger Frauen handeln; die Sachlage muss an anderer Stelle ausführlich erörtert werden. In jedem Fall wurde in den fraglichen Gräbern weder eine Harfe noch eine Leier angetroffen. Tatsächlich konnte Woolley im Areal der ausgegrabenen Private Graves nur zwei Saiteninstrumente nachweisen. Unter PG.1151 listet er im Katalog unter �„Varia and notes�“ auch eine Leier auf. Die Leier fand sich aber als isoliertes Artefakt im Erdreich etwas unterhalb der schon besprochenen Holzsargbestattung des Brim-Stirnketten-Trägers. Woolley argumen-tiert, dass die Leier in den Kontext einer völlig zerstörten Royal Tomb gehören könnte, mit der wiederum das ca. 3m unterhalb der Holzsargbestattung liegende Massengrab RT.1157 in Verbindung gebracht werden könnte.88 Das andere Saiten-instrument entdeckte Woolley vor dem Sarg einer reich ausgestatteten Dog-Collar-Trägerin (PG.1130).89 Von der kleinen Harfe waren nur noch Spuren vorhanden. Sie lag unter einer Ansammlung von Gerätschaften wie Kupfer- und Steingefäße; in der Nähe kamen die zwei schon erwähnten goldenen Stirnbänder und eine Bronzeaxt
85 Wie eingangs schon erwähnt, können in RT.1237 �‘Subgruppen�‘ definiert werden, einmal anhand eines besonderen Armbandes, des Bead Cuff, dann anhand von goldenen Steckroset-ten für die Dekoration der Frisur. Hinzuweisen ist auch auf die Gruppe der Frauen, deren Gewand Muschelapplikationen aufwies oder die einen Gürtel aus Muscheln trugen; vgl. hierzu auch Gansell 2007, 31. 86 Beispielsweise bilden in RT.789 die Mitbestattungen Nr. 30 und 31 ein �‚Paar�‘, in RT.1237 die Mitbestattungen Nr. 7 und 8 und die Mitbestattungen Nr. 60 und 61; vgl. hierzu auch Gansell 2007, 42 und Vidale 2011, 443 444. 87 In Betracht kommen PG.159. 260. 453. 221. 1150. 1167. 1414. 88 Vgl. Woolley 1934, 169 170. Die Bergung der Leier (U.12315; Pl.118) war ohne jeden Zweifel eine Meisterleistung Woolleys. Der potenzielle Aufbau des Schachtes wäre gegebe-nenfalls ebenso unverständlich wie in RT.1050. Im Fall von RT.1157/1151 legte Woolley 9,20 m unterhalb der modernen Oberfläche das nur 16,25 qm2 großes Massengrab mit den Skelettresten von 58 Individuen frei (vgl. Anm.26). Darüber eine Mattenschicht, die von einer Schicht zerbrochener Keramikgefäße abgedeckt wurde. Über dieser lagen eine Menge plan-konvexer ungebrannter Lehmziegel, wie von zusammengebrochenen Mauern. Darin fand sich die Harfe in der Nähe des erwähnten Holzsarges. Ein weiterer Holzsarg stand auf gleichem Niveau nicht weit entfernt (PG.1156). In unterschiedlichen Höhen wurden im unteren Bereich der Füllung begrenzte Feuer entfacht. In RT.1050 besteht die unterste Schicht aus zerbroche-nen Tongefäßen und Asche, versiegelt mit gestampftem Lehm. Darauf lagen in einem Mas-sengrab von ca. 15 m2 ca. 40 Tote, bedeckt von Erde (vgl. Anm.26). Eine 50 cm dicke Lehm-ziegelschicht, die darüber lag, bildete zugleich die Unterlage für eine stark gestörte Holzsarg-bestattung; der Sarg stand an der SW Wand des Schachtes. Eindeutige Reste einer Grabkam-mer konnten nicht festgestellt werden. In der Füllung des Schachtes fand man weiter oben in einer Art Nische eine Bestattung in einem Sarg aus Schilfbündeln. Oben gründet auf einer Schicht aus gestampftem, rot gebranntem Lehm ein vierräumiges Lehmziegelgebäude mit weiteren Bestattungen und Mit-/Begleitbestattungen. 89 Vgl. Woolley 1934, 165 167 (zur Harfe S.167).
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 491
zum Vorschein, die der Bestatteten als Totengabe hinterlassen worden waren.90 Bei der Harfe handelte es sich wahrscheinlich um den persönlichen Besitz der Bestatte-ten wie dies auch bei der Harfe der Fall war, die in der Grabkammer der Stadtfürstin Pû-ab entdeckt wurde. Es ergibt sich also vorläufig, dass in den Private Graves kein Individuum zusammen mit einer der großen, dekorierten �‚Prunk�‘-Leiern- oder Har-fen bestattet wurde, die wir von RT.789. 800 und 1237 her kennen.
Im Gegensatz zu den Musikerinnen lassen sich Dog-Collar-Trägerinnen auch als Bestattungen in Private Graves sicher nachweisen. In Tab. 6 habe ich die mir be-kannten acht Gräber von Dog-Collar-Trägerinnen erfasst sowie ergänzend die Aus-stattung der Mitbestattungen Nr. 61 und 7 in RT.1237 und die Teile des Schmuckes, den eine Frau im Sarg des Meskalamdug hinterließ. Es kann als sicher gelten, dass es sich bei keiner Bestattung einer Dog-Collar-Trägerin in einem Private Grave um eine arme Bestattung handelte. Besonders die in PG.1130. 1315 und 1749 Bestatte-ten hatten von ihrer Ausstattung her zu urteilen, einen sehr hohen sozialen Status inne; ihre Gräber gehören überhaupt zu den reichsten Private Graves. Hinter deren Aufmachung bleibt nun die der schon mehrfach erwähnten Mitbestattung Nr. 61 in RT.1237 keinesfalls zurück. Von den Schmuckstücken, die im Kontext des frühdy-nastischen Gräberfeldes den Frauen der Elite vorbehalten waren, fehlten der Mitbe-stattung Nr.61 nur ein Haarkranz mit goldenen Ringanhängern und Amulette. Die Anzahl ihrer goldenen Fingerringe (sechs) wird nur durch die der Stadtfürstin Pû-ab (zehn) übertroffen. Ihr Haarkranz mit Anhängern aus runden Goldblechen, die eine scheibenförmige Perle aus Lapislazuli umfassen, kann als ein individuelles Schmuckstück gelten; besondere Schmuckstücke oder Abwandlungen bekannter Schmuckformen findet man bekanntlich häufig als Teil von Schmuckensembles hochrangiger Personen. Mithin kann wie im Falle der Brim-Stirnketten-Träger auch im Falle der Dog-Collar-Trägerinnen die Mitbestattung einer mit sehr hohem Status/ Prestige und/oder Autorität ausgestatteten Person als gesichert gelten. Leitende Funktionen nahmen sicherlich aber auch mitbestattete siegelführende Frauen wahr.
Die mit ihrer Assistentin/Begleiterin/Freundin91 in abgesonderter Lage in RT. 1237 aufgefundene Mitbestattung Nr. 7 führte ein Lapislazulisiegel mit einer Na-mensinschrift mit sich. Ihr Name lautete dumu- iparx (KISAL) �„child of the i-par.�“92 Akk. gip ru bezeichnet in erster Linie die �„residence of the enu-priest or entu-priestess.�“93 Woolley grub in Ur die Grundrisse des altbabylonischen ip ru einschließlich des Ningal-Tempels mehr oder weniger vollständig aus.94 Die zitierte Siegelinschrift macht es wahrscheinlich, dass schon in der FD IIIA-Zeit in Ur ein
ip ru existierte. Auf ein solches lässt sich ansonsten archäologisch nur wegen eines 90 Vgl. Woolley 1934, 166 167 und Tab. 5. 91 Die Mitbestattung Nr. 8 hatte man mit zwei goldenen Haarringen, zwei goldenen Mondsi-chelohrringen, einer Kette aus kleinen, dattelförmigen Lapislazuliperlen und einer Kette aus doppelkonischen Gold,- Silber und Lapislazuliperlen �„with gold �‚grape-cluster�‘ pendant in-laid with lapis�“ sowie zwei goldenen Fingerringen geschmückt. Woolley rechnete ihr zwei Kleidernadeln zu, �„with gold and lapis heads�“; vgl. Woolley 1934, 116. Um eine Magd wird es sich folglich nicht handeln. 92 Lesung nach Marchesi 2004, 174. U.12374. Festszenen in zwei Registern: oben eine Ban-kettszene, unten Musikgruppe und zwei tanzende Kinder. 93 Vgl. CAD G 83 iparru (1). 94 Vgl. Woolley 1976, 40 63; Weadock 1975.
492 Helga Vogel
kurzen Stückes einer aus plankonvexen Ziegeln errichteten Mauer im Bereich des späteren Ningal-Tempels schließen.95 Denkbar wäre somit, dass die mit einem Dog-Collar geschmückten Frauen zum Personal eines FD IIIA-zeitlichen ip ru zählten und dort in unterschiedlicher Funktion tätig waren. Die in den Private Graves be-statteten Dog-Collar-Trägerinnen könnten dieser Hypothese folgend als hochrangige Funktionärinnen des ip ru identifiziert werden, ein Rang der dann auch der Mitbe-stattung Nr.61 zukäme.
Es bleibt allerdings noch die Frage nach der Stellung und der Funktion der Frau, die Meskalamdug ihren Schmuck in seinen Sarg legte, darunter ein Dog-Collar.96 Wegen der Inschrift auf einem kleinen Silber- oder Kupfergefäß, die sum. nin-tur ere�š �„Nintur, the queen�“97 nennt, wird angenommen, dass Meskalamdug dem Herr-scherhaus von Ur angehörte.98 Wenn man davon ausgeht, dass die Frau, die Meska-lamdug ihren Schmuck hinterließ, in einer engen persönlichen Beziehung zum Toten stand, dann schlussfolgert, dass weibliche Angehörige des Herrscherhauses zu den Dog-Collar-Trägerinnen rechneten.
95 Vgl. Woolley 1926, 366. 96 Im Katalog notiert Woolley unter der Nummer U.10007 hingegen seiner Beschreibung des Befundes und der publizierten Zeichnung, dass das Dog-Collar �„inside the coffin at the back of the body�“ gelegen habe, wofür keine Gründe genannt werden. Vgl. für die Beschreibung des Grabes PG.755 Woolley 1934, 155 160 (zum Schmuck der Frau S. 158). 97 Lesung nach Marchesi 2004, 162 mit Anm. 61. 98 Es muss sich um ein eher unspektakuläres Gefäß gehandelt haben. Woolley notiert: �„(...) this [zwei größere Kupfergefäße; HV] lay on the top of (51) [= Position im Plan des Grabes; HV] a pile of cups and bowls of copper and of silver, perhaps sixty in all, all corroded to-gether and most of them crushed and broken (...); one of these bore the name Mes-kalam-dug, one that of Nin-Tur-Nin�“ (Woolley 1934, 159). Die gesellschaftliche Spitzenposition des in PG.755 bestatteten Mannes wird durch seine Edelmetallwaffen, die im Sarg angetroffenen Goldgefäße (zwei mit seinen Namen) und besonders durch den Goldhelm, der die ansonsten nur bei Darstellungen von Stadtfürsten auszumachende Haarknotenfrisur nachahmt, ange-zeigt. Sein Muschelsiegel war zerstört.
494 Helga Vogel
Tab. 6 Dog-Collar-Trägerinnen in Private Graves und Vergleichsdaten Abgesehen vom Dog-Collar handelt es sich beim niedergelegten Schmuck aber in jedem Fall um ein persönliches Schmuckensemble, denn es fehlen einerseits wichti-ge Elemente der institutionellen Schmucksets wie Schmuckkamm und goldene Mondsichelohrringe, andererseits finden sich persönliche Gegenstände wie die mit einem Äffchen aus massivem Gold dekorierte Kupfernadel, an der zwei Amulette befestigt waren (vgl. Tab. 6). Auffällig ist, dass man nicht alle Schmuckteile der Frau aus Gold gefertigt hatte, wie dies bei einer Angehörigen des Herrscherhauses zu erwarten wäre. So besaß sie einerseits einen Haarkranz mit den seltenen und besonders kostbaren Ringanhängern, aber die Ringe hatte man in diesem Fall aus Silber und nicht aus Gold, wie sonst üblich, hergestellt; zudem trug sie ein Haarband aus Silber, sie besaß keine Fingerringe oder hatte diese zumindest nicht in den Sarg gelegt, auch ein Siegel fehlt. Ihre goldenen Haarringe und ihre goldene Kleidernadel entsprechen dagegen wieder den Erwartungen. Im Vergleich bleibt das bei Meska-lamdug im Sarg angetroffene Schmuckensemble, von seiner Wertigkeit her betrach-tet, aber hinter der Aufmachung der in Private Graves bestatteten Dog-Collar-Trägerinnen, aber auch hinter der der Mitbestattung Nr. 61 zurück. Ihr Schmuck erscheint aber �‚reicher�‘, da individueller, als der Schmuck der Frau, den man in PG. 1312 beim mit einem �‚Gold-Brim�‘ und mit einem goldenen Stirnband mit Rosette geschmückten Leichnam fand.
In summa: Selbst die hier gebotene überblicksartige Darstellung der Befunde zu den Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen lässt noch erkennen, wie komplex die
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 495
Sachlagen auch in ihrem Fall tatsächlich sind. Sicher als Mitbestattungen nach-weisen lassen sich die beiden Frauengruppen erst in den spät angelegten Anlagen RT.789. 800 und 1237, sie gehören aber sehr wahrscheinlich auch zu den Personen, deren Überreste Woolley in den Massengräbern RT.1050/Grube. 1157 und 1332 ausgrub. Für die zuerst angelegten Anlagen RT.779. 777 und 1236 lässt sich ihre Mitbestattung nicht erweisen.99 Die standardisierten Schmucksets belegen, dass die mitbestatteten Musikerinnen und die Mehrzahl der Dog-Collar-Trägerinnen ihren Schmuck von bestimmten Institutionen zur Verfügung gestellt bekamen. In Frage kommt einerseits zunächst der Palast und andererseits, im Falle der Dog-Collar-Trägerinnen, wegen der Siegelinschrift der Mitbestattung Nr. 7 in RT.1237, ein schon in der FD IIIA-Zeit bestehendes gip ru als Wirkungsstätte und Wohnsitz einer Hohepriesterin und ihres kultischen und administrativen Personals. Alternativ denkbar wäre aber auch, dass die Dog-Collar-Trägerinnen die institutionelle Ver-sorgung einer von Ningal und Nanna verschiedenen Gottheit betrieben, den Haus-halt der Stadtfürstin angehörten oder im Palast spezifische Funktionen erfüllten. Bei den vorgenannten Frauengruppen handelt es sich weiterhin um funktional differen-zierte Verbände mit siegelführenden Leiterinnen, Trägerinnen von bestimmten Ge-genständen und Hilfspersonal. Einigen der mitbestatteten Frauen gehörten individu-elle Gegenstände wie Fingerringe oder kleine Anhänger; Ketten und Kleidernadeln variieren im Material und in der Ausführung. Wie weiter oben schon notiert, hatte man die mitbestatteten Frauen durchgängig mit Trinkgefäßen versorgt und wahr-scheinlich auch in der �‚normalen�‘ Position der Toten hingelegt; dies suggerieren zumindest die in UE II publizierten Pläne der Gräber.
Die in den Private Graves bestatteten Dog-Collar-Trägerinnen lassen sich, wenn ihr Schmuckensemble auch die charakteristischen Elemente des institutionellen Schmucksets aufweist, als Elite der an einer Institution wirkenden Dog-Collar-Trägerinnen bestimmen (PG.1315. 1749); zu diesem Personenkreis zählte wohl auch die Mitbestattung Nr.61 in RT.1237. Zugleich gehörten dem Kreis der Dog-Collar-Trägerinnen, so der Befund, aber auch Frauen aus der Elite Urs an, deren institutio-nelle Einbindung aus ihren Grablegen nicht ersichtlich wird. Die Schmucksets dieser Frauen weisen viele individuelle Elemente auf (PG.263), sie konnten zudem über ihren Schmuck verfügen (Situation in PG.755) und standen in Beziehung zu Män-nern, die ihnen ihrerseits wertvolle Totengaben hinterließen (PG.1130). Die Mehr-zahl der Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen lässt sich aber als �‚normale�‘ Bestattung nicht nachweisen. Wie auch immer und von wem auch immer diese
99 In RT.779 konnten nur noch sehr wenige Artefakte sichergestellt werden, u.a. Luxusge-genstände (etwa: Fragmente eines Straußeneis) oder männlich konnotierte Artefakte (Wetz-steine, Rasiermesser etc.). Nur eine Silbernadel mit Lapislazulikopf deutet eine weibliche Be-stattung oder Mitbestattung an. In Kammer D fand man die Standarte von Ur. In RT.777 ha-ben die weibliche Hauptbestattung wohl nur Männer im Tod begleitet, unter anderem der er-wähnte �‚Gold-Brim-Träger�‘, der zusätzlich mit dem Goldstirnband mit Rosette geschmückt war; (eventuell handelte es sich bei der Mitbestattung in der Südecke um eine Frau). In RT. 1236 fand man in den einzelnen Kammern noch Elemente von Haarkränzen (goldene Blätter, Ringe, Rosetten), Haarringe, eine Silbernadel und Perlen, neben Dolchklingen, Wetzsteinen, Rasiermessern und anderen Artefakten. Die Haarkränze könnten sowohl weibliche Bestattun-gen als auch etwaige Mitbestattungen geschmückt haben. Haarbänder, Mondsichelohrringe oder Schmuckkämme waren nicht vorhanden.
496 Helga Vogel
Frauen bei einem natürlichen Tod bestattet wurden, es geschah ohne die charakteris-tischen Elemente der Schmucksets, die zu ihren Lebzeiten ihren Arbeitsplatz, ihre Funktion oder/ und ihren Rang anzeigten. 5. DISKUSSION, OFFENE FRAGEN
Das hier einschlägige Schrifttum der Vorderasiatischen Archäologie respektive der Ancient Near Eastern Studies adressiert die Mitbestattungen in den Royal Tombs in aller Regel pauschal als Gefolge, Hofstaat, Dienerschaft, Personal100 (ab 2004 insbe-sondere für Bankette101), Untergebene, Befehlsempfänger oder Haushaltsmitglie-der,102 außer es lassen sich mögliche Funktionen direkt aus dem Befund respektive den publizierten Plänen deduzieren; letzteres gelingt de facto aber nur bei den mit-bestatteten bewaffneten Männern im Zugang zum Schacht (Soldaten, Wache) und bei in der Nähe von Fuhrwerken Mitbestatteten (Tierführer; Wagenlenker). Cohen plädierte 2005 dafür, die bei Musikinstrumenten aufgefundenen Mitbestattungen als Musiker (maskulin) anzusprechen, einige seinen wahrscheinlich sum. gala �„Klage-sänger�“.103 Für die weiblichen Mitbestattungen erwog Woolley die Bezeichnung �„harim�“104; dieser Idee schloss sich zuletzt 2011 Vidale an.105 Böhl, der nur die Be-fundsituation in RT.800 kannte, dachte seinerzeit an Gottesbräute,106 in eine ähnli-che Richtung zielten auch später Deutungen der weiblichen Mitbestattungen, wenn angenommen wurde, dass die weiblichen Hauptbestattungen als Repräsentantin der Göttin Inanna/I�štar107 oder als irdische Gattin des Gottes Nanna108 bestattet wurden. Charvát und Sürenhagen plädierten unabhängig voneinander 2002 dafür, dass Kon-zept der �‚Mitbestattungen�‘ aufzugeben. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei den entsprechenden Befunden vielmehr um Sekundärbestattungen von Personen, die in der Nähe eines charismatischen Führers (maskulin) bestattet sein wollten.109 Wie einleitend schon erwähnt, ließ Woolley in Ur zehn Schädel von Mitbestattungen aus RT.789 und 1237 samt Schmuck oder Helm vor Ort in Wachs gießen. 2009 wurden die in Philadelphia aufbewahrten zwei Schädel geröntgt und es wurden CT-Scans angefertigt. Die Aufnahmen zeigen stark fragmentierte Schädel mit noch identifi-zierbaren Schädeltraumata, die auf die Einwirkung eines spitzen Gegenstandes zu-rückzuführen seien (vgl. Tab. 1). In Folge wurde die bislang akzeptierte Annahme einer stabilen Identität der Mitbestatteten angezweifelt. Es wurde vorgeschlagen, dass es sich bei den Mitbestattungen um Kriegsgefangene oder andere marginalisier- 100 Vgl. zuerst Woolley 1934, 35, 38, 41 42. 101 Vgl. Selz 2004, 210 211; Cohen 2005, 89 92, 150; Pollock 2007b, 102; Baadsgaard et al. 2012, 148; Porter 2012, 194. 197. 102 Vgl. zuerst Pollock 1991b, 175 zuletzt dies. 2007a, 219 220; dies. 2007b, 79. 99. 103 Vgl. Cohen 2005, 92. 104 Vgl. Woolley, 41. 105 Bezüglich der Situation in RT.1237 notiert Vidale: �„The occupants of PG.1237 appear in the funerary scene like a chorus accompanied by professional players and dancers, including �‚cross-dressed lamentation specialists�‘ (as suggested by Cohen 2005,148) or part of a royal harem�“ (Vidale 2011, 446). 106 Vgl. Böhl 1929 1930, bes. 94. 107 Etwa bei Moortgat 1949, 65 66. 108 Etwa Moorey 1977. 109 Vgl. Charvát 2002, 226 228; Sürenhagen 2002, 332. 336 337.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 497
te Personen handelt,110 die nicht, wie Woolley annahm, in den Royal Tombs durch Gift getötet, sondern außerhalb der Anlagen erschlagen wurden. Ihre Leichname hätte man dann durch Erhitzen konserviert und zu einem späteren Zeitpunkt in der von Woolley dokumentierten Weise hergerichtet und anschließend in die Grabkam-mern und Schächte verbracht, wo man die Toten dann sinnstiftend arrangierte.111 Ähnlich argumentierte vorher schon Dickson, der nach Sichtung der vorhandenen Literatur zu dem Schluss kam: �„Only members of the �‚lower orders�‘, presumably the least powerful members of society, descended into death pits�“.112
Vor diesem Hintergrund erbringen die in den vorhergehenden Abschnitten aufberei-teten Daten den folgenden Ertrag:
1. Festhalten lässt sich zunächst, dass im frühdynastischen Royal Cemetery ein spezifisches Spektrum an Schmuckelementen und anderen Artefakten verwendet wurde, das trotz aller beobachtbaren Varianten verbindlichen Maßstäben in der Materialauswahl, Materialbehandlung, Formgebung und Nutzung folgte. Vorausge-setzt, die regelhaft nachzuweisende Zusammenstellung bestimmter Schmuckteile oder die Verwendung einzelner signifikanter Schmuckstücke wie etwa Brim-Stirn-ketten und anderer Artefakte wie Waffen geschah mit Absicht, dann lässt sich wei-terhin postulieren, dass diese Gegenstände bestimmte Individuen je spezifisch �‚sichtbar machten�‘ und ihnen darüber eine je spezifische Identität zuwiesen.113 Es wurde argumentiert, dass nur wenige derart definierte Gruppen von Personen als Mitbestattungen in den Royal Tombs in Erscheinung treten. Dazu zählen bewaffnete Männer mit und ohne Brim-Stirnkette, männliches Personal bei gegebenenfalls vor-
110 Vgl. Vidale 2011, 430. 439. 447; Baadsgaard et al. 2012, 147 148. Die bei Vidale 2011, 431 Anm. 4 gestellte Frage: �„were the victims slaves imported from the latter region [=Harappa-Kultur, heutiges Südpakistan; HV]?�“, lässt sich zwischenzeitlich dahin gehend be-antworten, dass Kenoyer et al. 2013 feststellen, dass die Untersuchung der Zähne, der in Philadelphia aufbewahrten Schädel erbrachte, dass zumindest diese Individuen aus Südmeso-potamien und nicht aus Südpakistan stammten (vgl. ebenda, 2291 2295, bes. 2295). 111 Vgl. zuerst Baadsgaard 2011, 40. 112 Dickson 2006, 129 mit Hinweis auf Pollock 1991b, 177. Pollock argumentiert ebenda aber nicht, dass �„many of these people may have been menial labourers�“, wie Dickson formuliert, sondern, dass den �‚großen Haushalten�‘ eine Menge von Personen mit weit voneinander ab-weichenden Statuspositionen angehörten, die rein theoretisch als Mitzubestattende in Frage kamen. Anzumerken ist außerdem, dass Molleson und Hodgson 2003, 91 in der Zusammen-fassung ihrer anthropologischen Untersuchungen der in London aufbewahrten Knochen aus dem Royal Cemetery in Ur zwar anmerken, dass bestimmte an den Knochen beobachtbare Veränderungen �„result from intensive performance of restricted activities from an early age�“ (ebenda), jedoch ließen sich diese Veränderungen sowohl bei mitbestatteten Personen (Mitbe-stattungen RT.1648a und 1648d) als auch bei in Private Graves bestatteten Personen (bei-spielsweise PG.1573) feststellen. Wenn man bedenkt, dass in Mesopotamien Kinder mit 5 bis 6 Jahren in die anfallenden Arbeitsprozesse integriert bzw. schrittweise an zu erlernende Auf-gaben herangeführt wurden (vgl. etwa Waetzoldt 1988, 32. 34. 40), dann erstaunen die Er-gebnisse von Molleson und Hodgson nicht. 113 Dass bestimmte Handlungen und die Verfügungsmacht über bestimmte Dinge, neben der Namensgebung, im mesopotamischen Verständnis als konstitutiv für die Herausbildung von Identitäten galten, lässt sich anhand der Analyse bestimmter literarischen Texte aufzeigen; vgl. hierzu die Verfasserin in Druck mit weiterführender Literatur.
498 Helga Vogel
handenen Zugtieren und andere männliche Personen, deren Identität oder Funktion weder durch ihre Ausstattung noch durch ihre Lage im Grab bestimmt werden kann, dann die weiblichen Mitbestattungen in den Grabkammern und die Gruppen unter-schiedlich geschmückter Frauen in den Schächten, die vielleicht erst ab dem mittle-ren Bauhorizont der großen Schachtgrabanlagen zum Kreis der Mitbestattungen zählten. Hieraus lässt sich schließen, dass von den an einem frühdynastischen Hof oder Tempel vertretenen Berufs- und Statusgruppen, die sich beispielsweise aus prä-sargonischen Rationenlisten oder aus den oben erwähnten �‚Milch und Malz-�‘ re-spektive ma�šdaria-Urkunden erschließen lassen,114 nur ein geringer Prozentsatz als Mitbestattung in Frage kam: Musikerinnen, Sängerinnen und Rezitatorinnen, andere Personen, die im Palastinneren administrative Funktionen erfüllten und die Wachen respektive Leibgarde. Die Beschränkung auf wenige Berufs- und Statusgruppen bleibt auch dann evident, wenn man annimmt, dass beispielsweise in RT.1237 Tem-pelpersonal mitbestattet wurde.115 Um die Mitbestattung von schlechterdings Haus-halten oder Gefolge respektive Dienerschaft etc. handelte es sich so gesehen nicht. Der soziale Status der mitbestatteten Personen lässt sich allein auf der Basis der präsargonischen Rationenlisten, wie von Prentice aufgelistet, schwer einschätzen;116
114 Prentice 2010, 29 37 diskutiert Personen, die in Rationenlisten für Getreide aus Laga�š als �ša3-dub e2-gal �„registered at the palace�“ aufgeführt werden. Hierzu rechnen �„HAR.TU wo-men, cupbearers (sagi), cooks (muhaldim), messengers (sukkal), persons of the inner room, the store room, and of hot water, scribes (dub-sar), hairdressers (�šu-i2)�“ sowie ein �„statue attendant (lu2 alan)�“ und �„cleaner/washer (gab2-U�ŠxKID2)�“. Diese Personen arbeiteten in Laga�š im Baba-Tempel, wurden aber wahrscheinlich vom Palast bezahlt oder sie gehörten zum Bestand des Baba-Tempels und man hatte sie an den Palast abkommandiert. Einzeln als Getreiderationenempfänger auf Tafeln verzeichnet (vgl. die Diskussion bei Prentice 2010, 40 Anm. 198) sind �„leatherworkers (a�šgab), felt makers (tug2-du8), a boatman (ma2-lah5), smiths (simug), persons under U2-U2, doorkeepers (i3-du8), �‚assistant�‘ (gab2-ra), stonemason (za-dim), carpenter (nagar), matmaker (ad-KID), potter (bahar), brewer (bappir), forester of the tamarisk trees (lu2
gi�š�šinig), musicians and singers (gala, nar, a-da-ba), persons living with a gudu priest,�“ Ma2-DUN3 (vgl. Prentice 2010, 40-52). Die geme2-dumu-Rationenlisten ver-zeichnen die Rationen für Frauen in den Stoffmanufakturen und Spinnereien und für andere Personen, die als rangniedrig bewertete Berufe ausübten. Hinzu kommen beispielsweise Schiffer, Rohrarbeiter, Waldarbeiter, Gärtner, Fischer und Hirten. 115 Der Personalbestand eines Tempels unterschied sich, abgesehen vom Kultpersonal, an-sonsten im Grundsätzlichen nicht vom Personalbestand des Palastes; vgl. beispielsweise für das Personal des präsargonischen Baba-Tempels in Laga�š Selz 1995, 49 96 mit Diskussion auch der vorstehend erwähnten Personen, �„registered at the palace�“. 116 Die von Prentice 2010, 64 aufgelisteten Getreiderationen für geme2-dumu verzeichnen als Mindestration 18 sila; dies entspricht ungefähr dem von Waetzoldt 1988, 40 ermittelten Wert für die Ur-III-Zeit. Personen, die nur von dieser Getreideration ihren Unterhalt bestreiten mussten, lebten am absoluten Existenzminimum; vgl. beispielsweise Waetzoldt 1988, 42 für die Kosten von unterschiedlichen Nahrungsmitteln. Die Rationen der Personen, �„die einzeln auf Tafeln vermerkt�“ wurden (vgl. Prentice 2010, 51), liegen im präsargonischen Laga�š mehr-heitlich grundsätzlich über den erwähnten Mindestlohn. Die Spalte �„musicians�“ nennt min-destens 36 sila Getreide bis höchstens 72 sila Getreide als Monatsration. Auch die Personen, die zu dieser Zeit als �„registered at the palace�“ geführt wurden (vgl. ebenda, 37), verdienten vom �‚Grundgehalt�‘ her mehr als die Textilarbeiterinnen oder Spinnerinnen. Beispielsweise sind für Schreiber Rationen von 48 sila bis 72 sila verzeichnet, für Mundschenke von 18 sila (1 Person in einem Monat) bis 72 sila. Frauen scheinen auch im präsargonischen Laga�š wie
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 499
nicht alle in den Schächten mitbestatteten Berufsgruppen werden von den genannten Rationenlisten erfasst. Waetzoldt notierte 1988 für die Ur-III-Zeit im Kontext der Aufzählung von Frauenberufen: �„Eine gewisse Sonderrolle nehmen auch die Sänge-rinnen ein, da sie zum Teil ebenfalls Zugang zum Palast des Königs oder eines Stadtfürsten hatten.�“117 Dies deutet an, dass eine Anstellung am Palast, besonders dann, wenn sie den mehr oder minder direkten Kontakt mit dem Stadtfürsten oder der Stadtfürstin erlaubte, mit hohem Ansehen verbunden gewesen sein dürfte.
2. Besonders das Beispiel der Brim-Stirnketten-Träger zeigt, dass innerhalb einer gesonderten Personengruppe unterschiedliche Statusgruppen als Mitbestattungen vertreten waren. Es wurde vorgeschlagen, dass die in den Private Graves bestatteten Brim-Stirnketten-Träger militärische und/oder administrative Leitungsfunktionen erfüllt haben, worauf besonders ihre überdurchschnittlich häufige Ausstattung mit Waffen hindeutet. Wegen der Bestattung in Holzsärgen und des sonst noch vorge-fundenen Grabinventar kann man vermuten, dass zumindest ein Teil der Brim-Stirnketten-Träger zur sozialen Oberschicht Urs rechnete. Es wurde gezeigt, dass wenigstens eine Brim-Stirnketten-Träger-Mitbestattung ebenfalls zur Elite der Brim-Träger gezählt werden muss (RT.777). Auf eine soziale Binnengliederung der Brim-Stirnketten-Träger-Gruppe deuten die Variationen in der Ausführung der Stirnket-ten, statusbezogene Gegenstände wie Siegel oder Golddiademe sowie die weitere Versorgung der Toten hin. Auch innerhalb der funktional und sozial differenzierten Frauengruppen konnte mindestens eine ranghohe Mitbestattung identifiziert werden (Nr. 61 in RT.1237). Die soziale und funktionale Gliederung der Mitbestatteten-gruppen wurde bislang in der Forschung kaum beachtet. Besonders die hochrangi-gen Mitbestatteten können aber nur schwer mit Hilfe des vorherrschenden �‚Täter-Opfer-Paradigmas�‘, in dem die Mitbestatteten einzig als Opfer herrscherlicher Will-kür in Erscheinung treten, erklärt werden. Schlechthin stellen die Mitbestatteten Palast- oder Tempelangestellte bzw. dem Palast verbundene/ verpflichtete Personen mit unterschiedlichem sozialen Status vor, die abgeschichtet nach Rangstufen oder aus persönlichen Gründen ganz unterschiedliche Beziehungen zur bestatteten Person unterhalten haben werden. Die Möglichkeiten und Grenzen des individuellen und sozialen Handelns einer mitbestatteten Person, aber auch ihr Zugang zu �‚sinnhaften Diskursen�‘ (beispielsweise zu �‚Jenseits- oder Herrschaftsdiskursen�‘) dürfte je nach ihrer sozialen Position deutlich unterschiedlich gewesen sein. Demnach bleibt zu fragen, ob tatsächlich eine einzige Kraft (Zwang, direkte Gewalt, systemische Re-pression oder andererseits Liebe, Loyalität118) die Mitbestattungen auslösen und über mehrere Generationen erzwingen/motivieren konnte. Die Versorgung bestimm-
dies auch in der Ur-III-Zeit üblich war, grundsätzlich weniger als Männer verdient zu haben. Die Rationen schwankten über die Monate. Inwiefern Faktoren wie Erfahrung oder Können bei der Rationenbemessung eine Rolle spielten, bleibt offen; Aufseherinnen oder Aufseher er-hielten umfangreichere Rationen. 117 Waetzoldt 1988, 32. 118 Vgl. Woolley 1934, 41; Moorey 1977, 40; Selz 2004, 193 für Liebe, Treue zum vergött-lichten oder mit Charisma angefüllten Herrscher; vgl. Pollock 2007a, 223 224 und Pollock 2007b, 102. 105 für Loyalität zur Institution; vgl. Dickson 2006, 134. 140; Baadsgaard et al. 2011, 38 40; Vidale 2011, 438 440; Baadsgaard et al. 2012, 144. 147; Porter 2012, 194. 197 für Zwang, direkte Gewalt.
500 Helga Vogel
ter Mitbestattungen in den Grabkammern mit Beigaben, aber auch kleine individuel-le Schmuckstücke, die mitbestattete Frauen mit sich führten, sowie insgesamt die Ausstattung der allermeisten Mitbestattungen mit Gefäßen für Trankopfer wirft überdies die Frage auf, ob und inwiefern man Angehörige von Mitbestatteten in den Prozess einer �‚Mitbestattungszeremonie�‘ involvierte. Damit steht auch zur Debatte, ob die Mitbestattungen in den Royal Tombs tatsächlich sinnvoll als ein von der ge-sellschaftlichen Umgebung abgeschlossenes System analysiert werden können re-spektive ob die Beteiligung der Gesellschaft an diesen Prozessen tatsächlich auf die eines passiven Zuschauers/ Propagandaempfängers beschränkt blieb.
3. Im Einzelnen lässt sich festhalten: a) Gegen das Argument von Cohen und ihm folgende Fachkollegen, dass es sich bei den mitbestatteten Musikerinnengruppen eigentlich um Musiker oder Gruppen von sum. gala �„Klagesänger�“ handelt, ist vorzubringen, dass durch den Vergleich mit den Bestattungen von Frauen und Männern in Private Graves feststeht, dass die einzelnen Schmuckteile ihres Schmucksets eindeutig weiblich konnotiert waren, sieht man von den spiraligen Haarringen ab. Schmuckkämme, Haarkränze, Haar-bänder, große Mondsichelohrringe oder Dog-Collars rechnen nicht zum Schmuck-repertoire von Männern. Falls eine Frau ihren Schmuck oder Teile eines Schmuckes beim Leichnam ihres Mannes (oder Bruders/Vaters) niederlegte, dann hinterließ sie den Schmuck bei seinen Händen oder deponierte ihn vor seinem Oberkörper. Gleichfalls spricht gegen Cohens Argument, dass in Laga�š nachweislich weibliche und männliche gala-Priester/Innen tätig waren.119 Ur-III-zeitliche Urkunden nennen ebenfalls männliche und weibliche Sänger/Innen (gala), die Kultlieder zur Harfe oder Leier vortrugen.120 Selbst wenn man die mitbestatteten Musikerinnengruppen als gala identifiziert, besteht folglich keine Notwendigkeit, sie nicht als Frauen an-zusehen. b) Es gibt in den frühdynastischen Quellen keinen Hinweis auf einen �‚Harem�‘ des Stadtfürsten. Es ist hier nicht der Ort mich mit dem Konzept des �‚Harems�‘ im Schrifttum der altorientalischen Fächer/Ancient Near Eastern Studies näher zu be-fassen.121 Ich belasse es dabei, darauf hinzuweisen, dass selbst für die späteren Epo-chen die Existenz einer solchen Institution strittig ist.122 Erwähnenswert erscheint mir aber doch noch, dass der Begriff �‚Harem�‘ die mitbestatteten unterschiedlichen Frauen in eine spezifisch konstruierte �‚orientalische�‘ Umgebung versetzt, in der die �‚Orientalin�‘ stereotyp als passiv, ungebildet, machtlos und verführerisch fantasiert wird. Diese Ideen lassen sich weder am Material des Königsfriedhofes noch sonst an einer �‚altorientalischen�‘ Quelle erweisen. c) Es ist eher unwahrscheinlich, dass es sich bei der Mitbestattung Nr.61 in RT.1237 um die Bestattung einer Stadtfürstin (�“queen�“) handelt. Dagegen spricht zuallererst
119 Vgl. Selz 1995, 252 und Anm. 1208. 120 Vgl. Michalowski 2006. 121 Vgl. hierzu demnächst die Verfasserin in: G. J. Selz /K. Wagensonner (Hrsg.), Orientali-sche Kunstgeschichte(n), Festschrift Erika Bleibtreu, Wiener Offene Orientalistik 13. 122 Beispielsweise hat Saana Svärd, früher Teppo, jüngst gezeigt, dass die neuassyrischen �‚Harems�‘-Haushalte der Königinmutter oder anderer Frauen der Königsfamilie vorstellen, in denen Textilien im größeren Stil produziert wurden; vgl. zuletzt Svärd und Luukko 2009; Teppo 2007.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 501
die geringe räumliche Distanz zwischen ihr und allen anderen mitbestatteten Frauen und ebenso, dass die zu erwartenden Grabbeigaben fehlen. Dass die gesellschaft-liche Elite Urs im Frühdynastikum reich ausgestattet in Grabkammern und/oder gegebenenfalls in Särgen bestattet wurde, ist anerkannter Forschungsstand. Aber selbst hochrangige Mitbestattungen in Grabkammern wurden abgesondert von den anderen Mitbestattungen im Raum platziert.123 Ebenfalls unwahrscheinlich ist, dass eine Stadtfürstin den gleichen Gegenstand wie ihre Helferin/Magd vor sich her trug (im konkreten Fall handelt es sich um die beiden �„Ziegenböckchen im Blüten-strauch�“). Es kann auch noch auf die hochrangigen in Private Graves bestatteten Dog-Collar-Trägerinnen (vgl. Tab. 6) hingewiesen werden, die, würde man Baads-gaards These folgen, ebenfalls als Stadtfürstinnen adressiert werden könnten. Es wurde aber argumentiert, dass es sich bei ihnen, wenn ihr Schmuck die charakteristi-schen Elemente des institutionellen Schmucksets von Dog-Collar-Trägerinnen auf-weist, um die Elite an einer Institution tätigen Frauen handelt; beispielsweise könn-ten sie, wegen des Siegels der dumu- iparx(KISAL) (Mitbestattung Nr.7 in RT. 1237), in einem frühdynastisches gip ru oder in einer anderen religiösen Institution gewirkt haben oder auch einschlägige Aufgaben im Palast wahrgenommen haben. Dies gilt so auch für die Mitbestattung Nr.61. Wenn man sich festlegen müsste, dann käme für sie wohl am ehesten der Rang einer Nindingir-Priesterin in Frage.124 d) Es wurde mehrfach festgestellt, dass man die größere Anzahl der Mitbestatteten mit Trinkgefäßen ausgestattet hat. Dies gilt besonders für die weiblichen Mitbe-stattungen in den Schächten der zuletzt angelegten Royal Tombs, die sich als Bestat-tungen in Private Graves schlecht nachweisen lassen und die sich von daher als Beleg für die Interpretationsansätze anbieten, die in den Mitbestatteten spezifisch dekorierte, ermordete Personen von niedrigen sozialem Status oder Kriegsgefangene vermuten. Es wurde argumentiert, dass schon im frühdynastischen Ur die Behand-lung von Toten normativ geregelt war. Libationsröhren, Nahrungsmittelreste in Gefäßen und die Ausstattung mit Trinkbechern deuten an, dass die Versorgung der Toten mit lebenserhaltenden Stoffen über den physischen Tod hinaus gewährleistet sein musste. Angenommen werden kann deswegen, dass schon zu dieser Zeit eine Konzeption des Totenlandes existierte, die vorsah, dass der nicht-sterbliche Anteil einer Person �– sum. gidim / akk. e emmu �–, nachdem er in das Totenland einging, andauernd rituell zu versorgen war (da er ansonsten die Lebenden zu schädigen drohte.).125 Vor diesem Hintergrund stellen sich im aktuellen Zusammenhang zwei Fragen: Zum einen bleibt grundsätzlich offen, wie unter diesen konzeptionellen Bedingungen im Falle der Mitbestattungen der Transfer der Toten vom Grab ins Totenland konzipiert wurde, wenn man wie üblich davon ausgeht, dass sie dort für den Bestatteten oder die Bestattete Funktionen erfüllen sollten. Zum anderen muss im engeren Sinn nach der Stelle von �‚maskierten�‘ Subalternen oder Kriegsgefan-genen im skizzierten Jenseitskonzept, in den damit verbundenen rituellen Hand-lungen und im Totenkult gefragt werden. Die rituelle Versorgung der �‚Totengeister�‘ von Kriegsgefangenen durch das Herrscherhaus erscheint in jedem Fall als wenig
123 Vgl. die Diskussion der Brim-Träger-Mitbestattungen in RT.777 und 1054. 124 In Laga�š zumindest wurde das höchste Priesterinnen-Amt im präsargonischen Baba-Tempel von einer Nindingir-Priesterin bekleidet; vgl. Selz 1995, 70 71. 125 Vgl. zusammenfassend Vogel 2013, 426 429 mit weiterführenden Literaturhinweisen.
502 Helga Vogel
plausibel. Wenn man das Konzept �‚Totengeist�‘ als eine spezifische kulturelle Form der Erinnerung an einen Toten oder eine Tote auffasst, dann bleibt als zusätzliche Frage, wie deren Kohärenz gewahrt wurde, wenn in sie eine systematische �‚Glaub-würdigkeits-Bruchstelle�‘ durch die einem größeren Kreis bekannte Vorspiegelung falscher Identitäten eingeschrieben war.126 Das gleiche Problem stellt sich übrigens auch dann, wenn die Bestattungs-/Mitbestattungszeremonien als propagandistische Maßnahme des Herrscherhauses von Ur zur Sicherung und Legitimierung der Herr-schaft beim Tod eines Stadtfürsten beurteilt werden, was in der hier einschlägigen Literatur regelmäßig der Fall ist.127 6. SCHLUSS
Lässt man die Heterogenität und die Ambivalenzen der Befunde des früh-dynastischen Royal Cemetery zu, dann treten im Laufe der Arbeit mit dem Material die bestatteten und mitbestatteten Individuen und ihre je unterschiedliche soziale Welt immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit. Individuen sind gleichwohl der Feind der Archäologie, denn deren Bestreben ist es üblicherweise, die wider-sprüchliche, zufällige, veränderliche und mehrdeutige Wirklichkeit und Existenz-erfahrung des einzelnen, in einer archäologischen Kultur gelebt habenden Menschen in wissenschaftlich verwertbare Kategorien und Termini zu übersetzen und in über-geordnete Systeme und Fragestellungen einzuspeisen. Im Falle der Mitbestattungen in den Royal Tombs in Ur besteht vor dem Hintergrund des in diesem Beitrag disku-tierten Materials eine Herausforderung darin, zukünftig Interpretationen vorzu-schlagen, die die funktionale und soziale Heterogenität der Mitbestatteten, die auf je unterschiedliche Denk- und Handlungsmöglichkeiten von Individuen verweist, und deren Einbettung in soziale Bezüge (Familie; Freunde; Kollegen) ebenso berück-sichtigen wie die voneinander abweichende architektonische Gestaltung der einzel-nen Royal Tombs, deren sozialer Aussagewert im Detail noch erforscht werden muss. Bisher wurde im Allgemeinen der fehlende Begründungs �– und Kommunika-tionszusammenhang der Mitbestattungszeremonien durch Rekurs auf sehr weit ge-fasste Theorien zur Herrschaftslegitimierung unter den Bedingungen charisma-tischer Herrschaft kompensiert oder es wurden religiöse bis esoterische Motive ge-nannt. Es wäre zu überlegen, ob die Suche nach einer großen generellen Erklärung nicht vorerst durch Arbeit quasi �‚vor Ort�‘ ersetzt werden sollte, denn tatsächlich
126 Zu den Personen, die über die tatsächlichen Vorgänge bei einer Bestattungs- / Mitbestat-tungszeremonie �‚Bescheid gewusst�‘ hätten, würden mindestens die rechnen, die die margina-lisierten Personen oder die Kriegsgefangenen ausgewählt, ihre Leichname entkleidet und konserviert hätten, die getrockneten Leichname aufbewahrt und im aktuellen Fall hergerich-tet, sie auf Karren geladen, in die Schächte verbracht, abgeladen und arrangiert hätten. Aber auch die Personen, die die Anlagen planten und errichteten, das rituelle Personal und nicht zuletzt die Produzenten und Produzentinnen des Schmucks, der Kleider und der anderen bei den Mitbestatteten gefundenen Artefakte wären informiert gewesen. 127 Vgl. beispielsweise Pollock 1991, 180 182; Wagner 2002; Selz 2004, 188. 211; Cohen 2005, 153 154; Dickson 2006, 124. 133-135; Pollock 2007a, 222 224; Laneri 2008, 207; Baadsgaard et al. 2011, 40; Vidale 2011, 448.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 503
bleiben momentan noch zahlreiche zentrale Fragen, die sich aus dem Material erge-ben, ungelöst. Hierzu zählen:
- Wie lässt sich erklären, dass Personen bestimmte Positionen am Hof akzep-tierten oder bestimmte Berufe ergriffen, wenn sie und ihre Familien wussten, dass dies ihre Mitbestattung zur Folge haben könnte?
- Wie lassen sich die Mitbestattungen hochrangiger Personen erklären, ohne auf eine behauptete �‚Loyalität bis in den Tod�‘ zu rekurrieren?
- Wie lassen sich die sozioökonomischen Grundlagen von Begriffen wie Loyalität, Liebe, Treue usw. bestimmen?
- Wie lassen sich die aus dem Material ableitbaren Differenzierungsten-denzen innerhalb der Elite Urs in einen Erklärungsansatz für die Mitbestat-tungen integrieren?
- Lässt sich der soziale Status der Mitbestattungen im Einzelnen noch genau-er herausarbeiten als dies im vorliegenden Beitrag der Fall ist?
- Dass die spezifische Ästhetik der Erscheinungsweise der mitbestatteten Musikerinnen und Dog-Collar-Frauen, in der Materialien, Formen und Inhal-te dominieren, die ebenso das Schmuckrepertoire hochrangiger Frauen aus-zeichnen, in den Bereich der herrschaftsästhetischen Darstellung und Perpe-tuierung des Stadtfürstentums rechnet, steht fest. Bedeutet die Unmöglich-keit, diese Frauen in Private Graves nachzuweisen, dass sie im alltäglichen Leben sozial untergeordnete Positionen einnahmen und nur für diese Gele-genheit in der vorgefundenen Weise inszeniert wurden? Was ließe sich her-aus schlussfolgern?
- Wie lassen sich die Massengräber, die in den vorliegenden Erklärungs-ansätzen nie berücksichtigt wurden, obgleich sie doch das beste Argument für Thesen liefern wie Dickson, Baadsgaard et al. und andere sie formulieren, einer Erklärung zuführen?
- Wie verhalten sich also die Massengräber, die nicht nachweisbaren �‚norma-len�‘ Bestattungen von Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen und die sorgfältige Ausstattung und Behandlung ihrer Leichname in den noch erhal-tenen Schächten zueinander?
- Wie lassen sich Befunde wie das Gemenge von menschlichen und tieri-schen Knochen vor der Grabkammer in RT.1054, die in den Füllungen der Schächte entdeckten Schädel oder Knochenreste sowie die in den Lehm-ziegelgebäuden oben im Schacht ausgegrabenen Skelette vor Särgen erklä-ren? Handelt es sich dabei um von den Mitbestattungszeremonien gesonderte Befunde?
- Wie können die Mitbestattungen in den Gräbern der Stadtfürstinnen erklärt werden, wenn deren Bestattungen als nicht herrschaftsrelevant eingeschätzt werden?
504 Helga Vogel
Als ich diesen Beitrag schrieb, saß mir in der Berliner U-Bahn an einem Tag ein junger Mann gegenüber, der ein T-Shirt mit dem sehr großen Aufdruck �‚UR�‘ trug. In kleinen Buchstaben stand darunter zu lesen: �‚Underground Resistance �– Un-exploitable.�‘ Ich nehme es als Zeichen und Auftrag der Toten von Ur. VERZEICHNIS DER TABELLEN Tab.1 Ergebnisse der neuen anthropologischen Untersuchungen Tab.2 Anzahl der Mitbestattungen in den unterschiedlichen Bereichen
der Royal Tombs. Tab.3 Brim-Träger-Bestattungen in Private Graves Tab.4 Brim-Träger-Mittbestattungen in Royal Tombs Tab.5 Grabformen im frühdynastischen Gräberhorizont des Royal Ceme-
tery Tab.6 Dog-Collar-Trägerinnen in Private Graves und Vergleichsdaten VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN Abb.1 Brim-Stirnketten. Nach Zettler und Horne 1998, 105, Abb.52. Abb.2. Dog-Collar-Halsband. Nach Zettler und Horne 1998, 109, Abb.63 Abb.3 Gesamtplan der Royal Tombs. Nach Woolley 1934, Taf. 273. Abb.4 RT.1237. Plan nach Woolley 1934, Taf. 71. Abb.5 RT.789. Plan nach Woolley 1934, Taf. 29. LITERATURLISTE
Baadsgaard et al. 2011, Baadsgaard, A. / J. Monge / S. Cox und R.L. Zettler, Human Sacrifice and Intentional Corpse Preservation in the Royal Cemetery of Ur, Antiquity 85, 27 42.
Baadsgaard et al. 2012, Baadsgaard, A. / J. Monge und R.L. Zettler, Bludgeoned, Burned, and Beautified. Reevaluating Mortuary Practices, in: A. Porter / G.M. Schwartz (Hrsg.), Sacred Killing. The Archaeology of Sacrifice in the Ancient Near East (Winona Lake) 125 158.
Beld, S.G. 2002, The Queen of Lagash. Ritual Economy in a Sumerian State (Dis-sertationsschrift; The University of Michigan).
Charvát, P. 2002, Mesopotamia before History (London). Cohen, A.C. 2005, Death Rituals, Ideology and the Development of Early Mesopo-
tamian Kingship. Towards a New Understanding of Iraq�’s Royal Ceme-tery of Ur (Leiden Boston).
Dickson, D.B. 2006, Public Transcripts Expressed in Theatres of Cruelty. The Royal Graves at Ur in Mesopotamia, Cambridge Archaeological Journal 16/2, 123 144.
Gansell, A.R. 2007, Identity and Adornment in the Third-millennium BC Mesopo-tamian �‚Royal Cemetery�‘ at Ur, Cambridge Archaeological Journal 17/1, 29 46.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 505
Ellison et al. 1978, Ellison, R. / J. Renfrew / D. Brothwell / N. Seeley, Some Food Offerings from Ur, Excavated by Sir Leonard Woolley, and Previously Unpublished, Journal of Archaeological Science 5, 167 177.
Gansell, A.R. / I.J Winter 2002, Treasures from the Royal Tombs of Ur, Harvard University Art Museum Gallery Series, Number 36, 2 8.
Keith, A. 1934, Report on Human Remains, in: Woolley 1934, 400 410. Kenoyer et al. 2013, Kenoyer, J.M. / T.D. Price / J.H. Burton, A new approach to
tracking connections between the Indus Valley and Mesopotamia: initial results of Strotium isotope analyses from Harappa and Ur, Journal of Ar-chaeological Science 40, 2286 2297.
Laneri, N. 2008, Texts in Context: Praxis and Power of Funerary Ritual Among Elites in Ancient Mesopotamia, in: L. Fogelin (Hrsg.), Religion, Archae-ology, and the Material World (Carbindale) 196 215.
McCaffrey, K. 2008, The Female Kings of Ur, in: D. Bolger (Hrsg.), Gender through Time in the Ancient Near East (Lanham, MD) 173 215.
Marchesi, G. 2004, Who Was Buried in the Royal Tombs of Ur? The Epigraphic and Textual Data, Orientalia 73, 153 197.
Marchesi, G. / N. Marchetti 2011, Royal Statuary of Early Dynastic Mesopotamia (Eisenbrauns) (italienische Originalausgabe: 2006).
Michalowski, P. 2006, Love or Death? Observations on the Role of the Gala in Ur III Ceremonial Life, Journal of Cuneiform Studies 58, 49 61.
Molleson, T.H. / D. Hodgson 2000, The Porters of Ur, Isimu. Revista sobre Oriente Próximo y Egipto en la antigüedad, N°.3, 101 118.
2003 The Human Remains from Woolley�’s Excavations in Ur, Iraq 65, 91 129. Moorey, P.R.S. 1977, What Do We Know about the People Buried in the Royal
Cemetery of Ur? Expedition 20/1, 24 4. 1994 Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The Archaeological Evi-
dence (Oxford). Moortgat, A. 1949, Tammuz. Der Unsterblichkeitsglaube in der altorientalischen
Bildkunst (Berlin). Nissen, H.J. 1966, Zur Datierung des Königsfriedhofes von Ur (Bonn). Pollock, S. 1983, The Symbolism of Prestige. An Archaeological Example from the
Royal Cemetery of Ur (Dissertationsschrift, The University of Michigan). 1985 Chronology of the Royal Cemetery of Ur, Iraq 47, 129 158. 1991a Women in a Men�’s World. Images of Sumerian Women, in: J. Gero / M.
Conkey (Hrsg.), Engendering Archaeology. Women and Prehistory (Ox-ford) 366 387.
1991b Of Priestesses, Princes and Poor Relations. The Dead in the Royal Ceme-tery of Ur, Cambridge Archaeological Journal 1/2, 171-189.
2007a Death of a Household, in: N. Laneri (Hrsg.), Performing Death. Social Analyses of Funerary Traditions in the Ancient Mediterranean (Chicago) 215 228.
2007b The Royal Cemetery of Ur. Ritual, Tradition, and the Creation of Sub-jects, in: M. Heinz / M.H. Feldman (Hrsg.), Representations of Political Power. Case Histories from Times of Change and Dissolving Order in the Ancient Near East (Winona Lake) 89 110.
506 Helga Vogel
Pongratz-Leisten, B. 2005, Ritual Killing and Sacrifice in the Ancient Near East, in: K. Finsterbusch / A. Lange / K. Römheld / L. Lazar (Hrsg.), Human Sac-rifice in Jewish and Christian Tradition (Leiden) 3 33.
Porter, A. 2012, Divine Power and Political Aspiration in Third Millennium Meso-potamia and Beyond, in: S. Ralph (Hrsg.), The Archaeology of Violence. Interdisciplinary Approaches (Albany, NY) 185 202.
Prentice, R. 2010, The Exchange of Goods and Services in Pre-Sargonic Lagash, AOAT 368 (Münster).
Rehm, E. 2003, Waffengräber im Alten Orient. Zum Problem der Wertung von Waffen in Gräbern des 3. und frühen 2. Jahrtausends v. Chr. in Mesopo-tamien und Syrien (Oxford).
Rohn, K. 2011, Beschriftete mesopotamische Siegel der Frühdynastischen und der Akkad-Zeit (Fribourg Göttingen).
Schrakamp, I. 2010, Krieger und Waffen im frühen Mesopotamien. Organisation und Bewaffnung des Militärs in frühdynastischer und sargonidischer Zeit (Dissertationsschrift, Philipps-Universität Marburg).
2013 Die �„Sumerische Tempelstadt�“ heute. Die sozioökonomische Rolle eines Tempels in frühdynastischer Zeit. In: K. Kaniuth et al. (Hrsg.), Tempel im Alten Orient (Wiesbaden) 445 465.
Selz,, G.J. 1989, Die altsumerischen Wirtschaftsurkunden der Eremitage zu Lenin-grad. Altsumerische Verwaltungstexte aus Laga�š. Teil 1 (Stuttgart).
1995 Untersuchungen zur Götterwelt des altsumerischen Stadtstaates von Laga�š (Philadelphia).
2004 Early Dynastic Vessels in �‚Ritual Contexts�‘, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 94, 185 223.
2010 �„The Poor Are the Silent Ones in the Country�“. On the Loss of Legiti-macy; Challenging Power in Early Mesopotamia, in: P. Charvát / P. M. Vl ková (Hrsg.), Who Was King? Who Was Not King? The Rulers and the Ruled in the Ancient Near East (Prague) 1 15.
Sürenhagen, D. 2002, Death in Mesopotamia. The �‚Royal Tombs�‘ of Ur Revisited, in: L. al-Gailani Werr et. al. (Hrsg.), Of Pots and Plans. Papers on the Ar-chaeology and History of Mesopotamia and Syria Presented to David Oates in Honour of His 75th Birthday (London) 324 338.
Stol, M. 2008, ,Ration�‘, in: Reallexikon der Assyriologie 11, 264 269. Strommenger, E. 1962, Fünf Jahrtausende Mesopotamien. Die Kunst von den An-
fängen um 5000 v.Chr. bis zu Alexander dem Großen (München). Svärd, S. / M. Luukko 2009, Who Were the �‚Ladies of the House�‘ in the Assyrian
Empire? In: M. Luuko / S. Svärd / R. Mattila (Hrsg.), Of God(s), Trees, Kings, and Scholars. Neo-Assyrian and Related Studies in Honour of Simo Parpola, Studia Orientalia 106 (Helsinki) 279 294.
Teppo, S. 2007, The Role and the Duties of the Neo-Assyrian �šakintu in the Light of Archival Evidence, State Archives of Assyria Bulletin XVI 2007, 257 272.
Vidale, M. 2011, PG 1237, Royal Cemetery of Ur. Patterns in Death, Cambridge Archaeological Journal 21/33, 427 451.
Vogel, H. 2013, Death and Burial, in: H. Crawford (Hrsg.), The Sumerian World (London New York) 419 434.
Brim-Stirnketten-Träger, Musikerinnen und Dog-Collar-Trägerinnen 507
im Druck Doing Beauty: Schönheit als gesellschaftliche Praxis in Mesopotamien, in: U. Dubiel (Hrsg.), Making difference matter �– Schönheit als Index für soziales Kapital. Sonderband SAK Beilagen (Hrsg. N. Kloth und J. Kahl).
Wagner, E. 2002, Die Gefolgschaftsbestattungen im Königsfriedhof von Ur. Ein �„Soziales Drama�“? In: M. Heinz / D. Bonatz (Hrsg.), Der �„Garten Eden�“ im dritten Jahrtausend. Einblicke in das Leben städtischer Gesellschaften in Südmesopotamien zur frühdynastischen Zeit (ca. 2850�–2350 v. Chr.) (Freiburg) 88 94.
Woolley, C.L. 1934, Ur Excavations. Volume II. The Royal Cemetery (Oxford). 1976 Ur Excavations. Volume VII. The Old Babylonian Period (Oxford). Weadock, P.N. 1975, The Giparu at Ur, Iraq 37, 101 137. Waetzoldt, H. 1984, �‚Kleidung A. Philologisch�‘, Reallexikon der Assyriologie Bd.
6, 18 31. 1988 Die Situation der Frauen und Kinder anhand der Einkommensverhältnisse
zur Zeit der III. Dynastie von Ur, Altorientalische Forschungen 15, 30 44.
Weber J.A. / R.L. Zettler 1998, Tools and Weapons, in: R.L. Zettler / L. Horne (Hrsg.), Treasures from the Royal Tombs of Ur, (Philadelphia) 163 173.
Zimmerman, P.Chr. 1998, A Critical Reexamination of the Early Dynastic �„Royal Tomb�“ Architecture from Ur. (Masterarbeit, University of Pennsylvania).