Ökologie und Gesellschaft: über Ethik und Rationalität im Verhältnis von System und Umwelt
Sperrzonen und Grenzfälle: Beobachtungen zu Herrschaft und Gewalt im kolonialen Kontext zwischen...
Transcript of Sperrzonen und Grenzfälle: Beobachtungen zu Herrschaft und Gewalt im kolonialen Kontext zwischen...
Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft Band 27
Staats-Gewalt:
Ausnahmezustand und Sicherheitsregimes
MAX - PLANCK - INSTITUT
ZUR ERFORSCHUNG MULTIRELIGIÖSER UND
MULTIETHNISCHER G ESELLSCHAFTEN
GÖTTINGEN 2008
Staats-Gewalt: Ausnahmezustand
und Sicherheitsregimes Historische Perspektiven
Mit Beiträgen von Gadi Algazi, Jane Burbank,
Kathleen Canning, Andreas Eckert,
Michaela Hohkamp, Achim Landwehr,
Alf Lüdtke, Stefan Plaggenborg,
William E. Scheuerman und Micl1ael Wildt
Herausgegeben von
Alf Lüdtke und Michael Wildt
W ALLSTEIN VERLAG
GADI ALGAZI
I.
~~.entlieh gesprochen .befirtde-t sich Israel in ·einer perm,a'P;&ut·~n ·Notst.andssitu.ation, gen3:uer g·esa.gt: in einem per·mß:nent erneuerten vo·rüberg.ehenden Notstand_.2 Er wu·rde 'I·948 deklariert. B·is 1996 reicht€ eine einfac.he Re.gieXtl'n/g~·e.rklätu:ng, um seipe ·GeltU,ng für eine Periode von
.6 bi.s r ~ ~0.1:J~te~ zu verläng~rn·; seitdem mu·ss d·ies durch
d.iS: is~ailis.~he Parl:imeiit ratifizie~t Werden~ was .bisher
~iich geSCheheP i$~. ". ber N.o:tStaild ~rniäCfiif gr die Regie~ r,ung) N ot~tatiiiSeilasse (>i:EmerS,ellcy Regulatio~s«Y ausilisteilen, . die. ·se,h.i vet$~hiedene Lebe.nsb~relche tallgie-ren. ·oa:s B~ste&~n eines formellen Ausn'.ah'mezusiand . .s. i,st \:'örbeding9n:g·daf{ir, das.s· die älteren· briti;s:~hen No:tstands-
.y , " " ,„ ~
verteidigµ~seila:ss·~ . (;;n~:f ~nse . "(Eillerg~ncj) Regiila-ti_ons~< )~ cti.e für,Vafäsiina während der letzten Phas~n .des zweiten W~lt~riegs e;ia;sse~ worden waren, iin he~t.lgen IS.rael gliltjg bleiben. Teile diese"~ Korpu~ ·~on N~tstandsbestinimungen siqd heu.te ·tote 'Bucl1st~b~~- ~nder~ ~erden
" ; ,-v >' '" '
iiemli.~h. rege!n;aß;ig angewenilef; von der Eirizieh\lng pri-v~ter Pk.'Ys für militärische 'zwe,cke, Üb.e.r das· N ot.stands-
' <
arb~i~sdi~nstg·esetz,, das 'noc·h ,in der nicht a.llzu feT'r{en , ' '
Vergangenheit einges~tit wurde, u~·Streik~ in notwendi-„ " , >'
.g-~n bien;stle1·s.tung:s'beieichen zu unteib:inden ·bis' hi·n· ~ur "; 'li ; '< '< '
Preii;~egU.llerullg .urld der Einschrankµng d~r ß~Wegungs-freilieit, oie ·n ·emolietu.n.g v~n Hausern unct dt-e Deportation von Me·ns.chen. Der Notstand' stellt zugleich , d~e le_gal.e Basis des N otstand.sermäc·htigungsakts (>> Emergency
.. .:r-o.we·rs Act<<) von 1979 dar, welcher das Verteidigungs-
'Z ·:m1re ,-JD~,sku-ssio·n hat weitere Belege ·dafür e:rbrae'ht, dass -die Unter·se,h~'i4u:ilg0zwi~Ghen Ausnahmez4st~n9 -(state 6f excepti<:Jf,l). unq Not:st"ä:ttd-.(·state ·of em€r·gency) bedeutsam und fru~htb~r sein kann auch ·wenn .beide. 0.ft .. a:Is· S,ynonyme verwendet 'Werden. '
'
SPERRZGNEN UN·D .G.RENZFÄLLE
minis.t€ri-u;~ (~a.s .wor·tli,e.h ~~c.h :d.aß ~:>-Sicherheits,minis·te
rium<<' .hejß_~-~:„~ti:~oris:i~xt, ~ers.onen für bi·s zu. 6. Monaten
in H:i:f:t zu neh:cne·11 ·( >->..~:dmini:s~t.ative, de.t.en·tio n << ), o:hne. A·nkl~ge ''0r:h;yben zu· müs~sen. Ad_ministrative Haft ist im p:liinzip unb:egrenzt verlängerbar, doch unterl·iegt sie der
r.ichter.li.ohe:n· Priitung. Di~e .Häftlinge:· könne:n si~h zwar
durch. Arrwoälre vewetea la~sen, be.i seiner Entscheidung darf. S:t~h das Geticht ,aber auf~ :vettJ:aul·i,ch~ Informationen
S'tü:tzen, ·zu welc.h~n di'.e Verh:~fte-ten und selb·s't ihre ' ,
~>e.cfit~anwälte: kein·en .zu.gang h:aben.
·r 9:97 ·wies· das ·israeli:sche O ,bel's,te Gericht die Regierung an, alle G,eset~·€;~st.iic,k,e zu widerru·f en oder zu etse:tzen,
d:erep Geltung VO"tl der E.xistenz eines f(>rmell bestehend.en ,N o.tsta·nrls~ ,flibhäng~t. :Alle nachf·ol-genden. Re.gieru·ngen hab.e.~ e_s-. ve~sttumty ·dies zu eun. ~Eig·entlieh wurde der NotSit-and :s·ehctn vier .:J1:ag.e. nach S:taa:t-s:griihdung· proklamie-rt, do.€h die Ktiegs;si.tuati'on. h~t längst ·i_hre.n Platz einer bequ~~en rechtlichen Fikti'.On. ü:b.erlassen, die ein"e ganze Reihe v:on ·st)nctetmaßnallmen .mö·glich mac·h·t. Viele vo.n di:es,ert haben.:~:aum etwas· mit g-icherheit zu tun, ·nicht ein-
1 . . . s· D' ma Im · · · · · · · · ''' ' we1te,sten :Inn. ' le N .ots\tandsbes·timmungert
wutd.en - beso·nd.ers bis I 966-- dazu eingesetz.t, die politise;he Akt,jvität. der arab,ischen Bür.ge·r IsraEfls unter K·on
trolle .zu halten. In d.en fiinfzig·~r ·und sechziger Jahren
durftet). ar·abi~sche B'ijrger· d;ie =>Sieherh.eitsz:one·n<, :in denen di;e· .m,ei;s-ten: von ihnen lebten, ohne Erlaubni,sschei.n ,de.r Militäirl1ehovl1e nit::h:t v:erI.assen. Ganz besonders trafen
A uf\m"thalts-· und Arbeitsbeschränkungen policisc:he Aktivistei=l "7·v:oF allem Kommunisten und Nationalisten,. Die geschl·c1ssenen Militärzonen., u·rsprüngli,ch als Sicherheitss·treifen e:n-t:lang ls'raels ri.eu,e·r Gtenze,n nach dem Kti·eg
von 194.8 .defini~rt„ :s.te1lten ,sich als elastis'.ch g·eµu-g her~,us,
GADI ALGAZI
um nach Bedarf ausgedehnt und neu definiert zu werden.3
Sie dienten dazu, die Bewegungsfreiheit palästinensischer
Bürger einzuschränken und das zionistische Siedlungs
projekt zu unterstützen; Ackerland wurde für die Bauern
unzugänglich gemacht, um später als unbebautes Land
enteignet zu werden.4 Innerhalb Israels wurden diese
Maßnahmen bis in die späten sechziger Jahre hinein re
gelmäßig angewandt. Nach 1967, mit der militärischen
Besetzung von der Westbank, den Golanhöhen, dem Si
nai und dem Gazastreifen, fanden sie breite Anwendung,
um jenseits der Bekämpfung militärischen Widerstands
politische Opposition jeder Art einzudämmen und der
israelischen Kolonialpolitik den Weg zu ebnen.
Menschenrechtsgruppen, kritische Juristen und Oppo
sitionelle in Israel und anderswo haben schon längst in
diesem formal proklamierten Notstand ein geschmeidi
ges polit.isches Instrument erkannt, das einem Staat, der
stolz auf seine demokratischen Institutionen ist, erlaubt,
seine erklärte Verpflichtung zum Respekt von Menschen
rechten und Freiheiten zu umgehen. Das ist nichts Neues.
Wir haben gelernt, dass demokratische Institutionen und
Grundrechte äußerst zerbrechliche Wesen sind, für Ge
fahrwahrnehmung und Sicherheits.diskurse höchst emp
findlich. So sind wir Menschen auch.
Vielleicht hilft uns die zeitliche Struktur dieses Not
stands, seine Eigenart besser in den Griff zu bekommen.
Ein Notstand wird in der Regel als eine momentane Ab
weichung von der Regel wahrgenommen, als eine vorüber
gehende Situation, die von außerordentlichen Umständen
3 Menachem H ofnung, Democracy, Law, and N ational Security in Israel, Dartmouth r 996.
4 Sabri Jiryis, The Arabs in Israel, New York 1976, S. 16-18, 26.!30.
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
abhängt. Beides scheint für seine Akzeptanz als eine legi
time Divergenz von akzeptierten Normen erforderlich
zu sein. Achtundfünfzig Jahre Notstand, wie im Falle Is
raels, scheinen diese Vorstellung aber doch überzustrapa
zieren - bei allem Respekt für Kriege und militärische
Auseinandersetzungen unterschiedlicher Intensität. Eine
Notsituation verweist auf die Unmittelbarkeit des Mo
ments und seine eindringlichen Bedürfnisse. Doch in die
sem Fall stützt sie sich auf eine spezifische Zeitwahrneh
mung und verstärkt sie zugleich - eine ausgedehnte
Gegenwart, die die Schwankungen zwischen Zeiten rela
tiver Stabilität und tatsächlichen militärischen Konfron
tationen ignoriert, um stattdessen eine tief er liegende
Struktur permanenten Kriegs heraufzubeschwören. Ge
wiss haben israelische Regierungen diese Vorstellung re
produziert und ideologisch ausgenutzt. Gleichwohl bleibt
die Effektivität offizieller Diskurse sozial und kulturell
bedingt; wenn sie nicht nur Schein sind, liieren sie sich
mit Strukturen der gelebten Erfahrung. Auch der Sicher
heits- und Notstandsdiskurs, der ständig eine unmittelbar
gegenwärtige Gefahr beschwört, aber auch überspielt, ver
weist indirekt auf eine tiefere Unsicherheit. Er ignoriert
und maskiert sie, benutzt sie ab·er zugleich.
Der Notstand soll gegenwärtige Gefahr effektiv abweh
ren können. Er beruht auf der Versicherung, gefährdete
>Sicherheit< durch legitime Gewalt und militärische Maß
nahmen wiederherstellen zu können. Doch ständig ver
längert und immer neu deklariert, wird das eigene Ver
sprechen Lügen gestraft. Gleichzeitig schuldet er sowohl
seine Effektivität - nicht bloß als legale Fiktion, sondern
als formende Kraft des sozialen Bewusstseins - wi·e sein
subversives Potential dem Tatbestand, dass er auf eine
~
1
' i
i' ' '
- --··'"'· "" ' .
. · ..
GADI ALGAZI
unausgesprochene Gefahr verweist. Denn er zeigt in
direkt jenseits der momentanen, täglich verwalteten Ge
fahren eine langfristige, bleibende strukturelle Gefährdung
an, die der Gefahr-und-Sicherheit-Diskurs ignorieren
muss: Langfristig kann Israel im Nahen Osten nicht als
eine >>Villa mitten im Dschungel<< (in den Worten des
ehemaligen Premierministers Ehud Barak) existieren, als
>>ein Stück des Walles gegen Asien<< oder eine Gesell
schaft, welche >>den V orpostendienst der Kultur gegen die
Barbarei<< zu besorgen hat (in der alten, doch immer noch
relevanten Formulierung des Begründers des politischen
Zionismus, Theodor Herzl).5 Der permane-nt verlänger
bare temporäre Notstand führt zu einem dead end. Auf sichtbare, momentane Bedrohungen immer wie
der verweisend, rührt die Evokation von Sicherheit und
Notstand an Ängste und strukturelle Gefahren, welche
ebendieselbe Politik in Frage stellen, die immer wieder
Sicherheit durch militärische Überlegenheit und den
Rückgriff auf Waffen versprochen hat. >Sicherheit< ver
mag Hoffnungen zu erwecken, die ein Mini.sterium für
Sicherheit nicht erfüllen kann. Neben der nötigen kriti
schen Analyse o·ffizieller Geb·rauchsweisen von >Sicher
heit< und >Notstand< müssen wir diese Worte und ihre
soziale Resonanz ernst nehmen - bei der administrativen,
von Militärs und Sicherheitsexperten geprägten engen
Definition nicht haltmachen, um sie auf sedimentierte
Alltagserfahrungen zu beziehen. Die politische un·d so
ziale Effektivität vom >Ausnahmezustand< liegt nicht in
5 Ehud Barak, Address to the Plenary Session of the National Jewish C-ommunity Relations Advisory Bo,ard, St. Louis, USA, 1r .. 2.1996; Theodor Herzl, Der Judenstaat. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage, Berlin/Wien 1896, S. 29.
•
SPERRZONEN UN.D GRENZFÄLLE
seiner formalen, zunächst inhaltsleeren Definition als •
Ausnahme, sondern in der glaubhaften Evokation der
Not; erklärt wird sie ebenso wenig durch die bloße Be
stimmung der Instanz, die ihn verhängen kann, als viel
mehr durch die sozialen und kulturellen Bedingungen
seiner Ak·zeptanz. Und diese bringt wiederum neue Ver
flechtungen mit sich: Wer nicht bloß von einer formalen
Ausnahmesituation, sondern von einem Notstand glaub
haft zu sprechen versucht, hat einen Ausweg aus der Not
in Aussicht zu stellen. Das Spielen mit Sicherheit ist selbst
gefährlich. Wenn sich ein Notstandsdiskurs aus tiefer
Unsicherheit spe:ist, so verweist er zugleich auf eine zeit
liche Perspektive, die außerhalb des durch die politischen
Machthaber verwalteten Moments und jenseits der nächs
ten und übernächsten erfolgreich geführten Konfronta
tion liegt - eine historische Perspektive.
• II.
Die Notstandserlasse sind ein koloniales Erbe, zunächst
in einem einfachen rechtlichen Sinne: Wie viele andere
Besonderheiten der israelischen Verfassung schulden sie
ihre Form der britischen Mandatsherrschaft (1920-1948).
Mit der Unabhängigkeit erbte der Staat Israel die Macht
fülle des britischen Hochkommissars für Palästina. Dar
aus resultieren das Übergewicht der Exekutive und die
deutliche Schwäche lokaler Kommunen gegenüber der
Zentralregierung. Die Notstandsbestimmungen wurden
zunächst erlassen, um die arabische Rebellion (1936-1939)
zu unterdrücken, und später, nach ihrer Kodifikation
194 5, gegen jüdische Opponenten der britischen Präsenz
in Palästina angewendet. Zionistische Juristen und Politi-
:: .. · . ·:· .· ... · . :-::· ·: . .. . . . .. . .. :-·: :.: . . .. :·· .. :.·. . . . : . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .. .. . . . .. . .
:::= . .. . . . . . .. .
. . . ..
... . . . . . . .
. . . . .
. . . . ... . . . .. . . ' . ... .
' . .. . . .. . . . . ' ..... . ' .. ·:·· .. :.:·· :· .. ·.· .· .... '. ·:· ..... ' .. ·· .... . · .. : .... ·· .. : .. ::: :. . . . . . .· . . . . . . . . . . ·. ... . . . . .... . . ··:.::. :- : . : .. -: . .. . . . ·.. ··: .. : . .. .. . . .
. . . : ... · .: .. : .. ... . .. . .. : . . . . . . . . ... : GADI ALGAZI . . . .·· . .
·.
d€r k@lonialen Vergangenheit. Die Nots·tandsm.aßnahmen b'est.e·hen. weiter, weil sie in der· 'kolo.nialen ,'Ge.genwart
ihren,S.it·z im„,Le'b:€n haben. Koloniale. Situ.ationen untergr:ahen die herkömmlichen Untersc·heidunge·n zwi·schen Krie.g und Frieden; sie si·n:d vi-elmehr durch andau.ernde, endeJnisch.e. Feindseligkei.ten ch.;itakterisiert und zwingen
u·ns-:.d.adur~ch, Krieg als eine:n zent.v:alen Aspekt eine-r um
fassend-en sozialen Transf orma;tion zu begreifen ...... in. die
sem F.all, des. ko:lonialen Prozesses.~6 Ein ständig .erneuerter Notstand $'Cheint ene:n:dies, zu ar;tikutier:e.n: weder Krieg noch .Frieden,, ,ständige S·chw.ankungert'und, unvorherseh
bar,e. Entgleis.ungen zwi.schen r.elative:r Ruhe. und. immer •
wiederkehrender low intensity~ warfare. ßoch,viel ·b·edeut-' samer ist, dass N.otstan.dsbestimmun~g.en eine eminente
Rolle im kolonialen Prozess gespielt h.aben, inne,rhalb. Is
raels wie auch in ,den seit 1967 militärisch besetzten Territorien. In ,.Israel halfen .sie, unter :B.eibehaltu·ng ziviler
Rahmenbedingungen, die paläs·ti.nensische Minderhe~it~ zu entei,gnen„ In den b.esetzten Territorien b.oten die Not·-
d b ··· b . M.. i ·· hk. .. f .. d.. ·u stan s. est1mmungen reite .· . og io · ei·ten ·u.r ie . nter-wer:fun·g der Bevölk.erung un.d die Schaffung r,e·cht.sfreier Räumer ·die· für die ungehemmte Entfaltung kolonialer Pr .. o·J~;o,k·te ·s· o n·· o·· ti~ g·· s· 1~·n· ·d·· · .. ·· ·····. .: · · · ·· ··. ·· · .. · ··.· · :·.: .:: ·· .:. · · · ··· · · ·· · .. :·. · ·.· ·· ·. · ' '.· . ~ . ' .·: ... ' '.· .· . .. : . . ' .• , .. :::·:: ·: :: .. ·.: ·=·=·· ···:.::··;~:. ": ::.:- : .. :.:-·: .... ·· .· >·: .: :· .. : ·. · .. =.· -~· ": :·":· .. : .. :· :_=:.:.:;:· :·: <· -:~ :. :
· :<-:: Dies erklärt in hohem Maß,e, wie.so .der Staat Israel; ,der
seit.s;einer Grün:dung einen umfassenden Institutionalisie-
run:gsprozess du.rchlaufen hat, es vermeidet, die Not-·.
. -=: ~-:T === .. i: :.- :::· :: : : . : : :: · .. ·. ·==; .. :._.: · · · · . =· . :.: . ··=: . · · · . . . .· . :· . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . . .· ·:· ·. . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . ..
6 H. L. Wesseling, Imperialism and Colonialism; Es·says on the His. tory ,of Eurbpean Expansi.on, West_port, Co·nn., 1997, 3-26.
31S
.· <
. ·.·· '· . .
)~~ . ::::.
' . . :.·
~·
SPERRZONEN UND GRENZF.ÄLLE
standserlasse durch o.rdentliche .Gesetzgebung zu e:rsetzen. Diese Spannung klingt auch im Argum·ent isra:elischer Menschenrechtler mit, die Regierenden würden befürchten, s,olc.he Ge,s:etze - abg·eschwächte funktionale Äquiva~
len·te der alten Notstandserlasse - hielten der richterlichen
.Prüfung nicht stand„7 Es, ist, als ob der Staat davor zurückschr·ec:kt, seine eigene T~rans.f ormation in einen Rechts-
.
staat zu vollenden. Er zieht die imp·rovisi.erten Lösungen und, peinlichen histori,s,chen Re.likte ·der briti·schen _Herrschaft -dem due pro·cess und f ormgemäßer Gesetzge:bung vor. Auf dies-e We·ise hinterlässt der koloniale Prozess seine Spuren auch im Staat sel.bst, .denn er erford.ert stä.ndige Entgrenzung zur Aufrechterhaltung des Siedlungsimpe-, tus und. zugleich die Verflüssigung feststehend-er Struk
turen, bürgerlicher Kontrolle und formaler Regeln,. Die Siedlerbewe.gu.ng hat ebendies zum Ziel: nicht nur die ge ... waltsame Neugest:altung der physischen und sozialen
~ .
-Landschaft der eroberten Gebiete, sondern zugleich die Veränderung der israelische:n Gesellschaft. Das mobile, ständig in B'.ewegun.g befindliche colo.nial frontier soll rück~ wirkend die schon etablierte.n S.trukturen aufrütteln, die ganze Gesellschaft auf ihre kolonialen Ursprünge zurück
fü.hren. Zaunanlagen, Mauern und Straßensperren fü.llen die Landschaf-t der Westbank., aber den Aktionen von Soldaten und Siedlern -sind kaum Schranken gesetzt. In
dieser Hinsicht stellt sie ein überzei:chnetes Bild von Is
rael selb,st dar; ,eine Siedlergesellschaft, die vermeidet-· oder sich unfähig finde:t, - sich nieder·zulassen und sich zur Ruhe zu :setzen_, eine, welche in der Lage ist, di.e Koloni-
.. . . . . . . . . . . . .·. .
. . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . .
7 Yuval Yoaz, >>A State in Emergency<<, Haaretz, r9.6.2005. . .
.. ·:
319
. . . ..
. . . . .
. . . . . .
. ..... . .. . . . .· ...
. . . .. ···: . . .... . . : : : ; . : : ~.: ;~
. . . . ": . ··:
GADI ALGAZI •
sierten zu befrieden, aber nicht selbst den Frieden zu er
reichen. Der Notstand herrscht.
Es ist also verlockend, den Staat Israel und die Palästi
nensische Autonomiebehörde (Palestinian Authority) als
ein ungleiches Paar anzusehen, das in wichtigen Hinsich
ten ein Spiegelbild voneinander abgibt. Auf der einen Seite
gibt es einen etablierten Staat, der dem Prozess von For
malisierung und Institutionalisierung ausweicht - sich
etwa eine formale Verfassung und ein System bindender
Regeln zu geben, die eigenen Machtmittel Rechtsnormen
und öff entlieh er Kontrolle vollständig zu unterstellen,
wie ein idealisiertes Bild rationaler Herrschaft nach W e
ber' schem Muster es erfordert hätte. Vielmehr vermeidet
er, seine Grenzen - territorial wie normativ - zu definie
ren, und zieht temporäre W aff enstillstandslinien und einen
andauernden Notst.and vor. Auf der anderen Seite findet
sich ein Staatsgebilde, das alle formalen Elemente staat
licher Herrschaft aufweist, doch ein gekapptes Staatspro
jekt bleibt, mit allen Insignien der Macht ausgestattet,
doch mit wenig tatsächlicher Macht. Der Palästinensi
schen Autonomiebehörde wird ein zersplittertes T errito
rium zugewiesen; die Zuerkennung politischer Verant
wortung geht mit weitgehender Abhängigkeit von Israel
einher, das - über seine militärische Oberherrschaft hin
ausgehend - auch Gütermärkte und Melderegister, den
Zugang nach außen sowie lebensnotwendige Ressourcen
wie Land, Wasser und Energie kontrolliert. Von >unten<
und >oben<, durch globale Institutionen und lokale NGOs
unterminiert, kann die Palästinensische Autonomiebe
hörde ein Gewaltmonopol nicht durchsetzen, weder Israel
gegenüber noch gegenüber lokalen bewaffneten Gruppen
und ihren Patronen.
320
' ' , ' '
' ' : ' '
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
Dennoch sind die beiden miteinander verschränkt. In
den Augen der israelischen Elite war und ist es die Funk
tion der Palästinensischen Autonomiebehörde, das Elend
der Palästinenser zu verwalten, Israel von seiner Aufgabe
als Besatzungsmacht, für das Wohl der Bevölkerung in den
besetzten Gebieten zu sorgen, zu entlasten und vielleicht
auch die Kosten der militärischen Okkupation zu min
dern. Dies ist ohne Zweifel eine widersprüchliche Auf
gabe, und tatsächlich hat sich die Palästinensische Auto
nomiebehörde zuweilen als widerspenstig erwiesen. Sie
ist weder ein fügsamer Sublieferant von Sicherheitsdiens
ten für Israel noch ein unbeugsamer Widersacher gewor
den. Israel schwankt daher ständig zwischen indirekter
Herrschaft mittels halbverlässlicher Gegner und voller
direkter Kontrolle der Palästinenser. Auf der palästinen
sischen Seite hat es wiederum nicht an Kritikern geman
gelt, die - besonders seit 2000 - die Palästinensische Auto
nomiebehörde öff entlieh dazu aufgerufen haben, ihre
eigene Auflösung zu proklamieren und dadurch Israel
herauszufordern, die Kosten der Besatzung und die Ver
antwortung für die Not der Okkupierten zu überneh
men. Das ist bisher nicht geschehen, nicht nur deshalb,
weil die Palästinensische Autonomiebehörde für viele
immer noch für die Hoffnung auf Unabhängigkeit steht,
sondern auch, weil Machtpositionen - mögen sie noch so
schwach, derivativ und widersprüchlich sein - nicht leicht
aufgegeben werden. Beide Seiten, ungleich wie sie sind,
das israelische Establishment und die palästinensische
Elite, wahren also den Schein - miteinander und gegen
einander - und höhlen ihn gleichzeitig ständig aus.
Vielleicht ist diese Situation gar nicht so außergewöhn
lich, wie sie zunächst aussieht. Diese Form von Herr-
321
-
'
GADI ALGAZI
schaft lässt sich auch als eine moderne Form des Aus
lagerns (outsourcing) der Kosten des sozialen Elends
durch die Aufrechterhaltung einer Fiktion von Autorität
begreifen. Starke Staaten brauchen schwache Staatsge
bilde - nicht nur, um möglichst fern von >zuhause< rechts
fr·eie Zonen zu schaffen, in denen der Ausnahmezustand
vorherrschen kann, sondern ganz allgemein, um die >zu
hause< vorhandenen sozialen Schranken und öff entliehen
Kontrollen zu umgehen. Schwache Staatsgebilde ihrer
seits mögen sich als cunning states erweisen. 8 Aus dieser
Perspektive erscheint das koloniale frontier unter dem
Schirm scheinbarer politischer Autonomie als ein Grenz
fall neoliberaler Outsourcing-Politik. Eine widersprüch
liche, konfliktreiche und dennoch funktionale Arbeitstei
lung zwischen ungleichen Partnern mag dabei entstehen.
Herrschaft, auch moderne staatliche Herrschaft, ist kei
neswegs so einheitlich, total und formal erfassbar, wie sie
oft imaginiert wird. Kombinationen vorgespielter Souve
ränität und informeller Kontrolle dürften also eine Zu
kunft haben. Und lokale Eliten werden oft versucht sein,
die ihnen zugewiesene Rolle mit gemischten Gefühlen zu
übernehmen, was wiederum undurchschaubare Gemenge
lagen von Mitmachen und Widerspenstigkeit, Kollabora
tion und Auflehnung hervorbringt.
8 Shalini Randeria, Cunning States and Unaccountable lnternation~l Institutions: Social Movements and the Rights of Local Commun1-ties to Common Property Resources, in: E uropean Journal of Sociology 16 (1003), S. 27-60.
322
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
III.
Nun etwas konkreter: einige Bilder unterschiedlicher
Komplexität. Das erste zu autorisierter Gewalt. Es ist
Frühling 2004; ich sitze im Gerichtssaal der Stadt Kfar
Saba und schreibe Notizen. Diesmal steht ein Siedler vor
Gericht, weil er auf einen Friedensaktivisten geschossen
haben soll, meinen Freund und Kollegen A., einen Latinis
ten. Im 0 ktober 2002 schlossen sich Gruppen israelischer
Aktivisten palästinensischen Dorfbewohnern in der
Westbank bei der 0 livenernte an. Jahre kontinuierlicher
Schikanen der Siedler machten viele Felder zu no-go areas
für Palästinenser; sie wurden durch militante Kolonisten
faktisch enteignet. Die gewaltlose Teilnahme an den Ernte
arbeiten sollte den Palästinensern helfen, ihre Haine wie
der in Besitz zu nehmen; die Teilnehmer sollten ihnen im
Fall von Angriffen durch die Siedler beistehen.9 A.s
Gruppe schloss sich den Bewohnern von Einabus an,
einem Dorf in der Region von Nablous, und wurde tat
sächlich von bewaffneten Siedlern aus der benachbarten
Kolonie angegriffen. Die Siedler schossen in die Luft, bis
fast alle zur Flucht gezwungen waren. Als die Siedler
gruppe näher kam, blieb A. bei dem Olivenbaum, dessen
Früchte er erntete. >>Schieß ihm auf die Beine<< , soll einer
der bewaffneten Siedler .dem anderen gesagt haben; jener
beugte sich nieder und eröffnete das Feuer. Die Kugel
traf auf die Erde ganz nah bei A. - so zumindest glaubte
er. Erst zwei Tage später, als er mit hohem Fieber ins
9 Zum Kontext: Danny Adino Ababa, Meron Rapaport, Oron Meiri, >> The Battle of the O live<<, und Meron Rapaport, >> U prooted<<, Y edi' ot Acharonot, Supplement, 22.1 r.2002; englisch: Journal.cf P~lestine Studies 32 (2003), S. 94-roo; deutsch: >>Die 'Schlacht um die Olive<<: www.anis-online.de/ r/esays/gastessays/o6.htm (Stand: 1.6.2007).
.. :.·· .· ·::. . . . :: .. ::·. : : ..... .·: :: ..
.. . . ' .. . .:··: . . . . .
GA.DI ALGAZI
Kranke.nhaus eingeliefert wurde, hat er erfahren, dass er verwundet worden war. Ein Splitter hat'te seinen Magen
durchbohrt und musste chirurgisch entfernt werden. Es hat schon nicht wenig Mühe gekostet, A. dazu zu
bringen, Ankla:ge zu erheben. Palästinenser, meinte er, werden täglich erschossen; warum sollte sein Fall besonders behandelt we·rden?10 Doch. letztendlic'h ließ er sich überzeugen und ging zur Polizeistation in Ariel - einer der größten, mehr als 20.000 Einwohner starken Siedlungen in der Westbank - um den Fall registrieren ,zu lassen. ·Sie könnten wenig tun, meinten die Polizist.e:n, denn es sei äußerst schwierig, den Täter z·u identifizieren. A. hatte auch nicht den Eindruck, dass sie sich viel Mühe geben würden. Doch wenige Wochen später, beim Surfen im Internet, stieß er überraschenderweise auf einige Photos, die ein anderer Aktivist von der gewaltsamen Auseinan-
,
dersetzung auf den Hügeln von Einabus gemacht hatte. Er erkannte. darin den Mann, der auf ihn g:eschossen hatte. Hier war ein sehr seltener Fall von klarer Identifi~ zierung - oder so schie:n es zumindest, bis die Gericht:s
verhandlung begann. In seiner Beschreibung der Statur des Täters verwen
dete A. ei.nen nicht häufig gebrauc,hten Ausdruck, der, wie sich herausgestellt hat, von den Polizeioffizieren missverstanden wurde. Die Polizei versäumte es auch, die elementarsten Untersuchungsroutinen durchzuführen. Doch schwerwiegender war die Tatsache, dass der Angeklagte sich auf entlas~ende Zeugenaussagen anderer Siedler verlassen konnte. Als sich die Sitzung ihrem Ende
ro Siehe Chris McGreal, >>Bitter Harvest Groves,<< The Guardian, 14.11.2003.
in West Bank;s Olive
. " .·.
..
~:
it ': 1.:.
. : =r· „.
· .. 1,,: :· · ~::
. . II „·:: .
: j ·~~: ' jl „ •
. , . ::. : . . ·.·
?.'
> • '· ' -> ··• . .;:
_i·
-:·
: ; r~~i . ! · .
. {':° 1::
: :J~ .. ' : .
~:~ ·. ' ~,,~:·
:~: :::
:~; ~::
1 ·: :: '··
1 „. · .
.
,< · • • 1 ..
·:: · ..
1:: ,~.
;· :~:.
'·· :.: „. „. ), ..
·.
„ „ .
~·: .., .. . ,, .. · . . '·
• • - 1 •
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
näherte, wurde klar, dass die Chancen einer Verurteilung sehr gering waren.
Das ist kein isolierter Fall. Nach der Statistik von Yesh Din, einem israelischen Menschenrechtsverein, verhand.elten israelische Gerichte zwischen September 2002 und September 2005 392 Fälle israelischer Bürger, die wegen krimi.neller Straftaten im nördlichen Teil der Westbank angeklagt wurden. Nur r r von ihnen waren wegen Straftate.n gegen Palästinenser angeklagt und lediglich vier wurden tatsächlich verurteilt. 1
i Diese Zahlen bestätigen nur ein all:zu bekanntes Bild: Auf den Hügeln der Westbank sind die Siedler die wirklichen Herrscher vor Ort. Dieser ·Tatbestand ist keinem punktuellen Versäumni.s de·r Staatsgewalt geschuldet; er widerspiegelt dere.n tatsächliche Macht. Wenn wir Macht nicht rein formell definieren, sondern sie auch im Sinne der Fähigkeit verste~ hen, soziale Beziehung·en umzustruktu.rieren bzw. die sof,iale Landschaft zu verändern, wird klar, dass die Siedler die eigentl:ichen Machthaber sind.
Der koloni.ale Prozess ist kein Anhängsel der staatlichen Kontrolle oder der militärischen Gewalt, keine bloße Übertretung der Normen militärischer Okkupation. Die
Kolonisation ist das Herz des Ganzen; militärische Kon
trolle stellt aus dieser Perspektive eher den Schutz,schild dar, der die ungehemmte koloniale Transformation der Westbank möglich macht,. D·ie israelischen Militärs und Polizei erklären oft, dass sie angesichts der Gewaltsamkeit der Siedler hilflos sind. Das ist sicherlich oft ein bloßer Vorwand für Nichtstun, doch es gibt auch einen Kern
l 1 Esti. Ahar:onovich 1,fnd Yuval Y oaz, Settlers above the Law, Haaretz, 26.1.2006.
. . . :.· . „ . ..
. .
. .. : .. · . . .... :·:.::.:
• • .: .:· •• =
GADI ALGAZI
Wahrheit darin: Der Staat ist nicht in der Lage, seine Ge
setze gegen Taus ende bewaffneter Siedler durchzusetzen,
die eine Reihe formaler und informaler Immunitäten besit
zen, ständig vor Ort präsent sind und solidarisch gegen je
den Einmischungsversuch von außen auftreten. Gegenüber
einer solchen geschlossenen Grup·pe - einer sozialen Be
wegung, für die Schikanen und Terror keine individuellen
Straftaten sind, sondern Teil einer kollektiven politischen
Strategie und ein zentrales Element der Kolonisation -
werden die Grenzen individueller Straftatverfolgung sicht
bar. Man könnte gewiss auf kollektive Strafe zurückgrei
fen, aber sie ist bekanntlich Palästinensern vorbehalten.
Die Situation ist noch komplexer. Der angeklagte Sied
ler versuchte nicht nur zu behaupten, dass er vielleicht gar
nicht derjenige ist, der während der Olivenernte geschos
sen hatte. Er machte noch ein grundsätzlicheres Argument
geltend: Er sei nämlich nicht irgendein Hooligan, son
dern Recht und Ordnung in Person. Er hatte zwar keine
Uniform getragen, trat aber damals am Ort als das Haupt
der lokalen Siedlungswache auf, die zwar relativ autonom
operiert, aber der Armee angegliedert ist. Er war also kein
anonymer Krimineller, sondern den Soldaten gut bekannt
als derjenige, der für die Koordinierung von Sicherheits
fragen mit den lokalen Armeeeinheiten zuständig ist.
S.icherheit war seine Sache und er sei damals an die Stelle
gekommen, um Frieden wiederherzustellen. Er war eigent
lich der Einheimische; wären diese Unruhestifter, von
außen gekommen, um angeblich den Palästinensern zu
helfen, nicht dabei gewesen, hätte es keine Probleme mit
den Arabern gegeben. 'Die kennt er ja sehr gut.
Damit sollte unser Blick von den Beschränkungen
staatlicher Durchsetzungsfähigkeit im kolonialen Grenz-
' : ~'
. ;
~ ' '
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
raum hin zu der eigentlichen Allianz zwischen Staat und
Siedlern gelenkt werden. Macht - auch moderne Macht -
operiert hier mittels einer komplexen Arbeitsteilung zwi
schen staatlichen Organen und sozialen Bewegungen, den
Siedlergemeinden, ihren Vereinen sowie den ihnen nahe
stehenden Unternehmen. Es ist zweifelsohne eine kon
fliktreiche Kooperation, aber eine, die immerhin auch in
Krisenmomenten weiter besteht - man denke nur an die
enormen staatlichen Subventionen und die massiven In
vestitionen in der Infrastruktur der Siedlungen. Entgegen
einem Bild eines allmächtigen Staats, der die Bevölkerung
voll im Griff hat und ein Monopol der Gewaltausübung
besitzt, sind wir hier mit einer nicht weniger wirkungs
vollen Form von Herrschaft konfrontiert, in der die ko
loniale Dynamik eine enge Kooperation - und gelegent
lich sogar die Übertragung von Autorität - zwischen
Staat und >>Zivilgesellschaft<< erfordert. 12
Wie außergewöhnlich ist dies? Mag es sein, dass wir es
hier lediglich mit einem Grenzfall eines verbreiteten
Trends zu tun haben? NGOs (Non Governmental Orga
nizations) und GoNGOs (Governmental NGO's), private
Armeen, Sicherheitsunternehmen und protection brokers
als ökonomisch und politisch agierende Mitspieler, die in
enger Tuchfühlung mit politischen Organen operieren
und zuweilen sogar hoheitliche Funktionen ausüben, sind
nicht nur zwischen Israel und Palästina zu finden, sondern
auch anderswo in der Welt. In der Westbank selbst gibt es
vielleicht kein besseres Beispiel als der berühmt gewor-
r 2 Vgl. die Beobachtungen von Shalini Randeria, Zivilgesellschaft in postkolonialer Sicht, in: Jürgen Kocka, Paul N olte, Shalini Randeria und Sven Reichardt (Hgg.), Neu.es über Zivilgesellschaft. Aus historisch-sozialwissenschaflicl1em Blickwinkel, Berli112002, S. 81-103.
GADI ALGAZI
dene >Trennungszaun< - eigentlich ein ganzes System von
Zaunanlagen, Kontrollpunkten und Passierscheinen: vom
Staat angeblich aus Sicherheitsgründen unternommen
und finanziert, von privaten Bauunternehmen gebaut und
dabei durch schlechtbezahltes Sicherheitspersonal be
wacht, do·ch nach Fertigstellung als militärische Anlage
durch israelische Soldaten bemannt - bringt der Zaun
enorme Profite für die in den Kolonien tätigen Baukon
zerne, deren Immobilieninvestitionen er sichert. 1J
Wir brauchen uns keine Verschwörung zwischen Staat
und Siedlern vorzustellen. Sogar >objektive Komplizen
schaft<, um einen beliebten Ausdruck Pierre Bourdieus
zu gebrauchen, suggeriert zu viel und kann der Viel
schichtigkeit alltäglicher Situationen nicht gerecht wer
den. Denken Sie an die in der städtischen Sie·dlung Ariel
stationierten Polizisten, die es versäumten, eine ordent
liche Untersuchung im Fall der Schießerei während der
Olivenernte durchzuführen. Ich selbst habe sie nur ge
troffen, wenn ich verhaftet wurde oder wenn ich zum Re
vier kam, um zu helfen, andere Solidaritätsaktivisten aus
der Haft zu befreien. Viele von ihnen waren über die
Siedler tatsächlich empört: Sie hätten die Hooligans satt,
müssten anderes und wichtigeres tun, als auf den Hügeln
militanten jungen Siedlern, die in. kleine und große
Zwischenfälle involviert waren, nachzujagen.
Dabei handelt es sich um mehr als einen Sinn für Recht
und Ordnung oder den Frust der täglichen Polizeiarbeit.
Im Frühjahr 2001 befanden wir uns in einem militäri
schen Fahrzeug auf dem Weg zur Polizeistation in Ariel,
13 Vgl. Gadi Algazi, Kapital, Kolonialismus und ziviler Widerstand in der Westbank1 in: H istorische Anthropologie r 4 (2006), S. 441 -
456.
<
'
" <
' '
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
um verhört zu werden. Wir wurden verhaftet, weil wir
mit einer großen Gruppe die Belagerung des palästinen
sischen Dorfs Y assouf gebrochen hatten, um den Ein
wohnern Grundnahrungsmittel zu bringen, u.nd an einem
gemeinsamen Demonstrationszug durch das Dorf t·eil
nahmen, un1 gegen die Besatzung zu protestieren. Nun
fanden wir uns, ziemlich erschöpft, im Patrouillenfahr
zeug auf dem Weg nach Ariel.
Durch die Fenster des Fahrzeugs schauend, gab uns
einer der rangniederen Polizeioffiziere zu verstehen, dass
er mit den Kolonisten nicht unter einer Decke steckt:
>>Warum denkt ihr, dass ich unbedingt auf ihrer Seite
bin - nur deshalb, weil ich hier stationiert bin? Ich habe
anderes zu tun, als Siedler und Palästinenser voneinander
zu trennen. Habt ihr etwa überhaupt eine Vorstellung da
von, mit wie viel häuslicher Gewalt wir es hier zu tun
haben? << Und Geschichte, sagte er, liebt er übrigens auch.
Die in der Regel schlechtbezahlten Polizisten, oft orien
talischer Herkunft, wussten allzu gut, dass die radikalen
Siedler, die selbsternannten Vorkämpfer der Lander
lösung, auf sie herabschauen. Er zeigte auf die mit roten
Ziegelsteinen gedeckten Mittelstandshäuschen der Sied
lung: >> All diese Häuschen hier [ ... ] eines Tages werden
sie vielleicht alle den Palästinensern gehören <<, sagte er.
>> Die Jungs mit den Gewehren aus all den Sicherheits
organen werden sie wahrscheinlich unter sich teilen. << Er
überschätzte sicherlich die Erfolgschancen der Palästinen
ser: Es waren die ersten Monate des Zweiten Aufstands.
Vermutlich versu.chte er auch, etwas Gemeinsames mit
seinen ungewöhnlichen, wenn nicht merkwürdigen Häft
lingen zu finden, die, gab er zu, doch gar nicht gewaltsa1n
waren (im offiziellen Report sah das danach anders aus).
:.:.:···:·. ::·
GADI ALGAZI
Ich dachte mir aber, dass in seiner Aussag.e noch etwas
anderes mitklang: e·in Stück kaum verschleierter Identifi
kation mit diesen >Jungs mit Gewehren<, die eines Tag:es
die Beute unter sich teilen würden - st.att nur die Häus
chen zu bewachen, wie er es tun muss.
Drei Jahre später hatten wir wieder eine Auseinander-·
setzung in derselben Region, diesmal während der P.ro~
testkampagne gegen den Trennungszaun. Ein großer
Aufmarsch von Grenzpolizisten und Militärs blockierte
uns auf der Schnellstraße und hinderte uns dadurch da.r
an, unser Ziel zu erreichen - das Dorf Deir Ballout, in
dem wir an einem gemeinsamen israelisch~palästinensi
s-chen friedlichen Protestmarsch gegen den Zaun teilneh
men sollten, der drei relativ isolierte palästinensische
D·örfer in einer Enklave einzäunen sollte. Im Gegenzug
setzten sich die Aktivisten auf die Straße - eine dies.er
Schnellstraßen, die nur Siedlern und Soldaten vorbehal
ten s.ind und von Palästinensern gar n.icht befahren wer
.den düden - und blockierten den Verkehr der Siedler.
Nach einigen Schauern kalten Wassers und etwas Gewalt
seitens der So.nd·ereinheiten de.r Polizei ließen wir die bek.annten Rituale von V erhaftun.g und Registrierung im
Polizeirevier von Ariel über uns ergehen: Pitschnass im
Revierhof sitzen, auf die Strahlen der Wintersonne hof
fend, die Handys widerwillig abgeb·en (.diejenigen, die wir
nicht rechtzeitig verstecken konnten), warten., dass Fin
gerabdrücke genommen und die Verhörrunden be.ginnen
werd·en.
Mein Verhöroffizier schien seine Aufgabe ohne Enthusiasmus zu absolvieren. Als wir fertig waren, legte er
das Dos.sier zur Seite und schaute mich an. >>Gute Ant
worten<<, sagte er wie ein etwas verlegener Lehrer, der
330
„ "
.. !„ ·~ . : ~-
' '
. J.
,
. 1.
:: ·• '
:: ','
: .;
•· •·
)i:
. - '· . -, '·
" ; J.
;:·. ' ~:. . , :~.
' „ . ::
. ,}~· ~:::
,:~·
' ; .. - . . . ~ ' ~=~ ' '
: a::: .. . ·--- ·. . ···, ·.·
: itf • ' ~ ~ : i 1~.
; : :· ' : ' : ,;:::
. . . .·. : ' ·.::
' ~ .... ) :~~ : .::
. ' -- ~' j~ ;
• , .::::.:
• • ~r ' ' 1 ... . :.:•:· : .. .
: : ~
' '
SPERRZO NEN UND GRE'NZFÄLLE
realisiert, dass alle Schüler doch ihre Rolle zu gut kennen„
>>Eigentlich finde ich es richtig, was ihr da getan habt<<,
sagte er unerwartet zu mir. Ich habe mir seine Unter
schrift auf dem V erhörf ormular angesehen: er war al,so
Druse, gehörte zu der drusischen Minderheit unter den
arabischen Bürgern Israels, welche - anders als andere
arabische Bürger - zum Militärdiens.t eingezogen werden
(und deshalb für manche Zwecke als >wahre Israelis<
klassifiziert werden und eini:ge Vorrechte gegenüber an
deren arabischen Bürgern genießen), sie bleiben aber
nachdrücklich diskriminiert (und de-shalb für Rassisten
jeder Couleur schlichtweg >Araber<·).
Diese Fäll,e werden hier nicht zitiert, um die humane
Seite eines r·epressiven Systems zu exemplifizieren. We
der Polizisten wie der vorhin erwähnte noch drusische
Soldaten haben einen guten Ruf, wenn es um die Behand
lung von Palästinensern geht. Es ist kein Zufall, dass die
f rontpositionen des israelischen Kolonialismus - Grenz~
schutzpolizisten und rang.niedere Soldaten, welche täg
lich im Kontakt mit der unterworfenen palästinensischen
Bevölkerung stehen~ durch die Marginalisierten und Be
nachteiligten der israelischen Gesellschaft besetzt wer
den; Drusen, neue Immigranten aus Russland und Äthio~ pien und .orientalische Juden. Meine Pointe ist vielmehr,
dass ambivalente Positionen an den Rä:ndern der israe
lischen Gesellschaft und an ihren kolonialen Grenzrau -
men widersprüchliche und ambivalente Praktiken her
vorbringen.
Die drei Szenen sind als Gegenmitt.el zu einem Bild einer
homogenen und 'kohäsiven Staatsmaschinerie (man denke
an das Bild vom >apparat d'Etat<) gedacht und, konkreter,
um eine undifferenzierte Sicht der israelischen Gesell-
331
: .. :· :.:· . . . .
. ·:· . ..·
"
··.··
"
"
'"
',·
' ' .:.· " .:·.:
. . ;-~~ .::·
. . ~::: . . ..· ",
GADI ALGAZI
schaft in Frage zu stellen. Die gewaltsamen Siedler stan
den nicht einfach dem geordneten Staat gegenüber - und
die Polizisten und Soldaten gingen in ihm nicht voll auf,
als treue und blinde Vollstrecker seiner Politik. In beiden
Fällen - sowohl bei dem jüdischen Polizisten, der sich mit
den Waffentragenden der palästinensischen Gesellschaft
identifizieren konnte, die die Siedlerhäuschen nehmen
würden, als auch bei dem drusischen Polizeioffizier, dem
es so sehr daran lag, mir klarzumachen, dass er unseren
Widerstand gegen den Bau des Trennungszauns gerecht
fertigt fand - gingen Diskriminierung und Privileg, rela
tive Überlegenheit und ein wohlbegründetes Gefühl so
zialer Benachteiligung, Identifikation mit den Zielen des
Staats, Reserviertheit und Ambivalenz Hand in Hand.
IV.
Vom Bericht über Einzelfälle möchte ich nun zu einer
wiederholten Erfahrung kommen, die das Leben in der
Westbank seit den frühen neunziger Jahren tief geprägt
hat: der des Checkpoint. Ich habe Checkpoints nicht sel
ten beobachtet und zusammen mit Palästinensern über
quert, das heißt, ohne von dem privilegierten Zugang - in
manchen ausgebauten Checkpointanlagen existiert sogar
eine ganz getrennte, Siedlern und jüdischen Bürgern vor
behaltene Fahrspur - Gebrauch zu machen. Doch meine
Erfahrung als jüdischer Bürger Israels ist begrenzt und
gibt keineswegs die Erfahrung der Palästinenser wieder,
die unter dem Checkpoint-Regime leben. Die vielen
Checkpoints, die palästinensische Lokalitäten voneinan
der trennen, haben oft als zu ephemer gegolten, um ernst
genommen zu werden, aber sie dauern fort, vermehren
332
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
sich - im März 2007 zählte das UN Office f or the Co
ordination of Humanitarian Affairs in the Occupied Ter
ritories ( OCHA) 5 46 Straßensperren, Pforten und Check
points in der W estbank14 - und manche sind mittlerweile
zu Knotenpunkten des stetig ausgebauten Trennungs
zauns geworden. Sie sind oft als bloßes Menschenrechts
problem abgetan worden, als ein primitives Kontroll
instrument. Ich möchte vorschlagen, sie als ein zentrales
Element einer Form von Macht zu begreifen, die wir
ernst nehmen sollten. Ich werde versuchen, einige Fragen
zu stellen - sowohl über die Art von Macht, die im
Checkpoint-Regime verkörpert ist, als auch über die Er
fahrung, die mit ihr zusammenhängt. 1 5
Wie beschreibt man die Erfahrung, von einer Stimme
kontrolliert zu werd·en, die oft hinter einer Betonmauer
ertönt oder aus einer dunklen Kabine kommt? (Abb. r)
Manchmal siehst du kein Gesicht - nur eine Stimme, und
ein Gewehr. Diese Stimme hat einen sehr begrenzten
Wortschatz: >>Weitergehen! << , >>Stopp!<<, >> Umdrehen! <<,
>>Jacke ausziehen! <<, >>Links drehen, rechts drehen! << ,
>>Schnell weiter!<<, >>Alles auspacken! << (Abb. 2), >>Warten! <<,
14 Avi Issacharoff, World Bank Scolds Israel for Impeding T ravel in West Bank, in: Haaretz, 9. 5 .2007.
1 5 Einige wichtige Berichte: Azmi Bishara, Checkpoint. Ins Französische übersetzt von Rachid Akel, Arles 2004 ; Lia N irgad, Winter in Qualandia. Straßensperre zwischen Jerusalem und Ramallah. Ins D eutsche übersetzt von Abraham Melzer, Neu-Isenburg 200 5; siehe auch den D okumentarfilm: Y oav Shamir, C heckpoint (Israel 2003),
80 Min. Die hier abgedruckten Bilder machten Esther Tsal und Vera Reider, zwei Aktivistinnen von Machsom-Watch - Women for Human Rights, als teilnehmende Beobachterinnen am Checkp oint Beit Iba bei Nablus. Ich möchte ihnen herzlichen D ank aussprechen; ganz besonders danke ich Vera Reider und Snait Gissis für lehrreiche Gespräche.
333
GADI ALGAZI
oder: >>Schnell, schnell, weitergehen! <<, oder doch: >> Zu
rück, kein Durchgang. Heute ist zu!<<
Diese Stimme ist allmächtig und arbiträr (Abb. 3). Sie
kennt keinen Widerspruch, ihre Entscheidungen sind
endgültig. Protest wird oft umgehend bestraft: Stunden
lang am Straßenrand oder in den Feldern stehenzublei
ben, manchmal mit erhobenen Händen; gezwungen zu
werden, die Autoschlüssel, schlimmer noch - die Papiere
abzugeben (Abb. 4); vor allen Umstehenden, der ganzen
Checkpointgemeinschaft, die stundenlang wartet (es wird
gesprochen, gelacht, gespielt, gehandelt an dem Check
point), erniedrigt zu werden (Abb. 5 ). Nie werde ich den
blinden jungen Mann am Kalandya-Checkpoint verges
sen, im Frühjahr 2002, der auf dem Weg nach Jerusalem
von einem Verwandten begleitet wurde. Sie standen mit
ten im Niemandsland, die Menschenschlange hinter ih
nen, die zubetonierte Kabine vor ihnen, aus welcher die
Stimme kam. Der Verwandte wurde nicht zugelassen, er
wurde beordert, den Checkpoint zu verlassen; der Blinde
blieb allein stehen. Am Ende gab er auf und ging zurück.
Der Soldat am Checkpoint entscheidet, ob du nach
Hause kommen oder deine Tante besuchen kannst inner
halb von 20 Minute.n oder vier oder acht Stunden oder gar
nicht, ob du überhaupt deinen Arbeitsplatz erreichst, ob
eine schwangere Frau zum Geburtshaus gelangt, ob ein
Nierenkranker es rechtzeitig zur Dialyse schafft, ob die
Kinder zur ersten Schulstunde oder wieder nach Hause
kommen. Manchmal reicht es auch, wenn keiner da ist:
Das gelbe Tor am Zaun bleibt geschlossen, die Schulkin
der warten und gehen irgendwann nach Hause .. Oft legt
die Armee absichtlich Wert darauf, dass man nicht weiß,
womit man zu rechnen haben würde, wenn man am
334
SPERRZONEN UND Gl~ENZFÄLLE
Checkpoint ankommt. Hat man heute überhaupt ge
öffnet? Wenn du mit dieser Form von Macht konfrontiert
bist, plane nicht deinen Tag, versuch lieber nicht, genaue
Verabredungen zu treffen, einen Zeitplan zu haben. Du
solltest dich an einen Zustand gewöhnen, in dem du schier
nicht weiß, wie es weitergeht, ohne Vorhersehbarkeit.
Manchmal würdest du doch das Gesicht des Soldaten -
gelegentlich der Soldatin - sehen, vor allem in den kleine
ren, noch halb improvisierten Checkpoints (Abb. 6). Er
kennt dich und weiß nichts über dich. Er kennt dich, weil
Israel die ganze Westbank überwacht und ein breites
Netz von Spitzeln und Kollaborateuren operiert. Seine
Befehle sind definitiv, aber der Soldat weiß selbst nicht,
warum du nicht zugelassen wirst. Du magst zu einer der
Risikogruppen gehören - junge Männer etwa, oder Men
schen, deren V erwandre einer der palästinensischen politi
schen Gruppierungen angehören oder in bewaffnete Ak
tionen oder Attacken auf Zivilisten verwickelt sind. Oder
du stehst einfach auf seiner Liste oder im Bildschirm. Die
Listen sind lang; im Fall des Trennungszauns etwa wird
nur ein Bruchteil der Dorfbewohner zu den eigenen Fel
dern auf der anderen Seite des Zauns zugelassen. Aber
sonst entscheidet darüber dein vom Geheimdienst ange
fertigtes Dossier - und darin erhält der Soldat am Check
point keinen Einblick. Er ist allwissend und allmächtig
und weiß gleichzeitig nichts.
Wichtiger noch, er weiß nichts über dich als konkretes
soziales Wesen, über dein Leben, über die Gründe, war
um du deine Tante besuchen willst, wieso deine T achter
ebendort studiert, sonst hättest du ihn gar nicht belästi
gen müssen. Er versteht in der Regel l<ein Arabisch. Du
magst Papiere - Rezepte, Einladu.ngen, V orladu11gen, Bil-
335
GADI ALGAZI
der, Bestätigungen vor seiner Nase wedeln: Er kann da
mit nichts anfangen. Manchmal versucht er es schon.
Anders als andere Formen intrusiver Macht, die Ge
meinden kontrollieren, ignoriert diese Form von Macht
die Gesellschaft, die sie angreift. Früher kontrollierte die
israelische Besatzungsmacht jeden Aspekt des täglichen
Lebens in der Westbank und mischte sich massiv in das
Gewebe des sozialen Lebens ein. Wissen wurde geschickt
eingesetzt: Die Besatzungsmacht kontrollierte den Zu
gang zu Gesundheitsdiensten, erteilte Baugenehmigun
gen, spielte lokale Fraktionen im Dorf gegeneinander aus
und verteilte Privilegien in klassischer kolonialer Manier.
Anders das Checkpoint-Regime: Es erlaubt, die Bewegung
von Menschen und ihre Zugangsmöglichkeiten zu kon
trollieren, ohne in lokale Gemeinden einzudringen, ihr
Leben zu gestalten, und ohne jegliche Verantwortung für
die Folgen der eigenen Aktionen zu übernehmen. In die
sem Sinn, trotz effektiver Überwachung und strategische
Aufsicht, ist es blind. Was weiß schon ein Soldat oder seine
Vorgesetzten über die Folgen einer Straßensperre? Dieses
Regime lässt Menschen allein in ihrem Elend und zieht
die Fernsteuerung vor. Kontakt wird auf das Minimalste
reduziert; es ist auf gate-keeping und die Verwaltung von
Zäunen und Toren ausgerichtet. Es kann sich leisten, die
sozialen Konsequenzen der eigenen Politik zu vergessen,
und verstärkt unaufhörlich die gegenseitige Dämonisie
rung und Ignoranz (Abb. 7).
Denn es gibt eine enorme Distanz zwischen dieser
Macht und denen, die ihr unterstellt sind, auch wenn die
Soldaten am Checkpoint so nah sind, dass sie deinen Kör
per betasten und in deiner Tasche herumwühlen können.
Der Soldat am Checkpoint kennt deine Sprache nicht. Er
SPERRZONEN UND GRENZf'ÄLLE
ist oft auch nie an dem Ort gewesen, wo du herkommst.
r 9 Jahre alt, versteht er häufig nicht das familiäre Leid, die
Sorgen von Eltern. Da er dich und deine Kinder nicht
kennt, seid ihr für ihn eine Belästigung, unverständlich,
zu oft da, so dass er keine Ruhe hat, zt1 kurz da, um ihm
bekannt gent1g vorzukommen, damit man sich wiederer
kennt, kleine Keime von V orhersel1barkeit und Bere
chenbarkeit entstehen mögen (Abb. 8). Und vor allem;
Omnipotent wie er ist, in der Lage, über dein Schicksal
zu entscheiden, hat er oft Angst. Er ist r 9, vielleicht erst
20 Jahre alt, versteht deine Erklärungen nicht, aber weiß
über Angriffe und Selbstmordattacken gut Bescheid.
Dies ist keine providentielle Macht; sie ist fern von Bil
dern von allumfassender Regierung und Kontrolle, vo11
der Art Macht, die das Soziale neu zu gestalten und Sub
jekte umzubauen versucht. Ihre Eingriffe sind punktuell;
ihr Zugriff kurz und schmerzhaft, aber von weitreichen
den Folgen. Sie hat Übersicht, aber keine Umsicht.
Andere Formen von Macht - providentiell, scheinbar
rational, intrusiv und produktiv - sind nicht aus der Welt,
doch diejenige, die ich andeutungsweise skizziere, ge
winnt an Bedeutung. Wenn die Form von produktiver
Macht, die unter anderem von Michel Foucault diagnos
tiziert wurde, in der Tat bedeutsam mit der Entstehung
des modernen Kapitalismus zusammenhängt, so kann das
Checkpoint-Regime vielleicht mit der wachsenden Zahl
von Menschen in Beziehung gesetzt werden, die es nicht
mal wert sind, ausgebeutet zu werden, sogar nicht mal als
Konsumenten in Frage kommen und nur dadurch von
Belang werden, dass sie eine Gefahr darstellen könnten.
Die Logik dieser Macht heißt Containment, nicht Regie
rung. Ihre flüchtigen Subjekte - die sie ständig anderswo,
337
G ADI ALGAZI
Abb. 1: Beit Iba Checkpoint, ohne Datum. Photo: Esther Tsal. Quelle: Machsom-Watch Website: www.machsomwatch.org.
SPERRZO EN U D GRE ZFÄLLE
Abb. 2: Beit I ba Checkpoint, ohne Datum. Photo: Esther Tsal. Quelle: Machsom-Watch Website: www.machsomw atch. org.
339
GADI AL GAZI
Abb. 3: Beit Iba Checkpoint, ohne Datum. Photo: Esther Tsal. Quelle: Machsom-Watch Website: www.machsomwatch.org.
340
SPERRZONEN UND GRENZFÄLLE
Abb. 4: Beit Iba Checkpoint, Februar 2004. Photo: Vera
Reider.
341
GADI ALGAZI
„ • -. -
J
Abb. 5: Beit Jba Checkpoint, Februar 2004. Photo: Vera R eider.
342
SPERRZO E U D GRENZFÄLLE
Abb. 6: Beit Iba Checkpoint, Februar 2004. Photo: Vera R eider.
343
GADI ALGAZI
I
I
Abb. 7: Beit Jba Checkpoint, März 2004. Photo: Esther Tsal. Quelle: Machsom-Watch Website: W'[;)'[;).machsomwatch.org.
344
SPERRZO E . liND GRE ZI ÄLLE
Abb. 8 Beit lba Checkpoint, Februar 2004. Photo: Vera Reider.
345
GADI A~LGAZI
n1öglichst weit weg produziert - werden nicht auf ihre potentielle Produktivität hin wahrgenommen, sondern als Risikofaktor. In vielen Teilen der W elr macl1e11 Men~
sehen Erfahrungen mit dieser Form von Macht - eher für
kurze Zeit - an Eingängen und Tor,e.n, an Flughäfen und
Grenzen .-.. in anonymen und zerbrechlichen Zwischen-„
räumen. In der Westbank ist diese For1n von Macht allge-
genwärtig und hinterlässt ihre Spuren im Alltag von
Hunderttausenden. Welche Begriffe würden es erlauben, die tägliche Er
fahrung der Menschen, die mit dieser Form von Macht
konfrontiert sind, einzufangen ,~ omnipotent und arbi-,
trär, unsichtbar, allwissen,d und ignorant, zu fern für
menschliche Kommunikation, nah genug, um dich nackt ausziehen zu la,ssen? Wäre e,s nicht a,ngebracht und hilf
reich, über den Soldaten als eine kleine ver,borgene Gott
heit zu denken, die deine Bewegung kontrolliert, aber an
individueller Vorsehung nicht mehr interessiert ist, all
wissend, halbwissend und unberechenbar? Wären nicht
spezifische religiöse Semantiken di,e am meisten zugäng
lichen kulturellen Repertoires, u1n diese Erfahrung einzufangen -- wenn auch nicht zu erklären? Zugleich: Kolo
niale Grenzräume, scheinbar altmodische Machtformen,
sagen womöglich doch Wesentliches aus über moderne
Verhält11isse. Man könnte versuchen, vormoderne, früh-1noderne und moderne Erfahrungen mit arbitrarer Macht
und nichtstaatlicher Gewalt, mit merkwürdigen Staatsge
bilden und endemiscl1en Unsicherl1eiten, mit Hilflosig
keit und Mangel an Vorhersehbarkeit aufeinander zu be
ziehen - nicht um sie gleichzusetzen, sonder11 u1n sie
jeweils besser zu beleuchten. Vielleicht braucl1t man doch Historiker?
., , ..
. r
· ..
Über die Autorinnen und Autoren
G ADI A LGAZI ist Professor für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Tel Aviv und geschäftsführender Her
ausgeber der Zeitscl1rift History & Jvf emory. Seine For
schungsschwerpunkte sind Sozial- und Ku.lturgeschic.hte
des späten Mitte,lalters und der Frühen N euz.eit, Historiscl1e Anthropo,logie sowie die Geschichte u11d Theorie
der Sozialwissenschaften. Sein gegenwärtiges Forschu11gsproj ekt beha11delt gelehrte Lebensführungen zwischen
1400 und r6oo. Neuere Veröffentlichungen: >> Eine gelernte
Leben,sweise: Figurationen des Gelehrtenlebens zwischen
Mittelalter u11d Früher Neuzeit<<, in: Berichte zur \Klissen
schaftsgeschichte 30 (1007), S. 107-r r8; >> Making Invisible Movement Visible: Norbert Elias's Motion Pictures <<, in:
Studies in the History an.d Philosophy of Science ,(i1n Er
scheinen).
] ANE B uRBANK ist Professori11 für Geschichte und Russi
sche sowie Slawische Studien an der New York University. Ihre Forschu.ngen gelten den Korresp,onde,nzen und
Konflikten von Recht und politischen Praktiken i1n rus
sischen Reich* Derzeit ar,beitet sie, zusamme11 mit Fred-erick Cooper, a11 einer Studie zu Imp,erien in der Welt
geschichte. Neuere V eröff entlic.hungen: R ussian Empire: Space, Pe~ple, Power 1700-1930, hg. mit Mark von Hagen u11d Anatolyi Remnev, Bloomington 2007; >> An Imperial
Rights Regime: Law and Citizenship ii1 the Russia11 Em
pire<<, in: Kritika.: Explorations i,n Russian and Eurasian
History 7,3 (2006), S. 397-431; Russian Pe_asants G.o to Court: Legal Culture in the Countryside, 1905-1917,
Bloomington 2004 .
347
























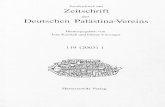




![Lippke (2012.1), Konkrete (S)Tiergestalt In Palästina/Israel [JNSL 28-1]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632078e6069357aa45063646/lippke-20121-konkrete-stiergestalt-in-palaestinaisrael-jnsl-28-1.jpg)










