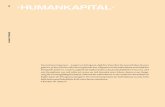Lernen und seine Körper. Habitusformungen und -umformungen in Bildungspraktiken
und Finanzzeitung
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of und Finanzzeitung
Han
dels
blat
t Gm
bH K
unde
nser
vice
Tel.
0211
887
360
2,
kund
ense
rvic
e@ha
ndel
sbla
tt.c
om
Mon
atsa
bonn
emen
t:
Han
dels
blat
t P
rint
: 66,
70 E
uro
Han
dels
blat
t P
rint
+ P
rem
ium
: 76,
69 E
uro
ww
w.h
ande
lsbl
att.
com
/ang
ebot
Bel
gien
, Lux
embu
rg, N
iede
rlan
de u
. Öst
erre
ich
3,70
€
/ 4,
00 €
, Fra
nkre
ich
4,10
€ /
4,5
0 €,
Gro
ßbri
tann
ien
3,70
GB
P /
4,00
GB
P, S
chw
eiz
5,50
CH
F /
6,00
CH
F,
Pole
n 20
,00
PLN
/ 2
2,50
PLN
G 02531 NR. 215 PR
EIS
4,00
€
Deutschlands Wirtschafts- und FinanzzeitungWOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021
VAU
DE,
GLS
/Pat
rick
Tie
dtke
, Car
o/O
berh
aeus
er, R
enat
o R
ibei
ro A
lves
, GR
OP
YUS,
Vol
ksw
agen
, San
dra
Steh
Pho
togr
aphy
/Vie
ssm
ann,
Die
tmar
Gus
t, E
urof
orum
, Shi
ftph
one,
KfW
, Tes
volt
, 2g
Ener
gy, P
lane
tly,
Cov
estr
o, M
ushl
ab, G
etty
Imag
es
iApps 155
Märkte
Dax16.024 Pkt.+0,40 %
MDax35.841 Pkt.+0,82 %
TecDax3.942 Pkt.+0,53 %
E-Stoxx 504.327 Pkt.+0,40 %
Dow Jones36.083 Pkt.-0,21 %
Nasdaq15.915 Pkt.+0,66 %
S&P 5004.667 Pkt.+0,14 %
Nikkei29.794 Pkt.+0,93 %
Euro/Dollar1,1551 US$-0,53 %
Gold1.793,40 US$+1,33 %
Öl82,11 US$+0,65 %
DaxGewinner
Zalando+4,59 %78,80 €
Dt. Post+3,19 %57,58 €
SiemensEnergy+2,75 %23,54 €
VerliererDt. Bank-3,55 %11,09 €
Heidelcement-2,79 %64,80 €
Brenntag-2,48 %82,70 €
Stand: 17:00 Uhr
ChinaDas Land entkoppelt
sich beim Datenschutz vom Rest der Welt.
Luftzerlegungs-anlage in Leuna: Die Linde-Sparte Clean Energy soll stark wachsen.
Lind
e A
G,
Bei ihren Verhandlungen zu einer Am-pelkoalition suchen SPD, FDP undGrüne nach Wegen, genügend Geldfür Investitionen aufzutreiben undgleichzeitig die Schuldenbremse ein-zuhalten. So könnte im kommendenJahr, in dem die Schuldenbremse letzt-malig wegen der Pandemie ausgesetztwerden soll, eine milliardenschwereRücklage im Energie- und Klimafondsangelegt werden. Aus dieser Reservewürden in den Folgejahren Investitio-nen finanziert. Die FDP lehnt den Planbisher ab. Zudem ist eine stärkere Nut-zung der KfW-Bank sowie anderer öf-fentlicher Unternehmen denkbar. Alsvierte Option ist ein Klimafonds aufEU-Ebene in der Diskussion. ► 9
Ampelkoalition
Schleichwege um die Schuldenbremse
Die VW-Betriebsratsvorsitzende Da-niela Cavallo hat die Betriebsversamm-lung in Wolfsburg für scharfe Angriffegegen Vorstandschef Herbert Diess ge-nutzt. „Inhaltlichen Unfug“ nannte Ca-vallo die Überlegungen von Diess,Zehntausende von Stellen in Deutsch-land zu streichen. Cavallo erhielt vonden Mitarbeitern stehende Ovatio-nen. Diess verteidigte sich und rech-nete vor, wie viel produktiver der US-Konkurrent Tesla in der Herstellungvon E-Autos sei: „Ja, ich mache mirSorgen um Wolfsburg! Wir dürfen unsunseren Standort nicht von Tesla ka-putt machen lassen!“ ► 20
Volkswagen
Streit bei Betriebsversammlung
Die US-Notenbank (Fed) hat am spä-ten Mittwoch ihre geldpolitische Wen-de eingeläutet – und die Börsen ange-trieben. Der US-Leitindex S&P 500setzte seine Serie mit Rekordanstiegenfort, und in Deutschland stellte der Daxmit 16.064 Punkten erstmals seit MitteAugust eine neue Bestmarke auf. Stra-tegen erklären dies damit, dass die Bör-sen jetzt mehr Klarheit haben. Die Fedbeginnt damit, ihre Anleihekäufe zu re-duzieren. Die Bank of England dagegenhielt überraschend an ihrem Leitzinsfest, die Märkte hatten eine Erhöhungerwartet. ► 30
Börsen
Fed versetzt Märkte in Rekordlaune
SWP
► 14 ► 38
Persönliche FinanzenZehn Tipps, mit denen sich die Steuer für 2021 jetzt noch senken lässt.
Literatur Acht unterschiedliche
Blicke auf das Klimaproblem.
► 62
► Fortsetzung auf Seite 6
Kirsten Westphal Die Wissenschaftlerin
über Energiewende und Geopolitik.
► 72
A ngesichts des steigenden Strombedarfs und der im-mer höheren Energiepreise wird in der Wirtschaft der Ruf nach einem Comeback der Kernkraft lauter. Steve Angel, der Chef des Linde-Konzerns, und sein
designierter Nachfolger Sanjiv Lamba sehen den deut-schen Atomausstieg als Fehler. „Wir werden einen Ener-giemix brauchen. Dazu gehört auch Atomkraft“, sagte Lamba im Gespräch mit dem Handelsblatt. Und Angel ergänzte: „Bill Gates hat zu 100 Prozent recht.“
Der Microsoft-Gründer hatte jüngst im Handelsblatt dafür plädiert, im Kampf gegen den Klimawandel auch auf Kernkraft zu setzen. Während in Deutschland die letzten Atomkraftwerke Ende 2022 vom Netz gehen, halten andere Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA an der Kernenergie fest oder bauen sie sogar aus. Viele Hoffnungen konzentrieren sich dabei auf so-genannte Minireaktoren. Experten rechnen allerdings nicht damit, dass die Technologie in den kommenden 15 Jahren für eine kommerzielle Anwendung taugt.
Die beiden Linde-Manager forderten zudem, stärker auf Gas als Brückentechnologie zu setzen. Lamba, der
am 1. März den CEO-Posten übernimmt, sagte mit Blick auf den CO2-Ausstoß: „Es würde für die Welt absolut Sinn ergeben, alle Kohlekraftwerke sofort zu schließen und durch Gaskraftwerke zu ersetzen.“
Bei Lindes Wachstumsplänen spielt der grüne Was-serstoff eine zentrale Rolle. Die Sparte Clean Energy kön-ne eines Tages mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes beisteuern, sagte Lamba. Aktuell sind es unter zehn Pro-zent. Kirsten Ludowig, Axel Höpner, Kathrin Witsch
Linde für AKW-ComebackDer Chef des Gaseherstellers und sein Nachfolger sind überzeugt: Die Welt
braucht Atomkraft. Für den Dax-Konzern haben sie große Wasserstoff-Pläne.
G 02531 NR. 215 Deutschlands Wirtschafts- und FinanzzeitungWOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021
In der neuen Bundesregie-rung wird es wohl kein ei-genständiges Digitalminis-terium geben. Das sagten mehrere mit den Verhand-lungen zur Bildung einer Ampelkoalition vertraute Personen dem Handelsblatt. Alternativ könnten in einem
bestehenden Ressort be-stimmte digitale Themen gebündelt werden. Für das Kanzleramt ist eine zentrale Koordinierungsfunktion im Gespräch. Die Digitalbran-che warnte, das Thema nur als Anhängsel zu betrachten. D. Neuerer, T. Stiens ► 8
Ampel nimmt Abschied von Digitalministerium
Die Digitalverbände reagieren enttäuscht auf den Verzicht.
Das Bundesgesundheits-ministerium hat 2019 und 2020 Zuwendungen von Unternehmen in Höhe von 131 Millionen Euro erhalten. Das geht aus dem Integri-tätsbericht der Bundesregie-rung hervor, der dem Han-delsblatt vorliegt.
Insgesamt stehen 27 Spenden mit einem Ge-samtwert von rund 61 Mil-lionen Euro im Zusammen-hang mit der Coronapande-mie. Größter Spender war demnach der Chemiekon-zern BASF. D. Delhaes, J. Klöck-ner ► 10
Millionenspenden für Spahns Ministerium
Die Zuwendungen kamen von Dutzenden Unternehmen.
Märkte
Dax16.024 Pkt.+0,40 %
MDax35.841 Pkt.+0,82 %
TecDax3.942 Pkt.+0,53 %
E-Stoxx 504.327 Pkt.+0,40 %
Dow Jones36.083 Pkt.-0,21 %
Nasdaq15.915 Pkt.+0,66 %
S&P 5004.667 Pkt.+0,14 %
Nikkei29.794 Pkt.+0,93 %
Euro/Dollar1,1551 US$-0,53 %
Gold1.793,40 US$+1,33 %
Öl82,11 US$+0,65 %
DaxGewinner
Zalando+4,59 %78,80 €
Dt. Post+3,19 %57,58 €
SiemensEnergy+2,75 %23,54 €
VerliererDt. Bank-3,55 %11,09 €
Heidelcement-2,79 %64,80 €
Brenntag-2,48 %82,70 €
Stand: 17:00 Uhr
ChinaDas Land entkoppelt
sich beim Datenschutz vom Rest der Welt.
Luftzerlegungs-anlage in Leuna: Die Linde-Sparte Clean Energy soll stark wachsen.
Lind
e A
G,
Bei ihren Verhandlungen zu einer Am-pelkoalition suchen SPD, FDP undGrüne nach Wegen, genügend Geldfür Investitionen aufzutreiben undgleichzeitig die Schuldenbremse ein-zuhalten. So könnte im kommendenJahr, in dem die Schuldenbremse letzt-malig wegen der Pandemie ausgesetztwerden soll, eine milliardenschwereRücklage im Energie- und Klimafondsangelegt werden. Aus dieser Reservewürden in den Folgejahren Investitio-nen finanziert. Die FDP lehnt den Planbisher ab. Zudem ist eine stärkere Nut-zung der KfW-Bank sowie anderer öf-fentlicher Unternehmen denkbar. Alsvierte Option ist ein Klimafonds aufEU-Ebene in der Diskussion. ► 9
Ampelkoalition
Schleichwege um die Schuldenbremse
Die VW-Betriebsratsvorsitzende Da-niela Cavallo hat die Betriebsversamm-lung in Wolfsburg für scharfe Angriffegegen Vorstandschef Herbert Diess ge-nutzt. „Inhaltlichen Unfug“ nannte Ca-vallo die Überlegungen von Diess,Zehntausende von Stellen in Deutsch-land zu streichen. Cavallo erhielt vonden Mitarbeitern stehende Ovatio-nen. Diess verteidigte sich und rech-nete vor, wie viel produktiver der US-Konkurrent Tesla in der Herstellungvon E-Autos sei: „Ja, ich mache mirSorgen um Wolfsburg! Wir dürfen unsunseren Standort nicht von Tesla ka-putt machen lassen!“ ► 20
Volkswagen
Streit bei Betriebsversammlung
Die US-Notenbank (Fed) hat am spä-ten Mittwoch ihre geldpolitische Wen-de eingeläutet – und die Börsen ange-trieben. Der US-Leitindex S&P 500setzte seine Serie mit Rekordanstiegenfort, und in Deutschland stellte der Daxmit 16.064 Punkten erstmals seit MitteAugust eine neue Bestmarke auf. Stra-tegen erklären dies damit, dass die Bör-sen jetzt mehr Klarheit haben. Die Fedbeginnt damit, ihre Anleihekäufe zu re-duzieren. Die Bank of England dagegenhielt überraschend an ihrem Leitzinsfest, die Märkte hatten eine Erhöhungerwartet. ► 30
Börsen
Fed versetzt Märkte in Rekordlaune
SWP
► 14 ► 38
Persönliche FinanzenZehn Tipps, mit denen sich die Steuer für 2021 jetzt noch senken lässt.
Literatur Acht unterschiedliche
Blicke auf das Klimaproblem.
► 62
► Fortsetzung auf Seite 6
Kirsten Westphal Die Wissenschaftlerin
über Energiewende und Geopolitik.
► 72
A ngesichts des steigenden Strombedarfs und der im-mer höheren Energiepreise wird in der Wirtschaft der Ruf nach einem Comeback der Kernkraft lauter. Steve Angel, der Chef des Linde-Konzerns, und sein
designierter Nachfolger Sanjiv Lamba sehen den deut-schen Atomausstieg als Fehler. „Wir werden einen Ener-giemix brauchen. Dazu gehört auch Atomkraft“, sagte Lamba im Gespräch mit dem Handelsblatt. Und Angel ergänzte: „Bill Gates hat zu 100 Prozent recht.“
Der Microsoft-Gründer hatte jüngst im Handelsblatt dafür plädiert, im Kampf gegen den Klimawandel auch auf Kernkraft zu setzen. Während in Deutschland die letzten Atomkraftwerke Ende 2022 vom Netz gehen, halten andere Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA an der Kernenergie fest oder bauen sie sogar aus. Viele Hoffnungen konzentrieren sich dabei auf so-genannte Minireaktoren. Experten rechnen allerdings nicht damit, dass die Technologie in den kommenden 15 Jahren für eine kommerzielle Anwendung taugt.
Die beiden Linde-Manager forderten zudem, stärker auf Gas als Brückentechnologie zu setzen. Lamba, der
am 1. März den CEO-Posten übernimmt, sagte mit Blick auf den CO2-Ausstoß: „Es würde für die Welt absolut Sinn ergeben, alle Kohlekraftwerke sofort zu schließen und durch Gaskraftwerke zu ersetzen.“
Bei Lindes Wachstumsplänen spielt der grüne Was-serstoff eine zentrale Rolle. Die Sparte Clean Energy kön-ne eines Tages mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes beisteuern, sagte Lamba. Aktuell sind es unter zehn Pro-zent. Kirsten Ludowig, Axel Höpner, Kathrin Witsch
Linde für AKW-ComebackDer Chef des Gaseherstellers und sein Nachfolger sind überzeugt: Die Welt
braucht Atomkraft. Für den Dax-Konzern haben sie große Wasserstoff-Pläne.
G 02531 NR. 215 Deutschlands Wirtschafts- und FinanzzeitungWOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021
In der neuen Bundesregie-rung wird es wohl kein ei-genständiges Digitalminis-terium geben. Das sagten mehrere mit den Verhand-lungen zur Bildung einer Ampelkoalition vertraute Personen dem Handelsblatt. Alternativ könnten in einem
bestehenden Ressort be-stimmte digitale Themen gebündelt werden. Für das Kanzleramt ist eine zentrale Koordinierungsfunktion im Gespräch. Die Digitalbran-che warnte, das Thema nur als Anhängsel zu betrachten. D. Neuerer, T. Stiens ► 8
Ampel nimmt Abschied von Digitalministerium
Die Digitalverbände reagieren enttäuscht auf den Verzicht.
Das Bundesgesundheits-ministerium hat 2019 und 2020 Zuwendungen von Unternehmen in Höhe von 131 Millionen Euro erhalten. Das geht aus dem Integri-tätsbericht der Bundesregie-rung hervor, der dem Han-delsblatt vorliegt.
Insgesamt stehen 27 Spenden mit einem Ge-samtwert von rund 61 Mil-lionen Euro im Zusammen-hang mit der Coronapande-mie. Größter Spender war demnach der Chemiekon-zern BASF. D. Delhaes, J. Klöck-ner ► 10
Millionenspenden für Spahns Ministerium
Die Zuwendungen kamen von Dutzenden Unternehmen.
PodcastHandelsblatt TodaySpaßwährung im Realitätscheck Der Meme-Coin Shiba Inu hat binnen eines Monats 900 Prozent an Wert ge -wonnen und gehört zu den zehn größten Cyberdevisen. Digitalexperte Alexander Braun macht den Realitätscheck.
dpa,
imag
o im
ages
/Jan
Hue
bner
, Blo
ombe
rg,
Wochenende
EssayWer, wenn nicht wir?Allen Protesten und Problemen zum Trotz: Deutschland hat das Know-how, die Köpfe und das Kapital, um zum Klima-Vorreiter zu werden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen mehr Mut und Tempo. � 46
KarriereGesucht – und nicht gefundenExperten verraten, was Hochqualifizierte diesen November bei der Jobsuche beach-ten müssen. � 60
LiteraturDie Geschichte unseres Überlebens Bücher über das Klima haben Konjunktur. Alle sind ein Appell, mehr zu tun. � 62
KunstmarktHistorische TragweiteFrankreich gibt 26 geraubte Kunstwerke an die Republik Benin zurück. � 64
NamensindexAhmed, Abiy ...............................19 Alex, Anna ...................................48 Alich, Pascal .........................47, 52 Altmaier, Peter ......................11, 18 Amann, Rupert ...........................57 Amer, Donya-Florence ................48 Andersson, Magdalena ..............15 Angel, Steve ..................................3 Appel, Frank ................................27 Baerbock, Annalena ...................71 Berg, Achim ..................................9 Bett, Andreas ..............................58 Biden, Joe .............................19, 72 Brockhagen, Dietrich .................49 Brown, Charles ...........................10 Campanella, Dominik ................55 Ching, Lynette ............................59 Dang, Matthias ...........................24 Diess, Herbert .............................19 Dodik, Milorad ............................19 Dubourg, Saori ...........................59 Esken, Saskia ..............................71 Ferkel, Hans ................................58 Franke, Benedikt ........................48 Fuhrmann, Markus .....................48 Gates, Bill ......................................3
Gottstein, Thomas ......................34 Graichen, Patrick .......................59 Grieder, Daniel ............................70 Grotholt, Christian .....................48 Grübler, Thomas .........................57 Günther, Regine .........................59 Habeck, Robert ...........................71 Haller, Franz ................................57 Hannemann, Daniel ...................58 Hastings, Reed ...........................24 Heilemann, Fabian .....................52 Heilemann, Ferry ........................52 Heitmann, Sebastian .................58 Hestvik, Line ...............................49 Hoppe-Ritter, Marli .....................49 Horta-Osório, António ................34 Jeromin, Kristina ........................50 Jorberg, Thomas ........................51 Klaus, Sascha .............................50 Kolb, Philipp ...............................49 Koopmann, Simon .....................56 Krishna, Arvind ...........................26 Kroetz, Philipp ............................70 Kroll, Christian ............................50 Lamba, Sanjiv ...............................3 Lang, Ricarda ..............................71 Lewis, Gary ...........................47, 52 Lindner, Christian ...................9, 71 Loeckel, Norman ........................10
Matthes, Felix .............................59 Mattil, Peter ................................33 Mauracher, Florian .....................57 Meyer, Robert .............................58 Milosevic, Slobodan ...................19 Nakladal, Janina .........................52 Nouripour, Omid .........................71 Peter, Patrick ..............................55 Popp, Michael .............................52 Prados, Cesar .............................55 Putin, Wladimir ..........................72 Rabe, Thomas .............................24 Rau, Thomas ...............................53 Riedel, Olaf .................................25 Riefler, Bernd ..............................25 Ritter, Alfred T. ............................49 Rizk, Mazen ................................53 Saharova, Daria ..........................50 Samaniego, Abel ........................56 Sauter, Claus ...............................57 Schäfer, Stephan ........................24 Schirp, Wolfgang ........................33 Schmidt, Sebastian-Justus ........55 Schneider, Reinhard ...................53 Scholz, Olaf ...................8, 9, 18, 71 Schönherr, Stefanie ....................53 Schrempp, Michael ....................50 Schuld, Michael ..........................25 Schwabe, Andreas ......................25
Schwind, Rolf .............................69 Semmelroch, Markus .................53 Sivaganeshamoorthy, G. ............56 Spahn, Jens ................................10 Speich, Ingo ................................54 Spenner, Leopold ........................58 Stoffers, Björn ............................57 Tappertzhofen, Thomas .............52 Trump, Donald ............................19 Viessmann, Max .........................54 Waldeck, Carsten .......................55 Waldeck, Samuel ........................55 Waldner, Michael ........................57 Wallner, Jürgen ...........................33 Wehlert, Petra .............................56 Wellendorff, Georg .....................68 Westphal, Kirsten .......................72 Wilhelm, Josef ............................54 Windhorst, Lars ..........................70 Wolzak, Sebastiaan ....................55 Wuttke, Jörg ...............................15
Unternehmensindex2G Energy ...................................48 Ace and Tate ...............................10 Alcemy ........................................58 Alibaba ........................................10 Allianz ....................................49, 70 Alstria Office ...............................37
Amazon .................................10, 24 Apple ...........................................10 Astra-Zeneca ...............................10 Atmosfair ....................................49 BASF ................................10, 22, 59 Berlin Hyp ...................................50 Bertelsmann ...............................24 Bionorica .....................................52 Bosch Climate Solutions ............48 Boston Consulting Group ..........25 Brookfield ...................................37 Celonis ........................................52 Circunomics ................................55 Commerzbank ............................56 Concular .....................................55 Covestro ......................................59 Credit Suisse ...............................34 Dabbel .........................................56 Deka ............................................35 Deka Investment ........................54 Deutsche Post ............................27 Disney .........................................24 dm ...............................................53 Ecosia ..........................................50 Elvah ............................................56 Enapter .......................................55 Envelio .........................................56 Eon ..............................................56
Evonik ..........................................22 Extantia .......................................58 EY ................................................25 Facebook ...............................10, 24 Fosun ...........................................10 Gilead Sciences ..........................10 GLS Bank ....................................51 Google ...................................10, 24 Gropyus .......................................48 Gruner + Jahr .............................24 Hannover Rück ...........................40 Henkel .........................................49 Hugo Boss ...................................70 IBM ..............................................26 KfW ..............................................56 Kyndryl ........................................26 Lake House .................................10 Lanxess .......................................22 Linde .............................................3 LinkedIn ......................................10 Madaster .....................................53 Mixteresting ................................57 Moderna .....................................23 Munich Re ..................................50 Mushlabs ....................................53 Netflix ..........................................24 Nexwafe ......................................58 Novartis .......................................10
Ororatech ....................................57
Pexapark .....................................57
Planetly .......................................48
Prezero ........................................52
Rapunzel Naturkost ...................54
Resourcify ...................................52
Ritter Sport .................................49
RTL ..............................................24
Schwarz-Gruppe .........................52
Schwind Eye-Tech-Solutions ......69
Shift .............................................55
SMS Group ..................................58
Strabag ........................................56
Talanx ..........................................40
Tennor Holding B.V. ....................70
Tesvolt .........................................58
Toyota ..........................................21
Twitter .........................................10
UDI ..............................................33
Verbio ..........................................57
Viessmann ..................................54
Volkswagen ...........................10, 19
Wellendorff .................................68
Werner & Mertz ..........................53
In dieser Ausgabe
FinanzenUnternehmenPolitik
KoalitionsverhandlungenDigitalministerium wird ad acta gelegt Aus den Gesprächen der Ampel-Parteien sickert durch, dass die Idee eines eigenen Digitalressorts verworfen werden soll. Zwei Alternativen sind nun im Gespräch der potenziellen Koalitionäre. � 8
Haushalt Die Ampel verspricht, genü-gend Geld für Investitionen aufzutreiben. Da hilft nur der Griff in die Trickkiste.� 9
Corona Ein Regierungsbericht listet Firmen-Spenden von mehr als 60 Millio-nen Euro an Ministerien auf. � 10
AdBlue Das Abgasreinigungsmittel wird knapp, Transporteure und die Landwirt-schaft schlagen Alarm. � 11
Chefökonom Bei den Koalitionsverhand-lungen droht der Blick für das Notwen-dige verloren zu gehen. � 12
China Die Staatsführung denkt beim Umgang mit Daten um. Das trifft beson-ders deren Transfer ins Ausland. � 14
Streit bei VolkswagenVW-Chef verteidigt Tesla-VergleicheDer Streit zwischen dem Betriebsrat und Herbert Diess gewinnt auch verbal an Schärfe. Auf einer Betriebsversammlung übt Betriebsratschefin Daniela Cavallo deutliche Kritik. � 20
Toyota Der weltgrößte Autohersteller profitiert vom Krisenmanagement und trotzt der Chipkrise. � 20
Lanxess, Evonik, BASF Chemiefirmen reagieren mit weiteren Preiserhöhungen auf teure Rohstoffe und Energie. � 22
Pharmabranche Der Schweizer Novartis-Konzern und Konkurrent Roche ent-flechten sich. � 23
Bertelsmann RTL + ist eine bislang ein - malige Medienplattform und ein ambitio-niertes Experiment des Konzerns. � 24
Kyndryl Ohne die Mutter IBM will sich das Unternehmen im Markt für IT-Dienst-leistungen emanzipieren. � 26
NotenbankentscheidungenGegenläufige SignaleDie US-Notenbank leitet die geldpolitische Wende ein, die Bank of England macht einen Rückzieher. Die Börsen reagieren überraschend. Der Dax steigt auf ein Rekordhoch. � 30
Opec Die Ölpreisrally wird zum geo-politischen Streitfall. Die Opec bleibt bei ihrer Förderpolitik. � 31
Commerzbank Das dritte Quartal war sehr stark. Nun rechnet das Institut fürs Gesamtjahr mit schwarzen Zahlen. � 32
Credit Suisse Die Großbank will künftig das Erfolgskonzept der UBS kopieren. Der personelle Neuanfang bleibt aus. � 34
Immobilien im Umland Dank hervor-ragender Infrastruktur ist das Düssel-dorfer Umland höchst beliebt. � 36
Steuern Zum Jahresende gilt es, wichtige Tipps zu berücksichtigen, um die Steuer-rückerstattung zu maximieren. � 38
Gastkommentar
Die Energietransformation wird nicht nur geopolitische Prozesse auslösen,
umgekehrt werden auch geopolitische Entwicklungen den Verlauf der
Transformation prägen. Kirsten Westphal
Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat
Notenbanken Bei Fed und EZB landen Probleme, die dort nicht hingehören. Es gibt zu viel Politik in der Geldpolitik – Zeit, sich von den Lasten zu befreien. � 18
Digitalministerium Die Zukunft scheint für Deutschland abgesagt. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. � 18
Volkswagen Der Vorstandsvorsitzende sollte statt Dauerprovokation auf Koope-ration mit dem Betriebsrat setzen. � 19
Prüfers Kolumne Im Niemandsland zwischen den Zeiten wäre es auch mög-lich, an den Renten zu sparen. � 19
Meinung & Analyse
� 48
Inhalt
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
PodcastHandelsblatt TodaySpaßwährung im Realitätscheck Der Meme-Coin Shiba Inu hat binnen eines Monats 900 Prozent an Wert ge -wonnen und gehört zu den zehn größten Cyberdevisen. Digitalexperte Alexander Braun macht den Realitätscheck.
dpa,
imag
o im
ages
/Jan
Hue
bner
, Blo
ombe
rg,
Wochenende
EssayWer, wenn nicht wir?Allen Protesten und Problemen zum Trotz: Deutschland hat das Know-how, die Köpfe und das Kapital, um zum Klima-Vorreiter zu werden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen mehr Mut und Tempo. � 46
KarriereGesucht – und nicht gefundenExperten verraten, was Hochqualifizierte diesen November bei der Jobsuche beach-ten müssen. � 60
LiteraturDie Geschichte unseres Überlebens Bücher über das Klima haben Konjunktur. Alle sind ein Appell, mehr zu tun. � 62
KunstmarktHistorische TragweiteFrankreich gibt 26 geraubte Kunstwerke an die Republik Benin zurück. � 64
NamensindexAhmed, Abiy ...............................19 Alex, Anna ...................................48 Alich, Pascal .........................47, 52 Altmaier, Peter ......................11, 18 Amann, Rupert ...........................57 Amer, Donya-Florence ................48 Andersson, Magdalena ..............15 Angel, Steve ..................................3 Appel, Frank ................................27 Baerbock, Annalena ...................71 Berg, Achim ..................................9 Bett, Andreas ..............................58 Biden, Joe .............................19, 72 Brockhagen, Dietrich .................49 Brown, Charles ...........................10 Campanella, Dominik ................55 Ching, Lynette ............................59 Dang, Matthias ...........................24 Diess, Herbert .............................19 Dodik, Milorad ............................19 Dubourg, Saori ...........................59 Esken, Saskia ..............................71 Ferkel, Hans ................................58 Franke, Benedikt ........................48 Fuhrmann, Markus .....................48 Gates, Bill ......................................3
Gottstein, Thomas ......................34 Graichen, Patrick .......................59 Grieder, Daniel ............................70 Grotholt, Christian .....................48 Grübler, Thomas .........................57 Günther, Regine .........................59 Habeck, Robert ...........................71 Haller, Franz ................................57 Hannemann, Daniel ...................58 Hastings, Reed ...........................24 Heilemann, Fabian .....................52 Heilemann, Ferry ........................52 Heitmann, Sebastian .................58 Hestvik, Line ...............................49 Hoppe-Ritter, Marli .....................49 Horta-Osório, António ................34 Jeromin, Kristina ........................50 Jorberg, Thomas ........................51 Klaus, Sascha .............................50 Kolb, Philipp ...............................49 Koopmann, Simon .....................56 Krishna, Arvind ...........................26 Kroetz, Philipp ............................70 Kroll, Christian ............................50 Lamba, Sanjiv ...............................3 Lang, Ricarda ..............................71 Lewis, Gary ...........................47, 52 Lindner, Christian ...................9, 71 Loeckel, Norman ........................10
Matthes, Felix .............................59 Mattil, Peter ................................33 Mauracher, Florian .....................57 Meyer, Robert .............................58 Milosevic, Slobodan ...................19 Nakladal, Janina .........................52 Nouripour, Omid .........................71 Peter, Patrick ..............................55 Popp, Michael .............................52 Prados, Cesar .............................55 Putin, Wladimir ..........................72 Rabe, Thomas .............................24 Rau, Thomas ...............................53 Riedel, Olaf .................................25 Riefler, Bernd ..............................25 Ritter, Alfred T. ............................49 Rizk, Mazen ................................53 Saharova, Daria ..........................50 Samaniego, Abel ........................56 Sauter, Claus ...............................57 Schäfer, Stephan ........................24 Schirp, Wolfgang ........................33 Schmidt, Sebastian-Justus ........55 Schneider, Reinhard ...................53 Scholz, Olaf ...................8, 9, 18, 71 Schönherr, Stefanie ....................53 Schrempp, Michael ....................50 Schuld, Michael ..........................25 Schwabe, Andreas ......................25
Schwind, Rolf .............................69 Semmelroch, Markus .................53 Sivaganeshamoorthy, G. ............56 Spahn, Jens ................................10 Speich, Ingo ................................54 Spenner, Leopold ........................58 Stoffers, Björn ............................57 Tappertzhofen, Thomas .............52 Trump, Donald ............................19 Viessmann, Max .........................54 Waldeck, Carsten .......................55 Waldeck, Samuel ........................55 Waldner, Michael ........................57 Wallner, Jürgen ...........................33 Wehlert, Petra .............................56 Wellendorff, Georg .....................68 Westphal, Kirsten .......................72 Wilhelm, Josef ............................54 Windhorst, Lars ..........................70 Wolzak, Sebastiaan ....................55 Wuttke, Jörg ...............................15
Unternehmensindex2G Energy ...................................48 Ace and Tate ...............................10 Alcemy ........................................58 Alibaba ........................................10 Allianz ....................................49, 70 Alstria Office ...............................37
Amazon .................................10, 24 Apple ...........................................10 Astra-Zeneca ...............................10 Atmosfair ....................................49 BASF ................................10, 22, 59 Berlin Hyp ...................................50 Bertelsmann ...............................24 Bionorica .....................................52 Bosch Climate Solutions ............48 Boston Consulting Group ..........25 Brookfield ...................................37 Celonis ........................................52 Circunomics ................................55 Commerzbank ............................56 Concular .....................................55 Covestro ......................................59 Credit Suisse ...............................34 Dabbel .........................................56 Deka ............................................35 Deka Investment ........................54 Deutsche Post ............................27 Disney .........................................24 dm ...............................................53 Ecosia ..........................................50 Elvah ............................................56 Enapter .......................................55 Envelio .........................................56 Eon ..............................................56
Evonik ..........................................22 Extantia .......................................58 EY ................................................25 Facebook ...............................10, 24 Fosun ...........................................10 Gilead Sciences ..........................10 GLS Bank ....................................51 Google ...................................10, 24 Gropyus .......................................48 Gruner + Jahr .............................24 Hannover Rück ...........................40 Henkel .........................................49 Hugo Boss ...................................70 IBM ..............................................26 KfW ..............................................56 Kyndryl ........................................26 Lake House .................................10 Lanxess .......................................22 Linde .............................................3 LinkedIn ......................................10 Madaster .....................................53 Mixteresting ................................57 Moderna .....................................23 Munich Re ..................................50 Mushlabs ....................................53 Netflix ..........................................24 Nexwafe ......................................58 Novartis .......................................10
Ororatech ....................................57
Pexapark .....................................57
Planetly .......................................48
Prezero ........................................52
Rapunzel Naturkost ...................54
Resourcify ...................................52
Ritter Sport .................................49
RTL ..............................................24
Schwarz-Gruppe .........................52
Schwind Eye-Tech-Solutions ......69
Shift .............................................55
SMS Group ..................................58
Strabag ........................................56
Talanx ..........................................40
Tennor Holding B.V. ....................70
Tesvolt .........................................58
Toyota ..........................................21
Twitter .........................................10
UDI ..............................................33
Verbio ..........................................57
Viessmann ..................................54
Volkswagen ...........................10, 19
Wellendorff .................................68
Werner & Mertz ..........................53
In dieser Ausgabe
FinanzenUnternehmenPolitik
KoalitionsverhandlungenDigitalministerium wird ad acta gelegt Aus den Gesprächen der Ampel-Parteien sickert durch, dass die Idee eines eigenen Digitalressorts verworfen werden soll. Zwei Alternativen sind nun im Gespräch der potenziellen Koalitionäre. � 8
Haushalt Die Ampel verspricht, genü-gend Geld für Investitionen aufzutreiben. Da hilft nur der Griff in die Trickkiste.� 9
Corona Ein Regierungsbericht listet Firmen-Spenden von mehr als 60 Millio-nen Euro an Ministerien auf. � 10
AdBlue Das Abgasreinigungsmittel wird knapp, Transporteure und die Landwirt-schaft schlagen Alarm. � 11
Chefökonom Bei den Koalitionsverhand-lungen droht der Blick für das Notwen-dige verloren zu gehen. � 12
China Die Staatsführung denkt beim Umgang mit Daten um. Das trifft beson-ders deren Transfer ins Ausland. � 14
Streit bei VolkswagenVW-Chef verteidigt Tesla-VergleicheDer Streit zwischen dem Betriebsrat und Herbert Diess gewinnt auch verbal an Schärfe. Auf einer Betriebsversammlung übt Betriebsratschefin Daniela Cavallo deutliche Kritik. � 20
Toyota Der weltgrößte Autohersteller profitiert vom Krisenmanagement und trotzt der Chipkrise. � 20
Lanxess, Evonik, BASF Chemiefirmen reagieren mit weiteren Preiserhöhungen auf teure Rohstoffe und Energie. � 22
Pharmabranche Der Schweizer Novartis-Konzern und Konkurrent Roche ent-flechten sich. � 23
Bertelsmann RTL + ist eine bislang ein - malige Medienplattform und ein ambitio-niertes Experiment des Konzerns. � 24
Kyndryl Ohne die Mutter IBM will sich das Unternehmen im Markt für IT-Dienst-leistungen emanzipieren. � 26
NotenbankentscheidungenGegenläufige SignaleDie US-Notenbank leitet die geldpolitische Wende ein, die Bank of England macht einen Rückzieher. Die Börsen reagieren überraschend. Der Dax steigt auf ein Rekordhoch. � 30
Opec Die Ölpreisrally wird zum geo-politischen Streitfall. Die Opec bleibt bei ihrer Förderpolitik. � 31
Commerzbank Das dritte Quartal war sehr stark. Nun rechnet das Institut fürs Gesamtjahr mit schwarzen Zahlen. � 32
Credit Suisse Die Großbank will künftig das Erfolgskonzept der UBS kopieren. Der personelle Neuanfang bleibt aus. � 34
Immobilien im Umland Dank hervor-ragender Infrastruktur ist das Düssel-dorfer Umland höchst beliebt. � 36
Steuern Zum Jahresende gilt es, wichtige Tipps zu berücksichtigen, um die Steuer-rückerstattung zu maximieren. � 38
Gastkommentar
Die Energietransformation wird nicht nur geopolitische Prozesse auslösen,
umgekehrt werden auch geopolitische Entwicklungen den Verlauf der
Transformation prägen. Kirsten Westphal
Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat
Notenbanken Bei Fed und EZB landen Probleme, die dort nicht hingehören. Es gibt zu viel Politik in der Geldpolitik – Zeit, sich von den Lasten zu befreien. � 18
Digitalministerium Die Zukunft scheint für Deutschland abgesagt. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. � 18
Volkswagen Der Vorstandsvorsitzende sollte statt Dauerprovokation auf Koope-ration mit dem Betriebsrat setzen. � 19
Prüfers Kolumne Im Niemandsland zwischen den Zeiten wäre es auch mög-lich, an den Renten zu sparen. � 19
Meinung & Analyse
� 48
Inhalt
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Steve Angel: Wird Chef des Verwaltungsrats.
Mon
ika
Höf
ler
für
Han
dels
blat
t [M
]
Nach einer Bewährungszeit als Chief Operating Officer wird Sanjiv Lamba am 1. März neu-er Linde-CEO. Amtsinhaber Steve Angel wechselt dann an die Spitze des Verwaltungs-
rats. In ihrem ersten Interview nach der Personalentscheidung sprechen die bei-den über den Energiemix der Zukunft, ihre Wachstumsstrategie und die He-rausforderung China.
Herr Angel, Sie haben die Margen immer weiter verbessert, selbst in der Pandemie. Aber man kann die Kosten nicht endlos drücken. Braucht Linde unter Ihrem Nachfol-ger jetzt eine Wachstumsstory?Angel: Zuerst einmal müssen Sie se-hen, dass wir schneller gewachsen sind als unser Hauptwettbewerber. Zugleich haben wir auch Kosten gesenkt. Wich-tig ist, dass Sie beides tun.
Aber was wird nach der Ära Angel nun die Lamba-Story?Lamba: Die Lamba-Story ist die Linde-Story und insofern ganz einfach eine Fortsetzung. Wir haben eine klare Vi-sion: Wir wollen weiterhin die beste In-dustriegase- und Anlagenbaufirma der Welt sein. Da geht es nicht nur um Um-satz und Margen.
Sondern um was noch?Lamba: Uns sind alle Stakeholder-Gruppen gleich wichtig. Nehmen Sie etwa die Communities: Während der Pandemie waren etwa 40.000 Linde-Mitarbeiter, also 60 Prozent unserer Belegschaft, jeden Tag unterwegs, um zu Patienten nach Hause zu gehen oder die Krankenhäuser mit Gesundheits-gasen zu versorgen. Das macht uns aus.
Das große Zukunftsfeld soll aber Clean Energy, also saubere Energie,
sein. Herr Angel, Sie wollen den Umsatz mit Wasserstoff von zwei auf acht Milliarden Dollar steigern. Die Welt giert nach Wasserstoff, ist die Prognose nicht arg konservativ?Angel: Unsere Ankündigung ist deut-lich aggressiver als alles, was andere sich vorgenommen haben. Zum Schluss ist die alles entscheidende Frage doch, wie schnell sich der Markt entwickelt. Das Potenzial ist auf jeden Fall riesig. Wenn nur ein Prozent der Lastwagen weltweit auf Wasserstoff umgestellt wird, ist das ein 20-Milliarden-Dollar-Markt. Damit allein kann unser Geschäft viel größer werden als acht Milliarden. Aber dafür müssen die Kosten für grünen Wasser-stoff runter und es braucht die entspre-chenden Weichenstellungen und die Unterstützung der Politik.
In welcher Form?
Steve Angel und Sanjiv Lamba im Interview
„Wir brauchen die Atomkraft“
Der Linde-CEO und sein designierter Nachfolger sehen den deutschen Atomausstieg als Fehler an. Sie fordern zudem einen raschen Umstieg von Kohle
auf Gas. Für den Konzern haben sie große Wasserstoff-Pläne.
Nur wenige Unternehmen sind in der Industrie weltweit so eng vernetzt wie Linde. Industriegase werden in der Produktion bei sehr vielen Prozes-sen eingesetzt, zum Beispiel in der Chemieindus-trie und bei den Autobauern. Schon deshalb hat es Gewicht, wenn die Führungsspitze des zweit-wertvollsten Dax-Konzerns ein Plädoyer für die Kernenergie und für Gaskraftwerke abgibt. In der Öffentlichkeit müsse derzeit alles grün sein, sagte Linde-CEO Steve Angel dem Handelsblatt. Doch wenn er mit Industriemanagern spreche, sei allen klar, dass man auch Gas brauche.
Auch beim Ruf nach Kernenergie stehen die Linde-Manager nicht allein da. Es gibt eine Reihe von Managern, die glauben, dass der wachsende Strombedarf in den kommenden Jahren nicht al-lein durch erneuerbare Energien gedeckt werden wird können.
So sprach sich Ex-BASF-Chef Jürgen Ham-brecht vor wenigen Tagen für eine Laufzeitverlän-gerung der sechs verbliebenen deutschen Atom-kraftwerke aus. Wenn Deutschland wie geplant Ende des kommenden Jahre aus der Kernenergie aussteige und früher als 2038 aus der Kohleverstro-mung, komme die Energieversorgung in Deutsch-land „schnell an Grenzen“, sagte er in einem In-terview mit der Onlineausgabe des Magazins „Ci-cero“. Man brauche „eine Rückfalloption, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint“.
Auch VW-Chef Herbert Diess hatte bereits vor zwei Jahren gesagt: „Um das Klima zu schüt-zen, sollte Deutschland zuerst aus der Kohlever-stromung aussteigen und dann erst aus der Atom-energie.“ Ähnlich sah das Linde-Verwaltungsrats-chef Wolfgang Reitzle. Er plädierte in der Vergangenheit dafür, die Kernenergie solle Be-standteil der deutschen Energiepolitik bleiben.
Doch in der Wirtschaft gibt es auch viele skep-tische Stimmen. Die Atomkraftkonzerne wie RWE, Eon und Co. selbst haben solchen Gedan-kenspielen aber immer wieder eine Absage erteilt.
Auch bei Siemens Energy rechnet man nicht mit einem AKW-Comeback in Deutschland. „De Atomausstieg ist in vollem Gange, das Thema ist politisch entschieden“, sagte Vorstand Jochen Eickholt. Man solle sich besser darauf konzentrie-ren, „den Ausbau erneuerbarer Energien voran-zutreiben und uns auch mit Transferlösungen wie Gas zu beschäftigen“. Axel Höpner, Kathrin Witsch
Linde für AKW-Come back
► Fortsetzung von Seite 3
Primärenergieverbrauch in Deutschland2020, Anteil der Energieträger
in Prozent
*Rundungsdifferenzen möglichQuelle: Statistisches BundesumweltamtHANDELSBLATT
Energiemix
Mineralöl
Gase
Erneuerbare Energien
Steinkohle
Braunkohle
Kernenergie
Sonstige
34
27
17
8
8
6
1
%
%
%
%
%
%
%
Thema des Tages
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Angel: Wir brauchen einerseits Anreize für die Umstellung auf saubere Energie und andererseits Sanktionen – zum Beispiel in Form von CO2-Bepreisung. Wenn die Tonne CO2 100 Dollar kos-tet, dann muss jede Firma umdenken. Deutschland ist auf diesem Weg ein-deutig weiter als die USA.
Wie lang wird es dauern, bis Was-serstoff den Durchbruch schafft?Angel: Bis Mitte der Dekade werden wir schon, das ist für mich der Tipping Point, große Fortschritte sehen. In den folgenden zehn Jahren, also bis 2035, wird der Markt um ein Vielfaches grö-ßer sein als heute. Aber wir haben noch viel zu tun. Nehmen Sie nur das Bei-spiel von Langstrecken-Trucks. Wenn Daimler mit seinen neuen Modellen auf den Markt kommt, kann das der Durchbruch sein.
Wie groß kann das Geschäft mit Clean Energy für Linde werden? Aktuell sind es weniger als zehn Prozent des Umsatzes. Kann es eines Tages die Hälfte sein?Lamba: Ja. Eines Tages sicherlich. 2050 kann der Markt für Wasserstoff zwi-schen 150 Milliarden und einer Billion Dollar groß sein.
Wann genau könnte Clean Energy die Hälfte des Umsatzes beisteu-ern?Lamba: Von Steve habe ich eines ge-lernt: Gib ein Ziel vor, aber nenne kein Datum!
Haben Sie alle Expertise für das Wasserstoffzeitalter im Haus oder sehen Sie sich nach Zukäufen um?
Lamba: Linde hat eine einzigartige Po-sitionierung, weil wir jeden Aspekt der Wertschöpfungskette abdecken kön-nen. Wir haben jede Technologie im Haus, niemand auf der Welt hat in Sa-chen Wasserstoff diese technologischen Fähigkeiten.
Ist das im Aktienkurs eingepreist?Angel: Das ist schwer zu beurteilen. Wir glauben, dass wir jedes Jahr den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft zweistellig steigern können. Die Was-serstoff-Chancen kommen obendrauf.
Ist Wasserstoff das neue Öl?Angel: Nehmen wir einmal Südkorea, das Land, das Wasserstoff am aggres-sivsten vorantreibt. Dort sollen 40.000 Brennstoffzellen-Busse bis 2040 auf der Straße sein. Das ersetzt Dieselkraft-stoff. Ähnlich sieht es bei Schwerlast-wagen und Schiffen aus. Daher kann man schon sagen: Wasserstoff hat das Zeug dazu, ja.
Wird Wasserstoff reichen? Wir haben gerade mit Bill Gates gespro-chen. Er sagt, die Welt wird neue Atomkraftwerke brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.Angel: Bill Gates hat zu 100 Prozent recht: Wir brauchen die Atomkraft, denn sie kann effizient und klimaneu-tral die Grundlast für die Stromnetze stellen. Es wird enorm teuer, wenn wir auf einen Schlag komplett auf erneuer-bare Energien umstellen wollen. Jeder will saubere Energie – aber alle wollen auch zu vertretbaren Preisen immer ge-nug Strom haben, damit das Licht geht und die Maschinen laufen. Solarkraft und Windenergie sind aber sehr volatil, das macht die Energie dann teuer.
War also der deutsche Atomaus-stieg ein Fehler, Herr Lamba?Lamba: Wie Steve richtig sagt, wir wer-den einen Energiemix brauchen. Dazu gehört auch Atomkraft. Bill Gates un-terstützt die Idee klei-ner, effizienter Atom-kraftwerke. Wir beob-achten das sehr genau. Vielleicht wird das für die Menschen ein ak-zeptabler Weg mit kleineren Risiken.
Also ja?Lamba: Ja, der deut-sche Atomausstieg war sicherlich nicht genial.
Gerade läuft der Klimagipfel in Glasgow. Wo sehen Sie die Schwie-rigkeiten beim globalen Klima-schutz?Angel: Vieles hängt von China ab. Das Land plant sechsmal so viele neue Koh-lekraftwerke, wie es insgesamt in Deutschland gibt. Solar, Wind und Wasserstoff werden zwar ebenfalls ge-fördert, aber die Wirtschaft in den meis-ten Provinzen hängt nach wie vor an der Kohle. Wenn China entscheidet, die Kohlekraftwerke nicht runterzufah-ren, ist alles, was der Rest der Welt macht, zwar nicht völlig umsonst, aber auf jeden Fall zu wenig.Lamba: Es ist ja nicht alles per se schlecht, was CO2 ausstößt: Ein mo-dernes Gaskraftwerk stößt ungefähr die Hälfte der Emissionen eines Koh-lekraftwerks aus. Insofern würde es für die Welt absolut Sinn ergeben, alle Kohlekraftwerke sofort zu schließen
und durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
Wenn Gas als Zwischenschritt der größte Hebel ist, warum reden alle nur von grünem Wasserstoff?Angel: In der öffentlichen Meinung ist eben alles auf das Ziel gerichtet, dass alles grün sein sollte. Doch wenn ich mit Industriemanagern spreche, ist al-len klar, dass wir auch Gas brauchen.
Chinas Kurs ist schwer abzuschät-zen. Das macht die Geschäfte dort schwierig, oder?Angel: Es gab auch bei uns verschie-dentlich Produktions-unterbrechungen we-gen fehlendem Strom, auch bei Kunden. Aber insgesamt fühlen wir uns wohl mit un-serer Position in Chi-na. Wir produzieren lokal für lokale Kun-den. So sind wir von der Unterbrechung der Lieferketten in der Re-gion nicht so stark be-troffen. Es gibt große Wachstumschancen für uns in China. Das Land ist fest ent-schlossen, eine Halbleiterindustrie auf-zubauen, da werden unsere Gase ge-braucht.
Aber wohin bewegt sich China, Herr Lamba? Die Führung tritt zunehmend autoritär auf, auch der Wirtschaft gegenüber.Lamba: China ist engstens mit der Weltwirtschaft vernetzt und wird sich deshalb nicht isolieren. Zweifellos steuert die Regierung die Wirtschaft über eine Art Soft Power, geht dabei aber behutsam vor. Klar ist, dass China auf lange Sicht weiter wachsen wird, auch unterstützt durch die demogra-fische Entwicklung.Angel: Alle großen Konzerne müssen
in China präsent sein. Der Markt ist zu groß, um ihn zu ignorieren. Man sollte anpas-sungsfähig sein und so versteht es sich von selbst, dass unsere Or-ganisation dort aus-schließlich chinesische Mitarbeiter hat …Lamba: … und zudem profitieren wir als Lin-de von unserer deut-
schen DNA, die seit Jahrzehnten in China sehr respektiert ist.
Die Spannungen zwischen China und den USA wachsen. Manche sprechen schon von einem neuen kalten Krieg.Angel: Das größte Risiko wäre ein mi-litärischer Konflikt zwischen den USA und China. Man kann sich streiten, aber man sollte sich immer zusam-mensetzen und den Konflikt lösen. Die wirklich spannende Frage ist, was pas-sieren würde, wenn China nach Tai-wan greifen würde. Taiwan ist nicht in der Nato, es gibt keine Beistands-pflicht. Die USA haben gesagt, dass sie die Verteidigung Taiwans zwar unter-stützen, nicht aber, dass sie Taiwan verteidigen. China wäre gut beraten, keine rote Linie zu überschreiten, son-dern eher behutsam vorzugehen. Aber Regierungen sind manchmal unbe-rechenbar.
Die Lage in der Weltwirtschaft ist ja fast schon paradox. Es gibt große Nachfrage, die aber wegen Materi-alknappheit und Logistikproblemen kaum bedient werden kann.Angel: Ja, und die Probleme in den glo-balen Lieferketten werden wohl noch bis in die zweite Hälfte 2022 anhalten.
Aktuell steigen überall die Preise. Wird Inflation ein nachhaltiges Problem für Linde?Angel: Linde kann gestiegene Kosten meist sofort an die Kunden weiterge-ben. Das ist das Besondere an unserem
Geschäftsmodell.
Und wird Inflation für die Welt ein Problem?Angel: Auf längere Sicht ja. Solange die Nachfrage höher ist als das Angebot, bleibt die Inflation hoch. Und so-lange so viel billiges Geld unterwegs ist, erst recht.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde glaubt ja, dass die Inflation ein vorübergehendes Phänomen ist.Lamba: Da muss ich Christine Lagarde und auch der US-Notenbank wider-sprechen. Die Inflation wird nicht mor-gen verschwinden, sondern uns nocheine Weile begleiten.
Da sind Sie einer Meinung. Was passiert bei Linde, wenn Sie einmal unterschiedlicher Meinung sind? Herr Angel, Sie wechseln direkt an die Spitze des „Aufsichtsrats“. In Deutschland wäre eine zweijährige Cooling-off-Phase notwendig. Besteht die Gefahr, Herr Lamba, dass er Ihnen reingrätscht?Lamba: Ich bin ja schon seit Jahresbe-ginn Chief Operating Officer und konn-te seither das Geschäft mit großer Un-abhängigkeit führen. Was sollte sich al-so ändern … Vom Cooling-off bin ich ohnehin nicht überzeugt. In der Rück-schau zeigt sich ganz klar, dass das Coo-ling-off von Wolfgang Reitzle nicht gut für die Linde AG war …Angel: Das war deutlich. Schauen Sie, Sanjiv und ich arbeiten super zusam-men und haben Spaß. Ins Tages-geschäft werde ich mich bestimmt nicht einmischen.
Sie beide sind sehr hungrig nach Erfolg. Liegt das vielleicht an Ihren Wurzeln? Sie, Herr Angel, waren der Erste in der Familie, der stu-diert hat. Herr Lamba kommt auch nicht aus dem klassischen west-lichen Establishment.Lamba: Ich stamme aus einer Militär-Familie in Indien, da bin ich mit meiner Unternehmenslaufbahn die Ausnahme. Hungrig sein ist ja vor allem eine Frage des Charakters und woran man glaubt …Angel: Ganz genau, ich habe mich stets angestrengt und daran gearbeitet, mich zu verbessern. Ich bin eben von Natur aus auf Wettbewerb gepolt.
Herr Angel, Herr Lamba, vielen Dank für das Interview.
Die Fragen stellten Axel Höpner und Kirsten Ludowig
Sanjiv Lamba: Wird im März
2022 neuer CEO von Linde.
Lind
e A
G
VitaeSteve Angel ist Bauingenieur. Er arbeitete 22 Jahre bei General Electric, ehe er 2001 bei Praxair anfing. Nach sechs Jahren wurde er Chef des später mit Linde fusionierten Unternehmens.
Sanjiv Lamba startete seine Karriere 1989 bei BOC. Nach der Übernahme durch Linde baute er das Asiengeschäft aus. Seit der Fusion mit Praxair war er COO. Am 1. März wird er CEO.
Der Konzern Linde plc ist aus der Fusion von Linde und Praxair zum weltgrößten Gasehersteller hervorgegangen. 2020 sanken die Umsätze leicht auf 27,2 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn stieg von 2,9 auf 3,3 Milliarden Dollar.
Alle großen Konzer-ne müssen in China
präsent sein.
Steve AngelCEO Linde
2050 kann der Markt für Wasserstoff zwi-schen 150 Milliarden
und einer Billion Dol-lar groß sein.
Sanjiv LambaChief Operating Officer Linde
Thema des Tages
7WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Steve Angel: Wird Chef des Verwaltungsrats.
Mon
ika
Höf
ler
für
Han
dels
blat
t [M
]
Nach einer Bewährungszeit als Chief Operating Officer wird Sanjiv Lamba am 1. März neu-er Linde-CEO. Amtsinhaber Steve Angel wechselt dann an die Spitze des Verwaltungs-
rats. In ihrem ersten Interview nach der Personalentscheidung sprechen die bei-den über den Energiemix der Zukunft, ihre Wachstumsstrategie und die He-rausforderung China.
Herr Angel, Sie haben die Margen immer weiter verbessert, selbst in der Pandemie. Aber man kann die Kosten nicht endlos drücken. Braucht Linde unter Ihrem Nachfol-ger jetzt eine Wachstumsstory?Angel: Zuerst einmal müssen Sie se-hen, dass wir schneller gewachsen sind als unser Hauptwettbewerber. Zugleich haben wir auch Kosten gesenkt. Wich-tig ist, dass Sie beides tun.
Aber was wird nach der Ära Angel nun die Lamba-Story?Lamba: Die Lamba-Story ist die Linde-Story und insofern ganz einfach eine Fortsetzung. Wir haben eine klare Vi-sion: Wir wollen weiterhin die beste In-dustriegase- und Anlagenbaufirma der Welt sein. Da geht es nicht nur um Um-satz und Margen.
Sondern um was noch?Lamba: Uns sind alle Stakeholder-Gruppen gleich wichtig. Nehmen Sie etwa die Communities: Während der Pandemie waren etwa 40.000 Linde-Mitarbeiter, also 60 Prozent unserer Belegschaft, jeden Tag unterwegs, um zu Patienten nach Hause zu gehen oder die Krankenhäuser mit Gesundheits-gasen zu versorgen. Das macht uns aus.
Das große Zukunftsfeld soll aber Clean Energy, also saubere Energie,
sein. Herr Angel, Sie wollen den Umsatz mit Wasserstoff von zwei auf acht Milliarden Dollar steigern. Die Welt giert nach Wasserstoff, ist die Prognose nicht arg konservativ?Angel: Unsere Ankündigung ist deut-lich aggressiver als alles, was andere sich vorgenommen haben. Zum Schluss ist die alles entscheidende Frage doch, wie schnell sich der Markt entwickelt. Das Potenzial ist auf jeden Fall riesig. Wenn nur ein Prozent der Lastwagen weltweit auf Wasserstoff umgestellt wird, ist das ein 20-Milliarden-Dollar-Markt. Damit allein kann unser Geschäft viel größer werden als acht Milliarden. Aber dafür müssen die Kosten für grünen Wasser-stoff runter und es braucht die entspre-chenden Weichenstellungen und die Unterstützung der Politik.
In welcher Form?
Steve Angel und Sanjiv Lamba im Interview
„Wir brauchen die Atomkraft“
Der Linde-CEO und sein designierter Nachfolger sehen den deutschen Atomausstieg als Fehler an. Sie fordern zudem einen raschen Umstieg von Kohle
auf Gas. Für den Konzern haben sie große Wasserstoff-Pläne.
Nur wenige Unternehmen sind in der Industrie weltweit so eng vernetzt wie Linde. Industriegase werden in der Produktion bei sehr vielen Prozes-sen eingesetzt, zum Beispiel in der Chemieindus-trie und bei den Autobauern. Schon deshalb hat es Gewicht, wenn die Führungsspitze des zweit-wertvollsten Dax-Konzerns ein Plädoyer für die Kernenergie und für Gaskraftwerke abgibt. In der Öffentlichkeit müsse derzeit alles grün sein, sagte Linde-CEO Steve Angel dem Handelsblatt. Doch wenn er mit Industriemanagern spreche, sei allen klar, dass man auch Gas brauche.
Auch beim Ruf nach Kernenergie stehen die Linde-Manager nicht allein da. Es gibt eine Reihe von Managern, die glauben, dass der wachsende Strombedarf in den kommenden Jahren nicht al-lein durch erneuerbare Energien gedeckt werden wird können.
So sprach sich Ex-BASF-Chef Jürgen Ham-brecht vor wenigen Tagen für eine Laufzeitverlän-gerung der sechs verbliebenen deutschen Atom-kraftwerke aus. Wenn Deutschland wie geplant Ende des kommenden Jahre aus der Kernenergie aussteige und früher als 2038 aus der Kohleverstro-mung, komme die Energieversorgung in Deutsch-land „schnell an Grenzen“, sagte er in einem In-terview mit der Onlineausgabe des Magazins „Ci-cero“. Man brauche „eine Rückfalloption, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint“.
Auch VW-Chef Herbert Diess hatte bereits vor zwei Jahren gesagt: „Um das Klima zu schüt-zen, sollte Deutschland zuerst aus der Kohlever-stromung aussteigen und dann erst aus der Atom-energie.“ Ähnlich sah das Linde-Verwaltungsrats-chef Wolfgang Reitzle. Er plädierte in der Vergangenheit dafür, die Kernenergie solle Be-standteil der deutschen Energiepolitik bleiben.
Doch in der Wirtschaft gibt es auch viele skep-tische Stimmen. Die Atomkraftkonzerne wie RWE, Eon und Co. selbst haben solchen Gedan-kenspielen aber immer wieder eine Absage erteilt.
Auch bei Siemens Energy rechnet man nicht mit einem AKW-Comeback in Deutschland. „De Atomausstieg ist in vollem Gange, das Thema ist politisch entschieden“, sagte Vorstand Jochen Eickholt. Man solle sich besser darauf konzentrie-ren, „den Ausbau erneuerbarer Energien voran-zutreiben und uns auch mit Transferlösungen wie Gas zu beschäftigen“. Axel Höpner, Kathrin Witsch
Linde für AKW-Come back
► Fortsetzung von Seite 3
Primärenergieverbrauch in Deutschland2020, Anteil der Energieträger
in Prozent
*Rundungsdifferenzen möglichQuelle: Statistisches BundesumweltamtHANDELSBLATT
Energiemix
Mineralöl
Gase
Erneuerbare Energien
Steinkohle
Braunkohle
Kernenergie
Sonstige
34
27
17
8
8
6
1
%
%
%
%
%
%
%
Thema des Tages
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Angel: Wir brauchen einerseits Anreize für die Umstellung auf saubere Energie und andererseits Sanktionen – zum Beispiel in Form von CO2-Bepreisung. Wenn die Tonne CO2 100 Dollar kos-tet, dann muss jede Firma umdenken. Deutschland ist auf diesem Weg ein-deutig weiter als die USA.
Wie lang wird es dauern, bis Was-serstoff den Durchbruch schafft?Angel: Bis Mitte der Dekade werden wir schon, das ist für mich der Tipping Point, große Fortschritte sehen. In den folgenden zehn Jahren, also bis 2035, wird der Markt um ein Vielfaches grö-ßer sein als heute. Aber wir haben noch viel zu tun. Nehmen Sie nur das Bei-spiel von Langstrecken-Trucks. Wenn Daimler mit seinen neuen Modellen auf den Markt kommt, kann das der Durchbruch sein.
Wie groß kann das Geschäft mit Clean Energy für Linde werden? Aktuell sind es weniger als zehn Prozent des Umsatzes. Kann es eines Tages die Hälfte sein?Lamba: Ja. Eines Tages sicherlich. 2050 kann der Markt für Wasserstoff zwi-schen 150 Milliarden und einer Billion Dollar groß sein.
Wann genau könnte Clean Energy die Hälfte des Umsatzes beisteu-ern?Lamba: Von Steve habe ich eines ge-lernt: Gib ein Ziel vor, aber nenne kein Datum!
Haben Sie alle Expertise für das Wasserstoffzeitalter im Haus oder sehen Sie sich nach Zukäufen um?
Lamba: Linde hat eine einzigartige Po-sitionierung, weil wir jeden Aspekt der Wertschöpfungskette abdecken kön-nen. Wir haben jede Technologie im Haus, niemand auf der Welt hat in Sa-chen Wasserstoff diese technologischen Fähigkeiten.
Ist das im Aktienkurs eingepreist?Angel: Das ist schwer zu beurteilen. Wir glauben, dass wir jedes Jahr den Gewinn pro Aktie im Kerngeschäft zweistellig steigern können. Die Was-serstoff-Chancen kommen obendrauf.
Ist Wasserstoff das neue Öl?Angel: Nehmen wir einmal Südkorea, das Land, das Wasserstoff am aggres-sivsten vorantreibt. Dort sollen 40.000 Brennstoffzellen-Busse bis 2040 auf der Straße sein. Das ersetzt Dieselkraft-stoff. Ähnlich sieht es bei Schwerlast-wagen und Schiffen aus. Daher kann man schon sagen: Wasserstoff hat das Zeug dazu, ja.
Wird Wasserstoff reichen? Wir haben gerade mit Bill Gates gespro-chen. Er sagt, die Welt wird neue Atomkraftwerke brauchen, um die Klimaziele zu erreichen.Angel: Bill Gates hat zu 100 Prozent recht: Wir brauchen die Atomkraft, denn sie kann effizient und klimaneu-tral die Grundlast für die Stromnetze stellen. Es wird enorm teuer, wenn wir auf einen Schlag komplett auf erneuer-bare Energien umstellen wollen. Jeder will saubere Energie – aber alle wollen auch zu vertretbaren Preisen immer ge-nug Strom haben, damit das Licht geht und die Maschinen laufen. Solarkraft und Windenergie sind aber sehr volatil, das macht die Energie dann teuer.
War also der deutsche Atomaus-stieg ein Fehler, Herr Lamba?Lamba: Wie Steve richtig sagt, wir wer-den einen Energiemix brauchen. Dazu gehört auch Atomkraft. Bill Gates un-terstützt die Idee klei-ner, effizienter Atom-kraftwerke. Wir beob-achten das sehr genau. Vielleicht wird das für die Menschen ein ak-zeptabler Weg mit kleineren Risiken.
Also ja?Lamba: Ja, der deut-sche Atomausstieg war sicherlich nicht genial.
Gerade läuft der Klimagipfel in Glasgow. Wo sehen Sie die Schwie-rigkeiten beim globalen Klima-schutz?Angel: Vieles hängt von China ab. Das Land plant sechsmal so viele neue Koh-lekraftwerke, wie es insgesamt in Deutschland gibt. Solar, Wind und Wasserstoff werden zwar ebenfalls ge-fördert, aber die Wirtschaft in den meis-ten Provinzen hängt nach wie vor an der Kohle. Wenn China entscheidet, die Kohlekraftwerke nicht runterzufah-ren, ist alles, was der Rest der Welt macht, zwar nicht völlig umsonst, aber auf jeden Fall zu wenig.Lamba: Es ist ja nicht alles per se schlecht, was CO2 ausstößt: Ein mo-dernes Gaskraftwerk stößt ungefähr die Hälfte der Emissionen eines Koh-lekraftwerks aus. Insofern würde es für die Welt absolut Sinn ergeben, alle Kohlekraftwerke sofort zu schließen
und durch Gaskraftwerke zu ersetzen. Das wäre schon mal ein erster Schritt.
Wenn Gas als Zwischenschritt der größte Hebel ist, warum reden alle nur von grünem Wasserstoff?Angel: In der öffentlichen Meinung ist eben alles auf das Ziel gerichtet, dass alles grün sein sollte. Doch wenn ich mit Industriemanagern spreche, ist al-len klar, dass wir auch Gas brauchen.
Chinas Kurs ist schwer abzuschät-zen. Das macht die Geschäfte dort schwierig, oder?Angel: Es gab auch bei uns verschie-dentlich Produktions-unterbrechungen we-gen fehlendem Strom, auch bei Kunden. Aber insgesamt fühlen wir uns wohl mit un-serer Position in Chi-na. Wir produzieren lokal für lokale Kun-den. So sind wir von der Unterbrechung der Lieferketten in der Re-gion nicht so stark be-troffen. Es gibt große Wachstumschancen für uns in China. Das Land ist fest ent-schlossen, eine Halbleiterindustrie auf-zubauen, da werden unsere Gase ge-braucht.
Aber wohin bewegt sich China, Herr Lamba? Die Führung tritt zunehmend autoritär auf, auch der Wirtschaft gegenüber.Lamba: China ist engstens mit der Weltwirtschaft vernetzt und wird sich deshalb nicht isolieren. Zweifellos steuert die Regierung die Wirtschaft über eine Art Soft Power, geht dabei aber behutsam vor. Klar ist, dass China auf lange Sicht weiter wachsen wird, auch unterstützt durch die demogra-fische Entwicklung.Angel: Alle großen Konzerne müssen
in China präsent sein. Der Markt ist zu groß, um ihn zu ignorieren. Man sollte anpas-sungsfähig sein und so versteht es sich von selbst, dass unsere Or-ganisation dort aus-schließlich chinesische Mitarbeiter hat …Lamba: … und zudem profitieren wir als Lin-de von unserer deut-
schen DNA, die seit Jahrzehnten in China sehr respektiert ist.
Die Spannungen zwischen China und den USA wachsen. Manche sprechen schon von einem neuen kalten Krieg.Angel: Das größte Risiko wäre ein mi-litärischer Konflikt zwischen den USA und China. Man kann sich streiten, aber man sollte sich immer zusam-mensetzen und den Konflikt lösen. Die wirklich spannende Frage ist, was pas-sieren würde, wenn China nach Tai-wan greifen würde. Taiwan ist nicht in der Nato, es gibt keine Beistands-pflicht. Die USA haben gesagt, dass sie die Verteidigung Taiwans zwar unter-stützen, nicht aber, dass sie Taiwan verteidigen. China wäre gut beraten, keine rote Linie zu überschreiten, son-dern eher behutsam vorzugehen. Aber Regierungen sind manchmal unbe-rechenbar.
Die Lage in der Weltwirtschaft ist ja fast schon paradox. Es gibt große Nachfrage, die aber wegen Materi-alknappheit und Logistikproblemen kaum bedient werden kann.Angel: Ja, und die Probleme in den glo-balen Lieferketten werden wohl noch bis in die zweite Hälfte 2022 anhalten.
Aktuell steigen überall die Preise. Wird Inflation ein nachhaltiges Problem für Linde?Angel: Linde kann gestiegene Kosten meist sofort an die Kunden weiterge-ben. Das ist das Besondere an unserem
Geschäftsmodell.
Und wird Inflation für die Welt ein Problem?Angel: Auf längere Sicht ja. Solange die Nachfrage höher ist als das Angebot, bleibt die Inflation hoch. Und so-lange so viel billiges Geld unterwegs ist, erst recht.
EZB-Präsidentin Christine Lagarde glaubt ja, dass die Inflation ein vorübergehendes Phänomen ist.Lamba: Da muss ich Christine Lagarde und auch der US-Notenbank wider-sprechen. Die Inflation wird nicht mor-gen verschwinden, sondern uns nocheine Weile begleiten.
Da sind Sie einer Meinung. Was passiert bei Linde, wenn Sie einmal unterschiedlicher Meinung sind? Herr Angel, Sie wechseln direkt an die Spitze des „Aufsichtsrats“. In Deutschland wäre eine zweijährige Cooling-off-Phase notwendig. Besteht die Gefahr, Herr Lamba, dass er Ihnen reingrätscht?Lamba: Ich bin ja schon seit Jahresbe-ginn Chief Operating Officer und konn-te seither das Geschäft mit großer Un-abhängigkeit führen. Was sollte sich al-so ändern … Vom Cooling-off bin ich ohnehin nicht überzeugt. In der Rück-schau zeigt sich ganz klar, dass das Coo-ling-off von Wolfgang Reitzle nicht gut für die Linde AG war …Angel: Das war deutlich. Schauen Sie, Sanjiv und ich arbeiten super zusam-men und haben Spaß. Ins Tages-geschäft werde ich mich bestimmt nicht einmischen.
Sie beide sind sehr hungrig nach Erfolg. Liegt das vielleicht an Ihren Wurzeln? Sie, Herr Angel, waren der Erste in der Familie, der stu-diert hat. Herr Lamba kommt auch nicht aus dem klassischen west-lichen Establishment.Lamba: Ich stamme aus einer Militär-Familie in Indien, da bin ich mit meiner Unternehmenslaufbahn die Ausnahme. Hungrig sein ist ja vor allem eine Frage des Charakters und woran man glaubt …Angel: Ganz genau, ich habe mich stets angestrengt und daran gearbeitet, mich zu verbessern. Ich bin eben von Natur aus auf Wettbewerb gepolt.
Herr Angel, Herr Lamba, vielen Dank für das Interview.
Die Fragen stellten Axel Höpner und Kirsten Ludowig
Sanjiv Lamba: Wird im März
2022 neuer CEO von Linde.
Lind
e A
G
VitaeSteve Angel ist Bauingenieur. Er arbeitete 22 Jahre bei General Electric, ehe er 2001 bei Praxair anfing. Nach sechs Jahren wurde er Chef des später mit Linde fusionierten Unternehmens.
Sanjiv Lamba startete seine Karriere 1989 bei BOC. Nach der Übernahme durch Linde baute er das Asiengeschäft aus. Seit der Fusion mit Praxair war er COO. Am 1. März wird er CEO.
Der Konzern Linde plc ist aus der Fusion von Linde und Praxair zum weltgrößten Gasehersteller hervorgegangen. 2020 sanken die Umsätze leicht auf 27,2 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn stieg von 2,9 auf 3,3 Milliarden Dollar.
Alle großen Konzer-ne müssen in China
präsent sein.
Steve AngelCEO Linde
2050 kann der Markt für Wasserstoff zwi-schen 150 Milliarden
und einer Billion Dol-lar groß sein.
Sanjiv LambaChief Operating Officer Linde
Thema des Tages
7WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Dietmar Neuerer, Teresa Stiens Berlin
Die FDP wollte es, die Digitalverbände wollten es, und auch die allermeisten Deutschen hielten es für eine gute Idee: ein eigenes Ministerium für digitale An-gelegenheiten. Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom vom September
dieses Jahres sprachen sich 71 Prozent der Befrag-ten für ein eigenes Digitalressort aus.
Von der FDP hieß es im Wahlkampf: „Ein Di-gitalisierungsministerium muss Tempo machen.“ Parteichef Christian Lindner war ein persönlicher Verfechter des Ansatzes, um von überholten Praktiken wie dem Faxen und der Rohrpost weg-zukommen, wie er im Bundestag und bei seinen Wahlkampfauftritten immer wieder betonte.
Doch jetzt, wo es an der Zeit wäre, diese Idee auch zu verwirklichen, wird klar: In der neuen Bundesregierung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach kein eigenständiges Digitalministerium ge-ben. Das sagten mehrere mit den Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition vertraute Per-sonen dem Handelsblatt.
Die FDP, die als einzige der drei Ampelpartei-en ein solches Ressort ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben hat, befinde sich mit ihrer Forderung „auf dem Rückzug“, sagte ein Unterhändler.
Während der Gespräche in der Facharbeits-gruppe hätten die Liberalen teilweise den Ein-druck erweckt, sie müssten nur Digitalressort sa-gen und alle Bälle rollten auf sie zu, sagte ein an-derer Insider. Inzwischen setzt sich allerdings auch bei der FDP laut Handelsblatt-Informationen die Einsicht durch, dass der Aufbau eines neuen Mi-nisteriums das Tempo bei der Digitalisierung eher bremsen als forcieren würde.
Das Problem: Ein eigenes Digitalministerium würde einen zu großen organisatorischen und personellen Umbau mit sich bringen. Räumlich-keiten in Berlin Mitte für ein neues Bundesminis-terium zu finden sei extrem schwierig. Außer-dem müsste eine große fachliche Restrukturie-rung mit der Schaffung einer neuen Behörde einhergehen und andere Ressorts einen personel-len Aderlass hinnehmen, lautet die Einschätzung in FDP-Kreisen.
Außerdem ist die Digitalisierung ein klassi-sches Querschnittsthema. Von Unterhändlern der SPD heißt es deshalb, es sei offenkundig, dass schon jetzt in allen Ministerien Digitalisierungs-projekte verfolgt würden, die sich jedoch nicht einfach in einem einzelnen Ressort bündeln lie-ßen, ohne einen Kompetenzverlust zu riskieren.
So gebe es „keine klare Logik“, weshalb zum Beispiel das Gesundheitsministerium plötzlich nicht mehr für das Projekt der elektronischen Pa-tientenakte zuständig sein solle.
Denkbar wäre dem Vernehmen nach aber, ein bestehendes Ministerium mit der Zuständigkeit für Digitales aufzuwerten und darin bestimmte Themen zu bündeln. Als Vorbild könne etwa Nordrhein-Westfalen dienen, sagte ein Insider.
Dort gibt es ein Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Das Res-sort wird aktuell vom FDP-Politiker Andreas Pinkwart geführt, der die Ampel im Bund in der digitalen Facharbeitsgruppe mitverhandelt.
Denkbar wäre außerdem, einen künftigen Di-gitalstaatsminister im Kanzleramt zu stärken. Ein Unterhändler sprach von der Möglichkeit, einen „Bundesminister mit besonderen Aufgaben“ ein-zusetzen. Dieser könne mit einem „agilen Team“ die Federführung bei digitalen Kernprojekten
übernehmen, hätte Koordinierungsrechte gegen-über anderen Ressorts, müsse für seine Aufgabe dann aber auch auf die Expertise der bestehenden Digitalabteilungen der Abteilung 6 im Kanzleramt zugreifen können.
Das entspräche in etwa der Vorstellung vor allem der SPD. Kanzlerkandidat Olaf Scholz stand der Idee, ein neues Digitalministerium aufzubau-en, schon im Wahlkampf skeptisch gegenüber. Die Digitalisierung solle stattdessen „Chefsache sein“, also im Kanzleramt gebündelt werden, sagte er im Sommer bei einer Handelsblatt-Veranstal-tung. Er könne sich vorstellen, einen „Chief Di-gital Officer“ im Bundeskanzleramt zu installieren. Es brauche jemanden in der Position mit einem tiefen Verständnis von neuen Technologien.
Als „Bundesminister mit besonderen Auf-gaben“ im Kanzleramt fungiert heute schon Helge Braun (CDU). Der geschäftsführende Chef des Bundeskanzleramts hat nach Ansicht der Ampel-verhandler seine Rolle beim Thema Digitalisie-rung nur unzureichend ausgefüllt.
Koalitionsgespräche
Digitalministerium zu den Akten gelegt
Aus den Verhandlungen der Ampelparteien sickert durch, dass die Idee eines eigenen Digitalressorts verworfen werden soll. Alternativen sind im Gespräch.
China
Japan
Bosnien-Herzegowina
Italien
Südkorea
Deutschland
Alle Befragten
18- bis 29-Jährige
30- bis 49-Jährige
50- bis 64-Jährige
Ab 65-Jährige
71 %
79 %
72 %
68 %
66 %
Befragt:1.007 Personen ab 18 Jahren,
August 2021
1.
2.
3.
4.
5.
34.
...
85 %
82 %
77 %
75 %
73 %
5 %
Glasfaseranschlüsse:Anteil an allen stationärenBreitbandanschlüssen in den OECD-Ländern in Prozent*
*Stand: Dezember 2020 • Quellen: OECD, Bitkom ResearchHANDELSBLATT
Digitalisierung in DeutschlandZustimmung zu der Aussage: „Die Bundesregierung sollte ein eigenes Digitalministerium schaffen.“ Angaben in Prozent
Traurige Realität: In vielen öffentlichen Verwaltungen Deutschlands werden die behördlichen Vorgänge noch in Akten archiviert.
Ein Digitalisierungsministerium muss Tempo machen.
Wahlkampfslogan 2021 FDP
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Politik
8
Auch die scheidende Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) habe mangels Mitarbeiter und Budget nicht viel bewegen können. Dies dür-fe sich nicht wiederholen, wenn man mit der Di-gitalisierung endlich vorankommen wolle.
Für die FDP wäre die Lösung, das „Digitale“ an ein anderes Ressort anzuhängen, allerdings die bessere Variante. Das Wahlkampfversprechen, ein „Digitalministerium“ ins Leben rufen zu wol-len, könnten die Liberalen so zumindest teilweise als erfüllt verkaufen. Die Digitalisierung als Kern-thema der Partei an ein SPD-geführte Kanzleramt anzudocken stößt deshalb bei den Liberalen eher auf Skepsis. Die Notlösung, ein bestehendes Mi-nisterium auszubauen, sehen viele in der FDP als Übergang zu einem echten Digitalressort.
Skepsis bei DigitalverbändenVertreter der Digitalwirtschaft reagierten ernüch-tert auf die Entscheidung der Ampelparteien. Der Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), Dirk Freytag, sagte dem Handelsblatt, ein eigenes Ministerium wäre vor allem als Instanz für den geplanten „Digitalisierungscheck“ neuer Gesetze wichtig gewesen. Dies würde signalisie-ren, „dass die Digitalisierung Deutschlands end-lich oben auf der Agenda steht“, so Freytag.
Ähnlich sieht das auch Oliver Süme, Vor-standsvorsitzender des Verbands der Internet-wirtschaft, Eco: „Die Bündelung der strategisch relevanten digitalpolitischen Aufgaben in einem Digitalressort mit klarem Auftrag ist aus meiner Sicht nach wie vor die beste strukturelle Lösung, um das Querschnittsthema digitale Transforma-tion konsistent politisch zu steuern“, so Süme.
Bitkom-Präsident Achim Berg begrüßt zwar die Lösung, ein bereits bestehendes Ministerium umzuwidmen, er warnt aber auch davor, Digita-lisierung als Anhängsel zu betrachten. Sie dürfe „nicht nur auf dem Klingelschild stehen“.
plai
npic
ture
/Fab
rice
Arf
aras
D ie Maßgabe klingt eindeutig: „Wir werden im Rahmen der grund-gesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen
gewährleisten, insbesondere in Klima-schutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur“, ha-ben SPD, FDP und Grüne in ihrem Sondierungspapier festgeschrieben. Die Ampelkoalition verspricht also, ge-nügend Geld für Investitionen auf-zutreiben und gleichzeitig die Schul-denbremse einzuhalten.
Derzeit suchen die Unterhändler in der Arbeitsgruppe „Finanzen und Haushalt“ nach Wegen, wie sich diese Vorgaben umsetzen lassen. Und schon bei der ersten Runde war klar: Es ist ein äußerst schwieriges Unterfangen.
So fordern die Grünen, 50 Milliar-den Euro zusätzlich im Jahr zu inves-tieren. Nur lässt die Schuldenbremse ab 2023 kaum Spielraum für zusätzli-che Schulden. Deshalb diskutieren die Ampel-Haushälter ungewöhnliche Wege, mit denen sich Investitionsmit-tel mobilisieren lassen, ohne dies aus dem Bundesetat finanzieren zu müs-sen. Über vier Tricks wird diskutiert.
� Milliardenrücklage im Energie- und Klimafonds (EKF)Die Blaupause für diesen Haushalts-trick lieferte Olaf Scholz (SPD). Als klar war, dass der Bundesfinanzminister wegen der Coronakrise Schulden in Rekordhöhe aufnehmen muss, ent-schloss er sich, mit einem Teil der Kre-dite Reserven für die Zukunft anzule-gen. So flossen rund 26 Milliarden Euro in den im Bundeshaushalt angesiedel-ten Energie- und Klimafonds (EKF), um damit ab 2021 Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket zu finanzieren.
Unter einem Kanzler Scholz könn-te diese Strategie wiederholt werden. 2022 soll nach derzeitiger Planung das letzte Jahr werden, in dem die Schul-denbremse wegen Corona ausgesetzt wird. Scholz’ Finanzplan sieht vor, im kommenden Jahr knapp 100 Milliarden Euro neue Schulden zu machen. Die Koalition könnte, so die Überlegung, aber noch mehr Kredite aufnehmen und das Geld im EKF parken. Diese Idee ist allerdings umstritten.
Es gibt Juristen, die bezweifeln, dass so ein Vorgehen verfassungs-gemäß ist. Die Ampel würde zumin-dest das Risiko eingehen, dass gleich ihr erster Haushalt als verfassungswid-rig eingestuft werden könnte. FDP-Chef Christian Lindner hat dem EKF-Trick deshalb zumindest teilweise eine Absage erteilt. Mehr als 100 Milliarden Euro Kredite lehnt er ab.
Grundlegend dürfte das Thema aber weiter wabern. Nach Informatio-nen des Handelsblatts haben auch be-reits die Abteilungsleiter der Länder-finanzministerien in einer internen Runde darüber diskutiert, ob der Kli-manotstand als Begründung für eine dauerhafte Ausnahme von der Schul-denbremse herangezogen werden könnte. Die Schuldenbremse schreibt den Ländern seit 2020 sogar eine Null-verschuldung vor.
Die Abteilungsleiter waren aber höchst skeptisch. Zwei hohe Finanzbe-amte aus Hamburg schrieben ihre Be-denken nieder. „Die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels durch eine Kreditaufnahme zu finan-zieren, würde der kommenden Gene-ration nicht nur die Folgen des Klima-wandels, sondern auch die finanziellen Lasten aufbürden“, heißt es darin.
� Ausbau der Förderbank KfWDie realistischste Option ist derzeit ei-ne andere: ein Ausbau der staatlichen Förderbank KfW. Sie soll zu einer „In-novations- und Investitionsagentur“ ausgebaut werden, wie es im Sondie-rungspapier heißt. Offen ist, wie genau die KfW eingespannt werden kann. Die KfW könnte zwar mehr Zuschüsse
und Kredite verteilen, etwa an Firmen, die in Klimaschutz investieren. Die Überlegungen der Unterhändler gehen aber noch weiter: Die KfW könnte auch als eine Art „Transformations-fonds“ dienen. Die Förderbank würde finanziell dort einspringen, wo Unter-nehmen und deren Banken mit der Kli-mawende überfordert werden.
Der Vorteil aus Sicht der Ampel-koalition: Wenn die KfW einspringt, engt das nicht den Spielraum im Bun-deshaushalt ein. Doch auch der KfW-Plan ist umstritten. So würde die staat-liche Bank – und mit ihr letztlich die Steuerzahler – dort ins Risiko gehen, wo es private Investoren nicht wol-len. Auch müsste sich die KfW neu er-finden.
Ob daher wirklich mehr private In-vestitionen angeschoben werden könn-ten, ist nicht sicher. Schon jetzt liegendie Zinsen nahezu bei null. Das Zins-umfeld ist also schon so, dass es mög-lichst viele private Investitionen gebenmüsste. Was da eine Förderbank zu-sätzlich bewirken soll, ist unklar.
� Öffentliche Unternehmen einspannenÜber die KfW-Bank hinaus könnte einAmpelbündnis auch andere öffentlicheUnternehmen einspannen, um die In-vestitionen zu erhöhen. Diese könnenKredite aufnehmen, ohne dass dieseauf die Schuldenregel angerechnet wer-den und damit den finanziellen Spiel-raum des Bundes einengen.
So könnte der Bund neue öffent-liche Unternehmen schaffen, etwa fürden Aufbau einer Wasserstoff-Infra-struktur. Oder ein staatliches Unter-nehmen, das entlang von BahnstreckenSolarmodule aufstellt und Windräderbaut, um den Ausbau der erneuerbarenEnergien voranzutreiben. Einnahmenkönnte das Unternehmen dann ausdem Verkauf von Strom bestreiten.
Naheliegend ist auch, den Ver-schuldungsspielraum bereits bestehen-der öffentlicher Unternehmen wie derDeutschen Bahn zu erweitern, verbun-den mit der Auflage, die zusätzlichenMittel müssten etwa in die Gleisinfra-struktur investiert werden.
Doch auch diese Überlegungenbergen Probleme: Die Entscheidungenwürden dann in den Unternehmen ge-troffen, der Bundestag würde an Ein-fluss- und Kontrollmöglichkeiten ver-lieren. Auch wirtschaftlich wäre ausSicht des Steuerzahlers eine höhereVerschuldung öffentlicher Unterneh-men nicht unbedingt effizient.
Gründung eines EU-KlimafondsWeil die Schuldenbremse national we-nig Spielraum lässt, denken die Sondie-rer über eine europäische Lösung nach:die Schaffung eines europäischenFonds, aus dem Klimainvestitionen fi-nanziert werden.
Der Bundesverband der DeutschenIndustrie (BDI) beziffert den Investi-tionsbedarf Deutschlands bis 2030 auf860 Milliarden Euro, wenn die Klima-ziele erreicht werden sollen. Da auchalle anderen EU-Staaten zur Bewälti-gung der Klimakrise viel investierenmüssen, liegt eine europäische Lösungnahe. Wie beim EU-Wiederaufbau-fonds würde dann die EU-Kommissionselbst Schulden machen, um den Topfmit Geld zu füllen. Der BDI begrüßtedie Idee bereits.
Während SPD und Grüne einenEU-Klimafonds sicher mitmachenwürden, kann die FDP kaum zustim-men. Sie war bislang strikt gegen eineVergemeinschaftung von Schulden aufEU-Ebene. Zudem wäre so ein Fondsmit hohen Hürden verbunden. Somüsste ein neuer Beschluss für eineAufstockung der EU-Eigenmittel her,jedes EU-Land müsste dem einzeln zu-stimmen, da hier das Einstimmigkeits-prinzip gilt. M. Greive, J. Hildebrand
Haushalt
Vier Tricks für mehr SchuldenDie Ampelkoalition verspricht, genügend Geld für Investitionen aufzutreiben und gleichzeitig
die Schuldenbremse einzuhalten. Dafür gibt es Möglichkeiten – aber alle haben Nachteile.
-76
-279
-18,5-31,5
Quelle: Stabilitätsrat
2022 20222018 2018
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
Finanzierungssaldo in Mrd. Euro
HANDELSBLATT
Schulden in Deutschland
Bund
Prognose Prognose
Länder
100Milliarden Euro
an neuen Schulden sieht bislang der Finanzplan des Bundesfinanz-ministeriums für das kommende
Jahr vor.
Quelle: Finanzministerium
71Prozent der Deutschen
haben sich laut einer Umfrage des Digital-verbandes Bitkom vom September für ein
eigenes Digitalressort ausgesprochen.
Quelle: Bitkom
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Politik
9
Dietmar Neuerer, Teresa Stiens Berlin
Die FDP wollte es, die Digitalverbände wollten es, und auch die allermeisten Deutschen hielten es für eine gute Idee: ein eigenes Ministerium für digitale An-gelegenheiten. Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom vom September
dieses Jahres sprachen sich 71 Prozent der Befrag-ten für ein eigenes Digitalressort aus.
Von der FDP hieß es im Wahlkampf: „Ein Di-gitalisierungsministerium muss Tempo machen.“ Parteichef Christian Lindner war ein persönlicher Verfechter des Ansatzes, um von überholten Praktiken wie dem Faxen und der Rohrpost weg-zukommen, wie er im Bundestag und bei seinen Wahlkampfauftritten immer wieder betonte.
Doch jetzt, wo es an der Zeit wäre, diese Idee auch zu verwirklichen, wird klar: In der neuen Bundesregierung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach kein eigenständiges Digitalministerium ge-ben. Das sagten mehrere mit den Verhandlungen zur Bildung einer Ampelkoalition vertraute Per-sonen dem Handelsblatt.
Die FDP, die als einzige der drei Ampelpartei-en ein solches Ressort ausdrücklich in ihrem Wahlprogramm festgeschrieben hat, befinde sich mit ihrer Forderung „auf dem Rückzug“, sagte ein Unterhändler.
Während der Gespräche in der Facharbeits-gruppe hätten die Liberalen teilweise den Ein-druck erweckt, sie müssten nur Digitalressort sa-gen und alle Bälle rollten auf sie zu, sagte ein an-derer Insider. Inzwischen setzt sich allerdings auch bei der FDP laut Handelsblatt-Informationen die Einsicht durch, dass der Aufbau eines neuen Mi-nisteriums das Tempo bei der Digitalisierung eher bremsen als forcieren würde.
Das Problem: Ein eigenes Digitalministerium würde einen zu großen organisatorischen und personellen Umbau mit sich bringen. Räumlich-keiten in Berlin Mitte für ein neues Bundesminis-terium zu finden sei extrem schwierig. Außer-dem müsste eine große fachliche Restrukturie-rung mit der Schaffung einer neuen Behörde einhergehen und andere Ressorts einen personel-len Aderlass hinnehmen, lautet die Einschätzung in FDP-Kreisen.
Außerdem ist die Digitalisierung ein klassi-sches Querschnittsthema. Von Unterhändlern der SPD heißt es deshalb, es sei offenkundig, dass schon jetzt in allen Ministerien Digitalisierungs-projekte verfolgt würden, die sich jedoch nicht einfach in einem einzelnen Ressort bündeln lie-ßen, ohne einen Kompetenzverlust zu riskieren.
So gebe es „keine klare Logik“, weshalb zum Beispiel das Gesundheitsministerium plötzlich nicht mehr für das Projekt der elektronischen Pa-tientenakte zuständig sein solle.
Denkbar wäre dem Vernehmen nach aber, ein bestehendes Ministerium mit der Zuständigkeit für Digitales aufzuwerten und darin bestimmte Themen zu bündeln. Als Vorbild könne etwa Nordrhein-Westfalen dienen, sagte ein Insider.
Dort gibt es ein Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Das Res-sort wird aktuell vom FDP-Politiker Andreas Pinkwart geführt, der die Ampel im Bund in der digitalen Facharbeitsgruppe mitverhandelt.
Denkbar wäre außerdem, einen künftigen Di-gitalstaatsminister im Kanzleramt zu stärken. Ein Unterhändler sprach von der Möglichkeit, einen „Bundesminister mit besonderen Aufgaben“ ein-zusetzen. Dieser könne mit einem „agilen Team“ die Federführung bei digitalen Kernprojekten
übernehmen, hätte Koordinierungsrechte gegen-über anderen Ressorts, müsse für seine Aufgabe dann aber auch auf die Expertise der bestehenden Digitalabteilungen der Abteilung 6 im Kanzleramt zugreifen können.
Das entspräche in etwa der Vorstellung vor allem der SPD. Kanzlerkandidat Olaf Scholz stand der Idee, ein neues Digitalministerium aufzubau-en, schon im Wahlkampf skeptisch gegenüber. Die Digitalisierung solle stattdessen „Chefsache sein“, also im Kanzleramt gebündelt werden, sagte er im Sommer bei einer Handelsblatt-Veranstal-tung. Er könne sich vorstellen, einen „Chief Di-gital Officer“ im Bundeskanzleramt zu installieren. Es brauche jemanden in der Position mit einem tiefen Verständnis von neuen Technologien.
Als „Bundesminister mit besonderen Auf-gaben“ im Kanzleramt fungiert heute schon Helge Braun (CDU). Der geschäftsführende Chef des Bundeskanzleramts hat nach Ansicht der Ampel-verhandler seine Rolle beim Thema Digitalisie-rung nur unzureichend ausgefüllt.
Koalitionsgespräche
Digitalministerium zu den Akten gelegt
Aus den Verhandlungen der Ampelparteien sickert durch, dass die Idee eines eigenen Digitalressorts verworfen werden soll. Alternativen sind im Gespräch.
China
Japan
Bosnien-Herzegowina
Italien
Südkorea
Deutschland
Alle Befragten
18- bis 29-Jährige
30- bis 49-Jährige
50- bis 64-Jährige
Ab 65-Jährige
71 %
79 %
72 %
68 %
66 %
Befragt:1.007 Personen ab 18 Jahren,
August 2021
1.
2.
3.
4.
5.
34.
...
85 %
82 %
77 %
75 %
73 %
5 %
Glasfaseranschlüsse:Anteil an allen stationärenBreitbandanschlüssen in den OECD-Ländern in Prozent*
*Stand: Dezember 2020 • Quellen: OECD, Bitkom ResearchHANDELSBLATT
Digitalisierung in DeutschlandZustimmung zu der Aussage: „Die Bundesregierung sollte ein eigenes Digitalministerium schaffen.“ Angaben in Prozent
Traurige Realität: In vielen öffentlichen Verwaltungen Deutschlands werden die behördlichen Vorgänge noch in Akten archiviert.
Ein Digitalisierungsministerium muss Tempo machen.
Wahlkampfslogan 2021 FDP
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Politik
8
Auch die scheidende Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) habe mangels Mitarbeiter und Budget nicht viel bewegen können. Dies dür-fe sich nicht wiederholen, wenn man mit der Di-gitalisierung endlich vorankommen wolle.
Für die FDP wäre die Lösung, das „Digitale“ an ein anderes Ressort anzuhängen, allerdings die bessere Variante. Das Wahlkampfversprechen, ein „Digitalministerium“ ins Leben rufen zu wol-len, könnten die Liberalen so zumindest teilweise als erfüllt verkaufen. Die Digitalisierung als Kern-thema der Partei an ein SPD-geführte Kanzleramt anzudocken stößt deshalb bei den Liberalen eher auf Skepsis. Die Notlösung, ein bestehendes Mi-nisterium auszubauen, sehen viele in der FDP als Übergang zu einem echten Digitalressort.
Skepsis bei DigitalverbändenVertreter der Digitalwirtschaft reagierten ernüch-tert auf die Entscheidung der Ampelparteien. Der Präsident des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW), Dirk Freytag, sagte dem Handelsblatt, ein eigenes Ministerium wäre vor allem als Instanz für den geplanten „Digitalisierungscheck“ neuer Gesetze wichtig gewesen. Dies würde signalisie-ren, „dass die Digitalisierung Deutschlands end-lich oben auf der Agenda steht“, so Freytag.
Ähnlich sieht das auch Oliver Süme, Vor-standsvorsitzender des Verbands der Internet-wirtschaft, Eco: „Die Bündelung der strategisch relevanten digitalpolitischen Aufgaben in einem Digitalressort mit klarem Auftrag ist aus meiner Sicht nach wie vor die beste strukturelle Lösung, um das Querschnittsthema digitale Transforma-tion konsistent politisch zu steuern“, so Süme.
Bitkom-Präsident Achim Berg begrüßt zwar die Lösung, ein bereits bestehendes Ministerium umzuwidmen, er warnt aber auch davor, Digita-lisierung als Anhängsel zu betrachten. Sie dürfe „nicht nur auf dem Klingelschild stehen“.
plai
npic
ture
/Fab
rice
Arf
aras
D ie Maßgabe klingt eindeutig: „Wir werden im Rahmen der grund-gesetzlichen Schuldenbremse die nötigen Zukunftsinvestitionen
gewährleisten, insbesondere in Klima-schutz, Digitalisierung, Bildung und Forschung sowie die Infrastruktur“, ha-ben SPD, FDP und Grüne in ihrem Sondierungspapier festgeschrieben. Die Ampelkoalition verspricht also, ge-nügend Geld für Investitionen auf-zutreiben und gleichzeitig die Schul-denbremse einzuhalten.
Derzeit suchen die Unterhändler in der Arbeitsgruppe „Finanzen und Haushalt“ nach Wegen, wie sich diese Vorgaben umsetzen lassen. Und schon bei der ersten Runde war klar: Es ist ein äußerst schwieriges Unterfangen.
So fordern die Grünen, 50 Milliar-den Euro zusätzlich im Jahr zu inves-tieren. Nur lässt die Schuldenbremse ab 2023 kaum Spielraum für zusätzli-che Schulden. Deshalb diskutieren die Ampel-Haushälter ungewöhnliche Wege, mit denen sich Investitionsmit-tel mobilisieren lassen, ohne dies aus dem Bundesetat finanzieren zu müs-sen. Über vier Tricks wird diskutiert.
� Milliardenrücklage im Energie- und Klimafonds (EKF)Die Blaupause für diesen Haushalts-trick lieferte Olaf Scholz (SPD). Als klar war, dass der Bundesfinanzminister wegen der Coronakrise Schulden in Rekordhöhe aufnehmen muss, ent-schloss er sich, mit einem Teil der Kre-dite Reserven für die Zukunft anzule-gen. So flossen rund 26 Milliarden Euro in den im Bundeshaushalt angesiedel-ten Energie- und Klimafonds (EKF), um damit ab 2021 Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket zu finanzieren.
Unter einem Kanzler Scholz könn-te diese Strategie wiederholt werden. 2022 soll nach derzeitiger Planung das letzte Jahr werden, in dem die Schul-denbremse wegen Corona ausgesetzt wird. Scholz’ Finanzplan sieht vor, im kommenden Jahr knapp 100 Milliarden Euro neue Schulden zu machen. Die Koalition könnte, so die Überlegung, aber noch mehr Kredite aufnehmen und das Geld im EKF parken. Diese Idee ist allerdings umstritten.
Es gibt Juristen, die bezweifeln, dass so ein Vorgehen verfassungs-gemäß ist. Die Ampel würde zumin-dest das Risiko eingehen, dass gleich ihr erster Haushalt als verfassungswid-rig eingestuft werden könnte. FDP-Chef Christian Lindner hat dem EKF-Trick deshalb zumindest teilweise eine Absage erteilt. Mehr als 100 Milliarden Euro Kredite lehnt er ab.
Grundlegend dürfte das Thema aber weiter wabern. Nach Informatio-nen des Handelsblatts haben auch be-reits die Abteilungsleiter der Länder-finanzministerien in einer internen Runde darüber diskutiert, ob der Kli-manotstand als Begründung für eine dauerhafte Ausnahme von der Schul-denbremse herangezogen werden könnte. Die Schuldenbremse schreibt den Ländern seit 2020 sogar eine Null-verschuldung vor.
Die Abteilungsleiter waren aber höchst skeptisch. Zwei hohe Finanzbe-amte aus Hamburg schrieben ihre Be-denken nieder. „Die Verringerung der Auswirkungen des Klimawandels durch eine Kreditaufnahme zu finan-zieren, würde der kommenden Gene-ration nicht nur die Folgen des Klima-wandels, sondern auch die finanziellen Lasten aufbürden“, heißt es darin.
� Ausbau der Förderbank KfWDie realistischste Option ist derzeit ei-ne andere: ein Ausbau der staatlichen Förderbank KfW. Sie soll zu einer „In-novations- und Investitionsagentur“ ausgebaut werden, wie es im Sondie-rungspapier heißt. Offen ist, wie genau die KfW eingespannt werden kann. Die KfW könnte zwar mehr Zuschüsse
und Kredite verteilen, etwa an Firmen, die in Klimaschutz investieren. Die Überlegungen der Unterhändler gehen aber noch weiter: Die KfW könnte auch als eine Art „Transformations-fonds“ dienen. Die Förderbank würde finanziell dort einspringen, wo Unter-nehmen und deren Banken mit der Kli-mawende überfordert werden.
Der Vorteil aus Sicht der Ampel-koalition: Wenn die KfW einspringt, engt das nicht den Spielraum im Bun-deshaushalt ein. Doch auch der KfW-Plan ist umstritten. So würde die staat-liche Bank – und mit ihr letztlich die Steuerzahler – dort ins Risiko gehen, wo es private Investoren nicht wol-len. Auch müsste sich die KfW neu er-finden.
Ob daher wirklich mehr private In-vestitionen angeschoben werden könn-ten, ist nicht sicher. Schon jetzt liegendie Zinsen nahezu bei null. Das Zins-umfeld ist also schon so, dass es mög-lichst viele private Investitionen gebenmüsste. Was da eine Förderbank zu-sätzlich bewirken soll, ist unklar.
� Öffentliche Unternehmen einspannenÜber die KfW-Bank hinaus könnte einAmpelbündnis auch andere öffentlicheUnternehmen einspannen, um die In-vestitionen zu erhöhen. Diese könnenKredite aufnehmen, ohne dass dieseauf die Schuldenregel angerechnet wer-den und damit den finanziellen Spiel-raum des Bundes einengen.
So könnte der Bund neue öffent-liche Unternehmen schaffen, etwa fürden Aufbau einer Wasserstoff-Infra-struktur. Oder ein staatliches Unter-nehmen, das entlang von BahnstreckenSolarmodule aufstellt und Windräderbaut, um den Ausbau der erneuerbarenEnergien voranzutreiben. Einnahmenkönnte das Unternehmen dann ausdem Verkauf von Strom bestreiten.
Naheliegend ist auch, den Ver-schuldungsspielraum bereits bestehen-der öffentlicher Unternehmen wie derDeutschen Bahn zu erweitern, verbun-den mit der Auflage, die zusätzlichenMittel müssten etwa in die Gleisinfra-struktur investiert werden.
Doch auch diese Überlegungenbergen Probleme: Die Entscheidungenwürden dann in den Unternehmen ge-troffen, der Bundestag würde an Ein-fluss- und Kontrollmöglichkeiten ver-lieren. Auch wirtschaftlich wäre ausSicht des Steuerzahlers eine höhereVerschuldung öffentlicher Unterneh-men nicht unbedingt effizient.
Gründung eines EU-KlimafondsWeil die Schuldenbremse national we-nig Spielraum lässt, denken die Sondie-rer über eine europäische Lösung nach:die Schaffung eines europäischenFonds, aus dem Klimainvestitionen fi-nanziert werden.
Der Bundesverband der DeutschenIndustrie (BDI) beziffert den Investi-tionsbedarf Deutschlands bis 2030 auf860 Milliarden Euro, wenn die Klima-ziele erreicht werden sollen. Da auchalle anderen EU-Staaten zur Bewälti-gung der Klimakrise viel investierenmüssen, liegt eine europäische Lösungnahe. Wie beim EU-Wiederaufbau-fonds würde dann die EU-Kommissionselbst Schulden machen, um den Topfmit Geld zu füllen. Der BDI begrüßtedie Idee bereits.
Während SPD und Grüne einenEU-Klimafonds sicher mitmachenwürden, kann die FDP kaum zustim-men. Sie war bislang strikt gegen eineVergemeinschaftung von Schulden aufEU-Ebene. Zudem wäre so ein Fondsmit hohen Hürden verbunden. Somüsste ein neuer Beschluss für eineAufstockung der EU-Eigenmittel her,jedes EU-Land müsste dem einzeln zu-stimmen, da hier das Einstimmigkeits-prinzip gilt. M. Greive, J. Hildebrand
Haushalt
Vier Tricks für mehr SchuldenDie Ampelkoalition verspricht, genügend Geld für Investitionen aufzutreiben und gleichzeitig
die Schuldenbremse einzuhalten. Dafür gibt es Möglichkeiten – aber alle haben Nachteile.
-76
-279
-18,5-31,5
Quelle: Stabilitätsrat
2022 20222018 2018
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
Finanzierungssaldo in Mrd. Euro
HANDELSBLATT
Schulden in Deutschland
Bund
Prognose Prognose
Länder
100Milliarden Euro
an neuen Schulden sieht bislang der Finanzplan des Bundesfinanz-ministeriums für das kommende
Jahr vor.
Quelle: Finanzministerium
71Prozent der Deutschen
haben sich laut einer Umfrage des Digital-verbandes Bitkom vom September für ein
eigenes Digitalressort ausgesprochen.
Quelle: Bitkom
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Politik
9
Daniel Delhaes, Jürgen Klöckner Berlin
Die Bundesregierung hat samt oberster Bundesbehörden in den Jahren 2019 und 2020 Geld aus der Privatwirtschaft in Höhe von rund 164 Millionen Euro er-
halten. Das sind gut 66 Millionen Euro mehr als im Zeitraum 2017 und 2018, wie aus dem Integritätsbericht der Bundesregierung hervorgeht. Der Be-richt liegt dem Handelsblatt vor.
Der Großteil an Spenden und Sponsoring floss an das Bundesgesund-heitsministerium, insgesamt 80 Prozent der Zuwendungen (131 Millionen Euro) erhielt das Ministerium von Jens Spahn (CDU). Fast die Hälfte davon sei vor al-lem „zur Unterstützung der Bewälti-gung der Coronapandemie und für Maßnahmen zur Gesundheitsför-derung und Prävention“ geflossen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Weitere 66 Millionen Euro erhielt die Bundeszen-trale für gesundheitliche Aufklärung.
Insgesamt stehen 27 Spenden von mehr als 5000 Euro im Zusammen-hang mit der Coronapandemie. Sie ha-ben einen Wert von rund 61 Millionen Euro. Größter Spender war laut Be-richt der Ludwigshafener Chemiekon-zern BASF, der Schutzausrüstungen im Wert von 42,5 Millionen Euro zur Verfügung stellte. Danach folgen der amerikanische Pharmakonzern Gilead Sciences mit einer Spende von 5,3 Mil-lionen Euro (Arzneimittel) und Volks-wagen mit 4,2 Millionen Euro für „per-sönliche Schutzausrüstung, Desinfek-tionsmittel, Thermometer“. Der Autohersteller selbst weist auf Anfrage darauf hin, im Jahr 2020 sogar Sach-spenden im Wert von rund 40 Millio-nen Euro an Bund und Länder getätigt zu haben, von denen rund zwei Drittel an Spahns Ministerium gingen. Aus „unternehmerischer Verantwortung“, wie es heißt.
Höherer Etat für das Gesundheitsministerium
Allein für Schutzausrüstungen, zu de-nen auch Masken gehören, gab es pri-vate Spenden in Höhe von fast 50 Mil-lionen Euro. Laut Gesundheitsministe-rium habe BASF allein 121 Millionen Schutzmasken geliefert. BASF hinge-gen teilte auf Anfrage mit, lediglich 100 Millionen Masken geliefert zu haben. Zu den Spendern gehörte ebenso Ali-baba (1,1 Millionen Euro), Apple (730.000 Euro), Novartis und Amazon (je 117.000 Euro) sowie Astra-Zeneca (351.000 Euro).
Auch der holländische Brillenher-steller Ace and Tate (5799 Euro) sowie der chinesische Mischkonzern Fosun (24.570 Euro) unterstützten den Kauf von Schutzausrüstung. Der Milliardär Charles Brown spendete über seine In-vestmentfirma Lake House nach eige-nem Bekunden eine Million Masken im Wert von 1,17 Millionen Euro.
Das Sponsoring der Verwaltung unterliegt ebenso wie Spenden und sonstigen Schenkungen strengen Re-geln, die der Bund in einer Verwal-tungsvorschrift festgelegt hat. Dem-nach muss „schon jeder Anschein fremder Einflussnahme vermieden werden“, heißt es im Integritätsbericht. „Daher ist eine restriktive und transpa-rente Handhabung geboten.“
Der Bericht listet jede Zuwendung über 5000 Euro gemeinsam mit dem Namen des Gebers und dem Grund der Spende auf. Laut diesem sei der Anteil des Sponsorings gemessen an der Höhe des Bundeshaushalts von rund 716 Milliarden Euro (2019 und 2020) „verschwindend gering“. Die
Leistungen seien Projekten zugutege-kommen, „die ohne die Leistung Drit-ter nicht oder nur in geringerem Um-fang hätten verwirklicht werden kön-nen“. Das Ministerium beruft sich auf diese Vorschrift.
Gilt dies aber etwa für das Sponso-ring von Twitter (8300 Euro), LinkedIn (10.000 Euro), Facebook (1,7 Millionen Euro) und Google (2,1 Millionen)? Die Unternehmen haben „Gutscheine zur Platzierung von Informationen“ ans Ministerium zur „Bewältigung der Co-ronapandemie“ verschenkt.
Facebook teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen weltweit Ge-sundheitsorganisationen unterstützt habe. Google stellte für solche Zwecke weltweit Gutscheine in Höhe von 215 Millionen Euro aus. Konkret nutzte Spahns Ministerium diese sogenannten Ad Grants nach eigenen Angaben zwi-schen März 2020 und April 2021. Da-mit habe man die Reichweite von In-
formationen über das Coronavirus und die Schutzimpfung erhöhen können, teilte das Ministerium mit.
Allerdings stellte die Bundesregie-rung etwa für den Zweck Information und Aufklärung zusätzliche Haushalts-mittel von 365 Millionen Euro zur Ver-fügung. Die Facebook- und Google-Kampagnen hätten also durchaus auch vollständig mit Steuermitteln finanziert werden können.
Auch steht die Frage im Raum, wa-rum Hilfen für den Einkauf von Mas-ken etwa angesichts der vergleichswei-se geringen Summe gemessen am Haushalt des Gesundheitsministers nicht bezahlt wurden. Denn in der Co-ronapandemie war Spahns Etat deut-lich aufgestockt worden. Im Jahr 2019 lagen die Ausgaben bei 15,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Coronapandemie, wurde der Etat dann auf 41,25 Milliarden Euro auf-gestockt, also fast verdreifacht. Und für dieses Jahr sieht der Nachtragshaushalt Ausgaben von 44 Milliarden Euro vor.
„Generell ist es kritisch zu sehen, wenn staatliche Aufgaben durch exter-ne Private finanziert werden“, sagt Norman Loeckel, Leiter der Arbeits-gruppe Transparente Verwaltung bei der Nichtregierungsorganisation Transparency Deutschland. Der Staat erhebe Steuern und Gebühren, um sei-ne Aufgaben zu erfüllen. „Im vorliegen-den Einzelfall mag vielleicht keine kon-krete Absicht seitens der Firmen vor-handen gewesen sein, sich über diese Art von ,Sponsoring‘ mit der Regierung gut zu stellen oder Einfluss zu gewin-nen.“ Allerdings genüge bereits der schlechte Anschein, um in der Öffent-lichkeit die Unabhängigkeit der Behör-den infrage zu stellen, sofern es künftig zu Entscheidungen zugunsten eines beteiligten Unternehmens komme, warnt Loeckel.
Sponsoring sei ähnlich problema-tisch wie die einstige Praxis von Fir-men, Mitarbeiter in Ministerien zu ent-senden und zu bezahlen, „eine Praxis, die mittlerweile weitgehend eingestellt wurde“.
Gesundheitsminister Spahn: Werbegutscheine von Google und Facebook
für Coronaaufklärung.
Spenden der Wirtschaft an den Staat: Summe in Euro, Anteil in Prozent
HANDELSBLATT
Gesponsorte Regierung
Quelle:
98,4Mio. €
164,1Mio. €
2019 bis 2020
Gesamt
131 Mio. €
21 Mio. €
3 Mio. €
73 Mio. €
70 Mio. €
11 Mio. €
Verwendungszweck/Art
Pho
toth
ek/G
etty
Imag
es
Sponsoring
Wenn Konzerne Ministerien
Millionen spendenBASF, Volkswagen, Facebook, Google: Ein Regierungsbericht
listet Coronaspenden von mehr als 60 Millionen Euro auf. Transparency kritisiert das Sponsoring durch Unternehmen.
Generell ist es kritisch zu sehen, wenn
staatliche Aufgaben durch externe Private
finanziert werden.
Norman LoeckelTransparency Deutschland
Politik
10 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D ie explodierenden Gaspreise wir-ken sich nicht nur auf die Ener-giepreise insgesamt, sondern auch auf das Logistik- und Trans-
portgewerbe aus. Inzwischen gibt es Lieferengpässe und derart stark stei-gende Preise für das Abgasreinigungs-mittel AdBlue, dass die Branche mit Flottenstilllegungen rechnet und von einem „drohenden Versorgungskollaps mit AdBlue als essenziellem Hilfsstoff zum Betrieb von Lkws und Bussen mit Euro VI-Motoren“ schreibt.
Dies geht aus einem Brief des Bun-desverbands Güterkraftverkehr Logis-tik und Entsorgung (BGL) sowie des Bundesverbands Deutscher Omnibus-unternehmer (BDO) an den geschäfts-führenden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hervor.
In ihrem Brief weisen die Verbände darauf hin, dass der Preis je Liter Ad-blue von 19 auf 69 Cent gestiegen sei und Unternehmen vermehrt berichte-ten, dass „Lieferanten die Lieferung einstellen“. Gäbe es bundesweit kein AdBlue mehr, dann seien 90 Prozent der Lkw-Transporte betroffen. „Die Fahrzeuge müssten faktisch stehen bleiben“, warnen die Verbände. „Die Lieferketten wären damit akut gefähr-det, die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen nicht mehr sicher.“
Ammoniak-Hersteller legen Produktionen still
Der Engpass bei AdBlue ist Folge der massiv gedrosselten Produktion bei den führenden Herstellern von Ammo-niak, aus dem der benötigte Harnstoff gewonnen wird. Der größte deutsche Anbieter SKW Piesteritz aus Luther-stadt Wittenberg hat vor wenigen Ta-gen die Produktion weiter herunterge-fahren und mittlerweile ein Drittel der Kapazitäten stillgelegt.
Dabei lohnt sich die Produktion nicht nur wegen der rasant gestiegenen Erdgaspreise. Die Ammoniak-Pro-duzenten sind vielmehr von drei Seiten unter Druck: Sie brauchen Gas einer-seits als Energieträger in der Produk-tion. Zugleich ist es der wichtigste Roh-stoff für die Ammoniak-Herstellung: Aus Gas wird mithilfe von Wasser der benötigte Wasserstoff gewonnen.
Dazu kommen die Kosten für den Erwerb von CO2-Zertifikaten. Neben SKW haben zahlreiche andere große Ammoniak-Anbieter ihre Produktion gesenkt und ganze Werke stillgelegt. Bei der norwegischen Yara, als welt-weit zweitgrößtem Ammoniakliefe-ranten, liegt die Drosselung bei 40 Pro-zent. Auch BASF hat die Fertigung an den Standorten Ludwigshafen und Antwerpen zurückgefahren.
Ebenso warnt der Bundesverband Spedition und Logistik entsprechend: „Bei vielen Fahrzeugen erlaubt die Mo-torsteuerung bei leerem AdBlue-Tank gar keinen Neustart, der Lkw bleibt dann stehen“, erklärte Hauptgeschäfts-führer Frank Huster. Zwar gebe es noch keinen flächendeckenden Ad-Blue-Engpass, allerdings stiegen die Preise aufgrund der sprunghaft gestie-genen Nachfrage spürbar.
Zur steigenden Nachfrage gehören Hamsterkäufe. So hatte etwa auch der ADAC Vielfahrern geraten, unter Um-ständen AdBlue zu bevorraten, da be-reits der „zweite Preisschock nach den
aktuellen Spritpreisen auf Rekord-niveau“ drohe. Der Verbrauch je Fahr-zeug liege bei drei bis fünf Prozent des Kraftstoffverbrauchs.
Für gewöhnlich müsse AdBlue nur ein- bis zweimal im Jahr nachgefüllt werden. Branchenvertreter Huster warnte davor, dass Käufe auf Vorrat die Verknappung weiter anheizen. „Im schlimmsten Fall könnte dies eine zu-sätzliche Bruchstelle in den ohnehin sehr angespannten Lieferketten wer-den.“ Neben den Transporteuren sind auch die Landwirte betroffen, da Am-moniak ebenfalls bei der Düngemittel-produktion zum Einsatz kommt.
„Der Energiepreisschock erfasst auch die Landwirtschaft, nicht nur beim Diesel, sondern auch bei Dünge-mitteln“, sagte der stellvertretende Ge-neralsekretär des Deutschen Bauern-verbandes, Udo Hemmerling. Er warnt ebenso vor Versorgungsengpässen. „Wenn Dünger fehlt, gibt es geringere Ernten. Wenn Adblue fehlt, bedeutet dies Stillstand in den Lieferketten. Auch Traktoren und Mähdrescher brauchen Adblue.“
Um das Problem kurzfristig zu lö-sen, fordern BGL und BDO in ihrem Brief einen Runden Tisch mit Vertre-tern des Wirtschafts-, des Verkehrs- und des Umweltministeriums mit den Produzenten und Händlern sowie den Nutzern. Die Runde soll klären, dass zumindest die Produktion weiterläuft und trotz der gestiegenen Preise die Versorgung gewährleistet wird.
Doch dürfte es dazu so bald nicht kommen. Zwar bestätigt das Ministe-rium die Bedeutung von AdBlue für Lastwagen und Busse mit Euro-VI Motoren. Allerdings verwies sie ebenso darauf, dass „vor allem der Last- und Busverkehr und damit der Zuständig-keitsbereich des Bundesverkehrsminis-teriums betroffen“ sei.
Bundesverkehrsminister AndreasScheuer (CSU) sagte hingegen, er neh-me die Warnungen der Logistiker„sehr ernst“. Die internationalenTransportketten seien allein wegen derCoronapandemie immer noch sehr an-gespannt. „Dass Teile des Straßen-transports durch einen Rohstoffmangelausfallen, können wir uns da einfachnicht leisten. Oberstes Ziel muss essein, unsere Lieferketten weiter amLaufen zu halten.“
BGL-Vorstandssprecher Dirk En-gelhardt versucht derweil, selbst eineLösung zu finden. „Aufgrund von Lie-ferstopps und sehr starker Mengen-sanktionierungen einiger Großhändlervon AdBlue versuchen wir aktuell, di-rekten Kontakt mit den Herstellernaufzunehmen“, sagte er dem Handels-blatt. D. Delhaes, B.-F. Fröndhoff
Energiepreise
AdBlue wird knapp: Transporteure schlagen AlarmHersteller, Logistik und Landwirte warnen vor einem Versorgungskollaps des Abgasreinigungsmittels. Die Politik winkt ab.
Leere Stationen: Die Versorgung mit AdBlue
stockt derzeit.
imag
o/C
ord
90Prozent
der Lkw-Transporte wären betrof-fen, gäbe es kein AdBlue mehr.
Quelle: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
Politik
11WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Daniel Delhaes, Jürgen Klöckner Berlin
Die Bundesregierung hat samt oberster Bundesbehörden in den Jahren 2019 und 2020 Geld aus der Privatwirtschaft in Höhe von rund 164 Millionen Euro er-
halten. Das sind gut 66 Millionen Euro mehr als im Zeitraum 2017 und 2018, wie aus dem Integritätsbericht der Bundesregierung hervorgeht. Der Be-richt liegt dem Handelsblatt vor.
Der Großteil an Spenden und Sponsoring floss an das Bundesgesund-heitsministerium, insgesamt 80 Prozent der Zuwendungen (131 Millionen Euro) erhielt das Ministerium von Jens Spahn (CDU). Fast die Hälfte davon sei vor al-lem „zur Unterstützung der Bewälti-gung der Coronapandemie und für Maßnahmen zur Gesundheitsför-derung und Prävention“ geflossen, wie aus dem Bericht hervorgeht. Weitere 66 Millionen Euro erhielt die Bundeszen-trale für gesundheitliche Aufklärung.
Insgesamt stehen 27 Spenden von mehr als 5000 Euro im Zusammen-hang mit der Coronapandemie. Sie ha-ben einen Wert von rund 61 Millionen Euro. Größter Spender war laut Be-richt der Ludwigshafener Chemiekon-zern BASF, der Schutzausrüstungen im Wert von 42,5 Millionen Euro zur Verfügung stellte. Danach folgen der amerikanische Pharmakonzern Gilead Sciences mit einer Spende von 5,3 Mil-lionen Euro (Arzneimittel) und Volks-wagen mit 4,2 Millionen Euro für „per-sönliche Schutzausrüstung, Desinfek-tionsmittel, Thermometer“. Der Autohersteller selbst weist auf Anfrage darauf hin, im Jahr 2020 sogar Sach-spenden im Wert von rund 40 Millio-nen Euro an Bund und Länder getätigt zu haben, von denen rund zwei Drittel an Spahns Ministerium gingen. Aus „unternehmerischer Verantwortung“, wie es heißt.
Höherer Etat für das Gesundheitsministerium
Allein für Schutzausrüstungen, zu de-nen auch Masken gehören, gab es pri-vate Spenden in Höhe von fast 50 Mil-lionen Euro. Laut Gesundheitsministe-rium habe BASF allein 121 Millionen Schutzmasken geliefert. BASF hinge-gen teilte auf Anfrage mit, lediglich 100 Millionen Masken geliefert zu haben. Zu den Spendern gehörte ebenso Ali-baba (1,1 Millionen Euro), Apple (730.000 Euro), Novartis und Amazon (je 117.000 Euro) sowie Astra-Zeneca (351.000 Euro).
Auch der holländische Brillenher-steller Ace and Tate (5799 Euro) sowie der chinesische Mischkonzern Fosun (24.570 Euro) unterstützten den Kauf von Schutzausrüstung. Der Milliardär Charles Brown spendete über seine In-vestmentfirma Lake House nach eige-nem Bekunden eine Million Masken im Wert von 1,17 Millionen Euro.
Das Sponsoring der Verwaltung unterliegt ebenso wie Spenden und sonstigen Schenkungen strengen Re-geln, die der Bund in einer Verwal-tungsvorschrift festgelegt hat. Dem-nach muss „schon jeder Anschein fremder Einflussnahme vermieden werden“, heißt es im Integritätsbericht. „Daher ist eine restriktive und transpa-rente Handhabung geboten.“
Der Bericht listet jede Zuwendung über 5000 Euro gemeinsam mit dem Namen des Gebers und dem Grund der Spende auf. Laut diesem sei der Anteil des Sponsorings gemessen an der Höhe des Bundeshaushalts von rund 716 Milliarden Euro (2019 und 2020) „verschwindend gering“. Die
Leistungen seien Projekten zugutege-kommen, „die ohne die Leistung Drit-ter nicht oder nur in geringerem Um-fang hätten verwirklicht werden kön-nen“. Das Ministerium beruft sich auf diese Vorschrift.
Gilt dies aber etwa für das Sponso-ring von Twitter (8300 Euro), LinkedIn (10.000 Euro), Facebook (1,7 Millionen Euro) und Google (2,1 Millionen)? Die Unternehmen haben „Gutscheine zur Platzierung von Informationen“ ans Ministerium zur „Bewältigung der Co-ronapandemie“ verschenkt.
Facebook teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen weltweit Ge-sundheitsorganisationen unterstützt habe. Google stellte für solche Zwecke weltweit Gutscheine in Höhe von 215 Millionen Euro aus. Konkret nutzte Spahns Ministerium diese sogenannten Ad Grants nach eigenen Angaben zwi-schen März 2020 und April 2021. Da-mit habe man die Reichweite von In-
formationen über das Coronavirus und die Schutzimpfung erhöhen können, teilte das Ministerium mit.
Allerdings stellte die Bundesregie-rung etwa für den Zweck Information und Aufklärung zusätzliche Haushalts-mittel von 365 Millionen Euro zur Ver-fügung. Die Facebook- und Google-Kampagnen hätten also durchaus auch vollständig mit Steuermitteln finanziert werden können.
Auch steht die Frage im Raum, wa-rum Hilfen für den Einkauf von Mas-ken etwa angesichts der vergleichswei-se geringen Summe gemessen am Haushalt des Gesundheitsministers nicht bezahlt wurden. Denn in der Co-ronapandemie war Spahns Etat deut-lich aufgestockt worden. Im Jahr 2019 lagen die Ausgaben bei 15,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Coronapandemie, wurde der Etat dann auf 41,25 Milliarden Euro auf-gestockt, also fast verdreifacht. Und für dieses Jahr sieht der Nachtragshaushalt Ausgaben von 44 Milliarden Euro vor.
„Generell ist es kritisch zu sehen, wenn staatliche Aufgaben durch exter-ne Private finanziert werden“, sagt Norman Loeckel, Leiter der Arbeits-gruppe Transparente Verwaltung bei der Nichtregierungsorganisation Transparency Deutschland. Der Staat erhebe Steuern und Gebühren, um sei-ne Aufgaben zu erfüllen. „Im vorliegen-den Einzelfall mag vielleicht keine kon-krete Absicht seitens der Firmen vor-handen gewesen sein, sich über diese Art von ,Sponsoring‘ mit der Regierung gut zu stellen oder Einfluss zu gewin-nen.“ Allerdings genüge bereits der schlechte Anschein, um in der Öffent-lichkeit die Unabhängigkeit der Behör-den infrage zu stellen, sofern es künftig zu Entscheidungen zugunsten eines beteiligten Unternehmens komme, warnt Loeckel.
Sponsoring sei ähnlich problema-tisch wie die einstige Praxis von Fir-men, Mitarbeiter in Ministerien zu ent-senden und zu bezahlen, „eine Praxis, die mittlerweile weitgehend eingestellt wurde“.
Gesundheitsminister Spahn: Werbegutscheine von Google und Facebook
für Coronaaufklärung.
Spenden der Wirtschaft an den Staat: Summe in Euro, Anteil in Prozent
HANDELSBLATT
Gesponsorte Regierung
Quelle:
98,4Mio. €
164,1Mio. €
2019 bis 2020
Gesamt
131 Mio. €
21 Mio. €
3 Mio. €
73 Mio. €
70 Mio. €
11 Mio. €
Verwendungszweck/Art
Pho
toth
ek/G
etty
Imag
es
Sponsoring
Wenn Konzerne Ministerien
Millionen spendenBASF, Volkswagen, Facebook, Google: Ein Regierungsbericht
listet Coronaspenden von mehr als 60 Millionen Euro auf. Transparency kritisiert das Sponsoring durch Unternehmen.
Generell ist es kritisch zu sehen, wenn
staatliche Aufgaben durch externe Private
finanziert werden.
Norman LoeckelTransparency Deutschland
Politik
10 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D ie explodierenden Gaspreise wir-ken sich nicht nur auf die Ener-giepreise insgesamt, sondern auch auf das Logistik- und Trans-
portgewerbe aus. Inzwischen gibt es Lieferengpässe und derart stark stei-gende Preise für das Abgasreinigungs-mittel AdBlue, dass die Branche mit Flottenstilllegungen rechnet und von einem „drohenden Versorgungskollaps mit AdBlue als essenziellem Hilfsstoff zum Betrieb von Lkws und Bussen mit Euro VI-Motoren“ schreibt.
Dies geht aus einem Brief des Bun-desverbands Güterkraftverkehr Logis-tik und Entsorgung (BGL) sowie des Bundesverbands Deutscher Omnibus-unternehmer (BDO) an den geschäfts-führenden Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hervor.
In ihrem Brief weisen die Verbände darauf hin, dass der Preis je Liter Ad-blue von 19 auf 69 Cent gestiegen sei und Unternehmen vermehrt berichte-ten, dass „Lieferanten die Lieferung einstellen“. Gäbe es bundesweit kein AdBlue mehr, dann seien 90 Prozent der Lkw-Transporte betroffen. „Die Fahrzeuge müssten faktisch stehen bleiben“, warnen die Verbände. „Die Lieferketten wären damit akut gefähr-det, die Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen nicht mehr sicher.“
Ammoniak-Hersteller legen Produktionen still
Der Engpass bei AdBlue ist Folge der massiv gedrosselten Produktion bei den führenden Herstellern von Ammo-niak, aus dem der benötigte Harnstoff gewonnen wird. Der größte deutsche Anbieter SKW Piesteritz aus Luther-stadt Wittenberg hat vor wenigen Ta-gen die Produktion weiter herunterge-fahren und mittlerweile ein Drittel der Kapazitäten stillgelegt.
Dabei lohnt sich die Produktion nicht nur wegen der rasant gestiegenen Erdgaspreise. Die Ammoniak-Pro-duzenten sind vielmehr von drei Seiten unter Druck: Sie brauchen Gas einer-seits als Energieträger in der Produk-tion. Zugleich ist es der wichtigste Roh-stoff für die Ammoniak-Herstellung: Aus Gas wird mithilfe von Wasser der benötigte Wasserstoff gewonnen.
Dazu kommen die Kosten für den Erwerb von CO2-Zertifikaten. Neben SKW haben zahlreiche andere große Ammoniak-Anbieter ihre Produktion gesenkt und ganze Werke stillgelegt. Bei der norwegischen Yara, als welt-weit zweitgrößtem Ammoniakliefe-ranten, liegt die Drosselung bei 40 Pro-zent. Auch BASF hat die Fertigung an den Standorten Ludwigshafen und Antwerpen zurückgefahren.
Ebenso warnt der Bundesverband Spedition und Logistik entsprechend: „Bei vielen Fahrzeugen erlaubt die Mo-torsteuerung bei leerem AdBlue-Tank gar keinen Neustart, der Lkw bleibt dann stehen“, erklärte Hauptgeschäfts-führer Frank Huster. Zwar gebe es noch keinen flächendeckenden Ad-Blue-Engpass, allerdings stiegen die Preise aufgrund der sprunghaft gestie-genen Nachfrage spürbar.
Zur steigenden Nachfrage gehören Hamsterkäufe. So hatte etwa auch der ADAC Vielfahrern geraten, unter Um-ständen AdBlue zu bevorraten, da be-reits der „zweite Preisschock nach den
aktuellen Spritpreisen auf Rekord-niveau“ drohe. Der Verbrauch je Fahr-zeug liege bei drei bis fünf Prozent des Kraftstoffverbrauchs.
Für gewöhnlich müsse AdBlue nur ein- bis zweimal im Jahr nachgefüllt werden. Branchenvertreter Huster warnte davor, dass Käufe auf Vorrat die Verknappung weiter anheizen. „Im schlimmsten Fall könnte dies eine zu-sätzliche Bruchstelle in den ohnehin sehr angespannten Lieferketten wer-den.“ Neben den Transporteuren sind auch die Landwirte betroffen, da Am-moniak ebenfalls bei der Düngemittel-produktion zum Einsatz kommt.
„Der Energiepreisschock erfasst auch die Landwirtschaft, nicht nur beim Diesel, sondern auch bei Dünge-mitteln“, sagte der stellvertretende Ge-neralsekretär des Deutschen Bauern-verbandes, Udo Hemmerling. Er warnt ebenso vor Versorgungsengpässen. „Wenn Dünger fehlt, gibt es geringere Ernten. Wenn Adblue fehlt, bedeutet dies Stillstand in den Lieferketten. Auch Traktoren und Mähdrescher brauchen Adblue.“
Um das Problem kurzfristig zu lö-sen, fordern BGL und BDO in ihrem Brief einen Runden Tisch mit Vertre-tern des Wirtschafts-, des Verkehrs- und des Umweltministeriums mit den Produzenten und Händlern sowie den Nutzern. Die Runde soll klären, dass zumindest die Produktion weiterläuft und trotz der gestiegenen Preise die Versorgung gewährleistet wird.
Doch dürfte es dazu so bald nicht kommen. Zwar bestätigt das Ministe-rium die Bedeutung von AdBlue für Lastwagen und Busse mit Euro-VI Motoren. Allerdings verwies sie ebenso darauf, dass „vor allem der Last- und Busverkehr und damit der Zuständig-keitsbereich des Bundesverkehrsminis-teriums betroffen“ sei.
Bundesverkehrsminister AndreasScheuer (CSU) sagte hingegen, er neh-me die Warnungen der Logistiker„sehr ernst“. Die internationalenTransportketten seien allein wegen derCoronapandemie immer noch sehr an-gespannt. „Dass Teile des Straßen-transports durch einen Rohstoffmangelausfallen, können wir uns da einfachnicht leisten. Oberstes Ziel muss essein, unsere Lieferketten weiter amLaufen zu halten.“
BGL-Vorstandssprecher Dirk En-gelhardt versucht derweil, selbst eineLösung zu finden. „Aufgrund von Lie-ferstopps und sehr starker Mengen-sanktionierungen einiger Großhändlervon AdBlue versuchen wir aktuell, di-rekten Kontakt mit den Herstellernaufzunehmen“, sagte er dem Handels-blatt. D. Delhaes, B.-F. Fröndhoff
Energiepreise
AdBlue wird knapp: Transporteure schlagen AlarmHersteller, Logistik und Landwirte warnen vor einem Versorgungskollaps des Abgasreinigungsmittels. Die Politik winkt ab.
Leere Stationen: Die Versorgung mit AdBlue
stockt derzeit.
imag
o/C
ord
90Prozent
der Lkw-Transporte wären betrof-fen, gäbe es kein AdBlue mehr.
Quelle: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung
Politik
11WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Mehr Analysen, Kommentare und Studien von Professor Rürup und seinem Team
erhalten Sie auf der Webseite https://research.
handelsblatt.com/de/
All jene, die in diesem Jahr auf einen ähnlich kräftigen Post-Corona-Aufschwung wie im Sommer des Vorjahres gehofft hatten, wur-den vergangene Woche vom Statisti-schen Bundesamt eines Besseren belehrt.
Die deutsche Wirtschaft wuchs in diesem Som-merquartal nur um 1,8 Prozent. In der Summe dürfte daher für das Gesamtjahr 2021 ein Wirt-schaftswachstum von 2,5 bis 2,7 Prozent in den Büchern stehen. Der massive Einbruch des Vor-jahres wäre damit – entgegen vielfachen Erwar-tungen – noch längst nicht aufgeholt.
Nicht wenige Konjunkturexperten sind der Meinung, dass der von ihnen vorhergesagte Boom jedoch keineswegs aufgehoben, sondern nur auf-geschoben sei. Das Institut für Weltwirtschaft sag-te jüngst sogar gut fünf Prozent Wachstum für 2022 voraus. Die Experten des Bundeswirt-schaftsministeriums rechnen für 2022 mit 4,1 Prozent und einer Überauslastung der gesamt-wirtschaftlichen Produktionskapazitäten, was – nebenbei bemerkt – ein klassischer Inflationstrei-ber wäre.
Natürlich ist ein solcher Boom, in dem zu-rückgestaute Produktion und ausgefallener Kon-sum in kurzer Zeit nachgeholt werden, ein mög-liches Szenario. Fraglich ist jedoch, ob es das wahr-scheinlichste ist.
Schließlich erleben wir, dass das Coronavirus keineswegs besiegt ist. Zwar wird es in Deutsch-land wohl keinen weiteren Lockdown geben. Doch schon jetzt, zu Beginn der vierten Welle, zeigt sich, dass viele Menschen Massenveranstal-tungen etwa in Fußballstadien meiden. Und auch auf vielen Weihnachtsmärkten wird wohl deutlich weniger Gedränge als in früheren Jahren herr-schen. Hinzu kommt, dass die hohe Inflation die Kaufkraft der Konsumenten spürbar mindert.
Für die kommenden Jahre deutet sich eine Jo-Jo-Konjunkturentwicklung an
Höchst ungewiss ist zudem, ob das Geschäft mit Tagungen und Dienstreisen jemals wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird. Videokonferen-zen sind etabliert, sodass sich viele Business-Ho-tels ernsthaft Sorgen machen. Ein echter Nach-holboom ist in diesem Bereich ausgeschlossen.
Viel wahrscheinlicher als ein rasanter Auf-schwung ist, dass die deutsche Volkswirtschaft noch einige Quartale mit einer Jo-Jo-Konjunktur wird leben müssen – Einbruch in Herbst und Winter, Aufschwung in Frühjahr und Sommer. Vermutlich werden die Konjunkturausschläge all-mählich schwächer, bis die Wirtschaft schließlich wieder im sich abschwächenden Trend wächst, also im Schnitt um rund 0,25 Prozent pro Quartal zulegen wird.
Das wohl größte Problem der industrie- und exportlastigen deutschen Volkswirtschaft sind die Störungen in den globalen Lieferketten, vor allem der weltweite Halbleitermangel. Zum einen muss wegen der rigorosen Anti-Corona-Politik Chinas jederzeit mit wochenlangen Hafenschlie-ßungen gerechnet werden. Zum anderen wird es noch viele Monate dauern, bis die globale Chip-produktion wieder Normalniveau erreicht.
Wegen der sehr langen Produktionszyklen dürfte es noch einige Quartale dauern, bis wieder die üblichen Mengen geliefert werden können. Zudem dürften die offenkundig gewordenen Ab-hängigkeitsverhältnisse die Hersteller zu dauer-haften Preiserhöhungen veranlassen, was die Her-stellungskosten in die Höhe treiben wird.
Hinzu kommt, dass die kurzfristigen Roh-stoffpreissteigerungen sowie die notwendigen langfristigen Klimaschutzbemühungen die Pro-duktions- und Transportkosten fast aller Waren spürbar steigen lassen werden. Das senkt die Mar-gen von Herstellern und Händlern oder – wenn die Überwälzung auf die Abnehmer gelingt – die Kaufkraft der Kunden. Eine Rückkehr auf den vor
der Pandemie prognostizierten Wachstumspfad ist somit keineswegs sicher.
Mit jeder Milliarde weniger Wirtschaftsleis-tung fehlen Regierung und Sozialversicherungen etwa 400 Millionen Euro Steuer- und Beitrags-einnahmen. Will die künftige Bundesregierung die Schuldenbremse nicht umgehen und zudem auf Steuer- und Beitragserhöhungen verzichten, dann muss sie sich entscheiden, ob sie ihre knap-pen Ressourcen zur Modernisierung und Digita-lisierung des Kapitalstocks, zur Rettung des Welt-klimas oder zur Stabilisierung der Sozialsysteme verwendet. Der politische Streit um knappe Steu-ermittel dürfte hart und konfliktbehaftet werden. Wichtiges von Wünschbarem zu unterscheiden wird daher zur obersten Maxime der neuen Re-gierung werden.
Am meisten bewegen die Bürger derzeit die stark steigenden Preise; das vom Handelsblatt Re-search Institute monatlich berechnete HDE-Kon-sumbarometer signalisiert so große Inflationssor-gen der Verbraucher wie noch nie seit Beginn der Datenreihen. Da Inflation die Ärmsten stets am härtesten trifft, ist die Regierung gut beraten, zum Jahreswechsel alle Fürsorgeleistungen an die hohe Teuerung anzupassen.
Die noch von der Großen Koalition beschlos-sene Erhöhung von Hartz-IV-Leistungen und So-zialhilfe um 0,76 Prozent – also drei Euro pro Mo-nat – ist angesichts einer Inflation von bald fünf Prozent schwer vermittelbar, selbst wenn die An-passung später nachgeholt wird.
Eine Bundesregierung, die sich den Klima-schutz auf die Fahne schreibt, sollte überlegen, ob es klug ist, die CO2-freie Atomstromproduk-tion durch klimaschädliche Gas- oder gar Koh-leverstromung zu ersetzen. Derzeit laufen noch sechs Atommeiler, drei davon werden in diesem Jahr und die restlichen bis Ende 2022 nach ver-gleichsweise kurzen Laufzeiten von rund 35 Jah-ren abgeschaltet.
Spätestens dann wird Deutschland zum Net-toimporteur von Strom – und wenn es darum geht, einen Blackout zu vermeiden, wird niemand danach fragen, ob es Atomstrom aus Frankreich oder Gasstrom aus den Niederlanden ist, welcher das deutsche Netz vor dem Zusammenbruch ret-tet. Sicher, in Atomkraftwerken entstehen hoch-giftige Abfälle, aber das Endlagerproblem muss sowieso gelöst werden. Zusätzliche Mengen fallen
da kaum ins Gewicht. Und auch die Chemieindus-trie produziert Giftmüll – und bislang wird deren Existenz nicht infrage gestellt.
So wünschenswert eine Unternehmensteuer-reform ist, so klar ist, dass Steuersenkungen für Unternehmen politisch nicht vermittelbar sind, wenn Geld für eine Einkommensteuerreform fehlt. Gleichwohl droht Deutschland im Wett-bewerb um international mobiles Investitionska-pital weiter ins Hintertreffen zu geraten.
Temporäre degressive Abschreibungen haben sich in der Vergangenheit als Lockmittel für In-vestitionen erwiesen – und haben den Vorteil, dass sie für den Staat nicht mit dauerhaften Ein-nahmeeinbußen verbunden sind. Den Steueraus-fällen in der ersten Zeit stehen höhere Einnahmen zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber.
Kürzere Abschreibungsfristen passen besser zum aktuellen Maschinenpark
Perspektivisch sollten freilich die Abschreibungs-tabellen gründlich überarbeitet werden. Sie stam-men überwiegend aus dem vergangenen Jahrhun-dert, als Maschinen meist hauptsächlich aus Stahl und Kunststoff sowie einem robusten und leis-tungsstarken Motor bestanden. Heute haben je-doch viele Investitionsgüter einen hohen Soft-ware- und Halbleiteranteil – mit der Folge, dass die Technik wesentlich schneller veraltet als die von traditionellen Maschinen. Realitätsnähere Abschreibungsfristen wären für viele Investitions-güter also angezeigt.
Ein solches Sofortprogramm würde den Standort Deutschland durch eine sicherere Ener-gieversorgung stärken und die CO2-Bilanz ver-bessern. Dringend benötigte private Investitionen würden durch bessere Abschreibungsregeln sti-muliert, sodass die deutsche Volkswirtschaft auf einen höheren Wachstumspfad gelangen könnte.
Nicht zuletzt würden Bedürftige für die ak-tuellen Preissprünge bei vielen Alltagsgütern kompensiert. Ohne eine Anhebung der Grund-sicherung würde die von SPD, Grünen und FDP angekündigte kräftige Erhöhung des Mindest-lohns die soziale Kluft weiter vergrößern. Die Po-litikverdrossenheit vieler, die sich als sozial Ab-gehängte betrachten, stiege weiter. Solch ein So-fortprogramm wäre zielführend, vergleichsweise kostengünstig, sozial gerecht und klimaschonend. Viel mehr kann man sich kaum wünschen.
Der Chefökonom
Ein Sofortprogramm für die Ampel Rund 300 Politikerinnen und Politiker verhandeln den neuen Koalitionsvertrag. Dabei droht der Blick
für das Notwendige verloren zu gehen, warnen Bert Rürup und Axel Schrinner.
Der Chefökonom Prof. Bert Rürup ist
Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handels-blatts. Er war viele Jahre
Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats
und Berater mehrerer Bundesregierungen sowie
ausländischer Regierungen.
HANDELSBLATT • Quelle: BMWi
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt (Index: 2015 = 100) Herbstprognose des Bundeswirtschaftsministeriums
Verlauf, vierteljährlich, in Preisen des Vorjahres, saison- und kalenderbereinigtJahresdurchschnitte, in Preisen des Vorjahres, Veränderungen gegenüber Vorjahr in Prozent
Konjunkturerholung mit Unterbrechung
2023 20242018 2019 2020 2021 2022
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
+1,1 %+1,1 %
-4,6 %
+2,6 %
+4,1 %
+1,6 %
Digital
Politik
12 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Mehr Analysen, Kommentare und Studien von Professor Rürup und seinem Team
erhalten Sie auf der Webseite https://research.
handelsblatt.com/de/
All jene, die in diesem Jahr auf einen ähnlich kräftigen Post-Corona-Aufschwung wie im Sommer des Vorjahres gehofft hatten, wur-den vergangene Woche vom Statisti-schen Bundesamt eines Besseren belehrt.
Die deutsche Wirtschaft wuchs in diesem Som-merquartal nur um 1,8 Prozent. In der Summe dürfte daher für das Gesamtjahr 2021 ein Wirt-schaftswachstum von 2,5 bis 2,7 Prozent in den Büchern stehen. Der massive Einbruch des Vor-jahres wäre damit – entgegen vielfachen Erwar-tungen – noch längst nicht aufgeholt.
Nicht wenige Konjunkturexperten sind der Meinung, dass der von ihnen vorhergesagte Boom jedoch keineswegs aufgehoben, sondern nur auf-geschoben sei. Das Institut für Weltwirtschaft sag-te jüngst sogar gut fünf Prozent Wachstum für 2022 voraus. Die Experten des Bundeswirt-schaftsministeriums rechnen für 2022 mit 4,1 Prozent und einer Überauslastung der gesamt-wirtschaftlichen Produktionskapazitäten, was – nebenbei bemerkt – ein klassischer Inflationstrei-ber wäre.
Natürlich ist ein solcher Boom, in dem zu-rückgestaute Produktion und ausgefallener Kon-sum in kurzer Zeit nachgeholt werden, ein mög-liches Szenario. Fraglich ist jedoch, ob es das wahr-scheinlichste ist.
Schließlich erleben wir, dass das Coronavirus keineswegs besiegt ist. Zwar wird es in Deutsch-land wohl keinen weiteren Lockdown geben. Doch schon jetzt, zu Beginn der vierten Welle, zeigt sich, dass viele Menschen Massenveranstal-tungen etwa in Fußballstadien meiden. Und auch auf vielen Weihnachtsmärkten wird wohl deutlich weniger Gedränge als in früheren Jahren herr-schen. Hinzu kommt, dass die hohe Inflation die Kaufkraft der Konsumenten spürbar mindert.
Für die kommenden Jahre deutet sich eine Jo-Jo-Konjunkturentwicklung an
Höchst ungewiss ist zudem, ob das Geschäft mit Tagungen und Dienstreisen jemals wieder das Vorkrisenniveau erreichen wird. Videokonferen-zen sind etabliert, sodass sich viele Business-Ho-tels ernsthaft Sorgen machen. Ein echter Nach-holboom ist in diesem Bereich ausgeschlossen.
Viel wahrscheinlicher als ein rasanter Auf-schwung ist, dass die deutsche Volkswirtschaft noch einige Quartale mit einer Jo-Jo-Konjunktur wird leben müssen – Einbruch in Herbst und Winter, Aufschwung in Frühjahr und Sommer. Vermutlich werden die Konjunkturausschläge all-mählich schwächer, bis die Wirtschaft schließlich wieder im sich abschwächenden Trend wächst, also im Schnitt um rund 0,25 Prozent pro Quartal zulegen wird.
Das wohl größte Problem der industrie- und exportlastigen deutschen Volkswirtschaft sind die Störungen in den globalen Lieferketten, vor allem der weltweite Halbleitermangel. Zum einen muss wegen der rigorosen Anti-Corona-Politik Chinas jederzeit mit wochenlangen Hafenschlie-ßungen gerechnet werden. Zum anderen wird es noch viele Monate dauern, bis die globale Chip-produktion wieder Normalniveau erreicht.
Wegen der sehr langen Produktionszyklen dürfte es noch einige Quartale dauern, bis wieder die üblichen Mengen geliefert werden können. Zudem dürften die offenkundig gewordenen Ab-hängigkeitsverhältnisse die Hersteller zu dauer-haften Preiserhöhungen veranlassen, was die Her-stellungskosten in die Höhe treiben wird.
Hinzu kommt, dass die kurzfristigen Roh-stoffpreissteigerungen sowie die notwendigen langfristigen Klimaschutzbemühungen die Pro-duktions- und Transportkosten fast aller Waren spürbar steigen lassen werden. Das senkt die Mar-gen von Herstellern und Händlern oder – wenn die Überwälzung auf die Abnehmer gelingt – die Kaufkraft der Kunden. Eine Rückkehr auf den vor
der Pandemie prognostizierten Wachstumspfad ist somit keineswegs sicher.
Mit jeder Milliarde weniger Wirtschaftsleis-tung fehlen Regierung und Sozialversicherungen etwa 400 Millionen Euro Steuer- und Beitrags-einnahmen. Will die künftige Bundesregierung die Schuldenbremse nicht umgehen und zudem auf Steuer- und Beitragserhöhungen verzichten, dann muss sie sich entscheiden, ob sie ihre knap-pen Ressourcen zur Modernisierung und Digita-lisierung des Kapitalstocks, zur Rettung des Welt-klimas oder zur Stabilisierung der Sozialsysteme verwendet. Der politische Streit um knappe Steu-ermittel dürfte hart und konfliktbehaftet werden. Wichtiges von Wünschbarem zu unterscheiden wird daher zur obersten Maxime der neuen Re-gierung werden.
Am meisten bewegen die Bürger derzeit die stark steigenden Preise; das vom Handelsblatt Re-search Institute monatlich berechnete HDE-Kon-sumbarometer signalisiert so große Inflationssor-gen der Verbraucher wie noch nie seit Beginn der Datenreihen. Da Inflation die Ärmsten stets am härtesten trifft, ist die Regierung gut beraten, zum Jahreswechsel alle Fürsorgeleistungen an die hohe Teuerung anzupassen.
Die noch von der Großen Koalition beschlos-sene Erhöhung von Hartz-IV-Leistungen und So-zialhilfe um 0,76 Prozent – also drei Euro pro Mo-nat – ist angesichts einer Inflation von bald fünf Prozent schwer vermittelbar, selbst wenn die An-passung später nachgeholt wird.
Eine Bundesregierung, die sich den Klima-schutz auf die Fahne schreibt, sollte überlegen, ob es klug ist, die CO2-freie Atomstromproduk-tion durch klimaschädliche Gas- oder gar Koh-leverstromung zu ersetzen. Derzeit laufen noch sechs Atommeiler, drei davon werden in diesem Jahr und die restlichen bis Ende 2022 nach ver-gleichsweise kurzen Laufzeiten von rund 35 Jah-ren abgeschaltet.
Spätestens dann wird Deutschland zum Net-toimporteur von Strom – und wenn es darum geht, einen Blackout zu vermeiden, wird niemand danach fragen, ob es Atomstrom aus Frankreich oder Gasstrom aus den Niederlanden ist, welcher das deutsche Netz vor dem Zusammenbruch ret-tet. Sicher, in Atomkraftwerken entstehen hoch-giftige Abfälle, aber das Endlagerproblem muss sowieso gelöst werden. Zusätzliche Mengen fallen
da kaum ins Gewicht. Und auch die Chemieindus-trie produziert Giftmüll – und bislang wird deren Existenz nicht infrage gestellt.
So wünschenswert eine Unternehmensteuer-reform ist, so klar ist, dass Steuersenkungen für Unternehmen politisch nicht vermittelbar sind, wenn Geld für eine Einkommensteuerreform fehlt. Gleichwohl droht Deutschland im Wett-bewerb um international mobiles Investitionska-pital weiter ins Hintertreffen zu geraten.
Temporäre degressive Abschreibungen haben sich in der Vergangenheit als Lockmittel für In-vestitionen erwiesen – und haben den Vorteil, dass sie für den Staat nicht mit dauerhaften Ein-nahmeeinbußen verbunden sind. Den Steueraus-fällen in der ersten Zeit stehen höhere Einnahmen zu einem späteren Zeitpunkt gegenüber.
Kürzere Abschreibungsfristen passen besser zum aktuellen Maschinenpark
Perspektivisch sollten freilich die Abschreibungs-tabellen gründlich überarbeitet werden. Sie stam-men überwiegend aus dem vergangenen Jahrhun-dert, als Maschinen meist hauptsächlich aus Stahl und Kunststoff sowie einem robusten und leis-tungsstarken Motor bestanden. Heute haben je-doch viele Investitionsgüter einen hohen Soft-ware- und Halbleiteranteil – mit der Folge, dass die Technik wesentlich schneller veraltet als die von traditionellen Maschinen. Realitätsnähere Abschreibungsfristen wären für viele Investitions-güter also angezeigt.
Ein solches Sofortprogramm würde den Standort Deutschland durch eine sicherere Ener-gieversorgung stärken und die CO2-Bilanz ver-bessern. Dringend benötigte private Investitionen würden durch bessere Abschreibungsregeln sti-muliert, sodass die deutsche Volkswirtschaft auf einen höheren Wachstumspfad gelangen könnte.
Nicht zuletzt würden Bedürftige für die ak-tuellen Preissprünge bei vielen Alltagsgütern kompensiert. Ohne eine Anhebung der Grund-sicherung würde die von SPD, Grünen und FDP angekündigte kräftige Erhöhung des Mindest-lohns die soziale Kluft weiter vergrößern. Die Po-litikverdrossenheit vieler, die sich als sozial Ab-gehängte betrachten, stiege weiter. Solch ein So-fortprogramm wäre zielführend, vergleichsweise kostengünstig, sozial gerecht und klimaschonend. Viel mehr kann man sich kaum wünschen.
Der Chefökonom
Ein Sofortprogramm für die Ampel Rund 300 Politikerinnen und Politiker verhandeln den neuen Koalitionsvertrag. Dabei droht der Blick
für das Notwendige verloren zu gehen, warnen Bert Rürup und Axel Schrinner.
Der Chefökonom Prof. Bert Rürup ist
Präsident des Handelsblatt Research Institute (HRI) und Chefökonom des Handels-blatts. Er war viele Jahre
Mitglied und Vorsitzender des Sachverständigenrats
und Berater mehrerer Bundesregierungen sowie
ausländischer Regierungen.
HANDELSBLATT • Quelle: BMWi
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt (Index: 2015 = 100) Herbstprognose des Bundeswirtschaftsministeriums
Verlauf, vierteljährlich, in Preisen des Vorjahres, saison- und kalenderbereinigtJahresdurchschnitte, in Preisen des Vorjahres, Veränderungen gegenüber Vorjahr in Prozent
Konjunkturerholung mit Unterbrechung
2023 20242018 2019 2020 2021 2022
118
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
+1,1 %+1,1 %
-4,6 %
+2,6 %
+4,1 %
+1,6 %
Digital
Politik
12 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Dana Heide Peking
In einem historischen Umbruch re-gelt die chinesische Staatsführung derzeit den Umgang mit in der Volksrepublik generierten Daten neu – mit massiven Folgen für Un-
ternehmen. Nach den chinesischen Tech-Konzernen dürften jetzt auch die multinationalen Konzerne mit Nieder-lassungen in der Volksrepublik stärker betroffen sein.
Derzeit veröffentlichen chinesische Behörden fast im Wochentakt neue Regeln zum Umgang mit Daten. An-fang dieser Woche trat in der Volksre-publik das Gesetz zum Schutz Persön-licher Daten (PIPL) in Kraft.
Erstmals gibt es damit ein umfas-sendes Regelwerk, das die persönlichen Daten von Menschen in China schüt-zen soll – allerdings nur mit Blick auf Unternehmen, nicht auf den Staat. Der hat weiterhin nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten.
Auch für europäische Firmen mit Vertretungen in China haben die neu-en Regeln massive Folgen. In seinen Grundzügen ähnelt das PIPL der euro-päischen Datenschutzgrundverord-nung. Für viele europäische Unterneh-men dürfte es daher zwar eine Umstel-lung sein, die neuen Regeln zu befolgen, halten Experten aber grund-sätzlich durchaus für machbar.
Schwieriger jedoch ist das Daten-sicherheitsgesetz (DSL). Es ist bereits im September in Kraft getreten und wurde in den vergangenen Wochen immer weiter konkretisiert. Besonders heikel: Mit dem Gesetz wird der grenz-überschreitende Datentransfer dras-tisch eingeschränkt.
Am Freitag veröffentlichte die chi-nesische Internetaufsichtsbehörde Cy-berspace Administration of China (CAC) erstmals einen neuen Entwurf dazu, wie der restriktivere Datentrans-fer genauer aussehen könnte.
Im Sommer hatte die Behörde be-reits verkündet, dass sich Unterneh-men mit Daten von mehr als einer Mil-lion Nutzern einer Sicherheitsüberprü-fung unterziehen müssen, bevor sie Anteile an einer internationalen Börse listen. „Die chinesische Staatsführung hat sehr gut verstanden, dass Daten ei-ne wichtige Ressource sind“, sagt Jost Wübbeke von der Berliner China-Un-ternehmensberatung Sinolytics.
„Sie ist sich sehr bewusst, dass der Fluss von Daten auch geopolitische Gegner begünstigen kann.“ Digitale Geschäftsmodelle bilden inzwischen ei-nen der wichtigsten Pfeiler der chine-sischen Wirtschaft. Die größten chine-sischen Privatunternehmen nach Marktkapitalisierung sind neben den traditionell großen Banken und Ver-sicherungen vor allem Tech-Konzerne: Alibaba, Tencent, Meituan, Pinduoduo.
Gemessen in absoluten Zahlen, hat China die größte Digitalwirtschaft der Welt, Tendenz steigend. Während die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Jahr insgesamt nur um 2,3 Prozent wuchs, legte die Digitalwirt-
schaft für sich allein genommen um 9,7 Prozent zu. Peking fährt daher zweiglei-sig: Auf der einen Seite will es die Nut-zung von Daten für geschäftliche Zwe-cke fördern. Daten werden seit Kurzem als Produktionsfaktor gesehen – neben den traditionellen Faktoren im chine-sischen System: Kapital, Land, Arbeits-kraft, Technologie.
Die Chinas Führung will, dass Fir-men stärker auf das immense Daten-
vorkommen des Landes zurückgreifen, um das schwächelnde Wirtschafts-wachstum anzukurbeln. Auf der ande-ren Seite will sie die Daten stärker als bislang kontrollieren.
Am deutlichsten wurde das bislang beim chinesischen Fahrdienstleister Di-di. Im Sommer hatte Chinas Internet-aufsichtsbehörde CAC wegen Risiken für die Datensicherheit und die nationale Sicherheit eine umfassende Unter-suchung bei dem Unternehmen gestar-tet. In der Folge brach der Aktienkurs des Unternehmens, das auch als das chi-nesische Pendant zum amerikanischen Fahrdienstleister Uber bekannt ist, ein und es verlor zeitweise fast ein Drittel seiner täglichen Nutzer.
Europäische Firmen sorgen sichAuch europäische Unternehmen sind angesichts der neuen Regeln für den Umgang mit Daten in der Volksrepu-blik besorgt. Bei einer Umfrage der Eu-ropäischen Kammer in Peking gab ein Drittel der befragten Unternehmen mit Geschäften in China an, dass das Cy-bersecurity-Law, das Data-Security-Law und das Personal-Information-Schutzgesetz in den nächsten fünf Jah-ren einen negativen Einfluss auf ihr Unternehmen haben werden.
Vor allem das Datensicherheits-gesetz bereitet ihnen Kopfzerbrechen. Dem jüngsten Entwurf des CAC zu den Richtlinien für grenzüberschreiten-den Datentransfer zufolge müssen alle Unternehmen, die in China gesammel-te Daten verarbeiten, eine Selbstprü-fung der Risiken durchführen, die mit einer Übertragung der Daten ins Aus-land verbunden sind. Ein breites Spek-trum von Daten soll einer staatlichen Sicherheitsprüfung unterzogen werden, bevor sie ins Ausland transferiert wer-den dürfen. Zu den Unternehmen, die
vor dem Export von Daten grünes Licht vom CAC einholen müssen, gehören Betreiber kritischer Informationsinfra-strukturen und Eigentümer „wichtiger Daten“, heißt es in dem Entwurf.
„Eine Unsicherheit in den Gesetzen ist die vage Definition von ,nationaler Sicherheit‘“, sagt Jens Hildebrandt, ge-schäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China. Es sei notwendig, Klarheit über die An-forderungen zur Lokalisierung von Da-ten und deren Transfer von Daten ins Ausland zu schaffen. Beobachter rech-nen damit, dass die Flut an neuen Re-
gulierungen nicht so schnell abebben wird. „Bei der Konkretisierung des Da-tensicherheitsgesetzes wird man im nächsten Jahr besser absehen können, in welcher Härte es umgesetzt wird“, sagt Mareike Seeßelberg, Senior Con-sultant bei Chinabrand IP Consulting in München. „Wenn es so sein wird, dass die Unternehmen für bestimmte Datentypen regelmäßig Genehmigun-gen zur Übertragung brauchen, wäre das für viele Unternehmen eine Katastro-phe, bei denen Daten standardmäßig nach Europa übertragen werden.“
Die Anforderungen stellten nicht nur eine große betriebliche Belastung
Digitalwirtschaft
China verteidigt seinen Datenschatz
Datenhandelszentren, Grenzkontrollen, Überwachung: Die chinesische Staatsführung denkt beim Umgang mit Daten um. Das trifft besonders deren Transfer ins Ausland.
Alles digital: Die Regierung in Peking will ihre
Bürger besser vor dem Datenmiss-
brauch von Firmen schützen.
*Letztes verfügbares Geschäftsjahr • Quelle: BloombergHANDELSBLATT
Amazon
Apple
Samsung Electronics
Alphabet
Foxconn
Microsoft
JD.com
Alibaba
Dell
Facebook (Meta)
Sony
Intel
IBM
Tencent
Panasonic
Foxconn
Lenovo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
USA
USA
Korea
USA
Taiwan
USA
China
China
USA
USA
Japan
USA
USA
China
Japan
China
China
TechriesenDie größten Tech-Konzerne weltweit
nach Umsatz* in Mrd. US-Dollar
386,1
365,8
201,1
182,5
182,0
168,1
108,2
106,0
94,2
86,0
84,9
77,9
73,6
69,9
63,2
62,6
60,7
Mom
ent/
Get
ty Im
ages
Eine Unsicherheit in den Gesetzen ist die
vage Definition von nationaler Sicherheit.
Jens HildebrandtVorstandsmitglied der Deutschen
Handelskammer in China
9,7Prozent
betrug das Wachstum der chinesischen Digitalwirtschaft im
vergangenen Jahr.
Quelle: Wirtschaftsministerium China
Ausland
14 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
dar, warnt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Pe-king, sondern könnten auch als Markt-zugangshindernis für ausländische Un-ternehmen wirken, da sie aus normalen betrieblichen Gründen und auf Ersu-chen ihrer Zentrale hin häufig grenz-überschreitend Daten übermittelten.
Um die Anforderungen zu erfüllen, betreiben größere ausländische Unter-nehmen eigene Datenspeicherzentren in China, darunter die deutschen Auto-hersteller Daimler, VW und BMW.
Aufbau eigner DatenzentrenNicht alle Daten werden langfristig der strengen Kontrolle der Behörden aus-gesetzt sein, glauben Experten. Chinas Staatsführung wolle ein Gleichgewicht zwischen Datenschutz auf der einen Sei-te und der Nutzung von Daten auf der anderen Seite herstellen, erklärt Kendra Schaefer, Leiterin Technologiepolitik bei dem in Peking ansässigen China-Thinktank Trivium.
„China ist auf nationaler politischer Ebene ebenso daran interessiert, die Verbreitung von nicht-sensiblen Daten zu fördern“, so Schaefer. Parallel zu den Restriktionen beim Datenverkehr arbei-tet China an der Einrichtung von lokalen Datentauschplattformen.
Laut Medienberichten gibt es bereits existierende oder im Aufbau befindliche Datenzentren, etwa in Peking und in Schanghai. Dort sollen Firmen und öf-fentliche Stellen ihre Daten speichern, sodass sie frei gehandelt werden können – jedoch nur innerhalb Chinas.
„Ziel ist der Aufbau eines nationalen Handelssystems für Daten“, sagt Sino-lytics-Experte Wübbeke. Auch auslän-dische Unternehmen wurden laut In-sidern bereits aufgefordert, ihre Daten dort zur Verfügung zu stellen. Doch die sind bislang wenig begeistert.
A n Selbstbewusstsein hat es ihr noch nie gefehlt. Sie sei „Europas sparsamster Finanzminister“, er-klärte Magdalena Andersson bei
einem Treffen mit ihren zumeist männlichen Kollegen in Brüssel. Nun könnte die „sparsamste Finanzministe-rin“ bald Schwedens erste Frau an der Spitze einer Regierung werden. Am Donnerstag wurde sie zur neuen Vor-sitzenden der schwedischen Sozialde-mokraten gewählt und tritt damit die Nachfolge von Stefan Löfven an.
Der 64-Jährige hatte im August seinen Rücktritt als Parteichef bekannt gegeben und gleichzeitig erklärt, dass er auch das Amt des Ministerpräsiden-ten abgeben werde. Wann genau das geschieht, ist noch nicht klar, doch die meisten Beobachter vermuten, dass der endgültige Rückzug aus der Politik schon in den kommenden Tagen oder Wochen vollzogen werden wird.
Die 54-jährige Andersson war die einzige Kandidatin für die Nachfolge von Löfven. Die Ökonomin wurde mit überwältigender Mehrheit auf dem Parteitag der Sozialdemokraten in Gö-teborg gewählt. Und das, obwohl der linke Parteiflügel im Vorfeld der Wahl Bedenken geäußert hatte. Andersson stünde dem konservativen Lager inner-halb der Partei nahe, lautete eine Kritik, sie sei gegenüber Umverteilungsmaß-nahmen eher skeptisch.
Der härteste Vorwurf jedoch lautet: „Sie redet über Steuern, aber erhöht sie nicht. Sie spricht über Ungleichheit, aber tut nichts dagegen“, polterte Da-niel Suhonen vom linken Flügel der Partei in einigen Medien.
Die zweifache Mutter ist seit 2014 Finanzministerin und hat das Land durch eine straffe Finanzpolitik gut durch alle Krisen geführt. Aus politi-schen Kontroversen hat sie sich heraus-gehalten und Regierungschef Löfven den Vortritt gelassen, wenn es darum ging, zwischen den Flügeln in der Par-tei zu vermitteln. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Viele Bürger sind verunsichert Die Partei, die das Land seit mehr als einhundert Jahren geprägt hat, braucht eine Führungsperson, um zwischen den unterschiedlichen Positionen zu vermitteln und der Basis zu zeigen, dass traditionelle sozialdemokratische Politik nicht verhandelbar ist. Auch nicht für den Preis der Machterhaltung.
Und es gibt mehr Probleme: Neben der Bekämpfung der Coronapandemie muss Andersson – sollte sie zur Regie-rungschefin gewählt werden – die es-kalierte Bandenkriminalität bekämp-fen. Allein in diesem Jahr wurden bei Schießereien zwischen den Clans über 40 Menschen auf offener Straße er-schossen. Schweden nimmt damit den traurigen Spitzenplatz in Europa ein.
Die größte Herausforderung für Andersson wird es aber sein, Mehrhei-ten für die rot-grüne Minderheitsregie-rung zu finden. Derzeit benötigt die Regierung die parlamentarische Unter-stützung der liberalen Zentrumspartei und der exkommunistischen Linkspar-tei. Der Noch-Regierungschef Löfven hat bitter erfahren müssen, dass die Kompromissfindung zwischen den vier Parteien äußerst schwierig ist - was auch dazu geführt hatte, dass er im Spätsommer das Handtuch warf.
Um Regierungschefin zu werden, benötigt Andersson die Stimmen bei-der Stützparteien. Die zieren sich. Die Vorsitzende der Linkspartei, Nooshi Dadgostar, forderte von Andersson kla-re Zugeständnisse. Als Regierungs-chefin muss sie vor allem den Haushalt für das kommende Jahr im Parlament durchbringen. Die Opposition hat bereits angekündigt, einen ei-genen Etat vorzulegen. Sollte Andersson keine Mehrheiten bekommen, müsste sie im schlimmsten Fall mit dem Haushalt der Opposition re-gieren – Löfven kann ein Lied davon singen, wie das vor zwei Jahren war. Es war-ten schwierige Zeiten auf die Ökonomin, die Wirtschafts-wissenschaften in Stockholm
studiert hat und ein kurzes Gastspielan der Harvard-Universität gab.
Andersson wäre die erste Frau ander Spitze des skandinavischen Landes,wenn sie neue Regierungschefin wird.Noch nie zuvor hatte es eine Frau andiese Position gebracht. Und das, ob-wohl sich das Land eine „feministischePolitik“ verordnet hat.
Doch während Dänemark, Island,Finnland und bis vor Kurzem auchNorwegen von Frauen regiert werden,dominierten an der Spitze der Regie-rungen in Stockholm immer Männer.Im September 2022 wird in Schwedenein neues Parlament gewählt. Bis dahinmuss die begeisterte Wanderin denNegativtrend ihrer Partei umkehren,die nur noch auf 25 Prozent der Stim-men kommt. Ansonsten wäre es einkurzes Gastspiel gewesen. Helmut Steuer
Magdalena Andersson
Sparsam und konservativDie neue Chefin der schwedischen Sozialdemokraten dürfte bald auch das Land führen – als erste Frau überhaupt.
Magdalena Andersson: Schwedens
Ministerpräsidentin in spe.
Get
ty Im
ages
New
s/G
etty
Imag
es
Ausland
15WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Dana Heide Peking
In einem historischen Umbruch re-gelt die chinesische Staatsführung derzeit den Umgang mit in der Volksrepublik generierten Daten neu – mit massiven Folgen für Un-
ternehmen. Nach den chinesischen Tech-Konzernen dürften jetzt auch die multinationalen Konzerne mit Nieder-lassungen in der Volksrepublik stärker betroffen sein.
Derzeit veröffentlichen chinesische Behörden fast im Wochentakt neue Regeln zum Umgang mit Daten. An-fang dieser Woche trat in der Volksre-publik das Gesetz zum Schutz Persön-licher Daten (PIPL) in Kraft.
Erstmals gibt es damit ein umfas-sendes Regelwerk, das die persönlichen Daten von Menschen in China schüt-zen soll – allerdings nur mit Blick auf Unternehmen, nicht auf den Staat. Der hat weiterhin nahezu unbegrenzten Zugriff auf Daten.
Auch für europäische Firmen mit Vertretungen in China haben die neu-en Regeln massive Folgen. In seinen Grundzügen ähnelt das PIPL der euro-päischen Datenschutzgrundverord-nung. Für viele europäische Unterneh-men dürfte es daher zwar eine Umstel-lung sein, die neuen Regeln zu befolgen, halten Experten aber grund-sätzlich durchaus für machbar.
Schwieriger jedoch ist das Daten-sicherheitsgesetz (DSL). Es ist bereits im September in Kraft getreten und wurde in den vergangenen Wochen immer weiter konkretisiert. Besonders heikel: Mit dem Gesetz wird der grenz-überschreitende Datentransfer dras-tisch eingeschränkt.
Am Freitag veröffentlichte die chi-nesische Internetaufsichtsbehörde Cy-berspace Administration of China (CAC) erstmals einen neuen Entwurf dazu, wie der restriktivere Datentrans-fer genauer aussehen könnte.
Im Sommer hatte die Behörde be-reits verkündet, dass sich Unterneh-men mit Daten von mehr als einer Mil-lion Nutzern einer Sicherheitsüberprü-fung unterziehen müssen, bevor sie Anteile an einer internationalen Börse listen. „Die chinesische Staatsführung hat sehr gut verstanden, dass Daten ei-ne wichtige Ressource sind“, sagt Jost Wübbeke von der Berliner China-Un-ternehmensberatung Sinolytics.
„Sie ist sich sehr bewusst, dass der Fluss von Daten auch geopolitische Gegner begünstigen kann.“ Digitale Geschäftsmodelle bilden inzwischen ei-nen der wichtigsten Pfeiler der chine-sischen Wirtschaft. Die größten chine-sischen Privatunternehmen nach Marktkapitalisierung sind neben den traditionell großen Banken und Ver-sicherungen vor allem Tech-Konzerne: Alibaba, Tencent, Meituan, Pinduoduo.
Gemessen in absoluten Zahlen, hat China die größte Digitalwirtschaft der Welt, Tendenz steigend. Während die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Jahr insgesamt nur um 2,3 Prozent wuchs, legte die Digitalwirt-
schaft für sich allein genommen um 9,7 Prozent zu. Peking fährt daher zweiglei-sig: Auf der einen Seite will es die Nut-zung von Daten für geschäftliche Zwe-cke fördern. Daten werden seit Kurzem als Produktionsfaktor gesehen – neben den traditionellen Faktoren im chine-sischen System: Kapital, Land, Arbeits-kraft, Technologie.
Die Chinas Führung will, dass Fir-men stärker auf das immense Daten-
vorkommen des Landes zurückgreifen, um das schwächelnde Wirtschafts-wachstum anzukurbeln. Auf der ande-ren Seite will sie die Daten stärker als bislang kontrollieren.
Am deutlichsten wurde das bislang beim chinesischen Fahrdienstleister Di-di. Im Sommer hatte Chinas Internet-aufsichtsbehörde CAC wegen Risiken für die Datensicherheit und die nationale Sicherheit eine umfassende Unter-suchung bei dem Unternehmen gestar-tet. In der Folge brach der Aktienkurs des Unternehmens, das auch als das chi-nesische Pendant zum amerikanischen Fahrdienstleister Uber bekannt ist, ein und es verlor zeitweise fast ein Drittel seiner täglichen Nutzer.
Europäische Firmen sorgen sichAuch europäische Unternehmen sind angesichts der neuen Regeln für den Umgang mit Daten in der Volksrepu-blik besorgt. Bei einer Umfrage der Eu-ropäischen Kammer in Peking gab ein Drittel der befragten Unternehmen mit Geschäften in China an, dass das Cy-bersecurity-Law, das Data-Security-Law und das Personal-Information-Schutzgesetz in den nächsten fünf Jah-ren einen negativen Einfluss auf ihr Unternehmen haben werden.
Vor allem das Datensicherheits-gesetz bereitet ihnen Kopfzerbrechen. Dem jüngsten Entwurf des CAC zu den Richtlinien für grenzüberschreiten-den Datentransfer zufolge müssen alle Unternehmen, die in China gesammel-te Daten verarbeiten, eine Selbstprü-fung der Risiken durchführen, die mit einer Übertragung der Daten ins Aus-land verbunden sind. Ein breites Spek-trum von Daten soll einer staatlichen Sicherheitsprüfung unterzogen werden, bevor sie ins Ausland transferiert wer-den dürfen. Zu den Unternehmen, die
vor dem Export von Daten grünes Licht vom CAC einholen müssen, gehören Betreiber kritischer Informationsinfra-strukturen und Eigentümer „wichtiger Daten“, heißt es in dem Entwurf.
„Eine Unsicherheit in den Gesetzen ist die vage Definition von ,nationaler Sicherheit‘“, sagt Jens Hildebrandt, ge-schäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutschen Handelskammer in China. Es sei notwendig, Klarheit über die An-forderungen zur Lokalisierung von Da-ten und deren Transfer von Daten ins Ausland zu schaffen. Beobachter rech-nen damit, dass die Flut an neuen Re-
gulierungen nicht so schnell abebben wird. „Bei der Konkretisierung des Da-tensicherheitsgesetzes wird man im nächsten Jahr besser absehen können, in welcher Härte es umgesetzt wird“, sagt Mareike Seeßelberg, Senior Con-sultant bei Chinabrand IP Consulting in München. „Wenn es so sein wird, dass die Unternehmen für bestimmte Datentypen regelmäßig Genehmigun-gen zur Übertragung brauchen, wäre das für viele Unternehmen eine Katastro-phe, bei denen Daten standardmäßig nach Europa übertragen werden.“
Die Anforderungen stellten nicht nur eine große betriebliche Belastung
Digitalwirtschaft
China verteidigt seinen Datenschatz
Datenhandelszentren, Grenzkontrollen, Überwachung: Die chinesische Staatsführung denkt beim Umgang mit Daten um. Das trifft besonders deren Transfer ins Ausland.
Alles digital: Die Regierung in Peking will ihre
Bürger besser vor dem Datenmiss-
brauch von Firmen schützen.
*Letztes verfügbares Geschäftsjahr • Quelle: BloombergHANDELSBLATT
Amazon
Apple
Samsung Electronics
Alphabet
Foxconn
Microsoft
JD.com
Alibaba
Dell
Facebook (Meta)
Sony
Intel
IBM
Tencent
Panasonic
Foxconn
Lenovo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
USA
USA
Korea
USA
Taiwan
USA
China
China
USA
USA
Japan
USA
USA
China
Japan
China
China
TechriesenDie größten Tech-Konzerne weltweit
nach Umsatz* in Mrd. US-Dollar
386,1
365,8
201,1
182,5
182,0
168,1
108,2
106,0
94,2
86,0
84,9
77,9
73,6
69,9
63,2
62,6
60,7
Mom
ent/
Get
ty Im
ages
Eine Unsicherheit in den Gesetzen ist die
vage Definition von nationaler Sicherheit.
Jens HildebrandtVorstandsmitglied der Deutschen
Handelskammer in China
9,7Prozent
betrug das Wachstum der chinesischen Digitalwirtschaft im
vergangenen Jahr.
Quelle: Wirtschaftsministerium China
Ausland
14 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
dar, warnt Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in Pe-king, sondern könnten auch als Markt-zugangshindernis für ausländische Un-ternehmen wirken, da sie aus normalen betrieblichen Gründen und auf Ersu-chen ihrer Zentrale hin häufig grenz-überschreitend Daten übermittelten.
Um die Anforderungen zu erfüllen, betreiben größere ausländische Unter-nehmen eigene Datenspeicherzentren in China, darunter die deutschen Auto-hersteller Daimler, VW und BMW.
Aufbau eigner DatenzentrenNicht alle Daten werden langfristig der strengen Kontrolle der Behörden aus-gesetzt sein, glauben Experten. Chinas Staatsführung wolle ein Gleichgewicht zwischen Datenschutz auf der einen Sei-te und der Nutzung von Daten auf der anderen Seite herstellen, erklärt Kendra Schaefer, Leiterin Technologiepolitik bei dem in Peking ansässigen China-Thinktank Trivium.
„China ist auf nationaler politischer Ebene ebenso daran interessiert, die Verbreitung von nicht-sensiblen Daten zu fördern“, so Schaefer. Parallel zu den Restriktionen beim Datenverkehr arbei-tet China an der Einrichtung von lokalen Datentauschplattformen.
Laut Medienberichten gibt es bereits existierende oder im Aufbau befindliche Datenzentren, etwa in Peking und in Schanghai. Dort sollen Firmen und öf-fentliche Stellen ihre Daten speichern, sodass sie frei gehandelt werden können – jedoch nur innerhalb Chinas.
„Ziel ist der Aufbau eines nationalen Handelssystems für Daten“, sagt Sino-lytics-Experte Wübbeke. Auch auslän-dische Unternehmen wurden laut In-sidern bereits aufgefordert, ihre Daten dort zur Verfügung zu stellen. Doch die sind bislang wenig begeistert.
A n Selbstbewusstsein hat es ihr noch nie gefehlt. Sie sei „Europas sparsamster Finanzminister“, er-klärte Magdalena Andersson bei
einem Treffen mit ihren zumeist männlichen Kollegen in Brüssel. Nun könnte die „sparsamste Finanzministe-rin“ bald Schwedens erste Frau an der Spitze einer Regierung werden. Am Donnerstag wurde sie zur neuen Vor-sitzenden der schwedischen Sozialde-mokraten gewählt und tritt damit die Nachfolge von Stefan Löfven an.
Der 64-Jährige hatte im August seinen Rücktritt als Parteichef bekannt gegeben und gleichzeitig erklärt, dass er auch das Amt des Ministerpräsiden-ten abgeben werde. Wann genau das geschieht, ist noch nicht klar, doch die meisten Beobachter vermuten, dass der endgültige Rückzug aus der Politik schon in den kommenden Tagen oder Wochen vollzogen werden wird.
Die 54-jährige Andersson war die einzige Kandidatin für die Nachfolge von Löfven. Die Ökonomin wurde mit überwältigender Mehrheit auf dem Parteitag der Sozialdemokraten in Gö-teborg gewählt. Und das, obwohl der linke Parteiflügel im Vorfeld der Wahl Bedenken geäußert hatte. Andersson stünde dem konservativen Lager inner-halb der Partei nahe, lautete eine Kritik, sie sei gegenüber Umverteilungsmaß-nahmen eher skeptisch.
Der härteste Vorwurf jedoch lautet: „Sie redet über Steuern, aber erhöht sie nicht. Sie spricht über Ungleichheit, aber tut nichts dagegen“, polterte Da-niel Suhonen vom linken Flügel der Partei in einigen Medien.
Die zweifache Mutter ist seit 2014 Finanzministerin und hat das Land durch eine straffe Finanzpolitik gut durch alle Krisen geführt. Aus politi-schen Kontroversen hat sie sich heraus-gehalten und Regierungschef Löfven den Vortritt gelassen, wenn es darum ging, zwischen den Flügeln in der Par-tei zu vermitteln. Das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Viele Bürger sind verunsichert Die Partei, die das Land seit mehr als einhundert Jahren geprägt hat, braucht eine Führungsperson, um zwischen den unterschiedlichen Positionen zu vermitteln und der Basis zu zeigen, dass traditionelle sozialdemokratische Politik nicht verhandelbar ist. Auch nicht für den Preis der Machterhaltung.
Und es gibt mehr Probleme: Neben der Bekämpfung der Coronapandemie muss Andersson – sollte sie zur Regie-rungschefin gewählt werden – die es-kalierte Bandenkriminalität bekämp-fen. Allein in diesem Jahr wurden bei Schießereien zwischen den Clans über 40 Menschen auf offener Straße er-schossen. Schweden nimmt damit den traurigen Spitzenplatz in Europa ein.
Die größte Herausforderung für Andersson wird es aber sein, Mehrhei-ten für die rot-grüne Minderheitsregie-rung zu finden. Derzeit benötigt die Regierung die parlamentarische Unter-stützung der liberalen Zentrumspartei und der exkommunistischen Linkspar-tei. Der Noch-Regierungschef Löfven hat bitter erfahren müssen, dass die Kompromissfindung zwischen den vier Parteien äußerst schwierig ist - was auch dazu geführt hatte, dass er im Spätsommer das Handtuch warf.
Um Regierungschefin zu werden, benötigt Andersson die Stimmen bei-der Stützparteien. Die zieren sich. Die Vorsitzende der Linkspartei, Nooshi Dadgostar, forderte von Andersson kla-re Zugeständnisse. Als Regierungs-chefin muss sie vor allem den Haushalt für das kommende Jahr im Parlament durchbringen. Die Opposition hat bereits angekündigt, einen ei-genen Etat vorzulegen. Sollte Andersson keine Mehrheiten bekommen, müsste sie im schlimmsten Fall mit dem Haushalt der Opposition re-gieren – Löfven kann ein Lied davon singen, wie das vor zwei Jahren war. Es war-ten schwierige Zeiten auf die Ökonomin, die Wirtschafts-wissenschaften in Stockholm
studiert hat und ein kurzes Gastspielan der Harvard-Universität gab.
Andersson wäre die erste Frau ander Spitze des skandinavischen Landes,wenn sie neue Regierungschefin wird.Noch nie zuvor hatte es eine Frau andiese Position gebracht. Und das, ob-wohl sich das Land eine „feministischePolitik“ verordnet hat.
Doch während Dänemark, Island,Finnland und bis vor Kurzem auchNorwegen von Frauen regiert werden,dominierten an der Spitze der Regie-rungen in Stockholm immer Männer.Im September 2022 wird in Schwedenein neues Parlament gewählt. Bis dahinmuss die begeisterte Wanderin denNegativtrend ihrer Partei umkehren,die nur noch auf 25 Prozent der Stim-men kommt. Ansonsten wäre es einkurzes Gastspiel gewesen. Helmut Steuer
Magdalena Andersson
Sparsam und konservativDie neue Chefin der schwedischen Sozialdemokraten dürfte bald auch das Land führen – als erste Frau überhaupt.
Magdalena Andersson: Schwedens
Ministerpräsidentin in spe.
Get
ty Im
ages
New
s/G
etty
Imag
es
Ausland
15WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Lilian Fiala, David Selbach Köln
Von außen wirkt das oberbayeri-sche Kloster Ettal wie ein baro-cker Fels in historischer Bran-dung. Feierlich geweiht im Jahr 1370, gründeten Benediktiner-
mönche hier im frühen 18. Jahrhundert eine „Ritterakademie“ für die Söhne adeliger Familien. 1900 wurde daraus ein katholisches Jungengymnasium mit angeschlossenem Internat – eine jener kirchlichen Bildungseinrichtungen, in denen in den vergangenen Jahren Fälle von sexuellem Missbrauch aufgedeckt wurden.
Der 2010 ans Licht gekommene Skandal hat den Ruf der Schule im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nachhaltig beschädigt. 2024 ist daher Schluss mit dem Internatsbetrieb: Es gibt schlicht zu wenige Anmeldungen. Dass die Mönche sich um Aufarbeitung bemühten und vor fünf Jahren sogar mit einer ehernen Tradition brachen und Mädchen zuließen, reichte nicht, um das verlorene Vertrauen wieder-herzustellen. Immerhin bleibt der nor-male Gymnasialbetrieb erhalten.
Vor allem katholische Internate ha-ben ein Imageproblem, seit der Miss-brauch von Kindern in kirchlichen Ein-richtungen zum öffentlichen Thema wurde. Doch der Blick auf extreme Einzelfälle wie Ettal täuscht: Die Nach-frage nach privater Schulbildung steigt seit Jahren, und auch an Konfessions-schulen ist sie ungebrochen.
Ein großer Teil der Privatschulen in Deutschland befindet sich in kirchlicher Trägerschaft. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind es laut Schulminis-terium rund 53 Prozent. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts besucht inzwischen jeder elfte Schüler eine Pri-vatschule, vor zehn Jahren war es noch jeder 13. Besonders hoch ist der Anteil in Ostdeutschland: Hier wird jeder ach-te Schüler an allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen an einer privaten Einrichtung unterrichtet.
Mehr Anfragen als PlätzeDie Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Viele Eltern beklagen die zum Teil mangelhafte Ausstattung so-wie den Unterrichtsausfall an öffent-lichen Schulen und suchen nach Alter-nativen. Zudem punkten viele Privat-schulen mit kleineren Klassen und einer besseren individuellen Betreu-ung. Bei Internaten kommen Plus-punkte in Sachen Sozialkompetenz hinzu: Die Schüler lernen, sich in eine Gruppe zu integrieren, sie leben, essen und spielen zusammen. Und nicht zu-letzt entlasten Internate auch die El-tern, insbesondere wenn beide Eltern-teile berufstätig stark eingespannt sind.
Kirchlich betriebene Privatschulen und Internate bekommen oft noch ein weiteres Argument genannt: Immer mehr Eltern legten Wert darauf, dass ihre Kinder christliche Werte vermit-
telt bekommen, sagt Peter Nothaft, Di-rektor des Katholischen Schulwerks Bayern. Die Nachfrage nach Plätzen an katholischen Schulen sei trotz der Skandale „sehr stabil“. „Einige Schulen können gar nicht alle Schüler aufneh-men, die sich anmelden möchten.“ Ähnlich sieht es an evangelischen Schulen aus, berichtet Martin Fricke, Synodalassessor beim Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf (siehe Inter-view rechts).
Das Gymnasium und Internat Ab-tei Schäftlarn südlich von München je-denfalls hat keine Nachwuchssorgen. 50 der 576 Schülerinnen und Schüler sind im Vollinternat, sie leben und ler-nen in dem barocken Klostergebäude. Direktor Wolfgang Sagmeister ver-zeichnet seit 15 Jahren steigende An-meldungszahlen. Für die Jungen und Mädchen sei das von Benediktinern ge-führte Internate „mehr als nur Schule“, betont er. „Das ist ihr Zuhause.“
Und Bildung sei für sie mehr als nur Ausbildung. Insbesondere im Internat gehe es um die „Schule des Lebens“, ganz nach den Idealen von Ordens-gründer Benedikt von Nursia. „Eine christlich geprägte Schule tut sich leich-ter, im Kollegium ein einheitliches Er-ziehungsziel zu finden“, vermutet Sag-meister. Sein Gymnasium pflegt zu-dem Kooperationen mit Schulen in Senegal oder in Indien. „So sorgen wir dafür, dass unsere Schüler Kontakt zu
Schülern aus anderen Ländern bekom-men. Mit Spendenläufen lernen sie au-ßerdem, wie man für andere Verant-wortung übernimmt.“
Guter Ruf trotz der SkandaleDie Missbrauchsdiskussion in der ka-tholischen Kirche wirke abgesehen von den betroffenen Einrichtungen jeden-falls kaum nach, erklärt Schulwerksdi-rektor Nothaft. „Meist wurden diese schrecklichen Taten nicht in den Schu-len, sondern den angrenzenden Inter-naten begangen.“ Und diese hätten eine „sehr ausgiebige Aufarbeitungsarbeit geleistet“. Die kirchlichen Privatschu-len insgesamt genössen weiterhin ei-nen sehr guten Ruf.
Allein in Bayern besuchen rund 80.000 Kinder und Jugendliche eine ka-tholische Bildungseinrichtung, das sind fast fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Wie andere Privatschulen be-kommen auch Konfessionsschulen fi-nanzielle Zuschüsse von den Landes-regierungen. In Bayern decken diese – je nach Schulart – rund 80 bis 85 Pro-zent der Kosten ab, schätzt Nothaft.
Den Rest müssen die kirchlichen Träger selbst finanzieren – und die El-tern über das Schulgeld, das an katho-lischen Gymnasien und Realschulen in Bayern bei durchschnittlich etwa 40 bis 50 Euro im Monat liegt. Ein Inter-natsplatz mit Kost und Logis ist natür-lich erheblich teurer, im Kloster Ettal
Konfessionsschulen
Sehnsucht nach WertenDie Missbrauchsskandale der Vergangenheit haben den Ruf kirchlicher Internate beschädigt.
Trotzdem melden christliche Schulen bis auf wenige Ausnahmen steigende Anmeldungszahlen. Was sind die Gründe für diese überraschende Entwicklung?
Kloster Ettal: Der 2010 ans Licht gekommene Missbrauchs-skandal hat den Ruf der Schule nachhaltig beschädigt.
80Prozent
mehr Privatschulen als zu Beginn der
Neunzigerjahre gibt es in Deutschland, rund 5800 insge-
samt.
Quelle: Destatis
Spezial: Privatschulen & Internate
16 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
etwa schlägt er mit 1250 Euro pro Mo-nat zu Buche.
Doch mit dem Rückgang der Reli-giosität in der Gesellschaft schrumpft auch die finanzielle Basis der kirchli-chen Schulen, was viele vor erhebliche Probleme stellt. Weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und daher das Kirchensteueraufkom-men sinkt, stehen für die Finanzierung der christlichen Bildungseinrichtungen immer weniger Mittel zur Verfügung.
„Generell hat die evangelische Kir-che nicht mehr so viel Geld wie früher“, sagt Synodalassessor Fricke, der selbst evangelischer Pfarrer am Düsseldorfer Annette-von-Droste-Hülshoff-Gym-nasium ist. „Auch die Schulen verfügen dadurch über weniger Budget.“ Vor al-lem in den östlichen Ländern finanzie-ren sich kirchliche Schulen daher im-mer öfter über Stiftungen.
„Kirchliche Schulen blühen“Ein weiteres Problem ist der bundes-weite Lehrermangel, den auch Privat-schulen zunehmend zu spüren bekom-men. „Schüler haben wir genug“, sagt der Schäftlarner Schuldirektor Sag-meister. „Nur Lehrer könnten wir ein paar mehr gebrauchen.“
Um das Modell Konfessionsschule, insbesondere mit Internatsbetrieb, zu-kunftsfest zu machen, sollten die Ein-richtungen sich auf ihre Stärken besin-nen, rät Schulwerksdirektor Nothaft. „Die Schulen müssen ihr Profil genau definieren.“ Anschließend sei es auch eine Frage von „Kommunikation und Markenbildung“, ob potenzielle Kun-den die spezifischen Stärken dieses Profils erkennen. „Da sind christliche Werte und religiöse Bezüge gut und ehrlich kommunizierbar“, sagt Nothaft. „Und die kommen auch an – egal, ob die Eltern selbst besonders religiös sind oder nicht.“
Die Kirche gehe durch eine schwie-rige Zeit, sagt er, und das sei teilweise hausgemacht. „Aber die kirchlichen Schulen, die blühen.“
Immer mehr Menschen wenden sich von Religion und Kirche ab, gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Plätzen an konfessionell gebundenen Pri-vatschulen. Wie das zusammenpasst und wie christliche Internate in postmodernen Zeiten bei Eltern und Schülern punkten können, erklärt Martin Fricke, Pfarrer am Düsseldorfer Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und Synodal -assessor, also Stellvertreter des leitenden Geist-lichen, im Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf.
Herr Fricke, warum schicken Eltern ihre Kinder auf eine kirchliche Privatschule?Schulen sollen immer mehr auch die Rolle des Er-ziehers übernehmen. Viele Eltern und ihre Kinder suchen und finden dabei an Konfessionsschulen ein Schulklima, das auch abseits des Unterrichts anders ist als an anderen Schulen, das eine sehr starke Gemeinschaft bietet. An Konfessionsschu-len lernt man bewusst, sich nicht nur mit eigenen Haltungen, sondern auch mit denen anderer aus-einanderzusetzen. Man lernt Toleranz. Es ist da-bei egal, ob man besonders gläubig ist oder nicht. Schüler erfahren, dass es Menschen gibt, die sie genauso nehmen, wie sie sind, auch wenn sie Feh-ler machen.
Gerade in Ostdeutschland sind Konfessions-schulen sehr beliebt. Wie passt das zum atheistischen Erbe der DDR?Ja, dabei gibt es in der ehemaligen DDR viel we-niger Kirchenmitglieder als im Westen. Ich erkläre mir das so, dass es dort ein besonders großes Be-dürfnis nach Wertevermittlung gibt. Natürlich sind das in einer Konfessionsschule christliche be-ziehungsweise religiös begründete Werte. Aber die sind ja auch universell: sozial miteinander um-zugehen, sich um Schwächere zu kümmern und an Fairness und Gerechtigkeit zu orientieren.
Wie können kirchliche Privatschulen und Internate künftig wettbewerbsfähig bleiben?Von evangelischer Seite würde ich sagen, dass sie gar nicht so viel ändern müssen. Sie sollten noch viel mehr zeigen, was sie zu bieten haben und wel-chen Beitrag sie für die Gesellschaft leisten kön-nen: Sie sorgen mit dafür, dass Menschen solida-risch, fair und verantwortungsvoll miteinander umgehen. Kritisch sehe ich eher, dass die aller-meisten Konfessionsschulen Gymnasien sind. Es gibt, zumindest im Westen, eher wenige konfes-sionelle Haupt-, Real- oder Gesamtschulen. Da könnten die Kirchen nachbessern.
Die Fragen stellte Lilian Fiala.
Nachgefragt
„Kirchliche Schulen bieten Gemeinschaft“
Schulpfarrer Martin Fricke über den Erfolg von Konfessionsschulen in
einer immer weniger religiösen Welt.
ww
w.g
oetz
-fot
o.de
Oliv
er M
arqu
ardt
17WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Lilian Fiala, David Selbach Köln
Von außen wirkt das oberbayeri-sche Kloster Ettal wie ein baro-cker Fels in historischer Bran-dung. Feierlich geweiht im Jahr 1370, gründeten Benediktiner-
mönche hier im frühen 18. Jahrhundert eine „Ritterakademie“ für die Söhne adeliger Familien. 1900 wurde daraus ein katholisches Jungengymnasium mit angeschlossenem Internat – eine jener kirchlichen Bildungseinrichtungen, in denen in den vergangenen Jahren Fälle von sexuellem Missbrauch aufgedeckt wurden.
Der 2010 ans Licht gekommene Skandal hat den Ruf der Schule im Landkreis Garmisch-Partenkirchen nachhaltig beschädigt. 2024 ist daher Schluss mit dem Internatsbetrieb: Es gibt schlicht zu wenige Anmeldungen. Dass die Mönche sich um Aufarbeitung bemühten und vor fünf Jahren sogar mit einer ehernen Tradition brachen und Mädchen zuließen, reichte nicht, um das verlorene Vertrauen wieder-herzustellen. Immerhin bleibt der nor-male Gymnasialbetrieb erhalten.
Vor allem katholische Internate ha-ben ein Imageproblem, seit der Miss-brauch von Kindern in kirchlichen Ein-richtungen zum öffentlichen Thema wurde. Doch der Blick auf extreme Einzelfälle wie Ettal täuscht: Die Nach-frage nach privater Schulbildung steigt seit Jahren, und auch an Konfessions-schulen ist sie ungebrochen.
Ein großer Teil der Privatschulen in Deutschland befindet sich in kirchlicher Trägerschaft. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind es laut Schulminis-terium rund 53 Prozent. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts besucht inzwischen jeder elfte Schüler eine Pri-vatschule, vor zehn Jahren war es noch jeder 13. Besonders hoch ist der Anteil in Ostdeutschland: Hier wird jeder ach-te Schüler an allgemeinbildenden oder beruflichen Schulen an einer privaten Einrichtung unterrichtet.
Mehr Anfragen als PlätzeDie Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Viele Eltern beklagen die zum Teil mangelhafte Ausstattung so-wie den Unterrichtsausfall an öffent-lichen Schulen und suchen nach Alter-nativen. Zudem punkten viele Privat-schulen mit kleineren Klassen und einer besseren individuellen Betreu-ung. Bei Internaten kommen Plus-punkte in Sachen Sozialkompetenz hinzu: Die Schüler lernen, sich in eine Gruppe zu integrieren, sie leben, essen und spielen zusammen. Und nicht zu-letzt entlasten Internate auch die El-tern, insbesondere wenn beide Eltern-teile berufstätig stark eingespannt sind.
Kirchlich betriebene Privatschulen und Internate bekommen oft noch ein weiteres Argument genannt: Immer mehr Eltern legten Wert darauf, dass ihre Kinder christliche Werte vermit-
telt bekommen, sagt Peter Nothaft, Di-rektor des Katholischen Schulwerks Bayern. Die Nachfrage nach Plätzen an katholischen Schulen sei trotz der Skandale „sehr stabil“. „Einige Schulen können gar nicht alle Schüler aufneh-men, die sich anmelden möchten.“ Ähnlich sieht es an evangelischen Schulen aus, berichtet Martin Fricke, Synodalassessor beim Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf (siehe Inter-view rechts).
Das Gymnasium und Internat Ab-tei Schäftlarn südlich von München je-denfalls hat keine Nachwuchssorgen. 50 der 576 Schülerinnen und Schüler sind im Vollinternat, sie leben und ler-nen in dem barocken Klostergebäude. Direktor Wolfgang Sagmeister ver-zeichnet seit 15 Jahren steigende An-meldungszahlen. Für die Jungen und Mädchen sei das von Benediktinern ge-führte Internate „mehr als nur Schule“, betont er. „Das ist ihr Zuhause.“
Und Bildung sei für sie mehr als nur Ausbildung. Insbesondere im Internat gehe es um die „Schule des Lebens“, ganz nach den Idealen von Ordens-gründer Benedikt von Nursia. „Eine christlich geprägte Schule tut sich leich-ter, im Kollegium ein einheitliches Er-ziehungsziel zu finden“, vermutet Sag-meister. Sein Gymnasium pflegt zu-dem Kooperationen mit Schulen in Senegal oder in Indien. „So sorgen wir dafür, dass unsere Schüler Kontakt zu
Schülern aus anderen Ländern bekom-men. Mit Spendenläufen lernen sie au-ßerdem, wie man für andere Verant-wortung übernimmt.“
Guter Ruf trotz der SkandaleDie Missbrauchsdiskussion in der ka-tholischen Kirche wirke abgesehen von den betroffenen Einrichtungen jeden-falls kaum nach, erklärt Schulwerksdi-rektor Nothaft. „Meist wurden diese schrecklichen Taten nicht in den Schu-len, sondern den angrenzenden Inter-naten begangen.“ Und diese hätten eine „sehr ausgiebige Aufarbeitungsarbeit geleistet“. Die kirchlichen Privatschu-len insgesamt genössen weiterhin ei-nen sehr guten Ruf.
Allein in Bayern besuchen rund 80.000 Kinder und Jugendliche eine ka-tholische Bildungseinrichtung, das sind fast fünf Prozent aller Schülerinnen und Schüler. Wie andere Privatschulen be-kommen auch Konfessionsschulen fi-nanzielle Zuschüsse von den Landes-regierungen. In Bayern decken diese – je nach Schulart – rund 80 bis 85 Pro-zent der Kosten ab, schätzt Nothaft.
Den Rest müssen die kirchlichen Träger selbst finanzieren – und die El-tern über das Schulgeld, das an katho-lischen Gymnasien und Realschulen in Bayern bei durchschnittlich etwa 40 bis 50 Euro im Monat liegt. Ein Inter-natsplatz mit Kost und Logis ist natür-lich erheblich teurer, im Kloster Ettal
Konfessionsschulen
Sehnsucht nach WertenDie Missbrauchsskandale der Vergangenheit haben den Ruf kirchlicher Internate beschädigt.
Trotzdem melden christliche Schulen bis auf wenige Ausnahmen steigende Anmeldungszahlen. Was sind die Gründe für diese überraschende Entwicklung?
Kloster Ettal: Der 2010 ans Licht gekommene Missbrauchs-skandal hat den Ruf der Schule nachhaltig beschädigt.
80Prozent
mehr Privatschulen als zu Beginn der
Neunzigerjahre gibt es in Deutschland, rund 5800 insge-
samt.
Quelle: Destatis
Spezial: Privatschulen & Internate
16 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
etwa schlägt er mit 1250 Euro pro Mo-nat zu Buche.
Doch mit dem Rückgang der Reli-giosität in der Gesellschaft schrumpft auch die finanzielle Basis der kirchli-chen Schulen, was viele vor erhebliche Probleme stellt. Weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und daher das Kirchensteueraufkom-men sinkt, stehen für die Finanzierung der christlichen Bildungseinrichtungen immer weniger Mittel zur Verfügung.
„Generell hat die evangelische Kir-che nicht mehr so viel Geld wie früher“, sagt Synodalassessor Fricke, der selbst evangelischer Pfarrer am Düsseldorfer Annette-von-Droste-Hülshoff-Gym-nasium ist. „Auch die Schulen verfügen dadurch über weniger Budget.“ Vor al-lem in den östlichen Ländern finanzie-ren sich kirchliche Schulen daher im-mer öfter über Stiftungen.
„Kirchliche Schulen blühen“Ein weiteres Problem ist der bundes-weite Lehrermangel, den auch Privat-schulen zunehmend zu spüren bekom-men. „Schüler haben wir genug“, sagt der Schäftlarner Schuldirektor Sag-meister. „Nur Lehrer könnten wir ein paar mehr gebrauchen.“
Um das Modell Konfessionsschule, insbesondere mit Internatsbetrieb, zu-kunftsfest zu machen, sollten die Ein-richtungen sich auf ihre Stärken besin-nen, rät Schulwerksdirektor Nothaft. „Die Schulen müssen ihr Profil genau definieren.“ Anschließend sei es auch eine Frage von „Kommunikation und Markenbildung“, ob potenzielle Kun-den die spezifischen Stärken dieses Profils erkennen. „Da sind christliche Werte und religiöse Bezüge gut und ehrlich kommunizierbar“, sagt Nothaft. „Und die kommen auch an – egal, ob die Eltern selbst besonders religiös sind oder nicht.“
Die Kirche gehe durch eine schwie-rige Zeit, sagt er, und das sei teilweise hausgemacht. „Aber die kirchlichen Schulen, die blühen.“
Immer mehr Menschen wenden sich von Religion und Kirche ab, gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Plätzen an konfessionell gebundenen Pri-vatschulen. Wie das zusammenpasst und wie christliche Internate in postmodernen Zeiten bei Eltern und Schülern punkten können, erklärt Martin Fricke, Pfarrer am Düsseldorfer Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium und Synodal -assessor, also Stellvertreter des leitenden Geist-lichen, im Evangelischen Kirchenkreis Düsseldorf.
Herr Fricke, warum schicken Eltern ihre Kinder auf eine kirchliche Privatschule?Schulen sollen immer mehr auch die Rolle des Er-ziehers übernehmen. Viele Eltern und ihre Kinder suchen und finden dabei an Konfessionsschulen ein Schulklima, das auch abseits des Unterrichts anders ist als an anderen Schulen, das eine sehr starke Gemeinschaft bietet. An Konfessionsschu-len lernt man bewusst, sich nicht nur mit eigenen Haltungen, sondern auch mit denen anderer aus-einanderzusetzen. Man lernt Toleranz. Es ist da-bei egal, ob man besonders gläubig ist oder nicht. Schüler erfahren, dass es Menschen gibt, die sie genauso nehmen, wie sie sind, auch wenn sie Feh-ler machen.
Gerade in Ostdeutschland sind Konfessions-schulen sehr beliebt. Wie passt das zum atheistischen Erbe der DDR?Ja, dabei gibt es in der ehemaligen DDR viel we-niger Kirchenmitglieder als im Westen. Ich erkläre mir das so, dass es dort ein besonders großes Be-dürfnis nach Wertevermittlung gibt. Natürlich sind das in einer Konfessionsschule christliche be-ziehungsweise religiös begründete Werte. Aber die sind ja auch universell: sozial miteinander um-zugehen, sich um Schwächere zu kümmern und an Fairness und Gerechtigkeit zu orientieren.
Wie können kirchliche Privatschulen und Internate künftig wettbewerbsfähig bleiben?Von evangelischer Seite würde ich sagen, dass sie gar nicht so viel ändern müssen. Sie sollten noch viel mehr zeigen, was sie zu bieten haben und wel-chen Beitrag sie für die Gesellschaft leisten kön-nen: Sie sorgen mit dafür, dass Menschen solida-risch, fair und verantwortungsvoll miteinander umgehen. Kritisch sehe ich eher, dass die aller-meisten Konfessionsschulen Gymnasien sind. Es gibt, zumindest im Westen, eher wenige konfes-sionelle Haupt-, Real- oder Gesamtschulen. Da könnten die Kirchen nachbessern.
Die Fragen stellte Lilian Fiala.
Nachgefragt
„Kirchliche Schulen bieten Gemeinschaft“
Schulpfarrer Martin Fricke über den Erfolg von Konfessionsschulen in
einer immer weniger religiösen Welt.
ww
w.g
oetz
-fot
o.de
Oliv
er M
arqu
ardt
17WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Die US-Notenbank (Fed) hat geliefert, was sie angekündigt hat: die geldpoliti-sche Wende. Weil es keinerlei böse Überraschung aus Sicht der Märkte gab, war eine kleine Erleichterungsral-ly an den Börsen die Folge. Die Euro-
päische Zentralbank (EZB) wird im Dezem-ber die Normalisierung der Geldpolitik einleiten, hat dabei aber noch einen weiteren Weg zurückzulegen als die Fed. Aber das passt dazu, dass Europa im wirtschaftlichen Zyklus hinter den USA zurückliegt.
Wenn die Notenbanken die Geldpolitik normalisieren, wird es Zeit, sie von politi-schen Lasten zu befreien – vor allem von ungelösten Verteilungsproblemen. In der Pandemie haben Finanz- und Geldpolitik wahrscheinlich besser als je zuvor zusammen-gearbeitet, um wenigstens die wirtschaftli-chen Folgen der Seuche, die jetzt schon Millionen Menschenleben gekostet hat, aufzufangen. Doch in Zukunft werden die Interessen der Notenbanken und der Regie-rung weniger übereinstimmen. Umso wichti-ger ist es, beide Bereiche sauber zu trennen. Entscheidend ist vor allem, dass die demokra-tisch legitimierte Politik keine Aufgaben bei den Notenbanken ablädt, mit denen sie selbst nicht klarkommt. Bei solchen Problemen geht es fast immer um Verteilungsfragen. Schon die große Finanzkrise wurde maßgeblich dadurch ausgelöst: In den USA ersetzte eine laxe Kreditvergabe für ärmere Haushalte eine solide Sozialpolitik – die entsprechenden Kredite brachten später fast das Weltfinanzsys-tem zum Einsturz. Das System musste mit einer Flut von Geld von den Notenbanken am Leben erhalten werden.
Heute geht es wieder um Verteilungsproble-me. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden versucht mit riesigen Ausgabenpake-ten, sozialen Ausgleich zu schaffen. Vor allem
bei linken Demokraten kommt dabei die Theorie mit dem Namen Modern Monetary Theory (MMT) gut an. Im Grunde läuft sie darauf hinaus, die Notenbank Ausgaben über Käufe von Staatsanleihen finanzieren zu lassen. Solange die Inflation nicht steigt, so die Theorie, kann der Staat sich quasi unbe-grenzt verschulden. Schade nur, dass die Teuerungsrate gerade in den USA deutlich steigt, und das auch wegen der großzügigen Finanzpolitik. So läuft MMT schneller als gedacht vor die Wand. Fazit daher: Die Fed ist die falsche Adresse, die Ungleichheit muss von den Politikern behoben werden.
In Europa stehen dagegen die Spannungen zwischen einzelnen Euro-Ländern im Vorder-grund. Euro-Land hat als einheitlicher Wirt-schaftsraum starke und schwache Regionen. Auf Dauer abbauen können solche Ungleich-heiten – und das wird viel zu wenig verstan-den und akzeptiert – nur finanzielle Trans-fers. Die Frage ist nicht, ob, sondern, wie sie passieren. In Märkten mit verschiedenen Währungen läuft das über die Abwertung schwacher Devisen. In einem Markt mit einheitlicher Währung läuft es über die Geldpolitik oder eben über einen offenen Finanzausgleich. Wenn gar nichts mehr geht, ist zwangsläufig ein Schuldenschnitt die Lösung, der auch auf Transfer hinausläuft.
Die Notenbanken sind – egal, wie ihr Mandat im Detail definiert ist – de facto für die Stabili-tät der Preise, der Wirtschaft insgesamt und des Finanzsystems zuständig; alle drei hängen ja auch zusammen. Deswegen können sie Probleme, die man ihnen überlässt, nicht ignorieren. Man sollte ihnen nicht zu viel zumuten.
Notenbanken
Zu viel Politik in der Geldpolitik
Der Autor ist Korrespondent in Frankfurt. Sie erreichen ihn unter: [email protected]
Entscheidend ist vor allem, dass die
demokratisch legitimierte Politik keine Aufgaben bei den Notenbanken ablädt, mit denen
sie selbst nicht klarkommt.
Frank Wiebe
Bei Fed und EZB landen Probleme, die dort nicht hingehören. Das muss aufhören.
Thomas Sigmund ist Ressortleiter Politik. Sie erreichen ihn unter: sigmund@ handelsblatt.com
W enn nicht noch ein Wunder geschieht, dann schafft die neue Regierung kein eigenständiges Digital-
ministerium. SPD, Grüne und FDP haben damit die digitale Zukunft abgesagt, eine wichtige Chance ist vertan. Jetzt soll das Mega-Thema wohl an irgend-ein Ressort angeflanscht werden. Priorität hat es damit nicht.
Ein Klimaschutzministerium wird es dagegen zu Recht geben. Dort will man alle Kompetenzen bün-deln und ganze Abteilungen hin und her schieben. Es gibt sogar Überlegungen, das Wirtschafts- und Umweltministerium zu fusionieren. Bei der Digitalisie-rung ist das angeblich alles zu schwierig. Der Aufwand würde sich nicht lohnen.
Das ist alles vorgeschoben. Es spielen parteipolitische Gründe eine Rolle. Keiner der zukünftigen Partner will dieses Profilierungs-feld dem anderen überlas-sen. Damit bleibt alles, wie es ist.
Das Innenministerium bleibt für die Cybersicherheit zuständig und grätscht damit weiter in alle Themen hinein. Das Zukunftsfeld E-Health untersteht dem Gesund-heitsministerium und dem Ein-fluss der verkrusteten Strukturen der AOK und anderer Wettbewer-ber. Das Verkehrs- und das Wirt-schaftsministerium werden über das autonome Fahren streiten.
Die Digitalisierung wird also weiter zerrieben, so wie es immer war.
In der vorletzten Großen Koaliti-on gab es eine breit angelegte digitale Agenda. Da waren fünf Ressorts federführend. Heraus-gekommen ist nichts. In der letzten Legislaturperiode ver-suchte man es mit einer Staats-ministerin im Kanzleramt. Außer nicht fliegenden Flugtaxis und schillernden Auftritten bei Gaming-Convents ist wenig hängen geblieben.
Wirtschaftsminister Peter Altmai-er ließ sich keine Telefonate von ausländischen Amtskollegen in sein Dienstauto durchstellen, weil er sich für die Funklöcher schämte. Es ist schon fast absehbar, dass der künftige Kanzler Olaf Scholz damit drohen wird, das Ganze zur Chefsache zu machen. Das war es dann wieder mit der Digitalisie-rung in Deutschland.
Digitalministerium
Zukunft ist abgesagt
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Meinung & Analyse
18
Zur Niederlage der Demokraten bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia schreibt die Zeitung „La Vanguardia“ :
Die Niederlage der Demokraten in Virginia schwächt noch mehr die Position des Präsiden-ten. Gestern hat sich ja zum ersten Mal jene Wahl gejährt, bei der der Demokrat zum US-Prä-sidenten gewählt wurde und der Republikaner Donald Trump eine Niederlage erlitt. Das Ge-schenk, das Biden an diesem Jahrestag erhielt, hätte nicht bitterer sein können. Bidens Beliebt-heitswerte fallen und fallen. Weil der Rückzug aus Afghanistan die US-Gesellschaft hart getrof-fen hat. Weil die Bilder vom brutalen Einsatz berittener Grenzschützer gegen Latino-Migran-ten in Texas auch den Demokraten miss fallen haben. Weil Covid weiterhin großen Schaden anrichtet. Weil Hurrikan Ida (...) die Schwächen der Infrastruktur (...) offenbart. Weil die Inflation und die Kraftstoffpreise steigen. Und weil der Präsident das Budget für sein Sozial-, Klima- und Infrastruktur-Paket wegen des Widerstandes in der eigenen Partei um die Hälfte stutzen musste.
Außenansichten
Zur aktuellen Lage in Äthiopien schreibt die französische Tageszeitung „La Croix“:
Der Krieg hat von ganz Äthiopien Besitz ergrif-fen. Dieses Land, das gerne als Vorbild für Fortschritt in Afrika dargestellt wird, ist von seinen alten Dämonen eingeholt worden. Zehn Monate lang hat sich der Krieg auf die nördlichs-te Region, die Tigray-Region, begrenzt, seit August breiten sich die Kämpfe nun aus. (...) Ministerpräsident Abiy Ahmed trägt eine erdrückende Verantwortung für dieses Desas-ter. Vor einem Jahr wollte er die Tigray-Region in den Griff bekommen, eine nach Unabhängig-keit strebende Provinz, die von politischen Gegnern geführt wurde. Damit hat er nicht nur die Zündschnur des Krieges angesteckt. Er hat sich dafür auch mit dem ehemaligen Erzfeind Eritrea verbündet, dessen Armee furchtbare Verbrechen begangen hat. Dieser junge Politi-ker mit dem Profil eines aufgeklärten Erneue-rers hatte einst den Friedensnobelpreis erhalten (...). Nun legt er Zynismus und Verblendung an den Tag.
Zu den Abspaltungsbestrebungen im serbi-schen Landesteil von Bosnien-Herzegowina schreibt die Budapester Zeitung „Nepszava“:
Die Erfahrung lehrt, dass ein diktatorisch veranlagter Politiker umso gefährlicher ist, je mehr er sich in die Enge gedrängt fühlt. (...) Milorad Dodik, das serbische Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, (...) droht damit, eigene bewaffnete Streitkräfte zu schaffen, was ein schwerer Verstoß gegen das Dayton-Abkom-men wäre, das den bosnischen Krieg beendet hat. Dodiks Worte können den Eindruck erwe-cken, dass der Friede auf dem Balkan in Gefahr ist wie noch nie seit 1995. (...) Dabei ist seine eigene Lage prekärer denn je, die (bosnisch-)ser-bische Bevölkerung ist wegen des außerordent-lich niedrigen Lebensstandards immer frustrier-ter. (...) Man hätte glauben können, dass das Schicksal des ehemaligen jugoslawischen und dann serbischen Präsidenten Slobodan Milose-vic (...) ein Warnsignal für jeden Politiker auf dem Balkan ist. Doch im Interesse des Machter-halts nehmen einige von ihnen leider immer noch das Risiko in Kauf, die ohnehin nicht friedliche Region in Brand zu stecken.
I n Wolfsburg geht es wieder hoch her. Die Arbeitnehmervertreter im VW-Aufsichts-rat sprechen ihrem Vorstandsvorsitzenden das Misstrauen aus, weil er seine Arbeit aus
ihrer Sicht nicht mehr ordentlich erledigt. Ein beispielloser Vorgang in der deutschen Unter-nehmensgeschichte. Herbert Diess hat sich diese Entwicklung selbst zuzuschreiben. VW ist ein besonderes Unternehmen, mit Sonder-rechten des Betriebsrats und des Landes Niedersachsen. Er muss mit dem Betriebsrat eng zusammenarbeiten, ob er nun will oder nicht.
Deshalb war es völlig unverständlich, dass er zunächst nicht auf der für diesen Donnerstag angesetzten Betriebsversammlung erscheinen wollte. Seit bald zwei Jahren hat es in Wolfs-burg kein Mitarbeitertreffen mehr gegeben, die Coronapandemie hat das verhindert. Diess und sein Umfeld haben die Symbolik dieses Treffens nicht verstanden, als sie sich zu-nächst gegen die Teilnahme an der Betriebs-versammlung entschieden haben. Aus Sicht der Arbeitnehmer war das eine Provokation – und es war nicht die erste. Denn Diess hat die Provokation zum Stilmittel seines Manage-mentstils gemacht. Er glaubt, dass er solche Attacken braucht, um Veränderungen aus-zulösen und um vor allem in Wolfsburg etwas zu bewegen. Erst Ende September schockte er den Aufsichtsrat mit der Bemerkung, in Deutschland möglicherweise 30.000 Stellen
streichen zu müssen. Die Arbeitnehmer und auch die Vertreter des Landes Niedersachsen sind diese Provokationen leid. Sie pochen auf Kooperation, gerade auch wegen der schwieri-gen Transformation in Richtung Elektromobi-lität und Digitalisierung. Diess sollte sich wieder stärker um das operative Geschäft kümmern. Da wachsen die Probleme: bei der Einführung der neuen Stromautos, aber auch in China, dem wichtigsten Markt der Wolfs-burger.
Das Mittel der Provokation nutzt sich ab. Die halbjährlichen Kraftproben mit den Arbeitneh-mern lähmen das Unternehmen und bringen auch seine Position in Gefahr. Heute wagt niemand in Wolfsburg eine konkrete Prog-nose, was in den nächsten Wochen passieren wird und ob Diess seinen Chefposten tatsäch-lich behält. Eines dürfte allerdings sicher sein: Die Aufsichtsräte werden sehr wahrscheinlich versuchen, Macht und Einfluss von Herbert Diess weiter zu begrenzen. Die Blaupause dafür liefert die Krise aus dem Sommer 2020, als dem Konzernchef die Führung der Marke Volkswagen abgenommen wurde. Wenn seine Kompetenzen erneut beschnitten würden, müsste Herbert Diess für sich ent-scheiden, ob der Chefposten in Wolfsburg noch die richtige Position für ihn ist.
Machtkampf bei Volkswagen
Der falsche Weg
Auch ein Konzernchef
wie Diess muss einsehen, dass
er die historisch bedingten
Sonderrechte des Betriebs -rates und des
Landes Nieder-sachsen nicht
aufheben kann.
Stefan Menzel
Der Autor ist Korrespondent im Unternehmensressort. Sie erreichen ihn unter: [email protected]
N un ist die Zeitumstellung fast eine Woche her, und noch immer bin ich nicht in der Normalzeit angekommen. Im Arbeitszimmer ist schon Winterzeit, auf
dem Radiowecker im Schlafzimmer ist Som-merzeit, die Uhr am Küchenherd ist auch nicht umgestellt. Ich lebe also in einem Niemands-land zwischen den Zeiten. Es ist mir echt zu anstrengend, all die Uhren umzustellen.
Dass es verschiedene Zeiten im selben Land gibt, ist ja nicht so ungewöhnlich. Als Deutsch-land noch aus Kleinstaaten bestand, hatte jede Stadt ihre eigene Ortszeit. Erst durch das Eisenbahnnetz wurde es notwendig, eine einheitliche Zeitzone zu schaffen. Und wenn man sich die Pünktlichkeit der Bahn anschaut, hat man das Gefühl, so richtig habe man das dort bis heute nicht verstanden. Ich übrigens auch nicht. Ich finde das eigentlich keine so schöne Vorstellung, dass gerade die Winter-zeit die Normalzeit sein soll. Ich konnte eine Stunde länger schlafen, habe diese Stunde allerdings gar nicht gemerkt; während mir umgekehrt die Stunde, die ich beim Wechsel zur Sommerzeit früher aufstehen muss, noch Tage lang in den Knochen steckt.
Regelmäßig wird darüber lamentiert, dass die EU ja schon lange die Zeitumstellung abschaf-fen will. Aber daraus geworden ist bislang nichts. Die aktuelle Zeitregelung gibt es seit 1980. Davor war man 30 Jahre ohne ein
Verstellen der Uhr ausgekommen. Zwischen 1916 und 1950 hingegen hatte es allerlei Zeitmodelle gegeben. Zwischen Mai und Juni 1947 hatte in ganz Deutschland sogar einmal die Moskauer Zeit geherrscht. Somit kann man die Periode nach 1980 auch als eine Ära der zeitlichen Stabilität sehen. Nie zuvor seit dem Ersten Weltkrieg wussten die Bürger so beständig, wann sie eine Stunde länger und eine Stunde kürzer schlafen sollten.
Es wird immer wieder angeführt, dass die Zeitumstellung nur eine geringe Stromerspar-nis bringe, weil man etwas Beleuchtung sparen könne, aber an anderer Stelle zahle man drauf – etwa bei gesundheitlichen Kosten durch die Störung des Biorhythmus oder durch reduzier-te Arbeitsleistung. Angeblich soll die Sommer-zeit am günstigsten sein.
Mein eigener Vorschlag zur Zeitreform: Lasst die Menschen einfach jeden Tag eine Stunde länger schlafen und führt den 25-Stunden-Tag ein. Zum einen ist Schlaf gesund. Gleichzeitig würde das Jahr dadurch um 15 Tage länger. Wir alle würden also langsamer älter und länger jung bleiben. Gleichzeitig aber ein paar Jahre früher sterben. Das würde die Rentenkas-se enorm entlasten. Ich schlage das mal der EU-Kommission vor.
Prüfers Kolumne
Zwischen den Zeiten
Lasst die Menschen
einfach jeden Tag eine Stunde länger schlafen und führt den 25-Stunden-
Tag ein.
Tillmann Prüfer
Der Autor ist Kolumnist. Sie erreichen ihn unter: [email protected]
Statt Dauerprovokation sollte CEO Diess auf Kooperation setzen.
Eine Reform der Schlafzeit könnte auch die Rentenkassen entlassen.
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Meinung & Analyse
19
Die US-Notenbank (Fed) hat geliefert, was sie angekündigt hat: die geldpoliti-sche Wende. Weil es keinerlei böse Überraschung aus Sicht der Märkte gab, war eine kleine Erleichterungsral-ly an den Börsen die Folge. Die Euro-
päische Zentralbank (EZB) wird im Dezem-ber die Normalisierung der Geldpolitik einleiten, hat dabei aber noch einen weiteren Weg zurückzulegen als die Fed. Aber das passt dazu, dass Europa im wirtschaftlichen Zyklus hinter den USA zurückliegt.
Wenn die Notenbanken die Geldpolitik normalisieren, wird es Zeit, sie von politi-schen Lasten zu befreien – vor allem von ungelösten Verteilungsproblemen. In der Pandemie haben Finanz- und Geldpolitik wahrscheinlich besser als je zuvor zusammen-gearbeitet, um wenigstens die wirtschaftli-chen Folgen der Seuche, die jetzt schon Millionen Menschenleben gekostet hat, aufzufangen. Doch in Zukunft werden die Interessen der Notenbanken und der Regie-rung weniger übereinstimmen. Umso wichti-ger ist es, beide Bereiche sauber zu trennen. Entscheidend ist vor allem, dass die demokra-tisch legitimierte Politik keine Aufgaben bei den Notenbanken ablädt, mit denen sie selbst nicht klarkommt. Bei solchen Problemen geht es fast immer um Verteilungsfragen. Schon die große Finanzkrise wurde maßgeblich dadurch ausgelöst: In den USA ersetzte eine laxe Kreditvergabe für ärmere Haushalte eine solide Sozialpolitik – die entsprechenden Kredite brachten später fast das Weltfinanzsys-tem zum Einsturz. Das System musste mit einer Flut von Geld von den Notenbanken am Leben erhalten werden.
Heute geht es wieder um Verteilungsproble-me. Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden versucht mit riesigen Ausgabenpake-ten, sozialen Ausgleich zu schaffen. Vor allem
bei linken Demokraten kommt dabei die Theorie mit dem Namen Modern Monetary Theory (MMT) gut an. Im Grunde läuft sie darauf hinaus, die Notenbank Ausgaben über Käufe von Staatsanleihen finanzieren zu lassen. Solange die Inflation nicht steigt, so die Theorie, kann der Staat sich quasi unbe-grenzt verschulden. Schade nur, dass die Teuerungsrate gerade in den USA deutlich steigt, und das auch wegen der großzügigen Finanzpolitik. So läuft MMT schneller als gedacht vor die Wand. Fazit daher: Die Fed ist die falsche Adresse, die Ungleichheit muss von den Politikern behoben werden.
In Europa stehen dagegen die Spannungen zwischen einzelnen Euro-Ländern im Vorder-grund. Euro-Land hat als einheitlicher Wirt-schaftsraum starke und schwache Regionen. Auf Dauer abbauen können solche Ungleich-heiten – und das wird viel zu wenig verstan-den und akzeptiert – nur finanzielle Trans-fers. Die Frage ist nicht, ob, sondern, wie sie passieren. In Märkten mit verschiedenen Währungen läuft das über die Abwertung schwacher Devisen. In einem Markt mit einheitlicher Währung läuft es über die Geldpolitik oder eben über einen offenen Finanzausgleich. Wenn gar nichts mehr geht, ist zwangsläufig ein Schuldenschnitt die Lösung, der auch auf Transfer hinausläuft.
Die Notenbanken sind – egal, wie ihr Mandat im Detail definiert ist – de facto für die Stabili-tät der Preise, der Wirtschaft insgesamt und des Finanzsystems zuständig; alle drei hängen ja auch zusammen. Deswegen können sie Probleme, die man ihnen überlässt, nicht ignorieren. Man sollte ihnen nicht zu viel zumuten.
Notenbanken
Zu viel Politik in der Geldpolitik
Der Autor ist Korrespondent in Frankfurt. Sie erreichen ihn unter: [email protected]
Entscheidend ist vor allem, dass die
demokratisch legitimierte Politik keine Aufgaben bei den Notenbanken ablädt, mit denen
sie selbst nicht klarkommt.
Frank Wiebe
Bei Fed und EZB landen Probleme, die dort nicht hingehören. Das muss aufhören.
Thomas Sigmund ist Ressortleiter Politik. Sie erreichen ihn unter: sigmund@ handelsblatt.com
W enn nicht noch ein Wunder geschieht, dann schafft die neue Regierung kein eigenständiges Digital-
ministerium. SPD, Grüne und FDP haben damit die digitale Zukunft abgesagt, eine wichtige Chance ist vertan. Jetzt soll das Mega-Thema wohl an irgend-ein Ressort angeflanscht werden. Priorität hat es damit nicht.
Ein Klimaschutzministerium wird es dagegen zu Recht geben. Dort will man alle Kompetenzen bün-deln und ganze Abteilungen hin und her schieben. Es gibt sogar Überlegungen, das Wirtschafts- und Umweltministerium zu fusionieren. Bei der Digitalisie-rung ist das angeblich alles zu schwierig. Der Aufwand würde sich nicht lohnen.
Das ist alles vorgeschoben. Es spielen parteipolitische Gründe eine Rolle. Keiner der zukünftigen Partner will dieses Profilierungs-feld dem anderen überlas-sen. Damit bleibt alles, wie es ist.
Das Innenministerium bleibt für die Cybersicherheit zuständig und grätscht damit weiter in alle Themen hinein. Das Zukunftsfeld E-Health untersteht dem Gesund-heitsministerium und dem Ein-fluss der verkrusteten Strukturen der AOK und anderer Wettbewer-ber. Das Verkehrs- und das Wirt-schaftsministerium werden über das autonome Fahren streiten.
Die Digitalisierung wird also weiter zerrieben, so wie es immer war.
In der vorletzten Großen Koaliti-on gab es eine breit angelegte digitale Agenda. Da waren fünf Ressorts federführend. Heraus-gekommen ist nichts. In der letzten Legislaturperiode ver-suchte man es mit einer Staats-ministerin im Kanzleramt. Außer nicht fliegenden Flugtaxis und schillernden Auftritten bei Gaming-Convents ist wenig hängen geblieben.
Wirtschaftsminister Peter Altmai-er ließ sich keine Telefonate von ausländischen Amtskollegen in sein Dienstauto durchstellen, weil er sich für die Funklöcher schämte. Es ist schon fast absehbar, dass der künftige Kanzler Olaf Scholz damit drohen wird, das Ganze zur Chefsache zu machen. Das war es dann wieder mit der Digitalisie-rung in Deutschland.
Digitalministerium
Zukunft ist abgesagt
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Meinung & Analyse
18
Zur Niederlage der Demokraten bei der Gouverneurswahl im Bundesstaat Virginia schreibt die Zeitung „La Vanguardia“ :
Die Niederlage der Demokraten in Virginia schwächt noch mehr die Position des Präsiden-ten. Gestern hat sich ja zum ersten Mal jene Wahl gejährt, bei der der Demokrat zum US-Prä-sidenten gewählt wurde und der Republikaner Donald Trump eine Niederlage erlitt. Das Ge-schenk, das Biden an diesem Jahrestag erhielt, hätte nicht bitterer sein können. Bidens Beliebt-heitswerte fallen und fallen. Weil der Rückzug aus Afghanistan die US-Gesellschaft hart getrof-fen hat. Weil die Bilder vom brutalen Einsatz berittener Grenzschützer gegen Latino-Migran-ten in Texas auch den Demokraten miss fallen haben. Weil Covid weiterhin großen Schaden anrichtet. Weil Hurrikan Ida (...) die Schwächen der Infrastruktur (...) offenbart. Weil die Inflation und die Kraftstoffpreise steigen. Und weil der Präsident das Budget für sein Sozial-, Klima- und Infrastruktur-Paket wegen des Widerstandes in der eigenen Partei um die Hälfte stutzen musste.
Außenansichten
Zur aktuellen Lage in Äthiopien schreibt die französische Tageszeitung „La Croix“:
Der Krieg hat von ganz Äthiopien Besitz ergrif-fen. Dieses Land, das gerne als Vorbild für Fortschritt in Afrika dargestellt wird, ist von seinen alten Dämonen eingeholt worden. Zehn Monate lang hat sich der Krieg auf die nördlichs-te Region, die Tigray-Region, begrenzt, seit August breiten sich die Kämpfe nun aus. (...) Ministerpräsident Abiy Ahmed trägt eine erdrückende Verantwortung für dieses Desas-ter. Vor einem Jahr wollte er die Tigray-Region in den Griff bekommen, eine nach Unabhängig-keit strebende Provinz, die von politischen Gegnern geführt wurde. Damit hat er nicht nur die Zündschnur des Krieges angesteckt. Er hat sich dafür auch mit dem ehemaligen Erzfeind Eritrea verbündet, dessen Armee furchtbare Verbrechen begangen hat. Dieser junge Politi-ker mit dem Profil eines aufgeklärten Erneue-rers hatte einst den Friedensnobelpreis erhalten (...). Nun legt er Zynismus und Verblendung an den Tag.
Zu den Abspaltungsbestrebungen im serbi-schen Landesteil von Bosnien-Herzegowina schreibt die Budapester Zeitung „Nepszava“:
Die Erfahrung lehrt, dass ein diktatorisch veranlagter Politiker umso gefährlicher ist, je mehr er sich in die Enge gedrängt fühlt. (...) Milorad Dodik, das serbische Mitglied des bosnischen Staatspräsidiums, (...) droht damit, eigene bewaffnete Streitkräfte zu schaffen, was ein schwerer Verstoß gegen das Dayton-Abkom-men wäre, das den bosnischen Krieg beendet hat. Dodiks Worte können den Eindruck erwe-cken, dass der Friede auf dem Balkan in Gefahr ist wie noch nie seit 1995. (...) Dabei ist seine eigene Lage prekärer denn je, die (bosnisch-)ser-bische Bevölkerung ist wegen des außerordent-lich niedrigen Lebensstandards immer frustrier-ter. (...) Man hätte glauben können, dass das Schicksal des ehemaligen jugoslawischen und dann serbischen Präsidenten Slobodan Milose-vic (...) ein Warnsignal für jeden Politiker auf dem Balkan ist. Doch im Interesse des Machter-halts nehmen einige von ihnen leider immer noch das Risiko in Kauf, die ohnehin nicht friedliche Region in Brand zu stecken.
I n Wolfsburg geht es wieder hoch her. Die Arbeitnehmervertreter im VW-Aufsichts-rat sprechen ihrem Vorstandsvorsitzenden das Misstrauen aus, weil er seine Arbeit aus
ihrer Sicht nicht mehr ordentlich erledigt. Ein beispielloser Vorgang in der deutschen Unter-nehmensgeschichte. Herbert Diess hat sich diese Entwicklung selbst zuzuschreiben. VW ist ein besonderes Unternehmen, mit Sonder-rechten des Betriebsrats und des Landes Niedersachsen. Er muss mit dem Betriebsrat eng zusammenarbeiten, ob er nun will oder nicht.
Deshalb war es völlig unverständlich, dass er zunächst nicht auf der für diesen Donnerstag angesetzten Betriebsversammlung erscheinen wollte. Seit bald zwei Jahren hat es in Wolfs-burg kein Mitarbeitertreffen mehr gegeben, die Coronapandemie hat das verhindert. Diess und sein Umfeld haben die Symbolik dieses Treffens nicht verstanden, als sie sich zu-nächst gegen die Teilnahme an der Betriebs-versammlung entschieden haben. Aus Sicht der Arbeitnehmer war das eine Provokation – und es war nicht die erste. Denn Diess hat die Provokation zum Stilmittel seines Manage-mentstils gemacht. Er glaubt, dass er solche Attacken braucht, um Veränderungen aus-zulösen und um vor allem in Wolfsburg etwas zu bewegen. Erst Ende September schockte er den Aufsichtsrat mit der Bemerkung, in Deutschland möglicherweise 30.000 Stellen
streichen zu müssen. Die Arbeitnehmer und auch die Vertreter des Landes Niedersachsen sind diese Provokationen leid. Sie pochen auf Kooperation, gerade auch wegen der schwieri-gen Transformation in Richtung Elektromobi-lität und Digitalisierung. Diess sollte sich wieder stärker um das operative Geschäft kümmern. Da wachsen die Probleme: bei der Einführung der neuen Stromautos, aber auch in China, dem wichtigsten Markt der Wolfs-burger.
Das Mittel der Provokation nutzt sich ab. Die halbjährlichen Kraftproben mit den Arbeitneh-mern lähmen das Unternehmen und bringen auch seine Position in Gefahr. Heute wagt niemand in Wolfsburg eine konkrete Prog-nose, was in den nächsten Wochen passieren wird und ob Diess seinen Chefposten tatsäch-lich behält. Eines dürfte allerdings sicher sein: Die Aufsichtsräte werden sehr wahrscheinlich versuchen, Macht und Einfluss von Herbert Diess weiter zu begrenzen. Die Blaupause dafür liefert die Krise aus dem Sommer 2020, als dem Konzernchef die Führung der Marke Volkswagen abgenommen wurde. Wenn seine Kompetenzen erneut beschnitten würden, müsste Herbert Diess für sich ent-scheiden, ob der Chefposten in Wolfsburg noch die richtige Position für ihn ist.
Machtkampf bei Volkswagen
Der falsche Weg
Auch ein Konzernchef
wie Diess muss einsehen, dass
er die historisch bedingten
Sonderrechte des Betriebs -rates und des
Landes Nieder-sachsen nicht
aufheben kann.
Stefan Menzel
Der Autor ist Korrespondent im Unternehmensressort. Sie erreichen ihn unter: [email protected]
N un ist die Zeitumstellung fast eine Woche her, und noch immer bin ich nicht in der Normalzeit angekommen. Im Arbeitszimmer ist schon Winterzeit, auf
dem Radiowecker im Schlafzimmer ist Som-merzeit, die Uhr am Küchenherd ist auch nicht umgestellt. Ich lebe also in einem Niemands-land zwischen den Zeiten. Es ist mir echt zu anstrengend, all die Uhren umzustellen.
Dass es verschiedene Zeiten im selben Land gibt, ist ja nicht so ungewöhnlich. Als Deutsch-land noch aus Kleinstaaten bestand, hatte jede Stadt ihre eigene Ortszeit. Erst durch das Eisenbahnnetz wurde es notwendig, eine einheitliche Zeitzone zu schaffen. Und wenn man sich die Pünktlichkeit der Bahn anschaut, hat man das Gefühl, so richtig habe man das dort bis heute nicht verstanden. Ich übrigens auch nicht. Ich finde das eigentlich keine so schöne Vorstellung, dass gerade die Winter-zeit die Normalzeit sein soll. Ich konnte eine Stunde länger schlafen, habe diese Stunde allerdings gar nicht gemerkt; während mir umgekehrt die Stunde, die ich beim Wechsel zur Sommerzeit früher aufstehen muss, noch Tage lang in den Knochen steckt.
Regelmäßig wird darüber lamentiert, dass die EU ja schon lange die Zeitumstellung abschaf-fen will. Aber daraus geworden ist bislang nichts. Die aktuelle Zeitregelung gibt es seit 1980. Davor war man 30 Jahre ohne ein
Verstellen der Uhr ausgekommen. Zwischen 1916 und 1950 hingegen hatte es allerlei Zeitmodelle gegeben. Zwischen Mai und Juni 1947 hatte in ganz Deutschland sogar einmal die Moskauer Zeit geherrscht. Somit kann man die Periode nach 1980 auch als eine Ära der zeitlichen Stabilität sehen. Nie zuvor seit dem Ersten Weltkrieg wussten die Bürger so beständig, wann sie eine Stunde länger und eine Stunde kürzer schlafen sollten.
Es wird immer wieder angeführt, dass die Zeitumstellung nur eine geringe Stromerspar-nis bringe, weil man etwas Beleuchtung sparen könne, aber an anderer Stelle zahle man drauf – etwa bei gesundheitlichen Kosten durch die Störung des Biorhythmus oder durch reduzier-te Arbeitsleistung. Angeblich soll die Sommer-zeit am günstigsten sein.
Mein eigener Vorschlag zur Zeitreform: Lasst die Menschen einfach jeden Tag eine Stunde länger schlafen und führt den 25-Stunden-Tag ein. Zum einen ist Schlaf gesund. Gleichzeitig würde das Jahr dadurch um 15 Tage länger. Wir alle würden also langsamer älter und länger jung bleiben. Gleichzeitig aber ein paar Jahre früher sterben. Das würde die Rentenkas-se enorm entlasten. Ich schlage das mal der EU-Kommission vor.
Prüfers Kolumne
Zwischen den Zeiten
Lasst die Menschen
einfach jeden Tag eine Stunde länger schlafen und führt den 25-Stunden-
Tag ein.
Tillmann Prüfer
Der Autor ist Kolumnist. Sie erreichen ihn unter: [email protected]
Statt Dauerprovokation sollte CEO Diess auf Kooperation setzen.
Eine Reform der Schlafzeit könnte auch die Rentenkassen entlassen.
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Meinung & Analyse
19
Stefan Menzel, Roman Tyborski Wolfsburg
Eigentlich wollte Herbert Diess an diesem Donnerstag gar nicht in Wolfsburg sein. Der VW-Chef hatte eine Reise in die USA geplant, um dort Investo-ren zu treffen. Doch der Be-
triebsrat protestierte scharf, warf Diess Desinteresse an seiner eigenen Beleg-schaft vor. Nun weilt der Vorstands-chef nicht im sonnigen Südwesten Amerikas, sondern trifft im verregne-ten Wolfsburg auf wütende Bandarbei-ter. In Halle 11 im Hauptwerk von VW steht die „Belegschaftsinformation des Betriebsrates“. Sie ist eine Abrechnung mit Diess.
„Wie Sie in den letzten Monaten öffentlich aufgetreten sind, da frage ich mich wirklich, ob Ihnen selbst diese La-ge hier an unserem Standort eigentlich bewusst ist und wie das in der Beleg-schaft ankommt“, sagt Daniela Cavallo, die Betriebsratsvorsitzende von Volks-wagen. Unter den Zuhörern in Halle 11 sind Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Beide wachen als Aufsichtsräte über die Arbeit von Diess. Beide sind mittlerweile keine Freunde mehr von ihm.
Cavallo nannte Mutmaßungen über die Streichung Zehntausender Stellen bei der Volkswagen-Kernmar-ke, die Diess in den vergangenen Wo-chen angeheizt hatte, „inhaltlichen Un-fug“. Wenn der Vorstandsvorsitzende dennoch öffentlich das Thema immer wieder befeuere, sei das „ziemlich trau-rig“, kritisierte sie. „Hier ist nicht ein Mensch zu viel an Bord. Nicht eine Stelle können Sie zusätzlich mit uns verhandeln!“
In einer Aufsichtsratssitzung im September sorgte Diess mit Planspielen über den Abbau von 30.000 Arbeits-plätzen in Deutschland für Aufruhr. Zwar rückte er von dieser Zahl schnell wieder ab, doch der Schaden war nicht zu kitten. „Die Mitarbeiter haben Angst!“, sagt Cavallo. „Angst um ihre Arbeit, um ihre Familien, um ihre Exis-tenz. Und Sie streuen immer wieder Salz in die Wunde, und das ohne Not.“
Cavallo erhält stehende Ovationen für ihre Worte. Diess scheint das nicht zu beeindrucken. Der VW-Chef bleibt dabei: In Wolfsburg müssen Stellen ge-strichen werden: „Die heute bestehen-den Jobs werden innerhalb der nächs-ten zehn bis 15 Jahre sicher weniger – vor allem in der Verwaltung auf Kon-zernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung.“ Aus dem Pu-blikum kommen jetzt Pfiffe.
Diess bleibt bei seiner LinieDiess muss wissen, was er hier tut. Seit der Aufsichtsratssitzung im September hat er eine geschlossene Front aus Be-triebsrat, Gewerkschaft und den Ver-tretern des Landes Niedersachsen ge-gen sich. Das sind zwölf von 20 Stim-men im Aufsichtsrat. Mittwoch vor einer Woche sprach ihm die Mitarbei-terseite das Misstrauen aus. Nun soll ein Vermittlungsausschuss über seine Zu-kunft entscheiden. Dort sitzt neben Ca-vallo, Hofmann und Weil nur noch der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch. Er ist sein einziger Verbündeter.
Diess scheint das nicht zu schre-cken. Er sieht sich einer größeren Auf-gabe verpflichtet als seiner eigenen Ar-beitsplatzsicherheit: die Rettung von
ganz Volkswagen. Ausgerechnet das Werk in Wolfsburg ist nicht wett-bewerbsfähig, meint Diess. Zu teuer, zu langsam, zu rückwärtsgewandt.
Seine Beschreibung ist hart, aber nicht falsch. Gerade in diesen Tagen ist das Hauptwerk von Europas größtem Autobauer ein Schatten seiner selbst. Chipkrise und Materialmangel lassen die Produktionszahlen abstürzen. Statt knapp einer Million Fahrzeuge werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht einmal 400.000 vom Band laufen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wa-ren schon zu wochenlanger Kurzarbeit gezwungen.
Cavallo will Diess die Rolle als ein-samer Kämpfer für Volkswagens Zu-kunft nicht zubilligen. Auch der Vor-stand trägt Verantwortung für die Mi-sere, rügt die Betriebsratschefin. „Das, was wir bei den Halbleitern sehen, ist ein Armutszeugnis“, sagt Cavallo. „Zu-mal es durchaus andere Automobilher-steller gibt, die besser durch die Krise kommen.“
Diess verspricht Besserung. Man werde alles dafür tun, dass die Chips
zwischen den Premiummarken, Volu-men, China, Europa und den USA ge-recht verteilt werden würden, erklärt der Volkswagen-Chef. Der Vorstand habe am Dienstag beschlossen, alle Werke bestmöglich auszulasten.
Cavallo stören die ständigen Tesla-Vergleiche
Das reicht aber nicht, sagt Diess. Der Chipmangel sei ärgerlich, aber vergäng-lich. Ein viel größeres Problem werde sich nicht mit der Zeit selbst lösen, son-dern immer nur größer: Tesla. Der US-Hersteller von Elektrofahrzeugen will in Grünheide bei Berlin im kommen-den Jahr mit 7000 Mitarbeitern rund eine halbe Million Fahrzeuge bauen. Diess rechnet der Belegschaft vor, was das bedeutet.
Tesla schaffe voraussichtlich 90 Einheiten pro Stunde in einer Linie, zehn Stunden pro Auto. „In Zwickau liegen wir bei über 30 Stunden“, sagt Diess. „20 Stunden wollen wir im nächsten Jahr schaffen – gestartet sind wir ursprünglich mit einem Projektziel von 16 Stunden.“ Jeder in Halle 11 kann
selbst nachrechnen: Tesla wäre selbst dann viel produktiver als Volkswagen, wenn Volkswagen seine Ziele erreichen würde. Man erreicht sie aber nicht.
„Diese Zahlen sind es, die mich dazu bewegen, auf diesen neuen Wettbewerb hinzuweisen und nicht die Augen zu verschließen“, erklärt Diess. „Das Tesla Model 3 war im September das meist-verkaufte Auto in Europa, noch vor dem Golf. Und das, obwohl Tesla noch gar nicht in Europa baut! Ja, ich mache mir Sorgen um Wolfsburg! Wir dürfen uns unseren Standort, unsere Konzernzen-trale nicht von Tesla in Grünheide ka-puttmachen lassen!“ Nun erhält auch Beifall aus der Belegschaft.
Cavallo hält die Rechnung von Diess für zu simpel. In Wolfsburg seien circa 13.000 Menschen direkt mit dem Autobau befasst, sagt die Betriebsrats-chefin. „Wenn wir mal die festgelegten 820.000 Autos nehmen, die für Wolfs-burg angepeilt waren, würden wir im Vergleich immer noch ziemlich gut ab-schneiden.“
Freilich: Niemand weiß, wann Volkswagen in Wolfsburg je wieder
Streit bei Volkswagen
VW-Chef verteidigt Tesla-Vergleiche
Der Streit zwischen dem Betriebsrat und Herbert Diess gewinnt auch verbal an Schärfe. Auf einer Betriebsversammlung übt Betriebsratschefin Cavallo deutliche Kritik.
alto
.pre
ss /
Alt
o P
ress
, im
ago
imag
es/S
usan
ne H
übne
r
Die Mitar-beiter haben Angst! Und Sie streuen immer wie-der Salz in
die Wunde.
Daniela CavalloBetriebsratsvorsit-zende von Volkswa-
gen
Im Konflikt: VW-Chef
Herbert Diess (l.) und seine
Kontrahentin, die Betriebsratschefin Daniela Cavallo (r.)
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Unternehmen
20
820.000 Fahrzeuge produzieren wird. Cavallo will unabhängig davon an jeder einzelnen Stelle im Hauptwerk festhal-ten. Auf Diess Vergleiche mit Tesla rea-giert sie geradezu allergisch. „Die Faszi-nation, die Sie offenbar gegenüber Herrn Musk empfinden, und den Elan, den Sie in die Kontaktpflege mit ihm stecken“, sagt die Betriebsratschefin, „das würden wir Beschäftigten uns auch für unsere aktuell großen Herausforderungen im Konzern sichtbar wünschen.“
Diess entgegnet, es gehöre zu sei-nem Job, die VW-Mitarbeiter heraus-zufordern, auch wenn es nervt. „Es ist meine Aufgabe und die des gesamten Managements, den Wettbewerb richtig einzuschätzen, den Konzern darauf vorzubereiten und zukunftssicher zu machen“, sagt der VW-Chef. „Selbst wenn ich nicht mehr über Elon Musk spreche: Er bleibt da und revolutioniert unsere Industrie und wird schnell im-mer wettbewerbsfähiger.“
Kompromissvorschlag auf dem Tisch
Wieder knirscht es zwischen den bei-den. Es sei einfach falsch, der VW-Be-legschaft mangelnden Fortschrittswillen zu unterstellen, entgegnet Cavallo. „Der Betriebsrat will den Wandel, die Beleg-schaft will den Wandel, Wolfsburg will den Wandel!“, sagt die Betriebsratsche-fin. „Aber den Wandel gibt es nur mit VW-Kultur. Und dazu gehört, dass der Betriebsrat sich einmischt. Sie erzählen überall, dass Sie Volkswagen in die E-Mobilität führen wollen. Alles klar, da sind wir dabei. Diesen Wandel finan-zieren wir doch aktuell und auch die kommenden Jahre aber noch über den Verkauf von Verbrennern.“
Wird sich Diess gegen diese Be-triebsrätin durchsetzen? Als Minister-präsident und VW-Aufsichtsrat Weil das Wort ergreift, muss Diess erken-nen, dass er sich isoliert hat. „Was ist
Aufgabe des Unternehmens in diesen Zeiten?“, fragt Weil in Halle 11. Und antwortet selbst: „Nicht die Sorgen zu schüren. Die Aufgabe des Unterneh-mens in diesen Zeiten ist es, Perspek-tiven zu geben!“
Volkswagen stehe seit Jahrzehnten im Wettbewerb. Er kenne in diesem Unternehmen niemanden, der diese Grundlage infrage stellt, sagt Weil. „Es kommt allerdings darauf an, Wett-bewerbsfähigkeit so zu erzielen, dass alle mitgehen können, das ist das Ent-scheidende.“
Weil hat deshalb Hausaufgaben für Diess. Die nächste sogenannte Pla-nungsrunde steht an. Weichenstellun-gen für Volkswagen werden gesucht. „Wir haben als Land Niedersachsen ei-ne sehr klare Erwartung an die nächste Planungsrunde“, sagt Weil. „Die Ver-unsicherung, die überall um sich greift – in der Öffentlichkeit, bei den Kun-den, auf den Märkten, hier im Werk selbst bei den Beschäftigten –, diese Verunsicherung muss ein Ende haben. Am Ende der Planungsrunde muss es noch in diesem Jahr klare Perspektiven geben, die dann für alle verbindlich sind und an denen sich alle dann auch ori-entieren können.“
Der Kampf um die Perspektiven ist in vollem Gange. Diess rechnet immer wieder vor, dass der Konkurrent Tesla mehr Autos in weniger Zeit produzie-ren kann. Eine Perspektive für Volks-wagen gibt es demnach erst, wenn der Konzern sich anpasst.
Der Betriebsrat will einen Wandel mit Arbeitsplatzsicherheit – und hat mit Weil einen Verbündeten im Auf-sichtsrat. Innerhalb von nur vier Wo-chen soll sich entscheiden, ob die VW-Kontrolleure Diess weitermachen las-sen. Doch wie sagte der VW-Chef: Tesla wird nicht verschwinden, nur weil in Wolfsburg niemand mehr von den Amerikanern redet.
T oyota hat ungeachtet der weltwei-ten Chipkrise im zweiten Ge-schäftsquartal seinen Gewinn stär-ker gesteigert als von Experten er-
wartet. Der weltgrößte Autobauer verwies am Donnerstag auf eine Erho-lung der Nachfrage und einen schwäche-ren Yen. Der operative Gewinn im Zeit-raum bis Ende September stieg um 48 Prozent auf 750 Milliarden Yen (etwa 5,7 Milliarden Euro).
Experten hatten Refinitiv-Daten zu-folge 593,3 Milliarden Yen erwartet. Toyota erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 2,8 Billionen Yen (21,2 Milliarden Euro) von zuvor 2,5 Bil-lionen. Dies entspricht einer Betriebs-gewinnmarge von 9,3 Prozent, ein sehr hoher Wert für einen Massenhersteller.
Allerdings erwarten Analysten hier im Schnitt 2,92 Billionen Yen. Toyota geht nun von einer Auslieferung von 10,29 Millionen Fahrzeugen im Gesamt-jahr aus nach zuvor 10,55 Millionen.
Toyota hatte Mitte Oktober sein Produktionsziel für diesen Monat wegen des andauernden Halbleitermangels nach unten korrigiert. Die Produktion sollte demnach bis zu 15 Prozent gerin-ger ausfallen, was 100.000 bis 150.000 weniger Fahrzeuge bedeutet hätte. Da-mals plante der japanische Konzern noch, den Ausfall im Dezember wettzu-machen, und hielt an seinem Produkti-onsziel für das Geschäftsjahr fest.
Toyota ist zunächst besser als andere Autobauer durch die Chipkrise gekom-men. Hintergrund sind Lehren, die der Konzern aus der Katastrophe von Fu-kushima gezogen habe: Er verbesserte das Lieferkettenmanagement und ver-langte von Lieferanten, Bauteile für bis zu sechs Monate auf Vorrat zu halten.
Unmittelbar nach Bekanntwerden der Zahlen sprang Toyotas Aktienkurs kurzzeitig um fast fünf Prozent in die Höhe. Denn die hohen Gewinne zahlen sich auch für die Aktionäre aus. Die von Toyota erwarteten 2,5 Billionen Yen (18,8 Milliarden Euro) Reingewinn, zehn Prozent mehr als 2020. Der Konzern will daher die Interimsdividende um 15 auf 120 Yen (0,91 Euro) erhöhen und für 150 Milliarden Yen Aktien zurückkaufen.
Dennoch zog Toyotas Finanzchef ein negatives Fazit und entschuldigte sich zu Beginn bei Händlern, Zuliefe-rern, Anlegern und Kunden für die Un-annehmlichkeiten, die die Produktions-drosselung verursachte. Ohne hohe
Wechselkursgewinne wäre die Vorher-sage wegen höherer Rohstoffpreise deutlich niedriger ausgefallen, merkte Kon an. Doch auch diese Vorsicht kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Toyotas neue Prognose angesichts des Halbjahresgewinns immer noch konser-vativ wirkt.
Denn: Toyota verbuchte für die erste Jahreshälfte immerhin eine Gewinnmar-ge von 11,3 Prozent. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum noch 4,6 Prozent gewesen. Dabei lag die Produktion in diesem Halbjahr mit 4,1 Millionen Autos wegen Chipengpässen 550.000 Autos unter dem Vorkrisenniveau. Dass der Autohersteller dennoch den Gewinn so stark erhöhen konnte, unterstreicht sei-ne derzeitige Ausnahmestellung in Ja-pans Autoindustrie.
Zulieferern Zuversicht signalisiert
Ein Grund für den Gewinnanstieg wäh-rend der Krise: Nachdem Naturkatastro-phen in Japan die heimische Produktion zweimal für Monate stillgelegt hatten, durchleuchtete Toyota seine Lieferkette nach möglichen Bruchpunkten, setzte im Design mehr auf Standardbauteile und erhöhte die Lagerhaltung von Schlüsselbauteilen.
Außerdem setzte der Konzern ge-rade zu Beginn der Coronakrise darauf, seinen Zulieferern Zuversicht zu signali-sieren. Als einziger japanischer Autoher-steller wagte das Unternehmen, eine Jahresprognose herauszugeben, die ei-nen steigenden Absatz in der zweiten Jahreshälfte annahm.
Gemeinsam mit der permanenten Kostensenkung, für die Toyota eng mit seinen Lieferanten zusammenarbeitet, zahlten sich diese Maßnahmen zu Be-ginn der Chipkrise aus. Während andere Hersteller zu Beginn des Jahres bereits deutlich die Produktion drosseln muss-ten, produzierte Toyota nahezu unge-stört weiter.
Erst als in diesem Sommer eine große Coronawelle in Südostasien viele dortige Werke in der Chiplieferkette zur Schlie-ßung zwang, musste auch Toyota seine Produktion erstmals massiv herunterfah-ren. Doch Toyotas Finanzchef Kon er-klärte, dass der Konzern die ausgefallene Produktion durch andere Maßnahmen wenigstens teilweise auffangen konnte.
So würden Händler ihre Lager-bestände abbauen, um die Einbrüche zu überbrücken. Außerdem können die Hersteller finanzielle Kaufanreize ab-bauen, da die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Auch die steigenden Gebrauchtwagenpreise wirken sich über die Finanzsparte des Konzerns positiv auf die Bilanz aus.
Dieser umsichtige Kurs zahlt sich nun aus. Allerdings schaut Toyota wei-terhin vorsichtig in die Zukunft. Kon er-wartete zwar, dass sich die Versorgung mit Chips und Bauteilen deutlich ver-bessern wird. „Aber wir sehen auch nach Dezember weiterhin Risiken“, sagte Toyotas Finanzchef. Martin Kölling
Autobauer
Toyota profitiert vom Krisenmanagement
Der größte Autohersteller der Welt trotzt der Chipkrise. Das liegt auch an den Lehren aus Japans Naturkatastrophen.
Fahrzeug-Produk -tion: Toyota erhöht
die Gewinnprog-nose für das Gesamtjahr.
Blo
ombe
rg/G
etty
Imag
es
750Milliarden Yen
betrug der operative Gewinn
von Toyota im Zeit-raum bis Ende
September.
Quelle: Toyota
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Unternehmen
21
Stefan Menzel, Roman Tyborski Wolfsburg
Eigentlich wollte Herbert Diess an diesem Donnerstag gar nicht in Wolfsburg sein. Der VW-Chef hatte eine Reise in die USA geplant, um dort Investo-ren zu treffen. Doch der Be-
triebsrat protestierte scharf, warf Diess Desinteresse an seiner eigenen Beleg-schaft vor. Nun weilt der Vorstands-chef nicht im sonnigen Südwesten Amerikas, sondern trifft im verregne-ten Wolfsburg auf wütende Bandarbei-ter. In Halle 11 im Hauptwerk von VW steht die „Belegschaftsinformation des Betriebsrates“. Sie ist eine Abrechnung mit Diess.
„Wie Sie in den letzten Monaten öffentlich aufgetreten sind, da frage ich mich wirklich, ob Ihnen selbst diese La-ge hier an unserem Standort eigentlich bewusst ist und wie das in der Beleg-schaft ankommt“, sagt Daniela Cavallo, die Betriebsratsvorsitzende von Volks-wagen. Unter den Zuhörern in Halle 11 sind Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann. Beide wachen als Aufsichtsräte über die Arbeit von Diess. Beide sind mittlerweile keine Freunde mehr von ihm.
Cavallo nannte Mutmaßungen über die Streichung Zehntausender Stellen bei der Volkswagen-Kernmar-ke, die Diess in den vergangenen Wo-chen angeheizt hatte, „inhaltlichen Un-fug“. Wenn der Vorstandsvorsitzende dennoch öffentlich das Thema immer wieder befeuere, sei das „ziemlich trau-rig“, kritisierte sie. „Hier ist nicht ein Mensch zu viel an Bord. Nicht eine Stelle können Sie zusätzlich mit uns verhandeln!“
In einer Aufsichtsratssitzung im September sorgte Diess mit Planspielen über den Abbau von 30.000 Arbeits-plätzen in Deutschland für Aufruhr. Zwar rückte er von dieser Zahl schnell wieder ab, doch der Schaden war nicht zu kitten. „Die Mitarbeiter haben Angst!“, sagt Cavallo. „Angst um ihre Arbeit, um ihre Familien, um ihre Exis-tenz. Und Sie streuen immer wieder Salz in die Wunde, und das ohne Not.“
Cavallo erhält stehende Ovationen für ihre Worte. Diess scheint das nicht zu beeindrucken. Der VW-Chef bleibt dabei: In Wolfsburg müssen Stellen ge-strichen werden: „Die heute bestehen-den Jobs werden innerhalb der nächs-ten zehn bis 15 Jahre sicher weniger – vor allem in der Verwaltung auf Kon-zernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung.“ Aus dem Pu-blikum kommen jetzt Pfiffe.
Diess bleibt bei seiner LinieDiess muss wissen, was er hier tut. Seit der Aufsichtsratssitzung im September hat er eine geschlossene Front aus Be-triebsrat, Gewerkschaft und den Ver-tretern des Landes Niedersachsen ge-gen sich. Das sind zwölf von 20 Stim-men im Aufsichtsrat. Mittwoch vor einer Woche sprach ihm die Mitarbei-terseite das Misstrauen aus. Nun soll ein Vermittlungsausschuss über seine Zu-kunft entscheiden. Dort sitzt neben Ca-vallo, Hofmann und Weil nur noch der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch. Er ist sein einziger Verbündeter.
Diess scheint das nicht zu schre-cken. Er sieht sich einer größeren Auf-gabe verpflichtet als seiner eigenen Ar-beitsplatzsicherheit: die Rettung von
ganz Volkswagen. Ausgerechnet das Werk in Wolfsburg ist nicht wett-bewerbsfähig, meint Diess. Zu teuer, zu langsam, zu rückwärtsgewandt.
Seine Beschreibung ist hart, aber nicht falsch. Gerade in diesen Tagen ist das Hauptwerk von Europas größtem Autobauer ein Schatten seiner selbst. Chipkrise und Materialmangel lassen die Produktionszahlen abstürzen. Statt knapp einer Million Fahrzeuge werden in diesem Jahr wahrscheinlich nicht einmal 400.000 vom Band laufen. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wa-ren schon zu wochenlanger Kurzarbeit gezwungen.
Cavallo will Diess die Rolle als ein-samer Kämpfer für Volkswagens Zu-kunft nicht zubilligen. Auch der Vor-stand trägt Verantwortung für die Mi-sere, rügt die Betriebsratschefin. „Das, was wir bei den Halbleitern sehen, ist ein Armutszeugnis“, sagt Cavallo. „Zu-mal es durchaus andere Automobilher-steller gibt, die besser durch die Krise kommen.“
Diess verspricht Besserung. Man werde alles dafür tun, dass die Chips
zwischen den Premiummarken, Volu-men, China, Europa und den USA ge-recht verteilt werden würden, erklärt der Volkswagen-Chef. Der Vorstand habe am Dienstag beschlossen, alle Werke bestmöglich auszulasten.
Cavallo stören die ständigen Tesla-Vergleiche
Das reicht aber nicht, sagt Diess. Der Chipmangel sei ärgerlich, aber vergäng-lich. Ein viel größeres Problem werde sich nicht mit der Zeit selbst lösen, son-dern immer nur größer: Tesla. Der US-Hersteller von Elektrofahrzeugen will in Grünheide bei Berlin im kommen-den Jahr mit 7000 Mitarbeitern rund eine halbe Million Fahrzeuge bauen. Diess rechnet der Belegschaft vor, was das bedeutet.
Tesla schaffe voraussichtlich 90 Einheiten pro Stunde in einer Linie, zehn Stunden pro Auto. „In Zwickau liegen wir bei über 30 Stunden“, sagt Diess. „20 Stunden wollen wir im nächsten Jahr schaffen – gestartet sind wir ursprünglich mit einem Projektziel von 16 Stunden.“ Jeder in Halle 11 kann
selbst nachrechnen: Tesla wäre selbst dann viel produktiver als Volkswagen, wenn Volkswagen seine Ziele erreichen würde. Man erreicht sie aber nicht.
„Diese Zahlen sind es, die mich dazu bewegen, auf diesen neuen Wettbewerb hinzuweisen und nicht die Augen zu verschließen“, erklärt Diess. „Das Tesla Model 3 war im September das meist-verkaufte Auto in Europa, noch vor dem Golf. Und das, obwohl Tesla noch gar nicht in Europa baut! Ja, ich mache mir Sorgen um Wolfsburg! Wir dürfen uns unseren Standort, unsere Konzernzen-trale nicht von Tesla in Grünheide ka-puttmachen lassen!“ Nun erhält auch Beifall aus der Belegschaft.
Cavallo hält die Rechnung von Diess für zu simpel. In Wolfsburg seien circa 13.000 Menschen direkt mit dem Autobau befasst, sagt die Betriebsrats-chefin. „Wenn wir mal die festgelegten 820.000 Autos nehmen, die für Wolfs-burg angepeilt waren, würden wir im Vergleich immer noch ziemlich gut ab-schneiden.“
Freilich: Niemand weiß, wann Volkswagen in Wolfsburg je wieder
Streit bei Volkswagen
VW-Chef verteidigt Tesla-Vergleiche
Der Streit zwischen dem Betriebsrat und Herbert Diess gewinnt auch verbal an Schärfe. Auf einer Betriebsversammlung übt Betriebsratschefin Cavallo deutliche Kritik.
alto
.pre
ss /
Alt
o P
ress
, im
ago
imag
es/S
usan
ne H
übne
r
Die Mitar-beiter haben Angst! Und Sie streuen immer wie-der Salz in
die Wunde.
Daniela CavalloBetriebsratsvorsit-zende von Volkswa-
gen
Im Konflikt: VW-Chef
Herbert Diess (l.) und seine
Kontrahentin, die Betriebsratschefin Daniela Cavallo (r.)
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Unternehmen
20
820.000 Fahrzeuge produzieren wird. Cavallo will unabhängig davon an jeder einzelnen Stelle im Hauptwerk festhal-ten. Auf Diess Vergleiche mit Tesla rea-giert sie geradezu allergisch. „Die Faszi-nation, die Sie offenbar gegenüber Herrn Musk empfinden, und den Elan, den Sie in die Kontaktpflege mit ihm stecken“, sagt die Betriebsratschefin, „das würden wir Beschäftigten uns auch für unsere aktuell großen Herausforderungen im Konzern sichtbar wünschen.“
Diess entgegnet, es gehöre zu sei-nem Job, die VW-Mitarbeiter heraus-zufordern, auch wenn es nervt. „Es ist meine Aufgabe und die des gesamten Managements, den Wettbewerb richtig einzuschätzen, den Konzern darauf vorzubereiten und zukunftssicher zu machen“, sagt der VW-Chef. „Selbst wenn ich nicht mehr über Elon Musk spreche: Er bleibt da und revolutioniert unsere Industrie und wird schnell im-mer wettbewerbsfähiger.“
Kompromissvorschlag auf dem Tisch
Wieder knirscht es zwischen den bei-den. Es sei einfach falsch, der VW-Be-legschaft mangelnden Fortschrittswillen zu unterstellen, entgegnet Cavallo. „Der Betriebsrat will den Wandel, die Beleg-schaft will den Wandel, Wolfsburg will den Wandel!“, sagt die Betriebsratsche-fin. „Aber den Wandel gibt es nur mit VW-Kultur. Und dazu gehört, dass der Betriebsrat sich einmischt. Sie erzählen überall, dass Sie Volkswagen in die E-Mobilität führen wollen. Alles klar, da sind wir dabei. Diesen Wandel finan-zieren wir doch aktuell und auch die kommenden Jahre aber noch über den Verkauf von Verbrennern.“
Wird sich Diess gegen diese Be-triebsrätin durchsetzen? Als Minister-präsident und VW-Aufsichtsrat Weil das Wort ergreift, muss Diess erken-nen, dass er sich isoliert hat. „Was ist
Aufgabe des Unternehmens in diesen Zeiten?“, fragt Weil in Halle 11. Und antwortet selbst: „Nicht die Sorgen zu schüren. Die Aufgabe des Unterneh-mens in diesen Zeiten ist es, Perspek-tiven zu geben!“
Volkswagen stehe seit Jahrzehnten im Wettbewerb. Er kenne in diesem Unternehmen niemanden, der diese Grundlage infrage stellt, sagt Weil. „Es kommt allerdings darauf an, Wett-bewerbsfähigkeit so zu erzielen, dass alle mitgehen können, das ist das Ent-scheidende.“
Weil hat deshalb Hausaufgaben für Diess. Die nächste sogenannte Pla-nungsrunde steht an. Weichenstellun-gen für Volkswagen werden gesucht. „Wir haben als Land Niedersachsen ei-ne sehr klare Erwartung an die nächste Planungsrunde“, sagt Weil. „Die Ver-unsicherung, die überall um sich greift – in der Öffentlichkeit, bei den Kun-den, auf den Märkten, hier im Werk selbst bei den Beschäftigten –, diese Verunsicherung muss ein Ende haben. Am Ende der Planungsrunde muss es noch in diesem Jahr klare Perspektiven geben, die dann für alle verbindlich sind und an denen sich alle dann auch ori-entieren können.“
Der Kampf um die Perspektiven ist in vollem Gange. Diess rechnet immer wieder vor, dass der Konkurrent Tesla mehr Autos in weniger Zeit produzie-ren kann. Eine Perspektive für Volks-wagen gibt es demnach erst, wenn der Konzern sich anpasst.
Der Betriebsrat will einen Wandel mit Arbeitsplatzsicherheit – und hat mit Weil einen Verbündeten im Auf-sichtsrat. Innerhalb von nur vier Wo-chen soll sich entscheiden, ob die VW-Kontrolleure Diess weitermachen las-sen. Doch wie sagte der VW-Chef: Tesla wird nicht verschwinden, nur weil in Wolfsburg niemand mehr von den Amerikanern redet.
T oyota hat ungeachtet der weltwei-ten Chipkrise im zweiten Ge-schäftsquartal seinen Gewinn stär-ker gesteigert als von Experten er-
wartet. Der weltgrößte Autobauer verwies am Donnerstag auf eine Erho-lung der Nachfrage und einen schwäche-ren Yen. Der operative Gewinn im Zeit-raum bis Ende September stieg um 48 Prozent auf 750 Milliarden Yen (etwa 5,7 Milliarden Euro).
Experten hatten Refinitiv-Daten zu-folge 593,3 Milliarden Yen erwartet. Toyota erhöhte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf 2,8 Billionen Yen (21,2 Milliarden Euro) von zuvor 2,5 Bil-lionen. Dies entspricht einer Betriebs-gewinnmarge von 9,3 Prozent, ein sehr hoher Wert für einen Massenhersteller.
Allerdings erwarten Analysten hier im Schnitt 2,92 Billionen Yen. Toyota geht nun von einer Auslieferung von 10,29 Millionen Fahrzeugen im Gesamt-jahr aus nach zuvor 10,55 Millionen.
Toyota hatte Mitte Oktober sein Produktionsziel für diesen Monat wegen des andauernden Halbleitermangels nach unten korrigiert. Die Produktion sollte demnach bis zu 15 Prozent gerin-ger ausfallen, was 100.000 bis 150.000 weniger Fahrzeuge bedeutet hätte. Da-mals plante der japanische Konzern noch, den Ausfall im Dezember wettzu-machen, und hielt an seinem Produkti-onsziel für das Geschäftsjahr fest.
Toyota ist zunächst besser als andere Autobauer durch die Chipkrise gekom-men. Hintergrund sind Lehren, die der Konzern aus der Katastrophe von Fu-kushima gezogen habe: Er verbesserte das Lieferkettenmanagement und ver-langte von Lieferanten, Bauteile für bis zu sechs Monate auf Vorrat zu halten.
Unmittelbar nach Bekanntwerden der Zahlen sprang Toyotas Aktienkurs kurzzeitig um fast fünf Prozent in die Höhe. Denn die hohen Gewinne zahlen sich auch für die Aktionäre aus. Die von Toyota erwarteten 2,5 Billionen Yen (18,8 Milliarden Euro) Reingewinn, zehn Prozent mehr als 2020. Der Konzern will daher die Interimsdividende um 15 auf 120 Yen (0,91 Euro) erhöhen und für 150 Milliarden Yen Aktien zurückkaufen.
Dennoch zog Toyotas Finanzchef ein negatives Fazit und entschuldigte sich zu Beginn bei Händlern, Zuliefe-rern, Anlegern und Kunden für die Un-annehmlichkeiten, die die Produktions-drosselung verursachte. Ohne hohe
Wechselkursgewinne wäre die Vorher-sage wegen höherer Rohstoffpreise deutlich niedriger ausgefallen, merkte Kon an. Doch auch diese Vorsicht kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Toyotas neue Prognose angesichts des Halbjahresgewinns immer noch konser-vativ wirkt.
Denn: Toyota verbuchte für die erste Jahreshälfte immerhin eine Gewinnmar-ge von 11,3 Prozent. Im Vorjahr waren es im selben Zeitraum noch 4,6 Prozent gewesen. Dabei lag die Produktion in diesem Halbjahr mit 4,1 Millionen Autos wegen Chipengpässen 550.000 Autos unter dem Vorkrisenniveau. Dass der Autohersteller dennoch den Gewinn so stark erhöhen konnte, unterstreicht sei-ne derzeitige Ausnahmestellung in Ja-pans Autoindustrie.
Zulieferern Zuversicht signalisiert
Ein Grund für den Gewinnanstieg wäh-rend der Krise: Nachdem Naturkatastro-phen in Japan die heimische Produktion zweimal für Monate stillgelegt hatten, durchleuchtete Toyota seine Lieferkette nach möglichen Bruchpunkten, setzte im Design mehr auf Standardbauteile und erhöhte die Lagerhaltung von Schlüsselbauteilen.
Außerdem setzte der Konzern ge-rade zu Beginn der Coronakrise darauf, seinen Zulieferern Zuversicht zu signali-sieren. Als einziger japanischer Autoher-steller wagte das Unternehmen, eine Jahresprognose herauszugeben, die ei-nen steigenden Absatz in der zweiten Jahreshälfte annahm.
Gemeinsam mit der permanenten Kostensenkung, für die Toyota eng mit seinen Lieferanten zusammenarbeitet, zahlten sich diese Maßnahmen zu Be-ginn der Chipkrise aus. Während andere Hersteller zu Beginn des Jahres bereits deutlich die Produktion drosseln muss-ten, produzierte Toyota nahezu unge-stört weiter.
Erst als in diesem Sommer eine große Coronawelle in Südostasien viele dortige Werke in der Chiplieferkette zur Schlie-ßung zwang, musste auch Toyota seine Produktion erstmals massiv herunterfah-ren. Doch Toyotas Finanzchef Kon er-klärte, dass der Konzern die ausgefallene Produktion durch andere Maßnahmen wenigstens teilweise auffangen konnte.
So würden Händler ihre Lager-bestände abbauen, um die Einbrüche zu überbrücken. Außerdem können die Hersteller finanzielle Kaufanreize ab-bauen, da die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Auch die steigenden Gebrauchtwagenpreise wirken sich über die Finanzsparte des Konzerns positiv auf die Bilanz aus.
Dieser umsichtige Kurs zahlt sich nun aus. Allerdings schaut Toyota wei-terhin vorsichtig in die Zukunft. Kon er-wartete zwar, dass sich die Versorgung mit Chips und Bauteilen deutlich ver-bessern wird. „Aber wir sehen auch nach Dezember weiterhin Risiken“, sagte Toyotas Finanzchef. Martin Kölling
Autobauer
Toyota profitiert vom Krisenmanagement
Der größte Autohersteller der Welt trotzt der Chipkrise. Das liegt auch an den Lehren aus Japans Naturkatastrophen.
Fahrzeug-Produk -tion: Toyota erhöht
die Gewinnprog-nose für das Gesamtjahr.
Blo
ombe
rg/G
etty
Imag
es
750Milliarden Yen
betrug der operative Gewinn
von Toyota im Zeit-raum bis Ende
September.
Quelle: Toyota
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Unternehmen
21
Bert Fröndhoff Düsseldorf
Die deutsche Chemieindustrie läuft weiter rund. Nach BASF verkündeten am Donnerstag auch die Spezialchemieunter-nehmen Lanxess und Evonik
starke Ergebnisse für das dritte Quartal. Allerdings warnen die Firmen vor wachsenden Belastungen durch massiv verteuerte Rohstoffe sowie teure Ener-gie und Logistik. Auch die Lieferketten seien weiter gespannt.
Die Chemiefirmen sind in der La-ge, die höheren Kosten für Rohstoffe und Energie an die Kunden in nahezu vollem Umfang weiterzugeben. So er-höhte die Kölner Lanxess AG im drit-ten Quartal die Verkaufspreise um bis zu 19 Prozent – solche Werte hat es laut CEO Matthias Zachert bisher im Konzern noch nicht gegeben. Der be-reinigte Gewinn schoss im dritten Quartal um 44 Prozent auf 278 Millio-nen Euro hoch.
Die Preiserhöhungen treffen zu-nächst die weiterverarbeitende Indus-trie, die Chemikalien und Kunststoffe für ihre Produkte braucht. Sie muss sich auf weitere Verteuerung in der Be-schaffung einstellen. „Wir gehen davon aus, dass der Kostendruck im vierten Quartal noch einmal zunehmen wird“, sagte Zachert. Wo nötig, würden die Preise weiter erhöht, um dies abzufan-gen.
Lanxess sei dazu wegen seines star-ken Portfolios in der Lage. Allerdings gelingen die Preiserhöhungen oft nur zeitversetzt, sodass auch die Chemie-firmen mit den sprunghaft steigenden Kosten für Container und Energie zu kämpfen haben.
Bei Lanxess war dies neben inter-nen Produktionsproblemen der Grund dafür, dass der Konzern in diesem Jahr
am unteren Ende der Spanne für den prognostizierten Gewinn von 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro landen wird. Die Anleger fassten diese Präzisierung als Gewinnwarnung auf. Die Lanxess-Ak-tie knickte um sieben Prozent ein.
Der Essener Spezialchemiekon-zern Evonik hingegen wird 2021 am oberen Ende seiner Prognosespanne landen – also bei 2,4 Milliarden Euro bereinigtem Gewinn. Operativ zeigten die Essener im dritten Quartal kaum Schwächen: Der operative Gewinn stieg um ein Viertel auf 645 Millionen Euro.
Lanxess und Evonik können die hohen Rohstoff- und Frachtkosten des-wegen eins zu eins weiterreichen, weil der Bedarf in den nachgelagerten In-dustrien ungebrochen ist. „Die Nach-frage aus der Weltwirtschaft ist aus un-serer Sicht intakt“, sagt Evonik-Chef Christian Kullmann. Auch Lanxess be-richtet von anhaltend hohen Bestellun-gen.
Die großen Chemieunternehmen setzen auf die „Pricing Power“, die sie in einer solchen wirtschaftlichen Ge-samtlage haben. Manche Segmente in der Chemie sind aktuell regelrecht aus-verkauft – so etwa bei harten und wei-chen Schäumen (Polyurethan), bei de-nen wenige Anbieter den Markt be-herrschen.
Aus Deutschland gehören Cove-stro und BASF dazu. BASF hat in sei-ner Kunststoffsparte, zu der die Polyu-rethane zählen, den Gewinn in den ers-ten neun Monaten von 346 Millionen auf mehr als zwei Milliarden Euro ge-steigert. Massive Preiserhöhungen ha-ben dazu beigetragen, die angesichts des Mangels problemlos durchzusetzen waren. Bei Covestro dürfte es ähnlich sein, dessen Quartalsergebnisse kom-men aber erst am Montag.
Andere Segmente von BASF hän-gen bei den Preisanpassungen hinter-her, etwa die Agrarchemie oder Kos-metikvorprodukte. Doch soll dies in den kommenden Monaten nachgeholt werden. Evonik hat ebenfalls angekün-digt, erneute Verteuerungen im Ein-kauf an die Kunden weiterzuleiten. „Die Preiserhöhungen werden bis ins Jahr 2022 hinein weitergehen“, sagt Evonik-Finanzvorständin Ute Wolf.
Brenntag: Lieferketten beeinträchtigt wie noch nie
Das gilt auch für die Beeinträchtigung der Lieferketten in der Chemie. Deren aktuelles Ausmaß habe der CEO des weltgrößten Chemikalienhändlers Brenntag, Christian Kohlpaitner, noch nie in seiner 30-jährigen Karriere er-lebt: „Die Produktverfügbarkeit domi-niert das tägliche Gespräch mit dem Kunden“, sagt er am Donnerstag.
Brenntag selbst ist davon aber ope-rativ nicht betroffen. Im dritten Quartal verbuchte der Dax-Konzern Zuwachs-raten von knapp 30 Prozent bei Um-satz und operativem Gewinn, der auf rund 343 Millionen Euro hochschnell-te. Die in diesem Jahr zweimal angeho-bene Prognose für 2021 bleibt beste-hen.
Immerhin: Lanxess-Chef Zachert sieht zumindest bei Rohstoffen und Frachtkosten eine „Beruhigung auf ho-hem Niveau“. Die noch nie da gewese-nen Preissprünge sind aber weiterhin eine große Herausforderung in einzel-nen Geschäftsbereichen. Die Kölner gehen deswegen teils mit speziellen Verträgen auf die Kunden zu, um je nach Entwicklung die Preise schneller anpassen zu können.
Evonik äußerte sich zumindest mit Blick auf die Energiekosten entspannt. Für 70 Prozent des Bedarfs an Erdgas
seien die Kosten auf drei Jahre gehedgt. CEO Kullmann blickt deswegen auch zuversichtlich auf das kommende Jahr. „Wir haben Resilienz bewiesen und vertrauen weiter darauf“, sagte er.
Aktuelles Vorzeigegeschäft der Es-sener ist die Herstellung von Lipiden, die als Schutzmoleküle in den mRNA-Impfstoffen eingesetzt werden. Einer der größten Kunden von Evonik ist Bi-ontech. Vom gesamten Lipid-Geschäft verspricht sich der Konzern ein durch-schnittliches jährliches Wachstum von 25 Prozent in den nächsten fünf Jahren.
Lanxess will im kommenden Jahr vor allem von seinen zahlreichen Zu-käufen profitieren. Zuletzt haben die Kölner für 1,3 Milliarden Euro die Mi-crobial-Sparte des US-Konzerns IFF übernommen. Sie stärkt das neue Lan-xess-Segment Consumer Protection mit Wirkstoffen und Formulierungen für Materialschutz, Konservierungs- und Desinfektionsmittel.
Lanxess-Chef Zachert nutzte am Donnerstag die Gelegenheit zu einem energiepolitischen Appell. Die Energie-preise seien in Deutschland besonders stark gestiegen, weil das Angebot durch den Wegfall von Atom und Kohle be-wusst verknappt werde. „Wir werden gezwungen sein, den steigenden Ener-giebedarf des Industriestandorts Deutschland von französischen Atom-meilern und polnischen Kohlekraft-werken decken zu lassen, die nicht un-seren Standards entsprechen.“
Erst in vier bis sechs Monaten wer-den die massiv gestiegenen Energie-kosten in aller Wucht auch bei den Konsumenten angekommen sein, er-wartet Zachert. „Dann wird es hoffent-lich auch ein öffentliches Thema sein und politisch diskutiert werden. Denn die Zeche zahlen am Ende die Ver-braucher.“
Industrie
Chemiefirmen erhöhen die PreiseWeil die Nachfrage boomt, können Lanxess und Evonik Belastungen an Kunden problemlos weiterreichen.
Ein Hauptfaktor: die stark steigenden Kosten für Energie.
Evonik-Anlagen in Godorf: Kosten werden
weitergegeben.
imag
o im
ages
/Fut
ure
Imag
e
44Prozent
beträgt der Anstieg des bereinigten Gewinns bei Lanxess
im dritten Quartal.Quelle: Lanxess
Wir gehen davon aus,
dass der Kos-tendruck im
vierten Quartal noch
einmal zu-nehmen
wird.
Matthias ZachertLanxess-CEO
Unternehmen
22 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Der US-Biotechkonzern Modernakommt mit der Produktion seines Co-vid-19-Impfstoffs nicht hinterher undhat die Umsatzprognose deshalb fürdieses Jahr gesenkt. Für 2021 rechnetModerna nun mit einem Umsatz von15 bis 18 Milliarden Dollar mit demVakzin statt wie bislang von 20 Mil-liarden, wie das Unternehmen amDonnerstag mitteilte.
Moderna geht davon aus, 700 bis800 Millionen Impfdosen 2021 auslie-fern zu können – statt 800 Millionenbis eine Milliarde Dosen, wie bishergeplant. Längere Lieferfristen für in-ternationale Sendungen und Exportekönnten die Auslieferungen auf An-fang 2022 verschieben. Auch wird dieProduktion durch die Erweiterung derAbfüllkapazitäten vorübergehend ge-bremst. Moderna hinkt dem Konkur-renten Pfizer hinterher, der 2021 deut-lich mehr Dosen herstellen will. Reuters
Moderna
Gesenktes Umsatzziel für Impfstoff
R und zwanzig Jahre lang war der Schweizer Novartis-Konzern am Konkurrenten Roche beteiligt: Jetzt haben sich beide Unterneh-
men auf einen Rückkauf der 53,3 Mil-lionen von Novartis gehaltenen Roche-Aktien geeinigt. Die Entflechtung hat ein Transaktionsvolumen von rund 19 Milliarden Schweizer Franken, wie bei-de Unternehmen am Donnerstag mit-teilten. Roche hat vor, die zurück-gekauften Aktien zu vernichten. Da-durch wird der Einfluss der Erben der Roche-Gründerfamilien größer: Der Anteil der Stimmrechte des Familien-pools wird von derzeit knapp 50 Pro-zent auf mehr als 67,5 Prozent steigen.
„Nach mehr als zwanzig Jahren als Aktionärin von Roche sind wir zu dem Schluss gekommen, dass nun der rich-tige Zeitpunkt gekommen ist, um un-sere Beteiligung zu monetisieren“, sagt Novartis-CEO Vas Narasimhan. Die Transaktion entspreche der Strategie des Unternehmens, das sich auf inno-vative Arzneimittel fokussieren will.
Novartis hatte den Roche-Anteil zwischen 2001 und 2003 für einen Ge-samtbetrag von rund fünf Milliarden US-Dollar als langfristige Finanzbetei-ligung erworben. Der Einstieg bei Ro-che war unter dem damaligen CEO Daniel Vasella erfolgt, der Novartis breit diversifiziert hat. Seit einigen Jah-ren dreht Novartis diese Entwicklung wieder um und trennt sich von den Sparten jenseits des Pharmageschäfts.
Vergangenen Monat hatte Novartis angekündigt, strategische Optionen für seine Generikatochter Sandoz zu prü-fen. Mit einer Trennung von Sandoz wäre der Konzern vollständig auf inno-vative Arzneimittel fokussiert.
Auch die Finanzbeteiligung an Ro-che betrachtet Novartis nicht als Teil seines Kerngeschäfts und daher auch nicht als strategische Investition. Al-lerdings hatte Narasimhan bei der Be-kanntgabe der Sandoz-Pläne Ende Ok-tober auf die Frage einer Journalistin, ob auch die Roche-Beteiligung auf dem Prüfstand stehe, noch abgewinkt.
Spielraum für weitere ZukäufeDer Verkauf der Roche-Aktien wird Novartis einen Gewinn in Höhe von rund 14 Milliarden Dollar bringen. Das eröffnet dem Unternehmen Spielraum für weitere Zukaufe innovativer Bio-tech-Firmen, von denen Novartis-CEO Narasimhan seit seinem Amts-antritt 2018 bereits einige abgeschlos-sen hat.
Aber auch die Novartis-Aktionäre sollen von dem Verkauf profitieren: „Wir planen, den Erlös aus der Trans-aktion im Einklang mit unseren Prio-ritäten bei der Kapitalallokation zu ver-wenden, um den Wert für unsere Ak-tionäre zu maximieren und weiterhin Medizin neu zu denken“, wird Nara-simhan in der Pressemitteilung von Novartis zitiert. Die Aktie des Unter-nehmens legte im frühen Handel leicht zu.
Vontobel-Analyst Stefan Schneider sieht das Wachstum von Novartis we-gen mehrerer laufender und bevorste-hender Patentabläufe verschiedener In-novative-Medicine-Produkte unter Druck. Daher habe das Unternehmen eine Übernahmestrategie formuliert, nach der Novartis Vermögenswerte im
Wert von bis zu fünf Prozent seiner Marktkapitalisierung pro Jahr erwerben wolle. „Wir halten die Bilanz des Un-ternehmens weiterhin für stark, und der heutige Verkauf der Beteiligung an Roche gewährleistet, dass das so bleibt“, so der Analyst.
Roche wiederum bekommt mehr Handlungsspielraum, wenn kein Wett-bewerber mehr eine große Beteiligung hält. „Ich bin überzeugt, dass diese ge-plante Transaktion aus strategischer und ökonomischer Sicht im besten In-teresse von Roche und unserer Anteils-inhaber ist“, sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche.
Der prozentuale Anteil der sich im Publikum befindenden Roche-Aktien, der Free Float, steigt mit der wegfallen-den Beteiligung von Novartis von der-zeit 16,6 auf 24,9 Prozent. Das ermög-licht die Aufnahme der Roche-Aktien in den Swiss Performance Index (SPI) sowie möglicherweise auch in weitere Indizes, was der Aktie dann Auftrieb geben könnte. Schon im frühen Handel hat die Aktie nach Verkündigung des Aktienrückkaufs zugelegt.
Roche finanziert die Transaktion, die der Verwaltungsrat genehmigt hat, mit Fremdmitteln. Die Vertreter des Familienpools haben an den Beratun-gen und der Abstimmung im Verwal-tungsrat zu dieser Transaktion nicht teilgenommen, heißt es in der Roche-Mitteilung. Der Preis pro Aktie beträgt 356,9 Schweizer Franken und ent-spricht damit dem gewichteten Durch-schnittskurs des Roche-Genussscheins der letzten 20 Handelstage bis ein-schließlich 2. November 2021.
Der Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der von Novartis zurück-gekauften Aktien muss noch eine au-ßerordentliche Generalversammlung zustimmen, die am 26. November 2021 stattfinden soll. Maike Telgheder
Pharmabranche
Roche kauft Novartis eigene Aktien abDer Novartis-Konkurrent will die Aktien vernichten – und so den Einfluss der
Eigentümer stärken.
Novartis-Labor: Novartis will sich auf innovative Arzneimittel fokussieren.B
loom
berg
via
Get
ty Im
ages
14Milliarden
Dollar Gewinn erwartet Novartis durch den Verkauf der
Roche-Aktien.
Quelle: Novartis
Unternehmen
23WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Bert Fröndhoff Düsseldorf
Die deutsche Chemieindustrie läuft weiter rund. Nach BASF verkündeten am Donnerstag auch die Spezialchemieunter-nehmen Lanxess und Evonik
starke Ergebnisse für das dritte Quartal. Allerdings warnen die Firmen vor wachsenden Belastungen durch massiv verteuerte Rohstoffe sowie teure Ener-gie und Logistik. Auch die Lieferketten seien weiter gespannt.
Die Chemiefirmen sind in der La-ge, die höheren Kosten für Rohstoffe und Energie an die Kunden in nahezu vollem Umfang weiterzugeben. So er-höhte die Kölner Lanxess AG im drit-ten Quartal die Verkaufspreise um bis zu 19 Prozent – solche Werte hat es laut CEO Matthias Zachert bisher im Konzern noch nicht gegeben. Der be-reinigte Gewinn schoss im dritten Quartal um 44 Prozent auf 278 Millio-nen Euro hoch.
Die Preiserhöhungen treffen zu-nächst die weiterverarbeitende Indus-trie, die Chemikalien und Kunststoffe für ihre Produkte braucht. Sie muss sich auf weitere Verteuerung in der Be-schaffung einstellen. „Wir gehen davon aus, dass der Kostendruck im vierten Quartal noch einmal zunehmen wird“, sagte Zachert. Wo nötig, würden die Preise weiter erhöht, um dies abzufan-gen.
Lanxess sei dazu wegen seines star-ken Portfolios in der Lage. Allerdings gelingen die Preiserhöhungen oft nur zeitversetzt, sodass auch die Chemie-firmen mit den sprunghaft steigenden Kosten für Container und Energie zu kämpfen haben.
Bei Lanxess war dies neben inter-nen Produktionsproblemen der Grund dafür, dass der Konzern in diesem Jahr
am unteren Ende der Spanne für den prognostizierten Gewinn von 1,0 bis 1,05 Milliarden Euro landen wird. Die Anleger fassten diese Präzisierung als Gewinnwarnung auf. Die Lanxess-Ak-tie knickte um sieben Prozent ein.
Der Essener Spezialchemiekon-zern Evonik hingegen wird 2021 am oberen Ende seiner Prognosespanne landen – also bei 2,4 Milliarden Euro bereinigtem Gewinn. Operativ zeigten die Essener im dritten Quartal kaum Schwächen: Der operative Gewinn stieg um ein Viertel auf 645 Millionen Euro.
Lanxess und Evonik können die hohen Rohstoff- und Frachtkosten des-wegen eins zu eins weiterreichen, weil der Bedarf in den nachgelagerten In-dustrien ungebrochen ist. „Die Nach-frage aus der Weltwirtschaft ist aus un-serer Sicht intakt“, sagt Evonik-Chef Christian Kullmann. Auch Lanxess be-richtet von anhaltend hohen Bestellun-gen.
Die großen Chemieunternehmen setzen auf die „Pricing Power“, die sie in einer solchen wirtschaftlichen Ge-samtlage haben. Manche Segmente in der Chemie sind aktuell regelrecht aus-verkauft – so etwa bei harten und wei-chen Schäumen (Polyurethan), bei de-nen wenige Anbieter den Markt be-herrschen.
Aus Deutschland gehören Cove-stro und BASF dazu. BASF hat in sei-ner Kunststoffsparte, zu der die Polyu-rethane zählen, den Gewinn in den ers-ten neun Monaten von 346 Millionen auf mehr als zwei Milliarden Euro ge-steigert. Massive Preiserhöhungen ha-ben dazu beigetragen, die angesichts des Mangels problemlos durchzusetzen waren. Bei Covestro dürfte es ähnlich sein, dessen Quartalsergebnisse kom-men aber erst am Montag.
Andere Segmente von BASF hän-gen bei den Preisanpassungen hinter-her, etwa die Agrarchemie oder Kos-metikvorprodukte. Doch soll dies in den kommenden Monaten nachgeholt werden. Evonik hat ebenfalls angekün-digt, erneute Verteuerungen im Ein-kauf an die Kunden weiterzuleiten. „Die Preiserhöhungen werden bis ins Jahr 2022 hinein weitergehen“, sagt Evonik-Finanzvorständin Ute Wolf.
Brenntag: Lieferketten beeinträchtigt wie noch nie
Das gilt auch für die Beeinträchtigung der Lieferketten in der Chemie. Deren aktuelles Ausmaß habe der CEO des weltgrößten Chemikalienhändlers Brenntag, Christian Kohlpaitner, noch nie in seiner 30-jährigen Karriere er-lebt: „Die Produktverfügbarkeit domi-niert das tägliche Gespräch mit dem Kunden“, sagt er am Donnerstag.
Brenntag selbst ist davon aber ope-rativ nicht betroffen. Im dritten Quartal verbuchte der Dax-Konzern Zuwachs-raten von knapp 30 Prozent bei Um-satz und operativem Gewinn, der auf rund 343 Millionen Euro hochschnell-te. Die in diesem Jahr zweimal angeho-bene Prognose für 2021 bleibt beste-hen.
Immerhin: Lanxess-Chef Zachert sieht zumindest bei Rohstoffen und Frachtkosten eine „Beruhigung auf ho-hem Niveau“. Die noch nie da gewese-nen Preissprünge sind aber weiterhin eine große Herausforderung in einzel-nen Geschäftsbereichen. Die Kölner gehen deswegen teils mit speziellen Verträgen auf die Kunden zu, um je nach Entwicklung die Preise schneller anpassen zu können.
Evonik äußerte sich zumindest mit Blick auf die Energiekosten entspannt. Für 70 Prozent des Bedarfs an Erdgas
seien die Kosten auf drei Jahre gehedgt. CEO Kullmann blickt deswegen auch zuversichtlich auf das kommende Jahr. „Wir haben Resilienz bewiesen und vertrauen weiter darauf“, sagte er.
Aktuelles Vorzeigegeschäft der Es-sener ist die Herstellung von Lipiden, die als Schutzmoleküle in den mRNA-Impfstoffen eingesetzt werden. Einer der größten Kunden von Evonik ist Bi-ontech. Vom gesamten Lipid-Geschäft verspricht sich der Konzern ein durch-schnittliches jährliches Wachstum von 25 Prozent in den nächsten fünf Jahren.
Lanxess will im kommenden Jahr vor allem von seinen zahlreichen Zu-käufen profitieren. Zuletzt haben die Kölner für 1,3 Milliarden Euro die Mi-crobial-Sparte des US-Konzerns IFF übernommen. Sie stärkt das neue Lan-xess-Segment Consumer Protection mit Wirkstoffen und Formulierungen für Materialschutz, Konservierungs- und Desinfektionsmittel.
Lanxess-Chef Zachert nutzte am Donnerstag die Gelegenheit zu einem energiepolitischen Appell. Die Energie-preise seien in Deutschland besonders stark gestiegen, weil das Angebot durch den Wegfall von Atom und Kohle be-wusst verknappt werde. „Wir werden gezwungen sein, den steigenden Ener-giebedarf des Industriestandorts Deutschland von französischen Atom-meilern und polnischen Kohlekraft-werken decken zu lassen, die nicht un-seren Standards entsprechen.“
Erst in vier bis sechs Monaten wer-den die massiv gestiegenen Energie-kosten in aller Wucht auch bei den Konsumenten angekommen sein, er-wartet Zachert. „Dann wird es hoffent-lich auch ein öffentliches Thema sein und politisch diskutiert werden. Denn die Zeche zahlen am Ende die Ver-braucher.“
Industrie
Chemiefirmen erhöhen die PreiseWeil die Nachfrage boomt, können Lanxess und Evonik Belastungen an Kunden problemlos weiterreichen.
Ein Hauptfaktor: die stark steigenden Kosten für Energie.
Evonik-Anlagen in Godorf: Kosten werden
weitergegeben.
imag
o im
ages
/Fut
ure
Imag
e
44Prozent
beträgt der Anstieg des bereinigten Gewinns bei Lanxess
im dritten Quartal.Quelle: Lanxess
Wir gehen davon aus,
dass der Kos-tendruck im
vierten Quartal noch
einmal zu-nehmen
wird.
Matthias ZachertLanxess-CEO
Unternehmen
22 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Der US-Biotechkonzern Modernakommt mit der Produktion seines Co-vid-19-Impfstoffs nicht hinterher undhat die Umsatzprognose deshalb fürdieses Jahr gesenkt. Für 2021 rechnetModerna nun mit einem Umsatz von15 bis 18 Milliarden Dollar mit demVakzin statt wie bislang von 20 Mil-liarden, wie das Unternehmen amDonnerstag mitteilte.
Moderna geht davon aus, 700 bis800 Millionen Impfdosen 2021 auslie-fern zu können – statt 800 Millionenbis eine Milliarde Dosen, wie bishergeplant. Längere Lieferfristen für in-ternationale Sendungen und Exportekönnten die Auslieferungen auf An-fang 2022 verschieben. Auch wird dieProduktion durch die Erweiterung derAbfüllkapazitäten vorübergehend ge-bremst. Moderna hinkt dem Konkur-renten Pfizer hinterher, der 2021 deut-lich mehr Dosen herstellen will. Reuters
Moderna
Gesenktes Umsatzziel für Impfstoff
R und zwanzig Jahre lang war der Schweizer Novartis-Konzern am Konkurrenten Roche beteiligt: Jetzt haben sich beide Unterneh-
men auf einen Rückkauf der 53,3 Mil-lionen von Novartis gehaltenen Roche-Aktien geeinigt. Die Entflechtung hat ein Transaktionsvolumen von rund 19 Milliarden Schweizer Franken, wie bei-de Unternehmen am Donnerstag mit-teilten. Roche hat vor, die zurück-gekauften Aktien zu vernichten. Da-durch wird der Einfluss der Erben der Roche-Gründerfamilien größer: Der Anteil der Stimmrechte des Familien-pools wird von derzeit knapp 50 Pro-zent auf mehr als 67,5 Prozent steigen.
„Nach mehr als zwanzig Jahren als Aktionärin von Roche sind wir zu dem Schluss gekommen, dass nun der rich-tige Zeitpunkt gekommen ist, um un-sere Beteiligung zu monetisieren“, sagt Novartis-CEO Vas Narasimhan. Die Transaktion entspreche der Strategie des Unternehmens, das sich auf inno-vative Arzneimittel fokussieren will.
Novartis hatte den Roche-Anteil zwischen 2001 und 2003 für einen Ge-samtbetrag von rund fünf Milliarden US-Dollar als langfristige Finanzbetei-ligung erworben. Der Einstieg bei Ro-che war unter dem damaligen CEO Daniel Vasella erfolgt, der Novartis breit diversifiziert hat. Seit einigen Jah-ren dreht Novartis diese Entwicklung wieder um und trennt sich von den Sparten jenseits des Pharmageschäfts.
Vergangenen Monat hatte Novartis angekündigt, strategische Optionen für seine Generikatochter Sandoz zu prü-fen. Mit einer Trennung von Sandoz wäre der Konzern vollständig auf inno-vative Arzneimittel fokussiert.
Auch die Finanzbeteiligung an Ro-che betrachtet Novartis nicht als Teil seines Kerngeschäfts und daher auch nicht als strategische Investition. Al-lerdings hatte Narasimhan bei der Be-kanntgabe der Sandoz-Pläne Ende Ok-tober auf die Frage einer Journalistin, ob auch die Roche-Beteiligung auf dem Prüfstand stehe, noch abgewinkt.
Spielraum für weitere ZukäufeDer Verkauf der Roche-Aktien wird Novartis einen Gewinn in Höhe von rund 14 Milliarden Dollar bringen. Das eröffnet dem Unternehmen Spielraum für weitere Zukaufe innovativer Bio-tech-Firmen, von denen Novartis-CEO Narasimhan seit seinem Amts-antritt 2018 bereits einige abgeschlos-sen hat.
Aber auch die Novartis-Aktionäre sollen von dem Verkauf profitieren: „Wir planen, den Erlös aus der Trans-aktion im Einklang mit unseren Prio-ritäten bei der Kapitalallokation zu ver-wenden, um den Wert für unsere Ak-tionäre zu maximieren und weiterhin Medizin neu zu denken“, wird Nara-simhan in der Pressemitteilung von Novartis zitiert. Die Aktie des Unter-nehmens legte im frühen Handel leicht zu.
Vontobel-Analyst Stefan Schneider sieht das Wachstum von Novartis we-gen mehrerer laufender und bevorste-hender Patentabläufe verschiedener In-novative-Medicine-Produkte unter Druck. Daher habe das Unternehmen eine Übernahmestrategie formuliert, nach der Novartis Vermögenswerte im
Wert von bis zu fünf Prozent seiner Marktkapitalisierung pro Jahr erwerben wolle. „Wir halten die Bilanz des Un-ternehmens weiterhin für stark, und der heutige Verkauf der Beteiligung an Roche gewährleistet, dass das so bleibt“, so der Analyst.
Roche wiederum bekommt mehr Handlungsspielraum, wenn kein Wett-bewerber mehr eine große Beteiligung hält. „Ich bin überzeugt, dass diese ge-plante Transaktion aus strategischer und ökonomischer Sicht im besten In-teresse von Roche und unserer Anteils-inhaber ist“, sagte Christoph Franz, Verwaltungsratspräsident von Roche.
Der prozentuale Anteil der sich im Publikum befindenden Roche-Aktien, der Free Float, steigt mit der wegfallen-den Beteiligung von Novartis von der-zeit 16,6 auf 24,9 Prozent. Das ermög-licht die Aufnahme der Roche-Aktien in den Swiss Performance Index (SPI) sowie möglicherweise auch in weitere Indizes, was der Aktie dann Auftrieb geben könnte. Schon im frühen Handel hat die Aktie nach Verkündigung des Aktienrückkaufs zugelegt.
Roche finanziert die Transaktion, die der Verwaltungsrat genehmigt hat, mit Fremdmitteln. Die Vertreter des Familienpools haben an den Beratun-gen und der Abstimmung im Verwal-tungsrat zu dieser Transaktion nicht teilgenommen, heißt es in der Roche-Mitteilung. Der Preis pro Aktie beträgt 356,9 Schweizer Franken und ent-spricht damit dem gewichteten Durch-schnittskurs des Roche-Genussscheins der letzten 20 Handelstage bis ein-schließlich 2. November 2021.
Der Kapitalherabsetzung durch Vernichtung der von Novartis zurück-gekauften Aktien muss noch eine au-ßerordentliche Generalversammlung zustimmen, die am 26. November 2021 stattfinden soll. Maike Telgheder
Pharmabranche
Roche kauft Novartis eigene Aktien abDer Novartis-Konkurrent will die Aktien vernichten – und so den Einfluss der
Eigentümer stärken.
Novartis-Labor: Novartis will sich auf innovative Arzneimittel fokussieren.B
loom
berg
via
Get
ty Im
ages
14Milliarden
Dollar Gewinn erwartet Novartis durch den Verkauf der
Roche-Aktien.
Quelle: Novartis
Unternehmen
23WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Michael Scheppe Berlin
Es soll nichts Geringeres werden als „das deutsche Medien-Abon-nement“, sagt RTL-Co-Chef Stephan Schäfer. Sein Kollege Matthias Dang schwärmt: „So
ein Produkt gibt es nicht. Wir bauen die Blaupause.“ Tatsächlich schafft RTL für die Medienbranche etwas bislang Einzigartiges: eine Streaming-Platt-form, auf der es nicht nur Live-TV und Filme geben soll. Nutzer können auf der Plattform „RTL +“, die bis Don-nerstag unter dem Namen „TV Now“ firmierte, ab Sommer 2022 auch Pod-casts, Hörbücher und Musiktitel sowie digitale Bücher und Magazine abrufen.
Alle Medien gebündelt in einer App – das Konzept hat RTL vor Pro-duzenten und Schauspielern am Don-nerstag ausgewählten Medien vorge-stellt, darunter auch dem Handelsblatt. Die RTL-Mutter Bertelsmann meint es ernst: Im Vergleich zu 2021 will man die jährlichen Programminvestitionen bis 2026 auf rund 600 Millionen Euro verdreifachen, kündigte Thomas Rabe an, der in Personalunion Chef von Ber-telsmann und der RTL Group ist.
RTL kämpft gegen die mächtigen Tech-Konzerne Facebook, Google und Amazon, die 80 bis 90 Prozent des di-gitalen Werbemarktes kontrollieren. Gleichzeitig graben internationale Plattformen wie Netflix oder Disney+ dem Sender Zuschauer ab. Damit lo-kale Anbieter bestehen können, müs-sen sie nach Wegen suchen, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden – so wie RTL es nun versucht.
„RTL +“ steht sinnbildlich für die Strategie von Bertelsmann, Medien
verschiedener Gattungen zusammen-zuführen. Die Gütersloher wollen zum 1. Januar 2022 die Hamburger Zeit-schriftentochter Gruner + Jahr (G + J) mit der Kölner Fernsehgruppe RTL fu-sionieren.
Weil es kein Vorbild für „RTL +“ gibt, ist das Vorhaben ein ambitionier-tes Experiment. Doch selbst die Kon-kurrenz scheint angetan: Netflix-Chef Reed Hastings sagte im September im Handelsblatt-Interview: „RTL wird sehr erfolgreich sein mit dem, was sie
RTL
Kölns Kampf gegen Netflix
Die Bertelsmann-Tochter plant mit „RTL +“ eine bislang einmalige Medienplattform.
Es ist ein ambitioniertes Experiment.
RTL-Fahnen vor Firmengebäude: Die Kölner Mediengruppe hat große Ziele.
D er Dax-Neuling Siemens Health -ineers stellt sich nach einem Um-satzrekord im Zuge der Corona-krise jetzt auf schwächeres
Wachstum ein. „Wir haben in der Pan-demie schnell und umsichtig agiert“, sagte CEO Bernd Montag am Don-nerstag bei Vorlage der Bilanz. In der Folge habe die Siemens-Tochter Marktanteile gewonnen.
Im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) stiegen die Erlöse des Me-dizintechnik-Spezialisten auch dank der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests um vergleichbar 19,3 Pro-zent auf erstmals 18 Milliarden Euro. Das hohe Niveau will der Konzern im laufenden Geschäftsjahr halten, auch wenn weniger Schnelltests verkauft werden.
Vorstandschef Montag prognosti-zierte für das neue Geschäftsjahr 2021/22 auf vergleichbarer Basis einen Umsatzzuwachs von null bis zwei Pro-zent. Rechnet man die Umsätze mit den Schnelltests heraus, sollen die Er-löse vergleichbar – also zum Beispiel ohne Währungseffekte – um fünf bis sieben Prozent wachsen. Das bereinig-te Ergebnis je Aktie wird zwischen
2,08 Euro und 2,20 Euro erwartet. Das Unternehmen gehe mit einem Rekord-auftragsbestand in das neue Geschäfts-jahr, für das man eine fortgesetzt starke Geschäftsentwicklung erwarte, so Montag.
Zu Beginn der Pandemie waren die Coronaeffekte für die Healthineers ge-mischt, etwa weil Kliniken diagnosti-sche Behandlungen und auch Investi-tionen verschoben hatten. Im weiteren Verlauf erholte sich das Geschäft dann wieder deutlich, und der Konzern pro-fitierte dann zusätzlich von der hohen Nachfrage nach Covid-19-Antigen-tests. Insgesamt erzielten die Healthi-
neers im Geschäftsjahr 2020/21 rund 1,1 Milliarden Euro Umsatz mit Anti-gen-Schnelltests und einen Nachsteu-ergewinn von rund 350 Millionen Euro. Im neuen Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen indes nur Umsätze in Höhe von 200 Millionen Euro – weil die Impfquoten gestiegen sind und die Preise für Antigen-Schnelltests fallen.
Aber auch ohne den Sondereffekt durch die Antigentests haben sich die Healthineers im abgelaufenen Jahr er-folgreich entwickelt: Die Erlöse legten um 11,8 Prozent zu. Erstmals flossen auch die Zahlen des US-Krebstherapie-spezialisten Varian nach der 16-Milliar-den-Dollar-Übernahme ein.
Den Aktionären winkt eine Divi-dendenerhöhung von 80 auf 85 Euro-cent je Aktie, das entspricht einer Aus-schüttungsquote von 55 Prozent des Gewinns nach Steuern. Die Börse rea-gierte positiv auf Bilanz und Prognose. Der Aktienkurs von Siemens Health -ineers stieg zwischenzeitlich um zwei Prozent auf knapp 61 Euro.
Ein Blick auf die Geschäftsfelder zeigt, dass die Bildgebung und die Di-agnostiksparte im vergangenen Ge-schäftsjahr prozentual zweistellig
wuchsen. Im vierten Quartal, das von Juli bis September ging, stieg der Kon-zernumsatz um vergleichbar 14,4 Pro-zent auf knapp 5,2 Milliarden Euro, das bereinigte Ebit um 26 Prozent auf 793 Millionen Euro.
Auch im Gesamtjahr machten die Healthineers beim Gewinn deutliche Fortschritte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 40 Prozent auf gut 3,1 Milliarden Euro. Das ent-sprach einer Marge von 17,4 Prozent. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,41 auf 1,57 Euro.
Prognose mehrfach angehobenSiemens Healthineers hatte die Prog-nose für das Geschäftsjahr mehrmals angehoben. Zuletzt rechnete das Un-ternehmen mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 17 bis 19 Pro-zent und einem bereinigten, unverwäs-serten Ergebnis von 1,95 bis 2,05 Euro je Aktie. Analysten hatten im Schnitt für das Geschäftsjahr mit einem Um-satzanstieg um vergleichbar 18 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro und einem an-gepassten Ebit von 3,25 Milliarden Euro gerechnet. Axel Höpner, Maike Telghe-der
Siemens Healthineers
Rekordumsätze in der PandemieVor allem die hohe Nachfrage nach Coronatests bringt dem Dax-Neuling Zuwächse. Nun dürfte sich das Wachstum abschwächen.
CT-Scanner bei Siemens Healthi-neers: Zweistel-liges prozentuales Wachstum in der Diagnostiksparte.
Blo
ombe
rg
Unternehmen
24 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
dort vorhaben.“ Auch Experten sehen Potenzial. Olaf Riedel, Partner bei EY und Leiter des Bereichs Technologie, Media & Entertainment und Telekom-munikation, sagt: „Die Chancen, mit einer einheitlichen Plattform ein brei-teres Publikum zu erschließen, sind groß.“ Auf „RTL +“ kann das Medien-haus TV-Sendungen oder Zeitungsar-tikel neben der Ausstrahlung oder dem gedruckten Magazin ein weiteres Mal verwerten und so „zusätzliche Nutzer-gruppen zu vergleichsweise geringen Kosten erreichen“, so Riedel.
Studien zeigen, dass der Bedarf nach Plattformen wächst, die den Nut-zern Zugang zu unterschiedlichen An-geboten in einer App anbieten. Gerade Bertelsmann mit seinen Marken hat dazu die Möglichkeit wie kaum jemand sonst: Auf der neuen Plattform wird es Zeitschriften wie „Stern“, „Geo“ oder „Brigitte“ geben, die zur Tochter G+J gehören; Hörbücher und Bücher des Bertelsmann-Verlags Penguin Random House sowie Musik und Podcasts von Audio Now. Im Bereich Musik hat RTL eine Partnerschaft mit dem Spo-tify-Konkurrenten Deezer geschlossen. RTL plant auch, mit anderen Medien-
häusern Partnerschaften zu schließen. RTL zählt auf seiner Plattform derzeit 2,4 Millionen zahlende Abonnenten, vor einem Jahr waren es noch 1,8 Mil-lionen. Trotz des Wachstums ist der Abstand zu Netflix groß: Für den deut-schen Markt weist Netflix zwar keine Zahlen aus, die Londoner Analysefir-ma Ampere Analysis geht für 2020 aber von 10,9 Millionen Abonnenten aus. RTL will bis Ende 2026 die Marke von zehn Millionen erreichen, aller-dings gemeinsam mit dem Angebot Vi-deoland in den Niederlanden, das der-zeit rund eine Million Nutzer zählt.
Große Ziele, die Branchenkenner für erreichbar halten. Bernd Riefler, Gründer und CEO des Analysehauses Veed Analytics, sagt: „Im Fernseh- und Streaming-Markt gibt es nicht den ei-nen Anbieter, der alle Kunden abgreift. Es wird immer Raum für die Vielfalt der Angebote geben.“ So bietet Netflix vor allem Filme und Serien an; RTL sendet daneben auch Nachrichten, Sport-Übertragungen und stellt künftig eben auch E-Books oder Hörspiele zur Verfügung – Bereiche, die sich für die US-Konkurrenz nicht lohnen. Dass RTL seine lokalen Vorteile ausspielen
wird, glaubt auch Netflix-Chef Has-tings. „Wir werden sicher nicht deut-scher werden als RTL.“
Wie teuer das Streaming-Angebot sein wird, erarbeiten die Kölner noch. Bei dem Einstiegspreis bekommen Nutzer Werbung ausgespielt, die Pre-mium-Variante soll frei davon sein. Die RTL-Macher sind überzeugt, dass Nutzer bereit sind, für ihr Angebot Geld auszugeben, selbst wenn sie schon Abos der Konkurrenz hätten. In-ternen Analysen zufolge würden Kon-sumenten im Schnitt zwei bis drei Abos für Streaming-Dienste abschlie-ßen. EY-Experte Riedel bestätigt den Trend: „Die Bereitschaft, für gute In-halte Geld auszugeben, ist durch die Pandemie gestiegen.“ Das gelte gerade für ältere Nutzer, Jüngere seien länger bereit, für werbefreie Angebote zu zah-len, weil sie das von Streaming-Diens-ten gewohnt sind.
Chancen für die VermarktungDie Neupositionierung hat einen wei-teren Grund: Lokale Firmen wie RTL müssen bei der Vorherrschaft von Google, Facebook und Amazon stärker denn je ihre Vorzüge für werbetreiben-
de Firmen klar machen. „Mit verschie-denen Gattungen in einer App könnenMedienunternehmen die Attraktivitätihrer Vermarktungsmöglichkeiten er-höhen“, sagt Marketingexperte Andre-as Schwabe, Partner bei der BeratungBoston Consulting Group (BCG).
Bei „RTL +“ soll es einen persönli-chen Bereich geben, in dem KünstlicheIntelligenz den Nutzern ähnliche an-dere Filme vorschlägt, aber auch pas-sende Podcasts oder Zeitungsbeiträge.Durch das breite Angebot über ver-schiedene Gattungen lernt der Algo-rithmus schneller, welche Inhalte denKunden gefallen. „Das ist sowohl fürden Endkunden wie auch für die Ver-marktung ein kluger Schritt“, sagtSchwabe. Werbekunden könnten denNutzern zielgenauere Kampagnen aus-spielen.
Um mehr Nutzer zu erreichen, ar-beitet RTL mit der Telekom zusam-men. Auf der Plattform Magenta TVsollen Nutzer „RTL +“ günstiger erhal-ten. Michael Schuld, TV-Chef der Te-lekom, sagt: „Es gibt einen Bedarf nachneuer Einfachheit.“ Ob „RTL +“ diesenerfüllen kann, wird sich allerdings erstim kommenden Sommer zeigen.dp
a
D er Diagnostikkonzern Qiagen präsentiert sich nach einem un-erwartet kräftigen Wachstum im dritten Quartal zuversichtlich:
„Wir sind ein starkes Unternehmen mit einer starken Pipeline“, bekräftigte Finanzchef Roland Sackers in einem Pressegespräch.
Zu den in Finanzkreisen seit Wo-chen kursierenden Spekulationen, wo-nach das französische Diagnostik-Unter-nehmen Biomerieux eine Fusion mit Qiagen auslotet, nahm Sackers allerdings nicht konkret Stellung: „Wir sind ja in einer Industrie, die grundsätzlich kon-solidiert und wo grundsätzlich Unter-nehmen miteinander zusammenarbei-ten“, sagte Sackers. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass immer wieder Spe-kulationen über mögliche Zusammen-schlüsse die Runde machten. Detailliert wolle man das aber nicht kommentieren. Entscheidend sei dem Finanzchef zufol-ge, langfristig Wert zu generieren.
Biomerieux ist mit 2,45 Milliarden Euro Umsatz in den ersten drei Quar-talen zwar deutlich größer als Qiagen und in einigen Teilbereichen des Diag-nostika-Geschäfts auch direkter Kon-kurrent des Hildener Konzerns. Ge-
messen an der Marktkapitalisierung bewegen sich beide Unternehmen mit 13 Milliarden Euro (Biomerieux) und elf Milliarden Euro (Qiagen) jedoch eher auf dem gleichen Niveau. Am Donnerstagnachmittag gab der Qia-gen-Kurs um zwei Prozent nach.
Der Diagnostik- und Lifescience-Bereich war in den letzten Jahren von zahlreichen Übernahmen geprägt, wo-bei vor allem die US-Konzerne Thermo Fisher Scientific und Danaher stark zu-kauften. Thermo Fisher hatte Anfang des letzten Jahres auch versucht, Qia-gen zu übernehmen, war damals aber mit seiner 11,3 Milliarden Euro schwe-ren Offerte am Ende am Widerstand der Qiagen-Aktionäre gescheitert.
Qiagens Geschäft entwickelt sich unterdessen etwas besser als zuletzt er-wartet. Das wiederum hat den Vor-stand veranlasst, die im Sommer noch reduzierte Jahresprognose wieder leicht anzuheben. Für das Gesamtjahr stellt er nun ein Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis von mindes-tens 15 Prozent sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie um ebenfalls rund 15 Prozent auf mindestens 2,48 Euro in Aussicht. Gegenüber der bis-
herigen Prognose entspricht das einer Anhebung um jeweils etwa drei Pro-zentpunkte. Qiagen begründet die ver-besserte Prognose vor allem mit einem stärkeren Wachstumstrend bei den Produktgruppen außerhalb des Covid-Bereichs. Sie legten nach Aussage des Finanzchefs gegenüber den Vorjahres-werten kräftig zu. „Wir sehen, dass La-bore weltweit in eine Normalität zu-rückkehren wollen“, so Sackers.
Im dritten Quartal stiegen die Erlöse von Qiagen um elf Prozent auf 535 Mil-
lionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 165 Millionen Dollar dagegen leicht unter Vorjahresniveau, ebenso wie der bereinigte Nettogewinn. Für die ersten neun Monate weist das Unternehmen einen Anstieg des Um-satzes um 28 Prozent auf 1,67 Milliarden Dollar aus. Das bereinigte Ergebnis ver-besserte sich in dem Zeitraum um 29 Prozent auf 443 Millionen Dollar. Qia-gen hat sich damit zwar deutlich besser entwickelt als der vermeintliche Fusi-ons-Interessent Biomerieux (mit nur acht Prozent Umsatzplus). Insgesamt kann der Konzern im Konkurrenzver-gleich indessen nicht voll mithalten.
Die führenden Konkurrenten imDiagnostik- und Lifescience-Geschäfthaben für die ersten neun Monate viel-mehr fast durchweg noch stärkeresWachstum ausgewiesen. Die beidengroßen US-Konzerne Thermo Fisherund Danaher zum Beispiel wuchsenum jeweils mehr als 30 Prozent. Markt-führer Roche legte mit seiner Diagnos-tika-Sparte um 38 Prozent zu, der US-Konzern Abbott sogar um 68 Prozent.Healthineers verbuchte bei Diagnosti-ka ein Umsatzplus von 38 Prozent. Siegfried Hofmann
Diagnostikkonzern
Qiagen erhöht PrognoseDer Diagnostik- und Biotechkonzern wächst stärker als erwartet. Eine mögliche Biomerieux-Übernahme bleibt offen.
Qiagen-Labor: Wachstum außerhalb des Covid-Bereichs.
dpa
Unternehmen
25WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Michael Scheppe Berlin
Es soll nichts Geringeres werden als „das deutsche Medien-Abon-nement“, sagt RTL-Co-Chef Stephan Schäfer. Sein Kollege Matthias Dang schwärmt: „So
ein Produkt gibt es nicht. Wir bauen die Blaupause.“ Tatsächlich schafft RTL für die Medienbranche etwas bislang Einzigartiges: eine Streaming-Platt-form, auf der es nicht nur Live-TV und Filme geben soll. Nutzer können auf der Plattform „RTL +“, die bis Don-nerstag unter dem Namen „TV Now“ firmierte, ab Sommer 2022 auch Pod-casts, Hörbücher und Musiktitel sowie digitale Bücher und Magazine abrufen.
Alle Medien gebündelt in einer App – das Konzept hat RTL vor Pro-duzenten und Schauspielern am Don-nerstag ausgewählten Medien vorge-stellt, darunter auch dem Handelsblatt. Die RTL-Mutter Bertelsmann meint es ernst: Im Vergleich zu 2021 will man die jährlichen Programminvestitionen bis 2026 auf rund 600 Millionen Euro verdreifachen, kündigte Thomas Rabe an, der in Personalunion Chef von Ber-telsmann und der RTL Group ist.
RTL kämpft gegen die mächtigen Tech-Konzerne Facebook, Google und Amazon, die 80 bis 90 Prozent des di-gitalen Werbemarktes kontrollieren. Gleichzeitig graben internationale Plattformen wie Netflix oder Disney+ dem Sender Zuschauer ab. Damit lo-kale Anbieter bestehen können, müs-sen sie nach Wegen suchen, sich von der Konkurrenz zu unterscheiden – so wie RTL es nun versucht.
„RTL +“ steht sinnbildlich für die Strategie von Bertelsmann, Medien
verschiedener Gattungen zusammen-zuführen. Die Gütersloher wollen zum 1. Januar 2022 die Hamburger Zeit-schriftentochter Gruner + Jahr (G + J) mit der Kölner Fernsehgruppe RTL fu-sionieren.
Weil es kein Vorbild für „RTL +“ gibt, ist das Vorhaben ein ambitionier-tes Experiment. Doch selbst die Kon-kurrenz scheint angetan: Netflix-Chef Reed Hastings sagte im September im Handelsblatt-Interview: „RTL wird sehr erfolgreich sein mit dem, was sie
RTL
Kölns Kampf gegen Netflix
Die Bertelsmann-Tochter plant mit „RTL +“ eine bislang einmalige Medienplattform.
Es ist ein ambitioniertes Experiment.
RTL-Fahnen vor Firmengebäude: Die Kölner Mediengruppe hat große Ziele.
D er Dax-Neuling Siemens Health -ineers stellt sich nach einem Um-satzrekord im Zuge der Corona-krise jetzt auf schwächeres
Wachstum ein. „Wir haben in der Pan-demie schnell und umsichtig agiert“, sagte CEO Bernd Montag am Don-nerstag bei Vorlage der Bilanz. In der Folge habe die Siemens-Tochter Marktanteile gewonnen.
Im Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) stiegen die Erlöse des Me-dizintechnik-Spezialisten auch dank der hohen Nachfrage nach Corona-Schnelltests um vergleichbar 19,3 Pro-zent auf erstmals 18 Milliarden Euro. Das hohe Niveau will der Konzern im laufenden Geschäftsjahr halten, auch wenn weniger Schnelltests verkauft werden.
Vorstandschef Montag prognosti-zierte für das neue Geschäftsjahr 2021/22 auf vergleichbarer Basis einen Umsatzzuwachs von null bis zwei Pro-zent. Rechnet man die Umsätze mit den Schnelltests heraus, sollen die Er-löse vergleichbar – also zum Beispiel ohne Währungseffekte – um fünf bis sieben Prozent wachsen. Das bereinig-te Ergebnis je Aktie wird zwischen
2,08 Euro und 2,20 Euro erwartet. Das Unternehmen gehe mit einem Rekord-auftragsbestand in das neue Geschäfts-jahr, für das man eine fortgesetzt starke Geschäftsentwicklung erwarte, so Montag.
Zu Beginn der Pandemie waren die Coronaeffekte für die Healthineers ge-mischt, etwa weil Kliniken diagnosti-sche Behandlungen und auch Investi-tionen verschoben hatten. Im weiteren Verlauf erholte sich das Geschäft dann wieder deutlich, und der Konzern pro-fitierte dann zusätzlich von der hohen Nachfrage nach Covid-19-Antigen-tests. Insgesamt erzielten die Healthi-
neers im Geschäftsjahr 2020/21 rund 1,1 Milliarden Euro Umsatz mit Anti-gen-Schnelltests und einen Nachsteu-ergewinn von rund 350 Millionen Euro. Im neuen Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen indes nur Umsätze in Höhe von 200 Millionen Euro – weil die Impfquoten gestiegen sind und die Preise für Antigen-Schnelltests fallen.
Aber auch ohne den Sondereffekt durch die Antigentests haben sich die Healthineers im abgelaufenen Jahr er-folgreich entwickelt: Die Erlöse legten um 11,8 Prozent zu. Erstmals flossen auch die Zahlen des US-Krebstherapie-spezialisten Varian nach der 16-Milliar-den-Dollar-Übernahme ein.
Den Aktionären winkt eine Divi-dendenerhöhung von 80 auf 85 Euro-cent je Aktie, das entspricht einer Aus-schüttungsquote von 55 Prozent des Gewinns nach Steuern. Die Börse rea-gierte positiv auf Bilanz und Prognose. Der Aktienkurs von Siemens Health -ineers stieg zwischenzeitlich um zwei Prozent auf knapp 61 Euro.
Ein Blick auf die Geschäftsfelder zeigt, dass die Bildgebung und die Di-agnostiksparte im vergangenen Ge-schäftsjahr prozentual zweistellig
wuchsen. Im vierten Quartal, das von Juli bis September ging, stieg der Kon-zernumsatz um vergleichbar 14,4 Pro-zent auf knapp 5,2 Milliarden Euro, das bereinigte Ebit um 26 Prozent auf 793 Millionen Euro.
Auch im Gesamtjahr machten die Healthineers beim Gewinn deutliche Fortschritte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) stieg um 40 Prozent auf gut 3,1 Milliarden Euro. Das ent-sprach einer Marge von 17,4 Prozent. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 1,41 auf 1,57 Euro.
Prognose mehrfach angehobenSiemens Healthineers hatte die Prog-nose für das Geschäftsjahr mehrmals angehoben. Zuletzt rechnete das Un-ternehmen mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 17 bis 19 Pro-zent und einem bereinigten, unverwäs-serten Ergebnis von 1,95 bis 2,05 Euro je Aktie. Analysten hatten im Schnitt für das Geschäftsjahr mit einem Um-satzanstieg um vergleichbar 18 Prozent auf 17,9 Milliarden Euro und einem an-gepassten Ebit von 3,25 Milliarden Euro gerechnet. Axel Höpner, Maike Telghe-der
Siemens Healthineers
Rekordumsätze in der PandemieVor allem die hohe Nachfrage nach Coronatests bringt dem Dax-Neuling Zuwächse. Nun dürfte sich das Wachstum abschwächen.
CT-Scanner bei Siemens Healthi-neers: Zweistel-liges prozentuales Wachstum in der Diagnostiksparte.
Blo
ombe
rg
Unternehmen
24 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
dort vorhaben.“ Auch Experten sehen Potenzial. Olaf Riedel, Partner bei EY und Leiter des Bereichs Technologie, Media & Entertainment und Telekom-munikation, sagt: „Die Chancen, mit einer einheitlichen Plattform ein brei-teres Publikum zu erschließen, sind groß.“ Auf „RTL +“ kann das Medien-haus TV-Sendungen oder Zeitungsar-tikel neben der Ausstrahlung oder dem gedruckten Magazin ein weiteres Mal verwerten und so „zusätzliche Nutzer-gruppen zu vergleichsweise geringen Kosten erreichen“, so Riedel.
Studien zeigen, dass der Bedarf nach Plattformen wächst, die den Nut-zern Zugang zu unterschiedlichen An-geboten in einer App anbieten. Gerade Bertelsmann mit seinen Marken hat dazu die Möglichkeit wie kaum jemand sonst: Auf der neuen Plattform wird es Zeitschriften wie „Stern“, „Geo“ oder „Brigitte“ geben, die zur Tochter G+J gehören; Hörbücher und Bücher des Bertelsmann-Verlags Penguin Random House sowie Musik und Podcasts von Audio Now. Im Bereich Musik hat RTL eine Partnerschaft mit dem Spo-tify-Konkurrenten Deezer geschlossen. RTL plant auch, mit anderen Medien-
häusern Partnerschaften zu schließen. RTL zählt auf seiner Plattform derzeit 2,4 Millionen zahlende Abonnenten, vor einem Jahr waren es noch 1,8 Mil-lionen. Trotz des Wachstums ist der Abstand zu Netflix groß: Für den deut-schen Markt weist Netflix zwar keine Zahlen aus, die Londoner Analysefir-ma Ampere Analysis geht für 2020 aber von 10,9 Millionen Abonnenten aus. RTL will bis Ende 2026 die Marke von zehn Millionen erreichen, aller-dings gemeinsam mit dem Angebot Vi-deoland in den Niederlanden, das der-zeit rund eine Million Nutzer zählt.
Große Ziele, die Branchenkenner für erreichbar halten. Bernd Riefler, Gründer und CEO des Analysehauses Veed Analytics, sagt: „Im Fernseh- und Streaming-Markt gibt es nicht den ei-nen Anbieter, der alle Kunden abgreift. Es wird immer Raum für die Vielfalt der Angebote geben.“ So bietet Netflix vor allem Filme und Serien an; RTL sendet daneben auch Nachrichten, Sport-Übertragungen und stellt künftig eben auch E-Books oder Hörspiele zur Verfügung – Bereiche, die sich für die US-Konkurrenz nicht lohnen. Dass RTL seine lokalen Vorteile ausspielen
wird, glaubt auch Netflix-Chef Has-tings. „Wir werden sicher nicht deut-scher werden als RTL.“
Wie teuer das Streaming-Angebot sein wird, erarbeiten die Kölner noch. Bei dem Einstiegspreis bekommen Nutzer Werbung ausgespielt, die Pre-mium-Variante soll frei davon sein. Die RTL-Macher sind überzeugt, dass Nutzer bereit sind, für ihr Angebot Geld auszugeben, selbst wenn sie schon Abos der Konkurrenz hätten. In-ternen Analysen zufolge würden Kon-sumenten im Schnitt zwei bis drei Abos für Streaming-Dienste abschlie-ßen. EY-Experte Riedel bestätigt den Trend: „Die Bereitschaft, für gute In-halte Geld auszugeben, ist durch die Pandemie gestiegen.“ Das gelte gerade für ältere Nutzer, Jüngere seien länger bereit, für werbefreie Angebote zu zah-len, weil sie das von Streaming-Diens-ten gewohnt sind.
Chancen für die VermarktungDie Neupositionierung hat einen wei-teren Grund: Lokale Firmen wie RTL müssen bei der Vorherrschaft von Google, Facebook und Amazon stärker denn je ihre Vorzüge für werbetreiben-
de Firmen klar machen. „Mit verschie-denen Gattungen in einer App könnenMedienunternehmen die Attraktivitätihrer Vermarktungsmöglichkeiten er-höhen“, sagt Marketingexperte Andre-as Schwabe, Partner bei der BeratungBoston Consulting Group (BCG).
Bei „RTL +“ soll es einen persönli-chen Bereich geben, in dem KünstlicheIntelligenz den Nutzern ähnliche an-dere Filme vorschlägt, aber auch pas-sende Podcasts oder Zeitungsbeiträge.Durch das breite Angebot über ver-schiedene Gattungen lernt der Algo-rithmus schneller, welche Inhalte denKunden gefallen. „Das ist sowohl fürden Endkunden wie auch für die Ver-marktung ein kluger Schritt“, sagtSchwabe. Werbekunden könnten denNutzern zielgenauere Kampagnen aus-spielen.
Um mehr Nutzer zu erreichen, ar-beitet RTL mit der Telekom zusam-men. Auf der Plattform Magenta TVsollen Nutzer „RTL +“ günstiger erhal-ten. Michael Schuld, TV-Chef der Te-lekom, sagt: „Es gibt einen Bedarf nachneuer Einfachheit.“ Ob „RTL +“ diesenerfüllen kann, wird sich allerdings erstim kommenden Sommer zeigen.dp
a
D er Diagnostikkonzern Qiagen präsentiert sich nach einem un-erwartet kräftigen Wachstum im dritten Quartal zuversichtlich:
„Wir sind ein starkes Unternehmen mit einer starken Pipeline“, bekräftigte Finanzchef Roland Sackers in einem Pressegespräch.
Zu den in Finanzkreisen seit Wo-chen kursierenden Spekulationen, wo-nach das französische Diagnostik-Unter-nehmen Biomerieux eine Fusion mit Qiagen auslotet, nahm Sackers allerdings nicht konkret Stellung: „Wir sind ja in einer Industrie, die grundsätzlich kon-solidiert und wo grundsätzlich Unter-nehmen miteinander zusammenarbei-ten“, sagte Sackers. Deshalb sei es nicht verwunderlich, dass immer wieder Spe-kulationen über mögliche Zusammen-schlüsse die Runde machten. Detailliert wolle man das aber nicht kommentieren. Entscheidend sei dem Finanzchef zufol-ge, langfristig Wert zu generieren.
Biomerieux ist mit 2,45 Milliarden Euro Umsatz in den ersten drei Quar-talen zwar deutlich größer als Qiagen und in einigen Teilbereichen des Diag-nostika-Geschäfts auch direkter Kon-kurrent des Hildener Konzerns. Ge-
messen an der Marktkapitalisierung bewegen sich beide Unternehmen mit 13 Milliarden Euro (Biomerieux) und elf Milliarden Euro (Qiagen) jedoch eher auf dem gleichen Niveau. Am Donnerstagnachmittag gab der Qia-gen-Kurs um zwei Prozent nach.
Der Diagnostik- und Lifescience-Bereich war in den letzten Jahren von zahlreichen Übernahmen geprägt, wo-bei vor allem die US-Konzerne Thermo Fisher Scientific und Danaher stark zu-kauften. Thermo Fisher hatte Anfang des letzten Jahres auch versucht, Qia-gen zu übernehmen, war damals aber mit seiner 11,3 Milliarden Euro schwe-ren Offerte am Ende am Widerstand der Qiagen-Aktionäre gescheitert.
Qiagens Geschäft entwickelt sich unterdessen etwas besser als zuletzt er-wartet. Das wiederum hat den Vor-stand veranlasst, die im Sommer noch reduzierte Jahresprognose wieder leicht anzuheben. Für das Gesamtjahr stellt er nun ein Umsatzwachstum auf währungsbereinigter Basis von mindes-tens 15 Prozent sowie einen Anstieg des Gewinns je Aktie um ebenfalls rund 15 Prozent auf mindestens 2,48 Euro in Aussicht. Gegenüber der bis-
herigen Prognose entspricht das einer Anhebung um jeweils etwa drei Pro-zentpunkte. Qiagen begründet die ver-besserte Prognose vor allem mit einem stärkeren Wachstumstrend bei den Produktgruppen außerhalb des Covid-Bereichs. Sie legten nach Aussage des Finanzchefs gegenüber den Vorjahres-werten kräftig zu. „Wir sehen, dass La-bore weltweit in eine Normalität zu-rückkehren wollen“, so Sackers.
Im dritten Quartal stiegen die Erlöse von Qiagen um elf Prozent auf 535 Mil-
lionen Dollar. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit 165 Millionen Dollar dagegen leicht unter Vorjahresniveau, ebenso wie der bereinigte Nettogewinn. Für die ersten neun Monate weist das Unternehmen einen Anstieg des Um-satzes um 28 Prozent auf 1,67 Milliarden Dollar aus. Das bereinigte Ergebnis ver-besserte sich in dem Zeitraum um 29 Prozent auf 443 Millionen Dollar. Qia-gen hat sich damit zwar deutlich besser entwickelt als der vermeintliche Fusi-ons-Interessent Biomerieux (mit nur acht Prozent Umsatzplus). Insgesamt kann der Konzern im Konkurrenzver-gleich indessen nicht voll mithalten.
Die führenden Konkurrenten imDiagnostik- und Lifescience-Geschäfthaben für die ersten neun Monate viel-mehr fast durchweg noch stärkeresWachstum ausgewiesen. Die beidengroßen US-Konzerne Thermo Fisherund Danaher zum Beispiel wuchsenum jeweils mehr als 30 Prozent. Markt-führer Roche legte mit seiner Diagnos-tika-Sparte um 38 Prozent zu, der US-Konzern Abbott sogar um 68 Prozent.Healthineers verbuchte bei Diagnosti-ka ein Umsatzplus von 38 Prozent. Siegfried Hofmann
Diagnostikkonzern
Qiagen erhöht PrognoseDer Diagnostik- und Biotechkonzern wächst stärker als erwartet. Eine mögliche Biomerieux-Übernahme bleibt offen.
Qiagen-Labor: Wachstum außerhalb des Covid-Bereichs.
dpa
Unternehmen
25WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Christof Kerkmann Düsseldorf
Der Konzern IBM erfindet sich regelmäßig neu – doch das, was am heutigen Donnerstag an-steht, ist die wohl radikalste Veränderung in der 110-jährigen
Unternehmensgeschichte: Vorstands-chef Arvind Krishna spaltet den Kon-zern in zwei eigenständige Einheiten auf und bringt das Geschäft mit IT-In-frastrukturdienstleistungen unter dem kryptischen Namen Kyndryl an die Börse.
Das neue Unternehmen mit 90.000 Mitarbeitern, gut 19 Milliarden Dollar Jahresumsatz und Kunden in al-ler Welt ist ein Riese, allerdings ein schwächelnder: Das Geschäft ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich ge-schrumpft und defizitär gewesen. Das Management hofft, dass nun eine neue Dynamik entsteht. „Ich verspreche mir von der Unabhängigkeit einen deutli-chen Schwung“, sagte Markus Koer-ner, Präsident von Kyndryl Deutsch-land, dem Handelsblatt. Bei IBM als in-tegriertem Technologiekonzern habe
es eine „Vielzahl an Zielkonflikten“ ge-geben, ob bei Investitionen oder der Zusammenarbeit mit anderen Tech-nologieanbietern – das sei nun vorbei.
Nun muss das Management zei-gen, dass es mit dieser Botschaft an der Börse überzeugen kann. Die IBM-Ak-tionäre erhielten über eine Ausschüt-tung 80,1 Prozent der Kyndryl-Aktien, am Donnerstag begann der Handel des Papiers an der Wall Street. Gleich in den ersten Stunden fiel der Kurs um bis zu fünf Prozent auf knapp 27 Dollar.
Viele Jahre verfolgte IBM die Stra-tegie, als integrierter Technologiekon-zern Hardware, Software, Beratung und Service aus einer Hand anzubieten. Das sollte es ermöglichen, komplexe Projekte zu übernehmen – von der Pla-nung über die Umsetzung bis zum Be-trieb, beispielsweise elektronische Ge-sundheitsakten.
Das Ende eines MischkonzernsDas bewährte sich jedoch nur bedingt: Der Umsatz von IBM schrumpfte über Jahre – teils durch die Trennung von Ge-schäftsbereichen, teils durch eine schwa-che Entwicklung von Initiativen wie der Künstlichen Intelligenz Watson. Mit ei-nem Börsenwert von rund 114 Milliarden Dollar ist das Unternehmen, das man einst „Big Blue“ nannte, im Vergleich zu den heutigen Größen Microsoft, Google und Amazon ziemlich klein.
Die Aufspaltung des Mischkon-zerns soll für neue Dynamik sorgen. Bei der Rest-IBM stehen Cloud-Com-puting, KI und Quantencomputer im Mittelpunkt – Technologien mit gro-ßem Wachstumspotenzial also. Kyn-dryl übernimmt dagegen im Wesent-lichen das Segment Global Technology Services, das ein vielfältiges Sortiment von IT-Dienstleistungen beinhaltet, bei denen die Konkurrenz groß ist und die Margen klein sind.
Diese Zuteilung dürfte sich an der Börse bemerkbar machen: Bei Ge-schäftsmodellen mit hohen Margen und regelmäßigen Einnahmen legen die Aktionäre schließlich höhere Be-wertungsmaßstäbe an. Die Invest-mentbank Morgan Stanley beispiels-weise bewertet IBM nun mit dem 15,3-Fachen des freien Cashflows, Kyn-dryl nur mit dem Zwölffachen.
Das Geschäft von Kyndryl wird in der Branche als „Managed Infrastruc -ture Services“ bezeichnet: Das Unter-nehmen entwickelt, betreibt und mo-dernisiert die IT-Infrastruktur von Kunden. Das können digitale Arbeits-plätze und die Terminals einer Flugge-sellschaft sein, Cloud-Dienste und SAP-Systeme. Zu den 4400 Kunden zählen BMW, die Deutsche Bank und Henkel, international Michelin, EY und BBVA.
Kyndryl will von einigen Trends profitieren. So benötigen viele Unter-nehmen Unterstützung, um die IT mithilfe der Cloud zu modernisieren. Auch der digitale Arbeitsplatz, erreich-bar von überall und ausgestattet mit Software für die Kollaboration, ist für viele Kunden ein wichtiges Thema. Und bei allen Digitalisierungsinitiativen spielt IT-Sicherheit eine zentrale Rolle.
Der Bedarf nach solchen Dienst-leistungen wachse durch die digitale Transformation, ist Kyndryl-Chef Martin Schroeter überzeugt. Und der Konzern habe eine „einzigartige, inter-nationale Expertise“ für unterneh-menskritische IT-Infrastruktur. Das Unternehmensmotto ist somit, die „modernsten, effizientesten und zu-verlässigsten Technologiesysteme“ zu bauen, „auf die die Welt tagtäglich an-gewiesen ist“. Den adressierbaren
IT-Infrastrukturdienstleistungen
IBM-Abspaltung Kyndryl geht an
die BörseOhne die Mutter soll es besser laufen: Kyndryl will
sich im Markt für IT-Dienstleistungen von IBM emanzipieren. Die Zahlen allerdings sind mau.
Umsatz in Mrd. US-Dollar Nettoergebnisin Mio. US-Dollar
Zahl der Kunden
2018
2018
2019
2019
2020 2018 2019 2020
5.100 4.600 4.400
2020
-980 -943
-2.011
21,820,3 19,4
Quelle: UnternehmenHANDELSBLATT
Kyndryl: Schwächelnder Riese
Cai
aim
age/
Get
ty Im
ages
Ich verspre-che mir von der Unab-hängigkeit
einen deutli-chen
Schwung.
Markus KoernerPräsident von Kyn-dryl Deutschland
Unternehmen
26 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Markt beziffert das Management mit 415 Milliarden Dollar.
Deutschland ist mit einigen namhaf-ten Kunden ein wichtiger Markt. Rund 1000 Leute beschäftigt Kyndryl direkt, zudem kann die Landesgesellschaft auf 3500 Mitarbeiter in den Dienstleistungs-zentren des Konzerns zugreifen.
Die Vision steht jedoch im Kon-trast zur Realität. In den vergangenen Jahren lief das Geschäft schlecht. So schrumpfte der Umsatz 2020 um fünf Prozent auf 19 Milliarden Dollar, der Verlust vor Steuern stieg auf 1,8 Mil-liarden Dollar, wie aus Unterlagen für die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Auch im ersten Halbjahr 2021 war der Geschäftsbereich nicht profitabel.
Kyndryl-Manager Koerner ver-weist darauf, dass diese Berechnung der Verluste ein verzerrtes Bild ergebe. So habe IBM die allgemeinen Kosten durch die Zahl aller Mitarbeiter geteilt, wodurch das personalintensive Dienst-leistungsgeschäft schlechter dastehe. Das neue Unternehmen benötige je-doch einen kleineren Verwaltungs-apparat. Die genaue Entwicklung der Kosten ist indes noch offen.
Koerner, der lange bei IBM tätig war, hofft zudem darauf, dass das neue Unter-nehmen durch die Spezialisierung neues Potenzial erschließen kann. Das fängt schon damit an, dass es weniger Diskus-sionen über die Prioritäten bei den Inves-titionen geben soll, die im Geschäft mit IT-Infrastruktur traditionell hoch sind.
Zudem könne Kyndryl ohne IBM ein „viel größeres Ökosystem“ nutzen. So arbeite das Unternehmen mit Soft-wareherstellern wie VMWare und Net -app sowie den Cloud-Dienstleistern Amazon Web Services (AWS) und Mi-crosoft zusammen. „Das sind Lösun-gen und Vertriebskanäle, die uns vor-her nicht zur Verfügung standen – wir haben bestimmte Teile des Marktes weggelassen.“
„Das Marktpotenzial ist vorhan-den, aber der Wettbewerb ist intensiv“, urteilt Mario Zillmann, Partner des Marktforschungs- und Beratungs-unternehmens Lünendonk. Selbst in der Coronazeit sei das Geschäft der IT-Infrastrukturdienstleister gewachsen, allerdings hätten sich die Prioritäten verändert.
Serverraum: IBM will Hardware, Software, Beratung und Service aus einer Hand anbieten.
Die Deutsche Post erhöht zum vierten Mal ihre Prognose für das laufende Ge-schäftsjahr. So erwartet der Bonner Dax-Konzern nun 2021 einen Rekord-Betriebsgewinn (Ebit) von 7,7 Milliar-den Euro – und damit zehn Prozent mehr als bislang in Aussicht gestellt. 2020 waren gerade einmal 4,8 Milliar-den Euro zusammengekommen, in den Jahren zuvor durchschnittlich rund 3,5 Milliarden.
Auch die Mittelfristprognose bes-serte Konzernchef Frank Appel nach. Für 2023 prognostiziert er nun ein Konzern-Ebit von mehr als acht Mil-liarden Euro, was einer Zielanhebung um 0,6 Milliarden Euro entspricht.
„Unser Geschäft hat sich auch im dritten Quartal 2021 ausgesprochen positiv entwickelt“, begründete er den Schritt. „Nach neun Monaten haben wir bereits unser Rekord-Gesamtjah-resergebnis aus dem Vorjahr übertrof-fen.“ Der Welthandel sei auf dem Weg zurück zu alter Stärke, beobachtet Ap-pel. Der Onlinehandel halte sich auf seinem neuen, höheren Niveau.
Weniger Volumen, mehr UmsatzDabei sind es vor allem die Engpässe in der weltweiten Logistik und die da-mit verbundenen Preiserhöhungen, von denen Deutsche Post DHL erheb-lich profitiert. Nach der unfallbedingten Sperrung des Suezkanals Ende März und mehreren Corona-bedingten Ha-fenschließungen in China hatten sich insbesondere die Kapazitäten auf See im Sommer erheblich reduziert. In der Folge schossen die Frachtraten in die Höhe, was auch den Speditionen zu-gutekam. So lag der DHL-Umsatz aus der Seefracht 98 Prozent über dem Wert des dritten Quartals 2019, das vermittelte Frachtvolumen aber sieben Prozent unter dem Niveau vor Corona.
Einen ähnlichen Trend verzeichne-te DHL auch in der Luftfracht. Weil nach dem Ausbruch von Corona deut-lich weniger Passagierjets starteten, die üblicherweise rund die Hälfte der welt-weiten Luftfracht in ihren Bäuchen transportieren, überstieg auch hier die Nachfrage das Angebot deutlich. Im Aircargo-Geschäft von DHL stieg des-halb der Umsatz im Zwei-Jahres-Zeit-raum um 37 Prozent, obwohl sich das Frachtvolumen nur um 16 Prozent er-höhte. Unter dem Strich häufte die Frachtdivision der Deutschen Post da-mit im dritten Quartal 2021 einen Erlös
von zwei Milliarden Euro an, was ei-nem Plus von 53,3 Prozent im Ver-gleich zum Vorjahr entsprach.
Verhaltener entwickelte sich dage-gen das zuvor boomende Paket-geschäft. Der Unternehmensbereich Post und Paket Deutschland wuchs im Jahresvergleich nur noch um 3,6 Pro-zent, nachdem die Paketzustellung zu-vor zeitweise mehr als 20 Prozent zu-gelegt hatte. Zu Weihnachten erwartet die Post dennoch neue Rekordwerte. „Wir haben uns auf wachsende Zahlen vorbereitet“, sagte Appel.
Doch auch die Unsicherheiten neh-men zu. Starkes E-Commerce-Wachs-tum gibt es zwar noch in Osteuropa und den Niederlanden, in Großbritan-nien stagniert das Geschäft aber. Die USA melden sogar einen Umsatzrück-gang zum Vorjahr. Der US-Wett-bewerber UPS, der vor wenigen Tagen noch einen Gewinnsprung von 19 Pro-zent meldete, traut sich deshalb aktuell nicht einmal eine Jahresprognose zu.
Für Deutsche Post DHL läuft es weiterhin rund. Für das dritte Quartal bestätigte der Konzern die Anfang Ok-tober gemeldeten vorläufigen Ertrags-zahlen. So kletterte das operative Er-gebnis gegenüber dem Vorjahr um 28,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 8,8 Prozent – nach 8,5 Prozent im Vorjahr.
Überraschend stark legte zudem der Umsatz zu. Mit 20 Milliarden Euro übertraf er das Vorjahresquartal um 23,5 Prozent. Analysten hatten im
Schnitt zuletzt mit gerade einmal 17,9Milliarden Euro gerechnet. Auch derGewinn pro Aktie fiel mit 88 Cent fastfünf Prozent höher aus als vom Markterwartet. Die Aktie legte daher nachder Veröffentlichung der Zahlen zeit-weise um 3,5 Prozent zu und kratztean der Marke von 58 Euro.
Analysten empfehlen AktienkaufDie Schweizer Großbank UBS stuftedie Deutsche Post nach der Veröffent-lichung der detaillierten Quartalszahlenauf „Buy“ mit einem Kursziel von 65Euro ein. Der Ausblick des Logistik-konzerns für die Jahre 2021 bis 2023sei im Rahmen der Erwartungen undteilweise etwas besser ausgefallen,schrieb Analyst Cristian Nedelcu.
Auch die US-Bank JP Morgan be-wertete die Aktie mit „Overweight“und nannte als Kursziel 73,44 Euro.Goldman Sachs beließ die DeutschePost auf „Buy“ mit einem Kursziel von66 Euro. Die erhöhte Prognose für denfreien Barmittelfluss in diesem Jahr lie-ge über seiner Schätzung, schrieb Ana-lyst Patrick Creuset. Andre Mulder vonder Investmentbank Kepler Cheuvreuxzeigte sich dagegen enttäuscht von dennochmals aufgestockten Konzernprog-nosen und nannte ein Kursziel von 60.
Die Anteilseigner der Post, die zu-letzt schon von dem eine MilliardeEuro schweren Aktienrückkaufpro-gramm des Konzerns profitierten, dür-fen jedenfalls mit einer weitaus höhe-ren Dividende als im Vorjahr rechnen.Die Ausschüttungsquote sei nach wievor festgelegt auf 40 bis 60 Prozent desNettogewinns, erklärte FinanzchefinMelanie Kreis. Aufgrund des nun an-gepeilten Gewinns werde sie für 2021„signifikant höher“ ausfallen als imVorjahr. Für 2020 zahlte die DeutschePost pro Anteilsschein eine Dividendevon 1,35 Euro. Christoph Schlautmann
Deutsche Post
Rekordgewinn in SichtWährend das Paketgeschäft an Fahrt verliert, verhelfen See- und Luftfracht der Deutschen Post
zu Umsatz- und Gewinnsprung. Zum wiederholten Mal schraubt sie das Jahresziel hoch.
Post-Vorstands-chef Frank Appel:
Vorbereitet auf wachsendes Geschäft zu
Weihnachten.
dpa
20212016
Ergebnis (Ebit)in Mrd. Euro
3,5
Prog
nose
Quelle: UnternehmenHANDELSBLATT
Deutsche Post
7,7Mrd. €8
7
6
5
4
3
2
1
0
Unternehmen
27WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Christof Kerkmann Düsseldorf
Der Konzern IBM erfindet sich regelmäßig neu – doch das, was am heutigen Donnerstag an-steht, ist die wohl radikalste Veränderung in der 110-jährigen
Unternehmensgeschichte: Vorstands-chef Arvind Krishna spaltet den Kon-zern in zwei eigenständige Einheiten auf und bringt das Geschäft mit IT-In-frastrukturdienstleistungen unter dem kryptischen Namen Kyndryl an die Börse.
Das neue Unternehmen mit 90.000 Mitarbeitern, gut 19 Milliarden Dollar Jahresumsatz und Kunden in al-ler Welt ist ein Riese, allerdings ein schwächelnder: Das Geschäft ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich ge-schrumpft und defizitär gewesen. Das Management hofft, dass nun eine neue Dynamik entsteht. „Ich verspreche mir von der Unabhängigkeit einen deutli-chen Schwung“, sagte Markus Koer-ner, Präsident von Kyndryl Deutsch-land, dem Handelsblatt. Bei IBM als in-tegriertem Technologiekonzern habe
es eine „Vielzahl an Zielkonflikten“ ge-geben, ob bei Investitionen oder der Zusammenarbeit mit anderen Tech-nologieanbietern – das sei nun vorbei.
Nun muss das Management zei-gen, dass es mit dieser Botschaft an der Börse überzeugen kann. Die IBM-Ak-tionäre erhielten über eine Ausschüt-tung 80,1 Prozent der Kyndryl-Aktien, am Donnerstag begann der Handel des Papiers an der Wall Street. Gleich in den ersten Stunden fiel der Kurs um bis zu fünf Prozent auf knapp 27 Dollar.
Viele Jahre verfolgte IBM die Stra-tegie, als integrierter Technologiekon-zern Hardware, Software, Beratung und Service aus einer Hand anzubieten. Das sollte es ermöglichen, komplexe Projekte zu übernehmen – von der Pla-nung über die Umsetzung bis zum Be-trieb, beispielsweise elektronische Ge-sundheitsakten.
Das Ende eines MischkonzernsDas bewährte sich jedoch nur bedingt: Der Umsatz von IBM schrumpfte über Jahre – teils durch die Trennung von Ge-schäftsbereichen, teils durch eine schwa-che Entwicklung von Initiativen wie der Künstlichen Intelligenz Watson. Mit ei-nem Börsenwert von rund 114 Milliarden Dollar ist das Unternehmen, das man einst „Big Blue“ nannte, im Vergleich zu den heutigen Größen Microsoft, Google und Amazon ziemlich klein.
Die Aufspaltung des Mischkon-zerns soll für neue Dynamik sorgen. Bei der Rest-IBM stehen Cloud-Com-puting, KI und Quantencomputer im Mittelpunkt – Technologien mit gro-ßem Wachstumspotenzial also. Kyn-dryl übernimmt dagegen im Wesent-lichen das Segment Global Technology Services, das ein vielfältiges Sortiment von IT-Dienstleistungen beinhaltet, bei denen die Konkurrenz groß ist und die Margen klein sind.
Diese Zuteilung dürfte sich an der Börse bemerkbar machen: Bei Ge-schäftsmodellen mit hohen Margen und regelmäßigen Einnahmen legen die Aktionäre schließlich höhere Be-wertungsmaßstäbe an. Die Invest-mentbank Morgan Stanley beispiels-weise bewertet IBM nun mit dem 15,3-Fachen des freien Cashflows, Kyn-dryl nur mit dem Zwölffachen.
Das Geschäft von Kyndryl wird in der Branche als „Managed Infrastruc -ture Services“ bezeichnet: Das Unter-nehmen entwickelt, betreibt und mo-dernisiert die IT-Infrastruktur von Kunden. Das können digitale Arbeits-plätze und die Terminals einer Flugge-sellschaft sein, Cloud-Dienste und SAP-Systeme. Zu den 4400 Kunden zählen BMW, die Deutsche Bank und Henkel, international Michelin, EY und BBVA.
Kyndryl will von einigen Trends profitieren. So benötigen viele Unter-nehmen Unterstützung, um die IT mithilfe der Cloud zu modernisieren. Auch der digitale Arbeitsplatz, erreich-bar von überall und ausgestattet mit Software für die Kollaboration, ist für viele Kunden ein wichtiges Thema. Und bei allen Digitalisierungsinitiativen spielt IT-Sicherheit eine zentrale Rolle.
Der Bedarf nach solchen Dienst-leistungen wachse durch die digitale Transformation, ist Kyndryl-Chef Martin Schroeter überzeugt. Und der Konzern habe eine „einzigartige, inter-nationale Expertise“ für unterneh-menskritische IT-Infrastruktur. Das Unternehmensmotto ist somit, die „modernsten, effizientesten und zu-verlässigsten Technologiesysteme“ zu bauen, „auf die die Welt tagtäglich an-gewiesen ist“. Den adressierbaren
IT-Infrastrukturdienstleistungen
IBM-Abspaltung Kyndryl geht an
die BörseOhne die Mutter soll es besser laufen: Kyndryl will
sich im Markt für IT-Dienstleistungen von IBM emanzipieren. Die Zahlen allerdings sind mau.
Umsatz in Mrd. US-Dollar Nettoergebnisin Mio. US-Dollar
Zahl der Kunden
2018
2018
2019
2019
2020 2018 2019 2020
5.100 4.600 4.400
2020
-980 -943
-2.011
21,820,3 19,4
Quelle: UnternehmenHANDELSBLATT
Kyndryl: Schwächelnder Riese
Cai
aim
age/
Get
ty Im
ages
Ich verspre-che mir von der Unab-hängigkeit
einen deutli-chen
Schwung.
Markus KoernerPräsident von Kyn-dryl Deutschland
Unternehmen
26 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Markt beziffert das Management mit 415 Milliarden Dollar.
Deutschland ist mit einigen namhaf-ten Kunden ein wichtiger Markt. Rund 1000 Leute beschäftigt Kyndryl direkt, zudem kann die Landesgesellschaft auf 3500 Mitarbeiter in den Dienstleistungs-zentren des Konzerns zugreifen.
Die Vision steht jedoch im Kon-trast zur Realität. In den vergangenen Jahren lief das Geschäft schlecht. So schrumpfte der Umsatz 2020 um fünf Prozent auf 19 Milliarden Dollar, der Verlust vor Steuern stieg auf 1,8 Mil-liarden Dollar, wie aus Unterlagen für die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Auch im ersten Halbjahr 2021 war der Geschäftsbereich nicht profitabel.
Kyndryl-Manager Koerner ver-weist darauf, dass diese Berechnung der Verluste ein verzerrtes Bild ergebe. So habe IBM die allgemeinen Kosten durch die Zahl aller Mitarbeiter geteilt, wodurch das personalintensive Dienst-leistungsgeschäft schlechter dastehe. Das neue Unternehmen benötige je-doch einen kleineren Verwaltungs-apparat. Die genaue Entwicklung der Kosten ist indes noch offen.
Koerner, der lange bei IBM tätig war, hofft zudem darauf, dass das neue Unter-nehmen durch die Spezialisierung neues Potenzial erschließen kann. Das fängt schon damit an, dass es weniger Diskus-sionen über die Prioritäten bei den Inves-titionen geben soll, die im Geschäft mit IT-Infrastruktur traditionell hoch sind.
Zudem könne Kyndryl ohne IBM ein „viel größeres Ökosystem“ nutzen. So arbeite das Unternehmen mit Soft-wareherstellern wie VMWare und Net -app sowie den Cloud-Dienstleistern Amazon Web Services (AWS) und Mi-crosoft zusammen. „Das sind Lösun-gen und Vertriebskanäle, die uns vor-her nicht zur Verfügung standen – wir haben bestimmte Teile des Marktes weggelassen.“
„Das Marktpotenzial ist vorhan-den, aber der Wettbewerb ist intensiv“, urteilt Mario Zillmann, Partner des Marktforschungs- und Beratungs-unternehmens Lünendonk. Selbst in der Coronazeit sei das Geschäft der IT-Infrastrukturdienstleister gewachsen, allerdings hätten sich die Prioritäten verändert.
Serverraum: IBM will Hardware, Software, Beratung und Service aus einer Hand anbieten.
Die Deutsche Post erhöht zum vierten Mal ihre Prognose für das laufende Ge-schäftsjahr. So erwartet der Bonner Dax-Konzern nun 2021 einen Rekord-Betriebsgewinn (Ebit) von 7,7 Milliar-den Euro – und damit zehn Prozent mehr als bislang in Aussicht gestellt. 2020 waren gerade einmal 4,8 Milliar-den Euro zusammengekommen, in den Jahren zuvor durchschnittlich rund 3,5 Milliarden.
Auch die Mittelfristprognose bes-serte Konzernchef Frank Appel nach. Für 2023 prognostiziert er nun ein Konzern-Ebit von mehr als acht Mil-liarden Euro, was einer Zielanhebung um 0,6 Milliarden Euro entspricht.
„Unser Geschäft hat sich auch im dritten Quartal 2021 ausgesprochen positiv entwickelt“, begründete er den Schritt. „Nach neun Monaten haben wir bereits unser Rekord-Gesamtjah-resergebnis aus dem Vorjahr übertrof-fen.“ Der Welthandel sei auf dem Weg zurück zu alter Stärke, beobachtet Ap-pel. Der Onlinehandel halte sich auf seinem neuen, höheren Niveau.
Weniger Volumen, mehr UmsatzDabei sind es vor allem die Engpässe in der weltweiten Logistik und die da-mit verbundenen Preiserhöhungen, von denen Deutsche Post DHL erheb-lich profitiert. Nach der unfallbedingten Sperrung des Suezkanals Ende März und mehreren Corona-bedingten Ha-fenschließungen in China hatten sich insbesondere die Kapazitäten auf See im Sommer erheblich reduziert. In der Folge schossen die Frachtraten in die Höhe, was auch den Speditionen zu-gutekam. So lag der DHL-Umsatz aus der Seefracht 98 Prozent über dem Wert des dritten Quartals 2019, das vermittelte Frachtvolumen aber sieben Prozent unter dem Niveau vor Corona.
Einen ähnlichen Trend verzeichne-te DHL auch in der Luftfracht. Weil nach dem Ausbruch von Corona deut-lich weniger Passagierjets starteten, die üblicherweise rund die Hälfte der welt-weiten Luftfracht in ihren Bäuchen transportieren, überstieg auch hier die Nachfrage das Angebot deutlich. Im Aircargo-Geschäft von DHL stieg des-halb der Umsatz im Zwei-Jahres-Zeit-raum um 37 Prozent, obwohl sich das Frachtvolumen nur um 16 Prozent er-höhte. Unter dem Strich häufte die Frachtdivision der Deutschen Post da-mit im dritten Quartal 2021 einen Erlös
von zwei Milliarden Euro an, was ei-nem Plus von 53,3 Prozent im Ver-gleich zum Vorjahr entsprach.
Verhaltener entwickelte sich dage-gen das zuvor boomende Paket-geschäft. Der Unternehmensbereich Post und Paket Deutschland wuchs im Jahresvergleich nur noch um 3,6 Pro-zent, nachdem die Paketzustellung zu-vor zeitweise mehr als 20 Prozent zu-gelegt hatte. Zu Weihnachten erwartet die Post dennoch neue Rekordwerte. „Wir haben uns auf wachsende Zahlen vorbereitet“, sagte Appel.
Doch auch die Unsicherheiten neh-men zu. Starkes E-Commerce-Wachs-tum gibt es zwar noch in Osteuropa und den Niederlanden, in Großbritan-nien stagniert das Geschäft aber. Die USA melden sogar einen Umsatzrück-gang zum Vorjahr. Der US-Wett-bewerber UPS, der vor wenigen Tagen noch einen Gewinnsprung von 19 Pro-zent meldete, traut sich deshalb aktuell nicht einmal eine Jahresprognose zu.
Für Deutsche Post DHL läuft es weiterhin rund. Für das dritte Quartal bestätigte der Konzern die Anfang Ok-tober gemeldeten vorläufigen Ertrags-zahlen. So kletterte das operative Er-gebnis gegenüber dem Vorjahr um 28,6 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Die Ebit-Marge verbesserte sich auf 8,8 Prozent – nach 8,5 Prozent im Vorjahr.
Überraschend stark legte zudem der Umsatz zu. Mit 20 Milliarden Euro übertraf er das Vorjahresquartal um 23,5 Prozent. Analysten hatten im
Schnitt zuletzt mit gerade einmal 17,9Milliarden Euro gerechnet. Auch derGewinn pro Aktie fiel mit 88 Cent fastfünf Prozent höher aus als vom Markterwartet. Die Aktie legte daher nachder Veröffentlichung der Zahlen zeit-weise um 3,5 Prozent zu und kratztean der Marke von 58 Euro.
Analysten empfehlen AktienkaufDie Schweizer Großbank UBS stuftedie Deutsche Post nach der Veröffent-lichung der detaillierten Quartalszahlenauf „Buy“ mit einem Kursziel von 65Euro ein. Der Ausblick des Logistik-konzerns für die Jahre 2021 bis 2023sei im Rahmen der Erwartungen undteilweise etwas besser ausgefallen,schrieb Analyst Cristian Nedelcu.
Auch die US-Bank JP Morgan be-wertete die Aktie mit „Overweight“und nannte als Kursziel 73,44 Euro.Goldman Sachs beließ die DeutschePost auf „Buy“ mit einem Kursziel von66 Euro. Die erhöhte Prognose für denfreien Barmittelfluss in diesem Jahr lie-ge über seiner Schätzung, schrieb Ana-lyst Patrick Creuset. Andre Mulder vonder Investmentbank Kepler Cheuvreuxzeigte sich dagegen enttäuscht von dennochmals aufgestockten Konzernprog-nosen und nannte ein Kursziel von 60.
Die Anteilseigner der Post, die zu-letzt schon von dem eine MilliardeEuro schweren Aktienrückkaufpro-gramm des Konzerns profitierten, dür-fen jedenfalls mit einer weitaus höhe-ren Dividende als im Vorjahr rechnen.Die Ausschüttungsquote sei nach wievor festgelegt auf 40 bis 60 Prozent desNettogewinns, erklärte FinanzchefinMelanie Kreis. Aufgrund des nun an-gepeilten Gewinns werde sie für 2021„signifikant höher“ ausfallen als imVorjahr. Für 2020 zahlte die DeutschePost pro Anteilsschein eine Dividendevon 1,35 Euro. Christoph Schlautmann
Deutsche Post
Rekordgewinn in SichtWährend das Paketgeschäft an Fahrt verliert, verhelfen See- und Luftfracht der Deutschen Post
zu Umsatz- und Gewinnsprung. Zum wiederholten Mal schraubt sie das Jahresziel hoch.
Post-Vorstands-chef Frank Appel:
Vorbereitet auf wachsendes Geschäft zu
Weihnachten.
dpa
20212016
Ergebnis (Ebit)in Mrd. Euro
3,5
Prog
nose
Quelle: UnternehmenHANDELSBLATT
Deutsche Post
7,7Mrd. €8
7
6
5
4
3
2
1
0
Unternehmen
27WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFTS- UND FINANZZEITUNG
Verleger: Dieter von Holtzbrinck
Herausgeberbeirat: Prof. Dr. Bert Rürup, Katharina Borchert, Hans-Jürgen Jakobs, Dr. Josef Joffe, Prof. Dr. Katharina Anna Zweig
RedaktionChefredakteur: Sebastian Matthes Stv. d. Chefredakteurs: Peter Brors, Kirsten Ludowig Mitglied der Chefredaktion: Charlotte Haunhorst (Head of Digital)
Autor: Hans-Jürgen Jakobs
Textchef: Christian Rickens
Chefökonom: Prof. Dr. Bert Rürup
Ressortleiter: Thomas Sigmund (Politik), Markus Fasse, Jürgen Flauger (Unternehmen), Kathrin Jones (Finanzen), Nicole Bastian, Dr. Jens Münchrath (Ausland & Meinung), Sönke Iwersen, Martin Murphy (Investigative Recherche)
Chefs vom Dienst: Stefan Kaufmann (Leitung), Sven Prange (Nachrichtenchef), Tobias Döring, Tom Körkemeier, Marc Renner, Claus Baumann (Print), Susanne Wesch (Print)
Art Direction: Michel Becker, Ralf Peter Paßmann
International Correspondents: Mathias Brüggmann, Torsten Riecke
Verantwortlich im Sinne des Presserechts sind die jeweiligen Leiter für ihren Bereich. Im Übrigen die Chefredaktion.
Handelsblatt Research InstituteTel.: 0211 - 887-0, Telefax: 0211 - 887-97-0, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup (Präsident), Dr. Christian Sellmann (Managing Director)
Verlag Handelsblatt GmbH (Verleger im Sinne des Presserechts).
Geschäftsführung: Andrea Wasmuth
Verantwortlich für Herstellung und Anzeigen: Christian Wiele
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Düsseldorf. Anschrift von Redaktion, Verlag und Anzeigenleitung: Toulouser Allee 27, D-40211 Düsseldorf, Tel. 0211 - 887–0 Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte, Unterlagen und Fotos. Axel Springer SE, Offsetdruckerei Kettwig, Im Teelbruch 100, 45219 Essen; Pressedruck Potsdam GmbH, Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam; Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH, Zamdorfer St. 40, 81677 München
Vertrieb Einzelverkauf: Verlag Der Tagesspiegel GmbH, www.tagesspiegel.de
Kundenservice: Postfach 103345, 40024 Düsseldorf, Telefon: 0211 887 3602, Aus dem Ausland: 0049 211 887 3602 E-Mail: [email protected] Ihre Daten werden zum Zweck der Zeitungszustellung übermittelt an Zustellpartner und an die Medienservice GmbH & Co. KG, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main.
Anzeigen: Anzeigenverkauf Handelsblatt Tel.: 0211 - 887–0, Fax: 0211 - 887–33 59 E-Mail: [email protected]; Internet: www.iqm.de Anzeigenverkauf Handelsblatt.com Tel.: 0211 - 887–26 26, Fax: 0211 - 887–97 26 56 E-Mail: [email protected]; Internet: www.iqdigital.de Anzeigenverkauf Handelsblatt Personalanzeigen Tel.: 040–3280 5800 E-Mail: [email protected] Internet: https://talent.zeit.de/ Anzeigendisposition Handelsblatt Tel.: 0211 - 887 – 26 60, Fax: 0211 - 887 – 97 26 60 E-Mail: [email protected]: Telefax: 0211 - 887–97 12 40 E-Mail: [email protected] Politik Tel.: 030 - 61 68 61 92, Fax: 0211 – 887–97 80 27 E-Mail: [email protected] Unternehmen Tel.: 0211 - 8 87–13 65, Fax: 0211 - 8 87–97 12 40 E-Mail: [email protected] Finanzen Tel.: 0211 - 887–4002, Fax: 0211 - 887–97 41 90 E-Mail: [email protected]
Handelsblatt Veranstaltungen Tel.: 0211 - 887 0, Fax: 0211 - 887 43-40 00 E-Mail: [email protected] www.handelsblatt.com/veranstaltungen
Das Handelsblatt wird ganz oder in Teilen im Print und digital vertrieben. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitung darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.
Artikelanfragen: Club-Mitglieder erhalten einen Artikel kostenlos, Telefon: 0800-2233110 E-Mail: [email protected] Nutzungsrechte: Telefon: 0211 – 2054–4640 (Dieser Service steht Ihnen Mo-Fr zu den üblichen Bürozeiten zur Verfügung) E-Mail: [email protected] Sonderdrucke: Tel.: 0211 – 887–1748, Fax: 0211 – 887–97-1748 E-Mail: [email protected]
Bezugspreise Inland und EU: monatlich € 66,70 (Inland inkl. € 4,36 MwSt./EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Jahresvorzugspreis: € 799,- (Inland inkl. € 52,27 MwSt./EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Vorzugspreis für Studenten (gegen Vorlage einer gültigen Bescheinigung): Monatlich € 33,30 (Inland inkl. € 2,18 MwSt. / EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Jahresvorzugspreis € 399,- (Inland inkl. € 26,10 MwSt. / EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Lieferung jeweils frei Haus. Bezugspreise übriges Ausland: auf Anfrage. Bezugspreise übriges Ausland: auf Anfrage.
Abonnementskündigungen sind nur schriftlich mit einer Frist von 21 Tagen zum Ende des berechneten Bezugszeitraumes möglich, solange keine andere Regelung vorgesehen ist. Im Falle höherer Gewalt (Streik oder Aussperrungen) besteht kein Belieferungs- oder Entschädigungsanspruch. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Düsseldorf. Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte, Unterlagen und Fotos. Für die Übernahme von Artikeln in interne elektronische Pressespiegel erhalten Sie die erforderlichen Rechte über die PMG Presse-Monitor GmbH. Telefon: 030/284930 oder www.presse-monitor.de. Die ISSN-Nummer für das Handelsblatt lautet: 0017–7296
Deloitte-Gebäude: Phase des ungebro-
chenen und stürmischen
Wachstums vorerst beendet. @
Rol
and
Nag
y w
ww
.rol
andn
agy.
com
Bert Fröndhoff Düsseldorf
Die Coronapandemie hat bei der Prüfungs- und Beratungsgesell-schaft Deloitte deutliche Spuren im operativen Geschäft hinter-lassen. In dem Ende Mai abge-
schlossenen Geschäftsjahr ist der Um-satz der Gesellschaft in Deutschland um acht Prozent auf 1,56 Milliarden Euro gesunken. Für den viertgrößten deutschen Wirtschaftsprüfer ist damit die Phase des ungebrochenen und in manchen Jahren stürmischen Wachs-tums vorerst beendet.
Deloitte-Deutschlandchef Volker Krug zeigt sich aber nicht überrascht oder nervös. „Wir haben zwei völlig verschiedene Halbjahre erlebt. Bis En-de 2020 haben auch wir die Zurück-haltung der Kunden gespürt, seit Jah-resbeginn legen wir wieder kräftig zu. Ich bin deshalb zufrieden unter den ge-gebenen Bedingungen“, sagt er im In-terview mit dem Handelsblatt.
Die Delle führt Deloitte vor allem auf Sonderfaktoren zurück. So sei ein
Großauftrag im Segment Financial Ad-visory plangemäß ausgelaufen, andere Projekte seien von Mandanten pande-miebedingt zeitlich gestreckt oder ver-schoben worden. Zudem habe die Ge-sellschaft im Coronajahr den Kunden wesentlich weniger Reisespesen in Rechnung gestellt, was zu Umsatzein-bußen führte.
Grund: Die Berater und Prüfer sind während der Pandemie nicht wie ge-wohnt ständig gereist, sondern haben mit den Kunden per Videokonferenz gearbeitet. Auch intern fielen teure
Präsenzmeetings aus und wurden auf virtuelle Formate umgestellt. Dies wie-derum stützte den Gewinn von Deloit-te: Die Ertragskraft – also die Rendite – sei im Geschäftsjahr 2020/21 gestie-gen, erläuterte Krug, nannte aber keine konkrete Zahl.
Der Umsatzverlust habe im Con-sulting (minus 7,5 Prozent) und bei Fi-nancial Advisory (minus 30 Prozent) auch daran gelegen, dass ausländische Deloitte-Gesellschaften pandemiebe-dingt weniger zu internationalen Pro-jekten mit deutschen Kunden beigetra-gen hätten. Viele Unternehmen haben die Umsetzung vorsichtshalber zu-nächst auf Deutschland begrenzt. Die Volumina sanken in der Folge.
Reisekosten sollen um 30 Prozent sinken
Fürs laufende Geschäftsjahr plant Deloitte wieder mit einem höheren einstelligen Umsatzwachstum, hofft aber auf mehr. Denn dieser Wert sei in den Monaten seit Ende Mai schon deutlich übertroffen worden. „Eines wollen wir aber nicht zurückgewinnen: die im Umsatz abgerechneten Reise-kosten und die damit verbundenen Emissionen“, sagte Krug.
Das heißt: Eine Rückkehr zur frü-her gewohnten Arbeitsweise mit stän-diger Präsenz bei den Kunden und Flü-gen zu internen Meetings in aller Welt wird es bei Deloitte nicht geben. Die Firma will dauerhaft bis zu 30 Prozent der Reisekosten einsparen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wol-len die zusätzlich gewonnene Flexibi-lität nicht aufgeben.
Zu einer kompletten Umstellung auf mobiles Arbeiten etwa aus dem Homeoffice wird es bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft allerdings auch nicht kommen. „Das Büro ist ein Ankerpunkt für ein Unternehmen und seine Kultur“, so Krug. Derzeit liege die Firma bei 25 Prozent Anwesenheits-quote im Office, doch der Wert steige merklich.
Bei den Kunden sei angesichts stei-gender Infektionszahlen noch eine ge-wisse Zurückhaltung zu spüren. Die ei-nen wollen, dass die Beraterteams auch wieder bei ihnen vor Ort sind, andere befürworten weiterhin den weitgehen-den Remote-Austausch. Dies wird laut Deloitte selbst innerhalb von Konzern-einheiten unterschiedlich gehandhabt.
Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Deloitte von der Pandemie stärker ge-troffen ist als die Konkurrenz. Alle vier großen Prüfungsgesellschaften haben ungerade Geschäftsjahre, die im Früh-sommer enden, bei KPMG erst im Herbst. Marktführer PwC hat im Ge-schäftsjahr 2020/21 eine Gesamtleistung von 2,3 Milliarden Euro erzielt, rund zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Bei EY schrumpfte der Umsatz um drei Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Dieser im Transparenzbericht ausgewiesene Rückgang beruhe aber allein auf Sondereffekten der Corona-pandemie, teilte EY mit. Auch die Nummer zwei der Branche verweist
Wirtschaftsprüfung
Deloitte verarbeitet die Folgen der Pandemie
Die Prüfungsgesellschaft will die Delle aus dem Coronajahr schnell ausgleichen. Eine Rückkehr zum alten Arbeitsmodell wird es nicht geben.
Die Reisekosten und die damit verbundenen
Emissionen wollen wir nicht zurückgewinnen.
Volker KrugDeloitte-Deutschlandchef
Deloitte-Deutsch-landchef Volker Krug: Zufrieden
unter den gegebe-nen Bedingungen.
Del
oitt
e
Unternehmen
28 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D ie Finanzinvestoren Hellman & Friedman (H&F) und EQT haben ihr erstes wichtiges Ziel bei der Übernahme des Onlinehändlers
Zooplus erreicht. Wie sie mitteilten, konnten sie sich mehr als 50 Prozent der Anteile sichern.
Nachdem sie sich zunächst ei-nen heftigen Übernahmekampf gelie-fert hatten, schlossen sich H&F und EQT zusammen und legten den Aktio-nären ein gemeinsames Übernahmean-gebot vor. Sie boten 480 Euro pro Ak-tie und bewerteten damit Zooplus ins-gesamt mit 3,7 Milliarden Euro.
Bis zuletzt war nicht sicher, ob die Offerte erfolgreich sein würde. Obwohl der gebotene Preis mehr als 80 Prozent über dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Zoo-plus-Aktie vor dem ersten Übernah-meangebot lag, konnten sich die Inves-toren bis einen Tag vor Ende der Annahmefrist erst gut 30 Prozent der Anteile sichern.
Das genaue Ergebnis, wie viel Pro-zent der Anteile den Investoren bereits angedient wurde, wird voraussichtlich am 8. November bekannt gegeben. Das Angebot war an eine Annahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie ge-knüpft. Die Annahmefrist endete in der Nacht zum 4. November.
H&F und EQT planen, Zooplus mittelfristig von der Börse zu nehmen. Dafür haben sie mit der Übernahme der Mehrheit den ersten wichtigen Schritt getan. Aktionäre, die ihre Ak-tien noch nicht angedient haben, haben nun die Möglichkeit, das Angebot von 480 Euro pro Aktie in einer weiteren Annahmefrist noch zu akzeptieren. Diese Frist wird voraussichtlich vom 9. bis zum 22. November laufen.
Zooplus reduziert die Ergebnisprognose
Während die Aktionäre profitieren, zieht der Erfolg des Angebots für Zoo-plus zusätzliche Kosten nach sich: Wie das Unternehmen mitteilte, werden ihm als Folge des voraussichtlichen Vollzugs des Übernahmeangebots ein-malige Transaktionskosten in Höhe ei-nes zweistelligen Millionenbetrags im Geschäftsjahr 2021 entstehen.
Deshalb reduziert der Vorstand sei-ne Ergebnisprognose und erwartet der-zeit ein Ebitda für das Gesamt-geschäftsjahr 2021 in der Bandbreite von 20 bis 35 Millionen Euro. Zuvor hatte er ein Ebitda in einer Bandbreite von 40 bis 80 Millionen Euro prognos-tiziert. Die Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2021 liegt unver-ändert in der Bandbreite von 2,04 Mil-liarden bis 2,14 Milliarden Euro.
Mitte August hatte Zorro Bidco, ei-ne Holdinggesellschaft, die durch von Hellman & Friedman beratene Fonds kontrolliert wird, ihre Absicht ange-kündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Zooplus zu un-terbreiten. Anfang Oktober wurde das Angebot von Pet Bidco, einer indirekt von EQT Private Equity gehaltenen Holdinggesellschaft übertroffen, dann zog H&F einen Tag später gleich.
Nun ziehen beide Finanzinvesto-ren gemeinsam die Übernahme durch, was in der Investorenbranche durchaus selten vorkommt, wenn sie zuvor kon-kurriert haben.
Was viele Zooplus-Aktionäre letzt-lich überzeugt hat: Das aktuelle Ge-bot liegt weit jenseits dessen, was Ana-lysten Zooplus vorher als Potenzial zu-getraut hatten. So hatte Barclays Mitte Mai noch ein Kursziel von 185 Euro ausgerufen.
Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser hatte als Kursziel ur-sprünglich 225 Euro genannt und ent-sprechend schon die erste Offerte von H&F in Höhe von 390 Euro als attrak-tiv bezeichnet – und zur Annahme ge-raten. Doch dann stieg der Kurs weiter.
Einig sind sich alle Fachleute, dass Zooplus noch großes Potenzial hat. „Es ist langfristig durchaus realistisch, dass sich der Onlineanteil im Handel mit Tierbedarf von heute rund 15 auf bis zu 50 Prozent erhöht“, prognostizierte
Volker Bosse, Handels- und Konsum-güterexperte der Baader Bank.
Beide Investoren hatten in ihrenOfferten angedeutet, dass sie bereitwären, auch nach dem Kauf weitereMittel in Zooplus zu stecken, um die-ses Wachstumspotenzial zu nutzen.„Kurzfristig wird das viele Investmentsnach sich ziehen“, heißt es in Bieter-kreisen. Um Zooplus auf höhereWachstumsraten zu bringen, müssenoch viel Arbeit geleistet werden.
Auch deshalb konnten sich H&Fund EQT ein weiteres Wettbieten miteinem noch höheren Kaufpreis nichterlauben. Mit dem Erreichen der An-nahmeschwelle für ihr gemeinsamesAngebot haben sie nun die Möglich-keit, ihren Anteil weiter aufzustocken.Florian Kolf
Zooplus-Übernahme
Entscheidende Hürde genommenDie milliardenschwere Übernahme des Tierspezialisten Zooplus steht vor dem Abschluss.
Doch für den Onlinehändler hat das auch negative Folgen.
480Euro
pro Aktie können Aktionäre in einer
weiteren Annahme-frist noch
bekommen.
Quelle: Zooplus
auf geringere Reisespesen, die den Kunden in Rechnung gestellt wurden und den Umsatz drückten. Rein ope-rativ sei EY leicht gewachsen.
Bei allen großen Prüfungs- und Be-ratungsgesellschaften ziehen seit Früh-jahr 2021 die Umsätze und die Auf-tragslage vor allem in den Consulting-Einheiten wieder kräftig an. Bei Deloitte gibt es dafür laut Krug meh-rere Treiber.
Zum einen verlagern immer mehr Unternehmen ihre IT-Applikationen in die Cloud und investieren zeitgleich in Systeme zur Abwehr von Cybercri-me. Deloitte positioniert sich dabei nicht mehr allein als Berater, sondern will die Cloud- und Security-Systeme für die Mandaten auch betreiben.
Dazu kommt das neue Megathema Nachhaltigkeit. Wirtschaftsprüfer pro-fitieren davon nicht nur, weil sie die entsprechenden Berichte ihrer Prü-fungskunden abzeichnen. Bei anderen Firmen ist Deloitte etwa auch als Be-rater für Messung, Analyse und Con-trolling von Nachhaltigkeitskennzah-len engagiert.
Neuer Abschlussprüfer der Software AG
Deloitte will in Deutschland rund 340 Millionen Euro bis 2025 investieren. Das Geld soll in neue Technologien und in Talentförderung gesteckt wer-den. Dazu gehört auch die weitere di-gitale Aufrüstung der Abschlussprü-fung inklusive Cloud-Anwendungen.
Dieses Stammgeschäft der Wirt-schaftsprüfung ist bei Deloitte ebenso
wie die Steuerberatung 2020/21 leicht gewachsen. Beim Wettbewerb um neue Abschlussprüfermandate will Krug „weiter selektiv“ vorgehen – es wird also auf den Einzelfall geschaut.
Dabei geht es auch um die Frage, ob Deloitte bei den betreffenden Fir-men weiter als Berater tätig sein will oder dies auf Wunsch des Mandanten bleiben soll. Abschlussprüfer eines Konzerns dürfen diesen kaum noch zugleich beraten. In Branchenkreisen heißt es, dass Deloitte sich aus diesem Grund gar nicht erst ums Prüfermandat bei SAP beworben habe. Der Auftrag ging im Frühjahr an BDO.
Zuletzt hat Deloitte mehrere neue Dax-Mandate gewonnen. Neben Bayer prüft die Gesellschaft künftig auch die Deutsche Post und die Merck KGaA. Aktuell buhlt die Gesellschaft um das Mandat der Deutschen Telekom. Frisch auf der Mandantenliste ist der MDax-Konzern Software AG. Dessen Aufsichtsrat hat sich für Deloitte als neuen Abschlussprüfer ausgesprochen, die Hauptversammlung muss dies aber noch absegnen.
Deloitte
457 Mio. €Wirtschafts-prüfung
278 Mio. €Steuer- u.
Rechts-beratung
227 Mio. €FinancialAdvisory
592 Mio. €Consulting
*Bis 31. Mai • Quelle: UnternehmenHANDELSBLATT
Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21*in Mio. Euro, Veränderung in Prozent
1.554Mio. Euro
-8 %
+1,1 % +0,4 %
-29,5 %-7,5 %
Unternehmen
29WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
DEUTSCHLANDS WIRTSCHAFTS- UND FINANZZEITUNG
Verleger: Dieter von Holtzbrinck
Herausgeberbeirat: Prof. Dr. Bert Rürup, Katharina Borchert, Hans-Jürgen Jakobs, Dr. Josef Joffe, Prof. Dr. Katharina Anna Zweig
RedaktionChefredakteur: Sebastian Matthes Stv. d. Chefredakteurs: Peter Brors, Kirsten Ludowig Mitglied der Chefredaktion: Charlotte Haunhorst (Head of Digital)
Autor: Hans-Jürgen Jakobs
Textchef: Christian Rickens
Chefökonom: Prof. Dr. Bert Rürup
Ressortleiter: Thomas Sigmund (Politik), Markus Fasse, Jürgen Flauger (Unternehmen), Kathrin Jones (Finanzen), Nicole Bastian, Dr. Jens Münchrath (Ausland & Meinung), Sönke Iwersen, Martin Murphy (Investigative Recherche)
Chefs vom Dienst: Stefan Kaufmann (Leitung), Sven Prange (Nachrichtenchef), Tobias Döring, Tom Körkemeier, Marc Renner, Claus Baumann (Print), Susanne Wesch (Print)
Art Direction: Michel Becker, Ralf Peter Paßmann
International Correspondents: Mathias Brüggmann, Torsten Riecke
Verantwortlich im Sinne des Presserechts sind die jeweiligen Leiter für ihren Bereich. Im Übrigen die Chefredaktion.
Handelsblatt Research InstituteTel.: 0211 - 887-0, Telefax: 0211 - 887-97-0, E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup (Präsident), Dr. Christian Sellmann (Managing Director)
Verlag Handelsblatt GmbH (Verleger im Sinne des Presserechts).
Geschäftsführung: Andrea Wasmuth
Verantwortlich für Herstellung und Anzeigen: Christian Wiele
Erfüllungsort und Gerichtsstand: Düsseldorf. Anschrift von Redaktion, Verlag und Anzeigenleitung: Toulouser Allee 27, D-40211 Düsseldorf, Tel. 0211 - 887–0 Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte, Unterlagen und Fotos. Axel Springer SE, Offsetdruckerei Kettwig, Im Teelbruch 100, 45219 Essen; Pressedruck Potsdam GmbH, Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam; Süddeutscher Verlag Zeitungsdruck GmbH, Zamdorfer St. 40, 81677 München
Vertrieb Einzelverkauf: Verlag Der Tagesspiegel GmbH, www.tagesspiegel.de
Kundenservice: Postfach 103345, 40024 Düsseldorf, Telefon: 0211 887 3602, Aus dem Ausland: 0049 211 887 3602 E-Mail: [email protected] Ihre Daten werden zum Zweck der Zeitungszustellung übermittelt an Zustellpartner und an die Medienservice GmbH & Co. KG, Hellerhofstraße 2–4, 60327 Frankfurt am Main.
Anzeigen: Anzeigenverkauf Handelsblatt Tel.: 0211 - 887–0, Fax: 0211 - 887–33 59 E-Mail: [email protected]; Internet: www.iqm.de Anzeigenverkauf Handelsblatt.com Tel.: 0211 - 887–26 26, Fax: 0211 - 887–97 26 56 E-Mail: [email protected]; Internet: www.iqdigital.de Anzeigenverkauf Handelsblatt Personalanzeigen Tel.: 040–3280 5800 E-Mail: [email protected] Internet: https://talent.zeit.de/ Anzeigendisposition Handelsblatt Tel.: 0211 - 887 – 26 60, Fax: 0211 - 887 – 97 26 60 E-Mail: [email protected]: Telefax: 0211 - 887–97 12 40 E-Mail: [email protected] Politik Tel.: 030 - 61 68 61 92, Fax: 0211 – 887–97 80 27 E-Mail: [email protected] Unternehmen Tel.: 0211 - 8 87–13 65, Fax: 0211 - 8 87–97 12 40 E-Mail: [email protected] Finanzen Tel.: 0211 - 887–4002, Fax: 0211 - 887–97 41 90 E-Mail: [email protected]
Handelsblatt Veranstaltungen Tel.: 0211 - 887 0, Fax: 0211 - 887 43-40 00 E-Mail: [email protected] www.handelsblatt.com/veranstaltungen
Das Handelsblatt wird ganz oder in Teilen im Print und digital vertrieben. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitung darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM.
Artikelanfragen: Club-Mitglieder erhalten einen Artikel kostenlos, Telefon: 0800-2233110 E-Mail: [email protected] Nutzungsrechte: Telefon: 0211 – 2054–4640 (Dieser Service steht Ihnen Mo-Fr zu den üblichen Bürozeiten zur Verfügung) E-Mail: [email protected] Sonderdrucke: Tel.: 0211 – 887–1748, Fax: 0211 – 887–97-1748 E-Mail: [email protected]
Bezugspreise Inland und EU: monatlich € 66,70 (Inland inkl. € 4,36 MwSt./EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Jahresvorzugspreis: € 799,- (Inland inkl. € 52,27 MwSt./EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Vorzugspreis für Studenten (gegen Vorlage einer gültigen Bescheinigung): Monatlich € 33,30 (Inland inkl. € 2,18 MwSt. / EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Jahresvorzugspreis € 399,- (Inland inkl. € 26,10 MwSt. / EU zzgl. der jeweiligen MwSt.). Lieferung jeweils frei Haus. Bezugspreise übriges Ausland: auf Anfrage. Bezugspreise übriges Ausland: auf Anfrage.
Abonnementskündigungen sind nur schriftlich mit einer Frist von 21 Tagen zum Ende des berechneten Bezugszeitraumes möglich, solange keine andere Regelung vorgesehen ist. Im Falle höherer Gewalt (Streik oder Aussperrungen) besteht kein Belieferungs- oder Entschädigungsanspruch. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Düsseldorf. Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte, Unterlagen und Fotos. Für die Übernahme von Artikeln in interne elektronische Pressespiegel erhalten Sie die erforderlichen Rechte über die PMG Presse-Monitor GmbH. Telefon: 030/284930 oder www.presse-monitor.de. Die ISSN-Nummer für das Handelsblatt lautet: 0017–7296
Deloitte-Gebäude: Phase des ungebro-
chenen und stürmischen
Wachstums vorerst beendet. @
Rol
and
Nag
y w
ww
.rol
andn
agy.
com
Bert Fröndhoff Düsseldorf
Die Coronapandemie hat bei der Prüfungs- und Beratungsgesell-schaft Deloitte deutliche Spuren im operativen Geschäft hinter-lassen. In dem Ende Mai abge-
schlossenen Geschäftsjahr ist der Um-satz der Gesellschaft in Deutschland um acht Prozent auf 1,56 Milliarden Euro gesunken. Für den viertgrößten deutschen Wirtschaftsprüfer ist damit die Phase des ungebrochenen und in manchen Jahren stürmischen Wachs-tums vorerst beendet.
Deloitte-Deutschlandchef Volker Krug zeigt sich aber nicht überrascht oder nervös. „Wir haben zwei völlig verschiedene Halbjahre erlebt. Bis En-de 2020 haben auch wir die Zurück-haltung der Kunden gespürt, seit Jah-resbeginn legen wir wieder kräftig zu. Ich bin deshalb zufrieden unter den ge-gebenen Bedingungen“, sagt er im In-terview mit dem Handelsblatt.
Die Delle führt Deloitte vor allem auf Sonderfaktoren zurück. So sei ein
Großauftrag im Segment Financial Ad-visory plangemäß ausgelaufen, andere Projekte seien von Mandanten pande-miebedingt zeitlich gestreckt oder ver-schoben worden. Zudem habe die Ge-sellschaft im Coronajahr den Kunden wesentlich weniger Reisespesen in Rechnung gestellt, was zu Umsatzein-bußen führte.
Grund: Die Berater und Prüfer sind während der Pandemie nicht wie ge-wohnt ständig gereist, sondern haben mit den Kunden per Videokonferenz gearbeitet. Auch intern fielen teure
Präsenzmeetings aus und wurden auf virtuelle Formate umgestellt. Dies wie-derum stützte den Gewinn von Deloit-te: Die Ertragskraft – also die Rendite – sei im Geschäftsjahr 2020/21 gestie-gen, erläuterte Krug, nannte aber keine konkrete Zahl.
Der Umsatzverlust habe im Con-sulting (minus 7,5 Prozent) und bei Fi-nancial Advisory (minus 30 Prozent) auch daran gelegen, dass ausländische Deloitte-Gesellschaften pandemiebe-dingt weniger zu internationalen Pro-jekten mit deutschen Kunden beigetra-gen hätten. Viele Unternehmen haben die Umsetzung vorsichtshalber zu-nächst auf Deutschland begrenzt. Die Volumina sanken in der Folge.
Reisekosten sollen um 30 Prozent sinken
Fürs laufende Geschäftsjahr plant Deloitte wieder mit einem höheren einstelligen Umsatzwachstum, hofft aber auf mehr. Denn dieser Wert sei in den Monaten seit Ende Mai schon deutlich übertroffen worden. „Eines wollen wir aber nicht zurückgewinnen: die im Umsatz abgerechneten Reise-kosten und die damit verbundenen Emissionen“, sagte Krug.
Das heißt: Eine Rückkehr zur frü-her gewohnten Arbeitsweise mit stän-diger Präsenz bei den Kunden und Flü-gen zu internen Meetings in aller Welt wird es bei Deloitte nicht geben. Die Firma will dauerhaft bis zu 30 Prozent der Reisekosten einsparen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wol-len die zusätzlich gewonnene Flexibi-lität nicht aufgeben.
Zu einer kompletten Umstellung auf mobiles Arbeiten etwa aus dem Homeoffice wird es bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft allerdings auch nicht kommen. „Das Büro ist ein Ankerpunkt für ein Unternehmen und seine Kultur“, so Krug. Derzeit liege die Firma bei 25 Prozent Anwesenheits-quote im Office, doch der Wert steige merklich.
Bei den Kunden sei angesichts stei-gender Infektionszahlen noch eine ge-wisse Zurückhaltung zu spüren. Die ei-nen wollen, dass die Beraterteams auch wieder bei ihnen vor Ort sind, andere befürworten weiterhin den weitgehen-den Remote-Austausch. Dies wird laut Deloitte selbst innerhalb von Konzern-einheiten unterschiedlich gehandhabt.
Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Deloitte von der Pandemie stärker ge-troffen ist als die Konkurrenz. Alle vier großen Prüfungsgesellschaften haben ungerade Geschäftsjahre, die im Früh-sommer enden, bei KPMG erst im Herbst. Marktführer PwC hat im Ge-schäftsjahr 2020/21 eine Gesamtleistung von 2,3 Milliarden Euro erzielt, rund zwei Prozent weniger als im Jahr zuvor.
Bei EY schrumpfte der Umsatz um drei Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Dieser im Transparenzbericht ausgewiesene Rückgang beruhe aber allein auf Sondereffekten der Corona-pandemie, teilte EY mit. Auch die Nummer zwei der Branche verweist
Wirtschaftsprüfung
Deloitte verarbeitet die Folgen der Pandemie
Die Prüfungsgesellschaft will die Delle aus dem Coronajahr schnell ausgleichen. Eine Rückkehr zum alten Arbeitsmodell wird es nicht geben.
Die Reisekosten und die damit verbundenen
Emissionen wollen wir nicht zurückgewinnen.
Volker KrugDeloitte-Deutschlandchef
Deloitte-Deutsch-landchef Volker Krug: Zufrieden
unter den gegebe-nen Bedingungen.
Del
oitt
e
Unternehmen
28 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D ie Finanzinvestoren Hellman & Friedman (H&F) und EQT haben ihr erstes wichtiges Ziel bei der Übernahme des Onlinehändlers
Zooplus erreicht. Wie sie mitteilten, konnten sie sich mehr als 50 Prozent der Anteile sichern.
Nachdem sie sich zunächst ei-nen heftigen Übernahmekampf gelie-fert hatten, schlossen sich H&F und EQT zusammen und legten den Aktio-nären ein gemeinsames Übernahmean-gebot vor. Sie boten 480 Euro pro Ak-tie und bewerteten damit Zooplus ins-gesamt mit 3,7 Milliarden Euro.
Bis zuletzt war nicht sicher, ob die Offerte erfolgreich sein würde. Obwohl der gebotene Preis mehr als 80 Prozent über dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der Zoo-plus-Aktie vor dem ersten Übernah-meangebot lag, konnten sich die Inves-toren bis einen Tag vor Ende der Annahmefrist erst gut 30 Prozent der Anteile sichern.
Das genaue Ergebnis, wie viel Pro-zent der Anteile den Investoren bereits angedient wurde, wird voraussichtlich am 8. November bekannt gegeben. Das Angebot war an eine Annahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie ge-knüpft. Die Annahmefrist endete in der Nacht zum 4. November.
H&F und EQT planen, Zooplus mittelfristig von der Börse zu nehmen. Dafür haben sie mit der Übernahme der Mehrheit den ersten wichtigen Schritt getan. Aktionäre, die ihre Ak-tien noch nicht angedient haben, haben nun die Möglichkeit, das Angebot von 480 Euro pro Aktie in einer weiteren Annahmefrist noch zu akzeptieren. Diese Frist wird voraussichtlich vom 9. bis zum 22. November laufen.
Zooplus reduziert die Ergebnisprognose
Während die Aktionäre profitieren, zieht der Erfolg des Angebots für Zoo-plus zusätzliche Kosten nach sich: Wie das Unternehmen mitteilte, werden ihm als Folge des voraussichtlichen Vollzugs des Übernahmeangebots ein-malige Transaktionskosten in Höhe ei-nes zweistelligen Millionenbetrags im Geschäftsjahr 2021 entstehen.
Deshalb reduziert der Vorstand sei-ne Ergebnisprognose und erwartet der-zeit ein Ebitda für das Gesamt-geschäftsjahr 2021 in der Bandbreite von 20 bis 35 Millionen Euro. Zuvor hatte er ein Ebitda in einer Bandbreite von 40 bis 80 Millionen Euro prognos-tiziert. Die Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr 2021 liegt unver-ändert in der Bandbreite von 2,04 Mil-liarden bis 2,14 Milliarden Euro.
Mitte August hatte Zorro Bidco, ei-ne Holdinggesellschaft, die durch von Hellman & Friedman beratene Fonds kontrolliert wird, ihre Absicht ange-kündigt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Zooplus zu un-terbreiten. Anfang Oktober wurde das Angebot von Pet Bidco, einer indirekt von EQT Private Equity gehaltenen Holdinggesellschaft übertroffen, dann zog H&F einen Tag später gleich.
Nun ziehen beide Finanzinvesto-ren gemeinsam die Übernahme durch, was in der Investorenbranche durchaus selten vorkommt, wenn sie zuvor kon-kurriert haben.
Was viele Zooplus-Aktionäre letzt-lich überzeugt hat: Das aktuelle Ge-bot liegt weit jenseits dessen, was Ana-lysten Zooplus vorher als Potenzial zu-getraut hatten. So hatte Barclays Mitte Mai noch ein Kursziel von 185 Euro ausgerufen.
Analyst Christian Salis von Hauck & Aufhäuser hatte als Kursziel ur-sprünglich 225 Euro genannt und ent-sprechend schon die erste Offerte von H&F in Höhe von 390 Euro als attrak-tiv bezeichnet – und zur Annahme ge-raten. Doch dann stieg der Kurs weiter.
Einig sind sich alle Fachleute, dass Zooplus noch großes Potenzial hat. „Es ist langfristig durchaus realistisch, dass sich der Onlineanteil im Handel mit Tierbedarf von heute rund 15 auf bis zu 50 Prozent erhöht“, prognostizierte
Volker Bosse, Handels- und Konsum-güterexperte der Baader Bank.
Beide Investoren hatten in ihrenOfferten angedeutet, dass sie bereitwären, auch nach dem Kauf weitereMittel in Zooplus zu stecken, um die-ses Wachstumspotenzial zu nutzen.„Kurzfristig wird das viele Investmentsnach sich ziehen“, heißt es in Bieter-kreisen. Um Zooplus auf höhereWachstumsraten zu bringen, müssenoch viel Arbeit geleistet werden.
Auch deshalb konnten sich H&Fund EQT ein weiteres Wettbieten miteinem noch höheren Kaufpreis nichterlauben. Mit dem Erreichen der An-nahmeschwelle für ihr gemeinsamesAngebot haben sie nun die Möglich-keit, ihren Anteil weiter aufzustocken.Florian Kolf
Zooplus-Übernahme
Entscheidende Hürde genommenDie milliardenschwere Übernahme des Tierspezialisten Zooplus steht vor dem Abschluss.
Doch für den Onlinehändler hat das auch negative Folgen.
480Euro
pro Aktie können Aktionäre in einer
weiteren Annahme-frist noch
bekommen.
Quelle: Zooplus
auf geringere Reisespesen, die den Kunden in Rechnung gestellt wurden und den Umsatz drückten. Rein ope-rativ sei EY leicht gewachsen.
Bei allen großen Prüfungs- und Be-ratungsgesellschaften ziehen seit Früh-jahr 2021 die Umsätze und die Auf-tragslage vor allem in den Consulting-Einheiten wieder kräftig an. Bei Deloitte gibt es dafür laut Krug meh-rere Treiber.
Zum einen verlagern immer mehr Unternehmen ihre IT-Applikationen in die Cloud und investieren zeitgleich in Systeme zur Abwehr von Cybercri-me. Deloitte positioniert sich dabei nicht mehr allein als Berater, sondern will die Cloud- und Security-Systeme für die Mandaten auch betreiben.
Dazu kommt das neue Megathema Nachhaltigkeit. Wirtschaftsprüfer pro-fitieren davon nicht nur, weil sie die entsprechenden Berichte ihrer Prü-fungskunden abzeichnen. Bei anderen Firmen ist Deloitte etwa auch als Be-rater für Messung, Analyse und Con-trolling von Nachhaltigkeitskennzah-len engagiert.
Neuer Abschlussprüfer der Software AG
Deloitte will in Deutschland rund 340 Millionen Euro bis 2025 investieren. Das Geld soll in neue Technologien und in Talentförderung gesteckt wer-den. Dazu gehört auch die weitere di-gitale Aufrüstung der Abschlussprü-fung inklusive Cloud-Anwendungen.
Dieses Stammgeschäft der Wirt-schaftsprüfung ist bei Deloitte ebenso
wie die Steuerberatung 2020/21 leicht gewachsen. Beim Wettbewerb um neue Abschlussprüfermandate will Krug „weiter selektiv“ vorgehen – es wird also auf den Einzelfall geschaut.
Dabei geht es auch um die Frage, ob Deloitte bei den betreffenden Fir-men weiter als Berater tätig sein will oder dies auf Wunsch des Mandanten bleiben soll. Abschlussprüfer eines Konzerns dürfen diesen kaum noch zugleich beraten. In Branchenkreisen heißt es, dass Deloitte sich aus diesem Grund gar nicht erst ums Prüfermandat bei SAP beworben habe. Der Auftrag ging im Frühjahr an BDO.
Zuletzt hat Deloitte mehrere neue Dax-Mandate gewonnen. Neben Bayer prüft die Gesellschaft künftig auch die Deutsche Post und die Merck KGaA. Aktuell buhlt die Gesellschaft um das Mandat der Deutschen Telekom. Frisch auf der Mandantenliste ist der MDax-Konzern Software AG. Dessen Aufsichtsrat hat sich für Deloitte als neuen Abschlussprüfer ausgesprochen, die Hauptversammlung muss dies aber noch absegnen.
Deloitte
457 Mio. €Wirtschafts-prüfung
278 Mio. €Steuer- u.
Rechts-beratung
227 Mio. €FinancialAdvisory
592 Mio. €Consulting
*Bis 31. Mai • Quelle: UnternehmenHANDELSBLATT
Umsatz im Geschäftsjahr 2020/21*in Mio. Euro, Veränderung in Prozent
1.554Mio. Euro
-8 %
+1,1 % +0,4 %
-29,5 %-7,5 %
Unternehmen
29WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Andrea Cünnen, Carsten Volkery, Jan Mallien Frankfurt, London
Seit Monaten treibt kaum ein Thema die Finanzmärkte so sehr um wie die Frage, wann die großen Notenbanken ihre Geld-politik und den Märkten die so wichtige Liquidität entziehen. Vor allem die US-Notenbank (Fed) steht hier im Blick-
punkt. Zumindest einige Investoren fürchteten vor der geldpolitischen Sitzung der Zentralbank am Mittwoch, dass die Börsen in diesem Moment zumindest kurzzeitig abtauchen, wenn die Fed bei den Anleihekäufen auf die Bremse tritt.
Guido Barthels, Fondsmanager bei TBF Glo-bal Asset Management, drückte das so aus: „Es ist ein Effekt wie auf der Geisterbahn: Jeder weiß, was passiert, und erschrickt trotzdem.“ Am späten Mittwochabend hat jetzt die Fed die geldpolitische Wende eingeleitet, doch zunächst hat sich nie-mand erschreckt. Im Gegenteil: Die großen In-dizes S&P 500 und Dow Jones an der Wall Street, die schon seit Tagen wieder auf Rekordjagd sind, markierten neue Allzeithochs. Und der deutsche Leitindex Dax stellte am Donnerstag mit 16.064 Punkten erstmals seit Mitte August eine neue Bestmarke auf.
Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktstrate-gie bei der Baader Bank, erklärt das unter anderem damit, dass die Märkte jetzt Klarheit haben. Tat-sächlich hat die Fed mit Blick auf ihre Anleihekäu-fe wie erwartet einen recht deutlichen Fahrplan vorgelegt. Sie beginnt noch in diesem Monat da-mit, ihre monatlichen Anleihekäufe von bislang noch 120 Milliarden Dollar um 15 Milliarden Dol-lar zu reduzieren. Damit würde das Programm Mitte 2022 enden.
Fed gibt den Märkten KlarheitDass die Märkte selbst für sie letztlich unangeneh-me Entscheidungen wie einen Liquiditätsentzug besser verkraften als Unsicherheit, zeigt sich in Großbritannien. Die Bank of England hat ent-gegen den Erwartungen der Märkte die Leitzinsen am Donnerstag noch nicht erhöht, sondern auf ihrem historischen Tief von 0,1 Prozent belassen. Die Folge: Der britische Leitindex FTSE 100, der den anderen europäischen Börsen ohnehin seit Langem hinterherhinkt, gab kurz nach der Ent-scheidung der Bank of England ein halbes Prozent nach – drehte später aber ins Plus.
Großbritanniens Notenbankchef Andrew Bai-ley persönlich hatte die Erwartungen der Märkte geschürt, indem er vergangenen Monat sagte, die Bank müsse etwas gegen die steigende Inflation tun. Die Märkte preisten daraufhin einen ersten Zinsschritt auf 0,25 Prozent fest ein, die Renditen britischer Staatsanleihen waren vorab schon deut-lich gestiegen. Nun muss sich Bailey den Vorwurf gefallen lassen, die Märkte in die Irre geführt zu haben. „Das war kein Triumph für die Kommuni-kation von Zentralbanken“, sagt Henry Cook, Ökonom bei der japanischen Großbank MUFG. Die Märkte hätten nach den Äußerungen Baileys im vergangenen Monat eine Zinserhöhung erwar-tet. Die Notenbank habe aber vor der Sitzung kei-ne Anstalten gemacht, diese Erwartungen zu dämpfen. Unabhängig davon habe die Bank of England „wahrscheinlich richtig entschieden, an-gesichts der Abwärtsrisiken für die britische Wirt-schaft in den kommenden Monaten erst mal ab-zuwarten“.
Wirtschaftliche Unsicherheit Die Bank of England begründete ihre Zurückhal-tung vor allem mit der wirtschaftlichen Unsicher-heit in Großbritannien. Das Wachstum habe sich im dritten Quartal verlangsamt, heißt es. Die Lie-ferkettenengpässe wirkten dämpfend und auch der Konsum sei schwächer als noch im Sommer erwartet. Die Notenbank rechnet nun mit 1,2 Pro-zent Wachstum im laufenden Quartal. Die Ent-scheidung für eine Beibehaltung der Leitzinsen im geldpolitischen Ausschuss der Bank of England fiel mit sieben zu zwei Stimmen recht deutlich aus. Die Zentralbanker stellten allerdings Zins-erhöhungen „in den kommenden Monaten“ in
Zentralbankentscheidungen in Washington und London
Gegenläufige SignaleDie US-Notenbank leitet die geldpolitische Wende ein, die Bank of
England macht einen Rückzieher. Die Börsen reagieren überraschend: Die großen US-Indizes und der Dax steigen auf Rekordhochs.
Bank of England: Entgegen den Erwartungen der Märkte beließ sie am Donnerstag die Leitzinsen auf einem historischen Tief von 0,1 Prozent.
REU
TER
S, A
FP
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Finanzen
30
Aussicht. Die Inflationsprognose legt nahe, dass der Leitzins Ende 2022 bei einem Prozent liegen könnte.
Die konjunkturellen Sorgen überwogen bei den Notenbankern in London die Angst vor der Inflation. Die Teuerungsrate lag im September zwar mit 3,1 Prozent deutlich über dem langfris-tigen Zielwert von zwei Prozent. Die Bank of England erwartet, dass sie im November auf vier-einhalb Prozent steigen wird, im kommenden April sogar auf fünf Prozent.
Doch halten die Zentralbanker die hohe In-flation weiterhin für ein vorübergehendes Pro-blem. In der zweiten Jahreshälfte 2022 werde die Teuerungsrate wieder deutlich zurückgehen, heißt es im Bericht des geldpolitischen Ausschus-ses der Bank of England. Den langfristigen Ziel-wert von zwei Prozent soll sie der Prognose zu-folge jedoch erst Ende 2023 erreichen.
Auch Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass er den Inflationsanstieg nur für vorübergehend hält. Er rechne damit, dass die Inflation im zwei-ten oder dritten Quartal des kommenden Jahres wieder sinkt. „Wir schauen uns das genau an und werden unsere Politik dementsprechend ändern“, sagte er. Die Inflation in den USA war zuletzt im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent gestiegen. Nach Ansicht von Uwe Streich, Aktienstratege bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), waren es auch Powells Worte zur Infla-tion, die Investoren beruhigten und den Börsen Auftrieb gaben. „Es gab im Vorfeld Befürchtun-gen, dass die Fed ihre Wortwahl verändert und Inflationsrisiken nicht mehr als temporär bezeich-net“.
Ganz klar ist die Lage indes auch in den USA noch nicht. Die Meinungen darüber, ob die Fed die Leitzinsen schon Ende nächsten Jahres oder erst 2023 erhöht, gehen auseinander. Fed-Chef Powell selbst betonte, dass das wahrscheinliche Ende des Kaufprogramms im Sommer 2022 kei-nen Hinweis auf Zinsänderungen gebe. Für die Märkte ist nach Ansicht von Halver aber vor allem eines wichtig: „Die Fed geht homöopathisch vor, und die Leitzinsen werden die Inflationsrate noch lange nicht einholen.“ Zudem werde die Fed mit ihren Anleihekäufen ja auch im nächsten Jahr noch mehr Liquidität in die Finanzmärkte pum-pen.
EZB entscheidet im DezemberDas macht auch die Europäische Zentralbank. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte jüngst er-neut versichert, dass die EZB noch sehr lange an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten will und sie eine Zinserhöhung in absehbarer Zeit für „sehr unwahrscheinlich“ hält. Vor einer Zinserhöhung müsste die EZB zudem wie die Fed erst einmal ihre Anleihekäufe beenden. Im Dezember will sie beschließen, wie es damit weitergehen soll.
Lagarde hat zwar signalisiert, dass das Pande-mie-Kaufprogramm PEPP Ende März auslaufen soll, über das die Notenbanken im Euro-Raum derzeit noch monatlich 80 Milliarden Euro an An-leihen kaufen. Parallel zu PEPP gibt es aber noch ein älteres Kaufprogramm mit dem Kürzel APP. Dieses beläuft sich aktuell auf 20 Milliarden Euro monatlich. Die meisten Experten erwarten, dass die Notenbank das APP-Programm auch über den März hinaus weiterlaufen lässt und eventuell zu-nächst noch aufstockt. Die Bank of England geht einen anderen Weg. Ihr insgesamt 895 Milliarden Pfund schweres Anleihekaufprogramm läuft im Dezember aus.
D ie Allianz der Ölexporteure Opec plus hat Forderungen nach einer höheren Ölproduktion ignoriert. Bei einem virtuellen Gipfeltreffen
am Donnerstag entschieden die Ener-gieminister der 23 Opec-plus-Mitglie-der um Saudi-Arabien und Russland, die Ölproduktion um 400.000 Barrel pro Tag anzuheben, wie die Opec mit-teilte. Das entspricht rund 0,4 Prozent der weltweiten Ölproduktion.
Eine Erhöhung des Angebots um 600.000 oder 800.000 Barrel pro Tag sei kein Thema gewesen, hieß es wei-ter. Die Ölpreise legten daraufhin zwi-schenzeitlich um rund 2,5 Prozent zu. Der Preis für europäisches Brent-Öl lag bei rund 83 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Innerhalb von zwölf Monaten hat sich Öl in Europa um knapp 100 Prozent verteuert.
US-Präsident Joe Biden hatte die Opec am Rande seines Besuchs auf dem Weltklimagipfel in Glasgow für steigende Benzinpreise verantwortlich gemacht. Benzin und Diesel seien teu-rer „wegen der Weigerung von Russ-land oder der Opec, mehr Öl zu för-dern“. Wenige Tage zuvor hatte die US-Energieministerin Jennifer Gran-holm die Opec ein „Kartell“ genannt, eine Bezeichnung, die die Energiemi-nister der Opec gar nicht gerne hören.
Trotz des steigenden Drucks von außen bleibt die Opec-plus-Allianz bei ihrer konservativen Förderpolitik. In der Coronakrise war der Ölpreis ex-trem eingebrochen, auch weil sich Sau-di-Arabien und Russland kurzzeitig ei-nen Preiskampf lieferten. Um den Öl-preis zu stabilisieren, einigte sich die Allianz im Sommer 2020 darauf, zehn Prozent der weltweiten Ölproduktion auf einen Schlag vom Markt zu neh-men.
Energieminister unbeeindrucktSeit Jahresbeginn wickelt die Opec die-se historisch einmalige Produktions-kürzung ab und bringt schrittweise mehr Öl auf den Markt. Doch obwohl die Ölnachfrage Analysten zufolge das Vorkrisenniveau beinahe wieder er-reicht hat, halten die Opec-plus-Staa-ten weiterhin rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots zurück.
In den vergangenen Wochen hat-ten Verwerfungen am Gasmarkt sowie Knappheiten bei Kohle die Ölnachfra-ge zusätzlich verstärkt, weil Kraftwerke für die Stromproduktion von Gas oder Kohle auf Öl umschwenkten. Doch die Opec-Energieminister zeigten sich be-reits bei der vorangegangenen Sitzung Anfang Oktober davon unbeeindruckt. Im Vorfeld des November-Gipfeltref-fens hatten daher die USA den Druck auf die Allianz der Ölexportländer nochmals erhöht. Die USA fürchten, dass die Ölpreisrally die Inflation weiter anheizt und damit der Popularität von Präsident Biden weiter schadet.
Allerdings sind die Probleme teil-weise hausgemacht: Die US-Schiefer-ölindustrie, über Jahre der Hauptkon-
kurrent der Opec-Produzenten,kommt nicht in Gang. Die Zahl derneuen Bohrungen in den USA liegt Da-ten des Ölausrüsters Baker Hughes zu-folge bei 544. Sie sind ein Signal für dasWachstum des Ölangebots in denUSA. Zum Vergleich: Im Herbst 2018,als die US-Ölpreise auf einem ähnlichhohen Niveau notierten, waren es dop-pelt so viele aktive Bohrungen. Statt aufrasantes Wachstum fokussieren sichviele US-Ölproduzenten derzeit aufSchuldenabbau und Rendite für ihreInvestoren.
Allerdings blieben auch die Opec-Staaten zuletzt hinter ihren festgeleg-ten Produktionsquoten zurück. Datendes Analysehauses S&P Platts zufolgeproduzierten die 22 Mitgliedstaatender erweiterten Opec-plus-Allianz imSeptember durchschnittlich 40,7 Mil-lionen Barrel Öl pro Tag – das ent-spricht etwas mehr als 40 Prozent derglobalen Ölproduktion. Es sind jedochrund 500.000 Barrel pro Tag weniger,als der für September geltende Opec-Deal vorsah.
Das knappe Ölangebot hatte zu-sammen mit einer stetig wachsendenNachfrage die Ölpreisrally befeuert.Daher hatten auch andere wichtige Öl-importeure, etwa Indien, die Opec-Staaten aufgefordert, mehr zu pro-duzieren. Erst unmittelbar vor demOpec-Treffen hatte sich die Lage amÖlmarkt etwas entspannt: SteigendeLagerbestände in den USA drücktenden US-Ölpreis am Mittwoch zeitweiseum fünf Prozent unter die Marke von80 Dollar pro Fass. Offen ist nun, wiedie USA auf die Weigerung der Opec,reagieren: Helima Croft, Rohstoff-expertin bei RBC Capital Markets, hältes für möglich, dass US-Präsident Bi-den die strategische Reserve des Lan-des anzapft. Jakob Blume
Rohstoffpreise
Opec wird Ölproduktion nicht deutlich erhöhen
Die Ölpreis-Rally wird zum geopolitischen Streitfall. Die Opec ignoriert US-Forderungen und bleibt bei ihrer Förderpolitik.
Ölraffinerie: US-Präsident Biden könnte die strategischen Reserven
des Landes anzapfen.
dpa
Das war kein Triumph für die Kommunikation von
Zentralbanken.
Henry CookÖkonom bei MUFG über die Bank of England
4.11.20211.1.2020
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Deutscher Aktienindexin Punkten
16.063Pkt.
4.11.20211.1.2020
7.800
7.200
6.600
6.000
5.400
4.800
FTSE 100 Aktienindexin Punkten
7.280Pkt.
4.11.20211.1.2020
5.000
4.400
3.700
3.200
2.600
2.000
S&P 500 Aktienindexin Punkten
4.678Pkt.
4.11.20211.1.2020
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
BundesanleiheRendite in Prozent
-0,226%
4.11.20211.1.2020
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0
Staatsanleihe GroßbritannienRendite in Prozent
0,939%
4.11.20211.1.2020
2,2
1,8
1,4
1,0
0,6
0,2
Staatsanleihe USARendite in Prozent
1,54%
Quelle: Bloomberg
Laufzeit 10 Jahre
Laufzeit 10 Jahre
Laufzeit 10 Jahre
HANDELSBLATT
Unterschiedliche Entwicklung
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Finanzen
31
Andrea Cünnen, Carsten Volkery, Jan Mallien Frankfurt, London
Seit Monaten treibt kaum ein Thema die Finanzmärkte so sehr um wie die Frage, wann die großen Notenbanken ihre Geld-politik und den Märkten die so wichtige Liquidität entziehen. Vor allem die US-Notenbank (Fed) steht hier im Blick-
punkt. Zumindest einige Investoren fürchteten vor der geldpolitischen Sitzung der Zentralbank am Mittwoch, dass die Börsen in diesem Moment zumindest kurzzeitig abtauchen, wenn die Fed bei den Anleihekäufen auf die Bremse tritt.
Guido Barthels, Fondsmanager bei TBF Glo-bal Asset Management, drückte das so aus: „Es ist ein Effekt wie auf der Geisterbahn: Jeder weiß, was passiert, und erschrickt trotzdem.“ Am späten Mittwochabend hat jetzt die Fed die geldpolitische Wende eingeleitet, doch zunächst hat sich nie-mand erschreckt. Im Gegenteil: Die großen In-dizes S&P 500 und Dow Jones an der Wall Street, die schon seit Tagen wieder auf Rekordjagd sind, markierten neue Allzeithochs. Und der deutsche Leitindex Dax stellte am Donnerstag mit 16.064 Punkten erstmals seit Mitte August eine neue Bestmarke auf.
Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktstrate-gie bei der Baader Bank, erklärt das unter anderem damit, dass die Märkte jetzt Klarheit haben. Tat-sächlich hat die Fed mit Blick auf ihre Anleihekäu-fe wie erwartet einen recht deutlichen Fahrplan vorgelegt. Sie beginnt noch in diesem Monat da-mit, ihre monatlichen Anleihekäufe von bislang noch 120 Milliarden Dollar um 15 Milliarden Dol-lar zu reduzieren. Damit würde das Programm Mitte 2022 enden.
Fed gibt den Märkten KlarheitDass die Märkte selbst für sie letztlich unangeneh-me Entscheidungen wie einen Liquiditätsentzug besser verkraften als Unsicherheit, zeigt sich in Großbritannien. Die Bank of England hat ent-gegen den Erwartungen der Märkte die Leitzinsen am Donnerstag noch nicht erhöht, sondern auf ihrem historischen Tief von 0,1 Prozent belassen. Die Folge: Der britische Leitindex FTSE 100, der den anderen europäischen Börsen ohnehin seit Langem hinterherhinkt, gab kurz nach der Ent-scheidung der Bank of England ein halbes Prozent nach – drehte später aber ins Plus.
Großbritanniens Notenbankchef Andrew Bai-ley persönlich hatte die Erwartungen der Märkte geschürt, indem er vergangenen Monat sagte, die Bank müsse etwas gegen die steigende Inflation tun. Die Märkte preisten daraufhin einen ersten Zinsschritt auf 0,25 Prozent fest ein, die Renditen britischer Staatsanleihen waren vorab schon deut-lich gestiegen. Nun muss sich Bailey den Vorwurf gefallen lassen, die Märkte in die Irre geführt zu haben. „Das war kein Triumph für die Kommuni-kation von Zentralbanken“, sagt Henry Cook, Ökonom bei der japanischen Großbank MUFG. Die Märkte hätten nach den Äußerungen Baileys im vergangenen Monat eine Zinserhöhung erwar-tet. Die Notenbank habe aber vor der Sitzung kei-ne Anstalten gemacht, diese Erwartungen zu dämpfen. Unabhängig davon habe die Bank of England „wahrscheinlich richtig entschieden, an-gesichts der Abwärtsrisiken für die britische Wirt-schaft in den kommenden Monaten erst mal ab-zuwarten“.
Wirtschaftliche Unsicherheit Die Bank of England begründete ihre Zurückhal-tung vor allem mit der wirtschaftlichen Unsicher-heit in Großbritannien. Das Wachstum habe sich im dritten Quartal verlangsamt, heißt es. Die Lie-ferkettenengpässe wirkten dämpfend und auch der Konsum sei schwächer als noch im Sommer erwartet. Die Notenbank rechnet nun mit 1,2 Pro-zent Wachstum im laufenden Quartal. Die Ent-scheidung für eine Beibehaltung der Leitzinsen im geldpolitischen Ausschuss der Bank of England fiel mit sieben zu zwei Stimmen recht deutlich aus. Die Zentralbanker stellten allerdings Zins-erhöhungen „in den kommenden Monaten“ in
Zentralbankentscheidungen in Washington und London
Gegenläufige SignaleDie US-Notenbank leitet die geldpolitische Wende ein, die Bank of
England macht einen Rückzieher. Die Börsen reagieren überraschend: Die großen US-Indizes und der Dax steigen auf Rekordhochs.
Bank of England: Entgegen den Erwartungen der Märkte beließ sie am Donnerstag die Leitzinsen auf einem historischen Tief von 0,1 Prozent.
REU
TER
S, A
FP
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Finanzen
30
Aussicht. Die Inflationsprognose legt nahe, dass der Leitzins Ende 2022 bei einem Prozent liegen könnte.
Die konjunkturellen Sorgen überwogen bei den Notenbankern in London die Angst vor der Inflation. Die Teuerungsrate lag im September zwar mit 3,1 Prozent deutlich über dem langfris-tigen Zielwert von zwei Prozent. Die Bank of England erwartet, dass sie im November auf vier-einhalb Prozent steigen wird, im kommenden April sogar auf fünf Prozent.
Doch halten die Zentralbanker die hohe In-flation weiterhin für ein vorübergehendes Pro-blem. In der zweiten Jahreshälfte 2022 werde die Teuerungsrate wieder deutlich zurückgehen, heißt es im Bericht des geldpolitischen Ausschus-ses der Bank of England. Den langfristigen Ziel-wert von zwei Prozent soll sie der Prognose zu-folge jedoch erst Ende 2023 erreichen.
Auch Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass er den Inflationsanstieg nur für vorübergehend hält. Er rechne damit, dass die Inflation im zwei-ten oder dritten Quartal des kommenden Jahres wieder sinkt. „Wir schauen uns das genau an und werden unsere Politik dementsprechend ändern“, sagte er. Die Inflation in den USA war zuletzt im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 Prozent gestiegen. Nach Ansicht von Uwe Streich, Aktienstratege bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), waren es auch Powells Worte zur Infla-tion, die Investoren beruhigten und den Börsen Auftrieb gaben. „Es gab im Vorfeld Befürchtun-gen, dass die Fed ihre Wortwahl verändert und Inflationsrisiken nicht mehr als temporär bezeich-net“.
Ganz klar ist die Lage indes auch in den USA noch nicht. Die Meinungen darüber, ob die Fed die Leitzinsen schon Ende nächsten Jahres oder erst 2023 erhöht, gehen auseinander. Fed-Chef Powell selbst betonte, dass das wahrscheinliche Ende des Kaufprogramms im Sommer 2022 kei-nen Hinweis auf Zinsänderungen gebe. Für die Märkte ist nach Ansicht von Halver aber vor allem eines wichtig: „Die Fed geht homöopathisch vor, und die Leitzinsen werden die Inflationsrate noch lange nicht einholen.“ Zudem werde die Fed mit ihren Anleihekäufen ja auch im nächsten Jahr noch mehr Liquidität in die Finanzmärkte pum-pen.
EZB entscheidet im DezemberDas macht auch die Europäische Zentralbank. EZB-Chefin Christine Lagarde hatte jüngst er-neut versichert, dass die EZB noch sehr lange an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten will und sie eine Zinserhöhung in absehbarer Zeit für „sehr unwahrscheinlich“ hält. Vor einer Zinserhöhung müsste die EZB zudem wie die Fed erst einmal ihre Anleihekäufe beenden. Im Dezember will sie beschließen, wie es damit weitergehen soll.
Lagarde hat zwar signalisiert, dass das Pande-mie-Kaufprogramm PEPP Ende März auslaufen soll, über das die Notenbanken im Euro-Raum derzeit noch monatlich 80 Milliarden Euro an An-leihen kaufen. Parallel zu PEPP gibt es aber noch ein älteres Kaufprogramm mit dem Kürzel APP. Dieses beläuft sich aktuell auf 20 Milliarden Euro monatlich. Die meisten Experten erwarten, dass die Notenbank das APP-Programm auch über den März hinaus weiterlaufen lässt und eventuell zu-nächst noch aufstockt. Die Bank of England geht einen anderen Weg. Ihr insgesamt 895 Milliarden Pfund schweres Anleihekaufprogramm läuft im Dezember aus.
D ie Allianz der Ölexporteure Opec plus hat Forderungen nach einer höheren Ölproduktion ignoriert. Bei einem virtuellen Gipfeltreffen
am Donnerstag entschieden die Ener-gieminister der 23 Opec-plus-Mitglie-der um Saudi-Arabien und Russland, die Ölproduktion um 400.000 Barrel pro Tag anzuheben, wie die Opec mit-teilte. Das entspricht rund 0,4 Prozent der weltweiten Ölproduktion.
Eine Erhöhung des Angebots um 600.000 oder 800.000 Barrel pro Tag sei kein Thema gewesen, hieß es wei-ter. Die Ölpreise legten daraufhin zwi-schenzeitlich um rund 2,5 Prozent zu. Der Preis für europäisches Brent-Öl lag bei rund 83 Dollar pro Barrel (rund 159 Liter). Innerhalb von zwölf Monaten hat sich Öl in Europa um knapp 100 Prozent verteuert.
US-Präsident Joe Biden hatte die Opec am Rande seines Besuchs auf dem Weltklimagipfel in Glasgow für steigende Benzinpreise verantwortlich gemacht. Benzin und Diesel seien teu-rer „wegen der Weigerung von Russ-land oder der Opec, mehr Öl zu för-dern“. Wenige Tage zuvor hatte die US-Energieministerin Jennifer Gran-holm die Opec ein „Kartell“ genannt, eine Bezeichnung, die die Energiemi-nister der Opec gar nicht gerne hören.
Trotz des steigenden Drucks von außen bleibt die Opec-plus-Allianz bei ihrer konservativen Förderpolitik. In der Coronakrise war der Ölpreis ex-trem eingebrochen, auch weil sich Sau-di-Arabien und Russland kurzzeitig ei-nen Preiskampf lieferten. Um den Öl-preis zu stabilisieren, einigte sich die Allianz im Sommer 2020 darauf, zehn Prozent der weltweiten Ölproduktion auf einen Schlag vom Markt zu neh-men.
Energieminister unbeeindrucktSeit Jahresbeginn wickelt die Opec die-se historisch einmalige Produktions-kürzung ab und bringt schrittweise mehr Öl auf den Markt. Doch obwohl die Ölnachfrage Analysten zufolge das Vorkrisenniveau beinahe wieder er-reicht hat, halten die Opec-plus-Staa-ten weiterhin rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots zurück.
In den vergangenen Wochen hat-ten Verwerfungen am Gasmarkt sowie Knappheiten bei Kohle die Ölnachfra-ge zusätzlich verstärkt, weil Kraftwerke für die Stromproduktion von Gas oder Kohle auf Öl umschwenkten. Doch die Opec-Energieminister zeigten sich be-reits bei der vorangegangenen Sitzung Anfang Oktober davon unbeeindruckt. Im Vorfeld des November-Gipfeltref-fens hatten daher die USA den Druck auf die Allianz der Ölexportländer nochmals erhöht. Die USA fürchten, dass die Ölpreisrally die Inflation weiter anheizt und damit der Popularität von Präsident Biden weiter schadet.
Allerdings sind die Probleme teil-weise hausgemacht: Die US-Schiefer-ölindustrie, über Jahre der Hauptkon-
kurrent der Opec-Produzenten,kommt nicht in Gang. Die Zahl derneuen Bohrungen in den USA liegt Da-ten des Ölausrüsters Baker Hughes zu-folge bei 544. Sie sind ein Signal für dasWachstum des Ölangebots in denUSA. Zum Vergleich: Im Herbst 2018,als die US-Ölpreise auf einem ähnlichhohen Niveau notierten, waren es dop-pelt so viele aktive Bohrungen. Statt aufrasantes Wachstum fokussieren sichviele US-Ölproduzenten derzeit aufSchuldenabbau und Rendite für ihreInvestoren.
Allerdings blieben auch die Opec-Staaten zuletzt hinter ihren festgeleg-ten Produktionsquoten zurück. Datendes Analysehauses S&P Platts zufolgeproduzierten die 22 Mitgliedstaatender erweiterten Opec-plus-Allianz imSeptember durchschnittlich 40,7 Mil-lionen Barrel Öl pro Tag – das ent-spricht etwas mehr als 40 Prozent derglobalen Ölproduktion. Es sind jedochrund 500.000 Barrel pro Tag weniger,als der für September geltende Opec-Deal vorsah.
Das knappe Ölangebot hatte zu-sammen mit einer stetig wachsendenNachfrage die Ölpreisrally befeuert.Daher hatten auch andere wichtige Öl-importeure, etwa Indien, die Opec-Staaten aufgefordert, mehr zu pro-duzieren. Erst unmittelbar vor demOpec-Treffen hatte sich die Lage amÖlmarkt etwas entspannt: SteigendeLagerbestände in den USA drücktenden US-Ölpreis am Mittwoch zeitweiseum fünf Prozent unter die Marke von80 Dollar pro Fass. Offen ist nun, wiedie USA auf die Weigerung der Opec,reagieren: Helima Croft, Rohstoff-expertin bei RBC Capital Markets, hältes für möglich, dass US-Präsident Bi-den die strategische Reserve des Lan-des anzapft. Jakob Blume
Rohstoffpreise
Opec wird Ölproduktion nicht deutlich erhöhen
Die Ölpreis-Rally wird zum geopolitischen Streitfall. Die Opec ignoriert US-Forderungen und bleibt bei ihrer Förderpolitik.
Ölraffinerie: US-Präsident Biden könnte die strategischen Reserven
des Landes anzapfen.
dpa
Das war kein Triumph für die Kommunikation von
Zentralbanken.
Henry CookÖkonom bei MUFG über die Bank of England
4.11.20211.1.2020
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Deutscher Aktienindexin Punkten
16.063Pkt.
4.11.20211.1.2020
7.800
7.200
6.600
6.000
5.400
4.800
FTSE 100 Aktienindexin Punkten
7.280Pkt.
4.11.20211.1.2020
5.000
4.400
3.700
3.200
2.600
2.000
S&P 500 Aktienindexin Punkten
4.678Pkt.
4.11.20211.1.2020
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
BundesanleiheRendite in Prozent
-0,226%
4.11.20211.1.2020
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0
Staatsanleihe GroßbritannienRendite in Prozent
0,939%
4.11.20211.1.2020
2,2
1,8
1,4
1,0
0,6
0,2
Staatsanleihe USARendite in Prozent
1,54%
Quelle: Bloomberg
Laufzeit 10 Jahre
Laufzeit 10 Jahre
Laufzeit 10 Jahre
HANDELSBLATT
Unterschiedliche Entwicklung
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Finanzen
31
Andreas Kröner Frankfurt
Beim Umbau der Commerzbank ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Das Frankfurter Geldhaus ist im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zu-
rückgekehrt und rechnet nun auch im Gesamtjahr mit einem Gewinn. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2021 erreichen oder sogar übertreffen werden“, sagte Vorstands-chef Manfred Knof.
Bisher hatte die Commerzbank of-fengelassen, ob sie nach einem Verlust von 2,9 Milliarden Euro im vergange-nen Jahr 2021 in die Gewinnzone zu-rückkehren wird. Nach einem Über-schuss von 403 Millionen Euro im drit-ten Quartal, der deutlich höher ausfiel als von Analysten erwartet, ist das In-stitut nun jedoch optimistischer für das Gesamtjahr. Commerzbank-Aktien legten daraufhin am Donnerstag zeit-weise sieben Prozent auf 6,90 Euro zu und notierten damit so hoch wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Damals verhandelte das Geldhaus noch über ei-ne Fusion mit der Deutschen Bank, die letztendlich aber nicht zustande kam.
Im Tagesverlauf gab die Commerz-bank-Aktie einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Investoren sind jedoch zu-versichtlich, dass für das Institut unter dem seit Jahresanfang amtierenden Vorstandschef Knof nun langsam wie-der bessere Zeiten anbrechen. „Nach Jahren des Stillstands habe ich den Ein-druck, dass sich die Commerzbank jetzt entschlossen in die richtige Rich-tung bewegt“, sagt Fondsmanager An-dreas Thomae von der Deka. „Die Er-gebnisse und die steigenden Zins-erwartungen sind ermutigend.“
Aus Sicht von Thomae steigt da-durch die Wahrscheinlichkeit, dass die Commerzbank 2024 wie angepeilt ei-
ne Eigenkapitalrendite von sieben Pro-zent erreichen wird. Bisher trauten Analysten dem Institut im Schnitt nur eine Rendite von 5,1 Prozent zu.
Im zweiten Quartal hatte die Com-merzbank noch einen Verlust von 527 Millionen Euro geschrieben – unter an-derem wegen hoher Restrukturierungs-kosten. Das Institut will bis 2024 welt-weit 10.000 Stellen streichen und in Deutschland 340 Filialen dichtmachen. Mehr als die Hälfte des Stellenabbaus habe die Bank bereits sozialverträglich geregelt, sagte Knof. Zudem werde sich das Management in den nächsten Ta-gen oder Wochen mit dem Betriebsrat auf den Abschluss von Teilinteressen-ausgleichen verständigen, in denen die Details des Umbaus für die einzelnen Segmente geregelt werden.
Knof will nicht nachlassen Im dritten Quartal profitierte die Com-merzbank davon, dass Kreditausfälle infolge der Coronakrise bisher weniger stark zu Buche schlugen als befürchtet. Die Risikovorsorge ging um mehr als 90 Prozent auf 22 Millionen Euro zu-rück. Die Commerzbank rechnet 2021 nun mit einer Risikovorsorge von we-niger als 700 Millionen Euro, nach 1,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Zudem verbuchte die Bank von Juli bis Ende September nur noch Restruktu-rierungsaufwendungen von 76 Millio-nen Euro, nach 201 Millionen im Vor-jahresquartal. Damit hat das Institut den Großteil der Gesamtkosten für den Konzernumbau von gut zwei Mil-liarden Euro inzwischen verdaut.
Knof will bei seinen Sanierungs-bemühungen nicht nachlassen und die Kosten bis 2024 auf 5,3 Milliarden Euro drücken. Ein Vorgehen wie bei der Deutschen Bank, die ihr absolutes Kostenziel kassiert hat und sich nun nur noch auf das Verhältnis von Kosten
zu Erträgen (Cost-Income-Ratio) kon-zentrieren will, kommt für den Vor-standschef der Commerzbank nicht in-frage. „Wir bleiben bei absoluten Kos-tenzielen“, betonte Knof. „Ein Aufweichen auf Cost-Income-Ratio“ werde es mit ihm nicht geben.
Rückenwind verleihen könnten der Bank steigende Zinsen. Bei der Verab-schiedung ihrer Strategie im Februar war das Geldhaus von konstant nied-rigen Zinsen in der Euro-Zone ausge-gangen. Sollten die Zinsen wie aktuell am Markt erwartet ansteigen, würde dies der Commerzbank 2024 jedoch Mehreinnahmen von über 200 Millio-nen Euro bescheren, sagte Finanzche-fin Bettina Orlopp.
Sie machte den Aktionären zudem Hoffnung, dass die Bank schon für das Geschäftsjahr 2022 wieder eine Divi-dende bezahlen könnte. Das wäre ein Jahr früher als bisher geplant. Das Ma-nagement wolle jedoch erst den Ver-lauf des nächsten Jahres abwarten und werde dann Anfang 2023 über eine Ausschüttung diskutieren, so Orlopp.
Die Deka würde sich „über eine kleine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 freuen, auch wenn diese vermut-lich nur fünf oder zehn Cent betragen würde“, sagt Fondsmanager Thomae. „Das wäre eine positive Überraschung.“ Allerdings weist Thomae auch darauf hin, dass andere europäische Großban-ken schon deutlich weiter sind. „Dort erhalten Investoren bereits heute wie-der eine Dividendenrendite von sechs bis sieben Prozent.“
Auch beim Umbau der Commerz-bank sieht Thomae noch große Unsi-cherheitsfaktoren, beispielsweise die künftige Ertragsentwicklung und die Rechtsrisiken bei der polnischen Toch-ter mBank. Die Prognose der Com-merzbank für 2021 basiert darauf, dass es „keine substanziellen Veränderun-
gen“ bei einem 2,4 Milliarden Euro großen Kreditportfolio der mBank in Schweizer Franken gibt.
Aufgrund niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Fran-ken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Häuslebauer stie-gen. Viele Kreditnehmer gingen da-raufhin wegen möglicherweise un-rechtmäßiger Klauseln gegen polnische Geldhäuser vor. Allein gegen die mBank gibt es mehr als 10.000 Klagen. Das Geldhaus hat seine Risikovorsorge deshalb im dritten Quartal um weitere 95 Millionen Euro aufgestockt.
mBank strebt Vergleiche an Nachdem eine Entscheidung des obersten polnischen Gerichtshofs über das Thema mehrfach vertagt worden war, legte die polnische Finanzaufsicht KNF den Geldhäusern kürzlich nahe, außergerichtliche Vergleiche mit ihren Kunden anzustreben. Die mBank sei offen für alle Lösungen, sagte Com-merzbank-Finanzchefin Orlopp. „Wir wollen diese Saga beenden, aber es muss ein vernünftiges Ende sein.“ Es müssten bindende Vergleiche gefun-den werden, die alle Kunden akzeptie-ren könnten und mit denen die Ge-richtsverfahren beendet würden.
mBank-Chef Cezary Stypulkowski hatte am Dienstag angekündigt, das In-stitut wolle den ersten Kunden bald Vergleiche anbieten. Zudem sagte er, er rechne nicht damit, dass die Com-merzbank ihre Mehrheitsbeteiligung von 69,3 Prozent an der mBank in na-her Zukunft verkaufe. Laut Knof gibt es zu dem Thema „nichts Neues“ zu sagen. „Die mBank ist Teil der Com-merzbank und insofern arbeiten wir auch mit ihr zusammen.“
Konzernumbau
Commerzbank macht FortschritteNach einem überraschend starken dritten Quartal rechnet Deutschlands zweitgrößte Privatbank
nun auch im Gesamtjahr mit schwarzen Zahlen. Sorgen bereitet aber die polnische Tochter mBank.
Commerzbank-Zentrale in Frankfurt: Das Institut könne früher Dividenden zahlen als
ursprünglich geplant.
ulls
tein
bild
- U
nkel
Nach Jahren des Still-
stands habe ich den
Eindruck, dass sich die Commerz-bank jetzt
entschlossen in die richtige
Richtung bewegt.
Andreas Thomae Fondsmanager bei
der Deka
Finanzen
32 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D er Frontalangriff auf den Insol-venzverwalter der UDI-Gruppe ist 15 Seiten lang. Anlegeranwalt Wolfgang Schirp fordert in dem
Schreiben das Amtsgericht in Leipzig auf, Insolvenzverwalter Jürgen Wallner aus dem Amt zu entlassen. Schirps Kanzlei vertritt einige UDI-Anleger.
Diesen Freitag beginnen die Gläu-bigerversammlungen der acht insolven-ten UDI-Festzins-Gesellschaften, bei denen Wallner abgelöst werden könnte. Der Dresdner sei nicht unabhängig, kri-tisiert Schirp, er habe Pflichten verletzt und das „grundlegende Vertrauen“ zer-stört. Insolvenzverwalter Wallner wollte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Er sagte: „Die ersten Gläubiger-versammlungen sind das Forum, in dem die Gläubiger umfassend über den Ver-fahrensstand informiert werden.“ Das Amtsgericht in Leipzig äußerte sich ebenfalls nicht.
Bei dem Öko-Investmenthaus aus Nürnberg stehen geschätzt bis zu 100 Millionen Euro im Feuer. Das Geld soll-te in Biomasse-, Sonnen- und Wind-energie investiert werden. Anfang 2021 eskalierte bei UDI die Finanzkrise. Auf-grund mutmaßlich unwirksamer Ver-tragsklauseln ordnete die Finanzaufsicht Bafin die Rückabwicklung der Darlehen an. Mehrere UDI-Gesellschaften kipp-ten um. Nun geht es darum, wie eine möglichst hohe Quote für die Gläubiger erzielt werden kann.
Für Anlegeranwalt Schirp ist das Projekt „Matterhorn“ kurz vor der In-solvenz der zentrale Kritikpunkt. Die Restrukturierung und das vorläufige In-solvenzverfahren in Eigenverwaltung stünden im Widerspruch zur Anord-nung der Finanzaufsicht.
Bafin-Anordnung ignoriertWallner habe jedoch in einem Zwi-schenbericht die Auffassung vertreten, es gebe keine Gründe, von der Eigen-verwaltung abzusehen, schreibt Schirp. Die Anordnung der Bafin zu ignorieren sei strafbar, die Position des Sachwalters „schlechthin unvertretbar“ und „gravie-rende Pflichtverletzung“.
Am 22. Juni schickte die Bafin einen Brandbrief an das Gericht. Die Anord-nung einer Eigenverwaltung verstoße gegen das Kreditwesengesetz. Es gelte, „den gesetzeswidrigen Zustand“ nicht fortzusetzen. Die Schuldnerin habe ge-zeigt, „dass sie nicht bereit ist, ihre Ge-schäftsführung im Interesse der Gläu-biger auszurichten“. Erst danach nahm Langnickel die Anträge auf Eigenver-waltung zurück und beantragte Regel -insolvenzen. Den Sachwalter Wallner behielt das Gericht im Amt, nun als re-gulären Insolvenzverwalter.
Schirp: „Während eines Zeitraums von mehr als drei Monaten waren zuvor die Geschäfte entgegen der Anordnung der Bafin und mit Duldung des Sachwal-ters durch die Schuldnerin weitergeführt worden.“ Weder Langnickel noch Wall-ner äußerten sich dazu.
Im Vorfeld der Gläubigerversamm-lungen erhielten Anleger Post von Wall-ner. Er nannte zwei Anwälte, die für die Gläubigerversammlung mandatiert werden könnten. Schirp ist überzeugt, Wallner habe gegen „standesrechtliche und wettbewerbsrechtliche Vorschrif-ten“ verstoßen.
Was ihm besonders aufstieß: Einer der empfohlenen Anwälte ist der Anle-
geranwalt Peter Mattil. Der Münchener zog früh in den vorläufigen Gläubigerausschuss ein. Im Mai unterschrieb er eine Erklärung, den Sachwalter Wallner und die Eigenverwaltung bei UDI zu befürworten. Schirp argwöhnt: Wallner schustere Mattil nun Mandate zu.
Wallner äußerte sich nicht. Mattil versicherte, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Über Interna könne er nicht berichten.
Bei all dem Gerangel scheint der Privatan-leger nur eine Nebenrolle zu spielen. Er hat oh-nehin schlechte Karten. Bei der UDI Festzins
VIII hat der Insolvenzverwalter eine freie Masse von 1,3 Millionen Euro lokalisiert. Dem gegen-über stehen Verbindlichkeiten von fast neun Millionen Euro. Bei den anderen UDI-Gesell-schaften soll es ähnlich trist aussehen. F. Holter-mann, L.-M. Nagel, M. Verfürden
Öko-Investment
Attacke gegen den UDI-InsolvenzverwalterIn Leipzig beginnen die Gläubigerversammlungen der Gruppe. Für Anleger wird es wohl wenig gute Nachrichten geben.
Finanzen
33WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Andreas Kröner Frankfurt
Beim Umbau der Commerzbank ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Das Frankfurter Geldhaus ist im dritten Quartal in die schwarzen Zahlen zu-
rückgekehrt und rechnet nun auch im Gesamtjahr mit einem Gewinn. „Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2021 erreichen oder sogar übertreffen werden“, sagte Vorstands-chef Manfred Knof.
Bisher hatte die Commerzbank of-fengelassen, ob sie nach einem Verlust von 2,9 Milliarden Euro im vergange-nen Jahr 2021 in die Gewinnzone zu-rückkehren wird. Nach einem Über-schuss von 403 Millionen Euro im drit-ten Quartal, der deutlich höher ausfiel als von Analysten erwartet, ist das In-stitut nun jedoch optimistischer für das Gesamtjahr. Commerzbank-Aktien legten daraufhin am Donnerstag zeit-weise sieben Prozent auf 6,90 Euro zu und notierten damit so hoch wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr. Damals verhandelte das Geldhaus noch über ei-ne Fusion mit der Deutschen Bank, die letztendlich aber nicht zustande kam.
Im Tagesverlauf gab die Commerz-bank-Aktie einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Investoren sind jedoch zu-versichtlich, dass für das Institut unter dem seit Jahresanfang amtierenden Vorstandschef Knof nun langsam wie-der bessere Zeiten anbrechen. „Nach Jahren des Stillstands habe ich den Ein-druck, dass sich die Commerzbank jetzt entschlossen in die richtige Rich-tung bewegt“, sagt Fondsmanager An-dreas Thomae von der Deka. „Die Er-gebnisse und die steigenden Zins-erwartungen sind ermutigend.“
Aus Sicht von Thomae steigt da-durch die Wahrscheinlichkeit, dass die Commerzbank 2024 wie angepeilt ei-
ne Eigenkapitalrendite von sieben Pro-zent erreichen wird. Bisher trauten Analysten dem Institut im Schnitt nur eine Rendite von 5,1 Prozent zu.
Im zweiten Quartal hatte die Com-merzbank noch einen Verlust von 527 Millionen Euro geschrieben – unter an-derem wegen hoher Restrukturierungs-kosten. Das Institut will bis 2024 welt-weit 10.000 Stellen streichen und in Deutschland 340 Filialen dichtmachen. Mehr als die Hälfte des Stellenabbaus habe die Bank bereits sozialverträglich geregelt, sagte Knof. Zudem werde sich das Management in den nächsten Ta-gen oder Wochen mit dem Betriebsrat auf den Abschluss von Teilinteressen-ausgleichen verständigen, in denen die Details des Umbaus für die einzelnen Segmente geregelt werden.
Knof will nicht nachlassen Im dritten Quartal profitierte die Com-merzbank davon, dass Kreditausfälle infolge der Coronakrise bisher weniger stark zu Buche schlugen als befürchtet. Die Risikovorsorge ging um mehr als 90 Prozent auf 22 Millionen Euro zu-rück. Die Commerzbank rechnet 2021 nun mit einer Risikovorsorge von we-niger als 700 Millionen Euro, nach 1,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Zudem verbuchte die Bank von Juli bis Ende September nur noch Restruktu-rierungsaufwendungen von 76 Millio-nen Euro, nach 201 Millionen im Vor-jahresquartal. Damit hat das Institut den Großteil der Gesamtkosten für den Konzernumbau von gut zwei Mil-liarden Euro inzwischen verdaut.
Knof will bei seinen Sanierungs-bemühungen nicht nachlassen und die Kosten bis 2024 auf 5,3 Milliarden Euro drücken. Ein Vorgehen wie bei der Deutschen Bank, die ihr absolutes Kostenziel kassiert hat und sich nun nur noch auf das Verhältnis von Kosten
zu Erträgen (Cost-Income-Ratio) kon-zentrieren will, kommt für den Vor-standschef der Commerzbank nicht in-frage. „Wir bleiben bei absoluten Kos-tenzielen“, betonte Knof. „Ein Aufweichen auf Cost-Income-Ratio“ werde es mit ihm nicht geben.
Rückenwind verleihen könnten der Bank steigende Zinsen. Bei der Verab-schiedung ihrer Strategie im Februar war das Geldhaus von konstant nied-rigen Zinsen in der Euro-Zone ausge-gangen. Sollten die Zinsen wie aktuell am Markt erwartet ansteigen, würde dies der Commerzbank 2024 jedoch Mehreinnahmen von über 200 Millio-nen Euro bescheren, sagte Finanzche-fin Bettina Orlopp.
Sie machte den Aktionären zudem Hoffnung, dass die Bank schon für das Geschäftsjahr 2022 wieder eine Divi-dende bezahlen könnte. Das wäre ein Jahr früher als bisher geplant. Das Ma-nagement wolle jedoch erst den Ver-lauf des nächsten Jahres abwarten und werde dann Anfang 2023 über eine Ausschüttung diskutieren, so Orlopp.
Die Deka würde sich „über eine kleine Dividende für das Geschäftsjahr 2022 freuen, auch wenn diese vermut-lich nur fünf oder zehn Cent betragen würde“, sagt Fondsmanager Thomae. „Das wäre eine positive Überraschung.“ Allerdings weist Thomae auch darauf hin, dass andere europäische Großban-ken schon deutlich weiter sind. „Dort erhalten Investoren bereits heute wie-der eine Dividendenrendite von sechs bis sieben Prozent.“
Auch beim Umbau der Commerz-bank sieht Thomae noch große Unsi-cherheitsfaktoren, beispielsweise die künftige Ertragsentwicklung und die Rechtsrisiken bei der polnischen Toch-ter mBank. Die Prognose der Com-merzbank für 2021 basiert darauf, dass es „keine substanziellen Veränderun-
gen“ bei einem 2,4 Milliarden Euro großen Kreditportfolio der mBank in Schweizer Franken gibt.
Aufgrund niedriger Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Fran-ken-Kredite aufgenommen, um ihr Haus zu finanzieren. Dann verlor die Landeswährung Zloty gegenüber dem Franken stark an Wert, wodurch die Belastungen für die Häuslebauer stie-gen. Viele Kreditnehmer gingen da-raufhin wegen möglicherweise un-rechtmäßiger Klauseln gegen polnische Geldhäuser vor. Allein gegen die mBank gibt es mehr als 10.000 Klagen. Das Geldhaus hat seine Risikovorsorge deshalb im dritten Quartal um weitere 95 Millionen Euro aufgestockt.
mBank strebt Vergleiche an Nachdem eine Entscheidung des obersten polnischen Gerichtshofs über das Thema mehrfach vertagt worden war, legte die polnische Finanzaufsicht KNF den Geldhäusern kürzlich nahe, außergerichtliche Vergleiche mit ihren Kunden anzustreben. Die mBank sei offen für alle Lösungen, sagte Com-merzbank-Finanzchefin Orlopp. „Wir wollen diese Saga beenden, aber es muss ein vernünftiges Ende sein.“ Es müssten bindende Vergleiche gefun-den werden, die alle Kunden akzeptie-ren könnten und mit denen die Ge-richtsverfahren beendet würden.
mBank-Chef Cezary Stypulkowski hatte am Dienstag angekündigt, das In-stitut wolle den ersten Kunden bald Vergleiche anbieten. Zudem sagte er, er rechne nicht damit, dass die Com-merzbank ihre Mehrheitsbeteiligung von 69,3 Prozent an der mBank in na-her Zukunft verkaufe. Laut Knof gibt es zu dem Thema „nichts Neues“ zu sagen. „Die mBank ist Teil der Com-merzbank und insofern arbeiten wir auch mit ihr zusammen.“
Konzernumbau
Commerzbank macht FortschritteNach einem überraschend starken dritten Quartal rechnet Deutschlands zweitgrößte Privatbank
nun auch im Gesamtjahr mit schwarzen Zahlen. Sorgen bereitet aber die polnische Tochter mBank.
Commerzbank-Zentrale in Frankfurt: Das Institut könne früher Dividenden zahlen als
ursprünglich geplant.
ulls
tein
bild
- U
nkel
Nach Jahren des Still-
stands habe ich den
Eindruck, dass sich die Commerz-bank jetzt
entschlossen in die richtige
Richtung bewegt.
Andreas Thomae Fondsmanager bei
der Deka
Finanzen
32 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D er Frontalangriff auf den Insol-venzverwalter der UDI-Gruppe ist 15 Seiten lang. Anlegeranwalt Wolfgang Schirp fordert in dem
Schreiben das Amtsgericht in Leipzig auf, Insolvenzverwalter Jürgen Wallner aus dem Amt zu entlassen. Schirps Kanzlei vertritt einige UDI-Anleger.
Diesen Freitag beginnen die Gläu-bigerversammlungen der acht insolven-ten UDI-Festzins-Gesellschaften, bei denen Wallner abgelöst werden könnte. Der Dresdner sei nicht unabhängig, kri-tisiert Schirp, er habe Pflichten verletzt und das „grundlegende Vertrauen“ zer-stört. Insolvenzverwalter Wallner wollte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Er sagte: „Die ersten Gläubiger-versammlungen sind das Forum, in dem die Gläubiger umfassend über den Ver-fahrensstand informiert werden.“ Das Amtsgericht in Leipzig äußerte sich ebenfalls nicht.
Bei dem Öko-Investmenthaus aus Nürnberg stehen geschätzt bis zu 100 Millionen Euro im Feuer. Das Geld soll-te in Biomasse-, Sonnen- und Wind-energie investiert werden. Anfang 2021 eskalierte bei UDI die Finanzkrise. Auf-grund mutmaßlich unwirksamer Ver-tragsklauseln ordnete die Finanzaufsicht Bafin die Rückabwicklung der Darlehen an. Mehrere UDI-Gesellschaften kipp-ten um. Nun geht es darum, wie eine möglichst hohe Quote für die Gläubiger erzielt werden kann.
Für Anlegeranwalt Schirp ist das Projekt „Matterhorn“ kurz vor der In-solvenz der zentrale Kritikpunkt. Die Restrukturierung und das vorläufige In-solvenzverfahren in Eigenverwaltung stünden im Widerspruch zur Anord-nung der Finanzaufsicht.
Bafin-Anordnung ignoriertWallner habe jedoch in einem Zwi-schenbericht die Auffassung vertreten, es gebe keine Gründe, von der Eigen-verwaltung abzusehen, schreibt Schirp. Die Anordnung der Bafin zu ignorieren sei strafbar, die Position des Sachwalters „schlechthin unvertretbar“ und „gravie-rende Pflichtverletzung“.
Am 22. Juni schickte die Bafin einen Brandbrief an das Gericht. Die Anord-nung einer Eigenverwaltung verstoße gegen das Kreditwesengesetz. Es gelte, „den gesetzeswidrigen Zustand“ nicht fortzusetzen. Die Schuldnerin habe ge-zeigt, „dass sie nicht bereit ist, ihre Ge-schäftsführung im Interesse der Gläu-biger auszurichten“. Erst danach nahm Langnickel die Anträge auf Eigenver-waltung zurück und beantragte Regel -insolvenzen. Den Sachwalter Wallner behielt das Gericht im Amt, nun als re-gulären Insolvenzverwalter.
Schirp: „Während eines Zeitraums von mehr als drei Monaten waren zuvor die Geschäfte entgegen der Anordnung der Bafin und mit Duldung des Sachwal-ters durch die Schuldnerin weitergeführt worden.“ Weder Langnickel noch Wall-ner äußerten sich dazu.
Im Vorfeld der Gläubigerversamm-lungen erhielten Anleger Post von Wall-ner. Er nannte zwei Anwälte, die für die Gläubigerversammlung mandatiert werden könnten. Schirp ist überzeugt, Wallner habe gegen „standesrechtliche und wettbewerbsrechtliche Vorschrif-ten“ verstoßen.
Was ihm besonders aufstieß: Einer der empfohlenen Anwälte ist der Anle-
geranwalt Peter Mattil. Der Münchener zog früh in den vorläufigen Gläubigerausschuss ein. Im Mai unterschrieb er eine Erklärung, den Sachwalter Wallner und die Eigenverwaltung bei UDI zu befürworten. Schirp argwöhnt: Wallner schustere Mattil nun Mandate zu.
Wallner äußerte sich nicht. Mattil versicherte, seine Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen. Über Interna könne er nicht berichten.
Bei all dem Gerangel scheint der Privatan-leger nur eine Nebenrolle zu spielen. Er hat oh-nehin schlechte Karten. Bei der UDI Festzins
VIII hat der Insolvenzverwalter eine freie Masse von 1,3 Millionen Euro lokalisiert. Dem gegen-über stehen Verbindlichkeiten von fast neun Millionen Euro. Bei den anderen UDI-Gesell-schaften soll es ähnlich trist aussehen. F. Holter-mann, L.-M. Nagel, M. Verfürden
Öko-Investment
Attacke gegen den UDI-InsolvenzverwalterIn Leipzig beginnen die Gläubigerversammlungen der Gruppe. Für Anleger wird es wohl wenig gute Nachrichten geben.
Finanzen
33WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Jakob Blume Zürich
Es war eine sorgfältig austarierte Choreografie, mit der die Credit Suisse am Donnerstag ihre neue Strategie vor Investoren präsen-tierte: Verwaltungsratspräsident
António Horta-Osório durfte 15 Minu-ten lang seine Zukunftsvision für die Bank darlegen. Im Anschluss präsen-tierte Vorstandschef Thomas Gottstein 30 Minuten lang die Details der Stra-tegie. So sollte der Eindruck der letzten Monate zerstreut werden, wonach sich Horta-Osório stark ins operative Ge-schäft einmischt und als eine Art Schat-ten-CEO agiert.
Horta-Osório machte deutlich: Der radikale Umbruch bleibt trotz der an-haltenden Skandalserie aus: Er sieht die Credit Suisse weiter als Universalbank: „Wir verstärken unser integriertes Mo-dell“, sagte er. Nach dem Vorbild des Lokalrivalen UBS will die Bank ihre bislang regional organisierte Ver-mögensverwaltung zu einer zentralen Einheit zusammenfassen.
Keine drastischen EinschnitteDas Investmentbanking bleibt jedoch von drastischen Einschnitten ver-schont. Auch einer Abspaltung des Ge-schäfts mit professionellen Kunden (Asset-Management) erteilte Horta-Osório eine Absage. Ein personeller Neuanfang an der Spitze der Bank ist ebenfalls kein Thema: Thomas Gott-stein bleibt auch unter der neuen Stra-tegie Chef der Credit Suisse.
Allerdings wolle die Bank weniger Risiken eingehen. Mit Blick auf Verlus-
te aus dem Zusammenbruch des Hedge fonds Archegos sowie der mit dem Fintech Greensill betriebenen Fonds sagte der Verwaltungsratschef: „Zahl und Ausmaß der Vorfälle sind nicht akzeptabel.“
Auch Vorstandschef Gottstein zeigte sich einsichtig: „Wir haben erns-te Lektionen gelernt.“ Er strebe einen Kulturwandel an: „Im Herzen sind wir alle Risikomanager“, beteuerte der langjährige Investmentbanker.
Ins Zentrum stellt die Bank künftig das Geschäft mit reichen und ver-mögenden Kunden: Das neu formierte Wealth-Management soll bis zum Jahr 2024 1,1 Billionen Schweizer Franken (eine Billion Euro) verwalten – das wä-
re ein Anstieg um 200 Milliarden Fran-ken innerhalb von drei Jahren. So soll der wichtigste Geschäftsbereich der Bank eine Milliarde Franken zusätzlich an Erträgen abwerfen. Zudem will sich das Institut aus zehn Märkten zurück-ziehen, die als Nicht-Kernmärkte an-gesehen werden. Dazu zählen Staaten in Subsahara Afrika.
Zu Personalien gab die Bank vor-erst nichts bekannt. Das Global Wealth -Management soll einen um 25 Prozent gestiegenen Anteil am zuge-wiesenen Eigenkapital erhalten und da-durch wachsen können. Das Kapital soll von der Investmentbank abgezogen werden. In den nächsten Jahren will die Credit Suisse zudem 500 Kundenbera-
ter einstellen, um das Geschäft mit Rei-chen und Superreichen auszubauen.
Auch der Investmentbank werden regionale Einheiten am schweizeri-schen Heimatmarkt und in Asien zu-geschlagen. Aus dem sogenannten Pri-me Brokerage, dem Handelsgeschäft mit Hedgefonds, will die Bank kom-plett aussteigen. Der Bereich war für den fünf Milliarden Franken schweren Verlust beim Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos verantwortlich.
Ebenso wie die UBS will die Credit Suisse eine kapitalschonende Strategie im Investmentbanking einschlagen, mit einem Fokus auf Beratung bei Fu-sionen und Übernahmen. Die Füh-rungspositionen bei riskanteren Anlei-heprodukten will die Bank jedoch nicht aufgeben. Dafür soll der Bestand von komplexen Finanzderivaten abgebaut werden, der viel Kapital bindet.
Die Umstrukturierung geht mit ei-ner deutlichen Machtverschiebung ein-her: Die Schweizer Bank unter Führung von André Helfenstein wird gemessen am Nettoertrag auf vergleichbarer Basis halbiert. Die eigenständige Asien-Di-vision unter Herman Sitohang wird zerschlagen. Die Vermögensverwal-tung wächst um das 2,6-Fache, gemes-sen am Nettoertrag. Gleichzeitig sollen die Regionalgesellschaften jedoch auf-gewertet werden.
Weitere WachstumschancenIm Asset-Management sieht Verwal-tungsratschef Horta-Osório ebenfalls „klare Wachstumsmöglichkeiten“. Mit rund 470 Milliarden Franken verwal-tetem Vermögen gilt die Sparte als ver-gleichsweise klein. Interessenten stün-den bereit, ist im Markt zu hören. Doch die Sparte steht nicht zum Verkauf. Das Asset-Management ist derzeit noch mit der Bewältigung der Greensill-Krise be-schäftigt. Die professionellen Kunden des Geldhauses bangen um mehr als zwei Milliarden Dollar.
Horta-Osório unterstrich: „Die heute bekannt gegebenen Maßnahmen bilden den Rahmen für eine deutlich stärkere, kundenorientiertere Bank mit führenden Geschäftsbereichen und re-gionalen Angeboten.“ Er hatte die Stra-tegie seit seinem Amtsantritt im Mai ausgearbeitet.
Viele Analysten zeigten sich jedoch enttäuscht, dass der große Umbruch ausbleibt. So bezeichnete Andreas Venditti, Analyst bei Vontobel, die neue Strategie als „Evolution statt dem großen Knall“. Sie wirke auf den ersten Blick wie eine Rückkehr zur Ausrich-tung der Bank im Jahr 2015, vor dem Amtsantritt des umstrittenen Ex-Chefs Tidjane Thiam. Die Strukturen könnten zwar relativ schnell verändert werden, sagte Venditti. Doch er fügt hinzu: „Vertrauen und Reputation wie-derherzustellen“ werde Jahre bean-spruchen.
Das Kerngeschäft der Credit Suisse wächst derweil trotz aller Krisen weiter an: Wie die Bank am Donnerstag eben-falls bekannt gab, nahm sie im dritten Quartal rund 5,4 Milliarden Franken ein, rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Vorsteuergewinn stieg um 26 Prozent auf rund eine Milliarde Franken. Unter dem Strich blieben je-doch lediglich 434 Millionen Franken Reingewinn übrig, ein Rückgang um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahres-zeitraum.
Zudem stellte die Credit Suisse ih-ren Aktionären einen Verlust im vier-ten Quartal in Aussicht: Im Zuge der Umstrukturierungen muss die Bank 1,6 Milliarden Franken abschreiben. Der Kampf mit den Altlasten ist für die Bank noch lange nicht beendet.
Credit Suisse
Die Reichen sollen künftig das Geld bringen
Neue Struktur, neue Strategie: Die Credit Suisse will künftig das Erfolgskonzept der UBS kopieren. Der personelle Neuanfang bleibt vorerst aus.
Credit Suisse: Es gilt, die anhaltende
Skandalserie zu durchbrechen.
Blo
ombe
rg
Kennzahlen für Jan. bis Sept.
Vorsteuerergebnisin Mrd. Schweizer Franken
Eigenkapitalrenditein Prozent
2020 2021 2020 2021
2020 2021 2020 2021
Credit Suisse
Credit Suisse
-17 %
UBS
UBS
+34 %
3,65,8
1,1
7,1
8,8 %11,5 %
1,3 %
13,8 %
Quellen: Bloomberg, UnternehmenHANDELSBLATT
Schweizer Banken im Vergleich
4.11.1.1.2021
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
Aktienkurs: Prozentuale Veränderung in Prozent
Vorstandschef Thomas Gottstein: Er präsentierte die Details der neuen
Strategie.
EPA
-EFE
/Shu
tter
stoc
Finanzen
34 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D ie Frankfurter Deka hat sich mit ihren Mitarbeitervertretungen auf verbindliche Regeln für das Ar-beiten im Homeoffice geeinigt.
Die ab sofort gültige Vereinbarung er-möglicht es den Beschäftigten des Fondsanbieters der Sparkassen, bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit pro Wo-che von daheim aus oder von einem anderen Ort innerhalb Deutschlands zu arbeiten.
Über diese Regeln hat die Deka ihre Mitarbeiter in dieser Woche informiert. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Abmachung. Neben der mobilen Arbeitsausstattung mit Notebook und Computertelefonie sollen die Deka-Mitarbeiter noch in diesem Jahr eine finanzielle Unterstützung für die Aus-stattung ihres Heimarbeitsplatzes von 1000 Euro bekommen.
Die Coronapandemie hat auch bei Banken das mobile Arbeiten auf breiter Front salonfähig gemacht. In vielen Geldhäusern hat dies eine Debatte da-rüber ausgelöst, wie flexibel nach der Pandemie gearbeitet werden soll – und ob die Banken ihren Mitarbeitern ne-ben der technischen Ausstattung auch eine Aufwandsentschädigung zahlen
sollen. Die Vereinbarung bei der Deka sieht ähnlich aus wie beim deutschen Ableger der niederländischen Groß-bank ING und der Deutschen Bank, die sich Ende Oktober mit ihren Mit-arbeitern auf verbindliche Homeoffice-Regeln geeinigt hat.
Allerdings werden die 1000 Euro bei der Deka erst einmal als Einmal-zahlung fließen, während die Deutsche Bank die Unterstützung alle fünf Jahre bezahlen will.
Dafür gilt die Deka-Vereinbarung quasi für alle rund 4300 in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter. Bei der Deutschen Bank sind erhebliche Teile der Belegschaft momentan von der Ei-nigung mit dem Gesamtbetriebsrat ausgeschlossen. Das gilt nicht nur für Bereiche, die aus regulatorischen Gründen und aufgrund der Art der Tä-tigkeit nicht teilnehmen können wie der Handel oder der Servicebereich der Filialen, sondern vorerst auch für viele
ehemalige Postbank-Betriebe derDeutschen Bank AG.
Den Gewerkschaften gehen dieAngebote vieler Banken noch nichtweit genug. So setzt sich Verdi in denlaufenden Tarifgesprächen der Ban-kenbranche für einen Anspruch aufHomeoffice von bis zu 60 Prozent derArbeitszeit und eine Ausstattungspau-schale in Höhe von 1500 Euro ein. DieTarifgespräche bei den privaten Ban-ken laufen allerdings sehr zäh. Der Ar-beitgeberverband wehrt sich insbeson-dere gegen allgemeine Tarifregeln fürdas Homeoffice.
Die jetzt bei der Deka festgelegteHomeoffice-Quote von 40 Prozentkann auf bis zu 100 Prozent auf-gestockt werden. Dafür gilt dann aberdie sogenannte doppelte Freiwilligkeit:Sowohl der betroffene Mitarbeiter alsauch der Vorgesetzte müssen einemhöheren Anteil der mobilen Arbeitszeitzustimmen.
Die Deka will die neuen Regeln alledrei Jahre überprüfen. Derzeit gilt imUnternehmen noch die Pandemie-Re-gelung, die eine Anwesenheit von ma-ximal 30 Prozent der Mitarbeiter imBüro erlaubt. M. Maisch, Y. Osman
Homeoffice
Deka zahlt 1000 Euro für das Arbeiten zu HauseBeim Fondsanbieter der Sparkassen können die Mitarbeiter ab sofort bis zu 40 Prozent in der Woche mobil arbeiten.
Fondsanbieter Deka: Die
Pandemie hat auch bei den Banken
das mobile Arbeiten salonfähig
gemacht.
met
ropo
l IM
AG
ES /
Ale
xand
er E
Finanzen
35WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Jakob Blume Zürich
Es war eine sorgfältig austarierte Choreografie, mit der die Credit Suisse am Donnerstag ihre neue Strategie vor Investoren präsen-tierte: Verwaltungsratspräsident
António Horta-Osório durfte 15 Minu-ten lang seine Zukunftsvision für die Bank darlegen. Im Anschluss präsen-tierte Vorstandschef Thomas Gottstein 30 Minuten lang die Details der Stra-tegie. So sollte der Eindruck der letzten Monate zerstreut werden, wonach sich Horta-Osório stark ins operative Ge-schäft einmischt und als eine Art Schat-ten-CEO agiert.
Horta-Osório machte deutlich: Der radikale Umbruch bleibt trotz der an-haltenden Skandalserie aus: Er sieht die Credit Suisse weiter als Universalbank: „Wir verstärken unser integriertes Mo-dell“, sagte er. Nach dem Vorbild des Lokalrivalen UBS will die Bank ihre bislang regional organisierte Ver-mögensverwaltung zu einer zentralen Einheit zusammenfassen.
Keine drastischen EinschnitteDas Investmentbanking bleibt jedoch von drastischen Einschnitten ver-schont. Auch einer Abspaltung des Ge-schäfts mit professionellen Kunden (Asset-Management) erteilte Horta-Osório eine Absage. Ein personeller Neuanfang an der Spitze der Bank ist ebenfalls kein Thema: Thomas Gott-stein bleibt auch unter der neuen Stra-tegie Chef der Credit Suisse.
Allerdings wolle die Bank weniger Risiken eingehen. Mit Blick auf Verlus-
te aus dem Zusammenbruch des Hedge fonds Archegos sowie der mit dem Fintech Greensill betriebenen Fonds sagte der Verwaltungsratschef: „Zahl und Ausmaß der Vorfälle sind nicht akzeptabel.“
Auch Vorstandschef Gottstein zeigte sich einsichtig: „Wir haben erns-te Lektionen gelernt.“ Er strebe einen Kulturwandel an: „Im Herzen sind wir alle Risikomanager“, beteuerte der langjährige Investmentbanker.
Ins Zentrum stellt die Bank künftig das Geschäft mit reichen und ver-mögenden Kunden: Das neu formierte Wealth-Management soll bis zum Jahr 2024 1,1 Billionen Schweizer Franken (eine Billion Euro) verwalten – das wä-
re ein Anstieg um 200 Milliarden Fran-ken innerhalb von drei Jahren. So soll der wichtigste Geschäftsbereich der Bank eine Milliarde Franken zusätzlich an Erträgen abwerfen. Zudem will sich das Institut aus zehn Märkten zurück-ziehen, die als Nicht-Kernmärkte an-gesehen werden. Dazu zählen Staaten in Subsahara Afrika.
Zu Personalien gab die Bank vor-erst nichts bekannt. Das Global Wealth -Management soll einen um 25 Prozent gestiegenen Anteil am zuge-wiesenen Eigenkapital erhalten und da-durch wachsen können. Das Kapital soll von der Investmentbank abgezogen werden. In den nächsten Jahren will die Credit Suisse zudem 500 Kundenbera-
ter einstellen, um das Geschäft mit Rei-chen und Superreichen auszubauen.
Auch der Investmentbank werden regionale Einheiten am schweizeri-schen Heimatmarkt und in Asien zu-geschlagen. Aus dem sogenannten Pri-me Brokerage, dem Handelsgeschäft mit Hedgefonds, will die Bank kom-plett aussteigen. Der Bereich war für den fünf Milliarden Franken schweren Verlust beim Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos verantwortlich.
Ebenso wie die UBS will die Credit Suisse eine kapitalschonende Strategie im Investmentbanking einschlagen, mit einem Fokus auf Beratung bei Fu-sionen und Übernahmen. Die Füh-rungspositionen bei riskanteren Anlei-heprodukten will die Bank jedoch nicht aufgeben. Dafür soll der Bestand von komplexen Finanzderivaten abgebaut werden, der viel Kapital bindet.
Die Umstrukturierung geht mit ei-ner deutlichen Machtverschiebung ein-her: Die Schweizer Bank unter Führung von André Helfenstein wird gemessen am Nettoertrag auf vergleichbarer Basis halbiert. Die eigenständige Asien-Di-vision unter Herman Sitohang wird zerschlagen. Die Vermögensverwal-tung wächst um das 2,6-Fache, gemes-sen am Nettoertrag. Gleichzeitig sollen die Regionalgesellschaften jedoch auf-gewertet werden.
Weitere WachstumschancenIm Asset-Management sieht Verwal-tungsratschef Horta-Osório ebenfalls „klare Wachstumsmöglichkeiten“. Mit rund 470 Milliarden Franken verwal-tetem Vermögen gilt die Sparte als ver-gleichsweise klein. Interessenten stün-den bereit, ist im Markt zu hören. Doch die Sparte steht nicht zum Verkauf. Das Asset-Management ist derzeit noch mit der Bewältigung der Greensill-Krise be-schäftigt. Die professionellen Kunden des Geldhauses bangen um mehr als zwei Milliarden Dollar.
Horta-Osório unterstrich: „Die heute bekannt gegebenen Maßnahmen bilden den Rahmen für eine deutlich stärkere, kundenorientiertere Bank mit führenden Geschäftsbereichen und re-gionalen Angeboten.“ Er hatte die Stra-tegie seit seinem Amtsantritt im Mai ausgearbeitet.
Viele Analysten zeigten sich jedoch enttäuscht, dass der große Umbruch ausbleibt. So bezeichnete Andreas Venditti, Analyst bei Vontobel, die neue Strategie als „Evolution statt dem großen Knall“. Sie wirke auf den ersten Blick wie eine Rückkehr zur Ausrich-tung der Bank im Jahr 2015, vor dem Amtsantritt des umstrittenen Ex-Chefs Tidjane Thiam. Die Strukturen könnten zwar relativ schnell verändert werden, sagte Venditti. Doch er fügt hinzu: „Vertrauen und Reputation wie-derherzustellen“ werde Jahre bean-spruchen.
Das Kerngeschäft der Credit Suisse wächst derweil trotz aller Krisen weiter an: Wie die Bank am Donnerstag eben-falls bekannt gab, nahm sie im dritten Quartal rund 5,4 Milliarden Franken ein, rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Vorsteuergewinn stieg um 26 Prozent auf rund eine Milliarde Franken. Unter dem Strich blieben je-doch lediglich 434 Millionen Franken Reingewinn übrig, ein Rückgang um 21 Prozent gegenüber dem Vorjahres-zeitraum.
Zudem stellte die Credit Suisse ih-ren Aktionären einen Verlust im vier-ten Quartal in Aussicht: Im Zuge der Umstrukturierungen muss die Bank 1,6 Milliarden Franken abschreiben. Der Kampf mit den Altlasten ist für die Bank noch lange nicht beendet.
Credit Suisse
Die Reichen sollen künftig das Geld bringen
Neue Struktur, neue Strategie: Die Credit Suisse will künftig das Erfolgskonzept der UBS kopieren. Der personelle Neuanfang bleibt vorerst aus.
Credit Suisse: Es gilt, die anhaltende
Skandalserie zu durchbrechen.
Blo
ombe
rg
Kennzahlen für Jan. bis Sept.
Vorsteuerergebnisin Mrd. Schweizer Franken
Eigenkapitalrenditein Prozent
2020 2021 2020 2021
2020 2021 2020 2021
Credit Suisse
Credit Suisse
-17 %
UBS
UBS
+34 %
3,65,8
1,1
7,1
8,8 %11,5 %
1,3 %
13,8 %
Quellen: Bloomberg, UnternehmenHANDELSBLATT
Schweizer Banken im Vergleich
4.11.1.1.2021
+40
+30
+20
+10
0
-10
-20
-30
Aktienkurs: Prozentuale Veränderung in Prozent
Vorstandschef Thomas Gottstein: Er präsentierte die Details der neuen
Strategie.
EPA
-EFE
/Shu
tter
stoc
Finanzen
34 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
D ie Frankfurter Deka hat sich mit ihren Mitarbeitervertretungen auf verbindliche Regeln für das Ar-beiten im Homeoffice geeinigt.
Die ab sofort gültige Vereinbarung er-möglicht es den Beschäftigten des Fondsanbieters der Sparkassen, bis zu 40 Prozent ihrer Arbeitszeit pro Wo-che von daheim aus oder von einem anderen Ort innerhalb Deutschlands zu arbeiten.
Über diese Regeln hat die Deka ihre Mitarbeiter in dieser Woche informiert. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Abmachung. Neben der mobilen Arbeitsausstattung mit Notebook und Computertelefonie sollen die Deka-Mitarbeiter noch in diesem Jahr eine finanzielle Unterstützung für die Aus-stattung ihres Heimarbeitsplatzes von 1000 Euro bekommen.
Die Coronapandemie hat auch bei Banken das mobile Arbeiten auf breiter Front salonfähig gemacht. In vielen Geldhäusern hat dies eine Debatte da-rüber ausgelöst, wie flexibel nach der Pandemie gearbeitet werden soll – und ob die Banken ihren Mitarbeitern ne-ben der technischen Ausstattung auch eine Aufwandsentschädigung zahlen
sollen. Die Vereinbarung bei der Deka sieht ähnlich aus wie beim deutschen Ableger der niederländischen Groß-bank ING und der Deutschen Bank, die sich Ende Oktober mit ihren Mit-arbeitern auf verbindliche Homeoffice-Regeln geeinigt hat.
Allerdings werden die 1000 Euro bei der Deka erst einmal als Einmal-zahlung fließen, während die Deutsche Bank die Unterstützung alle fünf Jahre bezahlen will.
Dafür gilt die Deka-Vereinbarung quasi für alle rund 4300 in Deutschland beschäftigten Mitarbeiter. Bei der Deutschen Bank sind erhebliche Teile der Belegschaft momentan von der Ei-nigung mit dem Gesamtbetriebsrat ausgeschlossen. Das gilt nicht nur für Bereiche, die aus regulatorischen Gründen und aufgrund der Art der Tä-tigkeit nicht teilnehmen können wie der Handel oder der Servicebereich der Filialen, sondern vorerst auch für viele
ehemalige Postbank-Betriebe derDeutschen Bank AG.
Den Gewerkschaften gehen dieAngebote vieler Banken noch nichtweit genug. So setzt sich Verdi in denlaufenden Tarifgesprächen der Ban-kenbranche für einen Anspruch aufHomeoffice von bis zu 60 Prozent derArbeitszeit und eine Ausstattungspau-schale in Höhe von 1500 Euro ein. DieTarifgespräche bei den privaten Ban-ken laufen allerdings sehr zäh. Der Ar-beitgeberverband wehrt sich insbeson-dere gegen allgemeine Tarifregeln fürdas Homeoffice.
Die jetzt bei der Deka festgelegteHomeoffice-Quote von 40 Prozentkann auf bis zu 100 Prozent auf-gestockt werden. Dafür gilt dann aberdie sogenannte doppelte Freiwilligkeit:Sowohl der betroffene Mitarbeiter alsauch der Vorgesetzte müssen einemhöheren Anteil der mobilen Arbeitszeitzustimmen.
Die Deka will die neuen Regeln alledrei Jahre überprüfen. Derzeit gilt imUnternehmen noch die Pandemie-Re-gelung, die eine Anwesenheit von ma-ximal 30 Prozent der Mitarbeiter imBüro erlaubt. M. Maisch, Y. Osman
Homeoffice
Deka zahlt 1000 Euro für das Arbeiten zu HauseBeim Fondsanbieter der Sparkassen können die Mitarbeiter ab sofort bis zu 40 Prozent in der Woche mobil arbeiten.
Fondsanbieter Deka: Die
Pandemie hat auch bei den Banken
das mobile Arbeiten salonfähig
gemacht.
met
ropo
l IM
AG
ES /
Ale
xand
er E
Finanzen
35WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Wohnen im Umland
Serie: Hohe Preise und
wenig Platz in der Stadt – auf der Suche nach einer Immobilie weichen immer mehr Deutsche aufs Land aus. In einer neuen Serie zeigt das Handelsblatt, welche Preis-
unterschiede es gibt und worauf man beim Kauf achten sollte.
Nächste Folge:
Frankfurt
Düsseldorf750.000 €Düsseldorf750.000 €
Kreis Kleve295.000 €
Kreis Wesel339.000 €
Kreis Viersen340.000 €
Oberhausen340.000 €
Duisburg345.000 €
Mönchengladbach349.000 € Remscheid
349.000 €
Wuppertal349.000 €
Essen420.000 €
Rhein-Kreis Neuss480.000 €
Kreis Mettmann479.000 €
Solingen438.000 €
Mülheim a. d. Ruhr450.000 €
Krefeld420.000 €
Quelle: von Poll Immobilien GmbHHANDELSBLATT
Immobilienpreisanalyse 2021
Wohnen in der Region Düsseldorf
Mülheim a. d. Ruhr
Wuppertal
Remscheid
Kreis Mettmann
Oberhausen
Kreis Wesel
Mönchengladbach
Kreis Viersen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss
Kreis Kleve
Krefeld
Essen
Duisburg
Solingen
+36,0 %
+69,4 %
+63,8 %
+66,3 %
+52,5 %
+52,7 %
+76,3 %
+55,3 %
+104,4 %
+80,5 %
+46,8 %
+70,0 %
+56,7 %
+76,0 %
+71,8 %
+4,7 %
+5,5 %
+6,1 %
+6,4 %
+7,8 %
+9,4 %
+9,4 %
+9,7 %
+10,3 %
+10,3 %
+10,7 %
+12,0 %
+13,8 %
+16,9 %
+21,7 %
Preissteigerungen 2020 in Prozent... zu 2019 ... zu 2010Durchschnittlicher
Kaufpreis für Ein- und Zwei-familienhäuser in Euro
Bis 300.000 €
Bis 800.000 €
Anne Wiktorin Düsseldorf
Das ist Anja Pötters inzwischen gewohnt: Sobald die Immobi-lienmaklerin aus Wesel eine neue Hausofferte auf ihre Homepage und in diverse On-
lineportale stellt, füllt sich ihr E-Mail-Postfach im Minutentakt. 100 Anfra-gen für eine Doppelhaushälfte in Dins-laken zählte sie kürzlich innerhalb von nur einer Stunde, berichtet die Ge-schäftsstellenleiterin bei von Poll Im-mobilien in der niederrheinischen Kreisstadt. „Ich musste das Angebot kurz aus dem Netz nehmen, um die Kundenmails erst einmal abarbeiten zu können.“
So oder ähnlich geht es vielen, die im Speckgürtel von Düsseldorf aktuell Eigenheime vermitteln. Und noch im-mer gilt: Je geringer die Entfernung oder je besser die Verkehrsanbindung zur NRW-Landeshauptstadt ist, desto größer ist der Andrang der Kunden.
Schließlich gehört die gute Infra-struktur zu den Vorteilen einer so dicht besiedelten Region wie der zwischen Rhein und Ruhr. Viele Autobahnen, dazu ein gutes S- und Regionalbahn-netz haben dafür gesorgt, dass es Haus-käufer seit jeher aus Düsseldorf ins Um-land zieht. Allein im Rhein-Kreis Neuss westlich des Rheins und seinem Pen-dant im Osten, dem Kreis Mettmann, leben fast eine Million Menschen – Düsseldorf zählt 600.000 Einwohner.
Neu aber ist: Der Radius der Käufer wird größer, wie eine Analyse des Maklerhauses von Poll Immobilien für das Handelsblatt zeigt.
Enorme PreisunterschiedeInsgesamt 14 Städte und Kreise im Um-land der Rheinmetropole sind in Zeiten von Homeoffice eine ernst zu nehmen-de Alternative für all jene Hauskäufer, die auf Düsseldorfs Immobilienmarkt nicht zum Zuge kommen oder die nach den Erfahrungen der Coronazeit ohne-hin raus wollen aus der Stadt.
Preislich sind die Unterschiede enorm: Während in Düsseldorf ein Ein-familienhaus oder eine Doppelhaushälf-te 2020 im Mittel 750.000 Euro kos-tete, waren es im gut 60 Kilometer nördlich gelegenen Wesel mit 340.000 Euro weniger als die Hälfte. Auch in Wuppertal – mit immerhin 355.000 Einwohnern alles andere als eine Klein-stadt – ist ein Eigenheim mit durch-schnittlich 400.000 Euro für viele Fa-milien noch erschwinglich. Und sogar im unmittelbar ans Stadtgebiet angren-zenden Rhein-Kreis Neuss liegen die Kaufpreise für Eigenheime deutlich un-ter dem Düsseldorfer Niveau.
„Dabei muss man allerdings wis-sen, dass es allein in Neuss und Umge-bung große Preisunterschiede gibt“, warnt Frank Löbig, Geschäftsstellenlei-ter bei von Poll Immobilien in Neuss, vor Verallgemeinerungen. In der Kreis-stadt lägen die Preise für Einfamilien-häuser zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Das liegt nicht zuletzt an der exzellenten Anbindung nach Düsseldorf. Mit der Straßenbahn ist man von der Stadthalle Neuss aus in knapp 20 Minuten an der Königsallee,
Immobilienmärkte im Düsseldorfer Umland
Alleinlage bevorzugt Dank einer guten Infrastruktur ist das Umland der NRW-Landeshauptstadt schon lange bei
Hauskäufern beliebt. Doch jetzt verschieben sich die Präferenzen: Der Suchradius wird immer größer.
Blick auf Rhein und Umland: 14 Städte und Kreise im Düsseldorfer Umland sind für Hauskäufer sehr interessant.
pict
ure
allia
nce
/ bl
ickw
inke
l/H
. Blo
ssey
Immobilien
36 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
mit S- und Regionalbahn in 15 Minuten am Düsseldorfer Hauptbahnhof.
In den direkt angrenzenden Ort-schaften – etwa Reuschenberg, Grim-linghausen oder Gnadental – begrün-den die Nähe zum Rhein und viel Grün ähnlich hohe Kaufpreise. „Auch Rosel-lerheide ist beliebt und kaum günstiger – das wird es für Käufer erst in Rich-tung Jüchen“, zählt Immobilienexperte Löbig weitere Beispiele auf.
Dort wie auch in vielen anderen Gemeinden des Kreises kommt man allerdings trotz Nahverkehrsangeboten nicht ohne Auto(s) aus. Das gilt sogar für den bei jungen Familien beliebten Neusser Ortsteil Allerheiligen. Der Wohnort im Süden der Kreisstadt ist seit den 1990er-Jahren dank verschie-dener Neubaugebiete stark gewachsen – ein nächstes Baugebiet ist schon in der Planung. Inzwischen gibt es sogar eine weitere Grundschule, auch die Nahversorgungsmöglichkeiten haben sich in den vergangenen Jahren verbes-sert. Trotzdem: „Wer dort hinzieht, braucht eigentlich zwei Autos“, stellt Löbig fest.
Die Käufer aus der Großstadt schrecken weitere Wege indes nicht ab – das für die meisten Bürobeschäftigten inzwischen üblich gewordene Arbeiten im Homeoffice macht’s möglich. „In schätzungsweise 80 Prozent der Fälle verkaufen wir aktuell an Düsseldorfer“, sagt der Vermittler.
Wie hoch genau deren Anteil bei den Hauskäufen im Umland ist, lässt sich nur schwer beziffern. Die jährlichen Marktberichte der amtlichen Gutach-terausschüsse für Grundstückswerte werten diese Daten anhand der nota-
riellen Kaufverträge bis auf wenige Aus-nahmen nicht aus. Im Kreis Mettmann lag der Anteil von Immobilienkäufern aus der „kreisangrenzenden Großstadt“ im vergangenen Jahr bei 25 Prozent.
Auch in Solingen wollte man es ge-nauer wissen: Von den knapp 500 aus-wärtigen Immobilienkäufern des Jahres 2020 – das entspricht etwa 37 Prozent aller damaligen Kaufverträge – kam ein Drittel aus Düsseldorf, ein Drittel aus Köln, der Rest verteilte sich auf kleine-re Gemeinden.
In Krefeld fächerten die Gutachter den Anteil auswärtiger Immobilienkäu-fer zwar geografisch nicht weiter auf – dafür werteten sie die Daten bezogen auf den Markt für Ein- und Zweifami-lienhäuser aus. Das Ergebnis: Auch von ihnen kam 2020 ein gutes Drittel nicht aus der Stadt am Niederrhein.
Alfred Achterfeldt, Geschäftsstel-lenleiter bei von Poll Immobilien in der 230.000-Einwohner-Stadt nordwest-lich von Düsseldorf, überrascht das nicht. Die Kaufnachfrage sei im Ver-gleich zu Vor-Corona-Zeiten noch ein-mal gestiegen. „In den südlichen Bezir-ken von Krefeld wie Fischeln und Op-pum, aber auch in den angrenzenden
Städten Uerdingen und Tönisvorst fin-den sich im Vergleich zu Düsseldorf noch vergleichsweise attraktive Ange-bote.“ Mit einem durchschnittlichen Preisniveau von 420.000 Euro rangiert auch die etwa 25 Kilometer von Düs-seldorf entfernte Stadt unter den 14 Umlandstädten und -kreisen allerdings bereits in der oberen Hälfte.
Denn ähnlich wie Neuss kann auch Krefeld mit seiner sehr guten Infra-struktur punkten: Das Einzugsgebiet ist mit der A40, A44, A52 und A57 an gleich vier große Verkehrsadern der Region angebunden. „Die maximale Entfernung zu diesen Autobahnen liegt jeweils bei nur 15 bis 20 Minuten. Und auch der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut“, sagt Achterfeldt.
Das gilt erst recht für die Lagen im südlichen Ruhrgebiet. Mülheim an der Ruhr etwa sei schon immer eine der hochpreisigen Städte der Region gewe-sen, sagt Stefan D’Heur, der das von-Poll-Immobilien-Büro in Duisburg lei-tet. Die Pandemie habe diesen Trend noch verstärkt. In Duisburg etwa – das für Hauskäufer aus Düsseldorf nicht zur ersten Wahl zählt – sind die Preise zwischen 2019 und 2020 um fast 17 Prozent gestiegen. Auf Zehn-Jahres-Sicht liegt der Wertzuwachs für Eigen-heime in der Stadt bei 76 Prozent – im teuren Mülheim sind es gerade 36 Pro-zent. Und auch Makler D’Heur muss viele seiner Immobilien gar nicht mehr inserieren: „Viele Verkäufe vermitteln wir inzwischen intern an die bei uns re-gistrierten Kunden.“
Viel Zeit mitbringenEgal aber, wo Käufer im Düsseldorfer Umland ein Haus suchen: Sie sollten viel Zeit mitbringen. Maklerin Anja Pötters aus Wesel berichtet von Fami-lien, die seit vier Jahren nach einem Domizil suchen. „Und selbst wenn sie es gefunden haben, bietet im letzten Moment ein Konkurrent dem Verkäu-fer doch noch etwas mehr.“
In Dinslaken oder Hünxe, Voerde, Schermbeck und sogar in Hamminkeln am Nordende des Kreises sind die Prei-se seit dem vergangenen Jahr noch ein-mal gestiegen. „Mit 350.000 bis 400.000 Euro sollten Käufer dort in-zwischen rechnen. Das Angebot ist einfach extrem gering“, sagt Pötters.
Im östlichen Düsseldorfer Umland ist die Situation kaum anders. In Wup-pertal oder Remscheid, wo die Durch-schnittspreise noch unter der 400.000-Euro-Marke liegen, sind nicht nur gepflegte ältere Häuser, son-dern auch solche mit Modernisierungs- oder Sanierungsbedarf äußerst rar ge-sät. „So nah an einem Ballungsraum gibt es eben kaum noch Geheimtipps“, konstatiert nüchtern Vermittler Ach-terfeldt.
Im Gegenteil: Es gebe nichts mehr auf dem Markt, was sich nicht verkau-fen ließe – weder im näheren Umland noch in den ländlichen Kreisen wie Wesel, heißt es unisono. „Selbst eine früher schwer zu vermarktende Immo-bilie ist heute nach drei, vier Monaten verkauft“, sagt Maklerin Pötters. Und sie beobachtet eine weitere Verände-rung in den Kundenpräferenzen: „Bis vor ein paar Jahren war ein Haus in Al-leinlage ein Ladenhüter, heute ist es hochbegehrt.“ Vor allem viele Familien suchten die Ruhe auf dem Land, einen großen Garten und möglichst keine di-rekten Nachbarn. Das frei stehende Haus sei schon immer der Traum vieler Käufer gewesen – doch jetzt seien viele bereit, weiter aus der Stadt heraus-zuziehen und eine suboptimale Infra-struktur zu akzeptieren, um sich diesen Wunsch zu erfüllen.
Wohnsiedlung in Dinslaken: Manchmal gibt es 100 Anfragen für eine Doppelhaus-
hälfte innerhalb von nur einer Stunde.
mau
riti
us im
ages
/ H
ans
Blo
ssey
D er kanadische Immobilien- und Infrastruktur-Investor Brookfield steht vor einem Milliardendeal in Deutschland. Das Unternehmen
greift für bis zu fünf Milliarden Euro nach dem Hamburger Büro-Vermieter Alstria Office. Brookfield Asset Ma-nagement, die sich seit Mai zum größ-ten Einzelaktionär von Alstria gemau-sert haben, kündigte am Donnerstag ein Übernahmeangebot über 19,50 Euro je Aktie an.
„Wir glauben an Büros“, sagte Brad Hyler, der für Brookfield das Immobi-liengeschäft in Europa managt. „Die Unternehmen werden ihre Büroflä-chen künftig aber anders, flexibler nut-zen.“ Alstria-Vorstandschef Olivier Elamine stellte sich hinter den Plan, das Unternehmen zu verkaufen und von der Börse zu nehmen.
Der milliardenschwere Kauf wirft damit ein Schlaglicht darauf, dass große Investoren weiter an die Zukunft des Büromarkts glauben. Die Pandemie hatte der Nachfrage nach Büro-Immo-bilien zeitweise einen Schlag versetzt - und die Frage aufgeworfen, ob nicht viele Unternehmen angesichts des Trends zum Home Office künftig mit weniger Büroflächen planen könnten.
Die Aussichten für die Branche gel-ten daher als ungewiss: Viele Konzerne haben angekündigt, ihre Mitarbeiter angesichts der Erfahrungen in der Co-rona-Krise zumindest zeitweise zuhau-se arbeiten zu lassen und die Büro-Flä-chen zu reduzieren.„Trotz Krise hat sich der gewerbliche Investmentmarkt als robust erwiesen, Büros waren wei-terhin eine eher gefragte Assetklasse“, beschreibt Sven Carstensen, Vor-standsmitglied des Analysehauses Bul-wiengesa jedoch den aktuellen Trend.
Die Büro-Branche sei aufgrund derveränderten Nachfrage in einemgrundlegenden Wandel, räumt Alstriaein. „Es ist von großem Wert, mit ei-nem erfahrenen Aktionär verankert zusein, der sich längerfristig an die Gesell-schaft bindet, als dies bei öffentlichemKapital normalerweise möglich ist – insbesondere während einer Phase er-heblicher Investitionen“, sagte Elami-ne, der nach dem Willen von Brook-field an Bord bleiben soll.
Alstria hält 111 Büroimmobilien indeutschen Großstädten – unter ande-rem in Hamburg, Frankfurt, Düssel-dorf, Berlin und Stuttgart – im Wertvon 4,7 Milliarden Euro. Die Offertevon Brookfield bewerte die Immobilien– einschließlich Schulden – mit fünfMilliarden. „Alstria ist extrem erfolg-reich damit, Immobilien in guten La-gen in Deutschland zu kaufen, die aberschon älter sind, und sie zu repositio-nieren“, erklärte Hyler. „Wir wollen dasbeschleunigen, und wir haben natürlichdas nötige Kapital, um das zu tun.“Brookfield verwaltet rund 330 Milliar-den Dollar. Ohne den Druck von derBörse könne Alstria mehr Schuldenaufnehmen und weniger Dividendenzahlen, sagte Elamine.
Brookfield ist in Deutschland alsImmobilien-Investor seit Jahren aktiv.Dem Unternehmen gehört das Quar-tier am Potsdamer Platz in Berlin, dasBrookfield vor fast sechs Jahren für eineMilliardensumme gekauft hat, sowiedas Stuttgarter SI-Centrum mit einemHotel, einem Musical-Theater, Kinosund Restaurants.
Bei Alstria streben die Kanadier ei-ne Mehrheit von mehr als 50 Prozentan. Für alle Aktien müssten sie 3,5 Mil-liarden Euro hinlegen. Spekulationenüber eine Übernahme waren erstmalsim Juli aufgetaucht, nachdem Brook-field seine Anteile über Monate hinwegaufgestockt hatte. Damals hatte Alstriaaber noch erklärt, es gebe keine Ver-handlungen. Inzwischen hat Brookfieldlaut Hyler Zugriff auf zwölf Prozent derAnteile. Die Kanadier bieten für Alstriaeinen Aufschlag 17 Prozent über demSchlusskurs der Aktie. Die Investorenreagierten erfreut: Die MDax-Firmalegte bis auf 19,55 Euro zu. Carsten Herz/Reuters
Gewerbeimmobilien
Milliardendeal am deutschen BüromarktKanadische Immobilienfirma Brookfield will Hamburger
Büro-Vermieter Alstria übernehmen.
Büroimmobilien: Große Investoren
glauben weiter an die Zukunft des
Segments. IMA
GO
Immobilien
37WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Wohnen im Umland
Serie: Hohe Preise und
wenig Platz in der Stadt – auf der Suche nach einer Immobilie weichen immer mehr Deutsche aufs Land aus. In einer neuen Serie zeigt das Handelsblatt, welche Preis-
unterschiede es gibt und worauf man beim Kauf achten sollte.
Nächste Folge:
Frankfurt
Düsseldorf750.000 €Düsseldorf750.000 €
Kreis Kleve295.000 €
Kreis Wesel339.000 €
Kreis Viersen340.000 €
Oberhausen340.000 €
Duisburg345.000 €
Mönchengladbach349.000 € Remscheid
349.000 €
Wuppertal349.000 €
Essen420.000 €
Rhein-Kreis Neuss480.000 €
Kreis Mettmann479.000 €
Solingen438.000 €
Mülheim a. d. Ruhr450.000 €
Krefeld420.000 €
Quelle: von Poll Immobilien GmbHHANDELSBLATT
Immobilienpreisanalyse 2021
Wohnen in der Region Düsseldorf
Mülheim a. d. Ruhr
Wuppertal
Remscheid
Kreis Mettmann
Oberhausen
Kreis Wesel
Mönchengladbach
Kreis Viersen
Düsseldorf
Rhein-Kreis Neuss
Kreis Kleve
Krefeld
Essen
Duisburg
Solingen
+36,0 %
+69,4 %
+63,8 %
+66,3 %
+52,5 %
+52,7 %
+76,3 %
+55,3 %
+104,4 %
+80,5 %
+46,8 %
+70,0 %
+56,7 %
+76,0 %
+71,8 %
+4,7 %
+5,5 %
+6,1 %
+6,4 %
+7,8 %
+9,4 %
+9,4 %
+9,7 %
+10,3 %
+10,3 %
+10,7 %
+12,0 %
+13,8 %
+16,9 %
+21,7 %
Preissteigerungen 2020 in Prozent... zu 2019 ... zu 2010Durchschnittlicher
Kaufpreis für Ein- und Zwei-familienhäuser in Euro
Bis 300.000 €
Bis 800.000 €
Anne Wiktorin Düsseldorf
Das ist Anja Pötters inzwischen gewohnt: Sobald die Immobi-lienmaklerin aus Wesel eine neue Hausofferte auf ihre Homepage und in diverse On-
lineportale stellt, füllt sich ihr E-Mail-Postfach im Minutentakt. 100 Anfra-gen für eine Doppelhaushälfte in Dins-laken zählte sie kürzlich innerhalb von nur einer Stunde, berichtet die Ge-schäftsstellenleiterin bei von Poll Im-mobilien in der niederrheinischen Kreisstadt. „Ich musste das Angebot kurz aus dem Netz nehmen, um die Kundenmails erst einmal abarbeiten zu können.“
So oder ähnlich geht es vielen, die im Speckgürtel von Düsseldorf aktuell Eigenheime vermitteln. Und noch im-mer gilt: Je geringer die Entfernung oder je besser die Verkehrsanbindung zur NRW-Landeshauptstadt ist, desto größer ist der Andrang der Kunden.
Schließlich gehört die gute Infra-struktur zu den Vorteilen einer so dicht besiedelten Region wie der zwischen Rhein und Ruhr. Viele Autobahnen, dazu ein gutes S- und Regionalbahn-netz haben dafür gesorgt, dass es Haus-käufer seit jeher aus Düsseldorf ins Um-land zieht. Allein im Rhein-Kreis Neuss westlich des Rheins und seinem Pen-dant im Osten, dem Kreis Mettmann, leben fast eine Million Menschen – Düsseldorf zählt 600.000 Einwohner.
Neu aber ist: Der Radius der Käufer wird größer, wie eine Analyse des Maklerhauses von Poll Immobilien für das Handelsblatt zeigt.
Enorme PreisunterschiedeInsgesamt 14 Städte und Kreise im Um-land der Rheinmetropole sind in Zeiten von Homeoffice eine ernst zu nehmen-de Alternative für all jene Hauskäufer, die auf Düsseldorfs Immobilienmarkt nicht zum Zuge kommen oder die nach den Erfahrungen der Coronazeit ohne-hin raus wollen aus der Stadt.
Preislich sind die Unterschiede enorm: Während in Düsseldorf ein Ein-familienhaus oder eine Doppelhaushälf-te 2020 im Mittel 750.000 Euro kos-tete, waren es im gut 60 Kilometer nördlich gelegenen Wesel mit 340.000 Euro weniger als die Hälfte. Auch in Wuppertal – mit immerhin 355.000 Einwohnern alles andere als eine Klein-stadt – ist ein Eigenheim mit durch-schnittlich 400.000 Euro für viele Fa-milien noch erschwinglich. Und sogar im unmittelbar ans Stadtgebiet angren-zenden Rhein-Kreis Neuss liegen die Kaufpreise für Eigenheime deutlich un-ter dem Düsseldorfer Niveau.
„Dabei muss man allerdings wis-sen, dass es allein in Neuss und Umge-bung große Preisunterschiede gibt“, warnt Frank Löbig, Geschäftsstellenlei-ter bei von Poll Immobilien in Neuss, vor Verallgemeinerungen. In der Kreis-stadt lägen die Preise für Einfamilien-häuser zwischen 500.000 und 600.000 Euro. Das liegt nicht zuletzt an der exzellenten Anbindung nach Düsseldorf. Mit der Straßenbahn ist man von der Stadthalle Neuss aus in knapp 20 Minuten an der Königsallee,
Immobilienmärkte im Düsseldorfer Umland
Alleinlage bevorzugt Dank einer guten Infrastruktur ist das Umland der NRW-Landeshauptstadt schon lange bei
Hauskäufern beliebt. Doch jetzt verschieben sich die Präferenzen: Der Suchradius wird immer größer.
Blick auf Rhein und Umland: 14 Städte und Kreise im Düsseldorfer Umland sind für Hauskäufer sehr interessant.
pict
ure
allia
nce
/ bl
ickw
inke
l/H
. Blo
ssey
Immobilien
36 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
mit S- und Regionalbahn in 15 Minuten am Düsseldorfer Hauptbahnhof.
In den direkt angrenzenden Ort-schaften – etwa Reuschenberg, Grim-linghausen oder Gnadental – begrün-den die Nähe zum Rhein und viel Grün ähnlich hohe Kaufpreise. „Auch Rosel-lerheide ist beliebt und kaum günstiger – das wird es für Käufer erst in Rich-tung Jüchen“, zählt Immobilienexperte Löbig weitere Beispiele auf.
Dort wie auch in vielen anderen Gemeinden des Kreises kommt man allerdings trotz Nahverkehrsangeboten nicht ohne Auto(s) aus. Das gilt sogar für den bei jungen Familien beliebten Neusser Ortsteil Allerheiligen. Der Wohnort im Süden der Kreisstadt ist seit den 1990er-Jahren dank verschie-dener Neubaugebiete stark gewachsen – ein nächstes Baugebiet ist schon in der Planung. Inzwischen gibt es sogar eine weitere Grundschule, auch die Nahversorgungsmöglichkeiten haben sich in den vergangenen Jahren verbes-sert. Trotzdem: „Wer dort hinzieht, braucht eigentlich zwei Autos“, stellt Löbig fest.
Die Käufer aus der Großstadt schrecken weitere Wege indes nicht ab – das für die meisten Bürobeschäftigten inzwischen üblich gewordene Arbeiten im Homeoffice macht’s möglich. „In schätzungsweise 80 Prozent der Fälle verkaufen wir aktuell an Düsseldorfer“, sagt der Vermittler.
Wie hoch genau deren Anteil bei den Hauskäufen im Umland ist, lässt sich nur schwer beziffern. Die jährlichen Marktberichte der amtlichen Gutach-terausschüsse für Grundstückswerte werten diese Daten anhand der nota-
riellen Kaufverträge bis auf wenige Aus-nahmen nicht aus. Im Kreis Mettmann lag der Anteil von Immobilienkäufern aus der „kreisangrenzenden Großstadt“ im vergangenen Jahr bei 25 Prozent.
Auch in Solingen wollte man es ge-nauer wissen: Von den knapp 500 aus-wärtigen Immobilienkäufern des Jahres 2020 – das entspricht etwa 37 Prozent aller damaligen Kaufverträge – kam ein Drittel aus Düsseldorf, ein Drittel aus Köln, der Rest verteilte sich auf kleine-re Gemeinden.
In Krefeld fächerten die Gutachter den Anteil auswärtiger Immobilienkäu-fer zwar geografisch nicht weiter auf – dafür werteten sie die Daten bezogen auf den Markt für Ein- und Zweifami-lienhäuser aus. Das Ergebnis: Auch von ihnen kam 2020 ein gutes Drittel nicht aus der Stadt am Niederrhein.
Alfred Achterfeldt, Geschäftsstel-lenleiter bei von Poll Immobilien in der 230.000-Einwohner-Stadt nordwest-lich von Düsseldorf, überrascht das nicht. Die Kaufnachfrage sei im Ver-gleich zu Vor-Corona-Zeiten noch ein-mal gestiegen. „In den südlichen Bezir-ken von Krefeld wie Fischeln und Op-pum, aber auch in den angrenzenden
Städten Uerdingen und Tönisvorst fin-den sich im Vergleich zu Düsseldorf noch vergleichsweise attraktive Ange-bote.“ Mit einem durchschnittlichen Preisniveau von 420.000 Euro rangiert auch die etwa 25 Kilometer von Düs-seldorf entfernte Stadt unter den 14 Umlandstädten und -kreisen allerdings bereits in der oberen Hälfte.
Denn ähnlich wie Neuss kann auch Krefeld mit seiner sehr guten Infra-struktur punkten: Das Einzugsgebiet ist mit der A40, A44, A52 und A57 an gleich vier große Verkehrsadern der Region angebunden. „Die maximale Entfernung zu diesen Autobahnen liegt jeweils bei nur 15 bis 20 Minuten. Und auch der öffentliche Nahverkehr ist gut ausgebaut“, sagt Achterfeldt.
Das gilt erst recht für die Lagen im südlichen Ruhrgebiet. Mülheim an der Ruhr etwa sei schon immer eine der hochpreisigen Städte der Region gewe-sen, sagt Stefan D’Heur, der das von-Poll-Immobilien-Büro in Duisburg lei-tet. Die Pandemie habe diesen Trend noch verstärkt. In Duisburg etwa – das für Hauskäufer aus Düsseldorf nicht zur ersten Wahl zählt – sind die Preise zwischen 2019 und 2020 um fast 17 Prozent gestiegen. Auf Zehn-Jahres-Sicht liegt der Wertzuwachs für Eigen-heime in der Stadt bei 76 Prozent – im teuren Mülheim sind es gerade 36 Pro-zent. Und auch Makler D’Heur muss viele seiner Immobilien gar nicht mehr inserieren: „Viele Verkäufe vermitteln wir inzwischen intern an die bei uns re-gistrierten Kunden.“
Viel Zeit mitbringenEgal aber, wo Käufer im Düsseldorfer Umland ein Haus suchen: Sie sollten viel Zeit mitbringen. Maklerin Anja Pötters aus Wesel berichtet von Fami-lien, die seit vier Jahren nach einem Domizil suchen. „Und selbst wenn sie es gefunden haben, bietet im letzten Moment ein Konkurrent dem Verkäu-fer doch noch etwas mehr.“
In Dinslaken oder Hünxe, Voerde, Schermbeck und sogar in Hamminkeln am Nordende des Kreises sind die Prei-se seit dem vergangenen Jahr noch ein-mal gestiegen. „Mit 350.000 bis 400.000 Euro sollten Käufer dort in-zwischen rechnen. Das Angebot ist einfach extrem gering“, sagt Pötters.
Im östlichen Düsseldorfer Umland ist die Situation kaum anders. In Wup-pertal oder Remscheid, wo die Durch-schnittspreise noch unter der 400.000-Euro-Marke liegen, sind nicht nur gepflegte ältere Häuser, son-dern auch solche mit Modernisierungs- oder Sanierungsbedarf äußerst rar ge-sät. „So nah an einem Ballungsraum gibt es eben kaum noch Geheimtipps“, konstatiert nüchtern Vermittler Ach-terfeldt.
Im Gegenteil: Es gebe nichts mehr auf dem Markt, was sich nicht verkau-fen ließe – weder im näheren Umland noch in den ländlichen Kreisen wie Wesel, heißt es unisono. „Selbst eine früher schwer zu vermarktende Immo-bilie ist heute nach drei, vier Monaten verkauft“, sagt Maklerin Pötters. Und sie beobachtet eine weitere Verände-rung in den Kundenpräferenzen: „Bis vor ein paar Jahren war ein Haus in Al-leinlage ein Ladenhüter, heute ist es hochbegehrt.“ Vor allem viele Familien suchten die Ruhe auf dem Land, einen großen Garten und möglichst keine di-rekten Nachbarn. Das frei stehende Haus sei schon immer der Traum vieler Käufer gewesen – doch jetzt seien viele bereit, weiter aus der Stadt heraus-zuziehen und eine suboptimale Infra-struktur zu akzeptieren, um sich diesen Wunsch zu erfüllen.
Wohnsiedlung in Dinslaken: Manchmal gibt es 100 Anfragen für eine Doppelhaus-
hälfte innerhalb von nur einer Stunde.
mau
riti
us im
ages
/ H
ans
Blo
ssey
D er kanadische Immobilien- und Infrastruktur-Investor Brookfield steht vor einem Milliardendeal in Deutschland. Das Unternehmen
greift für bis zu fünf Milliarden Euro nach dem Hamburger Büro-Vermieter Alstria Office. Brookfield Asset Ma-nagement, die sich seit Mai zum größ-ten Einzelaktionär von Alstria gemau-sert haben, kündigte am Donnerstag ein Übernahmeangebot über 19,50 Euro je Aktie an.
„Wir glauben an Büros“, sagte Brad Hyler, der für Brookfield das Immobi-liengeschäft in Europa managt. „Die Unternehmen werden ihre Büroflä-chen künftig aber anders, flexibler nut-zen.“ Alstria-Vorstandschef Olivier Elamine stellte sich hinter den Plan, das Unternehmen zu verkaufen und von der Börse zu nehmen.
Der milliardenschwere Kauf wirft damit ein Schlaglicht darauf, dass große Investoren weiter an die Zukunft des Büromarkts glauben. Die Pandemie hatte der Nachfrage nach Büro-Immo-bilien zeitweise einen Schlag versetzt - und die Frage aufgeworfen, ob nicht viele Unternehmen angesichts des Trends zum Home Office künftig mit weniger Büroflächen planen könnten.
Die Aussichten für die Branche gel-ten daher als ungewiss: Viele Konzerne haben angekündigt, ihre Mitarbeiter angesichts der Erfahrungen in der Co-rona-Krise zumindest zeitweise zuhau-se arbeiten zu lassen und die Büro-Flä-chen zu reduzieren.„Trotz Krise hat sich der gewerbliche Investmentmarkt als robust erwiesen, Büros waren wei-terhin eine eher gefragte Assetklasse“, beschreibt Sven Carstensen, Vor-standsmitglied des Analysehauses Bul-wiengesa jedoch den aktuellen Trend.
Die Büro-Branche sei aufgrund derveränderten Nachfrage in einemgrundlegenden Wandel, räumt Alstriaein. „Es ist von großem Wert, mit ei-nem erfahrenen Aktionär verankert zusein, der sich längerfristig an die Gesell-schaft bindet, als dies bei öffentlichemKapital normalerweise möglich ist – insbesondere während einer Phase er-heblicher Investitionen“, sagte Elami-ne, der nach dem Willen von Brook-field an Bord bleiben soll.
Alstria hält 111 Büroimmobilien indeutschen Großstädten – unter ande-rem in Hamburg, Frankfurt, Düssel-dorf, Berlin und Stuttgart – im Wertvon 4,7 Milliarden Euro. Die Offertevon Brookfield bewerte die Immobilien– einschließlich Schulden – mit fünfMilliarden. „Alstria ist extrem erfolg-reich damit, Immobilien in guten La-gen in Deutschland zu kaufen, die aberschon älter sind, und sie zu repositio-nieren“, erklärte Hyler. „Wir wollen dasbeschleunigen, und wir haben natürlichdas nötige Kapital, um das zu tun.“Brookfield verwaltet rund 330 Milliar-den Dollar. Ohne den Druck von derBörse könne Alstria mehr Schuldenaufnehmen und weniger Dividendenzahlen, sagte Elamine.
Brookfield ist in Deutschland alsImmobilien-Investor seit Jahren aktiv.Dem Unternehmen gehört das Quar-tier am Potsdamer Platz in Berlin, dasBrookfield vor fast sechs Jahren für eineMilliardensumme gekauft hat, sowiedas Stuttgarter SI-Centrum mit einemHotel, einem Musical-Theater, Kinosund Restaurants.
Bei Alstria streben die Kanadier ei-ne Mehrheit von mehr als 50 Prozentan. Für alle Aktien müssten sie 3,5 Mil-liarden Euro hinlegen. Spekulationenüber eine Übernahme waren erstmalsim Juli aufgetaucht, nachdem Brook-field seine Anteile über Monate hinwegaufgestockt hatte. Damals hatte Alstriaaber noch erklärt, es gebe keine Ver-handlungen. Inzwischen hat Brookfieldlaut Hyler Zugriff auf zwölf Prozent derAnteile. Die Kanadier bieten für Alstriaeinen Aufschlag 17 Prozent über demSchlusskurs der Aktie. Die Investorenreagierten erfreut: Die MDax-Firmalegte bis auf 19,55 Euro zu. Carsten Herz/Reuters
Gewerbeimmobilien
Milliardendeal am deutschen BüromarktKanadische Immobilienfirma Brookfield will Hamburger
Büro-Vermieter Alstria übernehmen.
Büroimmobilien: Große Investoren
glauben weiter an die Zukunft des
Segments. IMA
GO
Immobilien
37WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Laura de la Motte Frankfurt
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende ent-gegen und damit laufen auch einige Steu-ervorteile aus. Nicht nur deshalb lässt sich bei der eigenen Steuererklärung bis Sil-vester oft noch was rausholen. Das Fi-nanzamt berechnet die Lohnsteuer auf
Basis des Gehalts. Und diese Vorauszahlung ist oft zu hoch, denn viele Ausgaben können steu-erlich geltend gemacht werden. Das heißt, sie werden entweder vom zu versteuernden Einkom-men oder von der Steuerlast direkt abgezogen. Wer schlau ist, kann seine Steuern verringern und gegebenenfalls eine höhere Rückerstattung raus-holen. Für all diese Kosten ist der richtige Zeit-punkt entscheidend. Je nachdem, wie stark die anrechenbaren Beträge schon ausgenutzt wurden, kann es sinnvoll sein, Ausgaben noch vorzuziehen oder sie lieber ins nächste Jahr zu schieben.
Aufwendungen für Dienstleistungen rund um Haus und Haushalt werden direkt von der Steu-erlast abgezogen. Hier profitieren alle Steuer-pflichtigen gleichermaßen. Sind die abzugsfähigen Kosten größer als die Steuerschuld, verfällt aller-dings der Rest.
Werbungskosten, Spenden, Sonderausgaben für Gesundheit, Betreuung oder Altersvorsorge senken dagegen das zu versteuernde Einkommen, auf dessen Basis die Steuerlast neu berechnet und die Differenz erstattet wird. „Damit können Spit-zenverdiener hier mehr profitieren, denn bei ihnen macht sich eine Senkung des zu versteuernden Einkommens in einer stärkeren Steuerrückerstat-tung bemerkbar“, erklärt Uwe Rauhöft, Geschäfts-führer beim Bundesverband Lohnsteuerhilfever-eine. Das liegt an der Progression der Steuersätze. Hinzu kommt: Sind diese Ausgaben in einem Jahr so hoch, dass die Steuer auf einen negativen Betrag festgesetzt wird, kann der Steuerpflichtige die Ver-luste ins nächste Jahr vortragen und dann bei-spielsweise die übrig gebliebenen Werbungskosten geltend machen. Das kommt zum Beispiel bei Stu-dierenden regelmäßig vor, die ihre Studiengebüh-ren als Werbungskosten ansetzen.
Daher gilt: Wer im kommenden Jahr weniger Geld zur Verfügung haben wird – sei es durch Rente, Elternzeit oder auch Arbeitslosigkeit – zahlt auch weniger oder gar keine Einkommen-steuer und kann möglicherweise gewisse Aus-gaben nicht mehr in gleichem Maße steuermin-dernd nutzen. Diejenigen sollten versuchen, steu-erwirksame Ausgaben noch in diesem Jahr zu tätigen. Das Handelsblatt gibt einen Überblick, wie sich kurz vor dem Jahresende 2021 noch Steu-ern sparen lassen:
■ Abfindung: Bei Mehrverdienst auszahlen lassenDas richtige Timing bei der Auszahlung der Ab-findung entscheidet darüber, wie viel dem Fiskus von der Extrazahlung in den Schoß fällt. Wie man am meisten Steuern spart, hängt vom aktuellen Steuersatz ab. Und davon, wie hoch das Einkom-
men im laufenden Jahr und im kommenden Jahr ist. „Wer im nächsten Jahr durch einen Jobwechsel mehr verdienen wird, sollte sich die Abfindung noch im alten Jahr auszahlen lassen“, erklärt Rau-höft eine Faustregel. „Wenn jemand weniger ver-dienen wird, lohnt es sich, den optimalen Auszah-lungszeitpunkt vom Profi ausrechnen zu lassen.“
■ Betreuung: Homeschooling steuerlich geltend machenDer Lockdown im ersten Halbjahr, als vor allem die Schulen geschlossen waren, brachte viele El-tern in große Schwierigkeiten. Der Arbeitgeber darf seine Mitarbeiter, die Kinder bis 14 Jahre oder Pflegebedürftige zu betreuen haben, in „außer-gewöhnlichen Situationen“ mit zusätzlich bis zu 600 Euro steuerfrei unterstützen, wenn der Ar-beitnehmer die Kosten nachweist.
Unabhängig von diesem Betrag können Eltern pro Jahr pro Kind bis 14 Jahre bis zu 6000 Euro an Betreuungskosten steuerlich geltend machen. Dazu zählen auch private Anbieter. Zwei Drittel davon, also maximal 4000 Euro, können vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden.
■ Coronabonus: Bis zu 1500 Euro sind steuerfreiJeder Arbeitnehmer kann während der Pandemie einen steuerfreien Bonus seines Arbeitgebers in Höhe von maximal 1500 Euro erhalten. Voraus-setzung dafür ist, dass es sich wirklich um eine zu-sätzliche Prämie handelt, die nicht zum regulären Gehalt gehört. Weihnachtsgeld oder der Jahres-bonus gehören nicht dazu.
„Eine Stückelung auf mehrere Auszahlungen ist dabei möglich“, erklärt der Bund der Steuer-zahler (BdSt). Insgesamt könne der Höchstbetrag aber nur einmal geltend gemacht werden. Es lohnt sich also, den Chef gegebenenfalls daran zu er-innern, wenn er den Betrag noch nicht aus-geschöpft hat. Der Steuervorteil läuft Ende März 2022 aus.
■ Dienstleistungen im Haushalt: Zahlungs-zeitpunkt ist entscheidendJeweils 20 Prozent der Aufwendungen am Haus und im Haushalt können Steuerpflichtige jedes Jahr beim Finanzamt einreichen, die Beträge wer-den dann direkt von den bereits gezahlten Steuern abgezogen und zurückerstattet. Dabei gelten al-lerdings verschiedene Höchstsummen.
Am meisten Steuern sparen lassen sich mit den sogenannten haushaltsnahen Dienstleistun-gen. Dazu zählen Au-pair, Gärtner, Winterdienst, aber auch eine ambulante Pflegekraft oder eine selbstständige Putzhilfe. Mit deren Lohnkosten lässt sich die Steuerlast um bis zu 4000 Euro sen-ken. Wichtig hierbei ist der Zeitpunkt der Zah-lung, nicht das Rechnungsdatum. Extratipp für Mieter: Sie können auch die Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen aus ihren Miet-nebenkosten absetzen, beispielsweise Hausrei-nigung oder Winterdienst, rät das Portal Finanz-tip. Wer einen Minijobber als dauerhafte Unter-
stützung beschäftigt, kann von dessen Lohn maximal 510 Euro steuerlich absetzen. Durch Handwerkerkosten – mit Ausnahme der Aus-gaben für Material – kann die Steuerzahlung um maximal 1200 Euro sinken. Auch hier entscheidet immer der Zeitpunkt der Zahlung. „Bei größeren Arbeiten ist es auch möglich, im alten Jahr eine Abschlagszahlung zu leisten und den Rest erst im kommenden Jahr zu zahlen“, weiß der BdSt.
Wichtig für alle unverheirateten Paare: Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusam-men, können sie die Höchstbeträge für haushalts-nahe Dienstleistungen, Minijob und Handwerker insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen.
■ Eigentümer: Energetische Sanierung und Wohnungsneubau werden gefördertSeit 2020 wird der Austausch von Heizungen, der Einbau neuer Fenster oder die Dämmung von Dä-chern steuerlich stärker gefördert. Ebenfalls 20 Prozent der angefallenen Kosten – diesmal für Material und Arbeitslohn – und bis zu 40.000 Euro können über drei Jahre verteilt von der Steu-erlast abgezogen werden. „Die Ausgaben dürfen jedoch nicht gleichzeitig auch als Handwerkerkos-ten geltend gemacht werden“, warnt Rauhöft.
Private Investorinnen und Investoren können noch bis Jahresende von einer Sonderabschreibung profitieren. Wer neuen Mietwohnraum schafft, kann vier Jahre lang maximal je fünf Prozent der Gebäudekosten als Sonderabschreibung absetzen – zusätzlich zur normalen Abschreibung von zwei Prozent im Jahr – macht insgesamt 28 Prozent.
■ Gesundheitskosten: Hohe Kosten für Brillen und Kuren absetzenDie Krankenkassen knausern, aber der Fiskus hilft. Die Kosten für Zahnersatz, Brillen, Kuren
Ausgabengestaltung vor dem Jahresende
Jetzt noch schnell Steuern für 2021 sparen
Für viele Kosten ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Es kann sinnvoll sein, Ausgaben noch vorzuziehen oder
sie lieber ins nächste Jahr zu verschieben.
Wer im nächsten Jahr durch einen Jobwechsel mehr
verdienen wird, sollte sich die Abfindung noch im alten Jahr auszahlen lassen.
Uwe RauhöftGeschäftsführer beim
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Geldanlage
38
oder Heilpraktikerbehandlungen müssen Patien-ten zu großen Teilen übernehmen. In der Steu-ererklärung dürfen sie jedoch als „außergewöhn-liche Belastungen“ geltend gemacht werden. Bei Eltern umfasst das auch entsprechende Ausgaben für ihre Kinder. Voraussetzung ist, dass die Auf-wendungen den „zumutbaren Eigenanteil“ über-schreiten. Dieser Eigenanteil richtet sich nach der Höhe der Einkünfte (abzüglich etwaiger Freibe-träge), dem Familienstand und der Anzahl der Kinder. Für einen alleinerziehenden Mann mit einem Kind und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro liegt der Eigenanteil bei rund 1000 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern und einem
Einkommen von 90.000 Euro pro Jahr muss rund 3000 Euro an Gesundheitskosten komplett aus eigener Tasche zahlen.
Steuerzahler und -zahlerinnen sollten also ei-nen Kassensturz machen und wenn sie kurz vor der Schwelle sind, noch in diesem Jahr eine neue Brille kaufen oder eine Zahnarztbehandlung zah-len. „Wer weit unter der Belastungsgrenze liegt, sollte Anschaffungen – soweit dies möglich ist – ins nächste Jahr verschieben“, rät der BdSt. Tragen Sie trotzdem alle Gesundheitskosten ab dem ers-ten Euro in der Steuererklärung ein, denn beim Bundesfinanzhof ist ein Verfahren zum zumut-baren Eigenanteil anhängig (Az. VI R 18/19).
■ Kapitaleinkünfte: Freibetrag nutzen und Steuern optimierenBanken verrechnen die Gewinne und Verluste aus allen Konten und Depots eines Kunden nach be-stimmten Regeln automatisch steuerschonend. Erst wenn der Saldo den Freibetrag von 801 Euro pro Jahr übersteigt, führen sie Abgeltungsteuer ab. Dafür muss die Kundin vorab einen Freistel-lungsantrag erteilt haben, wenn nötig bei meh-reren Instituten. Andernfalls kann sie die zu viel gezahlten Steuern über die Steuererklärung zu-rückholen. Die Mühe kann umgehen, wer vor dem Jahresende prüft, wo die Freistellungsaufträ-ge wie weit ausgeschöpft sind und diese gegebe-nenfalls noch anpasst.
Anleger, die ihre Konten und Depots auf mehrere Institute verteilt haben, sollten sich an-fallende Miese bescheinigen lassen. Damit können Verluste aus dem Depot einer Bank mit Gewin-nen bei einer anderen Bank steuermindernd ver-rechnet werden. Der Antrag auf Verlustbeschei-nigung muss bis zum 15. Dezember gestellt wer-den. Eine Ausnahme gibt es bei Totalverlusten aus Aktien, Optionsscheinen und Knock-out-Zertifikaten. Diese dürfen bis 20.000 Euro mit Gewinnen aus Kapitalanlagen verrechnet werden. Dies erfolgt jedoch ausschließlich über die Steu-ererklärung. Das Gleiche gilt für Verluste aus Ter-mingeschäften.
Steuerzahler mit einem Jahreseinkommen von bis zu 9744 Euro (2021) zahlen keine Ein-kommensteuer. Sie können sich außerdem von der Abgeltungssteuer befreien lassen, indem sie eine Nichtveranlagungsbescheinigung beim Fi-
nanzamt beantragen. Diese gilt für drei Jahre. Alleanderen sollten den Freibetrag von 801 Euro jähr-lich ruhig ausnutzen. Ungenutzte Beträge könnennicht auf Folgejahre übertragen werden. Daher„ist es ratsam, bei hohen Gewinnen am Kapital-markt, diese auch bis zu dieser Höhe zu realisie-ren“, empfiehlt der BdSt. Das kann zum Beispielbedeuten, Fonds-Anteile entsprechend zu ver-kaufen, dass ein Gewinn von 801 Euro realisiertwird. Danach kann der Veräußerungserlös direktwieder investiert werden.
■ Spenden: Schriftlichen Nachweis bereit-haltenWer Gutes tut, den belohnt der Fiskus. Bis zu 20Prozent ihrer Einkünfte (abzüglich etwaiger Frei-beträge) dürfen Arbeitnehmer jedes Jahr spendenund können dies voll absetzen, das heißt ihr zuversteuerndes Einkommen um exakt die Spen-densumme reduzieren. Diesen Betrag können Siealso bis zum Jahresende noch ausschöpfen. Übriggebliebene Beträge lassen sich auf die Folgejahrevortragen.
Für Spenden bis 300 Euro ist keine formaleZuwendungsbescheinigung nötig, es genügt derKontoauszug und ein Beleg der Spendenorgani-sation. Kommt das Geld Betroffenen der Coro-nakrise oder Flutopfern zugute – egal in welcherHöhe –, ist ebenfalls kein formaler Nachweis er-forderlich. Grundsätzlich braucht der Spenden-nachweis nicht mehr der Einkommensteuererklä-rung beigefügt zu werden, die Bescheinigungmuss dem Finanzamt nur noch auf Anforderungvorgelegt werden. Dafür muss sie mindestens einJahr lang nach Bekanntgabe des Steuerbescheidsaufbewahrt werden.
■ Steuervorteile für Ehepaare: Steuerklas-sen überdenkenVerheiratete können nicht nur das Bett, sondernauch die Einkommensteuer teilen und sparen someist viel Geld. Wer noch bis zum 31.12. heiratet,kann den Splittingtarif schon für 2021 nutzen. Ei-ne standesamtliche Trauung genügt.
Auch getrennt lebende Paare können 2021noch in den Genuss der Steuervergünstigungkommen. Bedingung: Bis Silvester müssen sie ei-nen ernst gemeinten Versöhnungsversuch unter-nehmen. Laut einem Urteil des Bundesfinanzhofskann dieser steuerlich sogar dann zählen, wennein Ehegatte nach wenigen Wochen wieder ausder gemeinsamen Wohnung auszieht (Az: VIR268 94). Jedes Jahr dürfen Ehepaare zudem neuentscheiden, ob sie getrennt oder zusammen ver-anlagt werden möchten. Die Steuerklassen kön-nen sie seit 2020 sogar mehrmals im Jahr wech-seln. Der Antrag dafür kann online bei www.elster.de gestellt werden. Mehr Infos zu denSteuerklassen finden Sie hier. Wichtig: Lohn-ersatzansprüche wie Arbeitslosen- oder Eltern-geld hängen auch vom zuvor bezogenen Netto-lohn ab. „Wer eine Arbeitslosigkeit befürchtetoder Nachwuchs plant, sollte frühzeitig über einenSteuerklassenwechsel nachdenken, um seinenNettoarbeitslohn zu erhöhen“, rät Rauhöft. Denndann erhöhen sich auch die Lohnersatzansprüche.
■ Steuererklärung machen: Das Finanzamt nimmt Erklärungen bis 2017 anUm überhaupt Geld vom Finanzamt zurück-zubekommen, müssen Arbeitnehmer eine Steu-ererklärung einreichen. Die Mühe lohnt sich. LautStatistischem Bundesamt überwies der Fiskusnach den jüngsten verfügbaren Daten im Jahr2017 im Schnitt 1051 Euro zurück. Arbeitnehmer,die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuerer-klärung verpflichtet sind, dürfen sich vier JahreZeit lassen. Bis 31. Dezember 2021 können sie alsonoch ihre Steuererklärungen für die Jahre ab 2017nachreichen. Und dann winkt sogar ein Bonbon,denn das Finanzamt muss auf eine Steuerrücker-stattung Zinsen zahlen. Wer aber zur Nachzah-lung aufgefordert wird, der bekommt Nachzah-lungszinsen in der gleichen Höhe aufgebrummt.Zuletzt lag der Zinssatz bei 0,5 Prozent, dieserwurde jedoch als verfassungswidrig eingestuft undmuss nun neu festgelegt werden.
Die Steuererklärung: Arbeitnehmer, die nicht
zur Abgabe einer Einkommen-steuererklärung verpflichtet sind, dürfen sich vier Jahre
Zeit lassen.
imag
o/W
este
nd61
Altersvorsorgebeiträge
Betreuungskosten
Energetische Gebäudesanierung
Gesundheitskosten
Handwerker
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Homeoffice
Minijobber
Spenden
Werbungskosten
25.787
6.000
200.000
6.000
20.000
1.250
2.550
> 1.000
€
€
€
> Eigenanteil
€
€
€
€
unbegrenzt
€
€
€
individuell
€
individuell
individuell
€
€
€
€
92
66
20
100
20
20
100
20
20
100
%
%
%2
%
%
%
%
%
%3
%4
23.724
4.000
1.250
13.333
1.200
4.000
510
Diese Ausgaben lassen sich geltend machen
Max. Betrag Pro Jahr absetzbarMax. Reduzierung pro Jahr:
Einkommen1 Steuerlast
1) Zu versteuerndes Einkommen; 2) Verteilt auf drei Jahre; 3) Der eigenen Einkünfte;4) Bis 800 Euro Netto sofort abzugsfähig, darüber hinaus gemäß den Afa-Tabellen • Quelle: EinkommensteuergesetzHANDELSBLATT
Steuern sparen
1051Euro
– so viel bekommen Arbeitnehmer nach der Abgabe ihrer Steuererklärung
durchschnittlich vom Finanzamt wieder.
Quelle:Statistisches Bundesamt
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Geldanlage
39
Laura de la Motte Frankfurt
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende ent-gegen und damit laufen auch einige Steu-ervorteile aus. Nicht nur deshalb lässt sich bei der eigenen Steuererklärung bis Sil-vester oft noch was rausholen. Das Fi-nanzamt berechnet die Lohnsteuer auf
Basis des Gehalts. Und diese Vorauszahlung ist oft zu hoch, denn viele Ausgaben können steu-erlich geltend gemacht werden. Das heißt, sie werden entweder vom zu versteuernden Einkom-men oder von der Steuerlast direkt abgezogen. Wer schlau ist, kann seine Steuern verringern und gegebenenfalls eine höhere Rückerstattung raus-holen. Für all diese Kosten ist der richtige Zeit-punkt entscheidend. Je nachdem, wie stark die anrechenbaren Beträge schon ausgenutzt wurden, kann es sinnvoll sein, Ausgaben noch vorzuziehen oder sie lieber ins nächste Jahr zu schieben.
Aufwendungen für Dienstleistungen rund um Haus und Haushalt werden direkt von der Steu-erlast abgezogen. Hier profitieren alle Steuer-pflichtigen gleichermaßen. Sind die abzugsfähigen Kosten größer als die Steuerschuld, verfällt aller-dings der Rest.
Werbungskosten, Spenden, Sonderausgaben für Gesundheit, Betreuung oder Altersvorsorge senken dagegen das zu versteuernde Einkommen, auf dessen Basis die Steuerlast neu berechnet und die Differenz erstattet wird. „Damit können Spit-zenverdiener hier mehr profitieren, denn bei ihnen macht sich eine Senkung des zu versteuernden Einkommens in einer stärkeren Steuerrückerstat-tung bemerkbar“, erklärt Uwe Rauhöft, Geschäfts-führer beim Bundesverband Lohnsteuerhilfever-eine. Das liegt an der Progression der Steuersätze. Hinzu kommt: Sind diese Ausgaben in einem Jahr so hoch, dass die Steuer auf einen negativen Betrag festgesetzt wird, kann der Steuerpflichtige die Ver-luste ins nächste Jahr vortragen und dann bei-spielsweise die übrig gebliebenen Werbungskosten geltend machen. Das kommt zum Beispiel bei Stu-dierenden regelmäßig vor, die ihre Studiengebüh-ren als Werbungskosten ansetzen.
Daher gilt: Wer im kommenden Jahr weniger Geld zur Verfügung haben wird – sei es durch Rente, Elternzeit oder auch Arbeitslosigkeit – zahlt auch weniger oder gar keine Einkommen-steuer und kann möglicherweise gewisse Aus-gaben nicht mehr in gleichem Maße steuermin-dernd nutzen. Diejenigen sollten versuchen, steu-erwirksame Ausgaben noch in diesem Jahr zu tätigen. Das Handelsblatt gibt einen Überblick, wie sich kurz vor dem Jahresende 2021 noch Steu-ern sparen lassen:
■ Abfindung: Bei Mehrverdienst auszahlen lassenDas richtige Timing bei der Auszahlung der Ab-findung entscheidet darüber, wie viel dem Fiskus von der Extrazahlung in den Schoß fällt. Wie man am meisten Steuern spart, hängt vom aktuellen Steuersatz ab. Und davon, wie hoch das Einkom-
men im laufenden Jahr und im kommenden Jahr ist. „Wer im nächsten Jahr durch einen Jobwechsel mehr verdienen wird, sollte sich die Abfindung noch im alten Jahr auszahlen lassen“, erklärt Rau-höft eine Faustregel. „Wenn jemand weniger ver-dienen wird, lohnt es sich, den optimalen Auszah-lungszeitpunkt vom Profi ausrechnen zu lassen.“
■ Betreuung: Homeschooling steuerlich geltend machenDer Lockdown im ersten Halbjahr, als vor allem die Schulen geschlossen waren, brachte viele El-tern in große Schwierigkeiten. Der Arbeitgeber darf seine Mitarbeiter, die Kinder bis 14 Jahre oder Pflegebedürftige zu betreuen haben, in „außer-gewöhnlichen Situationen“ mit zusätzlich bis zu 600 Euro steuerfrei unterstützen, wenn der Ar-beitnehmer die Kosten nachweist.
Unabhängig von diesem Betrag können Eltern pro Jahr pro Kind bis 14 Jahre bis zu 6000 Euro an Betreuungskosten steuerlich geltend machen. Dazu zählen auch private Anbieter. Zwei Drittel davon, also maximal 4000 Euro, können vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden.
■ Coronabonus: Bis zu 1500 Euro sind steuerfreiJeder Arbeitnehmer kann während der Pandemie einen steuerfreien Bonus seines Arbeitgebers in Höhe von maximal 1500 Euro erhalten. Voraus-setzung dafür ist, dass es sich wirklich um eine zu-sätzliche Prämie handelt, die nicht zum regulären Gehalt gehört. Weihnachtsgeld oder der Jahres-bonus gehören nicht dazu.
„Eine Stückelung auf mehrere Auszahlungen ist dabei möglich“, erklärt der Bund der Steuer-zahler (BdSt). Insgesamt könne der Höchstbetrag aber nur einmal geltend gemacht werden. Es lohnt sich also, den Chef gegebenenfalls daran zu er-innern, wenn er den Betrag noch nicht aus-geschöpft hat. Der Steuervorteil läuft Ende März 2022 aus.
■ Dienstleistungen im Haushalt: Zahlungs-zeitpunkt ist entscheidendJeweils 20 Prozent der Aufwendungen am Haus und im Haushalt können Steuerpflichtige jedes Jahr beim Finanzamt einreichen, die Beträge wer-den dann direkt von den bereits gezahlten Steuern abgezogen und zurückerstattet. Dabei gelten al-lerdings verschiedene Höchstsummen.
Am meisten Steuern sparen lassen sich mit den sogenannten haushaltsnahen Dienstleistun-gen. Dazu zählen Au-pair, Gärtner, Winterdienst, aber auch eine ambulante Pflegekraft oder eine selbstständige Putzhilfe. Mit deren Lohnkosten lässt sich die Steuerlast um bis zu 4000 Euro sen-ken. Wichtig hierbei ist der Zeitpunkt der Zah-lung, nicht das Rechnungsdatum. Extratipp für Mieter: Sie können auch die Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen aus ihren Miet-nebenkosten absetzen, beispielsweise Hausrei-nigung oder Winterdienst, rät das Portal Finanz-tip. Wer einen Minijobber als dauerhafte Unter-
stützung beschäftigt, kann von dessen Lohn maximal 510 Euro steuerlich absetzen. Durch Handwerkerkosten – mit Ausnahme der Aus-gaben für Material – kann die Steuerzahlung um maximal 1200 Euro sinken. Auch hier entscheidet immer der Zeitpunkt der Zahlung. „Bei größeren Arbeiten ist es auch möglich, im alten Jahr eine Abschlagszahlung zu leisten und den Rest erst im kommenden Jahr zu zahlen“, weiß der BdSt.
Wichtig für alle unverheirateten Paare: Leben zwei Alleinstehende in einem Haushalt zusam-men, können sie die Höchstbeträge für haushalts-nahe Dienstleistungen, Minijob und Handwerker insgesamt jeweils nur einmal in Anspruch nehmen.
■ Eigentümer: Energetische Sanierung und Wohnungsneubau werden gefördertSeit 2020 wird der Austausch von Heizungen, der Einbau neuer Fenster oder die Dämmung von Dä-chern steuerlich stärker gefördert. Ebenfalls 20 Prozent der angefallenen Kosten – diesmal für Material und Arbeitslohn – und bis zu 40.000 Euro können über drei Jahre verteilt von der Steu-erlast abgezogen werden. „Die Ausgaben dürfen jedoch nicht gleichzeitig auch als Handwerkerkos-ten geltend gemacht werden“, warnt Rauhöft.
Private Investorinnen und Investoren können noch bis Jahresende von einer Sonderabschreibung profitieren. Wer neuen Mietwohnraum schafft, kann vier Jahre lang maximal je fünf Prozent der Gebäudekosten als Sonderabschreibung absetzen – zusätzlich zur normalen Abschreibung von zwei Prozent im Jahr – macht insgesamt 28 Prozent.
■ Gesundheitskosten: Hohe Kosten für Brillen und Kuren absetzenDie Krankenkassen knausern, aber der Fiskus hilft. Die Kosten für Zahnersatz, Brillen, Kuren
Ausgabengestaltung vor dem Jahresende
Jetzt noch schnell Steuern für 2021 sparen
Für viele Kosten ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Es kann sinnvoll sein, Ausgaben noch vorzuziehen oder
sie lieber ins nächste Jahr zu verschieben.
Wer im nächsten Jahr durch einen Jobwechsel mehr
verdienen wird, sollte sich die Abfindung noch im alten Jahr auszahlen lassen.
Uwe RauhöftGeschäftsführer beim
Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Geldanlage
38
oder Heilpraktikerbehandlungen müssen Patien-ten zu großen Teilen übernehmen. In der Steu-ererklärung dürfen sie jedoch als „außergewöhn-liche Belastungen“ geltend gemacht werden. Bei Eltern umfasst das auch entsprechende Ausgaben für ihre Kinder. Voraussetzung ist, dass die Auf-wendungen den „zumutbaren Eigenanteil“ über-schreiten. Dieser Eigenanteil richtet sich nach der Höhe der Einkünfte (abzüglich etwaiger Freibe-träge), dem Familienstand und der Anzahl der Kinder. Für einen alleinerziehenden Mann mit einem Kind und einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro liegt der Eigenanteil bei rund 1000 Euro. Eine Familie mit zwei Kindern und einem
Einkommen von 90.000 Euro pro Jahr muss rund 3000 Euro an Gesundheitskosten komplett aus eigener Tasche zahlen.
Steuerzahler und -zahlerinnen sollten also ei-nen Kassensturz machen und wenn sie kurz vor der Schwelle sind, noch in diesem Jahr eine neue Brille kaufen oder eine Zahnarztbehandlung zah-len. „Wer weit unter der Belastungsgrenze liegt, sollte Anschaffungen – soweit dies möglich ist – ins nächste Jahr verschieben“, rät der BdSt. Tragen Sie trotzdem alle Gesundheitskosten ab dem ers-ten Euro in der Steuererklärung ein, denn beim Bundesfinanzhof ist ein Verfahren zum zumut-baren Eigenanteil anhängig (Az. VI R 18/19).
■ Kapitaleinkünfte: Freibetrag nutzen und Steuern optimierenBanken verrechnen die Gewinne und Verluste aus allen Konten und Depots eines Kunden nach be-stimmten Regeln automatisch steuerschonend. Erst wenn der Saldo den Freibetrag von 801 Euro pro Jahr übersteigt, führen sie Abgeltungsteuer ab. Dafür muss die Kundin vorab einen Freistel-lungsantrag erteilt haben, wenn nötig bei meh-reren Instituten. Andernfalls kann sie die zu viel gezahlten Steuern über die Steuererklärung zu-rückholen. Die Mühe kann umgehen, wer vor dem Jahresende prüft, wo die Freistellungsaufträ-ge wie weit ausgeschöpft sind und diese gegebe-nenfalls noch anpasst.
Anleger, die ihre Konten und Depots auf mehrere Institute verteilt haben, sollten sich an-fallende Miese bescheinigen lassen. Damit können Verluste aus dem Depot einer Bank mit Gewin-nen bei einer anderen Bank steuermindernd ver-rechnet werden. Der Antrag auf Verlustbeschei-nigung muss bis zum 15. Dezember gestellt wer-den. Eine Ausnahme gibt es bei Totalverlusten aus Aktien, Optionsscheinen und Knock-out-Zertifikaten. Diese dürfen bis 20.000 Euro mit Gewinnen aus Kapitalanlagen verrechnet werden. Dies erfolgt jedoch ausschließlich über die Steu-ererklärung. Das Gleiche gilt für Verluste aus Ter-mingeschäften.
Steuerzahler mit einem Jahreseinkommen von bis zu 9744 Euro (2021) zahlen keine Ein-kommensteuer. Sie können sich außerdem von der Abgeltungssteuer befreien lassen, indem sie eine Nichtveranlagungsbescheinigung beim Fi-
nanzamt beantragen. Diese gilt für drei Jahre. Alleanderen sollten den Freibetrag von 801 Euro jähr-lich ruhig ausnutzen. Ungenutzte Beträge könnennicht auf Folgejahre übertragen werden. Daher„ist es ratsam, bei hohen Gewinnen am Kapital-markt, diese auch bis zu dieser Höhe zu realisie-ren“, empfiehlt der BdSt. Das kann zum Beispielbedeuten, Fonds-Anteile entsprechend zu ver-kaufen, dass ein Gewinn von 801 Euro realisiertwird. Danach kann der Veräußerungserlös direktwieder investiert werden.
■ Spenden: Schriftlichen Nachweis bereit-haltenWer Gutes tut, den belohnt der Fiskus. Bis zu 20Prozent ihrer Einkünfte (abzüglich etwaiger Frei-beträge) dürfen Arbeitnehmer jedes Jahr spendenund können dies voll absetzen, das heißt ihr zuversteuerndes Einkommen um exakt die Spen-densumme reduzieren. Diesen Betrag können Siealso bis zum Jahresende noch ausschöpfen. Übriggebliebene Beträge lassen sich auf die Folgejahrevortragen.
Für Spenden bis 300 Euro ist keine formaleZuwendungsbescheinigung nötig, es genügt derKontoauszug und ein Beleg der Spendenorgani-sation. Kommt das Geld Betroffenen der Coro-nakrise oder Flutopfern zugute – egal in welcherHöhe –, ist ebenfalls kein formaler Nachweis er-forderlich. Grundsätzlich braucht der Spenden-nachweis nicht mehr der Einkommensteuererklä-rung beigefügt zu werden, die Bescheinigungmuss dem Finanzamt nur noch auf Anforderungvorgelegt werden. Dafür muss sie mindestens einJahr lang nach Bekanntgabe des Steuerbescheidsaufbewahrt werden.
■ Steuervorteile für Ehepaare: Steuerklas-sen überdenkenVerheiratete können nicht nur das Bett, sondernauch die Einkommensteuer teilen und sparen someist viel Geld. Wer noch bis zum 31.12. heiratet,kann den Splittingtarif schon für 2021 nutzen. Ei-ne standesamtliche Trauung genügt.
Auch getrennt lebende Paare können 2021noch in den Genuss der Steuervergünstigungkommen. Bedingung: Bis Silvester müssen sie ei-nen ernst gemeinten Versöhnungsversuch unter-nehmen. Laut einem Urteil des Bundesfinanzhofskann dieser steuerlich sogar dann zählen, wennein Ehegatte nach wenigen Wochen wieder ausder gemeinsamen Wohnung auszieht (Az: VIR268 94). Jedes Jahr dürfen Ehepaare zudem neuentscheiden, ob sie getrennt oder zusammen ver-anlagt werden möchten. Die Steuerklassen kön-nen sie seit 2020 sogar mehrmals im Jahr wech-seln. Der Antrag dafür kann online bei www.elster.de gestellt werden. Mehr Infos zu denSteuerklassen finden Sie hier. Wichtig: Lohn-ersatzansprüche wie Arbeitslosen- oder Eltern-geld hängen auch vom zuvor bezogenen Netto-lohn ab. „Wer eine Arbeitslosigkeit befürchtetoder Nachwuchs plant, sollte frühzeitig über einenSteuerklassenwechsel nachdenken, um seinenNettoarbeitslohn zu erhöhen“, rät Rauhöft. Denndann erhöhen sich auch die Lohnersatzansprüche.
■ Steuererklärung machen: Das Finanzamt nimmt Erklärungen bis 2017 anUm überhaupt Geld vom Finanzamt zurück-zubekommen, müssen Arbeitnehmer eine Steu-ererklärung einreichen. Die Mühe lohnt sich. LautStatistischem Bundesamt überwies der Fiskusnach den jüngsten verfügbaren Daten im Jahr2017 im Schnitt 1051 Euro zurück. Arbeitnehmer,die nicht zur Abgabe einer Einkommensteuerer-klärung verpflichtet sind, dürfen sich vier JahreZeit lassen. Bis 31. Dezember 2021 können sie alsonoch ihre Steuererklärungen für die Jahre ab 2017nachreichen. Und dann winkt sogar ein Bonbon,denn das Finanzamt muss auf eine Steuerrücker-stattung Zinsen zahlen. Wer aber zur Nachzah-lung aufgefordert wird, der bekommt Nachzah-lungszinsen in der gleichen Höhe aufgebrummt.Zuletzt lag der Zinssatz bei 0,5 Prozent, dieserwurde jedoch als verfassungswidrig eingestuft undmuss nun neu festgelegt werden.
Die Steuererklärung: Arbeitnehmer, die nicht
zur Abgabe einer Einkommen-steuererklärung verpflichtet sind, dürfen sich vier Jahre
Zeit lassen.
imag
o/W
este
nd61
Altersvorsorgebeiträge
Betreuungskosten
Energetische Gebäudesanierung
Gesundheitskosten
Handwerker
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Homeoffice
Minijobber
Spenden
Werbungskosten
25.787
6.000
200.000
6.000
20.000
1.250
2.550
> 1.000
€
€
€
> Eigenanteil
€
€
€
€
unbegrenzt
€
€
€
individuell
€
individuell
individuell
€
€
€
€
92
66
20
100
20
20
100
20
20
100
%
%
%2
%
%
%
%
%
%3
%4
23.724
4.000
1.250
13.333
1.200
4.000
510
Diese Ausgaben lassen sich geltend machen
Max. Betrag Pro Jahr absetzbarMax. Reduzierung pro Jahr:
Einkommen1 Steuerlast
1) Zu versteuerndes Einkommen; 2) Verteilt auf drei Jahre; 3) Der eigenen Einkünfte;4) Bis 800 Euro Netto sofort abzugsfähig, darüber hinaus gemäß den Afa-Tabellen • Quelle: EinkommensteuergesetzHANDELSBLATT
Steuern sparen
1051Euro
– so viel bekommen Arbeitnehmer nach der Abgabe ihrer Steuererklärung
durchschnittlich vom Finanzamt wieder.
Quelle:Statistisches Bundesamt
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Geldanlage
39
Susanne Schier Frankfurt
Hannover Rück hat den Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax zuletzt verpasst. Verstecken muss sich der weltweit dritt-größte Rückversicherer aber
nicht, wie die Zahlen für das dritte Quartal zeigen. Damit ist die Aktie für Anleger eine Alternative zu den Markt-führern Munich Re und Swiss Re. Die Muttergesellschaft Talanx könnte aber der noch etwas attraktivere Kauf sein.
Die Aktien der beiden MDax-Kon-zerne sind in diesem Jahr bereits gut gelaufen. Die Titel von Hannover Rück legten seit Jahresbeginn fast 25 Prozent zu, Papiere von Talanx um mehr als 30 Prozent. Laut dem Datenanbieter Bloomberg raten derzeit mehr als zwei Drittel der Analysten zum Kauf der Talanx-Aktie und knapp die Hälfte zum Kauf von Hannover Rück.
Im Schnitt sind die Finanzprofis aber zurückhaltend, was weitere Kurs-chancen betrifft. Angesichts der guten Aussichten könnten sich ihre Erwar-tungen jedoch als zu vorsichtig erwei-sen.
So hält Hannover Rück trotz hoher Großschadenbelastungen im dritten Quartal an seinem Gewinnziel fest. Unter dem Strich will der Konzern im Gesamtjahr 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro verdienen. Für 2022 stellt das Unternehmen einen Zuwachs auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht.
Bereits in den ersten neun Mona-ten dieses Jahres konnte Hannover Rück den Gewinn um 28 Prozent auf 856 Millionen Euro steigern. Der Ge-winn je Aktie habe die Konsensschät-zung um satte 23 Prozent übertroffen, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett.
Hannover Rück zeigt damit ähnlich wie die Konkurrenten auf der Gewinn-seite Stärke: Munich Re verdiente laut vorläufigen Zahlen in den ersten drei Quartalen 2,1 Milliarden Euro und be-stätigte das Ziel, ein Gesamtjahres-ergebnis von 2,8 Milliarden Euro zu er-reichen. Swiss Re verzeichnete zwi-schen Januar und September einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro), nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum.
Gleichwohl mussten die Rückver-sicherer im dritten Quartal 2021 hohe Schäden aus Naturkatastrophen weg-stecken, was die Gewinne zwischen Ju-li und September belastete. Die Netto-Großschadenbelastung von Hannover Rück stieg per Ende September auf 1,07 Milliarden Euro. Damit war das Großschadenbudget von 1,1 Milliarden Euro für das Gesamtjahr nahezu aus-geschöpft. Größter Nettoeinzelscha-den war der Hurrikan „Ida“, gefolgt vom Unwettertief „Bernd“. Swiss Re berichtete nach den ersten neun Mo-naten von Großschäden in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar.
Die Schäden durch die Coronapan-demie und die Naturkatastrophen füh-
ren jedoch dazu, dass die Rückver-sicherer höhere Preise durchsetzen können. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen bei Hannover Rück in den ers-ten neun Monaten des Jahres um zwölf Prozent auf 21,6 Milliarden Euro. Wäh-rungsbereinigt soll das Wachstum der Konzernbruttoprämie 2022 mindes-tens fünf Prozent betragen.
Das gute Ergebnis des Konzerns ist auch auf ein starkes Kapitalanlage-ergebnis zurückzuführen. Bemerkens-wert ist, dass Hannover Rück in den ersten neun Monaten eine Kapital-anlagenrendite von 2,9 Prozent erzielte und damit nahezu an die 3,0 Prozent von Swiss Re herankam. Bei der Divi-dende sind die Hannoveraner zurück-haltender als die Konkurrenz, setzten sich Mitte Oktober aber neue Ziele: Die Basisdividende soll künftig min-destens auf Vorjahresniveau bleiben. Die Messlatte legte das Unternehmen zuletzt bei 4,50 Euro je Aktie. Zusätz-lich ist eine Sonderdividende möglich.
Bezogen auf den aktuellen Kurs entspräche eine zum Vorjahr stabile Ausschüttung einer Dividendenrendite von unter drei Prozent. Das ist deutlich weniger als bei Spitzenreiter Swiss Re. Sollte es bei den Schweizern, wie von Analysten erwartet, im nächsten Früh-jahr zu einer Anhebung der Dividende von zuletzt 5,90 Franken je Aktie auf 6,60 Franken kommen, ergäbe sich ei-ne Dividendenrendite von über sieben Prozent.
Kein günstiger TitelAktuell ist die Hannover-Rück-Aktie zudem bereits mit dem 16-Fachen des für das laufende Jahr erwarteten Ge-winns bewertet – günstig sind die Titel also nicht. Thorsten Wenzel von der DZ Bank hält die Bewertung zwar für berechtigt, interessanter könnte aber die Aktie der Mutter Talanx sein. Sie ist mit 50,2 Prozent an Hannover Rück beteiligt. Bei Talanx wirke sich der Rü-ckenwind durch steigende Preise so-wohl in der Rück- als auch in der Indus-trieversicherung aus, schreibt Wenzel in seiner aktuellen Studie. In der Erst-versicherung sollte das Unternehmen endlich die Früchte langjähriger Sanie-rungen und Kostensenkungen ernten können. Er halte mittelfristig eine Neu-bewertung der Erstversicherungsakti-vitäten und damit der Talanx-Aktie für realistisch. Ähnlich hatte sich auch Be-renberg-Analyst Michael Huttner ge-äußert. Er hält Talanx für stark unter-bewertet, insbesondere wenn man den Anteil an der Rückversicherungstoch-ter herausrechne.
Aktie unter der Lupe: Hannover Rück
Alternative zu MarktführernQuartalszahlen des Rückversicherers übertreffen Analystenschätzungen.
dpa
Hannover Rück
HANDELSBLATT Quellen: Bloomberg, Thomson Reuters, Unternehmen, IBES1) Geschäftsjahr zum 31.12.2020; 2) 4.11.2021; 3) IBES-Prognose
UmsatzBörsenwertNettoergebnisDividendenrenditeEigenkapitalrenditeErgebnis je Aktie
Kurs-Gewinn-VerhältnisKurs am Hoch/Tief (52 Wochen)ISINHauptversammlungHomepage
Kennzahlen
Prozentuale Veränderung seit 4.11.2020
Dez. 2020Dez. 2021Dez. 2022Dez. 2021
4.11.2021 (15 Uhr)
¹²¹
¹
³³³
4.11.2020 4.11.2021
Aktienkurs
Stoxx Europe 600Versicherungen
Geldanlage1
40 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
86,0
84,5
83,0
81,5
80,0
11,7
11,5
11,3
11,1
10,9
HA
ND
ELSB
LATT
• Q
uelle
: Blo
ombe
rg
Brenntag: Aktienkurs in Euro
Deutsche Bank: Aktienkurs in Euro
82,€60
11,€05
4.11.3.11.2021
67
66
65
64
63
Heidelberg Cement: Aktienkurs in Euro 64,€70
Die größten Verlierer im Dax 40
Brenntag: Die Titel des Chemikalienhändlers rutschten um 2,5 Prozent ab.
Bre
nnta
g A
G
Am deutschen Aktienmarkt gab es eine vorgezogene Jahresendrally. Der Dax ist am Donnerstag mit 16.065 Punkten auf ein neues Rekordhoch gestiegen.
Zum Handelsschluss notierte er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 16.029,7 Zählern. Die alte Bestmarke lag bei 16.030 Zählern.
Die Basis für den neuen Kurssprung leg-te die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die ihre geldpolitische Wende gestar-tet hat. Das war so erwartet worden, nun ist die Unsicherheit aus dem Markt. Gleich-zeitig dämpfte Fed-Chef Jerome Powell Spekulationen auf eine nahende Zinserhö-hung.
Nun wird es spannend, ob der Dax die 16.000er-Marke nachhaltig überwinden kann. Das wäre erst bei einer Notierung zum
Handelsschluss deutlich oberhalb von 16.000 Punkten der Fall. Bei den aktuellen Kursen nur knapp oberhalb dieser Marke dürfte diese Entscheidung wohl erst am Frei-tag fallen.
Denn seit Mitte August ist dieser Wider-stand aus Sicht der technischen Analysten intakt. Zwar hat der Leitindex die besagte Schwelle vor dem heutigen Tag bereits zwei-mal überwunden. Danach aber haben schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den In-dex zum Handelsschluss wieder unter 16.000 Punkte drückten.
Zusammen mit den fallenden Ölpreisen geben auch wieder die Renditen am Anlei-hemarkt nach. Dieser Wert für die zehnjäh-rige Bundesanleihe lag mittlerweile wieder bei minus 0,22 Prozent. Am Montag dieser
Woche notierte diese Benchmark-Anleihe in der Spitze noch bei minus 0,07 Prozent.
Der Zusammenhang zwischen den bei-den Asset-Klassen: Ein niedriger Ölpreis be-ruhigt die Inflationsentwicklung. Dadurch geraten die Notenbanken nicht in Zug-zwang, ihre ultralockere Geldpolitik sehr schnell zu beenden – was wiederum für fal-lende Renditen am Anleihemarkt sorgt.
Fallende Zinsen sind stets eine Belastung für Bankaktien. So gibt der europäische Branchenindex trotz eines insgesamt freundlichen Marktumfelds 1,6 Prozent nach. In dem Index war die Aktie der Deut-schen Bank mit einem Minus von 4,2 Pro-zent der größte Verlierer.
Brenntag konnte mit einem Umsatz- und Gewinnsprung nicht überzeugen. Das
operative Ergebnis liege nur knapp über denErwartungen, und die Gesamtjahreszieleseien lediglich bekräftigt worden, monierteein Börsianer. Die Titel des Chemikalien-händlers, die in den vergangenen Wochenmehr als sechs Prozent zugelegt hatten,rutschten um 2,6 Prozent ab.
Anleger warfen die Aktien von Heidel-berg Cement aus den Depots, nachdem diesteigenden Energiekosten den Gewinn desBaustoffherstellers geschmälert hatten. „Dieheutige Ankündigung wird wahrscheinlichzu einer Reduzierung der Konsens-Gewinn-schätzungen für 2021 im niedrigen einstel-ligen Prozentbereich führen“, urteilen dieAnalysten von Citigroup. Die Papiere fielenin der Spitze um 4,9 Prozent auf ein Zwei-wochentief von 63,42 Euro. Jürgen Röder
Marktbericht
Dax klettert auf ein neues RekordhochFallende Anleiherenditen belasten die Bankaktien. Deutsche Bank war mit einem Minus von über vier Prozent größte Verliererin.
Geldanlage1
41
KanadaS&P TSX21 297,90
+0,15%
GroßbritannienS&P UK1 455,07
+0,60%
DeutschlandDAX
16 041,28
+0,51%
RusslandRTS
1 826,65*
–1,31%Japan
Nikkei 22529 794,37
+0,93 %
ChinaSSE Comp.
3 526,87
+0,81%
HongkongHang Seng25 188,34
+0,77%
FrankreichCAC 406 983,42
+0,47%
BrasilienBovespa
104 582,40
–1,39 %
Stoxx Europe 503 752,35
+0,44%Euro Stoxx 50
4 333,50
+0,55%S&P 5004 675,03
+0,31%
USADow Jones36 076,09
–0,23 %Nasdaq15 915,27
+0,66%
Europa
Leitbörsen im Überblick4.11.2021, ME(S)Z 17:03 Uhr
* Index vom Vortag • Quelle:
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Susanne Schier Frankfurt
Hannover Rück hat den Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax zuletzt verpasst. Verstecken muss sich der weltweit dritt-größte Rückversicherer aber
nicht, wie die Zahlen für das dritte Quartal zeigen. Damit ist die Aktie für Anleger eine Alternative zu den Markt-führern Munich Re und Swiss Re. Die Muttergesellschaft Talanx könnte aber der noch etwas attraktivere Kauf sein.
Die Aktien der beiden MDax-Kon-zerne sind in diesem Jahr bereits gut gelaufen. Die Titel von Hannover Rück legten seit Jahresbeginn fast 25 Prozent zu, Papiere von Talanx um mehr als 30 Prozent. Laut dem Datenanbieter Bloomberg raten derzeit mehr als zwei Drittel der Analysten zum Kauf der Talanx-Aktie und knapp die Hälfte zum Kauf von Hannover Rück.
Im Schnitt sind die Finanzprofis aber zurückhaltend, was weitere Kurs-chancen betrifft. Angesichts der guten Aussichten könnten sich ihre Erwar-tungen jedoch als zu vorsichtig erwei-sen.
So hält Hannover Rück trotz hoher Großschadenbelastungen im dritten Quartal an seinem Gewinnziel fest. Unter dem Strich will der Konzern im Gesamtjahr 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro verdienen. Für 2022 stellt das Unternehmen einen Zuwachs auf 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro in Aussicht.
Bereits in den ersten neun Mona-ten dieses Jahres konnte Hannover Rück den Gewinn um 28 Prozent auf 856 Millionen Euro steigern. Der Ge-winn je Aktie habe die Konsensschät-zung um satte 23 Prozent übertroffen, schrieb Jefferies-Analyst Philip Kett.
Hannover Rück zeigt damit ähnlich wie die Konkurrenten auf der Gewinn-seite Stärke: Munich Re verdiente laut vorläufigen Zahlen in den ersten drei Quartalen 2,1 Milliarden Euro und be-stätigte das Ziel, ein Gesamtjahres-ergebnis von 2,8 Milliarden Euro zu er-reichen. Swiss Re verzeichnete zwi-schen Januar und September einen Gewinn von 1,3 Milliarden Dollar (1,1 Milliarden Euro), nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum.
Gleichwohl mussten die Rückver-sicherer im dritten Quartal 2021 hohe Schäden aus Naturkatastrophen weg-stecken, was die Gewinne zwischen Ju-li und September belastete. Die Netto-Großschadenbelastung von Hannover Rück stieg per Ende September auf 1,07 Milliarden Euro. Damit war das Großschadenbudget von 1,1 Milliarden Euro für das Gesamtjahr nahezu aus-geschöpft. Größter Nettoeinzelscha-den war der Hurrikan „Ida“, gefolgt vom Unwettertief „Bernd“. Swiss Re berichtete nach den ersten neun Mo-naten von Großschäden in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar.
Die Schäden durch die Coronapan-demie und die Naturkatastrophen füh-
ren jedoch dazu, dass die Rückver-sicherer höhere Preise durchsetzen können. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen bei Hannover Rück in den ers-ten neun Monaten des Jahres um zwölf Prozent auf 21,6 Milliarden Euro. Wäh-rungsbereinigt soll das Wachstum der Konzernbruttoprämie 2022 mindes-tens fünf Prozent betragen.
Das gute Ergebnis des Konzerns ist auch auf ein starkes Kapitalanlage-ergebnis zurückzuführen. Bemerkens-wert ist, dass Hannover Rück in den ersten neun Monaten eine Kapital-anlagenrendite von 2,9 Prozent erzielte und damit nahezu an die 3,0 Prozent von Swiss Re herankam. Bei der Divi-dende sind die Hannoveraner zurück-haltender als die Konkurrenz, setzten sich Mitte Oktober aber neue Ziele: Die Basisdividende soll künftig min-destens auf Vorjahresniveau bleiben. Die Messlatte legte das Unternehmen zuletzt bei 4,50 Euro je Aktie. Zusätz-lich ist eine Sonderdividende möglich.
Bezogen auf den aktuellen Kurs entspräche eine zum Vorjahr stabile Ausschüttung einer Dividendenrendite von unter drei Prozent. Das ist deutlich weniger als bei Spitzenreiter Swiss Re. Sollte es bei den Schweizern, wie von Analysten erwartet, im nächsten Früh-jahr zu einer Anhebung der Dividende von zuletzt 5,90 Franken je Aktie auf 6,60 Franken kommen, ergäbe sich ei-ne Dividendenrendite von über sieben Prozent.
Kein günstiger TitelAktuell ist die Hannover-Rück-Aktie zudem bereits mit dem 16-Fachen des für das laufende Jahr erwarteten Ge-winns bewertet – günstig sind die Titel also nicht. Thorsten Wenzel von der DZ Bank hält die Bewertung zwar für berechtigt, interessanter könnte aber die Aktie der Mutter Talanx sein. Sie ist mit 50,2 Prozent an Hannover Rück beteiligt. Bei Talanx wirke sich der Rü-ckenwind durch steigende Preise so-wohl in der Rück- als auch in der Indus-trieversicherung aus, schreibt Wenzel in seiner aktuellen Studie. In der Erst-versicherung sollte das Unternehmen endlich die Früchte langjähriger Sanie-rungen und Kostensenkungen ernten können. Er halte mittelfristig eine Neu-bewertung der Erstversicherungsakti-vitäten und damit der Talanx-Aktie für realistisch. Ähnlich hatte sich auch Be-renberg-Analyst Michael Huttner ge-äußert. Er hält Talanx für stark unter-bewertet, insbesondere wenn man den Anteil an der Rückversicherungstoch-ter herausrechne.
Aktie unter der Lupe: Hannover Rück
Alternative zu MarktführernQuartalszahlen des Rückversicherers übertreffen Analystenschätzungen.
dpa
Hannover Rück
HANDELSBLATT Quellen: Bloomberg, Thomson Reuters, Unternehmen, IBES1) Geschäftsjahr zum 31.12.2020; 2) 4.11.2021; 3) IBES-Prognose
UmsatzBörsenwertNettoergebnisDividendenrenditeEigenkapitalrenditeErgebnis je Aktie
Kurs-Gewinn-VerhältnisKurs am Hoch/Tief (52 Wochen)ISINHauptversammlungHomepage
Kennzahlen
Prozentuale Veränderung seit 4.11.2020
Dez. 2020Dez. 2021Dez. 2022Dez. 2021
4.11.2021 (15 Uhr)
¹²¹
¹
³³³
4.11.2020 4.11.2021
Aktienkurs
Stoxx Europe 600Versicherungen
Geldanlage1
40 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
86,0
84,5
83,0
81,5
80,0
11,7
11,5
11,3
11,1
10,9
HA
ND
ELSB
LATT
• Q
uelle
: Blo
ombe
rg
Brenntag: Aktienkurs in Euro
Deutsche Bank: Aktienkurs in Euro
82,€60
11,€05
4.11.3.11.2021
67
66
65
64
63
Heidelberg Cement: Aktienkurs in Euro 64,€70
Die größten Verlierer im Dax 40
Brenntag: Die Titel des Chemikalienhändlers rutschten um 2,5 Prozent ab.
Bre
nnta
g A
G
Am deutschen Aktienmarkt gab es eine vorgezogene Jahresendrally. Der Dax ist am Donnerstag mit 16.065 Punkten auf ein neues Rekordhoch gestiegen.
Zum Handelsschluss notierte er mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 16.029,7 Zählern. Die alte Bestmarke lag bei 16.030 Zählern.
Die Basis für den neuen Kurssprung leg-te die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die ihre geldpolitische Wende gestar-tet hat. Das war so erwartet worden, nun ist die Unsicherheit aus dem Markt. Gleich-zeitig dämpfte Fed-Chef Jerome Powell Spekulationen auf eine nahende Zinserhö-hung.
Nun wird es spannend, ob der Dax die 16.000er-Marke nachhaltig überwinden kann. Das wäre erst bei einer Notierung zum
Handelsschluss deutlich oberhalb von 16.000 Punkten der Fall. Bei den aktuellen Kursen nur knapp oberhalb dieser Marke dürfte diese Entscheidung wohl erst am Frei-tag fallen.
Denn seit Mitte August ist dieser Wider-stand aus Sicht der technischen Analysten intakt. Zwar hat der Leitindex die besagte Schwelle vor dem heutigen Tag bereits zwei-mal überwunden. Danach aber haben schnell Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den In-dex zum Handelsschluss wieder unter 16.000 Punkte drückten.
Zusammen mit den fallenden Ölpreisen geben auch wieder die Renditen am Anlei-hemarkt nach. Dieser Wert für die zehnjäh-rige Bundesanleihe lag mittlerweile wieder bei minus 0,22 Prozent. Am Montag dieser
Woche notierte diese Benchmark-Anleihe in der Spitze noch bei minus 0,07 Prozent.
Der Zusammenhang zwischen den bei-den Asset-Klassen: Ein niedriger Ölpreis be-ruhigt die Inflationsentwicklung. Dadurch geraten die Notenbanken nicht in Zug-zwang, ihre ultralockere Geldpolitik sehr schnell zu beenden – was wiederum für fal-lende Renditen am Anleihemarkt sorgt.
Fallende Zinsen sind stets eine Belastung für Bankaktien. So gibt der europäische Branchenindex trotz eines insgesamt freundlichen Marktumfelds 1,6 Prozent nach. In dem Index war die Aktie der Deut-schen Bank mit einem Minus von 4,2 Pro-zent der größte Verlierer.
Brenntag konnte mit einem Umsatz- und Gewinnsprung nicht überzeugen. Das
operative Ergebnis liege nur knapp über denErwartungen, und die Gesamtjahreszieleseien lediglich bekräftigt worden, monierteein Börsianer. Die Titel des Chemikalien-händlers, die in den vergangenen Wochenmehr als sechs Prozent zugelegt hatten,rutschten um 2,6 Prozent ab.
Anleger warfen die Aktien von Heidel-berg Cement aus den Depots, nachdem diesteigenden Energiekosten den Gewinn desBaustoffherstellers geschmälert hatten. „Dieheutige Ankündigung wird wahrscheinlichzu einer Reduzierung der Konsens-Gewinn-schätzungen für 2021 im niedrigen einstel-ligen Prozentbereich führen“, urteilen dieAnalysten von Citigroup. Die Papiere fielenin der Spitze um 4,9 Prozent auf ein Zwei-wochentief von 63,42 Euro. Jürgen Röder
Marktbericht
Dax klettert auf ein neues RekordhochFallende Anleiherenditen belasten die Bankaktien. Deutsche Bank war mit einem Minus von über vier Prozent größte Verliererin.
Geldanlage1
41
KanadaS&P TSX21 297,90
+0,15%
GroßbritannienS&P UK1 455,07
+0,60%
DeutschlandDAX
16 041,28
+0,51%
RusslandRTS
1 826,65*
–1,31%Japan
Nikkei 22529 794,37
+0,93 %
ChinaSSE Comp.
3 526,87
+0,81%
HongkongHang Seng25 188,34
+0,77%
FrankreichCAC 406 983,42
+0,47%
BrasilienBovespa
104 582,40
–1,39 %
Stoxx Europe 503 752,35
+0,44%Euro Stoxx 50
4 333,50
+0,55%S&P 5004 675,03
+0,31%
USADow Jones36 076,09
–0,23 %Nasdaq15 915,27
+0,66%
Europa
Leitbörsen im Überblick4.11.2021, ME(S)Z 17:03 Uhr
* Index vom Vortag • Quelle:
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
4.11.1.9.2021
66
63
60
57
54
Quelle: BloombergHANDELSBLATT
Lanxess: Aktienkurs in Euro 55,€26
Die Lanxess-Aktien gaben nach einem gekappten Ergeb-nisziel mehr als sieben Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 54,86 Euro nach. Das war der schwärzeste Börsentag seit rund einem Jahr für das Papier des Spezialchemie-Kon-zerns. Die Analysten von Credit Suisse und Jefferies sehen Gegenwind für die Aktien, da die neuen Ziele unter den durchschnittlichen Schätzungen lägen.
Chart des Tages
Geldanlage
42 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Märkte heute
Tops FlopsDax
MDax
Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50Aktienindex in Punkten
Zalando +4,59 %
Deutsche Post NA +3,08 %
Siemens Energy +2,79 %
Deutsche Bank NA -3,53 %
HeidelbergCement -2,82 %
Brenntag NA -2,45 %
Alstria Office +17,33 %
Nemetschek +5,08 %
Hypoport SE +3,85 %
Lanxess -6,99 %
freenet NA -6,91 %
ProSiebenSat.1 -5,93 %
Adyen +3,49 %
Deutsche Post NA +3,08 %
Universal Music Gr. +2,74 %
Banco Santander -2,60 %
BBVA -2,56 %
Flutter Entertain. -2,34 %
Stand: 04.11. / ME(S)Z 17:05 Uhr Quelle:
zum Vorjahr +37,05 %
4 332,13Punkte
zum Vorjahr+0,52 %
Euro-Wechselkurs
1,1569 US$
-1,30 % zum Vorjahr
10-jährige Bundesanleihe
-0,2260 %
+0,41 % zum Vorjahr
Rendite
Brentöl 82,74 US$je Barrel
+100,83 % zum Vorjahr
Gold 1793,52 US$
-5,81 % zum Vorjahr
je Feinunze
4.11.20211.12.2020 4.11.201.12.2020 021
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.2021
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.2021
Tagesverlauf
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.2021
je Euro
1.12.2020 4.11.2021 1.12.2020 44.11.2021
Dividendenrendite Jahresdiv. Ex-Tag KGV ErgebnisBASF NA 5,4 % 3,30 € 30.04.21
Allianz vNA 4,8 % 9,60 € 06.05.21
E.ON NA 4,2 % 0,47 € 20.05.21
Bayer NA 4,0 % 2,00 € 28.04.21
Münchener Rück vNA 3,8 % 9,80 € 29.04.21
Deutsche Telekom NA 3,6 % 0,60 € 06.04.21
HeidelbergCement 3,4 % 2,20 € 07.05.21
BMW St. 5,9 15,21
Porsche Vz. 6,4 13,66
Volkswagen Vz. 6,7 28,10
Covestro 6,9 7,85
Daimler NA 7,5 11,52
HeidelbergCement 8,0 8,10
Bayer NA 8,2 6,09
Dax 16037,86 | +0,49 % | 52-Wochen-Hoch 16064,79 | 52-Wochen-Tief 12370,08
Tages- 52 Wochen Umsatz Letzte HV Div. Div.s Ergebnis KGV Marktk.Streub.4.11.2021 / 17:06 h Hoch Tief Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Termin Rend. 2021 2021 2022 2021 2022 in Mrd in %
Adidas NA 1) 2) 296,00 292,75 293,35 +0,6 W +8,93 W 336,25 252,05 281 605 3,00 12.05.22 1,0 3,29 7,58 10,03 38,70 29,25 58,8 87Airbus 1) 2) 109,80 107,72 108,46 +0,44 W +57,99 WWWWWWW 120,92 68,78 237 337 k.A. 14.04.21 k.A. 0,78 3,77 4,83 28,77 22,46 85,3 78Allianz vNA 1) 2) 204,20 200,60 201,50 WW -0,79 +22,78 WWW 223,50 166,60 594 422 9,60 04.05.22 4,8 10,31 20,28 21,46 9,94 9,39 83,1 93BASF NA 1) 2) 63,32 61,55 61,64 WWW -1,49 +23,11 WWW 72,88 49,59 2 282 302 3,30 29.04.22 5,4 3,40 6,38 5,72 9,66 10,78 56,6 94Bayer NA 1) 2) 50,82 49,88 49,96 W -0,59 +14,18 WW 57,73 42,52 1 075 794 2,00 29.04.22 4,0 2,00 6,09 6,65 8,20 7,51 49,1 94Beiersdorf 93,66 91,50 93,14 W -0,06 W -0,58 108,05 81,86 223 806 0,70 31.03.22 0,8 0,70 3,05 3,32 30,54 28,05 23,5 49BMW St. 1) 91,44 89,22 89,92 W -0,04 +43,83 WWWWW 96,39 63,13 891 608 1,90 11.05.22 2,1 4,60 15,21 13,37 5,91 6,73 54,1 53Brenntag NA 85,24 80,34 82,60 WWWWWW -2,59 +42,66 WWWWW 87,40 57,46 657 255 1,35 10.06.21 1,6 1,45 4,07 4,47 20,29 18,48 12,8 95Continental 104,46 100,76 101,40 WW -0,78 +22,19 WWW 118,65 81,14 280 160 k.A. 29.04.22 k.A. 2,00 6,22 9,47 16,30 10,71 20,3 54Covestro 55,48 53,78 54,08 WWWW -1,64 +27,73 WWW 63,24 41,64 738 536 1,30 21.04.22 2,4 2,77 7,85 6,26 6,89 8,64 10,4 100Daimler NA 1) 2) 88,24 83,50 86,64 W -0,45 +80,42 WWWWWWWWWW 88,24 47,76 3 351 398 1,35 01.10.21 1,6 4,50 11,52 11,57 7,52 7,49 92,7 73Delivery Hero 109,70 107,95 109,05 +0,97 WW +2,64 W 145,40 91,00 176 660 k.A. 16.06.21 k.A. 0,00 -5,06 -3,74 0,00 0,00 27,2 64Deutsche Bank NA 11,70 11,01 11,06 WWWWWWWW -3,77 +29,28 WWWW 12,56 8,37 11 614 696 k.A. 19.05.22 k.A. 0,20 1,10 1,33 10,06 8,32 22,9 94Deutsche Börse NA 1) 150,60 146,90 149,50 +1,67 WWWW +13,04 WW 152,65 128,15 251 255 3,00 18.05.22 2,0 3,20 6,58 7,12 22,72 21,00 28,4 93Deutsche Post NA 1) 2) 58,07 56,28 57,52 +3,08 WWWWWWW +42,98 WWWWW 61,38 37,92 2 534 743 1,35 06.05.22 2,3 1,67 3,90 3,97 14,75 14,49 71,3 74Deutsche Telekom NA 1) 2) 3) 16,73 16,57 16,64 +0,04 W +21,4 WWW 18,92 14,13 4 764 693 0,60 07.04.22 3,6 0,60 1,14 1,27 14,60 13,11 83,0 86E.ON NA 11,34 11,16 11,28 +1,13 WW +20,92 WWW 11,43 8,27 2 751 316 0,47 12.05.22 4,2 0,49 0,86 0,89 13,12 12,68 29,8 85Fresenius 39,68 39,03 39,15 +0,85 WW +17,17 WW 47,60 32,94 1 004 631 0,88 21.05.21 2,2 0,90 3,27 3,69 11,97 10,61 21,9 73Fresenius Medical Care St. 59,62 58,02 59,22 +2,24 WWWWW WW -16,21 75,08 55,18 411 362 1,34 20.05.21 2,3 1,23 3,63 4,27 16,31 13,87 17,4 68HeidelbergCement 65,04 63,42 64,72 WWWWWW -2,91 +21,98 WWW 81,04 52,76 955 608 2,20 06.05.21 3,4 2,46 8,10 8,36 7,99 7,74 12,8 69HelloFresh 88,88 86,54 88,18 +0,52 W +75,48 WWWWWWWWW 97,38 38,02 663 447 k.A. 26.05.21 k.A. 0,00 1,66$ 2,03$ 61,35 50,17 15,3 89Henkel Vz. 80,58 79,48 80,16 W -0,32 W -8,72 99,50 75,78 349 888 1,85 04.04.22 2,3 1,85 4,65 4,98 17,24 16,10 14,3 100Infineon NA 1) 3) 42,61 41,78 42,03 +0,07 W +64,57 WWWWWWWW 42,61 25,59 2 850 139 0,22 24.02.22 0,5 0,27 1,12 1,43 37,53 29,39 54,9 93Linde PLC 1) 2) 286,55 281,85 285,65 +1,42 WWW +41,41 WWWWW 286,55 199,35 432 113 $1,06 26.07.21 1,2 4,24 10,35 11,29 27,60 25,30 148,6 100Merck 217,60 213,50 217,20 +1,83 WWWW +59,94 WWWWWWW 217,60 126,60 199 960 1,40 22.04.22 0,6 1,50 8,28 8,78 26,23 24,74 28,1 93MTU Aero Engines NA 193,60 190,55 191,10 W -0,16 +18,29 WW 224,90 160,55 66 768 1,25 21.04.21 0,7 1,98 5,85 8,09 32,67 23,62 10,2 90Münchener Rück vNA 1) 263,70 260,30 260,85 +0,06 W +20,99 WWW 269,30 203,60 151 680 9,80 28.04.22 3,8 10,37 19,21 23,94 13,58 10,90 36,5 94Porsche Vz. 88,48 86,70 87,30 W -0,23 +76,51 WWWWWWWWWW 102,00 49,38 414 883 2,21 23.07.21 2,5 3,80 13,66 15,49 6,39 5,64 13,4 100Puma 111,40 109,90 110,70 +1,37 WWW +42,47 WWWWW 111,40 78,66 141 325 0,16 05.05.21 0,1 0,59 1,95 2,85 56,77 38,84 16,7 62Qiagen 3) 48,41 47,27 48,34 +1,49 WWW +11,59 W 49,95 36,00 501 040 k.A. 29.06.21 k.A. 0,00 2,45 2,04 19,73 23,70 11,2 100RWE St. 33,29 32,77 32,89 0 W -2,89 38,65 28,39 1 230 463 0,85 28.04.22 2,6 0,90 1,83 1,85 17,97 17,78 22,2 94SAP 1) 2) 3) 129,52 127,32 129,22 +0,61 W +33,56 WWWW 129,52 95,96 997 526 1,85 18.05.22 1,4 1,86 5,93 5,19 21,79 24,90 158,7 84Sartorius Vz. 3) 591,40 577,60 589,20 +0,79 WW +49,85 WWWWWW 599,60 332,00 34 590 0,71 26.03.21 0,1 1,34 7,67 8,33 76,82 70,73 22,1 100Siemens Energy 24,01 23,11 23,54 +2,75 WWWWWW +23,67 WWW 34,48 19,85 2 575 616 k.A. 09.02.22 k.A. 0,10 -0,18 0,84 0,00 28,02 17,1 60Siemens Healthineers 3) 62,18 58,48 61,16 +1,97 WWWW +61,91 WWWWWWWW 62,18 36,92 801 738 0,80 11.02.22 1,3 0,88 1,94 2,04 31,53 29,98 69,0 25Siemens NA 1) 2) 146,56 143,56 146,08 +1,32 WWW +35,94 WWWW 151,86 107,08 718 899 3,50 10.02.22 2,4 3,60 7,26 7,71 20,12 18,95 124,2 88Symrise Inh. 124,90 121,25 124,05 +0,16 W +12,82 WW 127,15 95,88 173 089 0,97 05.05.21 0,8 1,07 2,82 3,04 43,99 40,81 17,3 89Volkswagen Vz. 1) 189,72 185,60 187,82 +1,19 WWW +42,2 WWWWW 252,20 132,62 932 288 4,86 22.07.21 2,6 7,56 28,10 32,29 6,68 5,82 38,7 100Vonovia NA 1) 54,08 52,54 53,58 +0,68 W W -9,65 61,66 48,57 806 252 1,69 16.04.21 3,2 1,80 2,47 2,70 21,69 19,84 30,8 90Zalando 78,86 75,04 78,78 +4,57 WWWWWWWWWW W -10,7 105,90 73,60 813 333 k.A. 19.05.21 k.A. 0,00 1,00 1,14 78,78 69,11 20,6 69
(auch im 1) Euro Stoxx 50, 2) Stoxx 50, 3) TecDAX)
1.12.2020 4.11.2021 1.12.2020 44.11.2021
Dividendenrendite Jahresdiv. Ex-Tag KGV Ergebnisfreenet NA 7,7 % 1,65 € 21.06.21
Telefónica Dt. 7,5 % 0,18 € 21.05.21
Evonik Industries 4,1 % 1,15 € 03.06.21
Grand City Prop. 3,6 % 0,82 € 01.07.21
Talanx NA 3,6 % 1,50 € 07.05.21
ProSiebenSat.1 3,5 % 0,49 € 02.06.21
Uniper NA 3,5 % 1,37 € 20.05.21
K+S NA 5,8 2,65
ProSiebenSat.1 9,7 1,44
Wacker Chemie 10,1 15,93
Talanx NA 11,1 3,80
Rheinmetall 11,9 7,16
freenet NA 12,5 1,71
Lanxess 12,9 4,28
MDax 35867,96 | +0,90 % | 52-Wochen-Hoch 36428,86 | 52-Wochen-Tief 27108,76
Tages- 52 Wochen Umsatz Letzte HV Div. Div.s Ergebnis KGV Marktk.Streub.4.11.2021 / 17:06 h Hoch Tief Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Termin Rend. 2021 2021 2022 2021 2022 in Mrd in %
Aixtron NA 3) 22,07 20,14 20,46 WWW -4,44 +112,15 WWWWW 26,60 9,58 2 575 756 0,11 25.05.22 0,5 0,14 0,72 0,75 28,42 27,28 2,3 100Alstria Office 20,00 19,48 19,50 +17,33 WWWWWWWWWW +74,11 WWW 20,00 11,45 3 453 756 0,53 06.05.21 2,7 0,53 0,61 0,67 31,97 29,10 3,5 82Aroundtown 6,31 6,14 6,28 +3,32 WW +48,24 WW 7,16 4,19 2 857 857 0,07 30.06.21 1,1 0,23 0,34 0,41 18,48 15,33 9,7 84Aurubis 76,38 75,24 75,54 +0,21 W +33,18 W 87,74 57,40 44 203 1,30 17.02.22 1,7 1,50 5,43 5,52 13,91 13,68 3,4 70Auto1 Group 33,20 32,00 32,40 W -1,82 0 56,76 28,19 40 866 k.A. 24.06.21 k.A. 0,00 -0,83 -0,68 0,00 0,00 6,9 48Bechtle 3) 68,84 66,90 68,80 +2,75 WW +32,15 W 68,84 49,13 218 514 0,45 02.06.22 0,7 0,50 1,79 1,95 38,44 35,28 8,7 51Befesa 63,80 62,20 63,60 +1,11 W +81,46 WWW 72,90 36,00 55 650 1,17 05.10.21 2,3 1,33 2,67 3,32 23,82 19,16 2,5 81Cancom 3) 63,18 61,10 61,94 +0,13 W +66,51 WWW 63,18 37,86 68 615 0,75 29.06.21 1,2 0,75 1,46 1,62 42,42 38,23 2,4 80Carl Zeiss Meditec 3) 185,80 181,75 185,40 +1,37 W +62,2 WWW 202,00 105,40 41 446 0,50 27.05.21 0,3 0,79 2,80 2,93 66,21 63,28 16,6 36Commerzbank 6,90 6,46 6,51 +0,99 W +52,78 WW 6,90 3,98 16 583 586 k.A. 10.05.22 k.A. 0,00 -0,28 0,53 0,00 12,28 8,2 80CompuGroup Med. 3) 77,85 74,00 74,80 W -0,73 W -2,92 85,35 59,40 54 404 0,50 05.05.22 0,7 0,55 1,98 2,28 37,78 32,81 4,0 54CTS Eventim 69,78 68,12 69,36 +1,94 W +68,27 WWW 69,78 41,38 43 664 k.A. 07.05.21 k.A. 0,00 -0,16 1,25 0,00 55,49 6,7 61Dürr 41,90 39,04 39,08 W -2,15 +49,05 WW 44,08 25,26 148 383 0,30 06.05.22 0,8 0,63 1,65 2,52 23,68 15,51 2,7 74Evonik Industries 29,01 27,65 28,22 W -1,02 +30,71 W 31,00 21,35 932 173 1,15 25.05.22 4,1 1,15 1,92 2,13 14,70 13,25 13,2 41Evotec 3) 39,48 37,38 39,14 +0,36 W +59,04 WW 45,83 23,69 1 302 558 k.A. 15.06.21 k.A. 0,00 0,38 0,24 103 163 6,5 73Fraport 66,10 63,54 65,74 +3,07 WW +98,49 WWWW 66,10 32,76 187 477 k.A. 01.06.21 k.A. 0,00 -1,06 2,88 0,00 22,83 6,1 40freenet NA 3) 23,26 21,01 21,43 WWWW -6,91 +33,81 W 23,26 16,01 1 804 939 1,65 18.06.21 7,7 1,50 1,71 1,90 12,53 11,28 2,7 100Fuchs Petrolub Vz. 41,50 40,88 40,96 W -0,92 W -11,91 49,70 37,04 30 779 0,99 03.05.22 2,4 1,03 1,83 2,01 22,38 20,38 2,8 100GEA Group 43,73 43,07 43,70 +1,32 W +43,56 WW 43,73 27,40 105 702 0,85 28.04.22 1,9 0,90 1,64 1,84 26,65 23,75 7,9 77Gerresheimer 84,30 82,15 83,00 +0,85 W W -9,64 103,70 75,60 99 344 1,25 09.06.21 1,5 1,30 4,30 5,02 19,30 16,53 2,6 85Grand City Prop. 22,78 22,24 22,70 +1,89 W +9,45 W 24,14 19,10 244 696 0,82 30.06.21 3,6 0,84 1,11 1,31 20,45 17,33 4,0 61Hann. Rückv. NA 165,90 162,60 162,95 +0,52 W +22,8 W 165,90 126,70 109 223 4,50 04.05.22 2,8 5,75 9,96 12,26 16,36 13,29 19,7 50Hella 60,42 59,70 60,40 +0,17 W +53,53 WW 68,72 39,58 109 529 0,96 30.09.22 1,6 0,81 3,22 2,98 18,76 20,27 6,7 40Hugo Boss NA 55,18 53,50 54,96 +1,4 W +165,12 WWWWWWW 55,18 20,39 229 592 0,04 11.05.21 0,1 0,64 1,64 2,44 33,51 22,52 3,9 78Hypoport SE 554,00 536,50 554,00 +3,94 WW +28,69 W 618,00 400,00 5 961 k.A. 21.05.21 k.A. 0,00 5,27 7,02 105 78,92 3,6 65Jungheinrich Vz. 46,36 44,82 45,84 +1,6 W +28,76 W 48,04 33,60 48 181 0,43 11.05.21 0,9 0,62 2,30 2,49 19,93 18,41 2,2 100K+S NA 15,55 15,14 15,42 +1,02 W +169,67 WWWWWWW 15,55 5,66 856 964 k.A. 12.05.21 k.A. 0,18 2,65 1,12 5,82 13,77 3,0 100Kion Group 98,12 96,68 97,40 +0,62 W +40,1 WW 98,12 63,26 115 388 0,41 11.05.22 0,4 1,10 4,31 5,34 22,60 18,24 12,8 55Knorr-Bremse 95,02 93,30 94,06 W -0,28 W -9,24 117,24 88,16 52 228 1,52 20.05.21 1,6 1,76 3,77 4,22 24,95 22,29 15,2 41Lanxess 57,64 54,86 55,30 WWWW -7,12 +20,53 W 67,38 44,18 676 868 1,00 19.05.21 1,8 1,06 4,28 5,14 12,92 10,76 4,8 84LEG Immobilien 133,50 129,85 132,10 +2,17 W +6,7 W 139,80 110,18 72 529 3,78 27.05.21 2,9 4,08 5,63 5,96 23,46 22,16 9,6 100Lufthansa vNA 6,65 6,34 6,49 +2,88 WW +13,48 W 9,25 5,26 15 633 393 k.A. 04.05.21 k.A. 0,00 -2,67 0,04 0,00 162 7,8 86Nemetschek 3) 110,00 104,00 109,85 +5,27 WWW +72,18 WWW 110,00 50,95 165 680 0,30 12.05.21 0,3 0,33 1,12 1,17 98,08 93,89 12,7 48ProSiebenSat.1 15,38 13,55 13,95 WWW -5,93 +39,78 WW 19,00 10,95 4 223 694 0,49 05.05.22 3,5 0,70 1,44 1,61 9,69 8,66 3,3 76Rational 896,00 852,60 895,80 +0,9 W +33,9 W 1 033,50 646,50 9 391 4,80 04.05.22 0,5 7,19 11,03 13,77 81,21 65,05 10,2 40Rheinmetall 86,44 85,18 85,34 +0,14 W +24,11 W 93,80 66,34 66 452 2,00 11.05.21 2,3 2,49 7,16 9,24 11,92 9,24 3,7 100Scout24 NA 63,62 62,32 63,48 +2,39 W W -11,28 73,36 56,94 109 961 0,82 08.07.21 1,3 0,75 1,50 1,82 42,32 34,88 5,8 89Software 3) 36,42 35,74 36,26 +1 W +11,16 W 44,00 31,58 96 626 0,76 12.05.21 2,1 0,77 1,35 1,75 26,86 20,72 2,7 69Ströer & Co. 74,95 73,95 74,75 +0,88 W +19,41 W 82,50 59,60 43 724 2,00 03.09.21 2,7 2,00 2,68 3,57 27,89 20,94 4,2 48TAG Immobilien 26,94 26,37 26,82 +1,9 W W -1,03 29,37 23,16 127 151 0,88 11.05.21 3,3 0,92 1,24 1,33 21,63 20,17 3,9 87Talanx NA 42,48 41,78 42,00 W -0,28 +53,62 WW 42,48 27,38 100 172 1,50 05.05.22 3,6 1,60 3,80 4,38 11,05 9,59 10,6 21TeamViewer 3) 14,90 14,06 14,39 W -0,86 WWW -62,23 49,64 12,47 2 423 995 k.A. 15.06.21 k.A. 0,00 0,47 0,67 30,62 21,48 2,9 75Telefónica Dt. 3) 2,40 2,34 2,39 +1,79 W +5,25 W 2,63 2,13 8 481 657 0,18 20.05.21 7,5 0,18 0,01 0,02 239 119 7,1 31thyssenkrupp 9,08 8,84 8,91 +1,27 W +109,74 WWWWW 12,03 4,05 1 690 508 k.A. 04.02.22 k.A. 0,00 -0,41 0,85 0,00 10,49 5,5 61Uniper NA 39,25 38,67 39,06 +0,39 W +44,35 WW 39,25 26,52 59 597 1,37 18.05.22 3,5 1,37 2,09 1,82 18,69 21,46 14,3 25United Internet NA 3) 32,74 32,36 32,46 W -0,55 +5,97 W 39,34 29,35 46 813 0,50 27.05.21 1,5 0,50 2,28 2,41 14,24 13,47 6,3 42Vantage Towers 3) 29,81 29,38 29,65 +0,44 W 0 31,58 23,97 52 511 0,56 28.07.21 1,9 k.A. 0,00 0,77 0,00 38,51 15,0 19Varta 3) 130,75 128,00 129,40 +0,98 W +14,61 W 181,30 100,40 101 134 2,48 17.06.21 1,9 0,66 3,28 4,17 39,45 31,03 5,2 44Wacker Chemie 161,75 157,55 160,25 +1,52 W +92,05 WWWW 162,40 83,18 87 581 2,00 12.05.21 1,2 4,30 15,93 10,39 10,06 15,42 8,4 34zooplus 481,00 467,60 480,40 +1,56 W +238,31 WWWWWWWWWW 491,80 133,00 17 065 k.A. 16.12.21 k.A. 0,00 3,20 4,12 150 117 3,4 64
TecDax 3946,45 | +0,65 % | 52-Wochen-Hoch 3990,76 | 52-Wochen-Tief 2911,88
Hinweis zum Kursteil: Telefon: 0800 0002053 oder Mail [email protected]. Aktien: Börsenplatz Dax 40 und MDax ist Xetra; Euro Stoxx Heimatbörse; Kurse und Dividenden von an deutschen Börsen gehandelten Wertenverstehen sich in Euro pro Stück sofern es keine anderen Angaben gibt. Dividenden von ausländischen Börsen sind in Landeswährung. Kurse: bereinigt um Kapitalmaßnahmen; Höchst-/Tiefstkurse können gerundet sein,beziehen sich auf den jeweiligen Börsenplatz und basieren auf allen „bezahlt“-Notierungen. Von einigen Märkten können nicht immer die Schlusskurse des Tages veröffentlicht werden, Uhrzeitangaben derKursabrufe beachten. Die Dividendenangaben beziehen sich auf die zuletzt gezahlten Dividenden - inklusive Zahlungen aus Kapitalrücklagen - im üblichen Auszahlungsrhythmus; sie werden automatisch abgelöst durch denneuen Dividendenvorschlag, wenn dieser für die bevorstehende Hauptversammlung offiziell bekannt gegeben wird. Netto- Dividendenrendite in % auf Basis der zuletzt gezahlten oder vorgeschlagenen Dividende als Summedes letzten Geschäftsjahres. Die ausgewiesenen Gewinnschätzungen beruhen auf Ibes-Daten. Börsenkapitalisierung: Zahl der Aktien multipliziert mit dem Kurs der Aktiengattung im Index in Landeswährung;Ergebnisse je Aktie vor Goodwillab schreibung in Euro bzw. Landeswährung; KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen. k.A. = keine Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr - keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Aktuelle Kursinformationen finden Sie unter http://finanzen.handelsblatt.com
Geldanlage
43
EuroStoxx50 4331,78 | +0,51 % | 52-Wochen-Hoch 4340,81 | 52-Wochen-Tief 3168,97
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 44.11.202152 Wochen Umsatz Letzte Div. Ergebnis KGV Marktk.Streub.
4.11.2021 / 17:06 h Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Rend. 2021 2021 2022 in Mrd in %
AB Inbev 51,35 WWWW -1,53 +9,69 W 65,86 46,66 1 199 567 0,50 1,0 2,83 18,14 15,42 89,1 54Adyen 2 726,50 +3,49 WWWWWWWWWW +67,63 WWWW 2 808,00 1 510,00 33 714 k.A. k.A. 14,92 183 130 83,2 87Ahold Delhaize 29,00 W -0,15 +20,11 W 29,46 21,50 956 253 0,43 3,1 2,05 14,14 13,94 31,9 94Air Liquide 149,74 +1,35 WWWW +11,08 W 153,26 124,25 467 409 2,75 1,8 5,56 26,93 24,83 70,9 100ASML Hold. 726,40 +2,69 WWWWWWWW +125,14 WWWWWWW 764,40 331,55 486 296 1,80 0,4 13,61 53,37 43,39 300,2 79AXA 25,44 WW -0,82 +64,16 WWWW 25,90 15,55 2 361 485 1,43 5,6 2,82 9,02 8,54 61,5 86Banco Santander 3,22 WWWWWWWW -2,7 +89,23 WWWWW 3,51 1,70 116 465 209 0,05 k.A. 0,40 8,05 7,49 55,8 95BBVA 6,02 WWWWWWWW -2,62 +145,15 WWWWWWWW 6,29 2,48 17 940 486 0,08 k.A. 0,57 10,56 9,87 40,1 95BNP Paribas 58,81 WWWWW -1,79 +77,57 WWWW 60,62 33,00 2 090 215 1,56 1,9 6,50 9,05 8,86 73,5 86CRH 43,00 W -0,26 +37,51 WW 45,96 31,31 793 862 0,20 2,2 3,24 13,27 12,22 33,3 100Danone 57,31 +0,03 W +14,44 W 65,30 48,97 859 382 1,94 3,4 3,27 17,53 16,47 39,4 94Enel 7,26 +0,01 W W -1,51 9,05 6,55 16 281 212 0,18 4,9 0,54 13,44 12,96 73,8 66ENI 12,54 +1,32 WWWW +90,15 WWWWW 12,83 6,47 11 891 771 0,43 2,9 0,92 13,63 11,10 45,2 70Essilor-Luxottica 189,14 +0,34 W +73,92 WWWW 189,42 111,05 309 227 1,08 0,6 4,76 39,74 33,07 83,6 68Flutter Entertain. 148,10 WWWWWWW -2,31 W -2,63 198,60 135,10 175 177 £0,67 1,5 324,98 0,46 0,36 26,0 69Iberdrola 10,21 +0,69 WW W -3,03 12,39 8,59 3 918 455 0,03 0,3 0,57 17,91 16,47 65,0 86Inditex 32,07 +1,84 WWWWW +41,9 WW 32,85 22,79 10 465 471 0,35 1,1 0,36 89,08 27,65 100,0 36ING Groep 13,27 WW -0,85 +107,02 WWWWWW 13,74 6,03 15 209 780 0,48 2,7 1,22 10,87 11,34 51,8 100Intesa Sanpaolo 2,45 WWWWWW -2,22 +53,12 WWW 2,59 1,59 110 887 996 0,07 2,9 0,22 11,12 9,79 47,5 89Kering 647,20 +0,03 W +16,99 W 798,00 513,30 86 174 5,50 1,2 25,56 25,32 21,86 80,9 59Kone Corp. 60,46 +1,37 WWWW W -15,63 75,44 55,48 333 337 2,25 3,7 2,02 29,93 28,25 27,4 89L’Oréal 408,05 +0,62 WW +36,06 WW 408,25 290,10 150 380 4,06 1,0 8,61 47,39 43,23 227,6 43LVMH 692,30 +1,44 WWWW +64,13 WWWW 716,60 429,55 206 348 3,00 0,9 21,10 32,81 29,89 349,4 53Pernod Ricard 204,10 +0,25 W +39,94 WW 204,50 146,10 183 335 1,79 1,5 6,16 33,13 28,67 53,4 74Philips Electr. 40,88 +0,07 W W -4,05 50,98 36,18 972 005 0,85 2,1 1,95 20,96 21,07 37,5 93Prosus 75,59 W -0,47 W -17,03 110,00 65,71 947 642 0,11 k.A. 3,51 21,54 20,05 156,7 43Safran 114,50 +0,46 W +16,67 W 127,74 98,16 339 442 0,43 0,4 2,70 42,41 26,50 48,9 73Sanofi S.A. 89,38 WWW -0,95 +2,96 W 91,14 74,92 1 123 257 3,20 3,6 6,32 14,14 12,62 112,9 84Schneider Electr. 153,86 +0,88 WWW +37,38 WW 159,30 111,00 403 834 2,60 1,7 5,81 26,48 23,97 87,6 94Stellantis 17,61 +0,34 W +174,6 WWWWWWWWWW 18,74 6,40 9 875 057 0,32 1,8 3,48 5,06 4,73 55,2 66TotalEnergies 43,23 +0,75 WW +54,95 WWW 45,16 27,12 3 008 541 0,66 6,1 5,45 7,93 7,24 114,1 88Universal Music Gr. 25,70 +2,72 WWWWWWWW 0 26,45 22,55 1 779 738 0,20 0,8 0,64 40,16 33,82 46,6 52Vinci 93,39 +0,42 W +26,75 WW 96,95 72,62 435 845 0,65 2,9 4,29 21,77 15,21 55,9 91
DividendenrenditeAXA 5,6 %
Enel 4,9 %
TotalEnergies 4,6 %
Kone Corp. 3,7 %
ING Groep 3,6 %
Sanofi S.A. 3,6 %
ENI 3,4 %
KGVFlutter Entertain. 0,5
Stellantis 5,1
TotalEnergies 7,9
Banco Santander 8,1
AXA 9,0
BNP Paribas 9,0
BBVA 10,6
(ohne deutsche Indextitel)
DänemarkHongkong
EURO-LEITZINSENREFINANZIERUNG (REFI)Mindestbietungssatz 0,00%Mindestbietungssatz, 7 Tage (fällig 10.11.2021) 0,00%
ZINSKANAL FÜR TAGESGELDSpitzenrefinanzierungsfazilität (ab 18.9.2020) 0,25%Einlagefazilität (ab 18.9.2020) -0,50%
MINDESTRESERVE Verzinsung (ab 31.1.2020) 0,00%
BASISZINS gem. § 247 BGB (ab 1.7.2021) -0,88%
EURO-RENDITEN3.11.2021 Hypo. und Öffentl.Laufzeit Pfandbriefe
1 Jahr(e) -0,4002 Jahr(e) -0,2403 Jahr(e) -0,1304 Jahr(e) -0,0505 Jahr(e) 0,020
Quelle: Deutsche Bundesbank
INTERNATIONALE RENDITEN10-j. Staatsanleihen 4.11.2021 ± in % 3.11.Australien 1,83 W -1,4 1,85Belgien 0,085 WW -42,57 0,15Dänemark 0,025 WWW -74,49 0,098Deutschland -0,226 WW -40,37 -0,161Frankreich 0,12 W -37,57 0,19Griechenland 1,10 W -6,36 1,18Großbritannien 0,85 W -14,36 1,00Hongkong 1,51 +2,94 W 1,47Irland 0,17 W -31,69 0,24Italien 0,93 W -10,48 1,04
Japan 0,077 W -2,65 0,079Kanada 1,63 W -6,07 1,74Neuseeland 2,56 +1,43 W 2,52Niederlande -0,094 k.A. -0,026Österreich -0,007 k.A. 0,066Portugal 0,34 W -19,1 0,42Russland 8,29 W -0,24 8,31Schweden 0,28 W -2,8 0,29Schweiz -0,169 W -29,01 -0,131Spanien 0,44 W -15,27 0,52USA 1,54 W -2,45 1,57
Umlaufrendite-0,29 | +0,0152-Wochen-Hoch -0,16 | Tief -0,64
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20221
AUSLÄNDISCHE LEITZINSENSatz in % gültig ab
EU-MITGLIEDSLÄNDERDänemark Diskontsatz 0,00 22.06.2017Grossbritannien Repo Satz 0,10 19.03.2020Polen Diskontsatz 0,60 09.04.2020Rumänien Reference Rate 1,50 05.10.2021Schweden Pensionssatz 0,00 08.01.2020Tschechien Diskontsatz 0,05 27.03.2020Ungarn Base Rate 1,80 19.10.2021
6 Jahr(e) 0,0807 Jahr(e) 0,1308 Jahr(e) 0,1809 Jahr(e) 0,23010 Jahr(e) 0,280
3.11.2021 Hypo. und Öffentl.Laufzeit Pfandbriefe
ZINSVERGLEICHE02.11.21
Festgeld 5tsd €1 Monat 0,03753 Monate 0,066 Monate 0,07112 Monate 0,0871
Spareckzins 0,0078
Sparbrief1 Jahr 0,08772 Jahre 0,13093 Jahre 0,21865 Jahre 0,2962
Dispositionskredit 9,2471
Hypozinsen effektiv 5 Jahre 0,9610 Jahre 0,95
Ratenkredit 5 tsd € 3 Jahre 3,56925 Jahre 3,6446 Jahre 3,7291
Ratenkredit 10 tsd € 3 Jahre 3,54655 Jahre 3,62326 Jahre 3,7091
Ø-Werte in %, mitgeteilt vonFMH-Finanzberatung e.K.
Zinsen
Zinsen
Europa
USA
GB
Japan
jeweils 1.9.2021 bis 4.11.2021
JJJJ
6.10.2014 4.11.2021-0,5
0,5
1,5
2,5
SDax 17383,28 | +0,81 % | 52-Wochen-Hoch 17418,30 | 52-Wochen-Tief 12262,13
52 Wochen Umsatz Letzte Div. Ergebnis KGV Marktk.Streub.4.11.2021 / 17:06 h Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Rend. 2021 2021 2022 in Mrd in %
1&1 25,58 W -0,78 +36,97 W 27,86 17,69 58 085 0,05 0,2 2,07 12,36 13,46 4,5 25Aareal Bank 27,76 W -0,86 +84,57 WWW 29,90 14,87 96 506 1,10 5,4 0,85 32,66 14,69 1,7 93About You Hold. 18,80 WWWW -5,53 0 26,98 18,50 126 491 k.A. k.A. k.A. k.A. 0,00 3,5 37Adler Group 12,14 +7,53 WWWWWW WW -46,52 29,72 9,03 912 819 0,46 3,8 1,15 10,56 9,95 1,4 73ADVA Optical Net. 12,40 +2,99 WW +88,45 WWW 15,48 6,52 71 627 k.A. k.A. 0,85 14,59 14,09 0,6 85Amadeus Fire 200,00 +3,31 WWW +115,52 WWWW 206,50 90,40 8 839 1,55 0,8 6,08 32,89 28,74 1,1 89Atoss Software 211,00 +3,43 WWW +66,14 WW 211,00 120,50 11 714 1,67 0,8 2,20 95,91 86,48 1,7 49Basler 148,80 WWWWWWWWWW -13,08 +170,55 WWWWWW 174,40 55,00 30 353 0,58 0,4 k.A. k.A. k.A.BayWa vNA 36,40 W -0,27 +34,81 W 43,80 27,00 12 634 1,00 2,7 1,29 28,22 27,79 1,2 38Bilfinger 32,62 +5,63 WWWW +91,43 WWW 33,24 18,36 286 253 1,88 5,8 1,40 23,30 14,31 1,4 94Ceconomy St. 4,17 +0,29 W +1,81 W 6,02 3,37 184 820 k.A. k.A. 0,36 11,58 7,32 1,5 42CeWe Stiftung 127,80 0 +49,12 WW 138,40 86,70 4 914 2,30 1,8 7,34 17,41 16,08 0,9 68Dermapharm Holding 90,20 W -0,17 +99,27 WWWW 91,35 45,37 16 077 0,88 1,0 3,09 29,19 26,53 4,9 35Deutz 7,50 +1,63 W +57,5 WW 8,45 4,63 121 881 k.A. k.A. 0,26 28,85 8,52 0,9 100DIC Asset NA 15,78 +2,27 WW +52,32 WW 16,84 10,28 65 846 0,70 4,4 0,95 16,61 16,44 1,3 49Drägerwerk Vz. 69,90 +0,72 W W -1,83 82,70 60,70 22 345 0,19 0,3 9,86 7,09 11,10 0,6 100Dt. EuroShop NA 17,60 +2,09 WW +53,04 WW 21,68 11,58 90 460 0,04 0,2 1,87 9,41 8,80 1,1 75Dt. Pfandbriefbank 11,00 0 +93,83 WWW 11,17 5,67 340 552 0,32 5,3 1,06 10,38 10,48 1,5 100DWS Group 36,98 W -0,75 +13,47 W 41,88 31,45 50 232 1,81 4,9 3,38 10,94 10,48 7,4 16Eckert & Ziegler 135,70 W -1,24 +232,27 WWWWWWWW 141,40 39,86 45 589 0,45 0,3 1,51 89,87 77,10 2,9 69Encavis 17,17 +2,39 WW W -1,44 25,55 13,97 366 103 0,28 1,6 0,37 46,41 42,93 2,8 77Fielmann 60,35 +0,58 W W -9,66 72,45 55,00 37 037 1,20 2,0 1,99 30,33 26,70 5,1 28flatexDEGIRO 20,66 W -0,86 +62,04 WW 29,70 11,90 479 706 k.A. k.A. 0,86 24,02 14,86 2,3 60Global Fashion Grp. 7,65 W -0,33 W -5,01 14,96 6,60 144 575 k.A. k.A. -0,40 0,00 0,00 1,7 33Grenke NA 33,72 W -0,53 W -7,36 43,10 24,20 17 823 0,26 0,8 1,38 24,43 17,75 1,6 59Hamborner Reit 9,93 +1,7 W +17,81 W 10,22 8,42 75 537 0,47 4,7 0,63 15,76 22,07 0,8 82Hensoldt 14,10 W -0,84 +28,18 W 17,46 10,50 63 003 0,13 0,9 0,84 16,79 11,75 1,5 32Hochtief 66,82 +0,33 W +0,86 W 88,55 61,22 62 505 3,93 5,9 6,78 9,86 8,64 4,7 34home24 11,54 +0,52 W W -28,24 26,86 10,90 127 211 k.A. k.A. -0,96 0,00 0,00 0,3 87Hornbach Hold. 113,30 W -0,61 +27,3 W 117,00 69,70 15 083 2,00 1,8 10,33 10,97 11,11 1,8 46Indus Holding 34,75 +0,29 W +30,39 W 37,70 25,30 8 920 0,80 2,3 2,42 14,36 11,10 0,9 77Instone Real 23,75 +4,63 WWWW +30,78 W 28,35 18,50 34 198 0,26 1,1 2,00 11,88 9,03 1,1 90Jenoptik 34,40 +0,41 W +54,68 WW 34,76 21,62 75 510 0,25 0,7 1,39 24,75 23,40 2,0 79Jost Werke 51,10 +0,2 W +49,42 WW 57,80 34,20 7 496 1,00 2,0 4,45 11,48 10,10 0,8 69Klöckner & Co. NA 11,67 +0,17 W +131,09 WWWWW 13,49 5,16 549 604 k.A. k.A. 4,63 2,52 12,16 1,2 75Krones 92,45 +1,59 W +77,45 WWW 92,70 50,90 50 818 0,06 0,1 3,47 26,64 19,55 2,9 43KWS Saat 75,60 W -0,79 +16,49 W 80,90 61,70 9 109 0,80 1,1 3,20 23,63 20,54 2,5 31LPKF Laser&Electr. 21,02 +0,96 W +20,94 W 33,35 17,96 88 264 0,10 0,5 0,35 60,06 26,95 0,5 100Metro St. 11,20 +0,18 W +32,39 W 11,85 7,35 126 190 0,70 6,3 0,04 280 21,95 4,0 12MorphoSys 40,43 W -1,85 WW -58,84 101,90 37,10 156 228 k.A. k.A. -4,56 0,00 0,00 1,4 94Nagarro 177,50 +2,6 WW 0 183,50 66,20 13 173 k.A. k.A. 2,06 86,17 64,55 2,1 61New Work 211,00 WW -2,09 W -8,06 293,00 193,20 2 342 2,59 1,2 7,11 29,68 27,37 1,2 44Nordex 13,69 +0,96 W +16,21 W 27,26 12,05 2 179 658 k.A. k.A. -0,14 0,00 19,01 2,2 71Norma Group NA 37,10 +9,05 WWWWWWW +34,32 W 49,36 27,30 134 266 0,70 1,9 2,29 16,20 12,71 1,2 85Patrizia 23,35 +2,64 WW +13,08 W 26,95 20,30 52 257 0,30 1,3 0,82 28,48 23,12 2,2 48Pfeiffer Vacuum 214,50 W -1,83 +35,42 W 222,50 149,60 1 154 1,60 0,7 6,39 33,57 29,26 2,1 37PVA TePla 40,45 +9,92 WWWWWWWW +252,97 WWWWWWWWW 41,75 11,38 317 804 k.A. k.A. 0,48 84,27 55,41 0,9 86RTL Group 50,05 W -0,1 +47,47 WW 53,50 35,40 46 403 3,00 6,0 4,14 12,09 11,17 7,7 24S&T 19,83 WW -2,22 +15,02 W 24,20 17,61 531 353 0,30 1,5 0,91 21,79 16,39 1,3 73SAF Holland 12,74 +1,51 W +66,54 WW 14,49 7,58 61 419 k.A. k.A. 0,96 13,27 10,27 0,6 90Salzgitter 31,26 +0,9 W +156,44 WWWWWW 35,08 12,36 120 339 k.A. k.A. 9,26 3,38 5,73 1,9 64Schaeffler Vz. 6,96 W -0,71 +24,84 W 8,44 5,41 316 744 0,25 3,6 1,04 6,69 6,00 1,2 75Secunet 559,00 +2,38 WW +123,6 WWWW 565,00 221,00 9 864 2,54 0,5 6,94 80,55 84,83 3,6 25SGL Carbon 8,42 +1,45 W +215,95 WWWWWWWW 10,88 2,71 295 718 k.A. k.A. 0,13 64,77 27,16 1,0 46Shop Apotheke 148,30 +2,21 WW W -2,56 249,00 116,50 106 170 k.A. k.A. -1,77 0,00 0,00 2,7 85Siltronic NA 136,15 W -0,37 +63,45 WW 147,35 85,40 5 167 2,00 1,5 7,14 19,07 15,01 4,1 56Sixt St. 164,40 +1,42 W +132,7 WWWWW 169,80 70,45 46 086 k.A. k.A. 5,48 30,00 27,26 5,0 42SMA Solar Techn. 42,64 +0,71 W +11,92 W 71,80 33,58 82 035 0,30 0,7 0,24 178 54,67 1,5 55Stabilus 66,00 W -0,3 +28,4 W 72,55 51,80 5 948 0,50 0,8 3,55 18,59 16,46 1,6 83Sto & Co. KGaA Vz 207,00 +3,24 WW +84,82 WWW 236,50 118,40 3 486 5,00 2,4 11,24 18,42 16,15 0,5 100Stratec 140,60 +0,43 W +7,33 W 147,40 94,80 4 126 0,90 0,6 3,53 39,83 39,72 1,7 59Südzucker 13,91 +0,36 W +7 W 14,62 11,24 196 351 0,20 1,4 -0,52 0,00 17,83 2,8 31Suse 37,99 +3,29 WWW 0 40,59 25,56 66 385 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.Synlab 21,49 W -0,19 0 21,99 17,40 24 177 k.A. k.A. 2,58 8,33 16,16 4,8 16Takkt 13,92 W -1,28 +51,47 WW 14,60 9,18 14 166 1,10 7,9 0,83 16,77 13,78 0,9 50Traton 22,46 W -1,75 +30,23 W 28,46 17,20 72 787 0,25 1,1 2,14 10,50 6,09 11,2 10Verbio Verein. Bio. 74,15 +2,99 WW +276,78 WWWWWWWWWW 74,55 20,75 111 280 0,20 0,3 1,47 50,44 52,59 4,7 50Wacker Neuson NA 29,82 W -0,73 +78,24 WWW 30,46 15,12 106 549 0,60 2,0 1,56 19,12 15,95 2,1 42Westwing Group 27,32 +1,86 W W -7,92 54,35 22,96 53 686 k.A. k.A. 0,87 31,40 29,06 0,6 63Zeal Network 39,95 +3,23 WW +5,13 W 46,50 32,60 6 021 0,90 2,3 0,43 92,91 43,90 0,9 32
Devisenmärkte
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20221
Devisen- und Sortenkurse für 1 Euro4.11.2021 Devisen1, 3) 3 Monate4)
Geld Brief Geld BriefAustralien A $ 1,5598 1,5599 +27,84 +28,92Dänemark dkr 7,4176 7,4576 -10,04 -3,48Großbrit. £ 0,8499 0,8539 +15,77 +17,27Hongkong HK $ 8,9881 8,9890 +183,52 +196,28Japan Yen 131,3100 131,7900 +14,91 +15,62Kanada kan $ 1,4293 1,4413 +31,32 +32,19Neuseeland NZ $ 1,6241 1,6243 +61,71 +63,28Norwegen nkr 9,8543 9,9023 +341,31 +353,14Polen Zloty 4,5992 4,6016 +260,98 +273,84Schweden skr 9,8932 9,9412 +93,14 +100,34Schweiz sfr 1,0532 1,0572 -5,58 -4,68Singapur S $ 1,5604 1,5605 +40,81 +42,60Südafrika Rand 17,5555 17,5663 +2488,64 +2522,78Tschechien Krone 25,3500 25,3620 +160,72 +203,13USA US-$ 1,1521 1,1581 +26,59 +27,04
6 Monate4) Ref.kurse Bankschalter2)Geld Brief EZB Verkauf Ankauf
Australien +57,95 +60,48 1,5602 1,4823 1,6549Dänemark -24,95 -8,87 7,4377 7,0973 7,8639Großbrit. +37,77 +40,40 0,8535 0,8159 0,9071Hongkong +343,97 +363,41 9,0059 8,4005 10,1922Japan +27,02 +28,84 131,7700 125,4130 139,7711Kanada +70,66 +73,11 1,4365 1,3671 1,5262Neuseeland +133,76 +137,64 1,6235 1,5353 1,7270Norwegen +713,90 +733,83 9,8590 9,3859 10,4645Polen +625,91 +652,10 4,6067 4,3162 4,9765Schweden +203,92 +221,51 9,9060 9,4470 10,4891Schweiz -12,38 -10,25 1,0554 1,0095 1,1173Singapur +73,19 +75,89 1,5627 1,4697 1,6814Südafrika +4928,08 +5009,66 17,5896 16,5254 20,3011Tschechien +403,18 +474,47 25,4690 24,1153 27,6810USA +48,73 +49,43 1,1569 1,1048 1,2203
1) Mitgeteilt von Infront Financial Technology GmbH, LBBW; 2) Frankfurter Sortenkurse aus Sicht des Bankkunden, die Bezeichnungen Verkauf und Ankauf entsprechen demGeld und Brief bei anderen Instituten, mitgeteilt von Reisebank; 3) Freiverkehr; 4) Swaps notiert in Forward Punkten - 1 Punkt = 1/10.000, Stand ME(S)Z 17:06 Uhr.
US $ je Euro1,1549 | -0,54%52-W-.Hoch 1,2349 | Tief 1,1524
Devisen-Cross-Rates4.11.2021 Euro US $ Pfund Yen sfr kan-$ Rubel
Euro - 1,1549 0,8551 131,2438 1,0538 1,4382 82,2582US $ 0,8659 - 0,7404 113,6350 0,9126 1,2452 71,2205Pfund 1,1694 1,3505 - 153,4373 1,2320 1,6814 96,1681Yen 0,0076 0,0088 0,0065 - 0,0080 0,0110 0,6267sfr 0,9487 1,0956 0,8112 124,5026 - 1,3646 78,0508
Mitgeteilt von
HEIZÖLPREISEeid HAMBURG. Am 3.11.2021 ermittelte der EID folgende Ange-botspreise für Lieferungen von 3000 l (Premium-Qualität) freiVerwendertank in €/100 l einschl. 19% MwSt., EBV und IWO:
Heizöl (Ø 15 Städte) 89,50 | -1,01 %52-Wochen-Hoch 97,20 | Tief 44,30
2.12.2020 3.11.20212.12.2020 3.11.20221
Berlin 94,90 - 96,55Bremen 87,80 - 89,95Cottbus 86,05 - 96,15Dresden 87,75 - 91,50Düsseldorf 90,90 - 92,60Frankfurt 93,25 - 98,65Hamburg 88,30 - 95,20Hannover 87,45 - 97,30
Karlsruhe 90,15 - 94,05Kiel 86,85 - 94,10Leipzig 87,70 - 94,85Lübeck 88,50 - 95,55München 92,60 - 97,35Rostock 88,55 - 95,05Stuttgart 91,75 - 94,90
TOP-FLOP DER ROHSTOFFTITEL4.11.2021 Kurs ± % Vortag
Bauholz ($/mbf) 675,30 +4,42 WWWWWWWWWW
Silber ($/Unze) 23,97 +3,16 WWWWWWW
Kakao ($/t) 2 477,0 +2,06 WWWWW
Schlachtschweine (Cents/lb) 77,45 +1,97 WWWW
Brentöl ($/Barrel) 82,82 +1,77 WWWW
Erdgas (Cents/mmBtu) 5,54 WWWWW -2,26Sojaöl (cents/lb) 59,73 WWWWW -2,13Aluminium, hochgrädig ($/t) 2 644,0 WWWWW -2,04Zinn ($/t) 37 960,0 WWWW -1,91Kohle ($/t) 148,00 WWWW -1,66
DEUTSCHE EDELMETALLE4.11.2021 3.11.
Silber 638,75 - 704,99 639,29 - 705,59Silber verarb. 737,78 738,41Platin Barren 31,27 31,14Platin verarb. 32,43 32,30Palladium Barren 60,06 59,39Palladium verarb. 62,35 61,66Gold 48,51 - 52,28 48,73 - 52,52Gold verarb. 54,75 55,01Silber Euro / kg; Platin, Palladium und Gold, Euro / g.Die Preise gelten nur für industrielle Abnehmer (ohne MwSt.)Quelle: Heraeus
DEUTSCHE METALLPREISEKassa Basis London (€/100 kg) 4.11.2021 3.11.
Aluminium, hochgrädig 228,5 - 228,6 233,6 - 233,6Aluminium, Legierung 216,6 - 217,5 216,3 - 217,2Blei 208,6 - 208,6 208,9 - 209,1Kupfer (A) 846,2 - 846,2 848,1 - 848,2Kobalt 4 990,9 - 5 034,2 4 812,2 - 4 855,4Nickel 1 692,5 - 1 694,2 1 707,1 - 1 707,5Zink, spezial-hochgrädig 288,9 - 289,0 290,8 - 291,0Zinn 3 303,6 - 3 312,3 3 314,9 - 3 323,5
GSCI 2 857,84 | +0,09 %52-W.-Hoch 2 949,16 | Tief 1 703,22
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20221
Rohstoffe Schalterkurse Edelmetalle
Goldbarren und -münzen in Euro Ankauf Verkauf Rendite in % 52-Wochen(Mehrwertsteuerfrei) 4.11.2021 4.11. 4.11.2020 Hoch Tief
Gold (kg) 49 400,00 51 175,00 WWWWWWWWWW - 7,84 53 150,50 45 820,00500 g Goldbarren 24 700,00 25 749,00 WWWWWWWWWW - 8,07 26 618,00 23 000,00100 g Goldbarren 4 940,00 5 179,00 WWWWWWWWWWW - 8,57 5 334,75 4 611,251 oz Goldbarren 1 536,50 1 619,30 WWWWWWWWWWWW - 9,03 1 665,60 1 440,5010 g Goldbarren 494,00 535,00 WWWWWWWWWWWWWWW - 11,31 541,75 469,251 oz Krügerrand 1 544,00 1 636,00 WWWWWWW - 10,39 1 682,00 1 455,001/2 oz Krügerrand 772,00 857,10 WWWWWWWWW - 13,85 858,05 744,501/4 oz Krügerrand 386,00 449,90 WWWWWWWWWWWW - 17,61 439,35 381,051/10 oz Krügerrand 154,00 189,90 WWWWWWWWWWWWWWW - 22,14 180,95 157,801 oz Maple Leaf 1 544,00 1 631,00 WWWWWWW - 9,65 1 674,75 1 448,251 Österreichischer Dukat 171,90 189,00 WWWW - 5,81 181,25 161,254 Österreichische Dukaten 687,60 732,00 WWWWWWWW - 11,16 746,75 640,7520 Österreichische Kronen 294,30 311,50 WWWWWWW - 10,55 318,50 276,65100 Österreichische Kronen 1 475,00 1 558,00 WWWWWW - 8,21 1 585,50 1 390,0020 Francs Leopold 282,00 312,00 WWWWWWWWW - 13,36 313,00 271,5020 Francs Marianne 289,60 307,70 WWWWWWWWWW - 15,25 322,00 269,801 D-Mark BRD Goldmark 601,70 814,10 WWWWWWWWWWWWWW - 20,93 712,15 632,9520 Mark Wilhelm I 358,00 431,00 WWWWWWWWWWWWWW - 21,66 419,50 361,7520 Mark Wilhelm II 358,00 413,90 WWWWWWWWWWWWWW - 20,71 416,15 351,8550 Mex. Pesos 1 787,50 1 893,60 WWWWWWWW - 11,21 1 981,00 1 795,452 Rand 357,30 389,00 WWWWWW - 8,38 381,45 341,501 Sovereign 365,50 382,90 WWWW - 5,63 382,45 338,2020 Franken Vreneli 289,90 320,50 WWWWWWWWWW - 15,60 322,25 282,50
Die Quelle der An- und Verkaufspreise (gültig für sehr gut erhaltene Stücke) ist die Degussa Goldhandel GmbH. Die Rendite entspricht dem Preis,den die Quelle dem Anleger bei einem Goldverkauf bezahlt, abzüglich der Anschaffungskosten, die ihm beim Kauf vor einem Jahr entstanden sind.
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
4.11.1.9.2021
66
63
60
57
54
Quelle: BloombergHANDELSBLATT
Lanxess: Aktienkurs in Euro 55,€26
Die Lanxess-Aktien gaben nach einem gekappten Ergeb-nisziel mehr als sieben Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 54,86 Euro nach. Das war der schwärzeste Börsentag seit rund einem Jahr für das Papier des Spezialchemie-Kon-zerns. Die Analysten von Credit Suisse und Jefferies sehen Gegenwind für die Aktien, da die neuen Ziele unter den durchschnittlichen Schätzungen lägen.
Chart des Tages
Geldanlage
42 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Märkte heute
Tops FlopsDax
MDax
Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50Aktienindex in Punkten
Zalando +4,59 %
Deutsche Post NA +3,08 %
Siemens Energy +2,79 %
Deutsche Bank NA -3,53 %
HeidelbergCement -2,82 %
Brenntag NA -2,45 %
Alstria Office +17,33 %
Nemetschek +5,08 %
Hypoport SE +3,85 %
Lanxess -6,99 %
freenet NA -6,91 %
ProSiebenSat.1 -5,93 %
Adyen +3,49 %
Deutsche Post NA +3,08 %
Universal Music Gr. +2,74 %
Banco Santander -2,60 %
BBVA -2,56 %
Flutter Entertain. -2,34 %
Stand: 04.11. / ME(S)Z 17:05 Uhr Quelle:
zum Vorjahr +37,05 %
4 332,13Punkte
zum Vorjahr+0,52 %
Euro-Wechselkurs
1,1569 US$
-1,30 % zum Vorjahr
10-jährige Bundesanleihe
-0,2260 %
+0,41 % zum Vorjahr
Rendite
Brentöl 82,74 US$je Barrel
+100,83 % zum Vorjahr
Gold 1793,52 US$
-5,81 % zum Vorjahr
je Feinunze
4.11.20211.12.2020 4.11.201.12.2020 021
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.2021
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.2021
Tagesverlauf
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.2021
je Euro
1.12.2020 4.11.2021 1.12.2020 44.11.2021
Dividendenrendite Jahresdiv. Ex-Tag KGV ErgebnisBASF NA 5,4 % 3,30 € 30.04.21
Allianz vNA 4,8 % 9,60 € 06.05.21
E.ON NA 4,2 % 0,47 € 20.05.21
Bayer NA 4,0 % 2,00 € 28.04.21
Münchener Rück vNA 3,8 % 9,80 € 29.04.21
Deutsche Telekom NA 3,6 % 0,60 € 06.04.21
HeidelbergCement 3,4 % 2,20 € 07.05.21
BMW St. 5,9 15,21
Porsche Vz. 6,4 13,66
Volkswagen Vz. 6,7 28,10
Covestro 6,9 7,85
Daimler NA 7,5 11,52
HeidelbergCement 8,0 8,10
Bayer NA 8,2 6,09
Dax 16037,86 | +0,49 % | 52-Wochen-Hoch 16064,79 | 52-Wochen-Tief 12370,08
Tages- 52 Wochen Umsatz Letzte HV Div. Div.s Ergebnis KGV Marktk.Streub.4.11.2021 / 17:06 h Hoch Tief Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Termin Rend. 2021 2021 2022 2021 2022 in Mrd in %
Adidas NA 1) 2) 296,00 292,75 293,35 +0,6 W +8,93 W 336,25 252,05 281 605 3,00 12.05.22 1,0 3,29 7,58 10,03 38,70 29,25 58,8 87Airbus 1) 2) 109,80 107,72 108,46 +0,44 W +57,99 WWWWWWW 120,92 68,78 237 337 k.A. 14.04.21 k.A. 0,78 3,77 4,83 28,77 22,46 85,3 78Allianz vNA 1) 2) 204,20 200,60 201,50 WW -0,79 +22,78 WWW 223,50 166,60 594 422 9,60 04.05.22 4,8 10,31 20,28 21,46 9,94 9,39 83,1 93BASF NA 1) 2) 63,32 61,55 61,64 WWW -1,49 +23,11 WWW 72,88 49,59 2 282 302 3,30 29.04.22 5,4 3,40 6,38 5,72 9,66 10,78 56,6 94Bayer NA 1) 2) 50,82 49,88 49,96 W -0,59 +14,18 WW 57,73 42,52 1 075 794 2,00 29.04.22 4,0 2,00 6,09 6,65 8,20 7,51 49,1 94Beiersdorf 93,66 91,50 93,14 W -0,06 W -0,58 108,05 81,86 223 806 0,70 31.03.22 0,8 0,70 3,05 3,32 30,54 28,05 23,5 49BMW St. 1) 91,44 89,22 89,92 W -0,04 +43,83 WWWWW 96,39 63,13 891 608 1,90 11.05.22 2,1 4,60 15,21 13,37 5,91 6,73 54,1 53Brenntag NA 85,24 80,34 82,60 WWWWWW -2,59 +42,66 WWWWW 87,40 57,46 657 255 1,35 10.06.21 1,6 1,45 4,07 4,47 20,29 18,48 12,8 95Continental 104,46 100,76 101,40 WW -0,78 +22,19 WWW 118,65 81,14 280 160 k.A. 29.04.22 k.A. 2,00 6,22 9,47 16,30 10,71 20,3 54Covestro 55,48 53,78 54,08 WWWW -1,64 +27,73 WWW 63,24 41,64 738 536 1,30 21.04.22 2,4 2,77 7,85 6,26 6,89 8,64 10,4 100Daimler NA 1) 2) 88,24 83,50 86,64 W -0,45 +80,42 WWWWWWWWWW 88,24 47,76 3 351 398 1,35 01.10.21 1,6 4,50 11,52 11,57 7,52 7,49 92,7 73Delivery Hero 109,70 107,95 109,05 +0,97 WW +2,64 W 145,40 91,00 176 660 k.A. 16.06.21 k.A. 0,00 -5,06 -3,74 0,00 0,00 27,2 64Deutsche Bank NA 11,70 11,01 11,06 WWWWWWWW -3,77 +29,28 WWWW 12,56 8,37 11 614 696 k.A. 19.05.22 k.A. 0,20 1,10 1,33 10,06 8,32 22,9 94Deutsche Börse NA 1) 150,60 146,90 149,50 +1,67 WWWW +13,04 WW 152,65 128,15 251 255 3,00 18.05.22 2,0 3,20 6,58 7,12 22,72 21,00 28,4 93Deutsche Post NA 1) 2) 58,07 56,28 57,52 +3,08 WWWWWWW +42,98 WWWWW 61,38 37,92 2 534 743 1,35 06.05.22 2,3 1,67 3,90 3,97 14,75 14,49 71,3 74Deutsche Telekom NA 1) 2) 3) 16,73 16,57 16,64 +0,04 W +21,4 WWW 18,92 14,13 4 764 693 0,60 07.04.22 3,6 0,60 1,14 1,27 14,60 13,11 83,0 86E.ON NA 11,34 11,16 11,28 +1,13 WW +20,92 WWW 11,43 8,27 2 751 316 0,47 12.05.22 4,2 0,49 0,86 0,89 13,12 12,68 29,8 85Fresenius 39,68 39,03 39,15 +0,85 WW +17,17 WW 47,60 32,94 1 004 631 0,88 21.05.21 2,2 0,90 3,27 3,69 11,97 10,61 21,9 73Fresenius Medical Care St. 59,62 58,02 59,22 +2,24 WWWWW WW -16,21 75,08 55,18 411 362 1,34 20.05.21 2,3 1,23 3,63 4,27 16,31 13,87 17,4 68HeidelbergCement 65,04 63,42 64,72 WWWWWW -2,91 +21,98 WWW 81,04 52,76 955 608 2,20 06.05.21 3,4 2,46 8,10 8,36 7,99 7,74 12,8 69HelloFresh 88,88 86,54 88,18 +0,52 W +75,48 WWWWWWWWW 97,38 38,02 663 447 k.A. 26.05.21 k.A. 0,00 1,66$ 2,03$ 61,35 50,17 15,3 89Henkel Vz. 80,58 79,48 80,16 W -0,32 W -8,72 99,50 75,78 349 888 1,85 04.04.22 2,3 1,85 4,65 4,98 17,24 16,10 14,3 100Infineon NA 1) 3) 42,61 41,78 42,03 +0,07 W +64,57 WWWWWWWW 42,61 25,59 2 850 139 0,22 24.02.22 0,5 0,27 1,12 1,43 37,53 29,39 54,9 93Linde PLC 1) 2) 286,55 281,85 285,65 +1,42 WWW +41,41 WWWWW 286,55 199,35 432 113 $1,06 26.07.21 1,2 4,24 10,35 11,29 27,60 25,30 148,6 100Merck 217,60 213,50 217,20 +1,83 WWWW +59,94 WWWWWWW 217,60 126,60 199 960 1,40 22.04.22 0,6 1,50 8,28 8,78 26,23 24,74 28,1 93MTU Aero Engines NA 193,60 190,55 191,10 W -0,16 +18,29 WW 224,90 160,55 66 768 1,25 21.04.21 0,7 1,98 5,85 8,09 32,67 23,62 10,2 90Münchener Rück vNA 1) 263,70 260,30 260,85 +0,06 W +20,99 WWW 269,30 203,60 151 680 9,80 28.04.22 3,8 10,37 19,21 23,94 13,58 10,90 36,5 94Porsche Vz. 88,48 86,70 87,30 W -0,23 +76,51 WWWWWWWWWW 102,00 49,38 414 883 2,21 23.07.21 2,5 3,80 13,66 15,49 6,39 5,64 13,4 100Puma 111,40 109,90 110,70 +1,37 WWW +42,47 WWWWW 111,40 78,66 141 325 0,16 05.05.21 0,1 0,59 1,95 2,85 56,77 38,84 16,7 62Qiagen 3) 48,41 47,27 48,34 +1,49 WWW +11,59 W 49,95 36,00 501 040 k.A. 29.06.21 k.A. 0,00 2,45 2,04 19,73 23,70 11,2 100RWE St. 33,29 32,77 32,89 0 W -2,89 38,65 28,39 1 230 463 0,85 28.04.22 2,6 0,90 1,83 1,85 17,97 17,78 22,2 94SAP 1) 2) 3) 129,52 127,32 129,22 +0,61 W +33,56 WWWW 129,52 95,96 997 526 1,85 18.05.22 1,4 1,86 5,93 5,19 21,79 24,90 158,7 84Sartorius Vz. 3) 591,40 577,60 589,20 +0,79 WW +49,85 WWWWWW 599,60 332,00 34 590 0,71 26.03.21 0,1 1,34 7,67 8,33 76,82 70,73 22,1 100Siemens Energy 24,01 23,11 23,54 +2,75 WWWWWW +23,67 WWW 34,48 19,85 2 575 616 k.A. 09.02.22 k.A. 0,10 -0,18 0,84 0,00 28,02 17,1 60Siemens Healthineers 3) 62,18 58,48 61,16 +1,97 WWWW +61,91 WWWWWWWW 62,18 36,92 801 738 0,80 11.02.22 1,3 0,88 1,94 2,04 31,53 29,98 69,0 25Siemens NA 1) 2) 146,56 143,56 146,08 +1,32 WWW +35,94 WWWW 151,86 107,08 718 899 3,50 10.02.22 2,4 3,60 7,26 7,71 20,12 18,95 124,2 88Symrise Inh. 124,90 121,25 124,05 +0,16 W +12,82 WW 127,15 95,88 173 089 0,97 05.05.21 0,8 1,07 2,82 3,04 43,99 40,81 17,3 89Volkswagen Vz. 1) 189,72 185,60 187,82 +1,19 WWW +42,2 WWWWW 252,20 132,62 932 288 4,86 22.07.21 2,6 7,56 28,10 32,29 6,68 5,82 38,7 100Vonovia NA 1) 54,08 52,54 53,58 +0,68 W W -9,65 61,66 48,57 806 252 1,69 16.04.21 3,2 1,80 2,47 2,70 21,69 19,84 30,8 90Zalando 78,86 75,04 78,78 +4,57 WWWWWWWWWW W -10,7 105,90 73,60 813 333 k.A. 19.05.21 k.A. 0,00 1,00 1,14 78,78 69,11 20,6 69
(auch im 1) Euro Stoxx 50, 2) Stoxx 50, 3) TecDAX)
1.12.2020 4.11.2021 1.12.2020 44.11.2021
Dividendenrendite Jahresdiv. Ex-Tag KGV Ergebnisfreenet NA 7,7 % 1,65 € 21.06.21
Telefónica Dt. 7,5 % 0,18 € 21.05.21
Evonik Industries 4,1 % 1,15 € 03.06.21
Grand City Prop. 3,6 % 0,82 € 01.07.21
Talanx NA 3,6 % 1,50 € 07.05.21
ProSiebenSat.1 3,5 % 0,49 € 02.06.21
Uniper NA 3,5 % 1,37 € 20.05.21
K+S NA 5,8 2,65
ProSiebenSat.1 9,7 1,44
Wacker Chemie 10,1 15,93
Talanx NA 11,1 3,80
Rheinmetall 11,9 7,16
freenet NA 12,5 1,71
Lanxess 12,9 4,28
MDax 35867,96 | +0,90 % | 52-Wochen-Hoch 36428,86 | 52-Wochen-Tief 27108,76
Tages- 52 Wochen Umsatz Letzte HV Div. Div.s Ergebnis KGV Marktk.Streub.4.11.2021 / 17:06 h Hoch Tief Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Termin Rend. 2021 2021 2022 2021 2022 in Mrd in %
Aixtron NA 3) 22,07 20,14 20,46 WWW -4,44 +112,15 WWWWW 26,60 9,58 2 575 756 0,11 25.05.22 0,5 0,14 0,72 0,75 28,42 27,28 2,3 100Alstria Office 20,00 19,48 19,50 +17,33 WWWWWWWWWW +74,11 WWW 20,00 11,45 3 453 756 0,53 06.05.21 2,7 0,53 0,61 0,67 31,97 29,10 3,5 82Aroundtown 6,31 6,14 6,28 +3,32 WW +48,24 WW 7,16 4,19 2 857 857 0,07 30.06.21 1,1 0,23 0,34 0,41 18,48 15,33 9,7 84Aurubis 76,38 75,24 75,54 +0,21 W +33,18 W 87,74 57,40 44 203 1,30 17.02.22 1,7 1,50 5,43 5,52 13,91 13,68 3,4 70Auto1 Group 33,20 32,00 32,40 W -1,82 0 56,76 28,19 40 866 k.A. 24.06.21 k.A. 0,00 -0,83 -0,68 0,00 0,00 6,9 48Bechtle 3) 68,84 66,90 68,80 +2,75 WW +32,15 W 68,84 49,13 218 514 0,45 02.06.22 0,7 0,50 1,79 1,95 38,44 35,28 8,7 51Befesa 63,80 62,20 63,60 +1,11 W +81,46 WWW 72,90 36,00 55 650 1,17 05.10.21 2,3 1,33 2,67 3,32 23,82 19,16 2,5 81Cancom 3) 63,18 61,10 61,94 +0,13 W +66,51 WWW 63,18 37,86 68 615 0,75 29.06.21 1,2 0,75 1,46 1,62 42,42 38,23 2,4 80Carl Zeiss Meditec 3) 185,80 181,75 185,40 +1,37 W +62,2 WWW 202,00 105,40 41 446 0,50 27.05.21 0,3 0,79 2,80 2,93 66,21 63,28 16,6 36Commerzbank 6,90 6,46 6,51 +0,99 W +52,78 WW 6,90 3,98 16 583 586 k.A. 10.05.22 k.A. 0,00 -0,28 0,53 0,00 12,28 8,2 80CompuGroup Med. 3) 77,85 74,00 74,80 W -0,73 W -2,92 85,35 59,40 54 404 0,50 05.05.22 0,7 0,55 1,98 2,28 37,78 32,81 4,0 54CTS Eventim 69,78 68,12 69,36 +1,94 W +68,27 WWW 69,78 41,38 43 664 k.A. 07.05.21 k.A. 0,00 -0,16 1,25 0,00 55,49 6,7 61Dürr 41,90 39,04 39,08 W -2,15 +49,05 WW 44,08 25,26 148 383 0,30 06.05.22 0,8 0,63 1,65 2,52 23,68 15,51 2,7 74Evonik Industries 29,01 27,65 28,22 W -1,02 +30,71 W 31,00 21,35 932 173 1,15 25.05.22 4,1 1,15 1,92 2,13 14,70 13,25 13,2 41Evotec 3) 39,48 37,38 39,14 +0,36 W +59,04 WW 45,83 23,69 1 302 558 k.A. 15.06.21 k.A. 0,00 0,38 0,24 103 163 6,5 73Fraport 66,10 63,54 65,74 +3,07 WW +98,49 WWWW 66,10 32,76 187 477 k.A. 01.06.21 k.A. 0,00 -1,06 2,88 0,00 22,83 6,1 40freenet NA 3) 23,26 21,01 21,43 WWWW -6,91 +33,81 W 23,26 16,01 1 804 939 1,65 18.06.21 7,7 1,50 1,71 1,90 12,53 11,28 2,7 100Fuchs Petrolub Vz. 41,50 40,88 40,96 W -0,92 W -11,91 49,70 37,04 30 779 0,99 03.05.22 2,4 1,03 1,83 2,01 22,38 20,38 2,8 100GEA Group 43,73 43,07 43,70 +1,32 W +43,56 WW 43,73 27,40 105 702 0,85 28.04.22 1,9 0,90 1,64 1,84 26,65 23,75 7,9 77Gerresheimer 84,30 82,15 83,00 +0,85 W W -9,64 103,70 75,60 99 344 1,25 09.06.21 1,5 1,30 4,30 5,02 19,30 16,53 2,6 85Grand City Prop. 22,78 22,24 22,70 +1,89 W +9,45 W 24,14 19,10 244 696 0,82 30.06.21 3,6 0,84 1,11 1,31 20,45 17,33 4,0 61Hann. Rückv. NA 165,90 162,60 162,95 +0,52 W +22,8 W 165,90 126,70 109 223 4,50 04.05.22 2,8 5,75 9,96 12,26 16,36 13,29 19,7 50Hella 60,42 59,70 60,40 +0,17 W +53,53 WW 68,72 39,58 109 529 0,96 30.09.22 1,6 0,81 3,22 2,98 18,76 20,27 6,7 40Hugo Boss NA 55,18 53,50 54,96 +1,4 W +165,12 WWWWWWW 55,18 20,39 229 592 0,04 11.05.21 0,1 0,64 1,64 2,44 33,51 22,52 3,9 78Hypoport SE 554,00 536,50 554,00 +3,94 WW +28,69 W 618,00 400,00 5 961 k.A. 21.05.21 k.A. 0,00 5,27 7,02 105 78,92 3,6 65Jungheinrich Vz. 46,36 44,82 45,84 +1,6 W +28,76 W 48,04 33,60 48 181 0,43 11.05.21 0,9 0,62 2,30 2,49 19,93 18,41 2,2 100K+S NA 15,55 15,14 15,42 +1,02 W +169,67 WWWWWWW 15,55 5,66 856 964 k.A. 12.05.21 k.A. 0,18 2,65 1,12 5,82 13,77 3,0 100Kion Group 98,12 96,68 97,40 +0,62 W +40,1 WW 98,12 63,26 115 388 0,41 11.05.22 0,4 1,10 4,31 5,34 22,60 18,24 12,8 55Knorr-Bremse 95,02 93,30 94,06 W -0,28 W -9,24 117,24 88,16 52 228 1,52 20.05.21 1,6 1,76 3,77 4,22 24,95 22,29 15,2 41Lanxess 57,64 54,86 55,30 WWWW -7,12 +20,53 W 67,38 44,18 676 868 1,00 19.05.21 1,8 1,06 4,28 5,14 12,92 10,76 4,8 84LEG Immobilien 133,50 129,85 132,10 +2,17 W +6,7 W 139,80 110,18 72 529 3,78 27.05.21 2,9 4,08 5,63 5,96 23,46 22,16 9,6 100Lufthansa vNA 6,65 6,34 6,49 +2,88 WW +13,48 W 9,25 5,26 15 633 393 k.A. 04.05.21 k.A. 0,00 -2,67 0,04 0,00 162 7,8 86Nemetschek 3) 110,00 104,00 109,85 +5,27 WWW +72,18 WWW 110,00 50,95 165 680 0,30 12.05.21 0,3 0,33 1,12 1,17 98,08 93,89 12,7 48ProSiebenSat.1 15,38 13,55 13,95 WWW -5,93 +39,78 WW 19,00 10,95 4 223 694 0,49 05.05.22 3,5 0,70 1,44 1,61 9,69 8,66 3,3 76Rational 896,00 852,60 895,80 +0,9 W +33,9 W 1 033,50 646,50 9 391 4,80 04.05.22 0,5 7,19 11,03 13,77 81,21 65,05 10,2 40Rheinmetall 86,44 85,18 85,34 +0,14 W +24,11 W 93,80 66,34 66 452 2,00 11.05.21 2,3 2,49 7,16 9,24 11,92 9,24 3,7 100Scout24 NA 63,62 62,32 63,48 +2,39 W W -11,28 73,36 56,94 109 961 0,82 08.07.21 1,3 0,75 1,50 1,82 42,32 34,88 5,8 89Software 3) 36,42 35,74 36,26 +1 W +11,16 W 44,00 31,58 96 626 0,76 12.05.21 2,1 0,77 1,35 1,75 26,86 20,72 2,7 69Ströer & Co. 74,95 73,95 74,75 +0,88 W +19,41 W 82,50 59,60 43 724 2,00 03.09.21 2,7 2,00 2,68 3,57 27,89 20,94 4,2 48TAG Immobilien 26,94 26,37 26,82 +1,9 W W -1,03 29,37 23,16 127 151 0,88 11.05.21 3,3 0,92 1,24 1,33 21,63 20,17 3,9 87Talanx NA 42,48 41,78 42,00 W -0,28 +53,62 WW 42,48 27,38 100 172 1,50 05.05.22 3,6 1,60 3,80 4,38 11,05 9,59 10,6 21TeamViewer 3) 14,90 14,06 14,39 W -0,86 WWW -62,23 49,64 12,47 2 423 995 k.A. 15.06.21 k.A. 0,00 0,47 0,67 30,62 21,48 2,9 75Telefónica Dt. 3) 2,40 2,34 2,39 +1,79 W +5,25 W 2,63 2,13 8 481 657 0,18 20.05.21 7,5 0,18 0,01 0,02 239 119 7,1 31thyssenkrupp 9,08 8,84 8,91 +1,27 W +109,74 WWWWW 12,03 4,05 1 690 508 k.A. 04.02.22 k.A. 0,00 -0,41 0,85 0,00 10,49 5,5 61Uniper NA 39,25 38,67 39,06 +0,39 W +44,35 WW 39,25 26,52 59 597 1,37 18.05.22 3,5 1,37 2,09 1,82 18,69 21,46 14,3 25United Internet NA 3) 32,74 32,36 32,46 W -0,55 +5,97 W 39,34 29,35 46 813 0,50 27.05.21 1,5 0,50 2,28 2,41 14,24 13,47 6,3 42Vantage Towers 3) 29,81 29,38 29,65 +0,44 W 0 31,58 23,97 52 511 0,56 28.07.21 1,9 k.A. 0,00 0,77 0,00 38,51 15,0 19Varta 3) 130,75 128,00 129,40 +0,98 W +14,61 W 181,30 100,40 101 134 2,48 17.06.21 1,9 0,66 3,28 4,17 39,45 31,03 5,2 44Wacker Chemie 161,75 157,55 160,25 +1,52 W +92,05 WWWW 162,40 83,18 87 581 2,00 12.05.21 1,2 4,30 15,93 10,39 10,06 15,42 8,4 34zooplus 481,00 467,60 480,40 +1,56 W +238,31 WWWWWWWWWW 491,80 133,00 17 065 k.A. 16.12.21 k.A. 0,00 3,20 4,12 150 117 3,4 64
TecDax 3946,45 | +0,65 % | 52-Wochen-Hoch 3990,76 | 52-Wochen-Tief 2911,88
Hinweis zum Kursteil: Telefon: 0800 0002053 oder Mail [email protected]. Aktien: Börsenplatz Dax 40 und MDax ist Xetra; Euro Stoxx Heimatbörse; Kurse und Dividenden von an deutschen Börsen gehandelten Wertenverstehen sich in Euro pro Stück sofern es keine anderen Angaben gibt. Dividenden von ausländischen Börsen sind in Landeswährung. Kurse: bereinigt um Kapitalmaßnahmen; Höchst-/Tiefstkurse können gerundet sein,beziehen sich auf den jeweiligen Börsenplatz und basieren auf allen „bezahlt“-Notierungen. Von einigen Märkten können nicht immer die Schlusskurse des Tages veröffentlicht werden, Uhrzeitangaben derKursabrufe beachten. Die Dividendenangaben beziehen sich auf die zuletzt gezahlten Dividenden - inklusive Zahlungen aus Kapitalrücklagen - im üblichen Auszahlungsrhythmus; sie werden automatisch abgelöst durch denneuen Dividendenvorschlag, wenn dieser für die bevorstehende Hauptversammlung offiziell bekannt gegeben wird. Netto- Dividendenrendite in % auf Basis der zuletzt gezahlten oder vorgeschlagenen Dividende als Summedes letzten Geschäftsjahres. Die ausgewiesenen Gewinnschätzungen beruhen auf Ibes-Daten. Börsenkapitalisierung: Zahl der Aktien multipliziert mit dem Kurs der Aktiengattung im Index in Landeswährung;Ergebnisse je Aktie vor Goodwillab schreibung in Euro bzw. Landeswährung; KGV: Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen. k.A. = keine Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr - keine Anlageberatung oder -empfehlung.
Aktuelle Kursinformationen finden Sie unter http://finanzen.handelsblatt.com
Geldanlage
43
EuroStoxx50 4331,78 | +0,51 % | 52-Wochen-Hoch 4340,81 | 52-Wochen-Tief 3168,97
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 44.11.202152 Wochen Umsatz Letzte Div. Ergebnis KGV Marktk.Streub.
4.11.2021 / 17:06 h Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Rend. 2021 2021 2022 in Mrd in %
AB Inbev 51,35 WWWW -1,53 +9,69 W 65,86 46,66 1 199 567 0,50 1,0 2,83 18,14 15,42 89,1 54Adyen 2 726,50 +3,49 WWWWWWWWWW +67,63 WWWW 2 808,00 1 510,00 33 714 k.A. k.A. 14,92 183 130 83,2 87Ahold Delhaize 29,00 W -0,15 +20,11 W 29,46 21,50 956 253 0,43 3,1 2,05 14,14 13,94 31,9 94Air Liquide 149,74 +1,35 WWWW +11,08 W 153,26 124,25 467 409 2,75 1,8 5,56 26,93 24,83 70,9 100ASML Hold. 726,40 +2,69 WWWWWWWW +125,14 WWWWWWW 764,40 331,55 486 296 1,80 0,4 13,61 53,37 43,39 300,2 79AXA 25,44 WW -0,82 +64,16 WWWW 25,90 15,55 2 361 485 1,43 5,6 2,82 9,02 8,54 61,5 86Banco Santander 3,22 WWWWWWWW -2,7 +89,23 WWWWW 3,51 1,70 116 465 209 0,05 k.A. 0,40 8,05 7,49 55,8 95BBVA 6,02 WWWWWWWW -2,62 +145,15 WWWWWWWW 6,29 2,48 17 940 486 0,08 k.A. 0,57 10,56 9,87 40,1 95BNP Paribas 58,81 WWWWW -1,79 +77,57 WWWW 60,62 33,00 2 090 215 1,56 1,9 6,50 9,05 8,86 73,5 86CRH 43,00 W -0,26 +37,51 WW 45,96 31,31 793 862 0,20 2,2 3,24 13,27 12,22 33,3 100Danone 57,31 +0,03 W +14,44 W 65,30 48,97 859 382 1,94 3,4 3,27 17,53 16,47 39,4 94Enel 7,26 +0,01 W W -1,51 9,05 6,55 16 281 212 0,18 4,9 0,54 13,44 12,96 73,8 66ENI 12,54 +1,32 WWWW +90,15 WWWWW 12,83 6,47 11 891 771 0,43 2,9 0,92 13,63 11,10 45,2 70Essilor-Luxottica 189,14 +0,34 W +73,92 WWWW 189,42 111,05 309 227 1,08 0,6 4,76 39,74 33,07 83,6 68Flutter Entertain. 148,10 WWWWWWW -2,31 W -2,63 198,60 135,10 175 177 £0,67 1,5 324,98 0,46 0,36 26,0 69Iberdrola 10,21 +0,69 WW W -3,03 12,39 8,59 3 918 455 0,03 0,3 0,57 17,91 16,47 65,0 86Inditex 32,07 +1,84 WWWWW +41,9 WW 32,85 22,79 10 465 471 0,35 1,1 0,36 89,08 27,65 100,0 36ING Groep 13,27 WW -0,85 +107,02 WWWWWW 13,74 6,03 15 209 780 0,48 2,7 1,22 10,87 11,34 51,8 100Intesa Sanpaolo 2,45 WWWWWW -2,22 +53,12 WWW 2,59 1,59 110 887 996 0,07 2,9 0,22 11,12 9,79 47,5 89Kering 647,20 +0,03 W +16,99 W 798,00 513,30 86 174 5,50 1,2 25,56 25,32 21,86 80,9 59Kone Corp. 60,46 +1,37 WWWW W -15,63 75,44 55,48 333 337 2,25 3,7 2,02 29,93 28,25 27,4 89L’Oréal 408,05 +0,62 WW +36,06 WW 408,25 290,10 150 380 4,06 1,0 8,61 47,39 43,23 227,6 43LVMH 692,30 +1,44 WWWW +64,13 WWWW 716,60 429,55 206 348 3,00 0,9 21,10 32,81 29,89 349,4 53Pernod Ricard 204,10 +0,25 W +39,94 WW 204,50 146,10 183 335 1,79 1,5 6,16 33,13 28,67 53,4 74Philips Electr. 40,88 +0,07 W W -4,05 50,98 36,18 972 005 0,85 2,1 1,95 20,96 21,07 37,5 93Prosus 75,59 W -0,47 W -17,03 110,00 65,71 947 642 0,11 k.A. 3,51 21,54 20,05 156,7 43Safran 114,50 +0,46 W +16,67 W 127,74 98,16 339 442 0,43 0,4 2,70 42,41 26,50 48,9 73Sanofi S.A. 89,38 WWW -0,95 +2,96 W 91,14 74,92 1 123 257 3,20 3,6 6,32 14,14 12,62 112,9 84Schneider Electr. 153,86 +0,88 WWW +37,38 WW 159,30 111,00 403 834 2,60 1,7 5,81 26,48 23,97 87,6 94Stellantis 17,61 +0,34 W +174,6 WWWWWWWWWW 18,74 6,40 9 875 057 0,32 1,8 3,48 5,06 4,73 55,2 66TotalEnergies 43,23 +0,75 WW +54,95 WWW 45,16 27,12 3 008 541 0,66 6,1 5,45 7,93 7,24 114,1 88Universal Music Gr. 25,70 +2,72 WWWWWWWW 0 26,45 22,55 1 779 738 0,20 0,8 0,64 40,16 33,82 46,6 52Vinci 93,39 +0,42 W +26,75 WW 96,95 72,62 435 845 0,65 2,9 4,29 21,77 15,21 55,9 91
DividendenrenditeAXA 5,6 %
Enel 4,9 %
TotalEnergies 4,6 %
Kone Corp. 3,7 %
ING Groep 3,6 %
Sanofi S.A. 3,6 %
ENI 3,4 %
KGVFlutter Entertain. 0,5
Stellantis 5,1
TotalEnergies 7,9
Banco Santander 8,1
AXA 9,0
BNP Paribas 9,0
BBVA 10,6
(ohne deutsche Indextitel)
DänemarkHongkong
EURO-LEITZINSENREFINANZIERUNG (REFI)Mindestbietungssatz 0,00%Mindestbietungssatz, 7 Tage (fällig 10.11.2021) 0,00%
ZINSKANAL FÜR TAGESGELDSpitzenrefinanzierungsfazilität (ab 18.9.2020) 0,25%Einlagefazilität (ab 18.9.2020) -0,50%
MINDESTRESERVE Verzinsung (ab 31.1.2020) 0,00%
BASISZINS gem. § 247 BGB (ab 1.7.2021) -0,88%
EURO-RENDITEN3.11.2021 Hypo. und Öffentl.Laufzeit Pfandbriefe
1 Jahr(e) -0,4002 Jahr(e) -0,2403 Jahr(e) -0,1304 Jahr(e) -0,0505 Jahr(e) 0,020
Quelle: Deutsche Bundesbank
INTERNATIONALE RENDITEN10-j. Staatsanleihen 4.11.2021 ± in % 3.11.Australien 1,83 W -1,4 1,85Belgien 0,085 WW -42,57 0,15Dänemark 0,025 WWW -74,49 0,098Deutschland -0,226 WW -40,37 -0,161Frankreich 0,12 W -37,57 0,19Griechenland 1,10 W -6,36 1,18Großbritannien 0,85 W -14,36 1,00Hongkong 1,51 +2,94 W 1,47Irland 0,17 W -31,69 0,24Italien 0,93 W -10,48 1,04
Japan 0,077 W -2,65 0,079Kanada 1,63 W -6,07 1,74Neuseeland 2,56 +1,43 W 2,52Niederlande -0,094 k.A. -0,026Österreich -0,007 k.A. 0,066Portugal 0,34 W -19,1 0,42Russland 8,29 W -0,24 8,31Schweden 0,28 W -2,8 0,29Schweiz -0,169 W -29,01 -0,131Spanien 0,44 W -15,27 0,52USA 1,54 W -2,45 1,57
Umlaufrendite-0,29 | +0,0152-Wochen-Hoch -0,16 | Tief -0,64
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20221
AUSLÄNDISCHE LEITZINSENSatz in % gültig ab
EU-MITGLIEDSLÄNDERDänemark Diskontsatz 0,00 22.06.2017Grossbritannien Repo Satz 0,10 19.03.2020Polen Diskontsatz 0,60 09.04.2020Rumänien Reference Rate 1,50 05.10.2021Schweden Pensionssatz 0,00 08.01.2020Tschechien Diskontsatz 0,05 27.03.2020Ungarn Base Rate 1,80 19.10.2021
6 Jahr(e) 0,0807 Jahr(e) 0,1308 Jahr(e) 0,1809 Jahr(e) 0,23010 Jahr(e) 0,280
3.11.2021 Hypo. und Öffentl.Laufzeit Pfandbriefe
ZINSVERGLEICHE02.11.21
Festgeld 5tsd €1 Monat 0,03753 Monate 0,066 Monate 0,07112 Monate 0,0871
Spareckzins 0,0078
Sparbrief1 Jahr 0,08772 Jahre 0,13093 Jahre 0,21865 Jahre 0,2962
Dispositionskredit 9,2471
Hypozinsen effektiv 5 Jahre 0,9610 Jahre 0,95
Ratenkredit 5 tsd € 3 Jahre 3,56925 Jahre 3,6446 Jahre 3,7291
Ratenkredit 10 tsd € 3 Jahre 3,54655 Jahre 3,62326 Jahre 3,7091
Ø-Werte in %, mitgeteilt vonFMH-Finanzberatung e.K.
Zinsen
Zinsen
Europa
USA
GB
Japan
jeweils 1.9.2021 bis 4.11.2021
JJJJ
6.10.2014 4.11.2021-0,5
0,5
1,5
2,5
SDax 17383,28 | +0,81 % | 52-Wochen-Hoch 17418,30 | 52-Wochen-Tief 12262,13
52 Wochen Umsatz Letzte Div. Ergebnis KGV Marktk.Streub.4.11.2021 / 17:06 h Verlauf ± % Vortag ± % 1 Jahr Hoch Tief Stück Div. Rend. 2021 2021 2022 in Mrd in %
1&1 25,58 W -0,78 +36,97 W 27,86 17,69 58 085 0,05 0,2 2,07 12,36 13,46 4,5 25Aareal Bank 27,76 W -0,86 +84,57 WWW 29,90 14,87 96 506 1,10 5,4 0,85 32,66 14,69 1,7 93About You Hold. 18,80 WWWW -5,53 0 26,98 18,50 126 491 k.A. k.A. k.A. k.A. 0,00 3,5 37Adler Group 12,14 +7,53 WWWWWW WW -46,52 29,72 9,03 912 819 0,46 3,8 1,15 10,56 9,95 1,4 73ADVA Optical Net. 12,40 +2,99 WW +88,45 WWW 15,48 6,52 71 627 k.A. k.A. 0,85 14,59 14,09 0,6 85Amadeus Fire 200,00 +3,31 WWW +115,52 WWWW 206,50 90,40 8 839 1,55 0,8 6,08 32,89 28,74 1,1 89Atoss Software 211,00 +3,43 WWW +66,14 WW 211,00 120,50 11 714 1,67 0,8 2,20 95,91 86,48 1,7 49Basler 148,80 WWWWWWWWWW -13,08 +170,55 WWWWWW 174,40 55,00 30 353 0,58 0,4 k.A. k.A. k.A.BayWa vNA 36,40 W -0,27 +34,81 W 43,80 27,00 12 634 1,00 2,7 1,29 28,22 27,79 1,2 38Bilfinger 32,62 +5,63 WWWW +91,43 WWW 33,24 18,36 286 253 1,88 5,8 1,40 23,30 14,31 1,4 94Ceconomy St. 4,17 +0,29 W +1,81 W 6,02 3,37 184 820 k.A. k.A. 0,36 11,58 7,32 1,5 42CeWe Stiftung 127,80 0 +49,12 WW 138,40 86,70 4 914 2,30 1,8 7,34 17,41 16,08 0,9 68Dermapharm Holding 90,20 W -0,17 +99,27 WWWW 91,35 45,37 16 077 0,88 1,0 3,09 29,19 26,53 4,9 35Deutz 7,50 +1,63 W +57,5 WW 8,45 4,63 121 881 k.A. k.A. 0,26 28,85 8,52 0,9 100DIC Asset NA 15,78 +2,27 WW +52,32 WW 16,84 10,28 65 846 0,70 4,4 0,95 16,61 16,44 1,3 49Drägerwerk Vz. 69,90 +0,72 W W -1,83 82,70 60,70 22 345 0,19 0,3 9,86 7,09 11,10 0,6 100Dt. EuroShop NA 17,60 +2,09 WW +53,04 WW 21,68 11,58 90 460 0,04 0,2 1,87 9,41 8,80 1,1 75Dt. Pfandbriefbank 11,00 0 +93,83 WWW 11,17 5,67 340 552 0,32 5,3 1,06 10,38 10,48 1,5 100DWS Group 36,98 W -0,75 +13,47 W 41,88 31,45 50 232 1,81 4,9 3,38 10,94 10,48 7,4 16Eckert & Ziegler 135,70 W -1,24 +232,27 WWWWWWWW 141,40 39,86 45 589 0,45 0,3 1,51 89,87 77,10 2,9 69Encavis 17,17 +2,39 WW W -1,44 25,55 13,97 366 103 0,28 1,6 0,37 46,41 42,93 2,8 77Fielmann 60,35 +0,58 W W -9,66 72,45 55,00 37 037 1,20 2,0 1,99 30,33 26,70 5,1 28flatexDEGIRO 20,66 W -0,86 +62,04 WW 29,70 11,90 479 706 k.A. k.A. 0,86 24,02 14,86 2,3 60Global Fashion Grp. 7,65 W -0,33 W -5,01 14,96 6,60 144 575 k.A. k.A. -0,40 0,00 0,00 1,7 33Grenke NA 33,72 W -0,53 W -7,36 43,10 24,20 17 823 0,26 0,8 1,38 24,43 17,75 1,6 59Hamborner Reit 9,93 +1,7 W +17,81 W 10,22 8,42 75 537 0,47 4,7 0,63 15,76 22,07 0,8 82Hensoldt 14,10 W -0,84 +28,18 W 17,46 10,50 63 003 0,13 0,9 0,84 16,79 11,75 1,5 32Hochtief 66,82 +0,33 W +0,86 W 88,55 61,22 62 505 3,93 5,9 6,78 9,86 8,64 4,7 34home24 11,54 +0,52 W W -28,24 26,86 10,90 127 211 k.A. k.A. -0,96 0,00 0,00 0,3 87Hornbach Hold. 113,30 W -0,61 +27,3 W 117,00 69,70 15 083 2,00 1,8 10,33 10,97 11,11 1,8 46Indus Holding 34,75 +0,29 W +30,39 W 37,70 25,30 8 920 0,80 2,3 2,42 14,36 11,10 0,9 77Instone Real 23,75 +4,63 WWWW +30,78 W 28,35 18,50 34 198 0,26 1,1 2,00 11,88 9,03 1,1 90Jenoptik 34,40 +0,41 W +54,68 WW 34,76 21,62 75 510 0,25 0,7 1,39 24,75 23,40 2,0 79Jost Werke 51,10 +0,2 W +49,42 WW 57,80 34,20 7 496 1,00 2,0 4,45 11,48 10,10 0,8 69Klöckner & Co. NA 11,67 +0,17 W +131,09 WWWWW 13,49 5,16 549 604 k.A. k.A. 4,63 2,52 12,16 1,2 75Krones 92,45 +1,59 W +77,45 WWW 92,70 50,90 50 818 0,06 0,1 3,47 26,64 19,55 2,9 43KWS Saat 75,60 W -0,79 +16,49 W 80,90 61,70 9 109 0,80 1,1 3,20 23,63 20,54 2,5 31LPKF Laser&Electr. 21,02 +0,96 W +20,94 W 33,35 17,96 88 264 0,10 0,5 0,35 60,06 26,95 0,5 100Metro St. 11,20 +0,18 W +32,39 W 11,85 7,35 126 190 0,70 6,3 0,04 280 21,95 4,0 12MorphoSys 40,43 W -1,85 WW -58,84 101,90 37,10 156 228 k.A. k.A. -4,56 0,00 0,00 1,4 94Nagarro 177,50 +2,6 WW 0 183,50 66,20 13 173 k.A. k.A. 2,06 86,17 64,55 2,1 61New Work 211,00 WW -2,09 W -8,06 293,00 193,20 2 342 2,59 1,2 7,11 29,68 27,37 1,2 44Nordex 13,69 +0,96 W +16,21 W 27,26 12,05 2 179 658 k.A. k.A. -0,14 0,00 19,01 2,2 71Norma Group NA 37,10 +9,05 WWWWWWW +34,32 W 49,36 27,30 134 266 0,70 1,9 2,29 16,20 12,71 1,2 85Patrizia 23,35 +2,64 WW +13,08 W 26,95 20,30 52 257 0,30 1,3 0,82 28,48 23,12 2,2 48Pfeiffer Vacuum 214,50 W -1,83 +35,42 W 222,50 149,60 1 154 1,60 0,7 6,39 33,57 29,26 2,1 37PVA TePla 40,45 +9,92 WWWWWWWW +252,97 WWWWWWWWW 41,75 11,38 317 804 k.A. k.A. 0,48 84,27 55,41 0,9 86RTL Group 50,05 W -0,1 +47,47 WW 53,50 35,40 46 403 3,00 6,0 4,14 12,09 11,17 7,7 24S&T 19,83 WW -2,22 +15,02 W 24,20 17,61 531 353 0,30 1,5 0,91 21,79 16,39 1,3 73SAF Holland 12,74 +1,51 W +66,54 WW 14,49 7,58 61 419 k.A. k.A. 0,96 13,27 10,27 0,6 90Salzgitter 31,26 +0,9 W +156,44 WWWWWW 35,08 12,36 120 339 k.A. k.A. 9,26 3,38 5,73 1,9 64Schaeffler Vz. 6,96 W -0,71 +24,84 W 8,44 5,41 316 744 0,25 3,6 1,04 6,69 6,00 1,2 75Secunet 559,00 +2,38 WW +123,6 WWWW 565,00 221,00 9 864 2,54 0,5 6,94 80,55 84,83 3,6 25SGL Carbon 8,42 +1,45 W +215,95 WWWWWWWW 10,88 2,71 295 718 k.A. k.A. 0,13 64,77 27,16 1,0 46Shop Apotheke 148,30 +2,21 WW W -2,56 249,00 116,50 106 170 k.A. k.A. -1,77 0,00 0,00 2,7 85Siltronic NA 136,15 W -0,37 +63,45 WW 147,35 85,40 5 167 2,00 1,5 7,14 19,07 15,01 4,1 56Sixt St. 164,40 +1,42 W +132,7 WWWWW 169,80 70,45 46 086 k.A. k.A. 5,48 30,00 27,26 5,0 42SMA Solar Techn. 42,64 +0,71 W +11,92 W 71,80 33,58 82 035 0,30 0,7 0,24 178 54,67 1,5 55Stabilus 66,00 W -0,3 +28,4 W 72,55 51,80 5 948 0,50 0,8 3,55 18,59 16,46 1,6 83Sto & Co. KGaA Vz 207,00 +3,24 WW +84,82 WWW 236,50 118,40 3 486 5,00 2,4 11,24 18,42 16,15 0,5 100Stratec 140,60 +0,43 W +7,33 W 147,40 94,80 4 126 0,90 0,6 3,53 39,83 39,72 1,7 59Südzucker 13,91 +0,36 W +7 W 14,62 11,24 196 351 0,20 1,4 -0,52 0,00 17,83 2,8 31Suse 37,99 +3,29 WWW 0 40,59 25,56 66 385 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.Synlab 21,49 W -0,19 0 21,99 17,40 24 177 k.A. k.A. 2,58 8,33 16,16 4,8 16Takkt 13,92 W -1,28 +51,47 WW 14,60 9,18 14 166 1,10 7,9 0,83 16,77 13,78 0,9 50Traton 22,46 W -1,75 +30,23 W 28,46 17,20 72 787 0,25 1,1 2,14 10,50 6,09 11,2 10Verbio Verein. Bio. 74,15 +2,99 WW +276,78 WWWWWWWWWW 74,55 20,75 111 280 0,20 0,3 1,47 50,44 52,59 4,7 50Wacker Neuson NA 29,82 W -0,73 +78,24 WWW 30,46 15,12 106 549 0,60 2,0 1,56 19,12 15,95 2,1 42Westwing Group 27,32 +1,86 W W -7,92 54,35 22,96 53 686 k.A. k.A. 0,87 31,40 29,06 0,6 63Zeal Network 39,95 +3,23 WW +5,13 W 46,50 32,60 6 021 0,90 2,3 0,43 92,91 43,90 0,9 32
Devisenmärkte
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20221
Devisen- und Sortenkurse für 1 Euro4.11.2021 Devisen1, 3) 3 Monate4)
Geld Brief Geld BriefAustralien A $ 1,5598 1,5599 +27,84 +28,92Dänemark dkr 7,4176 7,4576 -10,04 -3,48Großbrit. £ 0,8499 0,8539 +15,77 +17,27Hongkong HK $ 8,9881 8,9890 +183,52 +196,28Japan Yen 131,3100 131,7900 +14,91 +15,62Kanada kan $ 1,4293 1,4413 +31,32 +32,19Neuseeland NZ $ 1,6241 1,6243 +61,71 +63,28Norwegen nkr 9,8543 9,9023 +341,31 +353,14Polen Zloty 4,5992 4,6016 +260,98 +273,84Schweden skr 9,8932 9,9412 +93,14 +100,34Schweiz sfr 1,0532 1,0572 -5,58 -4,68Singapur S $ 1,5604 1,5605 +40,81 +42,60Südafrika Rand 17,5555 17,5663 +2488,64 +2522,78Tschechien Krone 25,3500 25,3620 +160,72 +203,13USA US-$ 1,1521 1,1581 +26,59 +27,04
6 Monate4) Ref.kurse Bankschalter2)Geld Brief EZB Verkauf Ankauf
Australien +57,95 +60,48 1,5602 1,4823 1,6549Dänemark -24,95 -8,87 7,4377 7,0973 7,8639Großbrit. +37,77 +40,40 0,8535 0,8159 0,9071Hongkong +343,97 +363,41 9,0059 8,4005 10,1922Japan +27,02 +28,84 131,7700 125,4130 139,7711Kanada +70,66 +73,11 1,4365 1,3671 1,5262Neuseeland +133,76 +137,64 1,6235 1,5353 1,7270Norwegen +713,90 +733,83 9,8590 9,3859 10,4645Polen +625,91 +652,10 4,6067 4,3162 4,9765Schweden +203,92 +221,51 9,9060 9,4470 10,4891Schweiz -12,38 -10,25 1,0554 1,0095 1,1173Singapur +73,19 +75,89 1,5627 1,4697 1,6814Südafrika +4928,08 +5009,66 17,5896 16,5254 20,3011Tschechien +403,18 +474,47 25,4690 24,1153 27,6810USA +48,73 +49,43 1,1569 1,1048 1,2203
1) Mitgeteilt von Infront Financial Technology GmbH, LBBW; 2) Frankfurter Sortenkurse aus Sicht des Bankkunden, die Bezeichnungen Verkauf und Ankauf entsprechen demGeld und Brief bei anderen Instituten, mitgeteilt von Reisebank; 3) Freiverkehr; 4) Swaps notiert in Forward Punkten - 1 Punkt = 1/10.000, Stand ME(S)Z 17:06 Uhr.
US $ je Euro1,1549 | -0,54%52-W-.Hoch 1,2349 | Tief 1,1524
Devisen-Cross-Rates4.11.2021 Euro US $ Pfund Yen sfr kan-$ Rubel
Euro - 1,1549 0,8551 131,2438 1,0538 1,4382 82,2582US $ 0,8659 - 0,7404 113,6350 0,9126 1,2452 71,2205Pfund 1,1694 1,3505 - 153,4373 1,2320 1,6814 96,1681Yen 0,0076 0,0088 0,0065 - 0,0080 0,0110 0,6267sfr 0,9487 1,0956 0,8112 124,5026 - 1,3646 78,0508
Mitgeteilt von
HEIZÖLPREISEeid HAMBURG. Am 3.11.2021 ermittelte der EID folgende Ange-botspreise für Lieferungen von 3000 l (Premium-Qualität) freiVerwendertank in €/100 l einschl. 19% MwSt., EBV und IWO:
Heizöl (Ø 15 Städte) 89,50 | -1,01 %52-Wochen-Hoch 97,20 | Tief 44,30
2.12.2020 3.11.20212.12.2020 3.11.20221
Berlin 94,90 - 96,55Bremen 87,80 - 89,95Cottbus 86,05 - 96,15Dresden 87,75 - 91,50Düsseldorf 90,90 - 92,60Frankfurt 93,25 - 98,65Hamburg 88,30 - 95,20Hannover 87,45 - 97,30
Karlsruhe 90,15 - 94,05Kiel 86,85 - 94,10Leipzig 87,70 - 94,85Lübeck 88,50 - 95,55München 92,60 - 97,35Rostock 88,55 - 95,05Stuttgart 91,75 - 94,90
TOP-FLOP DER ROHSTOFFTITEL4.11.2021 Kurs ± % Vortag
Bauholz ($/mbf) 675,30 +4,42 WWWWWWWWWW
Silber ($/Unze) 23,97 +3,16 WWWWWWW
Kakao ($/t) 2 477,0 +2,06 WWWWW
Schlachtschweine (Cents/lb) 77,45 +1,97 WWWW
Brentöl ($/Barrel) 82,82 +1,77 WWWW
Erdgas (Cents/mmBtu) 5,54 WWWWW -2,26Sojaöl (cents/lb) 59,73 WWWWW -2,13Aluminium, hochgrädig ($/t) 2 644,0 WWWWW -2,04Zinn ($/t) 37 960,0 WWWW -1,91Kohle ($/t) 148,00 WWWW -1,66
DEUTSCHE EDELMETALLE4.11.2021 3.11.
Silber 638,75 - 704,99 639,29 - 705,59Silber verarb. 737,78 738,41Platin Barren 31,27 31,14Platin verarb. 32,43 32,30Palladium Barren 60,06 59,39Palladium verarb. 62,35 61,66Gold 48,51 - 52,28 48,73 - 52,52Gold verarb. 54,75 55,01Silber Euro / kg; Platin, Palladium und Gold, Euro / g.Die Preise gelten nur für industrielle Abnehmer (ohne MwSt.)Quelle: Heraeus
DEUTSCHE METALLPREISEKassa Basis London (€/100 kg) 4.11.2021 3.11.
Aluminium, hochgrädig 228,5 - 228,6 233,6 - 233,6Aluminium, Legierung 216,6 - 217,5 216,3 - 217,2Blei 208,6 - 208,6 208,9 - 209,1Kupfer (A) 846,2 - 846,2 848,1 - 848,2Kobalt 4 990,9 - 5 034,2 4 812,2 - 4 855,4Nickel 1 692,5 - 1 694,2 1 707,1 - 1 707,5Zink, spezial-hochgrädig 288,9 - 289,0 290,8 - 291,0Zinn 3 303,6 - 3 312,3 3 314,9 - 3 323,5
GSCI 2 857,84 | +0,09 %52-W.-Hoch 2 949,16 | Tief 1 703,22
1.12.2020 4.11.20211.12.2020 4.11.20221
Rohstoffe Schalterkurse Edelmetalle
Goldbarren und -münzen in Euro Ankauf Verkauf Rendite in % 52-Wochen(Mehrwertsteuerfrei) 4.11.2021 4.11. 4.11.2020 Hoch Tief
Gold (kg) 49 400,00 51 175,00 WWWWWWWWWW - 7,84 53 150,50 45 820,00500 g Goldbarren 24 700,00 25 749,00 WWWWWWWWWW - 8,07 26 618,00 23 000,00100 g Goldbarren 4 940,00 5 179,00 WWWWWWWWWWW - 8,57 5 334,75 4 611,251 oz Goldbarren 1 536,50 1 619,30 WWWWWWWWWWWW - 9,03 1 665,60 1 440,5010 g Goldbarren 494,00 535,00 WWWWWWWWWWWWWWW - 11,31 541,75 469,251 oz Krügerrand 1 544,00 1 636,00 WWWWWWW - 10,39 1 682,00 1 455,001/2 oz Krügerrand 772,00 857,10 WWWWWWWWW - 13,85 858,05 744,501/4 oz Krügerrand 386,00 449,90 WWWWWWWWWWWW - 17,61 439,35 381,051/10 oz Krügerrand 154,00 189,90 WWWWWWWWWWWWWWW - 22,14 180,95 157,801 oz Maple Leaf 1 544,00 1 631,00 WWWWWWW - 9,65 1 674,75 1 448,251 Österreichischer Dukat 171,90 189,00 WWWW - 5,81 181,25 161,254 Österreichische Dukaten 687,60 732,00 WWWWWWWW - 11,16 746,75 640,7520 Österreichische Kronen 294,30 311,50 WWWWWWW - 10,55 318,50 276,65100 Österreichische Kronen 1 475,00 1 558,00 WWWWWW - 8,21 1 585,50 1 390,0020 Francs Leopold 282,00 312,00 WWWWWWWWW - 13,36 313,00 271,5020 Francs Marianne 289,60 307,70 WWWWWWWWWW - 15,25 322,00 269,801 D-Mark BRD Goldmark 601,70 814,10 WWWWWWWWWWWWWW - 20,93 712,15 632,9520 Mark Wilhelm I 358,00 431,00 WWWWWWWWWWWWWW - 21,66 419,50 361,7520 Mark Wilhelm II 358,00 413,90 WWWWWWWWWWWWWW - 20,71 416,15 351,8550 Mex. Pesos 1 787,50 1 893,60 WWWWWWWW - 11,21 1 981,00 1 795,452 Rand 357,30 389,00 WWWWWW - 8,38 381,45 341,501 Sovereign 365,50 382,90 WWWW - 5,63 382,45 338,2020 Franken Vreneli 289,90 320,50 WWWWWWWWWW - 15,60 322,25 282,50
Die Quelle der An- und Verkaufspreise (gültig für sehr gut erhaltene Stücke) ist die Degussa Goldhandel GmbH. Die Rendite entspricht dem Preis,den die Quelle dem Anleger bei einem Goldverkauf bezahlt, abzüglich der Anschaffungskosten, die ihm beim Kauf vor einem Jahr entstanden sind.
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Geldanlage
44
Name Whrg. ISIN Ausg. Rückn. Perf. 3J. in %Donnerstag, den 4.11.2021
INVESTMENTFONDS1)
Nachhaltigkeits-Fonds (ESG)
www.abrdn.com
Asian Sust Develop US LU2153591404 13,02Climate Trans Bond EU LU2332245534 9,90EM Markets Sust Dev US LU2153592121 11,67Gb Climate&Environm EU LU2337310135 11,05Gb Equity Impact EU LU1697922752 16,22 + 68,60
Mu Ass Climate Opp* EU LU2350869215 10,33 10,33
Telefon: +49 69 130 203 85www.swisscanto.de
LU Bd Re Gb AbR AAH* EU LU0957586737 81,67 + 6,61LU Bd Re GbCo ATH* EU LU0494188096 151,20 + 13,37LU BdReGbShTHY AAH* EU LU0830970272 77,31 + 4,62LU BdReSecHY AAH* EU LU1057798958 86,59 + 3,10LU Eq Su Gb Wa ATE* EU LU0302976872 302,99 + 77,89
LU Pf Resp Sel AA* EU LU0112799290 129,14 + 15,09PF Resp Amb (€) AA* EU LU0161533970 169,26 + 27,73PF Sust Bal (€) AA* EU LU0208341965 149,68 + 35,82
UNION INVESTMENTPrivatFonds: Nachh* EU LU1900195949 57,90 57,90UniNachh AkEu A* EU LU0090707612 70,91 68,18 + 51,22UniNachh AkEu netA* EU LU0096427496 57,26 57,26 + 49,86UniNachhaltig A Gl* EU DE000A0M80G4 161,94 154,23 + 59,66UniRak Na.Kon. A* EU LU1572731245 124,91 122,46 + 23,53
UniRak Nach.K-net-* EU LU1572731591 122,17 122,17 + 22,24UniRak Nachh.A net* EU LU0718558728 100,10 100,10 + 39,35UniRak NachhaltigA* EU LU0718558488 106,17 103,08 + 40,81
www.abrdn.com
Asia Pacific Equ T US LU0011963245 112,31 + 48,90China A Sh Eq A Acc US LU1146622755 23,01 + 83,26Em Mkts Corp Bd A US LU0566480116 15,95 + 17,36Em Mkts Eq A Acc US LU0132412106 91,59 + 41,90Europ Sm Comp A Acc* EU LU0306632414 49,22 49,22 + 80,24
European Eq A Acc EU LU0094541447 81,15 + 55,48Front Mkts Bd A Dis US LU0963865083 9,66 + 24,48Multi Asset Grth T EU LU1402171232 12,53 + 11,66
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLCAd Inv.M.plc SF 15* EU IE00BP41KY74 10,50
ALTE LEIPZIGER€uro Short Term EU DE0008471699 43,40 42,97 + 0,48Aktien Deutschland EU DE0008471608 144,31 137,44 + 25,28AL Trust €uro Relax EU DE0008471798 57,57 55,89 + 12,22AL Trust Stab. EU DE000A0H0PF4 72,00 69,90 + 19,04AL Trust Wachst IT EU DE000A2PWPE6 69,71 69,71
AL Trust Wachstum EU DE000A0H0PG2 93,64 90,04 + 30,11Trust €uRen IT EU DE000A2PWPA4 51,04 51,04Trust €uro Renten EU DE0008471616 47,84 46,45 + 6,00Trust Akt Europa EU DE0008471764 61,81 58,87 + 29,42Trust Chance EU DE000A0H0PH0 107,59 102,47 + 40,81
Trust Chance IT EU DE000A2PWPC0 80,32 80,32Trust Glb Inv IT EU DE000A2PWPB2 85,53 85,53Trust Glbl Invest EU DE0008471715 137,56 131,01 + 55,72Trust Stab IT EU DE000A2PWPD8 60,70 60,70
www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A* EU DE0008471038 169,03 160,98 + 38,64Biotechnologie A* EU DE0008481862 244,85 233,19 + 54,78Concentra A* EU DE0008475005 163,45 155,67 + 41,50Europazins A* EU DE0008476037 56,97 55,31 + 9,19Flexi Rentenf. A* EU DE0008471921 100,33 96,94 + 11,53
Fondak A* EU DE0008471012 242,09 230,56 + 37,34Global Eq.Divid A* EU DE0008471467 148,88 141,79 + 37,33Industria A* EU DE0008475021 151,21 144,01 + 51,28Interglobal A* EU DE0008475070 521,04 496,23 + 64,23Kapital Plus A* EU DE0008476250 76,58 74,35 + 22,46
Mobil-Fonds A* EU DE0008471913 49,97 48,99 + 1,93Nebw. Deutschl.A* EU DE0008481763 425,00 404,76 + 37,26Rentenfonds A* EU DE0008471400 89,74 87,55 + 7,77Rohstofffonds A* EU DE0008475096 83,50 79,52 + 31,92Strategief.Stab.A2* EU DE0009797621 56,91 55,25 + 6,06
Thesaurus AT* EU DE0008475013 1305,37 1243,21 + 38,26Verm. Deutschl. A* EU DE0008475062 224,54 213,85 + 27,59Wachstum Eurol A* EU DE0009789842 185,84 176,99 + 60,83Wachstum Europa A* EU DE0008481821 209,07 199,11 + 76,29
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, LUX. BRANCHBest Sty Eur Eq AT EU LU1019963369 176,09 167,70 + 29,30Best Sty US Eq AT EU LU0933100637 341,27 325,02 + 60,49
Dyn Mu Ass Str15 A EU LU1089088071 121,80 118,25 + 14,47
Dyn Mu Ass Str50 A EU LU1019989323 168,57 162,09 + 29,81
Dyn Mu Ass Str75 I EU LU1089088402 1972,11 1972,11 + 51,81
Enh ShTerm Euro AT EU LU0293294277 106,82 106,82 – 1,09
Euro Bond A EU LU0165915215 12,65 12,28 + 8,97
Europe SmCap Eq A EU LU0293315023 309,78 295,03 + 44,79
European Eq Div AT EU LU0414045822 301,44 287,09 + 4,35
Fl Rate NoPl-VZi A EU LU1100107371 96,59 96,59 – 0,82
Glb Agricult Tr. A* EU LU0342688198 164,47 156,64 + 3,24
Glb ArtIntellig AT EU LU1548497772 319,73 304,50 + 150,02
Glb Mu-Ass Cre-AH2 EU LU1480268660 95,93 93,14 + 2,31
Glb SmCap Eq AT US LU0963586101 21,40 20,38 + 56,02
Income & Gro A USD* US LU0964807845 14,97 14,39 + 53,14
Income Gr A-H2-EUR* EU LU0766462104 146,19 140,57 + 43,92
www.ampega.de
Amp Global Renten EU DE0008481086 17,78 17,14 + 5,94
Amp Rendite Renten EU DE0008481052 22,24 21,59 + 5,36
Amp Reserve Renten EU DE0008481144 50,56 50,06 + 0,56
terrAss Akt I AMI EU DE0009847343 48,77 46,67 + 66,56
Zan.Eu.Cor.B.AMI I* EU DE000A0Q8HQ0 124,86 124,86 + 10,16
Zan.Gl.Cred AMI Ia* EU DE000A1J3AJ9 111,74 111,74 + 16,78
Zantke Eu.HY AMI Ia* EU DE000A0YAX49 123,90 123,90 + 7,30
Akrobat-Europa A EU LU0138526776 397,59 378,66 + 56,59Akrobat-Europa B EU LU1221107615 188,39 179,42 + 44,43Ganador Cor.Alph.A* EU LU0294838924 93,77 92,84 – 4,43
BNP Paribas Funds
Aqua* EU LU1165135440 209,18 + 76,26Eq Euro Inc Def C* EU LU1049885806 78,67 – 30,38Euro Eq.* EU LU0823401574 689,65 + 39,99Europe SCap* EU LU0212178916 288,89 + 32,13FlexIUSMortClassic* US LU1080341065 1791,42 + 7,83
Gl Environment* EU LU0347711466 309,96 + 68,31Russia Eq.* EU LU0823431720 192,52 + 49,66SMaRT Food* EU LU1165137149 141,46 + 38,86Strat.Stab.SRI Eur* EU LU0087047089 438,95 438,95 + 5,18US SCap* US LU0823410997 388,93 + 64,06
BNP Paribas Real EstateBNP Pa MacStone P EU DE000A2DP6Y8 27,15 25,86INTER ImmoProfil EU DE0009820068 61,68 58,74 + 11,98
PB Balanced EU DE0008006263 61,66 58,72 + 8,93PB Europa* EU DE0009770289 59,66 56,82 + 29,61PB Eurorent EU DE0008006255 57,25 55,58 + 4,01PB Megatrend EU DE0005317374 216,58 206,27 + 89,30PB Triselect EU DE0009770370 51,81 49,34 + 13,72
COMMERZ REALhausInvest EU DE0009807016 45,07 42,92 + 6,53
DAVIS FUNDS SICAVGlobal A* US LU0067889476 53,50 50,42 + 40,91Value Fund A* US LU0067888072 80,08 75,48 + 49,57
Telefon +49 69 7147-652 www.deka.de
Aktfds RheinEdit I* EU DE000DK2J7N4 136,68 133,35 + 38,40Aktfds RheinEdit oA* EU DE0009771907 54,20 54,20 + 34,13Aktfds RheinEdit P* EU DE0008480674 68,23 64,82 + 37,15AriDeka CF* EU DE0008474511 89,52 85,05 + 35,85BasisStrat Flex CF* EU DE000DK2EAR4 127,83 123,21 + 24,86
BasisStrat Re.TF A* EU LU1084635462 96,26 96,26 + 1,13Berol.Ca.Chance* EU LU0096429435 68,79 66,79 + 26,22BerolinaRent Deka* EU DE0008480799 42,37 40,89 + 8,31BW Zielfonds 2025* EU DE000DK0ECP8 46,51 45,60 + 10,18BW Zielfonds 2030* EU DE000DK0ECQ6 58,57 57,42 + 26,76
Deka-Deut.Bal. CF* EU DE000DK2CFB1 115,86 112,49 + 6,99Deka-Deut.Bal. TF* EU DE000DK2CFC9 110,64 110,64 + 5,89Deka-Eurol.Bal. CF* EU DE0005896872 60,98 59,20 + 8,29Deka-Eurol.Bal. TF* EU DE000DK1CHH6 117,57 117,57 + 7,17Deka-Europa Akt Str* EU DE0008479247 90,99 86,66 + 46,39
DekaFonds CF* EU DE0008474503 136,64 129,81 + 27,51DekaFonds TF* EU DE000DK2D7T7 318,32 318,32 + 24,78Deka-Global Bal CF* EU DE000DK2J8N2 112,06 108,80 + 13,53Deka-Global Bal TF* EU DE000DK2J8P7 107,00 107,00 + 12,33Deka-MegaTrends CF* EU DE0005152706 134,01 129,17 + 74,37
Deka-Na.Div Str CF* EU DE000DK0V521 132,68 127,88Deka-Nach Div RhEd* EU DE000DK0EF98 116,07 111,87 + 29,08Deka-Nachh ManSel* EU DE000DK1CJS9 123,70 119,23 + 19,37
1822 Str.Wachstum* EU LU0151487302 53,63 52,07 + 0,08
1822-Struk. Ertrag* EU LU0224663640 42,22 41,39 – 4,43
BasisStr.Renten CF* EU LU0107368036 104,05 103,02 + 1,58
Berol.Ca.Premium* EU LU0096429609 91,62 88,52 + 44,44
Berol.Ca.Sicherh.* EU LU0096428973 44,62 43,53 + 4,30
Berol.Ca.Wachst.* EU LU0096429351 42,17 41,04 + 2,50
DekaEuAktSpezAV* EU LU1508335152 147,34 147,34 + 37,50
DekaEuAktSpezCF(A)* EU LU0835598458 215,43 207,64 + 37,14
Deka-EuropaVal.TF* EU LU0100186849 58,74 58,74 + 31,61
Deka-FlexZins CF* EU LU0249486092 968,83 964,01 + 0,69
Deka-FlexZins TF* EU LU0268059614 965,70 965,70 + 0,60
DekaGlobAktLRCF(A)* EU LU0851806900 225,55 217,40 + 32,46
Deka-Indust 4.0 CF* EU LU1508359509 222,15 214,12 + 70,13
Deka-Indust 4.0 TF* EU LU1508360002 206,84 206,84 + 66,50
Deka-Mul Asset Ert* EU LU1508354294 98,56 97,58 + 0,35
Deka-Nach.E.St CF A* EU LU2206794112 101,61 101,61
Deka-NachhAkt CF* EU LU0703710904 272,52 262,67 + 59,65
Deka-NachhRent CF A* EU LU0703711035 137,21 133,86 + 10,84
HMI Chance* EU LU0194947726 80,34 78,00 + 36,40
HMI Chance+* EU LU0213544652 82,01 79,24 + 44,89
HMI Ertrag+* EU LU0194942768 38,31 37,56 – 0,93
HMI Wachstum* EU LU0194946595 44,72 43,63 – 0,14
Köln Str.Chance* EU LU0101437480 71,47 70,07 + 24,68
Köln Str.Ertrag* EU LU0101436672 45,77 44,87 + 2,29
Köln Str.Wachstum* EU LU0101437217 44,37 43,50 + 2,38
KölnStr.Chance+* EU LU0117172097 65,36 64,08 + 39,18
UnterStrat Eu CF* EU LU1876154029 220,94 212,95
Wandelanleihen CF* EU LU0158528447 85,85 83,35 + 18,02
DEKA IMMOBILIEN INVESTMENTDeka Immob Europa* EU DE0009809566 49,89 47,40 + 8,93
Deka Immob Global* EU DE0007483612 57,74 54,85 + 4,96
Deka-Immo Nordam* US DE000DK0LLA6 56,78 54,73 + 6,48
Deka-ImmoMetropol* EU DE000DK0TWX8 53,95 51,25
WestInv. InterSel.* EU DE0009801423 49,78 47,29 + 7,61
DEKA-VERMÖGENSMANAGEMENT GMBHDBA ausgewogen* EU DE000DK2CFR7 128,04 123,12 + 6,17
DBA dynamisch* EU DE000A2DJVV1 115,37 110,93
DBA konservativ* EU DE000DK2CFP1 106,86 104,76 + 1,90
DBA moderat* EU DE000DK2CFQ9 117,57 114,15 + 6,58
DBA offensiv* EU DE000DK2CFT3 240,52 229,07 + 41,62
DBA Zlstr offensiv* EU DE000A2DJVW9 125,24 122,78
Deka-BaAZSt off 23* EU DE000A2N44K6 107,08 104,98
Deka-MM ausgew CF* EU DE000DK2J8Q5 122,26 118,41 + 17,34
Deka-MM defensiv CF* EU DE000DK2J8R3 121,54 118,00 + 18,02
Deka-PB Wert 4y* EU DE000DK0EC42 106,69 104,09 – 1,86
Deka-PfSel ausgew* EU DE000A2N44B5 116,68 113,28
Deka-PfSel dynam* EU DE000A2N44D1 125,98 122,31
Deka-PfSel moderat* EU DE000A2N44C3 106,96 104,86
DekaStruk.5Chance* EU DE000DK1CJP5 199,60 195,69 + 28,98
DekaStruk.5Chance+* EU DE000DK1CJQ3 328,26 321,82 + 42,98
DekaStruk.5Ertrag* EU DE000DK1CJL4 97,62 95,71 – 2,80
DekaStruk.5Ertrag+* EU DE000DK1CJM2 102,64 100,63 + 1,39
DekaStruk.5Wachst.* EU DE000DK1CJN0 107,79 105,68 + 1,15
Hamb Stiftung D* EU DE000DK0LJ38 1031,28 1011,06 + 10,00
Hamb Stiftung I* EU DE000A0YCK34 947,74 929,16 + 9,92
Hamb Stiftung P* EU DE000A0YCK42 95,27 91,61 + 8,85
Hamb Stiftung T* EU DE000A0YCK26 120,16 115,54 + 8,85
Haspa TrendKonz P* EU LU0382196771 96,90 93,17 + 2,17
Haspa TrendKonz V* EU LU1709333386 102,91 98,95 + 3,40
LBBW Bal. CR 20* EU LU0097711666 48,36 47,41 + 15,31
LBBW Bal. CR 40* EU LU0097712045 56,40 55,29 + 22,63
LBBW Bal. CR 75* EU LU0097712474 73,28 71,84 + 37,82
Naspa Str.Chan.Pl.* EU LU0202181771 136,09 133,42 + 40,32
Naspa Str.Chance* EU LU0104457105 64,42 63,16 + 26,83
Naspa Str.Ertrag* EU LU0104455588 48,42 47,47 + 2,96
Naspa Str.Wachstum* EU LU0104456800 47,21 46,28 + 2,83
Priv BaPrem Chance* EU DE0005320022 166,89 157,44 + 39,06
Priv BaPrem Ertrag* EU DE0005320030 52,77 50,74 + 3,05
DWS
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: EU DE000A0NDW81 42,72 40,69 + 8,80
grundb. europa RC EU DE0009807008 42,50 40,48 + 7,16
grundb. Fok Deu RC EU DE0009807081 56,09 53,42 + 8,22
grundb. Fokus D IC: EU DE0009807099 56,43 53,74 + 12,23
grundb. global IC: EU DE000A0NCT95 55,29 52,66 + 9,14
grundb. global RC EU DE0009807057 54,92 52,30 + 7,67
www.ethenea.com Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A EU LU0136412771 143,86 139,67 + 14,02
Ethna-AKTIV T EU LU0431139764 151,29 146,88 + 14,04
Ethna-DEFENSIV A EU LU0279509904 139,22 135,82 + 10,82
Ethna-DEFENSIV T EU LU0279509144 176,92 172,60 + 10,81
Ethna-DYNAMISCH A EU LU0455734433 98,08 93,41 + 22,24
Ethna-DYNAMISCH T EU LU0455735596 102,21 97,34 + 22,24
FIRST PRIVATE INVEST. MANAG. KAG MBHFP Aktien Global A* EU DE000A0KFRT0 136,15 129,67 + 28,24
FP Europa Akt.ULM* EU DE0009795831 106,37 101,30 + 26,82
FP Wealth B* EU DE000A0KFTH1 77,56 75,30 + 6,79
www.flossbachvonstorch.de Tel. +49 221 33 88 290
MuAsset-Balanced R EU LU0323578145 181,16 172,53 + 17,40
MuAsset-DefensiveR EU LU0323577923 144,63 140,42 + 11,13
MuAsset-Growth R EU LU0323578491 212,21 202,10 + 23,41
Multiple Opp II R EU LU0952573482 176,98 168,55 + 28,71
Deka-NachStrInv CF* EU DE000DK2EAD4 144,91 139,67 + 22,84Deka-NachStrInv TF* EU DE000DK2EAE2 135,67 135,67 + 20,21
Deka-Sachwer. CF* EU DE000DK0EC83 110,09 106,88 + 12,38Deka-Sachwer. TF* EU DE000DK0EC91 104,60 104,60 + 11,21DekaSe:Konservativ* EU DE000DK1CJR1 92,75 91,83 – 0,85DekaSpezial CF* EU DE0008474669 555,48 535,40 + 54,20DekaTresor* EU DE0008474750 88,65 86,49 + 4,13
Div.Strateg.CF A* EU DE000DK2CDS0 191,30 184,39 + 31,63DivStrategieEur CF* EU DE000DK2J6T3 109,06 105,12 + 32,11Euro Potential CF* EU DE0009786277 230,75 222,41 + 70,32EuropaBond CF* EU DE000DK091G0 122,64 119,07 + 10,46EuropaBond TF* EU DE0009771980 43,56 43,56 + 9,54
Frankf.Sparinrent* EU DE0008479981 54,59 54,05 + 7,79Frankf.Sparinvest* EU DE0008480732 176,58 168,17 + 28,98GlobalChampions CF* EU DE000DK0ECU8 298,53 287,74 + 63,31GlobalChampions TF* EU DE000DK0ECV6 262,19 262,19 + 59,82Mainfr. Strategiekonz.* EU DE000DK2CE40 188,53 188,53 + 21,77
Mainfr. Wertkonz. ausg.* EU DE000DK1CHU9 101,26 101,26 + 1,24Multi Asset In.CFA* EU DE000DK2J662 95,47 92,69 + 11,76Multirent-Invest* EU DE0008479213 34,03 33,04 + 3,65Multizins-INVEST* EU DE0009786061 29,21 28,36 + 3,02Nachh Dynamisch CF* EU DE000DK0V6U7 110,20 104,95
Nachh Mlt Asset CF* EU DE000DK0V5F0 113,69 110,38Nachh Mlt Asset TF* EU DE000DK0V5G8 109,57 109,57Nachhltg Gl Champ CF* EU DE000DK0V554 133,25 128,43Naspa-Ak.Gb NachCF* EU DE0009771956 85,76 83,06 + 31,60Naspa-Ak.Gb NachTF* EU DE000DK0LNH7 122,42 122,42
Naspa-Fonds* EU DE0008480807 43,36 42,30 + 12,32RenditDeka* EU DE0008474537 26,21 25,45 + 11,46RenditDeka TF* EU DE000DK2D640 32,92 32,92 + 10,96RentenStratGl TF* EU DE000DK2J6Q9 92,48 92,48 + 6,49RentenStratGlob CF* EU DE000DK2J6P1 95,76 92,97 + 7,72
RentenStratGlob PB* EU DE000DK2J6R7 94,82 92,96 + 7,86RheinEdition Glob.* EU DE0009786129 39,89 39,89 + 12,61Rntfds RheinEdit* EU DE0008480666 31,38 30,28 + 8,06Rntfds RheinEdit oA* EU DE0009771915 31,15 31,15 + 7,37Technologie CF* EU DE0005152623 74,23 71,55 + 103,02
Technologie TF* EU DE0005152631 57,45 57,45 + 97,43UmweltInvest CF* EU DE000DK0ECS2 257,45 248,14 + 105,24UmweltInvest TF* EU DE000DK0ECT0 223,54 223,54 + 100,84Weltzins-Invest P* EU DE000A1CXYM9 22,62 21,96 + 7,50
DEKA INTERN.(LUX)(DEKA-GRUPPE)1822 Str.Cha.Pl.* EU LU0151488458 153,32 147,42 + 37,371822 Str.Chance* EU LU0151488029 99,41 96,05 + 26,741822 Str.Ert.Pl.* EU LU0151486320 47,83 46,66 + 0,16
IN DEUTSCHLAND ZUGELASSENE QUALITÄTSFONDS
www.franklintempleton.de [email protected] Telefon 0800 / 073 80 02
FRK Biot.Disc. A a* US LU0109394709 44,24 41,92 + 36,81FRK E.SM C.Gr. A a* EU LU0138075311 41,84 39,64 + 4,67FRK Eu.Corp.Bd A d* EU LU0496369892 11,63 11,28 + 7,11FRK Eu.Gov.Bd A d* EU LU0093669546 11,98 11,62 + 10,14FRK Eu.Hi.Yi. A d* EU LU0109395268 5,97 5,79 + 7,97
FRK Gl.Fd.Stra.A d* EU LU0343523998 12,06 11,43 + 11,18FRK Gl.Re.Est. A d* EU LU0523922176 15,53 14,71 + 28,21FRK Income A d* US LU0098860793 12,11 11,47 + 22,47FRK India Fd. A d* EU LU0260862304 91,81 86,99 + 66,41FRK Japan A a* EU LU0231790675 8,69 8,23 + 16,24
FRK Mut.Europ. A a* EU LU0229938955 23,12 21,91 + 13,77FRK Mut.Gl.Disc.Aa* EU LU0294219513 16,99 16,10 + 20,54FRK Nat.Res. A a* EU LU0300741732 5,72 5,42 – 4,75FRK Strat.Inc. A a* EU LU0300742896 15,21 14,75 + 10,90FRK Technology A a* EU LU0260870158 45,54 43,15 + 164,59
FRK US Opp A d* EU LU0260861751 31,24 29,60 + 105,13FRK World Per. A a* EU LU0390134954 43,83 41,53 + 59,02FRK World Per. A a* US LU0390134368 37,29 35,33 + 61,65TEM Asian Bond A d* EU LU0260863377 8,34 8,09 – 3,67TEM Asian SmCp.A a* EU LU0390135415 78,72 74,59 + 40,29
TEM BRIC A a* US LU0229945570 24,65 23,36 + 37,14TEM China A a* US LU0052750758 38,51 36,49 + 32,69TEM East.EuropeA a* EU LU0078277505 36,09 34,20 + 62,24TEM Em.Mkts A a* US LU0128522744 54,68 51,81 + 38,20TEM Em.Mkts Bd A d* EU LU0496364158 4,03 3,91 – 17,30
TEM Em.Mkts.SmC.Aa* EU LU0300743431 19,87 18,83 + 37,05TEM Europ Opport A* EU LU0122612848 15,60 14,78 – 3,34TEM Front.Mkts.A a* US LU0390136736 24,07 22,81 + 33,67TEM Gl.Bd. A d* EU LU0300745303 12,19 11,82 – 10,53TEM Gl.Hi.Yi A d* EU LU0300744165 5,97 5,79 + 4,54
TEM Gl.Tot.Ret A d* EU LU0300745725 9,02 8,75 – 14,01TEM Gl.Tot.Ret AYd* EU LU0517465034 5,68 5,51 – 17,41TEM Gr.(Eur) Aa* EU LU0114760746 20,39 19,32 + 12,33TEM Gr.(Eur) Ad* EU LU0188152069 20,14 19,08 + 12,34TEM Lat.Amer. A d* EU LU0260865158 41,32 39,15 – 15,26
GUTMANN KAPITALANLAGEPRIME Val Growth T EU AT0000803689 163,54 155,75 + 19,49Prime Values Inc T EU AT0000973029 145,23 141,00 + 8,95
www.hauck-aufhaeuser.com
ERBA Invest OP EU LU0327349527 31,31 29,82 + 5,92H&A Dynamik Plus B EU LU0090344473 128,58 122,46 + 37,44H&A Glb Bond Opp B EU LU0328784664 120,17 117,81 + 8,63H&A Rend. Pl. CI EU LU0456037844 123,15 118,99 + 11,19H&A SmCap.Eq EMU B EU LU0100177426 195,79 186,47 + 59,77
MB Fd Max Value EU LU0121803570 170,45 162,33 + 8,54MB Fund Flex Plus EU LU0230369240 63,86 63,23 + 6,23MB Fund Max Global EU LU0230368945 117,93 112,31 + 38,85MB Fund Max Pl EU DE000A2N68L3 42,37 42,37MB Fund S Plus EU LU0354946856 97,70 93,05 – 25,86
Telefon: +49 89 287238-0www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A EU LU0365982395 827,51 788,10 + 12,86Sachwertaktien A EU LU0459025101 205,33 195,55 + 1,84
www.hwb-fonds.com | [email protected] +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R* EU LU0322055855 89,62 85,35 + 26,96HWB Alex.Str.Ptf V* EU LU0322055426 89,65 85,38 + 26,96HWB DfdsV.V.Vici R* EU LU0322916437 68,27 66,28 + 32,38HWB DfdsV.V.Vici V* EU LU0322915462 68,27 66,28 + 32,39HWB Europe Pf.* EU LU0119626884 5,27 5,02 + 22,60
HWB Glb.Conv.Plus* EU LU0219189544 100,47 97,54 + 9,46HWB Inter.Pf.* EU LU0119626454 5,40 5,14 + 27,36HWB Pf. Plus R* EU LU0277940762 116,82 111,26 + 44,61HWB Pf. Plus V* EU LU0173899633 116,80 111,24 + 44,61HWB Vict.Str.Pf. R* EU LU0277941570 1472,53 1402,41 + 31,89
HWB Vict.Str.Pf. V* EU LU0141062942 1473,18 1403,03 + 31,89HWB Wdelan + R* EU LU0277940929 54,37 52,79 + 10,23HWB Wdelan + V* EU LU0254656522 54,92 53,32 + 11,34
IFM INDEPENDENT FD. MANAGAMENT AGACATIS FV Akt.Gl.* EU LI0017502381 327,46 311,86 + 50,21
INKA INTERN. KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTHiYld Spez INKA* EU DE000A0F4ZC4 10931 10410 + 13,79StSk. Dü. Abs. Ret.* EU DE000A0D8QM5 115,80 110,29 – 0,32VM Vermögensver.* EU DE000A2P37F5 56,60 56,60
Die Fonds-Designerwww.ipconcept.com
ME Fonds PERGAMONF EU LU0179077945 991,14 943,94 + 42,42
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Geldanlage
45
ME Fonds Special V EU LU0150613833 3757,27 3578,35 + 38,63Stuttg. Aktienfd. EU LU0383026803 139,13 132,50 + 48,03Stuttg. Divid.fd. EU LU0506868503 108,18 103,03 + 33,41Stuttg. Energiefd. EU LU0434032149 41,23 39,27 + 11,28
KANAM GRUND KAPITALANLAGEGES.MBHLeading Cities EU DE0006791825 111,60 105,78 + 9,02
LILUXLiLux Convert* EU LU0069514817 265,20 257,48 + 21,26LiLux-Rent* EU LU0083353978 243,12 236,04 + 15,68
LLB INVEST KAPITALANLAGEGES.MBHConstantia ZZ1 EU AT0000989090 176,50 160,30 + 21,08ZZ TREND EU AT0000617675 177,50 161,30 + 25,54
LRI INVEST S.A.NW Global Strategy* EU LU0303177777 115,80 110,29 + 55,56
Telefon (0251) 702 49 www.lvm.de
Euro-Kurzläufer* EU IE0000641252 28,99 28,90 + 0,73Europa-Aktien* EU IE0000663926 31,32 29,75 + 36,08Euro-Renten* EU IE0000663256 38,08 36,94 + 4,83Inter-Aktien* EU IE0000664338 45,20 42,94 + 77,03Inter-Renten* EU IE0000663470 34,63 33,59 + 3,89
ProBasis* EU IE00B13XV652 32,59 31,45 + 12,38ProFutur* EU IE0000663694 37,28 35,98 + 28,89
Telefon +49 69 78808 [email protected] www.mainfirst.com
AbsRet Multi Ass A* EU LU0864714000 156,52 149,07 + 18,75EmMkts CorpB Bal A2* EU LU0816909369 138,74 132,13 + 9,89Germany Fund A* EU LU0390221256 298,56 284,34 + 37,29Global Equities A* EU LU0864709349 429,71 409,25 + 91,79Top Europ. Ideas A* EU LU0308864023 145,68 138,74 + 44,92
Telefon 089/[email protected] www.meag.com
Dividende A* EU DE000A1W18W8 62,50 59,52 + 25,34EM Rent Nachh.* EU DE000A1144X4 51,00 49,04 + 8,44ERGO Vermög Ausgew* EU DE000A2ARYT8 61,50 58,85 + 21,24ERGO Vermög Flexi* EU DE000A2ARYP6 63,65 60,62 + 27,34ERGO Vermög Robust* EU DE000A2ARYR2 55,71 53,57 + 12,75
EuroBalance* EU DE0009757450 66,05 63,51 + 23,70EuroCorpRent A* EU DE000A1W1825 58,18 56,21 + 6,39EuroErtrag* EU DE0009782730 73,80 71,30 + 13,07EuroFlex* EU DE0009757484 43,23 42,80 + 0,70EuroInvest A* EU DE0009754333 105,97 100,92 + 31,94
EuroKapital* EU DE0009757468 57,73 54,98 + 31,30EuroRent A* EU DE0009757443 31,96 30,88 + 5,38FairReturn A* EU DE000A0RFJ25 58,46 56,76 + 5,86GlobalBalance DF* EU DE0009782763 77,07 74,11 + 28,49GlobalChance DF* EU DE0009782789 80,84 76,99 + 40,15
Nachhaltigkeit A* EU DE0001619997 145,53 138,60 + 49,05ProInvest* EU DE0009754119 225,75 215,00 + 32,79VermAnlage Komfort* EU DE000A1JJJP7 64,74 62,55 + 7,29VermAnlage Ret A* EU DE000A1JJJR3 78,09 75,09 + 19,46
MERIDIO FUNDSGreen Balance P EU LU0117185156 173,76 165,49 + 50,38
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBHRWS-Aktienfonds* EU DE0009763300 108,50 103,33 + 28,35RWS-DYNAMIK A* EU DE0009763334 38,94 37,09 + 27,25RWS-ERTRAG A* EU DE0009763375 16,41 15,93 + 9,72
MONEGA KAPITALANLAGEGES.MBHFO Core plus* EU DE000A2JN5A6 128,86 128,86 + 28,73Greiff Syst All I* EU DE000A2JN5B4 110,35 110,35Greiff Syst All R* EU DE000A2JN5C2 112,09 108,83Monega Glob Bond I* EU DE000A1143J5 105,30 105,30 + 8,99SALytic Strategy* EU DE000A2DL4D1 58,22 58,22 + 26,15
NOMURA ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLANDAsia Pacific* EU DE0008484072 192,33 183,17 + 43,52Asian Bonds* EU DE0008484429 68,78 66,78 + 13,62Real Protect* EU DE0008484452 100,77 98,79 + 5,15Real Protect R* EU DE000A1XDW13 97,78 95,86 + 3,99Real Return* EU DE0008484361 628,50 616,18 + 14,04
am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€* EU DE000A141W00 150,98 143,79 + 53,98Basis-Fonds I* EU DE0008478090 138,13 138,13 – 0,11DC Value One I(t)* EU DE000A0YAX64 244,16 244,16 + 50,82DC Value One P(t)* EU DE000A0YAX72 227,23 216,41 + 48,22EURO ShTm Bd FT DR* EU DE000A2JJ1R5 100,46 99,47 + 1,49
FMM-Fonds EU DE0008478116 648,43 617,55 + 25,23FT EuroGovernm. M* EU DE000A0NEBR5 53,57 52,01 – 0,61
O.BHF € ShTe Bd FT* EU DE0008478124 116,12 114,97 + 1,52
O.BHF AlgoGlob CRW* EU DE0009772988 97,94 93,28 + 53,65
O.BHF MoneyMark G* EU DE000A1CUGJ8 4924,72 4924,72 – 1,46
Substanz-Fonds* EU DE000A0NEBQ7 1367,63 1327,80 + 28,96
Vermögens-Fonds* EU DE000A0MYEJ6 889,95 864,03 + 23,17
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX.
BHF Flex. Ind. FT EU LU0325203320 90,28 87,65 + 35,41
BHF Rendite P.FT EU LU0319572904 57,89 56,20 + 13,22
Grand Cru EU LU0399641637 201,18 199,19 + 24,28
Grand Cru (CHF) CH LU0580157419 145,23 143,79 + 23,80
O.BHF POLARIS BAL EU LU0319574272 90,48 87,84 + 25,51
O.BHF POLARIS DY EU LU0319577374 114,68 111,34 + 58,96
SMS Ars selecta EU LU0118271369 60,17 57,86 + 30,06
Growing Mkts 2.0 EU LU0800346016 294,97 280,92 + 94,38
Klima EU LU0301152442 141,56 134,82 + 104,81
Öko Rock‘n‘Roll EU LU0380798750 204,86 195,10 + 43,66
ÖkoVision Classic EU LU0061928585 281,95 268,52 + 56,71
Water For Life C EU LU0332822492 259,98 247,60 + 58,52
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
Gl.Em.Mkts Bd € A* EU IE00B04NLM33 21,31
Global HY Bond USD* US IE0030624831 31,88 + 24,79
International Bd $* US IE0007440070 28,79
International Bd €* EU IE0031865870 17,19
QUINT:ESSENCE CAPITAL S.A.
Strategy Defensive* EU LU0063042062 133,84 131,22 + 10,18
Strategy Dynamic* EU LU0063042229 289,38 280,95 + 47,05
Telefon +49 69 271355 0www.santanderassetmanagement.de
LatAm Corp Bd I* US LU0363170191 2115,41 2115,41 + 18,65
Telefon: 0800 1685555 www.sauren.de
Sauren Abs Return A EU LU0454070557 12,03 11,68 + 6,76
Sauren Gl Bal A EU LU0106280836 22,79 21,70 + 22,31
Sauren Gl Def A EU LU0163675910 17,17 16,67 + 8,66
Sauren Gl Growth A EU LU0095335757 54,97 52,35 + 56,83
Sauren Gl Opport A EU LU0106280919 47,28 45,03 + 51,02
Sauren Gl Stab Gr A EU LU0136335097 35,81 34,10 + 35,69
SECURITY KAPITALANLAGE AGSUP1-Ethik Rent A* EU AT0000855606 72,89 71,11 + 5,08
SUP1-Ethik Rent T* EU AT0000A07HR9 92,66 90,40 + 5,09
SUP1-Ethik Rent T4* EU AT0000A20CS1 1075,60 1049,37 + 6,49
SUP2–Ethik Mix A* EU AT0000855614 87,32 83,96 + 21,98
SUP2–Ethik Mix T* EU AT0000A07HS7 121,23 116,57 + 21,97
SUP3-Ethik A* EU AT0000904909 854,73 833,88 + 12,75
SUP3-Ethik T* EU AT0000A07HT5 1142,13 1114,27 + 12,75
SUP3-Ethik T4* EU AT0000A20CT9 1169,45 1140,93 + 15,29
SUP4-Ethik Akt A* EU AT0000993043 126,53 121,66 + 46,84
SUP4-Ethik Akt T* EU AT0000A07HU3 142,30 136,83 + 46,84
SUP4-Ethik Akt T4* EU AT0000A20CV5 1644,06 1580,83 + 52,88
SUP5-Ethik Kurz A* EU AT0000A01UQ7 102,19 101,68 + 3,54
SUP5-Ethik Kurz T* EU AT0000A01UR5 121,45 120,85 + 3,54
SUP5-Ethik Kurz T4* EU AT0000A20CW3 1033,29 1028,15 + 4,16
SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBHConstantia ZZ1 EU AT0000989090 176,50 160,30 + 21,08
ZZ TREND EU AT0000617675 177,50 161,30 + 25,54
EurSus CorBd Ind I* EU LU0579408831 13,82 13,82 + 7,20EurSus CorBdIn A2€* EU LU1259993019 10,69 10,69 + 7,52Flex Ass A. Plus B* EU LU1112178238 13,13 13,13 + 24,33Flex Ass A. Plus I* EU LU1112178154 12,63 12,63 + 22,30Flex Ass A. Plus P* EU LU1112178071 12,20 12,20 + 20,15
G Ag Bd Ind I CHFh* CH LU0956450976 10,93 10,93 + 6,82Gl Agg Bd Ind I* US LU0438093188 11,66 11,66 + 13,78Gl Agg Bd Ind I $h* US LU0956450620 12,72 12,72 + 14,15Gl Agg Bd Ind I £h* GB LU0956450893 11,90 11,90 + 10,98Gl Agg Bd Ind I €h* EU LU0956450547 11,38 11,38 + 8,12
Gl Def Equity B $* US LU1255422120 15,76 + 24,91Gl Def Equity I $* US LU1255422393 16,04 16,04 + 30,07Gl EM Ind Equity B* US LU1159236170 18,55 + 36,36Gl EM Ind Equity I* US LU1159235958 18,21 18,21 + 35,14Gl EM Ind Equity P* US LU1159236097 17,21 17,21 + 31,35
Gl Enh Eq I $ Cap* US LU1159225991 20,11 20,11 + 59,56Gl Enh Eq I $ Dis* US LU1162507138 18,29 18,29 + 58,79Gl Ma Vol Equ. A $* US LU1111599558 15,73 15,73 + 25,66Gl Ma Vol Equ. B* US LU0773065528 23,89 + 27,51Gl Ma Vol Equ. I €* EU LU1111597263 17,63 17,63 + 23,95
Gl Ma Vol Equ. P* US LU0450104905 19,04 19,04 + 23,93Gl Tr Bd I $h Cap* US LU0522796233 13,90 13,90 + 11,40Gl Tr Bd I $h Dis* US LU0956451271 11,88 11,88 + 10,99Gl Tr Bd I £h* GB LU0956451438 10,83 10,83 + 8,77Gl Tr Bd I €h* EU LU0956451354 11,52 11,52 + 5,58
Gl Val Spot I $* EU LU0759082885 19,85 19,85 + 20,66Gl Val Spot P $* EU LU0759083180 19,09 19,09 + 17,82Gl.Tr. Bd Ind.Fd I* US LU0438093345 12,15 12,15 + 10,54Gl.Trea.Bond Fnd.P* US LU0438093428 11,95 11,95 + 10,02Global Val Spot B* EU LU0759082612 24,13 + 23,41
GlobalAdvFd EMHV* EU LU0047906267 2504,63 2385,36 + 25,23GlobalAdvFd MMHV* EU LU0044747169 3832,84 3650,32 + 26,28Jap Ind Eq B JPY* JP LU1159239869 15,98 + 37,26Jap Ind Eq I EUR* EU LU1159240016 16,15 16,15 + 32,39Jap Ind Eq I JPY* JP LU1159239604 15,76 15,76 + 36,31
Jap Ind Eq P JPY* JP LU1159239786 15,39 15,39 + 34,69Multi-Factor Eq I* US LU1110725071 17,60 17,60 + 41,01NorthAm Enh Eq I $* US LU1112177776 23,16 23,16 + 72,36
UniDeutschl. XS* EU DE0009750497 253,24 243,50 + 48,13UniDeutschland* EU DE0009750117 269,12 258,77 + 37,07UniEuroAktien* EU DE0009757740 96,01 91,44 + 42,42UniEuropa-net-* EU DE0009750232 100,57 100,57 + 61,54UniEuroRenta* EU DE0008491069 67,34 65,38 + 1,70
UniEuroRentaHigh Y* EU DE0009757831 37,57 36,48 + 11,53UniFav.:Akt. -net-* EU DE0008007519 133,22 133,22 + 51,51Unifavorit: Aktien* EU DE0008477076 221,79 211,23 + 53,10UniFonds* EU DE0008491002 72,37 68,92 + 43,95UniFonds-net-* EU DE0009750208 101,21 101,21 + 39,07
UniGlobal* EU DE0008491051 369,31 351,72 + 69,85UniGlobal-net-* EU DE0009750273 211,15 211,15 + 67,24UniKapital* EU DE0008491085 109,67 107,52 – 1,47UniKapital-net-* EU DE0009750174 38,77 38,77 – 2,43UniKlassikMix* EU DE0009757682 107,66 104,52 + 39,74
UniNordamerika* EU DE0009750075 524,67 499,69 + 72,41UnionGeldmarktfds* EU DE0009750133 47,59 47,59 – 1,45UniRak* EU DE0008491044 157,99 153,39 + 35,01UniRak Kons.-net-A* EU DE000A1C81D8 128,99 128,99 + 18,70UniRak Konserva A* EU DE000A1C81C0 133,73 131,11 + 19,97
UniRak -net-* EU DE0005314462 82,56 82,56 + 33,60UniRenta* EU DE0008491028 20,10 19,51 + 9,05UniSel. Global I* EU DE0005326789 119,23 115,76 + 58,69UniStrat: Ausgew.* EU DE0005314116 76,82 74,58 + 25,24UniStrat: Dynam.* EU DE0005314124 69,39 67,37 + 35,39
UniStrat: Konserv.* EU DE0005314108 77,96 75,69 + 13,65UniStrat:Offensiv* EU DE0005314447 71,21 69,14 + 43,40
UNION INVESTMENT (LUXEMBURG)PrivFd:Konseq.pro* EU LU0493584741 106,80 106,80 – 4,39Uni.Eur. M&S.Caps* EU LU0090772608 76,27 73,34 + 47,46UniAbsoluterEnet-A* EU LU1206679554 45,51 45,51 – 0,71UniAbsoluterErt. A* EU LU1206678580 46,36 45,45 + 0,14UniAsia* EU LU0037079034 100,41 95,63 + 41,23
UniAsia Pac.net* EU LU0100938306 166,89 166,89 + 36,25UniAsia Pacific A* EU LU0100937670 170,06 163,52 + 37,68UniAusschü. net- A* EU LU1390462262 52,69 52,69 + 18,74UniAusschüttung A* EU LU1390462189 53,51 51,95 + 19,80
STATE STREETLuxembourg FundsAsia Pac Val S B* US LU1159225132 17,10 + 32,91Asia Pac Val S I* US LU1159224911 16,29 16,29 + 29,96Aust Ind Equity I* AU LU1159240107 17,97 17,97 + 36,12Aust Ind Equity P* AU LU1159240289 17,54 17,54 + 34,49Can Ind Equity I* CA LU1159237574 17,92 17,92 + 47,16
Can Ind Equity P* CA LU1159237657 17,49 17,49 + 45,40EC Treas Bd Ind IC* EU LU0570151364 13,60 13,60 + 5,02EC Treas Bd Ind ID* EU LU0773064802 11,45 11,45 + 5,02EC Treas Bd Ind P* EU LU0570151448 12,33 12,33 + 4,53EM Asia Equity P* EU LU1112180481 12,90 12,90 + 23,46
EM Asia Equity P $* US LU1112180309 13,34 13,34 + 25,69EM Sel Eq P USD* US LU1112177008 11,59 11,59 + 19,27EM Sel Eq Prem P* EU LU0379089245 12,09 12,09 + 17,20EM SRI Enh Eq I* US LU0810595867 15,85 15,85 + 30,89EM Vol Equity I €* EU LU0456116804 27,93 27,93 + 28,96
Em.Mark. Sel Eq* EU LU0379088940 14,08 14,08 + 20,87EMU Equity I* EU LU0379090334 36,42 36,42 + 46,13EMU Equity P Cap* EU LU0379090680 14,13 14,13 + 41,64EMU Equity P Dis* EU LU1112183824 13,77 13,77 + 41,65EMU Gov Bnd Ind B* EU LU0773065015 13,71 + 10,27
EMU Gov Bnd Ind I* EU LU0438092966 14,03 14,03 + 9,77EMU Gov Bnd Ind PC* EU LU0438093006 14,88 14,88 + 9,20EMU Gov Bnd Ind PD* EU LU0963596084 11,67 11,67 + 9,22EMU Gov LoBd Ind I* EU LU0956453301 17,59 17,59 + 25,88EMU Ind Equity B* EU LU1159238119 17,05 + 41,86
EMU Ind Equity I* EU LU1159237905 16,84 16,84 + 41,01EMU Ind Equity P* EU LU1159238036 16,42 16,42 + 39,17Enh EM Equity B* US LU0773064398 18,91 + 35,47ENH. EM EQ I EUR* EU LU0579408591 17,12 17,12 + 31,20ENH. EM EQ I USD* US LU0446997610 18,01 18,01 + 33,50
ENH. EM EQ P USD* US LU0446997701 17,26 17,26 + 31,42Eu Ma Vol P* EU LU0456116986 14,07 14,07 + 26,68Eu Su Co.Bd Ind I* EU LU0579408914 12,00 12,00 + 7,22Eu.Co.Bd.In.Fd I* EU LU0438092701 15,78 15,78 + 7,65Eu.Co.Bd.In.Fd P* EU LU0438092883 12,26 12,26 + 7,17
EuCo ex-Fin BdIndI* EU LU1112176968 10,14 10,14 + 7,90EuCo ex-Fin BdIndP* EU LU0956453996 11,93 11,93 + 7,42EuCoex-Fin BdIndI€* EU LU0956453640 12,05 12,05 + 7,91EuIs Sc CorBd In I* EU LU0704618890 11,76 11,76 + 5,91EuIsScCorBdInICHFh* CH LU0956151988 9,94 9,94 – 3,66
Eur Corp Bd Ind B* EU LU0773064711 13,73 + 8,14EurCorTrea Bd IndB* EU LU0773064984 12,56 + 5,50EurInfl LiBd Ind I* EU LU0956454291 12,73 12,73 + 14,90Europe Enh Equity I* EU LU1112179558 15,65 15,65 + 37,44Europe Enh Equity P* EU LU1112179475 13,64 13,64 + 36,42
Europe Ind Equ B* EU LU1159236683 15,27 + 32,24Europe Ind Equ I* EU LU1159236337 15,99 15,99 + 39,33Europe Ind Equ P* EU LU1159236501 15,59 15,59 + 37,58Europe Sm Equity P* EU LU1112178824 15,41 15,41 + 46,69Europe Value Sp. B* EU LU0892046151 16,70 + 22,51
Europe Value Sp. I* EU LU0892045930 11,61 11,61 + 19,76Europe Value Sp. P* EU LU0892045856 14,66 14,66 + 17,00Eurozone Val Sp. B* EU LU0892046409 19,78 + 34,01Eurozone Val Sp. I* EU LU0892046318 16,69 16,69 + 31,04Eurozone Val Sp. P* EU LU0892046235 16,85 16,85 + 27,90
UniCommodities* EU LU0249045476 59,34 56,51 + 36,06
UniDividAss net A* EU LU0186860663 58,56 58,56 + 27,35UniDividendenAss A* EU LU0186860408 61,63 59,26 + 28,70UniDyn.Europa A* EU LU0085167236 149,62 143,87 + 65,89UniDynamic Gl. A* EU LU0089558679 115,94 111,48 + 92,66UniEMGlobal* EU LU0115904467 108,75 103,57 + 25,83
UniEuRe Corp A* EU LU0117072461 54,74 53,15 + 9,01UniEurKap Corp-A* EU LU0168092178 37,61 36,87 + 2,44UniEurKap.Co.net A* EU LU0168093226 37,44 37,44 + 1,53UniEuroAnleihen* EU LU0966118209 58,18 56,49 + 7,94UniEuroKapital* EU LU0046307343 64,78 63,51 + 0,06
UniEuroKapital-net* EU LU0089559057 40,65 40,65 – 0,88UniEuropa* EU LU0047060487 3181,20 3029,71 + 61,91UniEuropaRenta* EU LU0003562807 51,05 49,56 + 10,50UniFavorit: Renten* EU LU0006041197 25,09 24,60 + 7,81UniGlobal II A* EU LU0718610743 159,25 151,67 + 68,43
UniIndustrie 4.0A* EU LU1772413420 84,81 81,55 + 75,61UniOpti4* EU LU0262776809 96,95 96,95 – 1,10UniRak Em. Mkts* EU LU0383775318 187,35 180,14 + 19,25UniRenta Osteuropa* EU LU0097169550 39,63 38,48 + 7,36UniRes: Euro Corp.* EU LU0247467987 42,15 42,15 + 3,79
UniReserve: Euro A* EU LU0055734320 493,86 493,86 – 0,62UniSec. BioPha.* EU LU0101441086 170,11 163,57 + 45,94UniSec. High Tech.* EU LU0101441672 204,47 196,61 + 106,18UniStruktur* EU LU1529950914 113,08 109,79 + 12,36UniVa. Global A* EU LU0126315885 143,73 138,20 + 41,19
UniVa.Glb-net-A* EU LU0126316180 136,86 136,86 + 40,25
UNION INVESTMENT REAL ESTATEUniImmo:Dt.* EU DE0009805507 97,97 93,30 + 7,63UniImmo:Europa* EU DE0009805515 57,44 54,70 + 5,89UniImmo:Global* EU DE0009805556 51,46 49,01 + 1,28
UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A.CondorBalance-UI* EU LU0112268841 108,24 103,09 + 31,07CondorChance-UI* EU LU0112269146 106,73 101,65 + 57,40CondorTrends-UI* EU LU0112269492 122,18 116,36 + 68,11
www.walserprivatbank.com Telefon +43 5517 202-01
Wal. Pf Akt USA US LU0121930688 361,33 344,12 + 41,58Wal. Pf Akt.Europa EU LU0121929912 133,12 126,78 + 31,26Wal. Pf EmMkt Sel EU LU0572807518 117,12 111,54 + 8,48Wal. Pf German Sel EU LU0181454132 254,78 242,65 + 18,70Wal. Weltpf 10 EU LU0327378385 145,35 142,50 + 9,09
Wal. Weltpf 25 EU LU0327378468 153,62 149,15 + 13,07Wal. Weltpf 45 EU LU0327378542 160,56 155,88 + 16,63Wal. Weltpf 65 EU LU0327378625 161,03 153,36 + 19,80
WARBURG INVESTDMüller Prem Akt € EU DE000A111ZF1 94,47 90,84 – 9,51
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLINSouthEast Asian Eq* EU IE0002096034 135,42 + 27,17
Exchange Traded Funds (ETF)
Produktname Währung ISIN NAV2)
Telefon: 069/29 807 0etf.invesco.com
Invesco AT1 Capital Bd GBP* GB IE00BYZLWM19 41,91Invesco AT1 Capital Bd USD* US IE00BG0TQB18 22,15Invesco Dynamic US Mrkt* US IE00B23D9240 19,49Invesco EQQQ Nasdaq-100* EU IE0032077012 147,50Invesco EQQQQ Na 100 ETF* US IE00BFZXGZ54 271,32
Invesco EuroMTS Cash 3M* EU IE00B3BPCH51 99,65Invesco FTSE RAFI EM* US IE00B23D9570 9,49Invesco FTSE RAFI Eu MS* EU IE00B23D8Y98 16,83Invesco FTSE RAFI Europe* EU IE00B23D8X81 10,60Invesco FTSE RAFI US 1000* EU IE00B23D8S39 15,90
Invesco IMII AT1 CapBd €Hd* EU IE00BFZPF439 20,72Invesco IMII AT1 CapBd Acc* US IE00BFZPF322 26,24Invesco Inv VarRate Pref A* US IE00BHJYDT11 50,35Invesco Invesco Pref Sh Ac* US IE00BG482169 50,86Invesco InvMSCIEurLeadCath* EU IE00BG0NY640 55,27
Invesco Pref Sh UCITS ETF* US IE00BDVJF675 20,24Invesco USD Float Rate ETF* US IE00BDRTCQ08 19,74Invesco Var Ra Pref Sh ETF* US IE00BG21M733 42,48
tägliche Anteilspreisveröffentlichungen – mitgeteilt von Infront Financial Technology GmbH
* Fondspreise/ETF-Preise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar1) Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)2) NAV: Nettoinventarwert
Währungen: AU=Australischer Dollar, CH=Schweizer Franken,CA=Canadischer Dollar, DK=Dänische Krone, EU=Euro, GB =Brit.Pfund, JP=Japanische Yen, NO=Norwegische Krone, PL=PolnischeZloty, SE=Schwedische Krone, SG=Singapur-Dollar, US=US-Dollar
Bei der ausschüttenden Tranche ist die Währung gefettet.
Weitere Fonds-Infos unter:http://handelsblatt.com/boerse/fondsFondsinformationen für Profis im IPThttps://www.infrontfinance.com/products/infront-professional-terminal/
Alle Angaben ohne Gewähr; keine Anlageberatung oder -empfehlung
Name Whrg. ISIN Ausg. Rückn. Perf. 3J. in % Pac ex jap Ind I $* US LU1161082836 17,68 17,68 + 32,68Pac ex jap Ind P $* US LU1161083644 17,25 17,25 + 31,09
PacexJap Ind Eq B$* US LU1161085342 17,90 + 33,47SSgA Glb ManVolEqI* US LU0450104814 28,28 28,28 + 26,14Swi Ind Eq I CHF* CH LU1159239190 16,97 16,97 + 44,72Swi Ind Eq P CHF* CH LU1159239273 16,56 16,56 + 42,98Swi Ind Eq P EUR* EU LU1159239513 17,11 17,11 + 54,14
UK Ind Eq I EUR* EU LU1159238978 12,55 12,55 + 15,31UK Ind Eq I GBP* GB LU1159238465 14,45 14,45 + 11,77UK Ind Eq P GBP* GB LU1159238549 14,10 14,10 + 10,43UK Index Eq B GBP* GB LU1159238622 11,54 – 10,71US Corp Bd Ind I* US LU0956452675 14,02 14,02 + 26,39
US I S C In I €h* EU LU0868465948 12,31 12,31 + 15,49US I S C In I CHFh* CH LU0956151715 11,04 11,04 + 7,00US Ind Eq B USD* US LU1159237061 26,61 + 80,36US Ind Eq I EUR* EU LU1159237228 25,35 25,35 + 76,16US Ind Eq I EUR h* EU LU1159237491 23,29 23,29 + 68,60
US Ind Eq I USD* US LU1159236840 26,28 26,28 + 79,28US Ind Eq P USD* US LU1159236923 25,65 25,65 + 77,14US Val Spot B USD* US LU1159224242 17,57 + 40,54US Val Spot USD* US LU1159224085 16,75 16,75 + 37,41Wld Ind Eq B USD* US LU1159234985 22,64 + 65,74
Wld Ind Eq I EUR* EU LU1159235107 21,57 21,57 + 61,87Wld Ind Eq I USD* US LU1159234712 22,36 22,36 + 64,75Wld Ind Eq P EUR h* EU LU1159235289 19,94 19,94 + 54,93Wld Ind Eq P USD* US LU1159234803 21,80 21,80 + 62,70Wld SRI Ind Eq B $* US LU1159235529 24,10 + 70,80
Wld SRI Ind Eq I $* US LU1159235362 22,68 22,68 + 69,35
Tel: +49 89 599 890 314 Fax: +49 89 599 890 [email protected] www.thomas-lloyd.com
Sus Infrstr Inc R€* EU LU1439435931 938,59 938,59Sust Infra R CZK A* CZ LU1108670180 998,69 998,69Sust Infrastruc IA* EU LU1108653095 784,14 784,14Sust Infrastruc IRD* US LU1859505734 1009,75 1009,75Sust Infrastruct I* US LU1108670347 1242,51 1242,51
Telefon 069 58998-6060www.union-investment.de
Priv.Fonds:Flex.* EU DE000A0Q2H14 94,02 94,02 – 8,11Priv.Fonds:FlexPro* EU DE000A0RPAL7 149,85 149,85 + 17,28PrivFd:Kontr.* EU DE000A0RPAM5 138,31 138,31 + 10,98PrivFd:Kontr.pro* EU DE000A0RPAN3 179,70 179,70 + 27,00Uni21.Jahrh.-net-* EU DE0009757872 47,35 47,35 + 54,82
DIE BESTEN IMMOBILIENFONDS IM VERGLEICHPREIS PERFORMANCE IN %
TITEL ISIN 4.11.’21 1 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. LFD. KOSTEN %
Catella MAX DE000A0YFRV7 21,11 EUR + 0,96 + 9,45 + 12,31 + 29,55 + 82,65 WWWWWWW0,97Catella European R DE000A0M98N2 15,93 EUR + 0,63 + 4,86 + 10,09 + 27,29 + 54,08 WWWWWWWWWWWWW1,69BNPP REIM INTER ImmoProfil DE0009820068 58,74 EUR + 0,12 + 2,39 + 3,58 + 11,98 + 14,30 WWWWWWWWWW1,34Catella Nachh Immo DE000A2DHR68 11,08 EUR + 0,36 + 2,37 + 3,11 + 10,27 - WWWWWWWWWWW1,49Catella Bavaria DE000A2AS909 10,55 EUR + 0,19 + 2,23 + 2,82 + 9,08 - WWWWWWWW1,06KanAM Spz Leading Cities DE0006791825 105,78 EUR + 0,14 + 1,35 + 2,65 + 9,02 + 15,99 WWWWWWWW1,06Deka Immo b Europa* DE0009809566 47,40 EUR + 0,21 + 1,15 + 2,39 + 8,93 + 16,49 WWWWWWW0,90Catella Wohnen Eur DE000A141UZ7 10,56 EUR + 0,28 + 1,23 + 2,00 + 8,76 + 12,69 WWWWWWW0,86DWS Gb. grundb. Fok Deu RC DE0009807081 53,42 EUR + 0,11 + 0,92 + 2,01 + 8,22 + 15,62 WWWWWWWWW1,11DWS Gb. grundb. global RC DE0009807057 52,30 EUR + 0,35 + 1,38 + 2,35 + 7,67 + 12,73 WWWWWWWWW1,12UniRealEst UniImmo:Dt.* DE0009805507 93,30 EUR + 0,20 + 1,35 + 2,21 + 7,63 + 13,82 WWWWWWW0,93Deka Immo WestInv. InterSel.* DE0009801423 47,29 EUR + 0,13 + 1,24 + 2,08 + 7,61 + 13,01 WWWWWW0,78DWS Gb. grundb. europa RC DE0009807008 40,48 EUR + 0,52 + 2,27 + 2,58 + 7,16 + 13,67 WWWWWWWW1,05Commerz hausInvest DE0009807016 42,92 EUR + 0,21 + 1,27 + 1,91 + 6,53 + 11,34 WWWWWW0,84Deka Immo Deka Immo Nordam* DE000DK0LLA6 54,73 USD + 0,20 + 0,90 + 2,19 + 6,48 + 13,58 WWWWWW0,73
Alle dargestellten Investmentfonds sind Teilnehmer am Funds Service, sortiert nach 3-Jahresperformance, berechnet nach BVI Methode. Laufende Kosten % = Anteil der Verwaltungskosten eines Fonds, hoherProzentsatz = hoher Kostenanteil. Erscheinungstäglich wechselnde Kategorien: Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Misch-, Immobilien- und wertgesicherte Fonds. Keine Anlageberatung und -empfehlung.
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Geldanlage
44
Name Whrg. ISIN Ausg. Rückn. Perf. 3J. in %Donnerstag, den 4.11.2021
INVESTMENTFONDS1)
Nachhaltigkeits-Fonds (ESG)
www.abrdn.com
Asian Sust Develop US LU2153591404 13,02Climate Trans Bond EU LU2332245534 9,90EM Markets Sust Dev US LU2153592121 11,67Gb Climate&Environm EU LU2337310135 11,05Gb Equity Impact EU LU1697922752 16,22 + 68,60
Mu Ass Climate Opp* EU LU2350869215 10,33 10,33
Telefon: +49 69 130 203 85www.swisscanto.de
LU Bd Re Gb AbR AAH* EU LU0957586737 81,67 + 6,61LU Bd Re GbCo ATH* EU LU0494188096 151,20 + 13,37LU BdReGbShTHY AAH* EU LU0830970272 77,31 + 4,62LU BdReSecHY AAH* EU LU1057798958 86,59 + 3,10LU Eq Su Gb Wa ATE* EU LU0302976872 302,99 + 77,89
LU Pf Resp Sel AA* EU LU0112799290 129,14 + 15,09PF Resp Amb (€) AA* EU LU0161533970 169,26 + 27,73PF Sust Bal (€) AA* EU LU0208341965 149,68 + 35,82
UNION INVESTMENTPrivatFonds: Nachh* EU LU1900195949 57,90 57,90UniNachh AkEu A* EU LU0090707612 70,91 68,18 + 51,22UniNachh AkEu netA* EU LU0096427496 57,26 57,26 + 49,86UniNachhaltig A Gl* EU DE000A0M80G4 161,94 154,23 + 59,66UniRak Na.Kon. A* EU LU1572731245 124,91 122,46 + 23,53
UniRak Nach.K-net-* EU LU1572731591 122,17 122,17 + 22,24UniRak Nachh.A net* EU LU0718558728 100,10 100,10 + 39,35UniRak NachhaltigA* EU LU0718558488 106,17 103,08 + 40,81
www.abrdn.com
Asia Pacific Equ T US LU0011963245 112,31 + 48,90China A Sh Eq A Acc US LU1146622755 23,01 + 83,26Em Mkts Corp Bd A US LU0566480116 15,95 + 17,36Em Mkts Eq A Acc US LU0132412106 91,59 + 41,90Europ Sm Comp A Acc* EU LU0306632414 49,22 49,22 + 80,24
European Eq A Acc EU LU0094541447 81,15 + 55,48Front Mkts Bd A Dis US LU0963865083 9,66 + 24,48Multi Asset Grth T EU LU1402171232 12,53 + 11,66
ADEPT INVESTMENT MANAGEMENT PLCAd Inv.M.plc SF 15* EU IE00BP41KY74 10,50
ALTE LEIPZIGER€uro Short Term EU DE0008471699 43,40 42,97 + 0,48Aktien Deutschland EU DE0008471608 144,31 137,44 + 25,28AL Trust €uro Relax EU DE0008471798 57,57 55,89 + 12,22AL Trust Stab. EU DE000A0H0PF4 72,00 69,90 + 19,04AL Trust Wachst IT EU DE000A2PWPE6 69,71 69,71
AL Trust Wachstum EU DE000A0H0PG2 93,64 90,04 + 30,11Trust €uRen IT EU DE000A2PWPA4 51,04 51,04Trust €uro Renten EU DE0008471616 47,84 46,45 + 6,00Trust Akt Europa EU DE0008471764 61,81 58,87 + 29,42Trust Chance EU DE000A0H0PH0 107,59 102,47 + 40,81
Trust Chance IT EU DE000A2PWPC0 80,32 80,32Trust Glb Inv IT EU DE000A2PWPB2 85,53 85,53Trust Glbl Invest EU DE0008471715 137,56 131,01 + 55,72Trust Stab IT EU DE000A2PWPD8 60,70 60,70
www.allianzglobalinvestors.de
Adifonds A* EU DE0008471038 169,03 160,98 + 38,64Biotechnologie A* EU DE0008481862 244,85 233,19 + 54,78Concentra A* EU DE0008475005 163,45 155,67 + 41,50Europazins A* EU DE0008476037 56,97 55,31 + 9,19Flexi Rentenf. A* EU DE0008471921 100,33 96,94 + 11,53
Fondak A* EU DE0008471012 242,09 230,56 + 37,34Global Eq.Divid A* EU DE0008471467 148,88 141,79 + 37,33Industria A* EU DE0008475021 151,21 144,01 + 51,28Interglobal A* EU DE0008475070 521,04 496,23 + 64,23Kapital Plus A* EU DE0008476250 76,58 74,35 + 22,46
Mobil-Fonds A* EU DE0008471913 49,97 48,99 + 1,93Nebw. Deutschl.A* EU DE0008481763 425,00 404,76 + 37,26Rentenfonds A* EU DE0008471400 89,74 87,55 + 7,77Rohstofffonds A* EU DE0008475096 83,50 79,52 + 31,92Strategief.Stab.A2* EU DE0009797621 56,91 55,25 + 6,06
Thesaurus AT* EU DE0008475013 1305,37 1243,21 + 38,26Verm. Deutschl. A* EU DE0008475062 224,54 213,85 + 27,59Wachstum Eurol A* EU DE0009789842 185,84 176,99 + 60,83Wachstum Europa A* EU DE0008481821 209,07 199,11 + 76,29
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, LUX. BRANCHBest Sty Eur Eq AT EU LU1019963369 176,09 167,70 + 29,30Best Sty US Eq AT EU LU0933100637 341,27 325,02 + 60,49
Dyn Mu Ass Str15 A EU LU1089088071 121,80 118,25 + 14,47
Dyn Mu Ass Str50 A EU LU1019989323 168,57 162,09 + 29,81
Dyn Mu Ass Str75 I EU LU1089088402 1972,11 1972,11 + 51,81
Enh ShTerm Euro AT EU LU0293294277 106,82 106,82 – 1,09
Euro Bond A EU LU0165915215 12,65 12,28 + 8,97
Europe SmCap Eq A EU LU0293315023 309,78 295,03 + 44,79
European Eq Div AT EU LU0414045822 301,44 287,09 + 4,35
Fl Rate NoPl-VZi A EU LU1100107371 96,59 96,59 – 0,82
Glb Agricult Tr. A* EU LU0342688198 164,47 156,64 + 3,24
Glb ArtIntellig AT EU LU1548497772 319,73 304,50 + 150,02
Glb Mu-Ass Cre-AH2 EU LU1480268660 95,93 93,14 + 2,31
Glb SmCap Eq AT US LU0963586101 21,40 20,38 + 56,02
Income & Gro A USD* US LU0964807845 14,97 14,39 + 53,14
Income Gr A-H2-EUR* EU LU0766462104 146,19 140,57 + 43,92
www.ampega.de
Amp Global Renten EU DE0008481086 17,78 17,14 + 5,94
Amp Rendite Renten EU DE0008481052 22,24 21,59 + 5,36
Amp Reserve Renten EU DE0008481144 50,56 50,06 + 0,56
terrAss Akt I AMI EU DE0009847343 48,77 46,67 + 66,56
Zan.Eu.Cor.B.AMI I* EU DE000A0Q8HQ0 124,86 124,86 + 10,16
Zan.Gl.Cred AMI Ia* EU DE000A1J3AJ9 111,74 111,74 + 16,78
Zantke Eu.HY AMI Ia* EU DE000A0YAX49 123,90 123,90 + 7,30
Akrobat-Europa A EU LU0138526776 397,59 378,66 + 56,59Akrobat-Europa B EU LU1221107615 188,39 179,42 + 44,43Ganador Cor.Alph.A* EU LU0294838924 93,77 92,84 – 4,43
BNP Paribas Funds
Aqua* EU LU1165135440 209,18 + 76,26Eq Euro Inc Def C* EU LU1049885806 78,67 – 30,38Euro Eq.* EU LU0823401574 689,65 + 39,99Europe SCap* EU LU0212178916 288,89 + 32,13FlexIUSMortClassic* US LU1080341065 1791,42 + 7,83
Gl Environment* EU LU0347711466 309,96 + 68,31Russia Eq.* EU LU0823431720 192,52 + 49,66SMaRT Food* EU LU1165137149 141,46 + 38,86Strat.Stab.SRI Eur* EU LU0087047089 438,95 438,95 + 5,18US SCap* US LU0823410997 388,93 + 64,06
BNP Paribas Real EstateBNP Pa MacStone P EU DE000A2DP6Y8 27,15 25,86INTER ImmoProfil EU DE0009820068 61,68 58,74 + 11,98
PB Balanced EU DE0008006263 61,66 58,72 + 8,93PB Europa* EU DE0009770289 59,66 56,82 + 29,61PB Eurorent EU DE0008006255 57,25 55,58 + 4,01PB Megatrend EU DE0005317374 216,58 206,27 + 89,30PB Triselect EU DE0009770370 51,81 49,34 + 13,72
COMMERZ REALhausInvest EU DE0009807016 45,07 42,92 + 6,53
DAVIS FUNDS SICAVGlobal A* US LU0067889476 53,50 50,42 + 40,91Value Fund A* US LU0067888072 80,08 75,48 + 49,57
Telefon +49 69 7147-652 www.deka.de
Aktfds RheinEdit I* EU DE000DK2J7N4 136,68 133,35 + 38,40Aktfds RheinEdit oA* EU DE0009771907 54,20 54,20 + 34,13Aktfds RheinEdit P* EU DE0008480674 68,23 64,82 + 37,15AriDeka CF* EU DE0008474511 89,52 85,05 + 35,85BasisStrat Flex CF* EU DE000DK2EAR4 127,83 123,21 + 24,86
BasisStrat Re.TF A* EU LU1084635462 96,26 96,26 + 1,13Berol.Ca.Chance* EU LU0096429435 68,79 66,79 + 26,22BerolinaRent Deka* EU DE0008480799 42,37 40,89 + 8,31BW Zielfonds 2025* EU DE000DK0ECP8 46,51 45,60 + 10,18BW Zielfonds 2030* EU DE000DK0ECQ6 58,57 57,42 + 26,76
Deka-Deut.Bal. CF* EU DE000DK2CFB1 115,86 112,49 + 6,99Deka-Deut.Bal. TF* EU DE000DK2CFC9 110,64 110,64 + 5,89Deka-Eurol.Bal. CF* EU DE0005896872 60,98 59,20 + 8,29Deka-Eurol.Bal. TF* EU DE000DK1CHH6 117,57 117,57 + 7,17Deka-Europa Akt Str* EU DE0008479247 90,99 86,66 + 46,39
DekaFonds CF* EU DE0008474503 136,64 129,81 + 27,51DekaFonds TF* EU DE000DK2D7T7 318,32 318,32 + 24,78Deka-Global Bal CF* EU DE000DK2J8N2 112,06 108,80 + 13,53Deka-Global Bal TF* EU DE000DK2J8P7 107,00 107,00 + 12,33Deka-MegaTrends CF* EU DE0005152706 134,01 129,17 + 74,37
Deka-Na.Div Str CF* EU DE000DK0V521 132,68 127,88Deka-Nach Div RhEd* EU DE000DK0EF98 116,07 111,87 + 29,08Deka-Nachh ManSel* EU DE000DK1CJS9 123,70 119,23 + 19,37
1822 Str.Wachstum* EU LU0151487302 53,63 52,07 + 0,08
1822-Struk. Ertrag* EU LU0224663640 42,22 41,39 – 4,43
BasisStr.Renten CF* EU LU0107368036 104,05 103,02 + 1,58
Berol.Ca.Premium* EU LU0096429609 91,62 88,52 + 44,44
Berol.Ca.Sicherh.* EU LU0096428973 44,62 43,53 + 4,30
Berol.Ca.Wachst.* EU LU0096429351 42,17 41,04 + 2,50
DekaEuAktSpezAV* EU LU1508335152 147,34 147,34 + 37,50
DekaEuAktSpezCF(A)* EU LU0835598458 215,43 207,64 + 37,14
Deka-EuropaVal.TF* EU LU0100186849 58,74 58,74 + 31,61
Deka-FlexZins CF* EU LU0249486092 968,83 964,01 + 0,69
Deka-FlexZins TF* EU LU0268059614 965,70 965,70 + 0,60
DekaGlobAktLRCF(A)* EU LU0851806900 225,55 217,40 + 32,46
Deka-Indust 4.0 CF* EU LU1508359509 222,15 214,12 + 70,13
Deka-Indust 4.0 TF* EU LU1508360002 206,84 206,84 + 66,50
Deka-Mul Asset Ert* EU LU1508354294 98,56 97,58 + 0,35
Deka-Nach.E.St CF A* EU LU2206794112 101,61 101,61
Deka-NachhAkt CF* EU LU0703710904 272,52 262,67 + 59,65
Deka-NachhRent CF A* EU LU0703711035 137,21 133,86 + 10,84
HMI Chance* EU LU0194947726 80,34 78,00 + 36,40
HMI Chance+* EU LU0213544652 82,01 79,24 + 44,89
HMI Ertrag+* EU LU0194942768 38,31 37,56 – 0,93
HMI Wachstum* EU LU0194946595 44,72 43,63 – 0,14
Köln Str.Chance* EU LU0101437480 71,47 70,07 + 24,68
Köln Str.Ertrag* EU LU0101436672 45,77 44,87 + 2,29
Köln Str.Wachstum* EU LU0101437217 44,37 43,50 + 2,38
KölnStr.Chance+* EU LU0117172097 65,36 64,08 + 39,18
UnterStrat Eu CF* EU LU1876154029 220,94 212,95
Wandelanleihen CF* EU LU0158528447 85,85 83,35 + 18,02
DEKA IMMOBILIEN INVESTMENTDeka Immob Europa* EU DE0009809566 49,89 47,40 + 8,93
Deka Immob Global* EU DE0007483612 57,74 54,85 + 4,96
Deka-Immo Nordam* US DE000DK0LLA6 56,78 54,73 + 6,48
Deka-ImmoMetropol* EU DE000DK0TWX8 53,95 51,25
WestInv. InterSel.* EU DE0009801423 49,78 47,29 + 7,61
DEKA-VERMÖGENSMANAGEMENT GMBHDBA ausgewogen* EU DE000DK2CFR7 128,04 123,12 + 6,17
DBA dynamisch* EU DE000A2DJVV1 115,37 110,93
DBA konservativ* EU DE000DK2CFP1 106,86 104,76 + 1,90
DBA moderat* EU DE000DK2CFQ9 117,57 114,15 + 6,58
DBA offensiv* EU DE000DK2CFT3 240,52 229,07 + 41,62
DBA Zlstr offensiv* EU DE000A2DJVW9 125,24 122,78
Deka-BaAZSt off 23* EU DE000A2N44K6 107,08 104,98
Deka-MM ausgew CF* EU DE000DK2J8Q5 122,26 118,41 + 17,34
Deka-MM defensiv CF* EU DE000DK2J8R3 121,54 118,00 + 18,02
Deka-PB Wert 4y* EU DE000DK0EC42 106,69 104,09 – 1,86
Deka-PfSel ausgew* EU DE000A2N44B5 116,68 113,28
Deka-PfSel dynam* EU DE000A2N44D1 125,98 122,31
Deka-PfSel moderat* EU DE000A2N44C3 106,96 104,86
DekaStruk.5Chance* EU DE000DK1CJP5 199,60 195,69 + 28,98
DekaStruk.5Chance+* EU DE000DK1CJQ3 328,26 321,82 + 42,98
DekaStruk.5Ertrag* EU DE000DK1CJL4 97,62 95,71 – 2,80
DekaStruk.5Ertrag+* EU DE000DK1CJM2 102,64 100,63 + 1,39
DekaStruk.5Wachst.* EU DE000DK1CJN0 107,79 105,68 + 1,15
Hamb Stiftung D* EU DE000DK0LJ38 1031,28 1011,06 + 10,00
Hamb Stiftung I* EU DE000A0YCK34 947,74 929,16 + 9,92
Hamb Stiftung P* EU DE000A0YCK42 95,27 91,61 + 8,85
Hamb Stiftung T* EU DE000A0YCK26 120,16 115,54 + 8,85
Haspa TrendKonz P* EU LU0382196771 96,90 93,17 + 2,17
Haspa TrendKonz V* EU LU1709333386 102,91 98,95 + 3,40
LBBW Bal. CR 20* EU LU0097711666 48,36 47,41 + 15,31
LBBW Bal. CR 40* EU LU0097712045 56,40 55,29 + 22,63
LBBW Bal. CR 75* EU LU0097712474 73,28 71,84 + 37,82
Naspa Str.Chan.Pl.* EU LU0202181771 136,09 133,42 + 40,32
Naspa Str.Chance* EU LU0104457105 64,42 63,16 + 26,83
Naspa Str.Ertrag* EU LU0104455588 48,42 47,47 + 2,96
Naspa Str.Wachstum* EU LU0104456800 47,21 46,28 + 2,83
Priv BaPrem Chance* EU DE0005320022 166,89 157,44 + 39,06
Priv BaPrem Ertrag* EU DE0005320030 52,77 50,74 + 3,05
DWS
Offene Immobilienfonds
grundb. europa IC: EU DE000A0NDW81 42,72 40,69 + 8,80
grundb. europa RC EU DE0009807008 42,50 40,48 + 7,16
grundb. Fok Deu RC EU DE0009807081 56,09 53,42 + 8,22
grundb. Fokus D IC: EU DE0009807099 56,43 53,74 + 12,23
grundb. global IC: EU DE000A0NCT95 55,29 52,66 + 9,14
grundb. global RC EU DE0009807057 54,92 52,30 + 7,67
www.ethenea.com Telefon 00352-276921-10
Ethna-AKTIV A EU LU0136412771 143,86 139,67 + 14,02
Ethna-AKTIV T EU LU0431139764 151,29 146,88 + 14,04
Ethna-DEFENSIV A EU LU0279509904 139,22 135,82 + 10,82
Ethna-DEFENSIV T EU LU0279509144 176,92 172,60 + 10,81
Ethna-DYNAMISCH A EU LU0455734433 98,08 93,41 + 22,24
Ethna-DYNAMISCH T EU LU0455735596 102,21 97,34 + 22,24
FIRST PRIVATE INVEST. MANAG. KAG MBHFP Aktien Global A* EU DE000A0KFRT0 136,15 129,67 + 28,24
FP Europa Akt.ULM* EU DE0009795831 106,37 101,30 + 26,82
FP Wealth B* EU DE000A0KFTH1 77,56 75,30 + 6,79
www.flossbachvonstorch.de Tel. +49 221 33 88 290
MuAsset-Balanced R EU LU0323578145 181,16 172,53 + 17,40
MuAsset-DefensiveR EU LU0323577923 144,63 140,42 + 11,13
MuAsset-Growth R EU LU0323578491 212,21 202,10 + 23,41
Multiple Opp II R EU LU0952573482 176,98 168,55 + 28,71
Deka-NachStrInv CF* EU DE000DK2EAD4 144,91 139,67 + 22,84Deka-NachStrInv TF* EU DE000DK2EAE2 135,67 135,67 + 20,21
Deka-Sachwer. CF* EU DE000DK0EC83 110,09 106,88 + 12,38Deka-Sachwer. TF* EU DE000DK0EC91 104,60 104,60 + 11,21DekaSe:Konservativ* EU DE000DK1CJR1 92,75 91,83 – 0,85DekaSpezial CF* EU DE0008474669 555,48 535,40 + 54,20DekaTresor* EU DE0008474750 88,65 86,49 + 4,13
Div.Strateg.CF A* EU DE000DK2CDS0 191,30 184,39 + 31,63DivStrategieEur CF* EU DE000DK2J6T3 109,06 105,12 + 32,11Euro Potential CF* EU DE0009786277 230,75 222,41 + 70,32EuropaBond CF* EU DE000DK091G0 122,64 119,07 + 10,46EuropaBond TF* EU DE0009771980 43,56 43,56 + 9,54
Frankf.Sparinrent* EU DE0008479981 54,59 54,05 + 7,79Frankf.Sparinvest* EU DE0008480732 176,58 168,17 + 28,98GlobalChampions CF* EU DE000DK0ECU8 298,53 287,74 + 63,31GlobalChampions TF* EU DE000DK0ECV6 262,19 262,19 + 59,82Mainfr. Strategiekonz.* EU DE000DK2CE40 188,53 188,53 + 21,77
Mainfr. Wertkonz. ausg.* EU DE000DK1CHU9 101,26 101,26 + 1,24Multi Asset In.CFA* EU DE000DK2J662 95,47 92,69 + 11,76Multirent-Invest* EU DE0008479213 34,03 33,04 + 3,65Multizins-INVEST* EU DE0009786061 29,21 28,36 + 3,02Nachh Dynamisch CF* EU DE000DK0V6U7 110,20 104,95
Nachh Mlt Asset CF* EU DE000DK0V5F0 113,69 110,38Nachh Mlt Asset TF* EU DE000DK0V5G8 109,57 109,57Nachhltg Gl Champ CF* EU DE000DK0V554 133,25 128,43Naspa-Ak.Gb NachCF* EU DE0009771956 85,76 83,06 + 31,60Naspa-Ak.Gb NachTF* EU DE000DK0LNH7 122,42 122,42
Naspa-Fonds* EU DE0008480807 43,36 42,30 + 12,32RenditDeka* EU DE0008474537 26,21 25,45 + 11,46RenditDeka TF* EU DE000DK2D640 32,92 32,92 + 10,96RentenStratGl TF* EU DE000DK2J6Q9 92,48 92,48 + 6,49RentenStratGlob CF* EU DE000DK2J6P1 95,76 92,97 + 7,72
RentenStratGlob PB* EU DE000DK2J6R7 94,82 92,96 + 7,86RheinEdition Glob.* EU DE0009786129 39,89 39,89 + 12,61Rntfds RheinEdit* EU DE0008480666 31,38 30,28 + 8,06Rntfds RheinEdit oA* EU DE0009771915 31,15 31,15 + 7,37Technologie CF* EU DE0005152623 74,23 71,55 + 103,02
Technologie TF* EU DE0005152631 57,45 57,45 + 97,43UmweltInvest CF* EU DE000DK0ECS2 257,45 248,14 + 105,24UmweltInvest TF* EU DE000DK0ECT0 223,54 223,54 + 100,84Weltzins-Invest P* EU DE000A1CXYM9 22,62 21,96 + 7,50
DEKA INTERN.(LUX)(DEKA-GRUPPE)1822 Str.Cha.Pl.* EU LU0151488458 153,32 147,42 + 37,371822 Str.Chance* EU LU0151488029 99,41 96,05 + 26,741822 Str.Ert.Pl.* EU LU0151486320 47,83 46,66 + 0,16
IN DEUTSCHLAND ZUGELASSENE QUALITÄTSFONDS
www.franklintempleton.de [email protected] Telefon 0800 / 073 80 02
FRK Biot.Disc. A a* US LU0109394709 44,24 41,92 + 36,81FRK E.SM C.Gr. A a* EU LU0138075311 41,84 39,64 + 4,67FRK Eu.Corp.Bd A d* EU LU0496369892 11,63 11,28 + 7,11FRK Eu.Gov.Bd A d* EU LU0093669546 11,98 11,62 + 10,14FRK Eu.Hi.Yi. A d* EU LU0109395268 5,97 5,79 + 7,97
FRK Gl.Fd.Stra.A d* EU LU0343523998 12,06 11,43 + 11,18FRK Gl.Re.Est. A d* EU LU0523922176 15,53 14,71 + 28,21FRK Income A d* US LU0098860793 12,11 11,47 + 22,47FRK India Fd. A d* EU LU0260862304 91,81 86,99 + 66,41FRK Japan A a* EU LU0231790675 8,69 8,23 + 16,24
FRK Mut.Europ. A a* EU LU0229938955 23,12 21,91 + 13,77FRK Mut.Gl.Disc.Aa* EU LU0294219513 16,99 16,10 + 20,54FRK Nat.Res. A a* EU LU0300741732 5,72 5,42 – 4,75FRK Strat.Inc. A a* EU LU0300742896 15,21 14,75 + 10,90FRK Technology A a* EU LU0260870158 45,54 43,15 + 164,59
FRK US Opp A d* EU LU0260861751 31,24 29,60 + 105,13FRK World Per. A a* EU LU0390134954 43,83 41,53 + 59,02FRK World Per. A a* US LU0390134368 37,29 35,33 + 61,65TEM Asian Bond A d* EU LU0260863377 8,34 8,09 – 3,67TEM Asian SmCp.A a* EU LU0390135415 78,72 74,59 + 40,29
TEM BRIC A a* US LU0229945570 24,65 23,36 + 37,14TEM China A a* US LU0052750758 38,51 36,49 + 32,69TEM East.EuropeA a* EU LU0078277505 36,09 34,20 + 62,24TEM Em.Mkts A a* US LU0128522744 54,68 51,81 + 38,20TEM Em.Mkts Bd A d* EU LU0496364158 4,03 3,91 – 17,30
TEM Em.Mkts.SmC.Aa* EU LU0300743431 19,87 18,83 + 37,05TEM Europ Opport A* EU LU0122612848 15,60 14,78 – 3,34TEM Front.Mkts.A a* US LU0390136736 24,07 22,81 + 33,67TEM Gl.Bd. A d* EU LU0300745303 12,19 11,82 – 10,53TEM Gl.Hi.Yi A d* EU LU0300744165 5,97 5,79 + 4,54
TEM Gl.Tot.Ret A d* EU LU0300745725 9,02 8,75 – 14,01TEM Gl.Tot.Ret AYd* EU LU0517465034 5,68 5,51 – 17,41TEM Gr.(Eur) Aa* EU LU0114760746 20,39 19,32 + 12,33TEM Gr.(Eur) Ad* EU LU0188152069 20,14 19,08 + 12,34TEM Lat.Amer. A d* EU LU0260865158 41,32 39,15 – 15,26
GUTMANN KAPITALANLAGEPRIME Val Growth T EU AT0000803689 163,54 155,75 + 19,49Prime Values Inc T EU AT0000973029 145,23 141,00 + 8,95
www.hauck-aufhaeuser.com
ERBA Invest OP EU LU0327349527 31,31 29,82 + 5,92H&A Dynamik Plus B EU LU0090344473 128,58 122,46 + 37,44H&A Glb Bond Opp B EU LU0328784664 120,17 117,81 + 8,63H&A Rend. Pl. CI EU LU0456037844 123,15 118,99 + 11,19H&A SmCap.Eq EMU B EU LU0100177426 195,79 186,47 + 59,77
MB Fd Max Value EU LU0121803570 170,45 162,33 + 8,54MB Fund Flex Plus EU LU0230369240 63,86 63,23 + 6,23MB Fund Max Global EU LU0230368945 117,93 112,31 + 38,85MB Fund Max Pl EU DE000A2N68L3 42,37 42,37MB Fund S Plus EU LU0354946856 97,70 93,05 – 25,86
Telefon: +49 89 287238-0www.hellerich.de, [email protected]
Global-Flexibel A EU LU0365982395 827,51 788,10 + 12,86Sachwertaktien A EU LU0459025101 205,33 195,55 + 1,84
www.hwb-fonds.com | [email protected] +49 651 1704 301 | +352 48 30 48 30
HWB Alex.Str.Ptf R* EU LU0322055855 89,62 85,35 + 26,96HWB Alex.Str.Ptf V* EU LU0322055426 89,65 85,38 + 26,96HWB DfdsV.V.Vici R* EU LU0322916437 68,27 66,28 + 32,38HWB DfdsV.V.Vici V* EU LU0322915462 68,27 66,28 + 32,39HWB Europe Pf.* EU LU0119626884 5,27 5,02 + 22,60
HWB Glb.Conv.Plus* EU LU0219189544 100,47 97,54 + 9,46HWB Inter.Pf.* EU LU0119626454 5,40 5,14 + 27,36HWB Pf. Plus R* EU LU0277940762 116,82 111,26 + 44,61HWB Pf. Plus V* EU LU0173899633 116,80 111,24 + 44,61HWB Vict.Str.Pf. R* EU LU0277941570 1472,53 1402,41 + 31,89
HWB Vict.Str.Pf. V* EU LU0141062942 1473,18 1403,03 + 31,89HWB Wdelan + R* EU LU0277940929 54,37 52,79 + 10,23HWB Wdelan + V* EU LU0254656522 54,92 53,32 + 11,34
IFM INDEPENDENT FD. MANAGAMENT AGACATIS FV Akt.Gl.* EU LI0017502381 327,46 311,86 + 50,21
INKA INTERN. KAPITALANLAGEGESELLSCHAFTHiYld Spez INKA* EU DE000A0F4ZC4 10931 10410 + 13,79StSk. Dü. Abs. Ret.* EU DE000A0D8QM5 115,80 110,29 – 0,32VM Vermögensver.* EU DE000A2P37F5 56,60 56,60
Die Fonds-Designerwww.ipconcept.com
ME Fonds PERGAMONF EU LU0179077945 991,14 943,94 + 42,42
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Geldanlage
45
ME Fonds Special V EU LU0150613833 3757,27 3578,35 + 38,63Stuttg. Aktienfd. EU LU0383026803 139,13 132,50 + 48,03Stuttg. Divid.fd. EU LU0506868503 108,18 103,03 + 33,41Stuttg. Energiefd. EU LU0434032149 41,23 39,27 + 11,28
KANAM GRUND KAPITALANLAGEGES.MBHLeading Cities EU DE0006791825 111,60 105,78 + 9,02
LILUXLiLux Convert* EU LU0069514817 265,20 257,48 + 21,26LiLux-Rent* EU LU0083353978 243,12 236,04 + 15,68
LLB INVEST KAPITALANLAGEGES.MBHConstantia ZZ1 EU AT0000989090 176,50 160,30 + 21,08ZZ TREND EU AT0000617675 177,50 161,30 + 25,54
LRI INVEST S.A.NW Global Strategy* EU LU0303177777 115,80 110,29 + 55,56
Telefon (0251) 702 49 www.lvm.de
Euro-Kurzläufer* EU IE0000641252 28,99 28,90 + 0,73Europa-Aktien* EU IE0000663926 31,32 29,75 + 36,08Euro-Renten* EU IE0000663256 38,08 36,94 + 4,83Inter-Aktien* EU IE0000664338 45,20 42,94 + 77,03Inter-Renten* EU IE0000663470 34,63 33,59 + 3,89
ProBasis* EU IE00B13XV652 32,59 31,45 + 12,38ProFutur* EU IE0000663694 37,28 35,98 + 28,89
Telefon +49 69 78808 [email protected] www.mainfirst.com
AbsRet Multi Ass A* EU LU0864714000 156,52 149,07 + 18,75EmMkts CorpB Bal A2* EU LU0816909369 138,74 132,13 + 9,89Germany Fund A* EU LU0390221256 298,56 284,34 + 37,29Global Equities A* EU LU0864709349 429,71 409,25 + 91,79Top Europ. Ideas A* EU LU0308864023 145,68 138,74 + 44,92
Telefon 089/[email protected] www.meag.com
Dividende A* EU DE000A1W18W8 62,50 59,52 + 25,34EM Rent Nachh.* EU DE000A1144X4 51,00 49,04 + 8,44ERGO Vermög Ausgew* EU DE000A2ARYT8 61,50 58,85 + 21,24ERGO Vermög Flexi* EU DE000A2ARYP6 63,65 60,62 + 27,34ERGO Vermög Robust* EU DE000A2ARYR2 55,71 53,57 + 12,75
EuroBalance* EU DE0009757450 66,05 63,51 + 23,70EuroCorpRent A* EU DE000A1W1825 58,18 56,21 + 6,39EuroErtrag* EU DE0009782730 73,80 71,30 + 13,07EuroFlex* EU DE0009757484 43,23 42,80 + 0,70EuroInvest A* EU DE0009754333 105,97 100,92 + 31,94
EuroKapital* EU DE0009757468 57,73 54,98 + 31,30EuroRent A* EU DE0009757443 31,96 30,88 + 5,38FairReturn A* EU DE000A0RFJ25 58,46 56,76 + 5,86GlobalBalance DF* EU DE0009782763 77,07 74,11 + 28,49GlobalChance DF* EU DE0009782789 80,84 76,99 + 40,15
Nachhaltigkeit A* EU DE0001619997 145,53 138,60 + 49,05ProInvest* EU DE0009754119 225,75 215,00 + 32,79VermAnlage Komfort* EU DE000A1JJJP7 64,74 62,55 + 7,29VermAnlage Ret A* EU DE000A1JJJR3 78,09 75,09 + 19,46
MERIDIO FUNDSGreen Balance P EU LU0117185156 173,76 165,49 + 50,38
METZLER ASSET MANAGEMENT GMBHRWS-Aktienfonds* EU DE0009763300 108,50 103,33 + 28,35RWS-DYNAMIK A* EU DE0009763334 38,94 37,09 + 27,25RWS-ERTRAG A* EU DE0009763375 16,41 15,93 + 9,72
MONEGA KAPITALANLAGEGES.MBHFO Core plus* EU DE000A2JN5A6 128,86 128,86 + 28,73Greiff Syst All I* EU DE000A2JN5B4 110,35 110,35Greiff Syst All R* EU DE000A2JN5C2 112,09 108,83Monega Glob Bond I* EU DE000A1143J5 105,30 105,30 + 8,99SALytic Strategy* EU DE000A2DL4D1 58,22 58,22 + 26,15
NOMURA ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLANDAsia Pacific* EU DE0008484072 192,33 183,17 + 43,52Asian Bonds* EU DE0008484429 68,78 66,78 + 13,62Real Protect* EU DE0008484452 100,77 98,79 + 5,15Real Protect R* EU DE000A1XDW13 97,78 95,86 + 3,99Real Return* EU DE0008484361 628,50 616,18 + 14,04
am.oddo-bhf.com
Algo Global DRW-€* EU DE000A141W00 150,98 143,79 + 53,98Basis-Fonds I* EU DE0008478090 138,13 138,13 – 0,11DC Value One I(t)* EU DE000A0YAX64 244,16 244,16 + 50,82DC Value One P(t)* EU DE000A0YAX72 227,23 216,41 + 48,22EURO ShTm Bd FT DR* EU DE000A2JJ1R5 100,46 99,47 + 1,49
FMM-Fonds EU DE0008478116 648,43 617,55 + 25,23FT EuroGovernm. M* EU DE000A0NEBR5 53,57 52,01 – 0,61
O.BHF € ShTe Bd FT* EU DE0008478124 116,12 114,97 + 1,52
O.BHF AlgoGlob CRW* EU DE0009772988 97,94 93,28 + 53,65
O.BHF MoneyMark G* EU DE000A1CUGJ8 4924,72 4924,72 – 1,46
Substanz-Fonds* EU DE000A0NEBQ7 1367,63 1327,80 + 28,96
Vermögens-Fonds* EU DE000A0MYEJ6 889,95 864,03 + 23,17
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT LUX.
BHF Flex. Ind. FT EU LU0325203320 90,28 87,65 + 35,41
BHF Rendite P.FT EU LU0319572904 57,89 56,20 + 13,22
Grand Cru EU LU0399641637 201,18 199,19 + 24,28
Grand Cru (CHF) CH LU0580157419 145,23 143,79 + 23,80
O.BHF POLARIS BAL EU LU0319574272 90,48 87,84 + 25,51
O.BHF POLARIS DY EU LU0319577374 114,68 111,34 + 58,96
SMS Ars selecta EU LU0118271369 60,17 57,86 + 30,06
Growing Mkts 2.0 EU LU0800346016 294,97 280,92 + 94,38
Klima EU LU0301152442 141,56 134,82 + 104,81
Öko Rock‘n‘Roll EU LU0380798750 204,86 195,10 + 43,66
ÖkoVision Classic EU LU0061928585 281,95 268,52 + 56,71
Water For Life C EU LU0332822492 259,98 247,60 + 58,52
PAYDEN & RYGEL GLOBAL LTD.
Gl.Em.Mkts Bd € A* EU IE00B04NLM33 21,31
Global HY Bond USD* US IE0030624831 31,88 + 24,79
International Bd $* US IE0007440070 28,79
International Bd €* EU IE0031865870 17,19
QUINT:ESSENCE CAPITAL S.A.
Strategy Defensive* EU LU0063042062 133,84 131,22 + 10,18
Strategy Dynamic* EU LU0063042229 289,38 280,95 + 47,05
Telefon +49 69 271355 0www.santanderassetmanagement.de
LatAm Corp Bd I* US LU0363170191 2115,41 2115,41 + 18,65
Telefon: 0800 1685555 www.sauren.de
Sauren Abs Return A EU LU0454070557 12,03 11,68 + 6,76
Sauren Gl Bal A EU LU0106280836 22,79 21,70 + 22,31
Sauren Gl Def A EU LU0163675910 17,17 16,67 + 8,66
Sauren Gl Growth A EU LU0095335757 54,97 52,35 + 56,83
Sauren Gl Opport A EU LU0106280919 47,28 45,03 + 51,02
Sauren Gl Stab Gr A EU LU0136335097 35,81 34,10 + 35,69
SECURITY KAPITALANLAGE AGSUP1-Ethik Rent A* EU AT0000855606 72,89 71,11 + 5,08
SUP1-Ethik Rent T* EU AT0000A07HR9 92,66 90,40 + 5,09
SUP1-Ethik Rent T4* EU AT0000A20CS1 1075,60 1049,37 + 6,49
SUP2–Ethik Mix A* EU AT0000855614 87,32 83,96 + 21,98
SUP2–Ethik Mix T* EU AT0000A07HS7 121,23 116,57 + 21,97
SUP3-Ethik A* EU AT0000904909 854,73 833,88 + 12,75
SUP3-Ethik T* EU AT0000A07HT5 1142,13 1114,27 + 12,75
SUP3-Ethik T4* EU AT0000A20CT9 1169,45 1140,93 + 15,29
SUP4-Ethik Akt A* EU AT0000993043 126,53 121,66 + 46,84
SUP4-Ethik Akt T* EU AT0000A07HU3 142,30 136,83 + 46,84
SUP4-Ethik Akt T4* EU AT0000A20CV5 1644,06 1580,83 + 52,88
SUP5-Ethik Kurz A* EU AT0000A01UQ7 102,19 101,68 + 3,54
SUP5-Ethik Kurz T* EU AT0000A01UR5 121,45 120,85 + 3,54
SUP5-Ethik Kurz T4* EU AT0000A20CW3 1033,29 1028,15 + 4,16
SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBHConstantia ZZ1 EU AT0000989090 176,50 160,30 + 21,08
ZZ TREND EU AT0000617675 177,50 161,30 + 25,54
EurSus CorBd Ind I* EU LU0579408831 13,82 13,82 + 7,20EurSus CorBdIn A2€* EU LU1259993019 10,69 10,69 + 7,52Flex Ass A. Plus B* EU LU1112178238 13,13 13,13 + 24,33Flex Ass A. Plus I* EU LU1112178154 12,63 12,63 + 22,30Flex Ass A. Plus P* EU LU1112178071 12,20 12,20 + 20,15
G Ag Bd Ind I CHFh* CH LU0956450976 10,93 10,93 + 6,82Gl Agg Bd Ind I* US LU0438093188 11,66 11,66 + 13,78Gl Agg Bd Ind I $h* US LU0956450620 12,72 12,72 + 14,15Gl Agg Bd Ind I £h* GB LU0956450893 11,90 11,90 + 10,98Gl Agg Bd Ind I €h* EU LU0956450547 11,38 11,38 + 8,12
Gl Def Equity B $* US LU1255422120 15,76 + 24,91Gl Def Equity I $* US LU1255422393 16,04 16,04 + 30,07Gl EM Ind Equity B* US LU1159236170 18,55 + 36,36Gl EM Ind Equity I* US LU1159235958 18,21 18,21 + 35,14Gl EM Ind Equity P* US LU1159236097 17,21 17,21 + 31,35
Gl Enh Eq I $ Cap* US LU1159225991 20,11 20,11 + 59,56Gl Enh Eq I $ Dis* US LU1162507138 18,29 18,29 + 58,79Gl Ma Vol Equ. A $* US LU1111599558 15,73 15,73 + 25,66Gl Ma Vol Equ. B* US LU0773065528 23,89 + 27,51Gl Ma Vol Equ. I €* EU LU1111597263 17,63 17,63 + 23,95
Gl Ma Vol Equ. P* US LU0450104905 19,04 19,04 + 23,93Gl Tr Bd I $h Cap* US LU0522796233 13,90 13,90 + 11,40Gl Tr Bd I $h Dis* US LU0956451271 11,88 11,88 + 10,99Gl Tr Bd I £h* GB LU0956451438 10,83 10,83 + 8,77Gl Tr Bd I €h* EU LU0956451354 11,52 11,52 + 5,58
Gl Val Spot I $* EU LU0759082885 19,85 19,85 + 20,66Gl Val Spot P $* EU LU0759083180 19,09 19,09 + 17,82Gl.Tr. Bd Ind.Fd I* US LU0438093345 12,15 12,15 + 10,54Gl.Trea.Bond Fnd.P* US LU0438093428 11,95 11,95 + 10,02Global Val Spot B* EU LU0759082612 24,13 + 23,41
GlobalAdvFd EMHV* EU LU0047906267 2504,63 2385,36 + 25,23GlobalAdvFd MMHV* EU LU0044747169 3832,84 3650,32 + 26,28Jap Ind Eq B JPY* JP LU1159239869 15,98 + 37,26Jap Ind Eq I EUR* EU LU1159240016 16,15 16,15 + 32,39Jap Ind Eq I JPY* JP LU1159239604 15,76 15,76 + 36,31
Jap Ind Eq P JPY* JP LU1159239786 15,39 15,39 + 34,69Multi-Factor Eq I* US LU1110725071 17,60 17,60 + 41,01NorthAm Enh Eq I $* US LU1112177776 23,16 23,16 + 72,36
UniDeutschl. XS* EU DE0009750497 253,24 243,50 + 48,13UniDeutschland* EU DE0009750117 269,12 258,77 + 37,07UniEuroAktien* EU DE0009757740 96,01 91,44 + 42,42UniEuropa-net-* EU DE0009750232 100,57 100,57 + 61,54UniEuroRenta* EU DE0008491069 67,34 65,38 + 1,70
UniEuroRentaHigh Y* EU DE0009757831 37,57 36,48 + 11,53UniFav.:Akt. -net-* EU DE0008007519 133,22 133,22 + 51,51Unifavorit: Aktien* EU DE0008477076 221,79 211,23 + 53,10UniFonds* EU DE0008491002 72,37 68,92 + 43,95UniFonds-net-* EU DE0009750208 101,21 101,21 + 39,07
UniGlobal* EU DE0008491051 369,31 351,72 + 69,85UniGlobal-net-* EU DE0009750273 211,15 211,15 + 67,24UniKapital* EU DE0008491085 109,67 107,52 – 1,47UniKapital-net-* EU DE0009750174 38,77 38,77 – 2,43UniKlassikMix* EU DE0009757682 107,66 104,52 + 39,74
UniNordamerika* EU DE0009750075 524,67 499,69 + 72,41UnionGeldmarktfds* EU DE0009750133 47,59 47,59 – 1,45UniRak* EU DE0008491044 157,99 153,39 + 35,01UniRak Kons.-net-A* EU DE000A1C81D8 128,99 128,99 + 18,70UniRak Konserva A* EU DE000A1C81C0 133,73 131,11 + 19,97
UniRak -net-* EU DE0005314462 82,56 82,56 + 33,60UniRenta* EU DE0008491028 20,10 19,51 + 9,05UniSel. Global I* EU DE0005326789 119,23 115,76 + 58,69UniStrat: Ausgew.* EU DE0005314116 76,82 74,58 + 25,24UniStrat: Dynam.* EU DE0005314124 69,39 67,37 + 35,39
UniStrat: Konserv.* EU DE0005314108 77,96 75,69 + 13,65UniStrat:Offensiv* EU DE0005314447 71,21 69,14 + 43,40
UNION INVESTMENT (LUXEMBURG)PrivFd:Konseq.pro* EU LU0493584741 106,80 106,80 – 4,39Uni.Eur. M&S.Caps* EU LU0090772608 76,27 73,34 + 47,46UniAbsoluterEnet-A* EU LU1206679554 45,51 45,51 – 0,71UniAbsoluterErt. A* EU LU1206678580 46,36 45,45 + 0,14UniAsia* EU LU0037079034 100,41 95,63 + 41,23
UniAsia Pac.net* EU LU0100938306 166,89 166,89 + 36,25UniAsia Pacific A* EU LU0100937670 170,06 163,52 + 37,68UniAusschü. net- A* EU LU1390462262 52,69 52,69 + 18,74UniAusschüttung A* EU LU1390462189 53,51 51,95 + 19,80
STATE STREETLuxembourg FundsAsia Pac Val S B* US LU1159225132 17,10 + 32,91Asia Pac Val S I* US LU1159224911 16,29 16,29 + 29,96Aust Ind Equity I* AU LU1159240107 17,97 17,97 + 36,12Aust Ind Equity P* AU LU1159240289 17,54 17,54 + 34,49Can Ind Equity I* CA LU1159237574 17,92 17,92 + 47,16
Can Ind Equity P* CA LU1159237657 17,49 17,49 + 45,40EC Treas Bd Ind IC* EU LU0570151364 13,60 13,60 + 5,02EC Treas Bd Ind ID* EU LU0773064802 11,45 11,45 + 5,02EC Treas Bd Ind P* EU LU0570151448 12,33 12,33 + 4,53EM Asia Equity P* EU LU1112180481 12,90 12,90 + 23,46
EM Asia Equity P $* US LU1112180309 13,34 13,34 + 25,69EM Sel Eq P USD* US LU1112177008 11,59 11,59 + 19,27EM Sel Eq Prem P* EU LU0379089245 12,09 12,09 + 17,20EM SRI Enh Eq I* US LU0810595867 15,85 15,85 + 30,89EM Vol Equity I €* EU LU0456116804 27,93 27,93 + 28,96
Em.Mark. Sel Eq* EU LU0379088940 14,08 14,08 + 20,87EMU Equity I* EU LU0379090334 36,42 36,42 + 46,13EMU Equity P Cap* EU LU0379090680 14,13 14,13 + 41,64EMU Equity P Dis* EU LU1112183824 13,77 13,77 + 41,65EMU Gov Bnd Ind B* EU LU0773065015 13,71 + 10,27
EMU Gov Bnd Ind I* EU LU0438092966 14,03 14,03 + 9,77EMU Gov Bnd Ind PC* EU LU0438093006 14,88 14,88 + 9,20EMU Gov Bnd Ind PD* EU LU0963596084 11,67 11,67 + 9,22EMU Gov LoBd Ind I* EU LU0956453301 17,59 17,59 + 25,88EMU Ind Equity B* EU LU1159238119 17,05 + 41,86
EMU Ind Equity I* EU LU1159237905 16,84 16,84 + 41,01EMU Ind Equity P* EU LU1159238036 16,42 16,42 + 39,17Enh EM Equity B* US LU0773064398 18,91 + 35,47ENH. EM EQ I EUR* EU LU0579408591 17,12 17,12 + 31,20ENH. EM EQ I USD* US LU0446997610 18,01 18,01 + 33,50
ENH. EM EQ P USD* US LU0446997701 17,26 17,26 + 31,42Eu Ma Vol P* EU LU0456116986 14,07 14,07 + 26,68Eu Su Co.Bd Ind I* EU LU0579408914 12,00 12,00 + 7,22Eu.Co.Bd.In.Fd I* EU LU0438092701 15,78 15,78 + 7,65Eu.Co.Bd.In.Fd P* EU LU0438092883 12,26 12,26 + 7,17
EuCo ex-Fin BdIndI* EU LU1112176968 10,14 10,14 + 7,90EuCo ex-Fin BdIndP* EU LU0956453996 11,93 11,93 + 7,42EuCoex-Fin BdIndI€* EU LU0956453640 12,05 12,05 + 7,91EuIs Sc CorBd In I* EU LU0704618890 11,76 11,76 + 5,91EuIsScCorBdInICHFh* CH LU0956151988 9,94 9,94 – 3,66
Eur Corp Bd Ind B* EU LU0773064711 13,73 + 8,14EurCorTrea Bd IndB* EU LU0773064984 12,56 + 5,50EurInfl LiBd Ind I* EU LU0956454291 12,73 12,73 + 14,90Europe Enh Equity I* EU LU1112179558 15,65 15,65 + 37,44Europe Enh Equity P* EU LU1112179475 13,64 13,64 + 36,42
Europe Ind Equ B* EU LU1159236683 15,27 + 32,24Europe Ind Equ I* EU LU1159236337 15,99 15,99 + 39,33Europe Ind Equ P* EU LU1159236501 15,59 15,59 + 37,58Europe Sm Equity P* EU LU1112178824 15,41 15,41 + 46,69Europe Value Sp. B* EU LU0892046151 16,70 + 22,51
Europe Value Sp. I* EU LU0892045930 11,61 11,61 + 19,76Europe Value Sp. P* EU LU0892045856 14,66 14,66 + 17,00Eurozone Val Sp. B* EU LU0892046409 19,78 + 34,01Eurozone Val Sp. I* EU LU0892046318 16,69 16,69 + 31,04Eurozone Val Sp. P* EU LU0892046235 16,85 16,85 + 27,90
UniCommodities* EU LU0249045476 59,34 56,51 + 36,06
UniDividAss net A* EU LU0186860663 58,56 58,56 + 27,35UniDividendenAss A* EU LU0186860408 61,63 59,26 + 28,70UniDyn.Europa A* EU LU0085167236 149,62 143,87 + 65,89UniDynamic Gl. A* EU LU0089558679 115,94 111,48 + 92,66UniEMGlobal* EU LU0115904467 108,75 103,57 + 25,83
UniEuRe Corp A* EU LU0117072461 54,74 53,15 + 9,01UniEurKap Corp-A* EU LU0168092178 37,61 36,87 + 2,44UniEurKap.Co.net A* EU LU0168093226 37,44 37,44 + 1,53UniEuroAnleihen* EU LU0966118209 58,18 56,49 + 7,94UniEuroKapital* EU LU0046307343 64,78 63,51 + 0,06
UniEuroKapital-net* EU LU0089559057 40,65 40,65 – 0,88UniEuropa* EU LU0047060487 3181,20 3029,71 + 61,91UniEuropaRenta* EU LU0003562807 51,05 49,56 + 10,50UniFavorit: Renten* EU LU0006041197 25,09 24,60 + 7,81UniGlobal II A* EU LU0718610743 159,25 151,67 + 68,43
UniIndustrie 4.0A* EU LU1772413420 84,81 81,55 + 75,61UniOpti4* EU LU0262776809 96,95 96,95 – 1,10UniRak Em. Mkts* EU LU0383775318 187,35 180,14 + 19,25UniRenta Osteuropa* EU LU0097169550 39,63 38,48 + 7,36UniRes: Euro Corp.* EU LU0247467987 42,15 42,15 + 3,79
UniReserve: Euro A* EU LU0055734320 493,86 493,86 – 0,62UniSec. BioPha.* EU LU0101441086 170,11 163,57 + 45,94UniSec. High Tech.* EU LU0101441672 204,47 196,61 + 106,18UniStruktur* EU LU1529950914 113,08 109,79 + 12,36UniVa. Global A* EU LU0126315885 143,73 138,20 + 41,19
UniVa.Glb-net-A* EU LU0126316180 136,86 136,86 + 40,25
UNION INVESTMENT REAL ESTATEUniImmo:Dt.* EU DE0009805507 97,97 93,30 + 7,63UniImmo:Europa* EU DE0009805515 57,44 54,70 + 5,89UniImmo:Global* EU DE0009805556 51,46 49,01 + 1,28
UNIVERSAL-INVESTMENT-LUXEMBOURG S.A.CondorBalance-UI* EU LU0112268841 108,24 103,09 + 31,07CondorChance-UI* EU LU0112269146 106,73 101,65 + 57,40CondorTrends-UI* EU LU0112269492 122,18 116,36 + 68,11
www.walserprivatbank.com Telefon +43 5517 202-01
Wal. Pf Akt USA US LU0121930688 361,33 344,12 + 41,58Wal. Pf Akt.Europa EU LU0121929912 133,12 126,78 + 31,26Wal. Pf EmMkt Sel EU LU0572807518 117,12 111,54 + 8,48Wal. Pf German Sel EU LU0181454132 254,78 242,65 + 18,70Wal. Weltpf 10 EU LU0327378385 145,35 142,50 + 9,09
Wal. Weltpf 25 EU LU0327378468 153,62 149,15 + 13,07Wal. Weltpf 45 EU LU0327378542 160,56 155,88 + 16,63Wal. Weltpf 65 EU LU0327378625 161,03 153,36 + 19,80
WARBURG INVESTDMüller Prem Akt € EU DE000A111ZF1 94,47 90,84 – 9,51
W&W ASSET MANAGEMENT DUBLINSouthEast Asian Eq* EU IE0002096034 135,42 + 27,17
Exchange Traded Funds (ETF)
Produktname Währung ISIN NAV2)
Telefon: 069/29 807 0etf.invesco.com
Invesco AT1 Capital Bd GBP* GB IE00BYZLWM19 41,91Invesco AT1 Capital Bd USD* US IE00BG0TQB18 22,15Invesco Dynamic US Mrkt* US IE00B23D9240 19,49Invesco EQQQ Nasdaq-100* EU IE0032077012 147,50Invesco EQQQQ Na 100 ETF* US IE00BFZXGZ54 271,32
Invesco EuroMTS Cash 3M* EU IE00B3BPCH51 99,65Invesco FTSE RAFI EM* US IE00B23D9570 9,49Invesco FTSE RAFI Eu MS* EU IE00B23D8Y98 16,83Invesco FTSE RAFI Europe* EU IE00B23D8X81 10,60Invesco FTSE RAFI US 1000* EU IE00B23D8S39 15,90
Invesco IMII AT1 CapBd €Hd* EU IE00BFZPF439 20,72Invesco IMII AT1 CapBd Acc* US IE00BFZPF322 26,24Invesco Inv VarRate Pref A* US IE00BHJYDT11 50,35Invesco Invesco Pref Sh Ac* US IE00BG482169 50,86Invesco InvMSCIEurLeadCath* EU IE00BG0NY640 55,27
Invesco Pref Sh UCITS ETF* US IE00BDVJF675 20,24Invesco USD Float Rate ETF* US IE00BDRTCQ08 19,74Invesco Var Ra Pref Sh ETF* US IE00BG21M733 42,48
tägliche Anteilspreisveröffentlichungen – mitgeteilt von Infront Financial Technology GmbH
* Fondspreise/ETF-Preise etc. vom Vortag oder letzt verfügbar1) Investmentfonds nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)2) NAV: Nettoinventarwert
Währungen: AU=Australischer Dollar, CH=Schweizer Franken,CA=Canadischer Dollar, DK=Dänische Krone, EU=Euro, GB =Brit.Pfund, JP=Japanische Yen, NO=Norwegische Krone, PL=PolnischeZloty, SE=Schwedische Krone, SG=Singapur-Dollar, US=US-Dollar
Bei der ausschüttenden Tranche ist die Währung gefettet.
Weitere Fonds-Infos unter:http://handelsblatt.com/boerse/fondsFondsinformationen für Profis im IPThttps://www.infrontfinance.com/products/infront-professional-terminal/
Alle Angaben ohne Gewähr; keine Anlageberatung oder -empfehlung
Name Whrg. ISIN Ausg. Rückn. Perf. 3J. in % Pac ex jap Ind I $* US LU1161082836 17,68 17,68 + 32,68Pac ex jap Ind P $* US LU1161083644 17,25 17,25 + 31,09
PacexJap Ind Eq B$* US LU1161085342 17,90 + 33,47SSgA Glb ManVolEqI* US LU0450104814 28,28 28,28 + 26,14Swi Ind Eq I CHF* CH LU1159239190 16,97 16,97 + 44,72Swi Ind Eq P CHF* CH LU1159239273 16,56 16,56 + 42,98Swi Ind Eq P EUR* EU LU1159239513 17,11 17,11 + 54,14
UK Ind Eq I EUR* EU LU1159238978 12,55 12,55 + 15,31UK Ind Eq I GBP* GB LU1159238465 14,45 14,45 + 11,77UK Ind Eq P GBP* GB LU1159238549 14,10 14,10 + 10,43UK Index Eq B GBP* GB LU1159238622 11,54 – 10,71US Corp Bd Ind I* US LU0956452675 14,02 14,02 + 26,39
US I S C In I €h* EU LU0868465948 12,31 12,31 + 15,49US I S C In I CHFh* CH LU0956151715 11,04 11,04 + 7,00US Ind Eq B USD* US LU1159237061 26,61 + 80,36US Ind Eq I EUR* EU LU1159237228 25,35 25,35 + 76,16US Ind Eq I EUR h* EU LU1159237491 23,29 23,29 + 68,60
US Ind Eq I USD* US LU1159236840 26,28 26,28 + 79,28US Ind Eq P USD* US LU1159236923 25,65 25,65 + 77,14US Val Spot B USD* US LU1159224242 17,57 + 40,54US Val Spot USD* US LU1159224085 16,75 16,75 + 37,41Wld Ind Eq B USD* US LU1159234985 22,64 + 65,74
Wld Ind Eq I EUR* EU LU1159235107 21,57 21,57 + 61,87Wld Ind Eq I USD* US LU1159234712 22,36 22,36 + 64,75Wld Ind Eq P EUR h* EU LU1159235289 19,94 19,94 + 54,93Wld Ind Eq P USD* US LU1159234803 21,80 21,80 + 62,70Wld SRI Ind Eq B $* US LU1159235529 24,10 + 70,80
Wld SRI Ind Eq I $* US LU1159235362 22,68 22,68 + 69,35
Tel: +49 89 599 890 314 Fax: +49 89 599 890 [email protected] www.thomas-lloyd.com
Sus Infrstr Inc R€* EU LU1439435931 938,59 938,59Sust Infra R CZK A* CZ LU1108670180 998,69 998,69Sust Infrastruc IA* EU LU1108653095 784,14 784,14Sust Infrastruc IRD* US LU1859505734 1009,75 1009,75Sust Infrastruct I* US LU1108670347 1242,51 1242,51
Telefon 069 58998-6060www.union-investment.de
Priv.Fonds:Flex.* EU DE000A0Q2H14 94,02 94,02 – 8,11Priv.Fonds:FlexPro* EU DE000A0RPAL7 149,85 149,85 + 17,28PrivFd:Kontr.* EU DE000A0RPAM5 138,31 138,31 + 10,98PrivFd:Kontr.pro* EU DE000A0RPAN3 179,70 179,70 + 27,00Uni21.Jahrh.-net-* EU DE0009757872 47,35 47,35 + 54,82
DIE BESTEN IMMOBILIENFONDS IM VERGLEICHPREIS PERFORMANCE IN %
TITEL ISIN 4.11.’21 1 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. LFD. KOSTEN %
Catella MAX DE000A0YFRV7 21,11 EUR + 0,96 + 9,45 + 12,31 + 29,55 + 82,65 WWWWWWW0,97Catella European R DE000A0M98N2 15,93 EUR + 0,63 + 4,86 + 10,09 + 27,29 + 54,08 WWWWWWWWWWWWW1,69BNPP REIM INTER ImmoProfil DE0009820068 58,74 EUR + 0,12 + 2,39 + 3,58 + 11,98 + 14,30 WWWWWWWWWW1,34Catella Nachh Immo DE000A2DHR68 11,08 EUR + 0,36 + 2,37 + 3,11 + 10,27 - WWWWWWWWWWW1,49Catella Bavaria DE000A2AS909 10,55 EUR + 0,19 + 2,23 + 2,82 + 9,08 - WWWWWWWW1,06KanAM Spz Leading Cities DE0006791825 105,78 EUR + 0,14 + 1,35 + 2,65 + 9,02 + 15,99 WWWWWWWW1,06Deka Immo b Europa* DE0009809566 47,40 EUR + 0,21 + 1,15 + 2,39 + 8,93 + 16,49 WWWWWWW0,90Catella Wohnen Eur DE000A141UZ7 10,56 EUR + 0,28 + 1,23 + 2,00 + 8,76 + 12,69 WWWWWWW0,86DWS Gb. grundb. Fok Deu RC DE0009807081 53,42 EUR + 0,11 + 0,92 + 2,01 + 8,22 + 15,62 WWWWWWWWW1,11DWS Gb. grundb. global RC DE0009807057 52,30 EUR + 0,35 + 1,38 + 2,35 + 7,67 + 12,73 WWWWWWWWW1,12UniRealEst UniImmo:Dt.* DE0009805507 93,30 EUR + 0,20 + 1,35 + 2,21 + 7,63 + 13,82 WWWWWWW0,93Deka Immo WestInv. InterSel.* DE0009801423 47,29 EUR + 0,13 + 1,24 + 2,08 + 7,61 + 13,01 WWWWWW0,78DWS Gb. grundb. europa RC DE0009807008 40,48 EUR + 0,52 + 2,27 + 2,58 + 7,16 + 13,67 WWWWWWWW1,05Commerz hausInvest DE0009807016 42,92 EUR + 0,21 + 1,27 + 1,91 + 6,53 + 11,34 WWWWWW0,84Deka Immo Deka Immo Nordam* DE000DK0LLA6 54,73 USD + 0,20 + 0,90 + 2,19 + 6,48 + 13,58 WWWWWW0,73
Alle dargestellten Investmentfonds sind Teilnehmer am Funds Service, sortiert nach 3-Jahresperformance, berechnet nach BVI Methode. Laufende Kosten % = Anteil der Verwaltungskosten eines Fonds, hoherProzentsatz = hoher Kostenanteil. Erscheinungstäglich wechselnde Kategorien: Aktien-, Renten-, Geldmarkt-, Misch-, Immobilien- und wertgesicherte Fonds. Keine Anlageberatung und -empfehlung.
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Wochenende
46
Wer in diesen Tagen über Klimaschutz redet, malt gern in düsteren Farben. „Fridays for Future“ wirft SPD, Grünen und FDP zum Start der Koalitionsverhand-lungen eine schönfärberische „Begrünung der Re-gierungsarbeit“ vor. Unternehmen, vor allem solche mit hohem Stromverbrauch, warnen vor zu scharfen Klimaschutzzielen und über ehrgeizigen Alleingän-gen in Deutschland und Europa. Und die Vereinten Nationen schlugen kurz vor Beginn der Weltklima-konferenz in Glasgow Alarm: Die Pläne der Teilneh-merstaaten zur CO2-Reduktion reichten nicht, es drohe ein Temperaturanstieg von 2,7 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Der erhoffte Durchbruch in der Klimadiplomatie lässt aber weiter auf sich warten.
Angesichts dessen könnten Deutschland und Europa es bei ihren bisherigen vergleichsweise ambitionierten Bemühungen belassen. Sie könn-ten auf andere Länder verweisen. Das aber wäre die falsche Haltung. Wer den Klimaschutz nur als Last sieht, die möglichst gleichmäßig über Kon-tinente und Generationen verteilt werden muss, verkennt die Chancen: Der Schutz des Klimas kann – trotz des historischen Kraftakts und der gewaltigen Investitionen, die für dieses Ziel nötig sind – Wachstum und Wohlstand schaffen.
Der Schlüssel sind innovative Geschäftsmodel-le, Technologien, Produkte, Maschinen, Anlagen und Verfahren. Nicht nur für das eigene Unterneh-men oder das eigene Land, sondern für die ganze Welt. Der frühere US-Vizepräsident und Green-tech-Investor Al Gore etwa glaubt, dass Techno-logie die Klimakrise entscheidend mitverursacht hat – und somit auch Teil ihrer Lösung ist.
So könnten die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer nach Berechnungen ihres Bran-chenverbands und der Strategieberatung BCG bis 2050 weltweit rund zehn Billionen Euro zusätz-lichen Umsatz mit klimaschonenden Technolo-gien wie Elektromotoren, Recyclinganlagen, Windrädern und Elektrolyseuren erwirtschaften. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bit-kom setzt die Hälfte der Menschen in Deutschland auf technische Innovationen als Erfolg verspre-chenden Weg, um den CO2-Ausstoß zu vermin-dern. Unter den Jungen zwischen 16 und 29 Jahren sind es sogar zwei Drittel.
Das Know-how, die Köpfe, das Kapital: Deutschland und Europa besitzen alle Bausteine für eine erfolgreiche „Net Zero“-Zukunft. Ob-wohl es den meisten Firmen schwerfällt, sich für diese Zukunft zu rüsten, haben sie schon viel Vor-zeigbares hervorgebracht. Nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft oder Energieeffizienz – all das sind Bereiche, die den deutschen Wohlstand und das globale Ökosystem nachhaltig sichern können.
Vier-Billionen-Marke geknackt Das Potenzial ist gigantisch: 2020 betrug das welt-weite Marktvolumen von Umwelttechnik und Ressourceneffizienz laut „Green-Tech-Atlas“ des Bundesministerium für Umwelt rund 4,6 Billionen Euro. In zehn Jahren sollen es gut neun Billionen Euro sein. In Deutschland lag das Marktvolumen im vergangenen Jahr bei 392 Milliarden Euro – bis 2030 soll es sich mehr als verdoppeln. Welcher unternehmerische Kopf, der diese Bezeichnung verdient, würde sich von solch einem Wachstums-markt nicht ein Stück abschneiden wollen?
Um dieses Potenzial zu heben, braucht es die Vision einer klimaneutralen Wirtschaft und einen Wachstumsplan. Deutschland und Europa müs-sen die Hürden für die grenzüberschreitende Fi-nanzierung weiter abbauen und sich genau über-legen, wo die grünen Milliardenmärkte mit der größten Wertschöpfung liegen. Ansonsten dro-hen viele Investitionen zu versickern und Unter-nehmen zu scheitern.
Das Gute ist: Es gibt Menschen in Deutsch-land, deren Ideen und Einsatz zusammengenom-men genau so einen Plan ergeben – die 50 grünen Pioniere der deutschen Wirtschaft, die das Han-delsblatt in dieser Ausgabe vorstellt. Was sie an-treibt und umtreibt, ist nicht allein das hehre Ziel der Weltenrettung. Es ist auch die Überzeugung, jetzt die Grundlage für den klimaneutralen Wohl-stand der kommenden Dekaden schaffen zu kön-nen. Sie sind der erfrischende Gegenpol zu
Schwarzmalerinnen und Untergangspropheten.n� Beispiel Energie Weg von Öl, Gas und Kohle, hin zu grünem Strom, der bezahlbar und in aus-reichenden Mengen vorhanden ist: Wie das ge-lingen kann, damit beschäftigt sich eine Vielzahl von Firmen. Der Ausbau der erneuerbaren Ener-gien – von Wind und Sonne über Biomasse bis Wasserkraft – steht im Fokus. Es geht aber auch um effiziente Verteilungsnetze und Speichertech-nologien. Elke Temme zum Beispiel arbeitet bei der Komponenten-Tochter von Volkswagen und leitet dort das Geschäftsfeld „Laden & Energie“. Sie sorgt nicht nur dafür, dass der Autobauer zum Stromanbieter wird, sie arbeitet auch daran, dass Millionen Elektroautos zum mobilen Speicher-netz werden und im Stromnetz Lieferschwankun-gen bei erneuerbaren Energien ausgleichen.
n� Beispiel Mobilität Der Verkehr ist einer der größten CO2-Sünder, doch mittlerweile forciert die Wirtschaft, allen voran die Autoindustrie, die Mobilitätswende. Im Mittelpunkt stehen alter-native Antriebe – in erster Linie Elektro, aber auch Hybrid und Brennstoffzelle. Biokraftstoffe spielen ebenfalls eine Rolle. Dietrich Brockhagen, Gründer und Chef der Non-Profit-Organisati-on Atmosfair, hat jüngst die erste Produktions-anlage für synthetisch hergestelltes Flugbenzin eingeweiht. Die von der Atmosfair-Schwester -gesellschaft Solarbelt betriebene Fabrik im Ems-land wird zwar nur rund eine Tonne des E-Fuels pro Tag herstellen. Dennoch ist sie ein wichtiger erster Schritt hin zum klimaneutralen Fliegen. Lufthansa gehört zu den ersten Kunden.
n� Beispiel Kreislaufwirtschaft Die Vorstellung, dass die Welt eines Tages so wirtschaftet, dass kein Müll mehr entsteht und Ressourcen immer wieder verwendet werden, treibt viele kluge Köp-
Essay
Wer, wenn nicht
wir? Allen Protesten und Problemen zum
Trotz: Deutschland hat das Know-how, die Köpfe und das Kapital, um
zum Klima-Vorreiter zu werden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen
mehr Mut und Tempo. Ein Plädoyer für die Chancen.
Von Kirsten Ludowig
Car
o/O
berh
aeus
er, A
llian
z, E
cosi
a, R
esou
rcify
, GR
OP
YUS,
Xin
g, V
olks
wag
en, R
apun
zel,
Mus
eum
Ritt
er, U
ta W
agne
r, dm
, Shi
ftph
one,
M
adas
ter,
Hel
mut
-G.-W
alth
er-K
linik
um G
mbH
, Elv
ah, 2
g En
ergy
, Ena
pter
, Pla
netl
y, T
obia
s A
de/B
osch
, And
reas
Pei
n/la
if, V
ytal
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Grüne Pioniere
47
fe und Unternehmen an. Bei der „Circular Eco-nomy“ geht es vor allem um das Sammeln, den Transport und die Trennung von Abfall als Basis für die weitere Verwertung sowie um Verfahren zum Recycling von Stoffen jeder Art. Hier setzen Gary Lewis und Pascal Alich den Hebel an. Die Mitgründer von Resourcify wollen den „Mangel an Technologie auf dem Recyclingmarkt“ besei-tigen. Das Start-up bietet Unternehmen eine cloudbasierte Plattform, auf der sie alle Anfragen und Aufträge rund um die Entsorgung und das Recycling ihrer Abfälle bündeln können.
Gates: „Ingenieurexpertise nutzen“Viele Klimatechnologien aus Deutschland sind marktreif, manche sind schon etabliert, andere warten nur noch auf ihre Skalierung. Deutschland kann Greentech entwickeln, installieren und be-treiben. Das beeindruckt auch Bill Gates. „Deutschland ist führend in allen möglichen In-genieurfeldern“, konstatiert der Microsoft-Grün-der und Greentech-Investor und fordert: „Wir müssen die Ingenieurexpertise nutzen.“
Die Tüftler und Gestalterinnen haben also ge-liefert, was Deutschland für den Aufbruch in die grün-soziale Marktwirtschaft braucht. Nun muss der Staat seine Aufgaben erledigen. Indem er för-dert, wo der Markt allein noch nicht genug grüne Fantasien entwickelt. Indem er Genehmigungs-verfahren beschleunigt, wo Bürokratie das grüne Wachstum bremst.
Ziel muss es sein, mehr deutschen Technolo-gien global zum Durchbruch zu verhelfen – und nicht, weniger Industrie in Deutschland fertigen zu lassen. Und das Ganze muss schnell vonstatten-gehen. Deutschland hat nicht mehr allzu viel Zeit, um sich als Greentech-Nation Nummer eins in Stellung zu bringen. „Uns bleiben etwa drei bis fünf Jahre, um diese Chancen für Deutschland zu he-
ben und uns dadurch weltweit eine Führungsposi-tion zu erarbeiten, bevor es andere tun“, schrieben prominente Topmanagerinnen in einem Thesen-papier vor der Bundestagswahl.
Gemeint sind mit diesen „anderen“ vor allem die USA und China. Die beiden Großmächte ha-ben die grünen Chancen längst erkannt. Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigte vor gut einem Jahr an, dass China „vor 2060“ klimaneutral sein wolle. Das Ziel steht weit oben auf Pekings Agen-da. Dabei wird der Finanzsektor systematisch mit eingebunden. Chinas Markt für grüne Anleihen boomt laut der „Climate Bonds Initiative“, auch wenn nur gut die Hälfte des Volumens interna-tionalen Definitionen genüge.
US-Präsident Joe Biden beschloss, gerade im Amt, die Rückkehr der USA ins Pariser Klimaab-kommen. Ein Schritt mit Symbolkraft. Sich selbst verordneten die USA Klimaneutralität bis 2050. Zwar musste Biden sein Klimapaket wegen Wi-derständen aus der eigenen Partei und der oppo-sitionellen Republikaner eindampfen, sein Mantra aber bleibt: Der Kampf gegen den Klimawandel treibt die Wirtschaft an und schafft Jobs in den USA.
Europa will bis zum Jahr 2050 der erste kli-maneutrale Kontinent der Erde sein. Das euro-päische Budget umfasst inklusive Corona-Wie-deraufbaufonds 2,1 Billionen Euro. Gut ein Drittel davon ist laut EU-Kommissionspräsidentin Ur-sula von der Leyen für den „Green Deal“ vorge-sehen. Das ist viel Geld und mehr, als die USA eingeplant haben. Bidens gekürztes Klimapaket kommt nur noch auf 555 Milliarden Dollar.
Von der Leyen sprach 2020 kurz nach dem Coronaausbruch von einem „Marshallplan für Europa“. Und die EU hat geliefert – mit einem Unterschied: Nach heutiger Kaufkraft investierten die USA beim historischen Marshallplan für den Wiederaufbau Europas nach dem Krieg nicht ein-
mal annähernd die Summe, die jetzt zur Verfü-gung steht, um Europa „grüner, digitaler und kri-senfester“ (von der Leyen) zu machen.
Kapitalmarkt als großer HebelDie Transformation der Wirtschaft wird nicht zu-letzt am Kapitalmarkt entschieden. Anleger be-werten längst nicht mehr nur Zahlen. In Deutsch-land beziehen mittlerweile fast vier Fünftel derinstitutionellen Investoren Nachhaltigkeitskrite-rien in ihre Anlageentscheidungen mit ein, heißtes in einer Umfrage von Union Investment. DieUnternehmen, die es schaffen, ihren Investoreneinen glaubhaften Plan zur Dekarbonisierung auf-zuzeigen, können viel Geld einsammeln.
Auch hier sind die Voraussetzungengut: Trotz Greenwashing-Gefahr und schwam-migen Nachhaltigkeitskriterien gibt es immermehr ESG-Fonds in Deutschland und Europa. Al-so solche Investments, die ökologischen, sozialenund ethischen Standards gerecht werden wollen.Allein für die deutschsprachigen Länder erwartetdie Strategieberatung des Wirtschaftsprüfers PwCin ihrem optimistischen Szenario eine Verviel -fachung des nachhaltig gemanagten Kapitals auf3,8 Billionen Euro im Jahr 2024.
Birgt der grüne Umbau der Wirtschaft ein sig-nifikantes Risiko? Ja, keine Frage. Aber am Endedes Tages ist Nichtstun das größere Risiko unddamit keine Option.
„Wir schaffen noch ein Wirtschaftswunder. Ein klimaneutrales“, stand auf einem der Plakatevor der Bundestagswahl. Ludwig Erhard, als Vaterdes vermeintlichen Wirtschaftswunders im kol-lektiven Gedächtnis, hat den Begriff nie gemocht.Für ihn war der Aufschwung in Deutschland nachdem Krieg kein Wunder, sondern die Folge vonharter Arbeit und Fleiß, von Hingabe und in denersten Jahren auch von Verzicht.
Energieeffizienz
Rohstoff- und Materialeffizienz
Nachhaltige Mobilität
Kreislaufwirtschaft
Nachhaltige Wasserwirtschaft
Gesamt
Umweltfreundliche Erzeugung,Speicherung u. Verteilung von Energie
Nachhaltige Agrar- und Forstwirtschaft
1.911
2.246
1.588
1.811
263
1.190
373
2030*
844
1.224
712
787
148
786
128
2020
Globales Volumen für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz in Mrd. Euro
Quelle: Roland Berger, Green-Tech-Atlas*Geschätzte Entwicklung
HANDELSBLATT
Großes Marktpotenzial
4.6289.383Mrd. €
Deutschland ist führend in allen möglichen Ingenieur-
feldern. Wir müssen die Ingenieurexpertise nutzen.
Bill GatesMicrosoft-Mitgründer, Philanthrop
und Tech-Investor
Die AutorinKirsten Ludowig ist seit März 2021 stellvertretende Chefredakteurin des Handelsblatts. Die Diplom-Ökonomin begann 2008 als Redakteurin beim Handels-blatt. 2018 wechselte sie auf die Unternehmensseite und verantwortete die externe Kommunikation der Metro AG, um im März 2020 als Leiterin des Unternehmens-ressorts zurückzukommen.
Max
Bru
nner
t
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215Wochenende
46
Wer in diesen Tagen über Klimaschutz redet, malt gern in düsteren Farben. „Fridays for Future“ wirft SPD, Grünen und FDP zum Start der Koalitionsverhand-lungen eine schönfärberische „Begrünung der Re-gierungsarbeit“ vor. Unternehmen, vor allem solche mit hohem Stromverbrauch, warnen vor zu scharfen Klimaschutzzielen und über ehrgeizigen Alleingän-gen in Deutschland und Europa. Und die Vereinten Nationen schlugen kurz vor Beginn der Weltklima-konferenz in Glasgow Alarm: Die Pläne der Teilneh-merstaaten zur CO2-Reduktion reichten nicht, es drohe ein Temperaturanstieg von 2,7 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Der erhoffte Durchbruch in der Klimadiplomatie lässt aber weiter auf sich warten.
Angesichts dessen könnten Deutschland und Europa es bei ihren bisherigen vergleichsweise ambitionierten Bemühungen belassen. Sie könn-ten auf andere Länder verweisen. Das aber wäre die falsche Haltung. Wer den Klimaschutz nur als Last sieht, die möglichst gleichmäßig über Kon-tinente und Generationen verteilt werden muss, verkennt die Chancen: Der Schutz des Klimas kann – trotz des historischen Kraftakts und der gewaltigen Investitionen, die für dieses Ziel nötig sind – Wachstum und Wohlstand schaffen.
Der Schlüssel sind innovative Geschäftsmodel-le, Technologien, Produkte, Maschinen, Anlagen und Verfahren. Nicht nur für das eigene Unterneh-men oder das eigene Land, sondern für die ganze Welt. Der frühere US-Vizepräsident und Green-tech-Investor Al Gore etwa glaubt, dass Techno-logie die Klimakrise entscheidend mitverursacht hat – und somit auch Teil ihrer Lösung ist.
So könnten die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer nach Berechnungen ihres Bran-chenverbands und der Strategieberatung BCG bis 2050 weltweit rund zehn Billionen Euro zusätz-lichen Umsatz mit klimaschonenden Technolo-gien wie Elektromotoren, Recyclinganlagen, Windrädern und Elektrolyseuren erwirtschaften. Laut einer Umfrage des IT-Branchenverbands Bit-kom setzt die Hälfte der Menschen in Deutschland auf technische Innovationen als Erfolg verspre-chenden Weg, um den CO2-Ausstoß zu vermin-dern. Unter den Jungen zwischen 16 und 29 Jahren sind es sogar zwei Drittel.
Das Know-how, die Köpfe, das Kapital: Deutschland und Europa besitzen alle Bausteine für eine erfolgreiche „Net Zero“-Zukunft. Ob-wohl es den meisten Firmen schwerfällt, sich für diese Zukunft zu rüsten, haben sie schon viel Vor-zeigbares hervorgebracht. Nachhaltige Mobilität, Kreislaufwirtschaft oder Energieeffizienz – all das sind Bereiche, die den deutschen Wohlstand und das globale Ökosystem nachhaltig sichern können.
Vier-Billionen-Marke geknackt Das Potenzial ist gigantisch: 2020 betrug das welt-weite Marktvolumen von Umwelttechnik und Ressourceneffizienz laut „Green-Tech-Atlas“ des Bundesministerium für Umwelt rund 4,6 Billionen Euro. In zehn Jahren sollen es gut neun Billionen Euro sein. In Deutschland lag das Marktvolumen im vergangenen Jahr bei 392 Milliarden Euro – bis 2030 soll es sich mehr als verdoppeln. Welcher unternehmerische Kopf, der diese Bezeichnung verdient, würde sich von solch einem Wachstums-markt nicht ein Stück abschneiden wollen?
Um dieses Potenzial zu heben, braucht es die Vision einer klimaneutralen Wirtschaft und einen Wachstumsplan. Deutschland und Europa müs-sen die Hürden für die grenzüberschreitende Fi-nanzierung weiter abbauen und sich genau über-legen, wo die grünen Milliardenmärkte mit der größten Wertschöpfung liegen. Ansonsten dro-hen viele Investitionen zu versickern und Unter-nehmen zu scheitern.
Das Gute ist: Es gibt Menschen in Deutsch-land, deren Ideen und Einsatz zusammengenom-men genau so einen Plan ergeben – die 50 grünen Pioniere der deutschen Wirtschaft, die das Han-delsblatt in dieser Ausgabe vorstellt. Was sie an-treibt und umtreibt, ist nicht allein das hehre Ziel der Weltenrettung. Es ist auch die Überzeugung, jetzt die Grundlage für den klimaneutralen Wohl-stand der kommenden Dekaden schaffen zu kön-nen. Sie sind der erfrischende Gegenpol zu
Schwarzmalerinnen und Untergangspropheten.n� Beispiel Energie Weg von Öl, Gas und Kohle, hin zu grünem Strom, der bezahlbar und in aus-reichenden Mengen vorhanden ist: Wie das ge-lingen kann, damit beschäftigt sich eine Vielzahl von Firmen. Der Ausbau der erneuerbaren Ener-gien – von Wind und Sonne über Biomasse bis Wasserkraft – steht im Fokus. Es geht aber auch um effiziente Verteilungsnetze und Speichertech-nologien. Elke Temme zum Beispiel arbeitet bei der Komponenten-Tochter von Volkswagen und leitet dort das Geschäftsfeld „Laden & Energie“. Sie sorgt nicht nur dafür, dass der Autobauer zum Stromanbieter wird, sie arbeitet auch daran, dass Millionen Elektroautos zum mobilen Speicher-netz werden und im Stromnetz Lieferschwankun-gen bei erneuerbaren Energien ausgleichen.
n� Beispiel Mobilität Der Verkehr ist einer der größten CO2-Sünder, doch mittlerweile forciert die Wirtschaft, allen voran die Autoindustrie, die Mobilitätswende. Im Mittelpunkt stehen alter-native Antriebe – in erster Linie Elektro, aber auch Hybrid und Brennstoffzelle. Biokraftstoffe spielen ebenfalls eine Rolle. Dietrich Brockhagen, Gründer und Chef der Non-Profit-Organisati-on Atmosfair, hat jüngst die erste Produktions-anlage für synthetisch hergestelltes Flugbenzin eingeweiht. Die von der Atmosfair-Schwester -gesellschaft Solarbelt betriebene Fabrik im Ems-land wird zwar nur rund eine Tonne des E-Fuels pro Tag herstellen. Dennoch ist sie ein wichtiger erster Schritt hin zum klimaneutralen Fliegen. Lufthansa gehört zu den ersten Kunden.
n� Beispiel Kreislaufwirtschaft Die Vorstellung, dass die Welt eines Tages so wirtschaftet, dass kein Müll mehr entsteht und Ressourcen immer wieder verwendet werden, treibt viele kluge Köp-
Essay
Wer, wenn nicht
wir? Allen Protesten und Problemen zum
Trotz: Deutschland hat das Know-how, die Köpfe und das Kapital, um
zum Klima-Vorreiter zu werden. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen
mehr Mut und Tempo. Ein Plädoyer für die Chancen.
Von Kirsten Ludowig
Car
o/O
berh
aeus
er, A
llian
z, E
cosi
a, R
esou
rcify
, GR
OP
YUS,
Xin
g, V
olks
wag
en, R
apun
zel,
Mus
eum
Ritt
er, U
ta W
agne
r, dm
, Shi
ftph
one,
M
adas
ter,
Hel
mut
-G.-W
alth
er-K
linik
um G
mbH
, Elv
ah, 2
g En
ergy
, Ena
pter
, Pla
netl
y, T
obia
s A
de/B
osch
, And
reas
Pei
n/la
if, V
ytal
WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215 Grüne Pioniere
47
fe und Unternehmen an. Bei der „Circular Eco-nomy“ geht es vor allem um das Sammeln, den Transport und die Trennung von Abfall als Basis für die weitere Verwertung sowie um Verfahren zum Recycling von Stoffen jeder Art. Hier setzen Gary Lewis und Pascal Alich den Hebel an. Die Mitgründer von Resourcify wollen den „Mangel an Technologie auf dem Recyclingmarkt“ besei-tigen. Das Start-up bietet Unternehmen eine cloudbasierte Plattform, auf der sie alle Anfragen und Aufträge rund um die Entsorgung und das Recycling ihrer Abfälle bündeln können.
Gates: „Ingenieurexpertise nutzen“Viele Klimatechnologien aus Deutschland sind marktreif, manche sind schon etabliert, andere warten nur noch auf ihre Skalierung. Deutschland kann Greentech entwickeln, installieren und be-treiben. Das beeindruckt auch Bill Gates. „Deutschland ist führend in allen möglichen In-genieurfeldern“, konstatiert der Microsoft-Grün-der und Greentech-Investor und fordert: „Wir müssen die Ingenieurexpertise nutzen.“
Die Tüftler und Gestalterinnen haben also ge-liefert, was Deutschland für den Aufbruch in die grün-soziale Marktwirtschaft braucht. Nun muss der Staat seine Aufgaben erledigen. Indem er för-dert, wo der Markt allein noch nicht genug grüne Fantasien entwickelt. Indem er Genehmigungs-verfahren beschleunigt, wo Bürokratie das grüne Wachstum bremst.
Ziel muss es sein, mehr deutschen Technolo-gien global zum Durchbruch zu verhelfen – und nicht, weniger Industrie in Deutschland fertigen zu lassen. Und das Ganze muss schnell vonstatten-gehen. Deutschland hat nicht mehr allzu viel Zeit, um sich als Greentech-Nation Nummer eins in Stellung zu bringen. „Uns bleiben etwa drei bis fünf Jahre, um diese Chancen für Deutschland zu he-
ben und uns dadurch weltweit eine Führungsposi-tion zu erarbeiten, bevor es andere tun“, schrieben prominente Topmanagerinnen in einem Thesen-papier vor der Bundestagswahl.
Gemeint sind mit diesen „anderen“ vor allem die USA und China. Die beiden Großmächte ha-ben die grünen Chancen längst erkannt. Staats- und Parteichef Xi Jinping kündigte vor gut einem Jahr an, dass China „vor 2060“ klimaneutral sein wolle. Das Ziel steht weit oben auf Pekings Agen-da. Dabei wird der Finanzsektor systematisch mit eingebunden. Chinas Markt für grüne Anleihen boomt laut der „Climate Bonds Initiative“, auch wenn nur gut die Hälfte des Volumens interna-tionalen Definitionen genüge.
US-Präsident Joe Biden beschloss, gerade im Amt, die Rückkehr der USA ins Pariser Klimaab-kommen. Ein Schritt mit Symbolkraft. Sich selbst verordneten die USA Klimaneutralität bis 2050. Zwar musste Biden sein Klimapaket wegen Wi-derständen aus der eigenen Partei und der oppo-sitionellen Republikaner eindampfen, sein Mantra aber bleibt: Der Kampf gegen den Klimawandel treibt die Wirtschaft an und schafft Jobs in den USA.
Europa will bis zum Jahr 2050 der erste kli-maneutrale Kontinent der Erde sein. Das euro-päische Budget umfasst inklusive Corona-Wie-deraufbaufonds 2,1 Billionen Euro. Gut ein Drittel davon ist laut EU-Kommissionspräsidentin Ur-sula von der Leyen für den „Green Deal“ vorge-sehen. Das ist viel Geld und mehr, als die USA eingeplant haben. Bidens gekürztes Klimapaket kommt nur noch auf 555 Milliarden Dollar.
Von der Leyen sprach 2020 kurz nach dem Coronaausbruch von einem „Marshallplan für Europa“. Und die EU hat geliefert – mit einem Unterschied: Nach heutiger Kaufkraft investierten die USA beim historischen Marshallplan für den Wiederaufbau Europas nach dem Krieg nicht ein-
mal annähernd die Summe, die jetzt zur Verfü-gung steht, um Europa „grüner, digitaler und kri-senfester“ (von der Leyen) zu machen.
Kapitalmarkt als großer HebelDie Transformation der Wirtschaft wird nicht zu-letzt am Kapitalmarkt entschieden. Anleger be-werten längst nicht mehr nur Zahlen. In Deutsch-land beziehen mittlerweile fast vier Fünftel derinstitutionellen Investoren Nachhaltigkeitskrite-rien in ihre Anlageentscheidungen mit ein, heißtes in einer Umfrage von Union Investment. DieUnternehmen, die es schaffen, ihren Investoreneinen glaubhaften Plan zur Dekarbonisierung auf-zuzeigen, können viel Geld einsammeln.
Auch hier sind die Voraussetzungengut: Trotz Greenwashing-Gefahr und schwam-migen Nachhaltigkeitskriterien gibt es immermehr ESG-Fonds in Deutschland und Europa. Al-so solche Investments, die ökologischen, sozialenund ethischen Standards gerecht werden wollen.Allein für die deutschsprachigen Länder erwartetdie Strategieberatung des Wirtschaftsprüfers PwCin ihrem optimistischen Szenario eine Verviel -fachung des nachhaltig gemanagten Kapitals auf3,8 Billionen Euro im Jahr 2024.
Birgt der grüne Umbau der Wirtschaft ein sig-nifikantes Risiko? Ja, keine Frage. Aber am Endedes Tages ist Nichtstun das größere Risiko unddamit keine Option.
„Wir schaffen noch ein Wirtschaftswunder. Ein klimaneutrales“, stand auf einem der Plakatevor der Bundestagswahl. Ludwig Erhard, als Vaterdes vermeintlichen Wirtschaftswunders im kol-lektiven Gedächtnis, hat den Begriff nie gemocht.Für ihn war der Aufschwung in Deutschland nachdem Krieg kein Wunder, sondern die Folge vonharter Arbeit und Fleiß, von Hingabe und in denersten Jahren auch von Verzicht.
Energieeffizienz
Rohstoff- und Materialeffizienz
Nachhaltige Mobilität
Kreislaufwirtschaft
Nachhaltige Wasserwirtschaft
Gesamt
Umweltfreundliche Erzeugung,Speicherung u. Verteilung von Energie
Nachhaltige Agrar- und Forstwirtschaft
1.911
2.246
1.588
1.811
263
1.190
373
2030*
844
1.224
712
787
148
786
128
2020
Globales Volumen für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz in Mrd. Euro
Quelle: Roland Berger, Green-Tech-Atlas*Geschätzte Entwicklung
HANDELSBLATT
Großes Marktpotenzial
4.6289.383Mrd. €
Deutschland ist führend in allen möglichen Ingenieur-
feldern. Wir müssen die Ingenieurexpertise nutzen.
Bill GatesMicrosoft-Mitgründer, Philanthrop
und Tech-Investor
Die AutorinKirsten Ludowig ist seit März 2021 stellvertretende Chefredakteurin des Handelsblatts. Die Diplom-Ökonomin begann 2008 als Redakteurin beim Handels-blatt. 2018 wechselte sie auf die Unternehmensseite und verantwortete die externe Kommunikation der Metro AG, um im März 2020 als Leiterin des Unternehmens-ressorts zurückzukommen.
Max
Bru
nner
t
Bosch produziert als weltweit erster Industriekonzern seit Februar 2020 an seinen 400 Standorten CO2-neutral. Über 1000 Klimaprojekte laufen bei Bosch – Tendenz steigend. Donya-Florence Amer hat daraus für das Stiftungsunternehmen eine Geschäftsidee entwickelt. Vor viereinhalb Jahren kam die langjährige IBM-Beraterin zu den Schwaben. Seit eineinhalb Jahren führt die 49-jährige Betriebswirtin
die neu gegründete Bosch Climate Solutions GmbH. Sie berät große Mittelständler wie Freudenberg und Hansgrohe, wie sie dem Bei-spiel Bosch folgen können. Das CO2-Audit plus Masterplan dauert vier Wochen. Für das detaillierte CO2-Konzept braucht die leiden-schaftliche „Klimaverbesserin“ drei Monate. Sie ist mit ihrer Arbeit zu einer grünen Multiplikatorin geworden – und hat ihrem Arbeit-geber ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Martin Buchenau
Grüne Pioniere
48 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Strategien für eine CO2-neutrale Wirtschaft
Innovation statt ResignationSie produzieren Biokraftstoff aus Stroh, bekämpfen Waldbrände per Nanosatellit, verhelfen
Ökoanleihen zum Durchbruch oder lassen Konzerne ergrünen: Deutschlands entscheidender Vorteil im Kampf gegen den Klimawandel sind die vielen klugen Köpfe, die an diesem Thema arbeiten.
Das Handelsblatt präsentiert die 50 grünen Pioniere der deutschen Wirtschaft.
Tobi
as A
de/
Bos
ch
1. Donya-Florence Amer
Gro
pyus
/PR
2. Markus Fuhrmann Der Name des Unternehmens ist eine Kampfansage: Gropyus leitet sich von Walter Gropius ab, dem Wegbereiter der modernen Architektur in Deutschland. Auch Gropyus-Chef Markus Fuhrmann möchte die Branche verändern. Gemeinsam mit Mitgründer Florian Fritsch will er mit holz-basierten Gebäuden das Wohnen nachhaltiger und billiger machen. Geplant wird deshalb bei der deutsch-österreichischen Firma
mit Künstlicher Intelligenz, Roboter bauen die Fertigteile, Software steuert die Gebäude. „Wir sehen uns nicht als Baufirma“, sagt Fuhrmann – man will eher Tech-Unternehmen sein: „Wir bauen Gebäude um die Technologie herum, nicht Technologie in die Gebäude hinein.“ So hat Gropyus ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das Licht, Strom, Jalousien und Türen per App regelt. Die Bau- und Gebäudewirtschaft trage 38 Prozent zur globalen CO2-Emis-sion bei. Das liegt nach Ansicht der Gropyus-Gründer auch daran, dass Zukunftstechnologien bisher kaum genutzt würden. Carsten Herz
2G E
nerg
y A
G
3. Christian Grotholt Die Technologie, mit der Christian Grotholts Unternehmen 2G Energy Geld verdient, gilt als besonders energieeffizient: Kraft-Wärme-Kopplung. Das börsennotierte Unternehmen baut Blockheizkraftwer-ke. „Wir benötigen ein saisonales Energiespeichersystem, um die regenerative Energieproduktion und deren Nutzung in Einklang zu bringen“, sagt der 53-jährige CEO. Heißt konkret: Seine Anlagen sollen die schwankende Stromproduktion von Wind und Sonne
ausgleichen. Während gewöhnli-che Blockheizkraftwerke oft Erdgas oder Öl verbrennen, bietet 2G Energy auch Kraftwerke mit Wasserstoffbetrieb an. Das Unternehmen hat bereits mehre-re Tausend Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in 55 Ländern installiert. Viele werden noch konventionell betrieben, können aber umgerüs-tet werden. 2020 machte 2G Energy einen Umsatz von rund 247 Millionen Euro. Catiana Krapp
4. Anna Alex Als Anna Alex, damals noch Co-Chefin beim digitalen Herrenausstatter Outfittery, den CO2-Fußabdruck ihres Start-ups berechnen lassen wollte, staunte sie nicht schlecht. Denn den Prozess, der sich vor ihren Augen entfalte-te, hat sie als „wahnsinnig umständlich“ in Erinnerung. Statt per Knopfdruck Auskunft über die Emissionen des Treibhausgases zu erhalten, befüllte ein Berater händisch Excel-Lis-ten und überreichte Alex später ein PDF mit den Zahlen.„Ernsthaft?“, dachte Alex, die sich schon bei Outfittery intensiv mit Automatisierung und maschinellem Lernen befasst hatte. „Wenn der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl dieses Jahrhunderts ist, müssen wir den doch auto-matisiert und fortwährend berechnen können. Und ihn genauso im Blick haben wie die Um-satzentwicklung.“ Alex sah nicht nur einen Bedarf, das Problem der intransparenten CO2-Emissionen anzuge-hen, sondern auch einen technischen Weg. Ende 2019 gründete sie gemeinsam mit Bene-dikt Franke Planetly. Auch Franke hat bereits Start-up-Erfahrung, er zählte einst zu den Mitgründern des Portals Helpling, das Rei-nigungskräfte vermittelt.
Die Software von Planetly erfasst alle klimarele-vanten Daten eines Unternehmens, die Firmen können dann nachvollziehen, wo die meisten CO2-Emissionen anfallen. Planetly analysiert unter anderem den CO2-Fußabdruck von BMW, Kärcher und Hellofresh. Doch Alex und Franke belassen es nicht bloß bei der Analyse. Auf Wunsch hilft Planetly seinen Kunden auch, Emissionen zu reduzieren oder durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompen-sieren. Nach nur zwei Jahren hat das Start-up nach eigener Auskunft mit über 170 Unterneh-men zusammengearbeitet und so 1,5 Millionen Tonnen CO2 „sichtbar“ gemacht. Schließlich lasse sich nur managen, was sicht- und mess-bar ist, ist Alex überzeugt. Dass ab 2023 alle europäischen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern Auskunft über ihre CO2-Emissionen erteilen müssen, kommt der 36-jährigen Unternehmerin entgegen. Weil die Zeit für die Dekarbonisierung drängt, will Alex, die sich 2019 der Klimainitiative „Leaders for Climate Action“ anschloss, mit ihrem Unternehmen möglichst schnell wachsen und ihr Geschäft skalieren. Purpose sei zwar schön, so Alex, für sie gelte das aber vor allem in Verbindung mit „echtem Impact“. Anna Gauto
Pla
netl
y
49WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
5. Dietrich Brockhagen Es ist eine komplizierte und für den Klima-schutz zentrale Aufgabe, die Dietrich Brock-hagen seit Jahren bearbeitet: den Flugverkehr klimafreundlicher zu machen. „Ich wollte das Thema positiv besetzen“, sagt der Gründer der Agentur Atmosfair. „Nicht nach dem Motto, du darfst nicht, sondern, es ist gut, mehr für den Klimaschutz zu bezahlen.“Getreu diesem Vorsatz bietet Atmosfair bereits seit 2004 Klimakompensationen an. Wer einen Flug bucht, kann auf der Atmosfair-Website berechnen, wie viel CO2 dabei entsteht, und exakt diese Menge durch eine Geldspende freiwillig kompensieren. Mit dem Geld betreibt Atmosfair Klimaschutzprojekte, bei denen Emissionen eingespart werden. Dazu zählen zum Beispiel effizientere holzbefeuerte Herde für mehrere Länder in Afrika, nicht aber die sonst häufig zur CO2-Kompensation genutzten Aufforstungsprojekte. Denn laut Atmosfair kann derzeit kein Projektpartner zusichern, dass ein Wald tatsächlich die 50 oder gar 100 Jahre stehen bleibe, die für einen positiven Klimaeffekt erforderlich sind. Seit der Gründung von Atmosfair sind die
Kompensationseinnahmen immer weiter gewachsen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 haben sie sich im Vergleich zu 2018 gar auf rund 21 Millionen Euro verdoppelt. Mittlerweile ist Brockhagen im Ringen um einen grüneren Flugverkehr einen Schritt weiter gegangen: Im Emsland hat die Atmosfair-Schwestergesell-schaft Solarbelt gemeinsam mit Siemens, der Lufthansa und dem Energieversorger EWE die weltweit erste Anlage gebaut, die CO2-neutrales E-Kerosin produziert. Der mögliche Flugzeug-treibstoff der Zukunft entsteht aus grünem Wasserstoff und CO2. Ab 2026 verpflichtet die Bundesregierung die Airlines in Deutschland, ihrem Treibstoff 0,5 Prozent nachhaltigen „Sustainable Aviation Fuel“ (SAF) beizumi-schen. Damit bräuchten die Fluggesellschaften 50.000 Tonnen synthetischen Treibstoff pro Jahr. Die Anlage im Emsland schafft jährlich 360 Tonnen. Brockhagen wünscht sich: „Deutschland sollte die Technologie für die Herstellung synthetischen Kerosins aus Strom, CO2 und Wasser zum Exportschlager machen und in fairen Energiepartnerschaften mit Entwicklungsländern aufbauen.“ Catiana Krapp
Uta
Wag
ner,
Mus
eum
Ritt
er
8. Alfred T. Ritter und Marli Hoppe-Ritter
Lange bevor ein Lieferkettengesetz Menschenrechte schützen sollte, vor fast genau 30 Jahren nämlich, befanden die Geschwister Marli Hoppe-Ritter und Alfred T. Ritter: Sie hätten eine Mitverantwortung für die Familien, die den Kakao für die familieneigene Schokoladen-marke Ritter Sport anbauen. Die Enkel der Firmengründer Alfred und Clara Ritter starteten ein Kakaoprojekt in Nicaragua, das den Bauern höhere Löhne zahlte, in Weiterbildung investierte und auf Agrarchemie verzichten sollte. Als das damalige Management gegen „die beiden Sozialromantiker“ aufbegehrte, musste es gehen. Unter der Führung von Alfred, der mit seiner Schwester und Mitinhaberin alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam traf, entwickelte sich Ritter Sport zu einer Marke, die wie wenige andere für nachhaltige Schokolade steht. Als erster Tafelhersteller bezieht das Familienunternehmen für das gesamte Sortiment seit 2018 ausschließlich zertifi-zierten Kakao. Wenn es nach der Kunstsammlerin Hoppe-Ritter geht, soll Nachhaltigkeit immer Firmen-DNA bleiben. In einem Interview sagte sie auf die Frage, ob man nicht auch mit einem Riesen wie Nestlé fusionieren würde: „Solange mein Bruder und ich das Sagen haben, ist das völlig ausgeschlossen.“ Anna Gauto
Alli
anz
6. Line Hestvik Wenn Line Hestvik über Ökologie und Soziales spricht, dann ist sie schnell bei ihrem zentralen Punkt: „Wir wollen Nachhaltigkeit einfach und skalierbar machen.“ Seit diesem Jahr ist die 52-jährige Norwegerin Chief-Sustainability- Managerin bei der Allianz. Eine Position, die es davor in der 131-jährigen Geschichte von Europas größtem Versicherer nicht gab. Bis 2050 will die Allianz klimaneutral sein. Versiche-rungsprodukte von 100 Millionen Kunden in 70 Ländern müssen dazu umgebaut, Anlagegelder von 2,5 Billionen Euro entsprechend investiert werden. Rund 150.000 Mitarbeiter weltweit müssen diesen Weg mitgehen. Manche Anre-gung bringt Hestvik aus ihrer Heimat mit. In Norwegen sind bereits 56 Prozent der Neufahr-zeuge elektrisch unterwegs. Nun will die Allianz in Ladenetze und Batterietechnik investieren: „Wir wollen schließlich weiter fahren können als nur 300 Kilometer am Stück.“ Christian Schnell
/Pri
vat
9. Philipp Kolb Durch die Digitalisierung der Produktion kann Philipp Kolb für Henkel CO2 einsparen. Der Maschi-nenbauingenieur hat federführend an der Implementierung einer cloudbasierten Datenplattform mitgearbeitet, welche die weltweit 30 Standorte der Wasch- und Reinigungsmittelproduktion in Echtzeit verbindet. Kolb kann sehen, welche Fabrik besonders wenig Strom oder Wasser benö-tigt. Weil viele Prozesse ähnlich
sind, ermöglicht das Rückschlüsse darauf, wie energieintensivere Standorte ihre Produktion effizienter gestalten können – etwa indem sie Prozesse optimieren oder andere Maschinen nutzen. Seit Beginn des Projekts 2013 konnte Henkel pro Tonne Waschmittel 26 Prozent Energie einsparen, so Kolb. „Wir werden immer Energie brauchen, um unsere Produkte herzustellen. Doch das Ziel muss sein, sie möglichst effizient einzusetzen.“ Das scheint gelungen: Mehrere Henkel-Produktionsstandorte wurden vom World Economic Forum ausgezeichnet. Ab Januar will Henkel Wasch- und Reinigungsmittel am Stammsitz Düsseldorf klimaneutral herstellen. Michael Scheppe
Tobi
as B
ohm
/Fut
ure
Coo
pera
tive
7. Simon Köhl Schon als Schüler hat Simon Köhl die freie Lernplattform serlo.org gegründet, die mehr Bildungs-gerechtigkeit fördern will. 2019 erhielt er dafür das Bundesver-dienstkreuz. Future Cooperative ist nun sein zweites, neues Start-up. Damit will er Städte weltweit nachhaltig verändern. Future Cooperative hilft dabei, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Unternehmen in einer Stadt wirklich fair und nachhaltig
wirtschaften, indem diese Firmen in einer „Future Map“ angezeigt werden. Als Genossenschaft angelegt, zahlen die Mitglieder Beiträ-ge, um Future Cooperative möglichst unabhängig zu machen. Je mehr Menschen den Umsatz der alternativen Anbieter ankurbeln, desto günstiger können diese ihr Angebot gestalten, was wiederum mehr Menschen den Zugang ermöglicht. Das Besondere an Future ist die Kombination des Aufbaus von Communitys vor Ort, vernetzt mit den Möglichkeiten digitaler Technologie. HB
And
reas
Pei
n/la
if
Bosch produziert als weltweit erster Industriekonzern seit Februar 2020 an seinen 400 Standorten CO2-neutral. Über 1000 Klimaprojekte laufen bei Bosch – Tendenz steigend. Donya-Florence Amer hat daraus für das Stiftungsunternehmen eine Geschäftsidee entwickelt. Vor viereinhalb Jahren kam die langjährige IBM-Beraterin zu den Schwaben. Seit eineinhalb Jahren führt die 49-jährige Betriebswirtin
die neu gegründete Bosch Climate Solutions GmbH. Sie berät große Mittelständler wie Freudenberg und Hansgrohe, wie sie dem Bei-spiel Bosch folgen können. Das CO2-Audit plus Masterplan dauert vier Wochen. Für das detaillierte CO2-Konzept braucht die leiden-schaftliche „Klimaverbesserin“ drei Monate. Sie ist mit ihrer Arbeit zu einer grünen Multiplikatorin geworden – und hat ihrem Arbeit-geber ein neues Geschäftsfeld eröffnet. Martin Buchenau
Grüne Pioniere
48 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Strategien für eine CO2-neutrale Wirtschaft
Innovation statt ResignationSie produzieren Biokraftstoff aus Stroh, bekämpfen Waldbrände per Nanosatellit, verhelfen
Ökoanleihen zum Durchbruch oder lassen Konzerne ergrünen: Deutschlands entscheidender Vorteil im Kampf gegen den Klimawandel sind die vielen klugen Köpfe, die an diesem Thema arbeiten.
Das Handelsblatt präsentiert die 50 grünen Pioniere der deutschen Wirtschaft.
Tobi
as A
de/
Bos
ch
1. Donya-Florence Amer
Gro
pyus
/PR
2. Markus Fuhrmann Der Name des Unternehmens ist eine Kampfansage: Gropyus leitet sich von Walter Gropius ab, dem Wegbereiter der modernen Architektur in Deutschland. Auch Gropyus-Chef Markus Fuhrmann möchte die Branche verändern. Gemeinsam mit Mitgründer Florian Fritsch will er mit holz-basierten Gebäuden das Wohnen nachhaltiger und billiger machen. Geplant wird deshalb bei der deutsch-österreichischen Firma
mit Künstlicher Intelligenz, Roboter bauen die Fertigteile, Software steuert die Gebäude. „Wir sehen uns nicht als Baufirma“, sagt Fuhrmann – man will eher Tech-Unternehmen sein: „Wir bauen Gebäude um die Technologie herum, nicht Technologie in die Gebäude hinein.“ So hat Gropyus ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das Licht, Strom, Jalousien und Türen per App regelt. Die Bau- und Gebäudewirtschaft trage 38 Prozent zur globalen CO2-Emis-sion bei. Das liegt nach Ansicht der Gropyus-Gründer auch daran, dass Zukunftstechnologien bisher kaum genutzt würden. Carsten Herz
2G E
nerg
y A
G
3. Christian Grotholt Die Technologie, mit der Christian Grotholts Unternehmen 2G Energy Geld verdient, gilt als besonders energieeffizient: Kraft-Wärme-Kopplung. Das börsennotierte Unternehmen baut Blockheizkraftwer-ke. „Wir benötigen ein saisonales Energiespeichersystem, um die regenerative Energieproduktion und deren Nutzung in Einklang zu bringen“, sagt der 53-jährige CEO. Heißt konkret: Seine Anlagen sollen die schwankende Stromproduktion von Wind und Sonne
ausgleichen. Während gewöhnli-che Blockheizkraftwerke oft Erdgas oder Öl verbrennen, bietet 2G Energy auch Kraftwerke mit Wasserstoffbetrieb an. Das Unternehmen hat bereits mehre-re Tausend Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen in 55 Ländern installiert. Viele werden noch konventionell betrieben, können aber umgerüs-tet werden. 2020 machte 2G Energy einen Umsatz von rund 247 Millionen Euro. Catiana Krapp
4. Anna Alex Als Anna Alex, damals noch Co-Chefin beim digitalen Herrenausstatter Outfittery, den CO2-Fußabdruck ihres Start-ups berechnen lassen wollte, staunte sie nicht schlecht. Denn den Prozess, der sich vor ihren Augen entfalte-te, hat sie als „wahnsinnig umständlich“ in Erinnerung. Statt per Knopfdruck Auskunft über die Emissionen des Treibhausgases zu erhalten, befüllte ein Berater händisch Excel-Lis-ten und überreichte Alex später ein PDF mit den Zahlen.„Ernsthaft?“, dachte Alex, die sich schon bei Outfittery intensiv mit Automatisierung und maschinellem Lernen befasst hatte. „Wenn der CO2-Fußabdruck die wichtigste Kennzahl dieses Jahrhunderts ist, müssen wir den doch auto-matisiert und fortwährend berechnen können. Und ihn genauso im Blick haben wie die Um-satzentwicklung.“ Alex sah nicht nur einen Bedarf, das Problem der intransparenten CO2-Emissionen anzuge-hen, sondern auch einen technischen Weg. Ende 2019 gründete sie gemeinsam mit Bene-dikt Franke Planetly. Auch Franke hat bereits Start-up-Erfahrung, er zählte einst zu den Mitgründern des Portals Helpling, das Rei-nigungskräfte vermittelt.
Die Software von Planetly erfasst alle klimarele-vanten Daten eines Unternehmens, die Firmen können dann nachvollziehen, wo die meisten CO2-Emissionen anfallen. Planetly analysiert unter anderem den CO2-Fußabdruck von BMW, Kärcher und Hellofresh. Doch Alex und Franke belassen es nicht bloß bei der Analyse. Auf Wunsch hilft Planetly seinen Kunden auch, Emissionen zu reduzieren oder durch Ausgleichsmaßnahmen zu kompen-sieren. Nach nur zwei Jahren hat das Start-up nach eigener Auskunft mit über 170 Unterneh-men zusammengearbeitet und so 1,5 Millionen Tonnen CO2 „sichtbar“ gemacht. Schließlich lasse sich nur managen, was sicht- und mess-bar ist, ist Alex überzeugt. Dass ab 2023 alle europäischen Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern Auskunft über ihre CO2-Emissionen erteilen müssen, kommt der 36-jährigen Unternehmerin entgegen. Weil die Zeit für die Dekarbonisierung drängt, will Alex, die sich 2019 der Klimainitiative „Leaders for Climate Action“ anschloss, mit ihrem Unternehmen möglichst schnell wachsen und ihr Geschäft skalieren. Purpose sei zwar schön, so Alex, für sie gelte das aber vor allem in Verbindung mit „echtem Impact“. Anna Gauto
Pla
netl
y
49WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
5. Dietrich Brockhagen Es ist eine komplizierte und für den Klima-schutz zentrale Aufgabe, die Dietrich Brock-hagen seit Jahren bearbeitet: den Flugverkehr klimafreundlicher zu machen. „Ich wollte das Thema positiv besetzen“, sagt der Gründer der Agentur Atmosfair. „Nicht nach dem Motto, du darfst nicht, sondern, es ist gut, mehr für den Klimaschutz zu bezahlen.“Getreu diesem Vorsatz bietet Atmosfair bereits seit 2004 Klimakompensationen an. Wer einen Flug bucht, kann auf der Atmosfair-Website berechnen, wie viel CO2 dabei entsteht, und exakt diese Menge durch eine Geldspende freiwillig kompensieren. Mit dem Geld betreibt Atmosfair Klimaschutzprojekte, bei denen Emissionen eingespart werden. Dazu zählen zum Beispiel effizientere holzbefeuerte Herde für mehrere Länder in Afrika, nicht aber die sonst häufig zur CO2-Kompensation genutzten Aufforstungsprojekte. Denn laut Atmosfair kann derzeit kein Projektpartner zusichern, dass ein Wald tatsächlich die 50 oder gar 100 Jahre stehen bleibe, die für einen positiven Klimaeffekt erforderlich sind. Seit der Gründung von Atmosfair sind die
Kompensationseinnahmen immer weiter gewachsen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 haben sie sich im Vergleich zu 2018 gar auf rund 21 Millionen Euro verdoppelt. Mittlerweile ist Brockhagen im Ringen um einen grüneren Flugverkehr einen Schritt weiter gegangen: Im Emsland hat die Atmosfair-Schwestergesell-schaft Solarbelt gemeinsam mit Siemens, der Lufthansa und dem Energieversorger EWE die weltweit erste Anlage gebaut, die CO2-neutrales E-Kerosin produziert. Der mögliche Flugzeug-treibstoff der Zukunft entsteht aus grünem Wasserstoff und CO2. Ab 2026 verpflichtet die Bundesregierung die Airlines in Deutschland, ihrem Treibstoff 0,5 Prozent nachhaltigen „Sustainable Aviation Fuel“ (SAF) beizumi-schen. Damit bräuchten die Fluggesellschaften 50.000 Tonnen synthetischen Treibstoff pro Jahr. Die Anlage im Emsland schafft jährlich 360 Tonnen. Brockhagen wünscht sich: „Deutschland sollte die Technologie für die Herstellung synthetischen Kerosins aus Strom, CO2 und Wasser zum Exportschlager machen und in fairen Energiepartnerschaften mit Entwicklungsländern aufbauen.“ Catiana Krapp
Uta
Wag
ner,
Mus
eum
Ritt
er
8. Alfred T. Ritter und Marli Hoppe-Ritter
Lange bevor ein Lieferkettengesetz Menschenrechte schützen sollte, vor fast genau 30 Jahren nämlich, befanden die Geschwister Marli Hoppe-Ritter und Alfred T. Ritter: Sie hätten eine Mitverantwortung für die Familien, die den Kakao für die familieneigene Schokoladen-marke Ritter Sport anbauen. Die Enkel der Firmengründer Alfred und Clara Ritter starteten ein Kakaoprojekt in Nicaragua, das den Bauern höhere Löhne zahlte, in Weiterbildung investierte und auf Agrarchemie verzichten sollte. Als das damalige Management gegen „die beiden Sozialromantiker“ aufbegehrte, musste es gehen. Unter der Führung von Alfred, der mit seiner Schwester und Mitinhaberin alle wichtigen Entscheidungen gemeinsam traf, entwickelte sich Ritter Sport zu einer Marke, die wie wenige andere für nachhaltige Schokolade steht. Als erster Tafelhersteller bezieht das Familienunternehmen für das gesamte Sortiment seit 2018 ausschließlich zertifi-zierten Kakao. Wenn es nach der Kunstsammlerin Hoppe-Ritter geht, soll Nachhaltigkeit immer Firmen-DNA bleiben. In einem Interview sagte sie auf die Frage, ob man nicht auch mit einem Riesen wie Nestlé fusionieren würde: „Solange mein Bruder und ich das Sagen haben, ist das völlig ausgeschlossen.“ Anna Gauto
Alli
anz
6. Line Hestvik Wenn Line Hestvik über Ökologie und Soziales spricht, dann ist sie schnell bei ihrem zentralen Punkt: „Wir wollen Nachhaltigkeit einfach und skalierbar machen.“ Seit diesem Jahr ist die 52-jährige Norwegerin Chief-Sustainability- Managerin bei der Allianz. Eine Position, die es davor in der 131-jährigen Geschichte von Europas größtem Versicherer nicht gab. Bis 2050 will die Allianz klimaneutral sein. Versiche-rungsprodukte von 100 Millionen Kunden in 70 Ländern müssen dazu umgebaut, Anlagegelder von 2,5 Billionen Euro entsprechend investiert werden. Rund 150.000 Mitarbeiter weltweit müssen diesen Weg mitgehen. Manche Anre-gung bringt Hestvik aus ihrer Heimat mit. In Norwegen sind bereits 56 Prozent der Neufahr-zeuge elektrisch unterwegs. Nun will die Allianz in Ladenetze und Batterietechnik investieren: „Wir wollen schließlich weiter fahren können als nur 300 Kilometer am Stück.“ Christian Schnell
/Pri
vat
9. Philipp Kolb Durch die Digitalisierung der Produktion kann Philipp Kolb für Henkel CO2 einsparen. Der Maschi-nenbauingenieur hat federführend an der Implementierung einer cloudbasierten Datenplattform mitgearbeitet, welche die weltweit 30 Standorte der Wasch- und Reinigungsmittelproduktion in Echtzeit verbindet. Kolb kann sehen, welche Fabrik besonders wenig Strom oder Wasser benö-tigt. Weil viele Prozesse ähnlich
sind, ermöglicht das Rückschlüsse darauf, wie energieintensivere Standorte ihre Produktion effizienter gestalten können – etwa indem sie Prozesse optimieren oder andere Maschinen nutzen. Seit Beginn des Projekts 2013 konnte Henkel pro Tonne Waschmittel 26 Prozent Energie einsparen, so Kolb. „Wir werden immer Energie brauchen, um unsere Produkte herzustellen. Doch das Ziel muss sein, sie möglichst effizient einzusetzen.“ Das scheint gelungen: Mehrere Henkel-Produktionsstandorte wurden vom World Economic Forum ausgezeichnet. Ab Januar will Henkel Wasch- und Reinigungsmittel am Stammsitz Düsseldorf klimaneutral herstellen. Michael Scheppe
Tobi
as B
ohm
/Fut
ure
Coo
pera
tive
7. Simon Köhl Schon als Schüler hat Simon Köhl die freie Lernplattform serlo.org gegründet, die mehr Bildungs-gerechtigkeit fördern will. 2019 erhielt er dafür das Bundesver-dienstkreuz. Future Cooperative ist nun sein zweites, neues Start-up. Damit will er Städte weltweit nachhaltig verändern. Future Cooperative hilft dabei, sich einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Unternehmen in einer Stadt wirklich fair und nachhaltig
wirtschaften, indem diese Firmen in einer „Future Map“ angezeigt werden. Als Genossenschaft angelegt, zahlen die Mitglieder Beiträ-ge, um Future Cooperative möglichst unabhängig zu machen. Je mehr Menschen den Umsatz der alternativen Anbieter ankurbeln, desto günstiger können diese ihr Angebot gestalten, was wiederum mehr Menschen den Zugang ermöglicht. Das Besondere an Future ist die Kombination des Aufbaus von Communitys vor Ort, vernetzt mit den Möglichkeiten digitaler Technologie. HB
And
reas
Pei
n/la
if
Um das Risiko beim Einstieg in ökologische Energieprojekte einschät-zen zu können, braucht man Menschen wie Michael Schrempp. Der Mathematiker leitet bei der Munich Re den Bereich Green Tech Solutions. Büros in München, New York, Hongkong und Tokio entwickeln beim Rückver-sicherer Versicherungslösun-gen für erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienztechnologien, etwa Windräder, Solaranlagen und Batteriespei-cher. Dafür hat der 45-jährige Mathematiker Methoden entwickelt, die dem Risiko solcher Anlagen einen Preis geben. Im Branchenjar-gon stellt Michael Schrempp mit seinem Team die sogenannte Bankfähigkeit her. Aus Investorensicht kommt das einer Art Gütesie-gel gleich. Deren Sichtweise lautet: Wenn ein großer Versicherer wie die Munich Re eine Versicherungsdeckung für ein Ökoprojekt anbietet, dann können Investoren dort beruhigt Geld anlegen. In der Folge wird die Finanzierung neuer Technologien erleichtert.Die Risikoeinschätzung, die Michael Schrempp mit seinem weltwei-ten Team bietet, gilt in der Branche als Avantgarde. Zu seinem Netzwerk gehören Energieversorger, Projektentwickler und Investo-ren, Branchenexperten sowie Forschungs- und Zertifizierungsinstitu-te. Deren Ziele gehen in eine Richtung: die Energiewende zu be-schleunigen. Christian Schnell
Mitarbeiter, Umsatz, Gewinn? Für Christian Kroll sind das trotz BWL-Studium vernachlässigbare Katego-rien. Der Unternehmer misst seinen Erfolg in Bäumen, die seine Firma Ecosia seit der Gründung 2009 gepflanzt hat. Mit seiner Internet-Suchmaschi-ne Ecosia hat Kroll sich ein Geschäftsmodell aus-gedacht, das Geld aus dem digitalen Anzeigengeschäft in den Klimaschutz umlei-tet. Wenn Werbetreibende eine Anzeige bei Ecosia schalten, dann bezahlt die Firma mit den Werbeeinnahmen Mitarbeiter und Unkosten und investiert den Rest in Aufforstung. Während dieser Text geschrieben wird, nähert sich die Zahl der neu gepflanzten Bäume 140 Millionen. 15 Millionen Menschen nutzen laut Ecosia die umweltfreundliche Suchmaschine, doch das reicht Kroll noch lange nicht: Zusammen mit drei anderen Unternehmern und der Investorin Daria Saharova hat der Berliner jüngst den „World Fund“ gegründet. Es soll der größte Fonds für Klimatechnologie in Europa werden. Ziel ist, bis 2022 350 Millionen Euro für Investments in junge Firmen einzusammeln, mehr als die Hälfte haben sie schon. Larissa Holzki
Unter der Führung von Sascha Klaus hat die Berlin Hyp eine grüne Vorreiterrol-le eingenommen. Die Immobilienbank ist der aktivste Emittent soge-nannter grüner Pfandbrie-fe in Deutschland. Außer-dem hat sie als erstes Kreditinstitut weltweit Sustainability- Linked Bonds emittiert, bei denen der Zinskupon an das Erreichen von Klimazielen für das eigene Kreditportfo-
lio gekoppelt ist: Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß der finanzierten Immobilien um 40 Prozent gesenkt werden. Verfehlt die Bank das Ziel, muss sie höhere Zinsen an die Anleihezeichner zahlen. Der knapp 26 Milliarden Euro große Darlehensbestand soll zudem bis 2025 zu einem Drittel aus grünen Immobilienkrediten bestehen. So ambitioniert und transparent sind andere Immobilienfinanzierer nicht. Bankchef Klaus sieht darin einen Beitrag zur Bewältigung einer „großen gesellschaftlichen Herausforderung“. Nicole Katzung
Grüne Pioniere
50 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
13. Kristina Jeromin Die 38-jährige Wiesbadenerin wirkt seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Finanzmarkt und Politik. Bis Ende vergangenen Jahres war sie Nachhaltigkeitschefin der Deutschen Börse, bis Februar 2021 außerdem Vizevorsitzende des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregie-rung. Das Innovationspotenzial des Finanz-markts ist Kristina Jeromin nach 13 Berufsjah-ren bei der Deutschen Börse daher ebenso vertraut wie die Bedeutung der richtigen Regeln. „Der Finanzmarkt beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber es gibt keine Standards – und damit auch keine Sicher-heit vor bewusstem oder unabsichtlichem Greenwashing“, sagt sie. Ein verbindlicher regulatorischer Rahmen wäre aus Jeromins Sicht ein entscheidender Faktor, um das Potenzi-al der Finanzbranche für den ökologischen Umbau der Wirtschaft zu heben: „Ohne Stan-dards ist die Gefahr groß, dass private und institutionelle Anleger das Vertrauen verlieren und nicht in solche Produkte investieren wollen – zulasten der Unternehmen, die ihre Transfor-mation über diesen Hebel gern finanzieren würden.“Jeromin war schon während ihres Politik- und Philosophie-Studiums Werkstudentin bei der
Deutschen Börse und heuerte dort nach dem Examen im Bereich Corporate Responsibility an, bevor sie die Leitung des gruppenweiten Nach-haltigkeitsmanagements übernahm. Gern hätte Jeromin an den richtigen Leitplanken noch konkreter mitgewirkt: Sie trat bei der Bundestagswahl für die Grünen an, verpasste aber den Einzug ins Parlament. Seit Oktober ist Jeromin zurück aus dem Wahl-kampf und wieder in Vollzeit Co-Geschäftsführe-rin des Green & Sustainability Finance Cluster Germany (GSFC), das 2018 von Deutscher Börse und hessischem Wirtschaftsministerium gegrün-det wurde. Jeromin hatte das Cluster mitinitiiert, das sie seither mit Karsten Löffler leitet. Das GSFC, zu dessen Mitgliedern neben der Börse unter anderem große Banken und die Rating-agentur Moody’s zählen, will der Finanzbranche bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsvorschrif-ten helfen. „Die Regulierung soll schnell in der Praxis ankommen, damit die Finanzbranche einen positiven Unterschied bei der Finanzie-rung der Transformation der Wirtschaft machen kann“, erklärt Jeromin. Denn: „Geld entfaltet seine Wirkung – im positiven oder im negativen Sinne. Wir müssen verstehen, was die Allokatio-nen von Kapital auslösen.“ Yasmin Osman
Ber
lin H
yp, A
nnik
a Le
vin
10. Sascha Klaus
Ecos
ia
12. Christian Kroll
Ren
ato
Rib
eiro
Alv
es
11. Michael Schrempp
Mun
ich
Re
51WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
GLS
/Pat
rick
Tie
dtke
14. Thomas Jorberg Zum Bankgeschäft kam Thomas Jorberg eher zufällig. Er war der erste Lehrling der alternativ angehauchten GLS Bank – und blieb. Mittlerweile gehört Jorberg seit fast 30 Jahren dem Vorstand der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken an. Seit 2003 ist er Vorstands-sprecher der mit einer Bilanzsumme von rund neun Milliarden Euro größten Nachhaltigkeitsbank in Deutschland. Der heute 64-jährige Ökonom hat den Weg des genossenschaftlichen Geldhau-ses wesentlich geprägt. Als Jorberg 1986 bei der GLS Bank anfing, hatte sie gerade einmal 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-ter, viele davon in Teilzeit. Heute sind es etwa 750 Beschäftigte.Das Bochumer Institut gilt als eines der wenigen Geldhäuser, die Kredit- wie Anlageentscheidungen heute schon nach strengen Nachhaltigkeitskriterien treffen. Für Atom- oder Kohleenergie, für Gen-technik in der Landwirtschaft, Massentier-haltung oder Waffen gibt es bei der GLS zum Beispiel keinen Cent Kredit. Jorberg warnt auch schon seit Längerem vor verstecken Klimarisiken in den Bilanzen der traditionellen Banken – insbesondere wenn bei einer plötzlichen Wende in der Klimapolitik kurzfristig Industrieanlagen abgeschaltet werden müssten, weil sie zu viel CO2 emittieren. Um das Umsteuern zu beschleunigen, fordert Jorberg einen höheren CO2-Preis.Selbst die Umweltorganisation Urgewald,
die sonst Banken regelmäßig für zu viele Kredite an Klimasünder attackiert, lobt die GLS Bank. Urgewald-Expertin Agnes Dieckmann meint, die GLS Bank begleite die „echte Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft“ – und das Wort „Transformation“ werde nicht miss-braucht, um zum Beispiel der fossilen Industrie weiter zu dienen, wie Urgewald es bei anderen Banken immer wieder feststelle.„Mich hat von Anfang an fasziniert, die Bank als eine Initiatorin für Unternehmun-gen zu sehen – und nicht Gewinnmaximie-rung als Ziel“, sagt Jorberg über seine Motivation, der GLS Bank sein ganzes Berufsleben treu zu bleiben. „Ökologie und Wirtschaft stehen eben nicht im Widerspruch. Die GLS Bank zeigt, dass das funktioniert: Die Bank wächst, sie hat ausreichend Eigenkapital und die Risiken im Griff. Wir sehen uns hier als Vorreiter.“Obwohl das Thema Nachhaltigkeit en vogue ist, agiert die GLS Bank – zu Beginn insbesondere als Finanzierer von freien Kindergärten und Schulen aufgetre-ten – noch immer in der Nische. Sie zählt 315.000 Privat- und Firmenkunden und führt rund 255.000 Girokonten. Mehrere Sparkassen und Volksbanken sind mit Blick auf Kundenzahl wie Bilanzsumme um einiges größer. „Für viele Kundinnen und Kunden ist der Wechsel der Bank immer noch ein großes Hemmnis“, meint Jorberg. Elisabeth Atzler
Anzeige
Um das Risiko beim Einstieg in ökologische Energieprojekte einschät-zen zu können, braucht man Menschen wie Michael Schrempp. Der Mathematiker leitet bei der Munich Re den Bereich Green Tech Solutions. Büros in München, New York, Hongkong und Tokio entwickeln beim Rückver-sicherer Versicherungslösun-gen für erneuerbare Energien und Energieeffi-
zienztechnologien, etwa Windräder, Solaranlagen und Batteriespei-cher. Dafür hat der 45-jährige Mathematiker Methoden entwickelt, die dem Risiko solcher Anlagen einen Preis geben. Im Branchenjar-gon stellt Michael Schrempp mit seinem Team die sogenannte Bankfähigkeit her. Aus Investorensicht kommt das einer Art Gütesie-gel gleich. Deren Sichtweise lautet: Wenn ein großer Versicherer wie die Munich Re eine Versicherungsdeckung für ein Ökoprojekt anbietet, dann können Investoren dort beruhigt Geld anlegen. In der Folge wird die Finanzierung neuer Technologien erleichtert.Die Risikoeinschätzung, die Michael Schrempp mit seinem weltwei-ten Team bietet, gilt in der Branche als Avantgarde. Zu seinem Netzwerk gehören Energieversorger, Projektentwickler und Investo-ren, Branchenexperten sowie Forschungs- und Zertifizierungsinstitu-te. Deren Ziele gehen in eine Richtung: die Energiewende zu be-schleunigen. Christian Schnell
Mitarbeiter, Umsatz, Gewinn? Für Christian Kroll sind das trotz BWL-Studium vernachlässigbare Katego-rien. Der Unternehmer misst seinen Erfolg in Bäumen, die seine Firma Ecosia seit der Gründung 2009 gepflanzt hat. Mit seiner Internet-Suchmaschi-ne Ecosia hat Kroll sich ein Geschäftsmodell aus-gedacht, das Geld aus dem digitalen Anzeigengeschäft in den Klimaschutz umlei-tet. Wenn Werbetreibende eine Anzeige bei Ecosia schalten, dann bezahlt die Firma mit den Werbeeinnahmen Mitarbeiter und Unkosten und investiert den Rest in Aufforstung. Während dieser Text geschrieben wird, nähert sich die Zahl der neu gepflanzten Bäume 140 Millionen. 15 Millionen Menschen nutzen laut Ecosia die umweltfreundliche Suchmaschine, doch das reicht Kroll noch lange nicht: Zusammen mit drei anderen Unternehmern und der Investorin Daria Saharova hat der Berliner jüngst den „World Fund“ gegründet. Es soll der größte Fonds für Klimatechnologie in Europa werden. Ziel ist, bis 2022 350 Millionen Euro für Investments in junge Firmen einzusammeln, mehr als die Hälfte haben sie schon. Larissa Holzki
Unter der Führung von Sascha Klaus hat die Berlin Hyp eine grüne Vorreiterrol-le eingenommen. Die Immobilienbank ist der aktivste Emittent soge-nannter grüner Pfandbrie-fe in Deutschland. Außer-dem hat sie als erstes Kreditinstitut weltweit Sustainability- Linked Bonds emittiert, bei denen der Zinskupon an das Erreichen von Klimazielen für das eigene Kreditportfo-
lio gekoppelt ist: Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß der finanzierten Immobilien um 40 Prozent gesenkt werden. Verfehlt die Bank das Ziel, muss sie höhere Zinsen an die Anleihezeichner zahlen. Der knapp 26 Milliarden Euro große Darlehensbestand soll zudem bis 2025 zu einem Drittel aus grünen Immobilienkrediten bestehen. So ambitioniert und transparent sind andere Immobilienfinanzierer nicht. Bankchef Klaus sieht darin einen Beitrag zur Bewältigung einer „großen gesellschaftlichen Herausforderung“. Nicole Katzung
Grüne Pioniere
50 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
13. Kristina Jeromin Die 38-jährige Wiesbadenerin wirkt seit Jahren an der Schnittstelle zwischen Finanzmarkt und Politik. Bis Ende vergangenen Jahres war sie Nachhaltigkeitschefin der Deutschen Börse, bis Februar 2021 außerdem Vizevorsitzende des Sustainable-Finance-Beirats der Bundesregie-rung. Das Innovationspotenzial des Finanz-markts ist Kristina Jeromin nach 13 Berufsjah-ren bei der Deutschen Börse daher ebenso vertraut wie die Bedeutung der richtigen Regeln. „Der Finanzmarkt beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit, aber es gibt keine Standards – und damit auch keine Sicher-heit vor bewusstem oder unabsichtlichem Greenwashing“, sagt sie. Ein verbindlicher regulatorischer Rahmen wäre aus Jeromins Sicht ein entscheidender Faktor, um das Potenzi-al der Finanzbranche für den ökologischen Umbau der Wirtschaft zu heben: „Ohne Stan-dards ist die Gefahr groß, dass private und institutionelle Anleger das Vertrauen verlieren und nicht in solche Produkte investieren wollen – zulasten der Unternehmen, die ihre Transfor-mation über diesen Hebel gern finanzieren würden.“Jeromin war schon während ihres Politik- und Philosophie-Studiums Werkstudentin bei der
Deutschen Börse und heuerte dort nach dem Examen im Bereich Corporate Responsibility an, bevor sie die Leitung des gruppenweiten Nach-haltigkeitsmanagements übernahm. Gern hätte Jeromin an den richtigen Leitplanken noch konkreter mitgewirkt: Sie trat bei der Bundestagswahl für die Grünen an, verpasste aber den Einzug ins Parlament. Seit Oktober ist Jeromin zurück aus dem Wahl-kampf und wieder in Vollzeit Co-Geschäftsführe-rin des Green & Sustainability Finance Cluster Germany (GSFC), das 2018 von Deutscher Börse und hessischem Wirtschaftsministerium gegrün-det wurde. Jeromin hatte das Cluster mitinitiiert, das sie seither mit Karsten Löffler leitet. Das GSFC, zu dessen Mitgliedern neben der Börse unter anderem große Banken und die Rating-agentur Moody’s zählen, will der Finanzbranche bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsvorschrif-ten helfen. „Die Regulierung soll schnell in der Praxis ankommen, damit die Finanzbranche einen positiven Unterschied bei der Finanzie-rung der Transformation der Wirtschaft machen kann“, erklärt Jeromin. Denn: „Geld entfaltet seine Wirkung – im positiven oder im negativen Sinne. Wir müssen verstehen, was die Allokatio-nen von Kapital auslösen.“ Yasmin Osman
Ber
lin H
yp, A
nnik
a Le
vin
10. Sascha Klaus
Ecos
ia
12. Christian Kroll
Ren
ato
Rib
eiro
Alv
es
11. Michael Schrempp
Mun
ich
Re
51WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215G
LS/P
atri
ck T
iedt
ke
14. Thomas Jorberg Zum Bankgeschäft kam Thomas Jorberg eher zufällig. Er war der erste Lehrling der alternativ angehauchten GLS Bank – und blieb. Mittlerweile gehört Jorberg seit fast 30 Jahren dem Vorstand der Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken an. Seit 2003 ist er Vorstands-sprecher der mit einer Bilanzsumme von rund neun Milliarden Euro größten Nachhaltigkeitsbank in Deutschland. Der heute 64-jährige Ökonom hat den Weg des genossenschaftlichen Geldhau-ses wesentlich geprägt. Als Jorberg 1986 bei der GLS Bank anfing, hatte sie gerade einmal 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-ter, viele davon in Teilzeit. Heute sind es etwa 750 Beschäftigte.Das Bochumer Institut gilt als eines der wenigen Geldhäuser, die Kredit- wie Anlageentscheidungen heute schon nach strengen Nachhaltigkeitskriterien treffen. Für Atom- oder Kohleenergie, für Gen-technik in der Landwirtschaft, Massentier-haltung oder Waffen gibt es bei der GLS zum Beispiel keinen Cent Kredit. Jorberg warnt auch schon seit Längerem vor verstecken Klimarisiken in den Bilanzen der traditionellen Banken – insbesondere wenn bei einer plötzlichen Wende in der Klimapolitik kurzfristig Industrieanlagen abgeschaltet werden müssten, weil sie zu viel CO2 emittieren. Um das Umsteuern zu beschleunigen, fordert Jorberg einen höheren CO2-Preis.Selbst die Umweltorganisation Urgewald,
die sonst Banken regelmäßig für zu viele Kredite an Klimasünder attackiert, lobt die GLS Bank. Urgewald-Expertin Agnes Dieckmann meint, die GLS Bank begleite die „echte Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft“ – und das Wort „Transformation“ werde nicht miss-braucht, um zum Beispiel der fossilen Industrie weiter zu dienen, wie Urgewald es bei anderen Banken immer wieder feststelle.„Mich hat von Anfang an fasziniert, die Bank als eine Initiatorin für Unternehmun-gen zu sehen – und nicht Gewinnmaximie-rung als Ziel“, sagt Jorberg über seine Motivation, der GLS Bank sein ganzes Berufsleben treu zu bleiben. „Ökologie und Wirtschaft stehen eben nicht im Widerspruch. Die GLS Bank zeigt, dass das funktioniert: Die Bank wächst, sie hat ausreichend Eigenkapital und die Risiken im Griff. Wir sehen uns hier als Vorreiter.“Obwohl das Thema Nachhaltigkeit en vogue ist, agiert die GLS Bank – zu Beginn insbesondere als Finanzierer von freien Kindergärten und Schulen aufgetre-ten – noch immer in der Nische. Sie zählt 315.000 Privat- und Firmenkunden und führt rund 255.000 Girokonten. Mehrere Sparkassen und Volksbanken sind mit Blick auf Kundenzahl wie Bilanzsumme um einiges größer. „Für viele Kundinnen und Kunden ist der Wechsel der Bank immer noch ein großes Hemmnis“, meint Jorberg. Elisabeth Atzler
Anzeige
Der Diplom-Geograf Thomas Tappertzhofen hat für den Handelskonzern Schwarz-Gruppe schon einige grüne Innovationen vorangetrieben. So war er für die Einführung von Ladesäulen bei den Töch-tern Lidl und Kaufland verantwortlich, mittlerwei-le sind es über 2000. Tappertzhofens neuestes Projekt: Aus der Silphie-Pflanze will die Schwarz-
Tochter Prezero nachhaltige Verpackungen herstellen. Der Clou: Die Pflanze kann zugleich als Zellstoffersatz und für die Biogasgewinnung genutzt werden. „Die Silphie bietet auch für Landwirte eine zukunftsfähige Perspektive, da sie unter anderem insektenfreundlich ist, im Boden CO2 einspeichert und ihn vor Wind- und Wassererosionen schützt“, erklärt Tappertz-hofen. Mehrere Studien haben die positiven Klimawirkungen bestä-tigt. Nun werden Verpackungen bei Lidl und Kaufland schrittweise auf den neuen Rohstoff umgestellt. Florian Kolf
Grüne Pioniere
52 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
16. Thomas Tappertzhofen
Get
ty Im
ages
Ent
erta
inm
ent
19. Michael Popp Die Natur ist der Ausgangspunkt für das Unternehmen Bionorica, das Medizin aus Heilpflanzen herstellt. Deswegen ist es für Inhaber und Vorstandschef Michael Popp zentrales Anliegen, sie zu schützen und zu erhalten. Dafür betreibt der 62-jährige Pharma-zeut mit seinem Unternehmen einigen Auf-wand: Die Heilpflanzen stammen aus kontrol-liert nachhaltigem, teils regionalem Anbau. Nachdem ihnen in der Herstellung die Wirkstof-fe entzogen worden sind, werden die Reste komplett zu biologischem Nährstoffhumus kompostiert. Die Firmenzentrale in Neumarkt in der Oberpfalz wurde schon 2007 nach Ökostan-dards erbaut, in der Produktion werden CO2-spa-rende moderne Dampfkessel verwandt. Popps Vision: mit Bionorica perspektivisch klimaposi-tiv zu werden, also mehr CO2 aus der Luft zu entnehmen als auszustoßen. Die direkten Emissionen kompensiert das Unternehmen bereits durch Investitionen in zertifizierte Aufforstungsprojekte. Jetzt werden auch die vor- und nachgelagerten Emissionen erfasst, etwa bei Zulieferern. Maike Telgheder
/Pri
vat
15. Janina Nakladal Wie groß ihr Einfluss sein könnte, hat Janina Nakla-dal erst nach und nach erkannt: Als „Global Director of Sustainability“ kümmert sie sich beim Softwareunternehmen Celonis darum, dass das Unternehmen ökologisch, sozial und wirtschaftlich handelt. In ihrer Rolle kann sie das Thema jedoch auch bei den Celonis-Kunden vorantreiben – darunter
Lufthansa, Siemens, Eon und BP. „Mit unserem Produkt beeinflussen wir, wie Prozesse funktionieren“, sagt Nakladal und gibt ein Beispiel: „Unsere Software kann praktisch wie Google Maps berechnen, welches Verkehrsmittel und welche Bündelung von Bestellungen aus Emissionsperspektive am besten ist.“ Bevor die Betriebswirtin im Juli 2020 zur Nachhaltig-keitschefin wurde, leitete sie den Bereich Wissenschaftskooperatio-nen. Dabei ging es darum, das Wissen über Celonis’ „Process Mi - ning“-Technologie zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Larissa Holzki
Res
ourc
ify
17. Gary Lewis und Pascal Alich
Jeden Betrieb in die Lage zu versetzen, 100 Prozent des eigenen Abfalls zu recyceln, lautet das Ziel des Hamburger Start-ups Resour-cify. Die 2015 von Gary Lewis und Pascal Alich gegründete Firma bietet dazu eine Cloud-basierte Software. Für Industriekunden macht sie auf einer Onlineplattform sichtbar, wie viel Holz, Metall, Papier oder sonstige Abfälle diese regelmäßig entsorgen – unterteilt in rund 200 Abfallarten. Zu den Kunden zählen nach Angaben des Start-ups Firmen wie Bosch Packaging Technology und Hornbach. Aus der Abfallwirtschaft habe man 220 Unternehmen mit der Plattform verbunden. Durch automatisierte, digitale Abläufe werde Recycling effizienter und transparenter, wirbt die Softwarefirma: Unternehmen könnten mehr recyceln, Kosten senken und wertvolle Abfälle wie Kupfer oder Hartplastik in vermarktbare Materialien umwandeln. Vor wenigen Wochen sammelten die Hamburger in einer zweiten Finanzierungsrunde drei Millionen Euro ein, angeführt von dem Frühphaseninvestor Speedinvest. Christoph Schlautmann
Pri
vat
Hof
foto
graf
en, E
arly
bird
18. Ferry & Fabian Heilemann Ferry Heilemann beschreibt sich selbst als „Klimaaktivisten“. Wer jetzt an Blockaden von Atomkraftwerken oder Hungerstreiks vor dem Reichstag denkt, muss das Bild aber revidieren: Ferry Heilemann und sein älterer Bruder Fabian Heilemann gehen die Klimakrise unternehme-risch an. „Unsere Vision ist, die gesamte Digital-wirtschaft in der westlichen Welt zu dekarboni-sieren und klimaneutral zu machen“, sagt Ferry Heilemann. Ihr erstes großes Geld haben sie mit dem Gutschein-Start-up Daily Deal gemacht, das sie 2011 für mehr als 100 Millionen Dollar an Google verkauft haben. Mit Klimaschutz hatte all das noch nichts zu tun. Doch mit dem Vermögen entwickelten die Brüder auch ein neues Verantwortungsbewusstsein. Heute investieren sie ihr Geld unter anderem über das eigene Family-Office „Pirate Impact“. Dieses Kapital soll zu 80 Prozent in Start-ups gehen, die Klimatechnologie entwickeln und eine nachhaltigere Wirtschaft fördern, 20 Prozent stehen für soziale Themen wie Chancen-gleichheit bereit. Wagniskapitalinvestments sind aus ihrer Sicht der größtmögliche Hebel, um den Wandel anzuschieben. Ferry Heilemann
widmet sich diesen Investments in Vollzeit. Hervorzuheben unter den Aktivitäten der Brüder ist zudem die Initiative „Leaders for Climate Action“, die die Heilemanns 2019 mitgegründet haben. Dort schließen sich Unternehmen zusammen, die ihre Klimabilanz verbessern wollen und notwendige CO2-Emissio-nen mit Ausgleichsmaßnahmen kompensieren. Knapp 1200 Firmen – vor allem aus der Start-up-Szene – sind inzwischen dabei. Zudem zahlrei-che Wagniskapitalfinanzierer, von denen viele inzwischen eine „Klimaklausel“ bei sich einge-führt haben: Damit verpflichten sich Investoren und ihre Portfoliofirmen gemeinsam zur Klima-verträglichkeit. Fabian Heilemann hat diese Klausel auch beim Münchener Start-up-Finanzie-rer Earlybird eingeführt, bei dem er einer der Partner ist. In seinem Buch „Climate Action Guide“, das im Frühjahr erschienen ist, zeigt Ferry Heilemann Wege auf, wie Unternehmen ihren klimatischen Fußabdruck verringern können, und verweist auf beispielhafte Ansätze. Und er beschreibt, was ihn antreibt: „Die Krise, vor der wir stehen, bedroht alles, was ich liebe und schätze und wofür ich dankbar bin.“ Larissa Holzki
Baustoffe sind derzeit oft Mangelware, die Preise hoch. Umso interessanter wird es, wenn alte Materialien wiederverwendet werden – auch unter dem Aspekt des nachhaltigen Bauens. Doch das scheitert vielfach schon am Wissen, welche Stoffe überhaupt verwendet wurden. Der 61-Jäh-rige Architekt Thomas Rau will so eine Übersicht nun schaffen. Der Deutsche, der in den Niederlanden lebt, hat Madaster gegründet, dessen deutscher Ableger im März startete. Eine Online-Datenbank, die für den Hochbau ähnlich relevante Informa-
tionen liefern soll, wie es Kataster für Liegenschaften tun. Während es bei Grundstücken um Lage, Größe und Eigentümer geht, speichert Madaster, wie viel Tonnen Stahl und welches Holz verbaut sind. Das Ziel: Kreislaufwirtschaft, die für mehr Nachhaltigkeit sorgt. „Damit werden Gebäude Materialdepots, und wir schreiben Materialien auf und nicht mehr ab“, sagt Rau. Carsten Herz
53WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
dm
23. Stefanie Schönherr Schon als Teenagerin sei sie „eher öko“ gewesen, sagt Stefanie Schönherr. Heute wacht die studierte Betriebswirtin als Nachhaltigkeitsmanagerin im dm-Produktmanagement über etwa 30 Eigenmarken des Drogerieunternehmens und tüftelt an der Transparenz der Lieferketten. Sie trug dazu bei, dass dm 2008 Frischfaser-Kartonagen auf FSC-Zertifizierung umstellte. Bereits 2009 führte dm erste recycelte Kunststofffla-schen ein. Schönherr begleitete zudem die neue „umweltneutrale“ Submarke Pro Climate in Zusammenarbeit mit der TU
Berlin und ist Gründungsmitglied des Forums Nachhaltiges Palmöl. Für ihr Engagement erhielten Schönherr und viele der dm-Marken Auszeichnungen, wie den B.A.U.M. Umweltpreis, den Green Brand Award oder den deutschen Nachhaltigkeitspreis. Durch ihre Arbeit gibt Schönherr Verbrauchern die Chance, per Kaufentscheidung zum Umweltschutz beizutragen. Anna Gauto
Hel
mut
-G.-W
alth
er-K
linik
um G
mbH
24. Markus Semmelroch Beim Technischen Leiter des Krankenhauses Lichtenfels laufen alle Fäden zusammen, die zur Steuerung des „Green Hospitals“ notwen-dig sind, das derzeit als Leuchtturmprojekt in Deutschland gilt. Photovoltaikanlagen in der Außenfassade, Kabelkanäle aus Alu statt Kunststoff sowie Licht- und Lärmminimie-rungskonzepte: Das nach dem Passivhaus-prinzip 2018 fertiggestellte Krankenhaus der Regiomed-Gruppe soll so klimaschonend wie möglich sein, ohne den Betrieb oder das Wohl der Patienten einzuschränken. Das ist im Alltag nicht immer ganz einfach: In einem
Niedrigenergiehaus darf man beispielsweise nicht lüften, wie man möchte. Der 49-jährige Markus Semmelroch misst an tausend Datenpunkten gemeinsam mit Projektteams aus den Hochschulen Hof, Bayreuth und Coburg, welche Maßnahmen am meisten für den Klimaschutz bringen. Die Endauswertung der Daten soll 2022 erfolgen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass viel Energie beim Heizen eingespart werden konnte, Strom wegen der steigenden Zahl tech-nischer Geräte dagegen kaum. Maike Telgheder
Wer
ner
& M
ertz
/Her
bert
Pie
l
22. Reinhard Schneider „Die ökologische Transformation wird oft mit dem Verweis auf ein Henne-Ei-Problem aufgehalten“, schimpft der Inhaber von Werner & Mertz, dem Produzenten der Putzmittelmarke Frosch. Weil viele Konzerne mit Verweis auf die höheren Kosten von recyceltem Material noch zögerten, würden die Stückkosten nicht sinken. „Wir legen dann einfach mal ein Ei“, sagt Reinhard Schneider. Das Ergebnis: Frosch hat mittler-weile mehr als 530 Millionen Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff her-gestellt. Üblicherweise stammt der Großteil
des Recyclats von geschredderten Pfandflaschen. Das gemischte Plastik aus dem Gelben Sack zu verwenden ist deutlich aufwendiger, deshalb schrecken viele Unternehmen davor zurück. Frosch dagegen hat im vergangenen Jahr den Anteil des Recyclats aus dem Gelben Sack von 20 auf 50 Prozent gestei-gert. „Wir können das ohne Qualitätseinbußen tun, weil wir die Sortiertechnolo-gie mit unseren Partnern weiterentwickelt haben“, sagt Schneider. Florian Kolf
20. Mazen Rizk Mit nachhaltigem Fleischersatz die Welt verbessern – das ist die Vision des Biotech-nologen Mazen Rizk. Sein Hamburger Start-up Mushlabs nutzt dafür Pilze. Jedoch nicht den sichtbaren Fruchtkörper, sondern das fadenförmige Wurzelgeflecht (Myzel) von Speisepilzen wie Pfifferling oder Shiitake.„Das Myzel braucht im Labor nur vier Tage bis zur Ernte, der Fruchtkörper hingegen bis zu 40 Tage im Pilzanbau“, erklärt der 36-Jährige. Sojabohnen für Tofu etwa sind sogar erst nach 140 Tagen erntereif. Ein weiterer Vorteil des Pilzmyzels: Es kann in geschlossenen Räumen das ganze Jahr hindurch überall auf der Welt gezüchtet werden. Denn Pilze betreiben anders als Pflanzen keine Fotosynthese. „Wir brau-chen im Labor weder Dünger noch Pestizi-de und nur wenig Wasser“, betont Rizk.Die Pilze werden zudem nachhaltig gefüt-tert – mit Reststoffen aus der Lebensmittel-produktion wie Getreidehülsen, Kaffeesatz oder Bananenschalen. Diese werden sonst bestenfalls als Tierfutter verwertet. Pilze sind Allesfresser, die aus verschiedenstem Material ihre Nährstoffe gewinnen können. Das Myzel vermehrt sich durch Fermentati-on in Bioreaktoren zu einem protein- und ballaststoffreichen Lebensmittel. Mushlabs entwickelt daraus Fleischersatz-produkte wie zum Beispiel Hackfleisch, Frikadellen oder Wurst. Das Pilzmyzel enthält wichtige Aminosäuren, die sonst nur in Fleisch vorkommen. In Burgern aus Tofu oder Erbsen müssen diese Aminosäu-ren künstlich zugesetzt werden. „Unser
Fleischersatz ist sehr gesund, schont Klima und Umwelt“, sagt Rizk, der 2010 aus dem Libanon zur Promotion an die Technische Universität Hamburg kam.Die Methode der Fermentation ist uralt und wird von einigen Foodtechs genutzt. Auch die britische Firma Qorn verwendet für ihre Fleischersatzprodukte schon länger ein Myzel, allerdings von Schimmel-pilzen statt von Speisepilzen. Vieh- und Fischzucht sind laut „Fleisch-atlas“ für 14,5 Prozent der globalen Emis-sionen von Treibhausgas verantwortlich. Das ist mehr als der weltweite Straßen- und Flugverkehr zusammen. Auch deshalb verzichten Immer mehr Verbraucher bewusst auf Fleisch und Milch. Der Markt für alternative Proteine wächst entspre-chend rasant – 2035 soll die weltweite Produktion bei 97 Millionen Tonnen liegen, schätzt die Beratungsfirma Boston Consul-ting. 22 Millionen Tonnen davon sollen aus Fermentation stammen. Mushlabs hat rund zwölf Millionen Euro Kapital eingesammelt – etwa von Bitbur-ger Ventures und Atlantic Food Labs. Food- Labs-Investor Christophe Maire sieht in Mushlabs „großes Potenzial“. 2018 gegrün-det, hat die Firma heute 40 Mitarbeiter. Neben der Massenproduktion ist die größte Herausforderung die Zulassung in der EU. „Foodtechs brauchen mehr Unterstützung von der Politik“, fordert Rizk. „Denn unsere Technologie ermöglicht uns, in den kommenden Jahren Fleisch-ersatz überall auf der Welt umweltscho-nend herzustellen.“ Katrin Terpitz
Mad
aste
r
21. Thomas Rau
Mus
hlab
s
Der Diplom-Geograf Thomas Tappertzhofen hat für den Handelskonzern Schwarz-Gruppe schon einige grüne Innovationen vorangetrieben. So war er für die Einführung von Ladesäulen bei den Töch-tern Lidl und Kaufland verantwortlich, mittlerwei-le sind es über 2000. Tappertzhofens neuestes Projekt: Aus der Silphie-Pflanze will die Schwarz-
Tochter Prezero nachhaltige Verpackungen herstellen. Der Clou: Die Pflanze kann zugleich als Zellstoffersatz und für die Biogasgewinnung genutzt werden. „Die Silphie bietet auch für Landwirte eine zukunftsfähige Perspektive, da sie unter anderem insektenfreundlich ist, im Boden CO2 einspeichert und ihn vor Wind- und Wassererosionen schützt“, erklärt Tappertz-hofen. Mehrere Studien haben die positiven Klimawirkungen bestä-tigt. Nun werden Verpackungen bei Lidl und Kaufland schrittweise auf den neuen Rohstoff umgestellt. Florian Kolf
Grüne Pioniere
52 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
16. Thomas Tappertzhofen
Get
ty Im
ages
Ent
erta
inm
ent
19. Michael Popp Die Natur ist der Ausgangspunkt für das Unternehmen Bionorica, das Medizin aus Heilpflanzen herstellt. Deswegen ist es für Inhaber und Vorstandschef Michael Popp zentrales Anliegen, sie zu schützen und zu erhalten. Dafür betreibt der 62-jährige Pharma-zeut mit seinem Unternehmen einigen Auf-wand: Die Heilpflanzen stammen aus kontrol-liert nachhaltigem, teils regionalem Anbau. Nachdem ihnen in der Herstellung die Wirkstof-fe entzogen worden sind, werden die Reste komplett zu biologischem Nährstoffhumus kompostiert. Die Firmenzentrale in Neumarkt in der Oberpfalz wurde schon 2007 nach Ökostan-dards erbaut, in der Produktion werden CO2-spa-rende moderne Dampfkessel verwandt. Popps Vision: mit Bionorica perspektivisch klimaposi-tiv zu werden, also mehr CO2 aus der Luft zu entnehmen als auszustoßen. Die direkten Emissionen kompensiert das Unternehmen bereits durch Investitionen in zertifizierte Aufforstungsprojekte. Jetzt werden auch die vor- und nachgelagerten Emissionen erfasst, etwa bei Zulieferern. Maike Telgheder
/Pri
vat
15. Janina Nakladal Wie groß ihr Einfluss sein könnte, hat Janina Nakla-dal erst nach und nach erkannt: Als „Global Director of Sustainability“ kümmert sie sich beim Softwareunternehmen Celonis darum, dass das Unternehmen ökologisch, sozial und wirtschaftlich handelt. In ihrer Rolle kann sie das Thema jedoch auch bei den Celonis-Kunden vorantreiben – darunter
Lufthansa, Siemens, Eon und BP. „Mit unserem Produkt beeinflussen wir, wie Prozesse funktionieren“, sagt Nakladal und gibt ein Beispiel: „Unsere Software kann praktisch wie Google Maps berechnen, welches Verkehrsmittel und welche Bündelung von Bestellungen aus Emissionsperspektive am besten ist.“ Bevor die Betriebswirtin im Juli 2020 zur Nachhaltig-keitschefin wurde, leitete sie den Bereich Wissenschaftskooperatio-nen. Dabei ging es darum, das Wissen über Celonis’ „Process Mi - ning“-Technologie zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Larissa Holzki
Res
ourc
ify
17. Gary Lewis und Pascal Alich
Jeden Betrieb in die Lage zu versetzen, 100 Prozent des eigenen Abfalls zu recyceln, lautet das Ziel des Hamburger Start-ups Resour-cify. Die 2015 von Gary Lewis und Pascal Alich gegründete Firma bietet dazu eine Cloud-basierte Software. Für Industriekunden macht sie auf einer Onlineplattform sichtbar, wie viel Holz, Metall, Papier oder sonstige Abfälle diese regelmäßig entsorgen – unterteilt in rund 200 Abfallarten. Zu den Kunden zählen nach Angaben des Start-ups Firmen wie Bosch Packaging Technology und Hornbach. Aus der Abfallwirtschaft habe man 220 Unternehmen mit der Plattform verbunden. Durch automatisierte, digitale Abläufe werde Recycling effizienter und transparenter, wirbt die Softwarefirma: Unternehmen könnten mehr recyceln, Kosten senken und wertvolle Abfälle wie Kupfer oder Hartplastik in vermarktbare Materialien umwandeln. Vor wenigen Wochen sammelten die Hamburger in einer zweiten Finanzierungsrunde drei Millionen Euro ein, angeführt von dem Frühphaseninvestor Speedinvest. Christoph Schlautmann
Pri
vat
Hof
foto
graf
en, E
arly
bird
18. Ferry & Fabian Heilemann Ferry Heilemann beschreibt sich selbst als „Klimaaktivisten“. Wer jetzt an Blockaden von Atomkraftwerken oder Hungerstreiks vor dem Reichstag denkt, muss das Bild aber revidieren: Ferry Heilemann und sein älterer Bruder Fabian Heilemann gehen die Klimakrise unternehme-risch an. „Unsere Vision ist, die gesamte Digital-wirtschaft in der westlichen Welt zu dekarboni-sieren und klimaneutral zu machen“, sagt Ferry Heilemann. Ihr erstes großes Geld haben sie mit dem Gutschein-Start-up Daily Deal gemacht, das sie 2011 für mehr als 100 Millionen Dollar an Google verkauft haben. Mit Klimaschutz hatte all das noch nichts zu tun. Doch mit dem Vermögen entwickelten die Brüder auch ein neues Verantwortungsbewusstsein. Heute investieren sie ihr Geld unter anderem über das eigene Family-Office „Pirate Impact“. Dieses Kapital soll zu 80 Prozent in Start-ups gehen, die Klimatechnologie entwickeln und eine nachhaltigere Wirtschaft fördern, 20 Prozent stehen für soziale Themen wie Chancen-gleichheit bereit. Wagniskapitalinvestments sind aus ihrer Sicht der größtmögliche Hebel, um den Wandel anzuschieben. Ferry Heilemann
widmet sich diesen Investments in Vollzeit. Hervorzuheben unter den Aktivitäten der Brüder ist zudem die Initiative „Leaders for Climate Action“, die die Heilemanns 2019 mitgegründet haben. Dort schließen sich Unternehmen zusammen, die ihre Klimabilanz verbessern wollen und notwendige CO2-Emissio-nen mit Ausgleichsmaßnahmen kompensieren. Knapp 1200 Firmen – vor allem aus der Start-up-Szene – sind inzwischen dabei. Zudem zahlrei-che Wagniskapitalfinanzierer, von denen viele inzwischen eine „Klimaklausel“ bei sich einge-führt haben: Damit verpflichten sich Investoren und ihre Portfoliofirmen gemeinsam zur Klima-verträglichkeit. Fabian Heilemann hat diese Klausel auch beim Münchener Start-up-Finanzie-rer Earlybird eingeführt, bei dem er einer der Partner ist. In seinem Buch „Climate Action Guide“, das im Frühjahr erschienen ist, zeigt Ferry Heilemann Wege auf, wie Unternehmen ihren klimatischen Fußabdruck verringern können, und verweist auf beispielhafte Ansätze. Und er beschreibt, was ihn antreibt: „Die Krise, vor der wir stehen, bedroht alles, was ich liebe und schätze und wofür ich dankbar bin.“ Larissa Holzki
Baustoffe sind derzeit oft Mangelware, die Preise hoch. Umso interessanter wird es, wenn alte Materialien wiederverwendet werden – auch unter dem Aspekt des nachhaltigen Bauens. Doch das scheitert vielfach schon am Wissen, welche Stoffe überhaupt verwendet wurden. Der 61-Jäh-rige Architekt Thomas Rau will so eine Übersicht nun schaffen. Der Deutsche, der in den Niederlanden lebt, hat Madaster gegründet, dessen deutscher Ableger im März startete. Eine Online-Datenbank, die für den Hochbau ähnlich relevante Informa-
tionen liefern soll, wie es Kataster für Liegenschaften tun. Während es bei Grundstücken um Lage, Größe und Eigentümer geht, speichert Madaster, wie viel Tonnen Stahl und welches Holz verbaut sind. Das Ziel: Kreislaufwirtschaft, die für mehr Nachhaltigkeit sorgt. „Damit werden Gebäude Materialdepots, und wir schreiben Materialien auf und nicht mehr ab“, sagt Rau. Carsten Herz
53WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
dm
23. Stefanie Schönherr Schon als Teenagerin sei sie „eher öko“ gewesen, sagt Stefanie Schönherr. Heute wacht die studierte Betriebswirtin als Nachhaltigkeitsmanagerin im dm-Produktmanagement über etwa 30 Eigenmarken des Drogerieunternehmens und tüftelt an der Transparenz der Lieferketten. Sie trug dazu bei, dass dm 2008 Frischfaser-Kartonagen auf FSC-Zertifizierung umstellte. Bereits 2009 führte dm erste recycelte Kunststofffla-schen ein. Schönherr begleitete zudem die neue „umweltneutrale“ Submarke Pro Climate in Zusammenarbeit mit der TU
Berlin und ist Gründungsmitglied des Forums Nachhaltiges Palmöl. Für ihr Engagement erhielten Schönherr und viele der dm-Marken Auszeichnungen, wie den B.A.U.M. Umweltpreis, den Green Brand Award oder den deutschen Nachhaltigkeitspreis. Durch ihre Arbeit gibt Schönherr Verbrauchern die Chance, per Kaufentscheidung zum Umweltschutz beizutragen. Anna Gauto
Hel
mut
-G.-W
alth
er-K
linik
um G
mbH
24. Markus Semmelroch Beim Technischen Leiter des Krankenhauses Lichtenfels laufen alle Fäden zusammen, die zur Steuerung des „Green Hospitals“ notwen-dig sind, das derzeit als Leuchtturmprojekt in Deutschland gilt. Photovoltaikanlagen in der Außenfassade, Kabelkanäle aus Alu statt Kunststoff sowie Licht- und Lärmminimie-rungskonzepte: Das nach dem Passivhaus-prinzip 2018 fertiggestellte Krankenhaus der Regiomed-Gruppe soll so klimaschonend wie möglich sein, ohne den Betrieb oder das Wohl der Patienten einzuschränken. Das ist im Alltag nicht immer ganz einfach: In einem
Niedrigenergiehaus darf man beispielsweise nicht lüften, wie man möchte. Der 49-jährige Markus Semmelroch misst an tausend Datenpunkten gemeinsam mit Projektteams aus den Hochschulen Hof, Bayreuth und Coburg, welche Maßnahmen am meisten für den Klimaschutz bringen. Die Endauswertung der Daten soll 2022 erfolgen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass viel Energie beim Heizen eingespart werden konnte, Strom wegen der steigenden Zahl tech-nischer Geräte dagegen kaum. Maike Telgheder
Wer
ner
& M
ertz
/Her
bert
Pie
l
22. Reinhard Schneider „Die ökologische Transformation wird oft mit dem Verweis auf ein Henne-Ei-Problem aufgehalten“, schimpft der Inhaber von Werner & Mertz, dem Produzenten der Putzmittelmarke Frosch. Weil viele Konzerne mit Verweis auf die höheren Kosten von recyceltem Material noch zögerten, würden die Stückkosten nicht sinken. „Wir legen dann einfach mal ein Ei“, sagt Reinhard Schneider. Das Ergebnis: Frosch hat mittler-weile mehr als 530 Millionen Flaschen aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff her-gestellt. Üblicherweise stammt der Großteil
des Recyclats von geschredderten Pfandflaschen. Das gemischte Plastik aus dem Gelben Sack zu verwenden ist deutlich aufwendiger, deshalb schrecken viele Unternehmen davor zurück. Frosch dagegen hat im vergangenen Jahr den Anteil des Recyclats aus dem Gelben Sack von 20 auf 50 Prozent gestei-gert. „Wir können das ohne Qualitätseinbußen tun, weil wir die Sortiertechnolo-gie mit unseren Partnern weiterentwickelt haben“, sagt Schneider. Florian Kolf
20. Mazen Rizk Mit nachhaltigem Fleischersatz die Welt verbessern – das ist die Vision des Biotech-nologen Mazen Rizk. Sein Hamburger Start-up Mushlabs nutzt dafür Pilze. Jedoch nicht den sichtbaren Fruchtkörper, sondern das fadenförmige Wurzelgeflecht (Myzel) von Speisepilzen wie Pfifferling oder Shiitake.„Das Myzel braucht im Labor nur vier Tage bis zur Ernte, der Fruchtkörper hingegen bis zu 40 Tage im Pilzanbau“, erklärt der 36-Jährige. Sojabohnen für Tofu etwa sind sogar erst nach 140 Tagen erntereif. Ein weiterer Vorteil des Pilzmyzels: Es kann in geschlossenen Räumen das ganze Jahr hindurch überall auf der Welt gezüchtet werden. Denn Pilze betreiben anders als Pflanzen keine Fotosynthese. „Wir brau-chen im Labor weder Dünger noch Pestizi-de und nur wenig Wasser“, betont Rizk.Die Pilze werden zudem nachhaltig gefüt-tert – mit Reststoffen aus der Lebensmittel-produktion wie Getreidehülsen, Kaffeesatz oder Bananenschalen. Diese werden sonst bestenfalls als Tierfutter verwertet. Pilze sind Allesfresser, die aus verschiedenstem Material ihre Nährstoffe gewinnen können. Das Myzel vermehrt sich durch Fermentati-on in Bioreaktoren zu einem protein- und ballaststoffreichen Lebensmittel. Mushlabs entwickelt daraus Fleischersatz-produkte wie zum Beispiel Hackfleisch, Frikadellen oder Wurst. Das Pilzmyzel enthält wichtige Aminosäuren, die sonst nur in Fleisch vorkommen. In Burgern aus Tofu oder Erbsen müssen diese Aminosäu-ren künstlich zugesetzt werden. „Unser
Fleischersatz ist sehr gesund, schont Klima und Umwelt“, sagt Rizk, der 2010 aus dem Libanon zur Promotion an die Technische Universität Hamburg kam.Die Methode der Fermentation ist uralt und wird von einigen Foodtechs genutzt. Auch die britische Firma Qorn verwendet für ihre Fleischersatzprodukte schon länger ein Myzel, allerdings von Schimmel-pilzen statt von Speisepilzen. Vieh- und Fischzucht sind laut „Fleisch-atlas“ für 14,5 Prozent der globalen Emis-sionen von Treibhausgas verantwortlich. Das ist mehr als der weltweite Straßen- und Flugverkehr zusammen. Auch deshalb verzichten Immer mehr Verbraucher bewusst auf Fleisch und Milch. Der Markt für alternative Proteine wächst entspre-chend rasant – 2035 soll die weltweite Produktion bei 97 Millionen Tonnen liegen, schätzt die Beratungsfirma Boston Consul-ting. 22 Millionen Tonnen davon sollen aus Fermentation stammen. Mushlabs hat rund zwölf Millionen Euro Kapital eingesammelt – etwa von Bitbur-ger Ventures und Atlantic Food Labs. Food- Labs-Investor Christophe Maire sieht in Mushlabs „großes Potenzial“. 2018 gegrün-det, hat die Firma heute 40 Mitarbeiter. Neben der Massenproduktion ist die größte Herausforderung die Zulassung in der EU. „Foodtechs brauchen mehr Unterstützung von der Politik“, fordert Rizk. „Denn unsere Technologie ermöglicht uns, in den kommenden Jahren Fleisch-ersatz überall auf der Welt umweltscho-nend herzustellen.“ Katrin Terpitz
Mad
aste
r
21. Thomas Rau
Mus
hlab
s
Fast 30 Prozent der welt-weiten Kohlenstoffemissio-nen stammen aus Gebäu-den. Und bis 2050 wird sich der weltweite Gebäu-debestand verdoppeln. In dieser Branche besteht also dringender Handlungs-bedarf, findet Max Viess-mann: „Wir müssen die Menschen in den Mittel-punkt stellen und Verbrau-cher in die Lage versetzen, nachhaltige und energieeffi-ziente Entscheidungen zu treffen.“ Eine echte Ver-
knüpfung von Digitalisierung und Energiewende werde genau das bewirken. Das wird eine der Missionen sein, die der Co-Chef des Heizungs- und Klimaspezialisten am kommenden Montag bei einem Auftritt in Glasgow rüberbringen will. Dass der Familienunternehmer auf der Klimakonferenz gefragt ist, rührt vor allem daher, dass Viessmann früher als andere erkannt und öffentlich gemacht hat: Er sieht seine Aufgabe nicht nur in der Transformation des eigenen Unternehmens, sondern der Wirtschaft insgesamt. Anja Müller
Grüne Pioniere
54 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
28. Antje von Dewitz Antje von Dewitz war 2010 erst ein Jahr im Amt. Und schon beschloss die damals 37-Jährige promovierte Ökonomin, dass Vaude bei der Fertigung von Zelten, Rucksäcken und Outdoor-Kleidung mittelfristig keine Schadstoffe mehr einsetzen will. „Unsere Produkte werden in der Natur genutzt. Das sehen wir als Verpflichtung“, sagte die Tochter des Firmengründers damals. Anfangs noch in der Branche belächelt, hat sie das Unternehmen früh und konsequent in Richtung Nachhaltigkeit und soziale Verantwor-tung umgebaut. Viele Schadstoffe wurden bereits ersetzt. Bis 2024 sollen 90 Prozent der Vaude-Produkte überwiegend aus recycelten oder biobasierten Materialien bestehen. Nächs-tes Ziel ist die CO2-Reduktion. Bereits seit 2012 arbeitet Vaude am Firmensitz in Tettnang klimaneutral. Ab Januar 2022 will Vaude mit allen Produkten weltweit komplett klimaneutral sein, allerdings noch mit Kompensationsleistun-gen vor allem für die Emissionen in den Herstel-lungsländern. Eine halbe Million Euro schichtet die Vaude-Chefin vom Marketingbudget in die Reduzierung der Emissionen um.Das teure Umweltengagement zahlt sich in einem hart umkämpften Markt aus. „Nachhaltig-keit steht als Ziel im ganzen Unternehmen gleichberechtigt neben der Wirtschaftlichkeit. Das gehört für mich zum Unternehmertum“,
sagte von Dewitz bereits vor zehn Jahren. Die Outdoor-Branche hatte zwar schon immer eine eher umweltbewusste Kundschaft. Die Auswir-kungen der Branche sind allerdings ambivalent. Die Kunden durchstreifen mit ihrer Ausrüstung abgelegene Regionen und ziehen mit ihren Instagram-Fotos weitere Touristen an, nicht immer zum Wohle der Natur. Auch das ist der Mutter von vier Kindern bewusst. Ihrem Engage-ment tut das keinen Abbruch.Ob Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Diver-sity, Arbeitsbedingungen oder Engagement für Geflüchtete, die Unternehmerin geht oft in Vorleistung und nimmt in ihrer ruhigen, freundli-chen Art kein Blatt vor den Mund. Zuletzt setzte sie sich für das Lieferkettengesetz ein und bezog im Bundestagswahlkampf Stellung: Von Dewitz kritisierte, dass gerade die CDU das Thema Klimawandel im Wahlkampf häufig mit Angst vor Kosten und Verboten verbunden und damit zur Polarisierung der Bevölkerung beigetragen habe: „Wir brauchen eine echte Politik für nachhaltiges Wirtschaften.“ Kein Wunder, dass sie einen Unternehmerpreis nach dem anderen abräumt und kürzlich als Vorbild für die Generation Z auch den „Role Model Award 2021“ bekam. Mitglied in der Hall of Fame des Handelsblatts ist Antje von Dewitz bereits seit 2017. Martin Buchenau
Sand
ra S
teh
26. Max Viessmann
Dek
a
25. Ingo Speich Auf Hauptversammlungen gehört sein Auftritt seit Jahren zu den Höhepunkten: Ebenso ruhig wie unnachgiebig kritisiert Ingo Speich Missstände bei großen deutschen Konzernen. Als erster namhafter Investorenvertreter im Land forderte Speich öffentlichkeitswirksam mehr Einsatz der Manager für Umwelt, Soziales und gute Unterneh-mensführung, die sogenannten ESG-Kriterien. Der 44-Jährige trommelte erst im Auftrag des genossenschaftlichen Fondshauses Union Investment für mehr Nachhaltigkeit, seit gut zweieinhalb Jahren nun als Leiter Nachhaltigkeit und gute Unternehmensfüh-rung bei der Sparkassenfondstochter Deka Investment. Seinen politischen Einfluss macht der Diplom- und Bank-Kaufmann im Beirat „Sustainable Finance“ der Bundesregierung geltend und auf europäischer Ebene in einer Arbeitsgruppe für Verbraucherschutz und Finanzen der EU-Wertpapieraufsicht Esma. Anke Rezmer
27. Joseph Wilhelm Die ersten Brotlaibe, die Joseph Wilhelm und seine Mitstreiter aus dem Ofen eines kleinen Naturkostladens in Augsburg zogen, sollen „prügelhart“ gewesen sein. Die Leute spotteten über die „Birkenstock-träger“ mit den wilden Locken. 1974 gründeten Wilhelm und seine damalige Partnerin Jennifer Vermeulen mit einem Startkapital von 3000 D-Mark die Rapunzel Naturkost GmbH. Heute zählt die einstige Selbstversorgerkommune in Europa zu den führenden Anbietern für Biolebensmittel mit 400 Mitarbeitern, rund 200 Millionen Euro Umsatz und mehreren Tausend Produzenten weltweit. Es gelang dem heute 67-Jährigen Wilhelm schon in den 1980er-Jahren, türki-schen Bauern Preise zu zahlen, die einen ökologischen Anbau erst ermöglichten. 2020 zog Wilhelm nach Corona-Äußerungen Kritik auf
sich, als er etwa Masken mit „Maulkörben“ verglich. Solche Botschaften hat Rapunzel inzwischen von der Homepage getilgt und Wilhelm sich davon in Teilen distanziert. 2020 setzte der deutsche Lebensmittelhandel mit Bioprodukten rund 15 Milliarden Euro um, eine Verdopplung binnen zehn Jahren. Hinter dieser Entwicklung stehen auch Naturkostpioniere wie Joseph. Anna GautoR
apun
zel
VAU
DE
55WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
29. Elke Temme Elke Temmes offizieller Jobtitel lautet „Ge-schäftsführerin Laden & Energie“ bei der Komponenten-Tochter von Volkswagen. Unter Kolleginnen und Kollegen wird sie in Wolfsburg manchmal auch scherzhaft „Miss Energy“ genannt. Die 53-Jährige ist die oberste Strom-Verantwortliche von Volkswagen, kommt ursprünglich vom RWE-Konzern und dessen späterer Tochter Innogy, wo sie fast zwei Jahrzehnte gearbeitet hatte. Anfang 2020 war sie aus dem Ruhrgebiet in die VW-Zentrale gewechselt. Der Konzern hatte erkannt, dass er wegen der schnell wachsenden Elektroflotte Fachleute mit ausgewiesener Stromexpertise in den eigenen Reihen braucht. Elke Temme sorgt als Leiterin der Volkswagen-Stromtochter Elli dafür, dass VW auch zum Stromanbieter wird. Eine fünfstellige Zahl von Lieferverträgen für den Elli-Strom ist bereits abgeschlossen worden. Mit einem besonderen Angebot will sich Volkswagen von der Konkur-renz abgrenzen: „Bei uns gibt es nur nachhaltig produzierten Strom aus erneuerbaren Energie-formen“, sagt Elke Temme im Gespräch mit dem Handelsblatt mit Blick auf den Tarif „Volkswagen Naturstrom Connect“.Über Elli läuft auch der Verkauf von Wallboxen, damit Kunden ihre neuen E-Autos daheim aufladen können. Laut Temme hat Volkswagen
in diesem Jahr bislang rund 60.000 dieser Wallboxen abgesetzt. „Volkswagen versteht sich als Komplettanbieter beim Verkauf von Elektro-autos“, erläutert sie. Wer sich für ein neues E-Modell entscheide, bekomme bei Volkswagen gleich ein Komplettangebot dazu: von der Hardware über den Grünstromtarif bis hin zur Planung, Realisierung und zum Betrieb der Ladestelle. Insofern beeinflusst Temme mit ihrer Arbeit die Akzeptanz und die Verbreitung von Elektroautos und in der Folge auch die Klimaverbesserung.In den kommenden Jahren dürfte der Job von Elke Temme noch wichtiger werden. Sie will dafür sorgen, dass Millionen von E-Fahrzeugen zum mobilen Speichernetz werden. Autoakkus können dann die im Stromnetz entstehenden Lieferschwankungen bei erneuerbaren Energien ausgleichen. Ihre Überzeugung: Der Fahrstrom für E-Autos dürfte dann nichts mehr kosten, weil die Autofahrer die Energie letztlich über die von ihren Fahrzeugen geleisteten Speicherdiens-te bezahlen.Allerdings sieht sie auch Defizite, gerade in der Ladeinfrastruktur und bei der Produktion von nachhaltigem Strom. Elke Temme hat deshalb eine klare Forderung an die Politik: „Für beides brauchen wir verbindliche Ausbauziele und schnellere Entscheidungen.“ Stefan Menzel
Shift
phon
e
32. Carsten und Samuel Waldeck
Der Name ist Programm: Der Elektronikhersteller Shift, 2014 gegrün-det, will mit seinen Produkten etwas verändern. Die Gründer – die Brüder Carsten und Samuel Waldeck aus dem hessischen Falken-berg – haben sich das Ziel gesetzt, dass bei der Fertigung von Smartphones und Notebooks niemand ausgenutzt wird und die Ressourcen geschont werden. Die Firma beschäftigt beispielsweise in China zehn festangestellte Mitarbeiter, die geregelte Arbeitszeiten haben und deutlich über dem lokalen Lohniveau verdienen. Nutzer können bei den Shift-Geräten mit einigen Handgriffen den Akku oder beschädigte Komponenten tauschen, was die Lebensdauer des Geräts erhöht. Und bei der Beschaffung von Rohstoffen achtet das Management darauf, dass diese von zertifizierten Zulieferern stam-men. Mit seinen Erträgen finanziert Shift gemeinnützige Projekte. So produziert eine Wassermühle seit 2019 Ökostrom, als Nächstes steht ein Biotop auf bisherigem Ackerland an. Christof Kerkmann
Uta
Wag
ner
33. Dominik Campanella Es gibt wenige Branchen, deren Produkte so langlebig sind wie im Baugewerbe. Die meisten Gebäude werden viele Jahrzehnte genutzt. Entsprechend wenig kümmern sich Bauherrn meist darum, was mit einer Immobilie pas-siert, wenn ihre Lebensdau-er eines Tages überschritten sein wird. Dominik Campanella, Gründer des Start-ups Concular, hat sich genau
dazu Gedanken gemacht – und ein Unternehmen gegründet, das Immobilienbesitzern dabei hilft, die Zusammensetzung ihrer Gebäu-de digital zu dokumentieren und ausgemusterte Baustoffe gegebe-nenfalls in neue Bauprojekte zu vermitteln. Allein dadurch sollen bei Abbruchprojekten bis zu 30 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. Wird das Gebäude von vornherein auf Recyclingfähigkeit hin optimiert, soll die Reduktion sogar 50 Prozent betragen. Gründer Campanella ist in der Branche kein Unbekannter: Schon vor zehn Jahren gründete der studierte Computerwissenschaftler mit seinem ersten Start-up Restado einen Online-Marktplatz für wiederverwendete Baustoffe. Kevin Knitterscheidt
Cir
cono
mic
s
31. Patrick Peter Bevor ausgediente Batte-rien aus Elektroautos auf dem Recyclinghof landen, können sie meist noch als Energiespeicher dienen. Bisher wird das aber kaum praktiziert. Gründer Patrick Peter will die Zweitnutzung erleichtern. „Damit lässt sich der CO2-Fußabdruck einer Batterie um bis zu 50 Prozent reduzieren“, sagt der 37-Jährige. Auf seinem Online-Marktplatz Circuno-mics, den er mit Sebastiaan Wolzak und Cesar Prados aufgebaut hat, können Autohersteller und Verwertungsfirmen mit gebrauchten Akkus handeln. Das Start-up bekommt eine Provision, wenn die Batterie den Besitzer wechselt. Zugleich erstellt es „digitale Zwillinge“ der Akkus, um von den Daten der Hersteller eine Abschätzung zum Ende der Lebensdauer im Fahrzeug sowie zu Batteriezustand und -wert ableiten zu können. Der Markt wächst, auch durch die vielen Batterierückrufe der Autobauer. Bisher hat Circunomics 2,3 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Claudia Scholz
Volk
swag
enEn
apte
r
30. Sebastian-Justus Schmidt Anders als die milliardenschwere Konkurrenz setzt Enapter auf kleine Wasserstoff-Elektrolyse-Systeme, die beliebig vergrößert werden können. So soll das Gas im Eigenheim oder als Ersatz für Dieselgeneratoren zum Einsatz kommen. „Wir wollen modulare Elektrolyseure bauen, die die Herstellung von Wasserstoff so günstig machen, dass fossile Energien sich nicht mehr rech-nen“, erklärt Gründer Sebastian-Justus Schmidt. Bislang sind die Projekte des Start-ups noch sehr kleinteilig. Mit der neuen Serienfertigung soll sich das aber in Zukunft ändern. In Nordrhein-Westfalen hat Enapter vor Kurzem den Bau seiner ersten industriel-len Produktionsanlage gestartet. Vor zwei Wochen gewann die bereits mehrfach ausgezeichnete Firma den Earthshot-Umweltpreis in der Kategorie „Unser Klima verbessern“. Die mit einer Million britischen Pfund (circa 1,2 Millionen Euro) dotierte Auszeichnung wurde von den britischen Royals Prinz William und Herzogin Catherine initiiert. Kathrin Witsch
Fast 30 Prozent der welt-weiten Kohlenstoffemissio-nen stammen aus Gebäu-den. Und bis 2050 wird sich der weltweite Gebäu-debestand verdoppeln. In dieser Branche besteht also dringender Handlungs-bedarf, findet Max Viess-mann: „Wir müssen die Menschen in den Mittel-punkt stellen und Verbrau-cher in die Lage versetzen, nachhaltige und energieeffi-ziente Entscheidungen zu treffen.“ Eine echte Ver-
knüpfung von Digitalisierung und Energiewende werde genau das bewirken. Das wird eine der Missionen sein, die der Co-Chef des Heizungs- und Klimaspezialisten am kommenden Montag bei einem Auftritt in Glasgow rüberbringen will. Dass der Familienunternehmer auf der Klimakonferenz gefragt ist, rührt vor allem daher, dass Viessmann früher als andere erkannt und öffentlich gemacht hat: Er sieht seine Aufgabe nicht nur in der Transformation des eigenen Unternehmens, sondern der Wirtschaft insgesamt. Anja Müller
Grüne Pioniere
54 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
28. Antje von Dewitz Antje von Dewitz war 2010 erst ein Jahr im Amt. Und schon beschloss die damals 37-Jährige promovierte Ökonomin, dass Vaude bei der Fertigung von Zelten, Rucksäcken und Outdoor-Kleidung mittelfristig keine Schadstoffe mehr einsetzen will. „Unsere Produkte werden in der Natur genutzt. Das sehen wir als Verpflichtung“, sagte die Tochter des Firmengründers damals. Anfangs noch in der Branche belächelt, hat sie das Unternehmen früh und konsequent in Richtung Nachhaltigkeit und soziale Verantwor-tung umgebaut. Viele Schadstoffe wurden bereits ersetzt. Bis 2024 sollen 90 Prozent der Vaude-Produkte überwiegend aus recycelten oder biobasierten Materialien bestehen. Nächs-tes Ziel ist die CO2-Reduktion. Bereits seit 2012 arbeitet Vaude am Firmensitz in Tettnang klimaneutral. Ab Januar 2022 will Vaude mit allen Produkten weltweit komplett klimaneutral sein, allerdings noch mit Kompensationsleistun-gen vor allem für die Emissionen in den Herstel-lungsländern. Eine halbe Million Euro schichtet die Vaude-Chefin vom Marketingbudget in die Reduzierung der Emissionen um.Das teure Umweltengagement zahlt sich in einem hart umkämpften Markt aus. „Nachhaltig-keit steht als Ziel im ganzen Unternehmen gleichberechtigt neben der Wirtschaftlichkeit. Das gehört für mich zum Unternehmertum“,
sagte von Dewitz bereits vor zehn Jahren. Die Outdoor-Branche hatte zwar schon immer eine eher umweltbewusste Kundschaft. Die Auswir-kungen der Branche sind allerdings ambivalent. Die Kunden durchstreifen mit ihrer Ausrüstung abgelegene Regionen und ziehen mit ihren Instagram-Fotos weitere Touristen an, nicht immer zum Wohle der Natur. Auch das ist der Mutter von vier Kindern bewusst. Ihrem Engage-ment tut das keinen Abbruch.Ob Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Diver-sity, Arbeitsbedingungen oder Engagement für Geflüchtete, die Unternehmerin geht oft in Vorleistung und nimmt in ihrer ruhigen, freundli-chen Art kein Blatt vor den Mund. Zuletzt setzte sie sich für das Lieferkettengesetz ein und bezog im Bundestagswahlkampf Stellung: Von Dewitz kritisierte, dass gerade die CDU das Thema Klimawandel im Wahlkampf häufig mit Angst vor Kosten und Verboten verbunden und damit zur Polarisierung der Bevölkerung beigetragen habe: „Wir brauchen eine echte Politik für nachhaltiges Wirtschaften.“ Kein Wunder, dass sie einen Unternehmerpreis nach dem anderen abräumt und kürzlich als Vorbild für die Generation Z auch den „Role Model Award 2021“ bekam. Mitglied in der Hall of Fame des Handelsblatts ist Antje von Dewitz bereits seit 2017. Martin Buchenau
Sand
ra S
teh
26. Max Viessmann
Dek
a
25. Ingo Speich Auf Hauptversammlungen gehört sein Auftritt seit Jahren zu den Höhepunkten: Ebenso ruhig wie unnachgiebig kritisiert Ingo Speich Missstände bei großen deutschen Konzernen. Als erster namhafter Investorenvertreter im Land forderte Speich öffentlichkeitswirksam mehr Einsatz der Manager für Umwelt, Soziales und gute Unterneh-mensführung, die sogenannten ESG-Kriterien. Der 44-Jährige trommelte erst im Auftrag des genossenschaftlichen Fondshauses Union Investment für mehr Nachhaltigkeit, seit gut zweieinhalb Jahren nun als Leiter Nachhaltigkeit und gute Unternehmensfüh-rung bei der Sparkassenfondstochter Deka Investment. Seinen politischen Einfluss macht der Diplom- und Bank-Kaufmann im Beirat „Sustainable Finance“ der Bundesregierung geltend und auf europäischer Ebene in einer Arbeitsgruppe für Verbraucherschutz und Finanzen der EU-Wertpapieraufsicht Esma. Anke Rezmer
27. Joseph Wilhelm Die ersten Brotlaibe, die Joseph Wilhelm und seine Mitstreiter aus dem Ofen eines kleinen Naturkostladens in Augsburg zogen, sollen „prügelhart“ gewesen sein. Die Leute spotteten über die „Birkenstock-träger“ mit den wilden Locken. 1974 gründeten Wilhelm und seine damalige Partnerin Jennifer Vermeulen mit einem Startkapital von 3000 D-Mark die Rapunzel Naturkost GmbH. Heute zählt die einstige Selbstversorgerkommune in Europa zu den führenden Anbietern für Biolebensmittel mit 400 Mitarbeitern, rund 200 Millionen Euro Umsatz und mehreren Tausend Produzenten weltweit. Es gelang dem heute 67-Jährigen Wilhelm schon in den 1980er-Jahren, türki-schen Bauern Preise zu zahlen, die einen ökologischen Anbau erst ermöglichten. 2020 zog Wilhelm nach Corona-Äußerungen Kritik auf
sich, als er etwa Masken mit „Maulkörben“ verglich. Solche Botschaften hat Rapunzel inzwischen von der Homepage getilgt und Wilhelm sich davon in Teilen distanziert. 2020 setzte der deutsche Lebensmittelhandel mit Bioprodukten rund 15 Milliarden Euro um, eine Verdopplung binnen zehn Jahren. Hinter dieser Entwicklung stehen auch Naturkostpioniere wie Joseph. Anna GautoR
apun
zel
VAU
DE
55WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
29. Elke Temme Elke Temmes offizieller Jobtitel lautet „Ge-schäftsführerin Laden & Energie“ bei der Komponenten-Tochter von Volkswagen. Unter Kolleginnen und Kollegen wird sie in Wolfsburg manchmal auch scherzhaft „Miss Energy“ genannt. Die 53-Jährige ist die oberste Strom-Verantwortliche von Volkswagen, kommt ursprünglich vom RWE-Konzern und dessen späterer Tochter Innogy, wo sie fast zwei Jahrzehnte gearbeitet hatte. Anfang 2020 war sie aus dem Ruhrgebiet in die VW-Zentrale gewechselt. Der Konzern hatte erkannt, dass er wegen der schnell wachsenden Elektroflotte Fachleute mit ausgewiesener Stromexpertise in den eigenen Reihen braucht. Elke Temme sorgt als Leiterin der Volkswagen-Stromtochter Elli dafür, dass VW auch zum Stromanbieter wird. Eine fünfstellige Zahl von Lieferverträgen für den Elli-Strom ist bereits abgeschlossen worden. Mit einem besonderen Angebot will sich Volkswagen von der Konkur-renz abgrenzen: „Bei uns gibt es nur nachhaltig produzierten Strom aus erneuerbaren Energie-formen“, sagt Elke Temme im Gespräch mit dem Handelsblatt mit Blick auf den Tarif „Volkswagen Naturstrom Connect“.Über Elli läuft auch der Verkauf von Wallboxen, damit Kunden ihre neuen E-Autos daheim aufladen können. Laut Temme hat Volkswagen
in diesem Jahr bislang rund 60.000 dieser Wallboxen abgesetzt. „Volkswagen versteht sich als Komplettanbieter beim Verkauf von Elektro-autos“, erläutert sie. Wer sich für ein neues E-Modell entscheide, bekomme bei Volkswagen gleich ein Komplettangebot dazu: von der Hardware über den Grünstromtarif bis hin zur Planung, Realisierung und zum Betrieb der Ladestelle. Insofern beeinflusst Temme mit ihrer Arbeit die Akzeptanz und die Verbreitung von Elektroautos und in der Folge auch die Klimaverbesserung.In den kommenden Jahren dürfte der Job von Elke Temme noch wichtiger werden. Sie will dafür sorgen, dass Millionen von E-Fahrzeugen zum mobilen Speichernetz werden. Autoakkus können dann die im Stromnetz entstehenden Lieferschwankungen bei erneuerbaren Energien ausgleichen. Ihre Überzeugung: Der Fahrstrom für E-Autos dürfte dann nichts mehr kosten, weil die Autofahrer die Energie letztlich über die von ihren Fahrzeugen geleisteten Speicherdiens-te bezahlen.Allerdings sieht sie auch Defizite, gerade in der Ladeinfrastruktur und bei der Produktion von nachhaltigem Strom. Elke Temme hat deshalb eine klare Forderung an die Politik: „Für beides brauchen wir verbindliche Ausbauziele und schnellere Entscheidungen.“ Stefan Menzel
Shift
phon
e
32. Carsten und Samuel Waldeck
Der Name ist Programm: Der Elektronikhersteller Shift, 2014 gegrün-det, will mit seinen Produkten etwas verändern. Die Gründer – die Brüder Carsten und Samuel Waldeck aus dem hessischen Falken-berg – haben sich das Ziel gesetzt, dass bei der Fertigung von Smartphones und Notebooks niemand ausgenutzt wird und die Ressourcen geschont werden. Die Firma beschäftigt beispielsweise in China zehn festangestellte Mitarbeiter, die geregelte Arbeitszeiten haben und deutlich über dem lokalen Lohniveau verdienen. Nutzer können bei den Shift-Geräten mit einigen Handgriffen den Akku oder beschädigte Komponenten tauschen, was die Lebensdauer des Geräts erhöht. Und bei der Beschaffung von Rohstoffen achtet das Management darauf, dass diese von zertifizierten Zulieferern stam-men. Mit seinen Erträgen finanziert Shift gemeinnützige Projekte. So produziert eine Wassermühle seit 2019 Ökostrom, als Nächstes steht ein Biotop auf bisherigem Ackerland an. Christof Kerkmann
Uta
Wag
ner
33. Dominik Campanella Es gibt wenige Branchen, deren Produkte so langlebig sind wie im Baugewerbe. Die meisten Gebäude werden viele Jahrzehnte genutzt. Entsprechend wenig kümmern sich Bauherrn meist darum, was mit einer Immobilie pas-siert, wenn ihre Lebensdau-er eines Tages überschritten sein wird. Dominik Campanella, Gründer des Start-ups Concular, hat sich genau
dazu Gedanken gemacht – und ein Unternehmen gegründet, das Immobilienbesitzern dabei hilft, die Zusammensetzung ihrer Gebäu-de digital zu dokumentieren und ausgemusterte Baustoffe gegebe-nenfalls in neue Bauprojekte zu vermitteln. Allein dadurch sollen bei Abbruchprojekten bis zu 30 Prozent der CO2-Emissionen eingespart werden. Wird das Gebäude von vornherein auf Recyclingfähigkeit hin optimiert, soll die Reduktion sogar 50 Prozent betragen. Gründer Campanella ist in der Branche kein Unbekannter: Schon vor zehn Jahren gründete der studierte Computerwissenschaftler mit seinem ersten Start-up Restado einen Online-Marktplatz für wiederverwendete Baustoffe. Kevin Knitterscheidt
Cir
cono
mic
s
31. Patrick Peter Bevor ausgediente Batte-rien aus Elektroautos auf dem Recyclinghof landen, können sie meist noch als Energiespeicher dienen. Bisher wird das aber kaum praktiziert. Gründer Patrick Peter will die Zweitnutzung erleichtern. „Damit lässt sich der CO2-Fußabdruck einer Batterie um bis zu 50 Prozent reduzieren“, sagt der 37-Jährige. Auf seinem Online-Marktplatz Circuno-mics, den er mit Sebastiaan Wolzak und Cesar Prados aufgebaut hat, können Autohersteller und Verwertungsfirmen mit gebrauchten Akkus handeln. Das Start-up bekommt eine Provision, wenn die Batterie den Besitzer wechselt. Zugleich erstellt es „digitale Zwillinge“ der Akkus, um von den Daten der Hersteller eine Abschätzung zum Ende der Lebensdauer im Fahrzeug sowie zu Batteriezustand und -wert ableiten zu können. Der Markt wächst, auch durch die vielen Batterierückrufe der Autobauer. Bisher hat Circunomics 2,3 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Claudia Scholz
Volk
swag
enEn
apte
r
30. Sebastian-Justus Schmidt Anders als die milliardenschwere Konkurrenz setzt Enapter auf kleine Wasserstoff-Elektrolyse-Systeme, die beliebig vergrößert werden können. So soll das Gas im Eigenheim oder als Ersatz für Dieselgeneratoren zum Einsatz kommen. „Wir wollen modulare Elektrolyseure bauen, die die Herstellung von Wasserstoff so günstig machen, dass fossile Energien sich nicht mehr rech-nen“, erklärt Gründer Sebastian-Justus Schmidt. Bislang sind die Projekte des Start-ups noch sehr kleinteilig. Mit der neuen Serienfertigung soll sich das aber in Zukunft ändern. In Nordrhein-Westfalen hat Enapter vor Kurzem den Bau seiner ersten industriel-len Produktionsanlage gestartet. Vor zwei Wochen gewann die bereits mehrfach ausgezeichnete Firma den Earthshot-Umweltpreis in der Kategorie „Unser Klima verbessern“. Die mit einer Million britischen Pfund (circa 1,2 Millionen Euro) dotierte Auszeichnung wurde von den britischen Royals Prinz William und Herzogin Catherine initiiert. Kathrin Witsch
Der gebürtige Spanier Abel Samaniego und seine Mitgründer Javier Ferre und Pablo Stahl reduzieren mit ihrer Software Dabbel den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß von Geschäfts-gebäuden. Denn diese heizen und lüften viel unflexibler, als es die Arbeitswelt mittlerweile erfordert. „Viel Energie geht durch Fehlsteuerung verloren“, sagt der 34-jäh-rige CEO. Dabbel klinkt sich innerhalb einer Woche in eine bestehende Gebäude-steuerung ein, Künstliche
Intelligenz erkennt in den Sensordaten Verschwendungsmuster und behebt sie. Einsparungen sollen sich nach einem Monat zeigen. Laut Samaniego sind 34 Prozent der Büros weltweit mit Gebäudesteuerungen ausgestattet und damit ein potenzieller Markt für Dabbel. Firmen wie Eon, Com-merzbank und Strabag sind Kunden. 3,6 Millionen Euro Investorengel-der hat das Start-up bekommen, die EU ist mit dem „Climate-KIC“-För-derprogramm dabei. Claudia Scholz
Das Geschäftsmodell des Start-ups Elvah wurde aus der Not geboren: Als im Coronajahr 2020 die Zielmärkte des damaligen IT-Dienstleisters einbra-chen, überlegten die drei Gründer mit ihrem Team, welcher Herausforderung sie sich fortan widmen könnten – und entschie-den sich für Ladesäulen. Das Problem, das Elvah-
Chef Gowrynath Sivaganes-hamoorthy lösen will: Auf E-Autofahrer warten an Ladesäulen verschiedene Preise – je nachdem, über welchen Anbieter sie zahlen. Die Idee von Elvah: eine Flatrate. „Damit geben wir unseren Kunden und Kundinnen die Kontrolle über ihre monatlichen Aus-gaben“, so Sivaganeshamoorthy. Der 43-Jährige, der mehr als 20 Jahre lang im IT-Bereich für Marken wie MTV und Uefa gearbeitet hat, will dazu eine intelligente App nutzen. Die soll ermitteln, welche Säulen für das jeweilige E-Auto funktionieren. Ein paar Investoren hat Elvah bereits überzeugt: Im September sammelte das Start-up 3,2 Millionen Euro von Business-Angels ein. Die Gespräche für eine weitere Finanzierungsrunde laufen. Catiana Krapp
Fünf Doktorarbeiten, eine große Erkenntnis: Um all die entstehenden Solaranla-gen, Windräder und Ladesäulen in das Strom-netz zu integrieren und zu managen, ist neue Soft-ware erforderlich. Denn die Netze stehen vor nie da gewesenen Herausforderun-gen: Der Strom stammt aus Tausenden Quellen, und es kommen immer neue Verbraucher hinzu. „Die Stromnetze sind der zentrale Flaschenhals für eine erfolgreiche Energie-wende“, sagt Simon
Koopmann. Der ehemalige Student der RWTH Aachen hat deshalb im Jahr 2017 mit vier Kom-militonen das Start-up Envelio gegründet – und eine „Intelligent Grid Platform“ entwickelt. In zwei Finanzierungsrunden hat Envelio insgesamt sieben Millionen Euro eingesammelt. Mittlerweile arbei-ten bei dem Unternehmen mehr als 70 Menschen für über 35 Kunden, darunter die Netzgesellschaft Rheinenergie und der Verteil-netzbetreiber Westnetz. Geld verdient das Start-up noch nicht. Schließlich wolle Envelio innerhalb Europas expandieren, so Koop-mann. Das Unternehmen sei aber auf dem Weg in Richtung Profita-bilität. Catiana Krapp
Grüne Pioniere
56 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
37. Petra Wehlert Nachhaltigkeit stärker am Kapitalmarkt ver-ankern – dieser Mission hat sich Petra Wehlert seit Jahren verschrieben. Die 53-Jährige leitet seit 2016 das Kapitalmarktgeschäft der KfW und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die staatliche Förderbank heute zu den wichtigsten Emittenten „grüner“ Anleihen zählt, bei denen die eingesammelten Mittel dem Klimaschutz zugutekommen. Blickt man auf das Volumen der ausstehenden Anleihen, ist die KfW nach Frankreich derzeit die zweitgrößte Green-Bond-Emittentin der Welt.In Deutschland zählte das staatliche Förderinsti-tut zu den Pionieren dieser Finanzierungsform. Wehlert hatte zusammen mit dem damaligen Treasury-Chef Frank Czichowski dafür gesorgt, dass sich die KfW 2014 erstmals über den da gerade entstehenden Markt der „Green Bonds“ Geld beschaffte. Das bot sich an – schließlich zählt das Förderinstitut, das zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Bundesländern gehört, ohnehin zu den größten Klimaschutz-finanzierern weltweit. „Damals gab es erste Investoren, die ganz bewusst in nachhaltige Produkte anlegen wollten, aber uns war wichtig, diese Anlageklas-se aus der Nische in den Mainstream zu brin-gen“, erklärt Wehlert. Um das zu erreichen, warb die Kapitalmarktexpertin der KfW auch in
Gesprächen mit klassischen Investoren für die grünen Anleihen. Und sie sorgte dafür, dass die grünen KfW-Bonds große Volumina haben und in vielen Laufzeiten verfügbar sind. Das macht sie für Großanleger interessanter.Parallel dazu hat sich die KfW stets aktiv für die Entwicklung von Standards eingesetzt, damit eine funktionierende Infrastruktur für Green Bonds entsteht. „Wir haben zum Beispiel extern bestätigen lassen, dass unsere grünen Anleihen allen Kriterien entsprechen, obwohl wir das als KfW vielleicht gar nicht gebraucht hätten“, erklärt Wehlert. „Uns war wichtig, dass da ein Markt mit glaubwürdigen, sicheren Strukturen entsteht, den auch andere Emittenten nutzen können.“Der Sprung aus der Nische ist den grünen Anleihen längst geglückt: Sechs Jahre nach der KfW lieh sich 2020 erstmals auch die Bundes-republik Deutschland auf diesem Wege Geld. Im Oktober platzierte die Europäische Union den mit zwölf Milliarden Euro bislang größten Green Bond der Welt zur Finanzierung des Corona-Wiederaufbaufonds. Die Nachfrage von Investoren ist mittlerweile so groß, dass sich Emittenten wie die KfW über solch nachhaltige Anleihen zum Teil sogar zu günstigeren Konditio-nen Geld leihen können als über konventionelle Bonds. Yasmin Osman
Dab
bel
34. Abel Samaniego
Elva
h
35. Gowrynath Sivaganeshamoorthy
Enve
lio
36. Simon Koopmann
KfW
57WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Mix
tere
stin
g
38. Franz Haller Es gibt keinen Werkstoff auf der Welt, der in größe-ren Mengen verbraucht wird als Beton – und nur wenige, deren Produktion so viel CO2 verursacht. Der Grund dafür ist der im Beton als Bindemittel enthaltene Zement, bei dessen Herstellung CO2 als Prozessgas entsteht. Allein in Deutschland emittiert die Zementbranche so ins-gesamt rund 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Franz Haller, Gründer des Start-
ups Mixteresting, will dabei helfen, diese Menge zu reduzieren – und zwar mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI), die das optimale Mischverhältnis für den Beton berechnet, der neben Zement auch aus Gestein und Wasser besteht. Dabei lässt sich mit der Software auch der Einsatz von alternativen Bestandteilen wie recyceltem Altbeton oder etwa granuliertem Plastik modellieren, was den Einsatz von Beton insgesamt nachhaltiger machen könnte. Die Planungsdauer soll sich durch die KI-Software von Mixteresting um bis zu 90 Prozent gegenüber konventionellen Berechnungs- methoden reduzieren. Kevin Knitterscheidt
Uta
Wag
ner
39. Thomas Grübler Thomas Grübler hat mit seinen Co-Gründern Björn Stoffers, Rupert Amann und Florian Mauracher eine der verheerendsten Auswir-kungen des Klimawandels zum Geschäftsmodell gemacht. Ihr Start-up Ororatech sammelt Bilder von Wettersatelliten, um Waldbrände weltweit schneller zu erkennen und Löschflugzeuge auto-matisch starten zu lassen. Die Kunden erhalten außerdem noch weitere
Daten, die für Löschmaßnahmen wichtig sind, etwa darüber, wie feucht der Boden ist. „Wir nutzen mittlerweile 20 verschiedene Satellitendatenquellen und erweitern unsere Algorithmen, um noch mehr einbinden zu können“, erklärt CEO Thomas Grübler. Im Januar startet außerdem der erste Prototyp eines Nanosatelliten mit Infrarot-kamera von Ororatech ins All. Grüblers Vision ist es, in etwa fünf Jahren eine eigene Flotte von rund 100 Kleinstsatelliten ins All gesendet zu haben, die rund um die Uhr Daten erheben. Kunden des Start-ups mit über 40 Mitarbeitern sind etwa die Forestry Corporati-on of New South Wales im Südosten Australiens und die Celulosa Arauco y Constitucíon in Chile, die eine monatliche Gebühr je Beobachtungshektar zahlen. Melanie Raidl
Uta
Wag
ner
40. Michael Waldner Die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ist für eine grüne Zukunft essenziell, doch dazu muss dieser Strom sich auch ohne hohe Subventionen erst einmal im Markt behaupten. Michael Waldner hat mit seinem Start-up Pexapark eine Plattform entwickelt, die bei der Preisgestaltung und Optimierung von Stromverträgen zwischen den Anbietern von Erneuerbaren und ihren Abnehmern hilft. Mehr als 80 Unternehmen verwenden bereits die Software des Züricher Start-ups, mit der sie den Energieverkauf ihrer Wind- und
Solarparks verwalten oder Grünstrom einkaufen können. Zu den Kunden gehören etwa RWE, BP und Uniper. Gegründet hat Waldner das Unternehmen 2017 mit Florian Müller und Luca Pedretti, als erneuer-bare Energien den Wandel von einem subventionierten System zu einem offenen Markt erlebten. CEO Waldner hat vor der Pexa-park-Gründung 20 Jahre bei Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und im Portfoliomanagement gearbeitet. Melanie Raidl
Uta
Wag
n
Jan
Zapp
ner
/
41. Claus Sauter Das seit vergangenem Dezember im SDax notier-te Leipziger Unternehmen Verbio gilt als Europas einziger großindustrieller Produzent von Biodie-sel, Bioethanol und Biomethan. Die von Claus Sauter geführte Firma schafft es mit ihren Kraftstoffen, den Kohlendioxidausstoß im Ver-gleich zu Benzin oder Diesel um 90 Prozent zu senken. Zudem hat Verbio Biodünger und Futter-mittel sowie Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie im Angebot. Das 2006 als „Vereinigte Bio-Energie AG“ gegründete Unternehmen produziert unter anderem an den Standorten Bitterfeld und Schwedt, aber auch in Indien, den USA, Kanada, Schweiz und Ungarn. Verbio zählt dabei zu den Vorreitern für Biokraft-stoffe aus agrarischen Reststoffen wie Mais-, Weizen- und Reisstroh. Durch die Verwendung solcher Reststoffe adressiert Verbio die häufig geäußerte Kritik, dass Biokraftstoffe wichtige Anbauflächen für die Lebensmittelproduktion wegnähmen. Sowohl Ölkonzerne und freie Tankstellen wie auch Stadtwerke stehen auf der Kundenliste. Seit diesem Sommer beliefert Verbio zudem den europäischen Bio-LNG-Markt, der insbesondere von Lkw-Betreibern genutzt wird. Christoph Schlautmann
Anzeige
Der gebürtige Spanier Abel Samaniego und seine Mitgründer Javier Ferre und Pablo Stahl reduzieren mit ihrer Software Dabbel den Energieverbrauch und CO2-Ausstoß von Geschäfts-gebäuden. Denn diese heizen und lüften viel unflexibler, als es die Arbeitswelt mittlerweile erfordert. „Viel Energie geht durch Fehlsteuerung verloren“, sagt der 34-jäh-rige CEO. Dabbel klinkt sich innerhalb einer Woche in eine bestehende Gebäude-steuerung ein, Künstliche
Intelligenz erkennt in den Sensordaten Verschwendungsmuster und behebt sie. Einsparungen sollen sich nach einem Monat zeigen. Laut Samaniego sind 34 Prozent der Büros weltweit mit Gebäudesteuerungen ausgestattet und damit ein potenzieller Markt für Dabbel. Firmen wie Eon, Com-merzbank und Strabag sind Kunden. 3,6 Millionen Euro Investorengel-der hat das Start-up bekommen, die EU ist mit dem „Climate-KIC“-För-derprogramm dabei. Claudia Scholz
Das Geschäftsmodell des Start-ups Elvah wurde aus der Not geboren: Als im Coronajahr 2020 die Zielmärkte des damaligen IT-Dienstleisters einbra-chen, überlegten die drei Gründer mit ihrem Team, welcher Herausforderung sie sich fortan widmen könnten – und entschie-den sich für Ladesäulen. Das Problem, das Elvah-
Chef Gowrynath Sivaganes-hamoorthy lösen will: Auf E-Autofahrer warten an Ladesäulen verschiedene Preise – je nachdem, über welchen Anbieter sie zahlen. Die Idee von Elvah: eine Flatrate. „Damit geben wir unseren Kunden und Kundinnen die Kontrolle über ihre monatlichen Aus-gaben“, so Sivaganeshamoorthy. Der 43-Jährige, der mehr als 20 Jahre lang im IT-Bereich für Marken wie MTV und Uefa gearbeitet hat, will dazu eine intelligente App nutzen. Die soll ermitteln, welche Säulen für das jeweilige E-Auto funktionieren. Ein paar Investoren hat Elvah bereits überzeugt: Im September sammelte das Start-up 3,2 Millionen Euro von Business-Angels ein. Die Gespräche für eine weitere Finanzierungsrunde laufen. Catiana Krapp
Fünf Doktorarbeiten, eine große Erkenntnis: Um all die entstehenden Solaranla-gen, Windräder und Ladesäulen in das Strom-netz zu integrieren und zu managen, ist neue Soft-ware erforderlich. Denn die Netze stehen vor nie da gewesenen Herausforderun-gen: Der Strom stammt aus Tausenden Quellen, und es kommen immer neue Verbraucher hinzu. „Die Stromnetze sind der zentrale Flaschenhals für eine erfolgreiche Energie-wende“, sagt Simon
Koopmann. Der ehemalige Student der RWTH Aachen hat deshalb im Jahr 2017 mit vier Kom-militonen das Start-up Envelio gegründet – und eine „Intelligent Grid Platform“ entwickelt. In zwei Finanzierungsrunden hat Envelio insgesamt sieben Millionen Euro eingesammelt. Mittlerweile arbei-ten bei dem Unternehmen mehr als 70 Menschen für über 35 Kunden, darunter die Netzgesellschaft Rheinenergie und der Verteil-netzbetreiber Westnetz. Geld verdient das Start-up noch nicht. Schließlich wolle Envelio innerhalb Europas expandieren, so Koop-mann. Das Unternehmen sei aber auf dem Weg in Richtung Profita-bilität. Catiana Krapp
Grüne Pioniere
56 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
37. Petra Wehlert Nachhaltigkeit stärker am Kapitalmarkt ver-ankern – dieser Mission hat sich Petra Wehlert seit Jahren verschrieben. Die 53-Jährige leitet seit 2016 das Kapitalmarktgeschäft der KfW und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die staatliche Förderbank heute zu den wichtigsten Emittenten „grüner“ Anleihen zählt, bei denen die eingesammelten Mittel dem Klimaschutz zugutekommen. Blickt man auf das Volumen der ausstehenden Anleihen, ist die KfW nach Frankreich derzeit die zweitgrößte Green-Bond-Emittentin der Welt.In Deutschland zählte das staatliche Förderinsti-tut zu den Pionieren dieser Finanzierungsform. Wehlert hatte zusammen mit dem damaligen Treasury-Chef Frank Czichowski dafür gesorgt, dass sich die KfW 2014 erstmals über den da gerade entstehenden Markt der „Green Bonds“ Geld beschaffte. Das bot sich an – schließlich zählt das Förderinstitut, das zu 80 Prozent dem Bund und zu 20 Prozent den Bundesländern gehört, ohnehin zu den größten Klimaschutz-finanzierern weltweit. „Damals gab es erste Investoren, die ganz bewusst in nachhaltige Produkte anlegen wollten, aber uns war wichtig, diese Anlageklas-se aus der Nische in den Mainstream zu brin-gen“, erklärt Wehlert. Um das zu erreichen, warb die Kapitalmarktexpertin der KfW auch in
Gesprächen mit klassischen Investoren für die grünen Anleihen. Und sie sorgte dafür, dass die grünen KfW-Bonds große Volumina haben und in vielen Laufzeiten verfügbar sind. Das macht sie für Großanleger interessanter.Parallel dazu hat sich die KfW stets aktiv für die Entwicklung von Standards eingesetzt, damit eine funktionierende Infrastruktur für Green Bonds entsteht. „Wir haben zum Beispiel extern bestätigen lassen, dass unsere grünen Anleihen allen Kriterien entsprechen, obwohl wir das als KfW vielleicht gar nicht gebraucht hätten“, erklärt Wehlert. „Uns war wichtig, dass da ein Markt mit glaubwürdigen, sicheren Strukturen entsteht, den auch andere Emittenten nutzen können.“Der Sprung aus der Nische ist den grünen Anleihen längst geglückt: Sechs Jahre nach der KfW lieh sich 2020 erstmals auch die Bundes-republik Deutschland auf diesem Wege Geld. Im Oktober platzierte die Europäische Union den mit zwölf Milliarden Euro bislang größten Green Bond der Welt zur Finanzierung des Corona-Wiederaufbaufonds. Die Nachfrage von Investoren ist mittlerweile so groß, dass sich Emittenten wie die KfW über solch nachhaltige Anleihen zum Teil sogar zu günstigeren Konditio-nen Geld leihen können als über konventionelle Bonds. Yasmin Osman
Dab
bel
34. Abel Samaniego
Elva
h
35. Gowrynath Sivaganeshamoorthy
Enve
lio
36. Simon Koopmann
KfW
57WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215M
ixte
rest
ing
38. Franz Haller Es gibt keinen Werkstoff auf der Welt, der in größe-ren Mengen verbraucht wird als Beton – und nur wenige, deren Produktion so viel CO2 verursacht. Der Grund dafür ist der im Beton als Bindemittel enthaltene Zement, bei dessen Herstellung CO2 als Prozessgas entsteht. Allein in Deutschland emittiert die Zementbranche so ins-gesamt rund 20 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Franz Haller, Gründer des Start-
ups Mixteresting, will dabei helfen, diese Menge zu reduzieren – und zwar mithilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI), die das optimale Mischverhältnis für den Beton berechnet, der neben Zement auch aus Gestein und Wasser besteht. Dabei lässt sich mit der Software auch der Einsatz von alternativen Bestandteilen wie recyceltem Altbeton oder etwa granuliertem Plastik modellieren, was den Einsatz von Beton insgesamt nachhaltiger machen könnte. Die Planungsdauer soll sich durch die KI-Software von Mixteresting um bis zu 90 Prozent gegenüber konventionellen Berechnungs- methoden reduzieren. Kevin Knitterscheidt
Uta
Wag
ner
39. Thomas Grübler Thomas Grübler hat mit seinen Co-Gründern Björn Stoffers, Rupert Amann und Florian Mauracher eine der verheerendsten Auswir-kungen des Klimawandels zum Geschäftsmodell gemacht. Ihr Start-up Ororatech sammelt Bilder von Wettersatelliten, um Waldbrände weltweit schneller zu erkennen und Löschflugzeuge auto-matisch starten zu lassen. Die Kunden erhalten außerdem noch weitere
Daten, die für Löschmaßnahmen wichtig sind, etwa darüber, wie feucht der Boden ist. „Wir nutzen mittlerweile 20 verschiedene Satellitendatenquellen und erweitern unsere Algorithmen, um noch mehr einbinden zu können“, erklärt CEO Thomas Grübler. Im Januar startet außerdem der erste Prototyp eines Nanosatelliten mit Infrarot-kamera von Ororatech ins All. Grüblers Vision ist es, in etwa fünf Jahren eine eigene Flotte von rund 100 Kleinstsatelliten ins All gesendet zu haben, die rund um die Uhr Daten erheben. Kunden des Start-ups mit über 40 Mitarbeitern sind etwa die Forestry Corporati-on of New South Wales im Südosten Australiens und die Celulosa Arauco y Constitucíon in Chile, die eine monatliche Gebühr je Beobachtungshektar zahlen. Melanie Raidl
Uta
Wag
ner
40. Michael Waldner Die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien ist für eine grüne Zukunft essenziell, doch dazu muss dieser Strom sich auch ohne hohe Subventionen erst einmal im Markt behaupten. Michael Waldner hat mit seinem Start-up Pexapark eine Plattform entwickelt, die bei der Preisgestaltung und Optimierung von Stromverträgen zwischen den Anbietern von Erneuerbaren und ihren Abnehmern hilft. Mehr als 80 Unternehmen verwenden bereits die Software des Züricher Start-ups, mit der sie den Energieverkauf ihrer Wind- und
Solarparks verwalten oder Grünstrom einkaufen können. Zu den Kunden gehören etwa RWE, BP und Uniper. Gegründet hat Waldner das Unternehmen 2017 mit Florian Müller und Luca Pedretti, als erneuer-bare Energien den Wandel von einem subventionierten System zu einem offenen Markt erlebten. CEO Waldner hat vor der Pexa-park-Gründung 20 Jahre bei Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und im Portfoliomanagement gearbeitet. Melanie Raidl
Uta
Wag
n
Jan
Zapp
ner
/
41. Claus Sauter Das seit vergangenem Dezember im SDax notier-te Leipziger Unternehmen Verbio gilt als Europas einziger großindustrieller Produzent von Biodie-sel, Bioethanol und Biomethan. Die von Claus Sauter geführte Firma schafft es mit ihren Kraftstoffen, den Kohlendioxidausstoß im Ver-gleich zu Benzin oder Diesel um 90 Prozent zu senken. Zudem hat Verbio Biodünger und Futter-mittel sowie Rohstoffe für die Pharma-, Kosmetik- und Nahrungsmittelindustrie im Angebot. Das 2006 als „Vereinigte Bio-Energie AG“ gegründete Unternehmen produziert unter anderem an den Standorten Bitterfeld und Schwedt, aber auch in Indien, den USA, Kanada, Schweiz und Ungarn. Verbio zählt dabei zu den Vorreitern für Biokraft-stoffe aus agrarischen Reststoffen wie Mais-, Weizen- und Reisstroh. Durch die Verwendung solcher Reststoffe adressiert Verbio die häufig geäußerte Kritik, dass Biokraftstoffe wichtige Anbauflächen für die Lebensmittelproduktion wegnähmen. Sowohl Ölkonzerne und freie Tankstellen wie auch Stadtwerke stehen auf der Kundenliste. Seit diesem Sommer beliefert Verbio zudem den europäischen Bio-LNG-Markt, der insbesondere von Lkw-Betreibern genutzt wird. Christoph Schlautmann
Anzeige
Seit Jahrhunderten schon gehören Stahlwerke zu den größten CO2-Verursachern überhaupt. Für die Produk-tion einer Tonne Stahl wird in etwa die doppelte Menge an CO2 freigesetzt. Entsprechend groß ist der Druck auf die Branche, neue Verfahren zu ent-wickeln. Als Chief Technolo-gy Officer (CTO) des Düsseldorfer Stahlwerkaus-rüsters SMS Group treibt
Hans Ferkel diese Transfor-mation an vorderster Front voran. So baut der Konzern etwa Anlagen für die wasserstoffbasierte Stahlproduktion, bei der die Kohle im Produktionsprozess durch das klimaneutral verbrennende Gas ersetzt werden kann. Oder investiert in die Entwicklung von Solar-technologien, die in Zukunft Prozesswärme für die Metallverarbei-tung erzeugen können. Dabei hilft Ferkel seine jahrzehntelange Erfahrung in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Stahlherstellern und -verbrauchern, darunter bei Branchengrößen wie Volkswagen und Thyssen-Krupp. Kevin Knitterscheidt
Eigentlich ist Andreas Bett Leiter des Fraunhofer- Instituts für Solare Energie-systeme. Wenn er aber nicht gerade die jüngsten Entwicklungen im Bereich Photovoltaik analysiert, gründet er auch schon mal eines der innovativsten Solar-Start-ups, die Deutschland seit Langem gesehen hat. Mit einem neuartigen Verfahren zur preiswerten und ressour-
censchonenden Herstel-lung von Silizium-Wafern für Photovoltaikanlagen will Nexwafe die Herstellungskosten um die Hälfte reduzieren und den CO2-Ausstoß gleich um 70 Prozent. Die Technologie ist so überzeugend, dass der indische Multimilliardär Mukesh Ambani eine strategische Partner-schaft mit dem Start-up eingegangen ist. Ambanis Solartochter Reliance New Energy Solar führte eine 39-Millionen-Euro-Investitions-runde bei der sechs Jahre alten Firma an. Genug Kapital, um die Gigafabrik im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld aufzubauen, mit der Nexwafe in die Massenproduktion starten will. Kathrin Witsch
Grüne Pioniere
58 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
45. Daniel HannemannGroßspeicher haben eine wichtige Aufgabe: Sie könnten in Zukunft dabei helfen, die schwanken-den Energiemassen aus Wind und Sonne besser in das Stromnetz zu integrieren. Aktuell sprin-gen vorrangig noch Kohle-, Gas- und Atomkraft-werke ein, wenn die Erneuerbaren nicht liefern können. Gerade bei kurzfristigen Lastspitzen aber, zum Beispiel wenn gleichzeitig viele Elektroautos an einer Schnellladesäule hängen, könnten Speicher einspringen, damit das Netz nicht überlastet wird. Einer der größten Produzenten solcher Netzspei-cher ist Tesvolt. Das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt produziert Großspeicher für gewerbliche Kunden. 2018 bekam Tesvolt den Deutschen Gründerpreis. 2020 wurde das Unternehmen zu den 100 Top-Innovatoren des Jahres gekürt. Gegründet hat Tesvolt 2014 Daniel Hannemann. Die Idee hatte er in seinem alten Job, in dem er Photovoltaiksysteme speziell für Landwirte mit eigenen Solar- oder Windturbinen betreute. Als seine Kunden immer wieder nach effizienteren Speichereinheiten fragten, entwickelten er und sein Mitgründer Simon Schandert einen ersten Prototyp. Inzwischen hat Tesvolt in Wittenberg mit der
Arbeit an Europas erster Gigafabrik für kommer-zielle Batteriespeichersysteme begonnen. Hannemann ist überzeugt: ohne Speicher keine Energiewende. Das scheinen auch immer mehr Kunden einzusehen. „Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Hannemann. Auf sechs Kontinenten und in über 30 Ländern ist Tesvolt mittlerweile mit mehr als 100 Mitarbeitern aktiv und zählt damit zu den größten Netzspeicheranbietern Europas.Gerade erst hat das Unternehmen einen Großauftrag im Wert von 40 Millionen Euro eingetütet: Die Apex Group aus Rostock ver-sorgt weltweit Industrieunternehmen emissions-frei mit Wärme und Strom, die aus grünem Wasserstoff gewonnen werden. Bei der Wasser-stoff-Elektrolyse wird Energie aus Solar- und Windkraftanlagen benötigt. Liefern die mal nicht genug Strom, versorgen die Hochleistungs-stromspeicher den Elektrolyseur mit zwischen-gespeicherter grüner Überschussenergie. Geschäftsführer Hannemann sprach mit Blick auf den Auftrag von einem Meilenstein. 2025, ist er überzeugt, wird die Netzintegration seiner Speicher mit der steigenden Anzahl Erneuer-barer dann richtig losgehen. Kathrin Witsch
Frau
nhof
er IS
E
42. Andreas Bett
Alc
emy
43. Leopold Spenner und Robert Meyer
Das Start-up von Leopold Spenner und Robert Meyer, Alcemy, bietet eine Software, die während der Herstellung von Zement und Beton Daten über deren Beschaffenheit sammelt. „Wir können dadurch die Präzision der Produktion unserer Kunden und den Automatisierungs-grad erhöhen“, erklärt CEO Spenner. Vor allem die Verwendung von nachhaltigem Beton soll durch die Software leichter werden. Spen-ner: „Grünen Beton, in dem fast der gesamte Zementklinker durch CO2-freie Kalksteinmehle oder calcinierte Tone ersetzt wird, gibt es im Labor schon seit Jahrzehnten.“ Allerdings würden diese Stoffe hohe Qualitätsanforderungen mit sich bringen und bis zu dreimal so viel kosten wie herkömmliche Ware. Mithilfe der Software werde grüner Beton praxistauglicher gemacht, so Spenner. Der Wirtschafts-ingenieur, der selbst aus einem Familienbetrieb für Zement und Beton kommt, startete Alcemy 2019 zusammen mit Robert Meyer. Zu den Kunden zählen neben dem eigenen Familienunternehmen die Zement- und Betonfirmen Märker und Rohrdorfer aus Süd-deutschland. Melanie Raidl
SMS
Gro
up
44. Hans Ferkel
priv
at
46. Sebastian Heitmann
Wer einen Start-up-Fonds managt, interessiert sich üblicherweise für Kennzahlen wie Wachs-tums- und Konversionsraten, Verbleibquoten oder die Dauer von Kundenbeziehungen. Doch bei Sebastian Heitmann, Gründer und
Geschäftsführer des Venture-Capital-Fonds Extantia, kommt auch die Klimabilanz hinzu. Denn der Berliner Fonds investiert nur in solche Unternehmen, deren Geschäftsmodell nachweislich mindestens eine Gigatonne CO2 pro Jahr einspart. In Anlehnung an den Begriff „Unicorns“, also Einhörner, für Start-ups, die mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet werden, spricht Heitmann dabei von „Gigacorns“. Eines davon könnte das Invest-ment Ineratec werden, das Produktions- anlagen für E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, herstellt, die etwa im Schiffsverkehr benötigt werden. Das Einsparpotenzial der Technologie entspricht laut Extantias „Head of Carbon Math“, dem britischen Nachhaltigkeits- experten Francesco Pomponi, den Emissionen von bis zu 250 Millionen Autos. Kevin Knitterscheidt
Uta
Wag
ner
59WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
47. Saori Dubourg Das Thema Nachhaltigkeit war für Saori Dubourg nicht unbedingt vorgezeichnet, als sie Mitte der 1990er-Jahre ihre Industriekar-riere bei der BASF begann. Der Vertrieb von Dispersionen und Pigmenten gehörte damals zu den ersten Stationen der gelern-ten Betriebswirtin und Marketingexpertin. Doch je weiter die Deutsch-Japanerin in den Führungsrängen des Chemieriesen nach oben rückte, desto intensiver musste sie sich mit Fragen der Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sei es als Leiterin des BASF-Projekts „Diversity & Inclusion“ oder als Chefin der BASF-Agrospar-te. Seit 2017 im Vorstand des Ludwigshafe-ner Konzerns, leitet sie heute neben der Agrosparte und dem Bereich Ernährung und Pflege auch den „Corporate Sustainability Board“, der als zentrales Steuerungsorgan der BASF für nachhaltige Entwicklung sowohl Nachhaltigkeitsziele für den Konzern definiert als auch über deren Umsetzung wacht. Dubourg ist damit eine treibende Kraft hinter der Nachhaltigkeitsstrategie der BASF und dürfte maßgeblich an den ambitio-nierten Klimazielen des Chemieriesen mitformuliert haben. Bis 2030 will der seine CO2-Emissionen um 25 Prozent reduzieren, ab 2050 komplett klimaneutral arbeiten. Für den Chemiekonzern mit seiner energie-intensiven Produktion ist das eine riesige
Herausforderung. Dessen ungeachtet reicht das Engagement der Managerin inzwischen längst über BASF hinaus. In der „High-Level Industrial Group“ der EU-Kommission etwa wirkte sie unter anderem an einem gemein-samen Visionspapier zu Europa 2030 mit. Als einer der führenden Vertreter in der von acht Großkonzernen gegründeten Wertealli-anz setzt sich Dubourg für ein ganzheitliche-res Werteverständnis in der Bilanzierung ein. Ziel ist es dabei, über die klassischen Erträge hinaus auch die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gesamtwirtschaft zu berücksichtigen. Seit dem vergangenen Jahr ist Dubourg zudem Mitglied im „Rat für Nachhaltige Entwicklung“, der die Bundes-regierung berät. Ein zentrales Thema für die BASF-Managerin auch hier: nachhaltige Entwicklung und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen. Die Transformation in ein werte-bestimmtes und ressourceneffizientes Zeitalter gelinge dann, argumentiert Du-bourg, „wenn wir gesellschaftliche und ökologische Verantwortung mit ökonomi-schem Erfolg in einer Verantwortungsebene denken“. Dieser Wandel erfordert aus Sicht der Topmanagerin auch neue innovative Finanzierungsformen sowie „eine neue Kooperationsfähigkeit zwischen Staat, Unternehmen und Gesellschaft“. Dubourg arbeitet dran. Siegfried Hofmann
Cov
estr
o
48. Lynette Chung Das Ziel ist ambitioniert: Der Kunststoffhersteller Covestro will sich langfris-tig komplett von Öl und Gas verabschieden – also von den heute zu mehr als 90 Prozent dominierenden Rohstoffen und Energieträ-gern. Den Wandel zu grüner Energie und erneuerbaren Rohstoffen treibt Lynette Chung in führender Positi-on mit voran. Als Head of Global Sustainability verantwortet die 44-Jährige
die Nachhaltigkeitsstrategie bei Covestro. Der Dax-Konzern will nach und nach Kunststoffprodukte aus erneuerbaren Rohstoffquellen wie CO2 und Pflanzen im industriellen Maßstab auf den Markt bringen. Die gesamte Produktion soll auf Kreislaufwirtschaft umgestellt werden, in der Stoffe wiederverwendet werden. Die gebürtige Schwedin Chung verantwortet auf Konzernebene die große Linie dieses Programms. Sie spricht von einem „Sustainable Future Deal“ statt von einem „Green Deal“: Nachhaltigkeit müsse aus einem ausgewogenen Verhältnis von ökonomischen, ökologischen und sozialen Komponenten bestehen. Bert Fröndhoff
Die
tmar
Gus
t, E
urof
orum
49. Patrick Graichen
Als Chef des Thinktanks Agora Energiewende setzt Patrick Graichen seit Jahren geschickt die Themen der energie- und klimapolitischen Debatte. Man darf gespannt sein, wie viele der 22 Ideen und Anre-gungen aus dem „Klimaschutz-Sofortprogramm“, das Agora Energie-wende im August gemeinsam mit der Stiftung Klimaneutralität vorstellte, es am Ende in den Koalitionsvertrag der nächsten Bundes-regierung schaffen. Seit Monaten legen beide Klimainstitutionen mit hoher Schlagzahl Vorschläge für den Umbau der Volkswirtschaft hin zur Klimaneutralität vor, die in einem großen Teil des politischen Spektrums Anklang finden. Graichen, promovierter Volkswirt, arbeitete vor seinem Einstieg bei Agora elf Jahre im Bundesumwelt-ministerium und ist daher mit den politischen Prozessen bestens vertraut – was ihn für die Arbeit in der nächsten Bundesregierung prädestiniert. Klaus Stratmann
ick Graichen
Öko
-Inst
itut
50. Felix Matthes Es dürfte kaum eine relevan-te energie- oder klimapoliti-sche Entscheidung aus den vergangenen Jahren geben, die Felix Matthes als Gut-achter, in Stellungnahmen und Anhörungen, als Mitglied von Expertengre-mien oder Regierungskom-missionen nicht in irgend-einer Form beeinflusst oder gar geprägt hat. Matthes vereint zwei Qualifikationen, die seiner Stimme in energie- und klimapolitischen Fragen Gewicht geben: Er ist Elektroingenieur und promovierter Politologe. Ob Kohlekompromiss oder Wasserstoffstrategie – Matthes’ Bewer-tung ist gefragt. Und das nicht nur in Deutschland. Seit Jahren berät er Regierungen im Ausland, beispielsweise China beim Aufbau des Emissionshandelssystems. Schon 1980 hat er beim Öko-Institut, wo er heute Forschungskoordinator im Bereich Energie- und Klima-schutz ist, das Konzept der „Energiewende“ mitentwickelt. Gern beziehen sich die Grünen auf Matthes, dessen Meinung aber auch in anderen Parteien zählt. Matthes ist verheiratet mit der Berliner Umweltsenatorin Regine Günther. Klaus StratmannB
ASF
Seit Jahrhunderten schon gehören Stahlwerke zu den größten CO2-Verursachern überhaupt. Für die Produk-tion einer Tonne Stahl wird in etwa die doppelte Menge an CO2 freigesetzt. Entsprechend groß ist der Druck auf die Branche, neue Verfahren zu ent-wickeln. Als Chief Technolo-gy Officer (CTO) des Düsseldorfer Stahlwerkaus-rüsters SMS Group treibt
Hans Ferkel diese Transfor-mation an vorderster Front voran. So baut der Konzern etwa Anlagen für die wasserstoffbasierte Stahlproduktion, bei der die Kohle im Produktionsprozess durch das klimaneutral verbrennende Gas ersetzt werden kann. Oder investiert in die Entwicklung von Solar-technologien, die in Zukunft Prozesswärme für die Metallverarbei-tung erzeugen können. Dabei hilft Ferkel seine jahrzehntelange Erfahrung in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Stahlherstellern und -verbrauchern, darunter bei Branchengrößen wie Volkswagen und Thyssen-Krupp. Kevin Knitterscheidt
Eigentlich ist Andreas Bett Leiter des Fraunhofer- Instituts für Solare Energie-systeme. Wenn er aber nicht gerade die jüngsten Entwicklungen im Bereich Photovoltaik analysiert, gründet er auch schon mal eines der innovativsten Solar-Start-ups, die Deutschland seit Langem gesehen hat. Mit einem neuartigen Verfahren zur preiswerten und ressour-
censchonenden Herstel-lung von Silizium-Wafern für Photovoltaikanlagen will Nexwafe die Herstellungskosten um die Hälfte reduzieren und den CO2-Ausstoß gleich um 70 Prozent. Die Technologie ist so überzeugend, dass der indische Multimilliardär Mukesh Ambani eine strategische Partner-schaft mit dem Start-up eingegangen ist. Ambanis Solartochter Reliance New Energy Solar führte eine 39-Millionen-Euro-Investitions-runde bei der sechs Jahre alten Firma an. Genug Kapital, um die Gigafabrik im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld aufzubauen, mit der Nexwafe in die Massenproduktion starten will. Kathrin Witsch
Grüne Pioniere
58 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
45. Daniel HannemannGroßspeicher haben eine wichtige Aufgabe: Sie könnten in Zukunft dabei helfen, die schwanken-den Energiemassen aus Wind und Sonne besser in das Stromnetz zu integrieren. Aktuell sprin-gen vorrangig noch Kohle-, Gas- und Atomkraft-werke ein, wenn die Erneuerbaren nicht liefern können. Gerade bei kurzfristigen Lastspitzen aber, zum Beispiel wenn gleichzeitig viele Elektroautos an einer Schnellladesäule hängen, könnten Speicher einspringen, damit das Netz nicht überlastet wird. Einer der größten Produzenten solcher Netzspei-cher ist Tesvolt. Das Unternehmen aus Sachsen-Anhalt produziert Großspeicher für gewerbliche Kunden. 2018 bekam Tesvolt den Deutschen Gründerpreis. 2020 wurde das Unternehmen zu den 100 Top-Innovatoren des Jahres gekürt. Gegründet hat Tesvolt 2014 Daniel Hannemann. Die Idee hatte er in seinem alten Job, in dem er Photovoltaiksysteme speziell für Landwirte mit eigenen Solar- oder Windturbinen betreute. Als seine Kunden immer wieder nach effizienteren Speichereinheiten fragten, entwickelten er und sein Mitgründer Simon Schandert einen ersten Prototyp. Inzwischen hat Tesvolt in Wittenberg mit der
Arbeit an Europas erster Gigafabrik für kommer-zielle Batteriespeichersysteme begonnen. Hannemann ist überzeugt: ohne Speicher keine Energiewende. Das scheinen auch immer mehr Kunden einzusehen. „Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Hannemann. Auf sechs Kontinenten und in über 30 Ländern ist Tesvolt mittlerweile mit mehr als 100 Mitarbeitern aktiv und zählt damit zu den größten Netzspeicheranbietern Europas.Gerade erst hat das Unternehmen einen Großauftrag im Wert von 40 Millionen Euro eingetütet: Die Apex Group aus Rostock ver-sorgt weltweit Industrieunternehmen emissions-frei mit Wärme und Strom, die aus grünem Wasserstoff gewonnen werden. Bei der Wasser-stoff-Elektrolyse wird Energie aus Solar- und Windkraftanlagen benötigt. Liefern die mal nicht genug Strom, versorgen die Hochleistungs-stromspeicher den Elektrolyseur mit zwischen-gespeicherter grüner Überschussenergie. Geschäftsführer Hannemann sprach mit Blick auf den Auftrag von einem Meilenstein. 2025, ist er überzeugt, wird die Netzintegration seiner Speicher mit der steigenden Anzahl Erneuer-barer dann richtig losgehen. Kathrin Witsch
Frau
nhof
er IS
E
42. Andreas Bett
Alc
emy
43. Leopold Spenner und Robert Meyer
Das Start-up von Leopold Spenner und Robert Meyer, Alcemy, bietet eine Software, die während der Herstellung von Zement und Beton Daten über deren Beschaffenheit sammelt. „Wir können dadurch die Präzision der Produktion unserer Kunden und den Automatisierungs-grad erhöhen“, erklärt CEO Spenner. Vor allem die Verwendung von nachhaltigem Beton soll durch die Software leichter werden. Spen-ner: „Grünen Beton, in dem fast der gesamte Zementklinker durch CO2-freie Kalksteinmehle oder calcinierte Tone ersetzt wird, gibt es im Labor schon seit Jahrzehnten.“ Allerdings würden diese Stoffe hohe Qualitätsanforderungen mit sich bringen und bis zu dreimal so viel kosten wie herkömmliche Ware. Mithilfe der Software werde grüner Beton praxistauglicher gemacht, so Spenner. Der Wirtschafts-ingenieur, der selbst aus einem Familienbetrieb für Zement und Beton kommt, startete Alcemy 2019 zusammen mit Robert Meyer. Zu den Kunden zählen neben dem eigenen Familienunternehmen die Zement- und Betonfirmen Märker und Rohrdorfer aus Süd-deutschland. Melanie Raidl
SMS
Gro
up
44. Hans Ferkel
priv
at
46. Sebastian Heitmann
Wer einen Start-up-Fonds managt, interessiert sich üblicherweise für Kennzahlen wie Wachs-tums- und Konversionsraten, Verbleibquoten oder die Dauer von Kundenbeziehungen. Doch bei Sebastian Heitmann, Gründer und
Geschäftsführer des Venture-Capital-Fonds Extantia, kommt auch die Klimabilanz hinzu. Denn der Berliner Fonds investiert nur in solche Unternehmen, deren Geschäftsmodell nachweislich mindestens eine Gigatonne CO2 pro Jahr einspart. In Anlehnung an den Begriff „Unicorns“, also Einhörner, für Start-ups, die mit mindestens einer Milliarde US-Dollar bewertet werden, spricht Heitmann dabei von „Gigacorns“. Eines davon könnte das Invest-ment Ineratec werden, das Produktions- anlagen für E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, herstellt, die etwa im Schiffsverkehr benötigt werden. Das Einsparpotenzial der Technologie entspricht laut Extantias „Head of Carbon Math“, dem britischen Nachhaltigkeits- experten Francesco Pomponi, den Emissionen von bis zu 250 Millionen Autos. Kevin Knitterscheidt
Uta
Wag
ner
59WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
47. Saori Dubourg Das Thema Nachhaltigkeit war für Saori Dubourg nicht unbedingt vorgezeichnet, als sie Mitte der 1990er-Jahre ihre Industriekar-riere bei der BASF begann. Der Vertrieb von Dispersionen und Pigmenten gehörte damals zu den ersten Stationen der gelern-ten Betriebswirtin und Marketingexpertin. Doch je weiter die Deutsch-Japanerin in den Führungsrängen des Chemieriesen nach oben rückte, desto intensiver musste sie sich mit Fragen der Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, sei es als Leiterin des BASF-Projekts „Diversity & Inclusion“ oder als Chefin der BASF-Agrospar-te. Seit 2017 im Vorstand des Ludwigshafe-ner Konzerns, leitet sie heute neben der Agrosparte und dem Bereich Ernährung und Pflege auch den „Corporate Sustainability Board“, der als zentrales Steuerungsorgan der BASF für nachhaltige Entwicklung sowohl Nachhaltigkeitsziele für den Konzern definiert als auch über deren Umsetzung wacht. Dubourg ist damit eine treibende Kraft hinter der Nachhaltigkeitsstrategie der BASF und dürfte maßgeblich an den ambitio-nierten Klimazielen des Chemieriesen mitformuliert haben. Bis 2030 will der seine CO2-Emissionen um 25 Prozent reduzieren, ab 2050 komplett klimaneutral arbeiten. Für den Chemiekonzern mit seiner energie-intensiven Produktion ist das eine riesige
Herausforderung. Dessen ungeachtet reicht das Engagement der Managerin inzwischen längst über BASF hinaus. In der „High-Level Industrial Group“ der EU-Kommission etwa wirkte sie unter anderem an einem gemein-samen Visionspapier zu Europa 2030 mit. Als einer der führenden Vertreter in der von acht Großkonzernen gegründeten Wertealli-anz setzt sich Dubourg für ein ganzheitliche-res Werteverständnis in der Bilanzierung ein. Ziel ist es dabei, über die klassischen Erträge hinaus auch die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Gesamtwirtschaft zu berücksichtigen. Seit dem vergangenen Jahr ist Dubourg zudem Mitglied im „Rat für Nachhaltige Entwicklung“, der die Bundes-regierung berät. Ein zentrales Thema für die BASF-Managerin auch hier: nachhaltige Entwicklung und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen. Die Transformation in ein werte-bestimmtes und ressourceneffizientes Zeitalter gelinge dann, argumentiert Du-bourg, „wenn wir gesellschaftliche und ökologische Verantwortung mit ökonomi-schem Erfolg in einer Verantwortungsebene denken“. Dieser Wandel erfordert aus Sicht der Topmanagerin auch neue innovative Finanzierungsformen sowie „eine neue Kooperationsfähigkeit zwischen Staat, Unternehmen und Gesellschaft“. Dubourg arbeitet dran. Siegfried Hofmann
Cov
estr
o
48. Lynette Chung Das Ziel ist ambitioniert: Der Kunststoffhersteller Covestro will sich langfris-tig komplett von Öl und Gas verabschieden – also von den heute zu mehr als 90 Prozent dominierenden Rohstoffen und Energieträ-gern. Den Wandel zu grüner Energie und erneuerbaren Rohstoffen treibt Lynette Chung in führender Positi-on mit voran. Als Head of Global Sustainability verantwortet die 44-Jährige
die Nachhaltigkeitsstrategie bei Covestro. Der Dax-Konzern will nach und nach Kunststoffprodukte aus erneuerbaren Rohstoffquellen wie CO2 und Pflanzen im industriellen Maßstab auf den Markt bringen. Die gesamte Produktion soll auf Kreislaufwirtschaft umgestellt werden, in der Stoffe wiederverwendet werden. Die gebürtige Schwedin Chung verantwortet auf Konzernebene die große Linie dieses Programms. Sie spricht von einem „Sustainable Future Deal“ statt von einem „Green Deal“: Nachhaltigkeit müsse aus einem ausgewogenen Verhältnis von ökonomischen, ökologischen und sozialen Komponenten bestehen. Bert Fröndhoff
Die
tmar
Gus
t, E
urof
orum
49. Patrick Graichen
Als Chef des Thinktanks Agora Energiewende setzt Patrick Graichen seit Jahren geschickt die Themen der energie- und klimapolitischen Debatte. Man darf gespannt sein, wie viele der 22 Ideen und Anre-gungen aus dem „Klimaschutz-Sofortprogramm“, das Agora Energie-wende im August gemeinsam mit der Stiftung Klimaneutralität vorstellte, es am Ende in den Koalitionsvertrag der nächsten Bundes-regierung schaffen. Seit Monaten legen beide Klimainstitutionen mit hoher Schlagzahl Vorschläge für den Umbau der Volkswirtschaft hin zur Klimaneutralität vor, die in einem großen Teil des politischen Spektrums Anklang finden. Graichen, promovierter Volkswirt, arbeitete vor seinem Einstieg bei Agora elf Jahre im Bundesumwelt-ministerium und ist daher mit den politischen Prozessen bestens vertraut – was ihn für die Arbeit in der nächsten Bundesregierung prädestiniert. Klaus Stratmann
ick Graichen
Öko
-Inst
itut
50. Felix Matthes Es dürfte kaum eine relevan-te energie- oder klimapoliti-sche Entscheidung aus den vergangenen Jahren geben, die Felix Matthes als Gut-achter, in Stellungnahmen und Anhörungen, als Mitglied von Expertengre-mien oder Regierungskom-missionen nicht in irgend-einer Form beeinflusst oder gar geprägt hat. Matthes vereint zwei Qualifikationen, die seiner Stimme in energie- und klimapolitischen Fragen Gewicht geben: Er ist Elektroingenieur und promovierter Politologe. Ob Kohlekompromiss oder Wasserstoffstrategie – Matthes’ Bewer-tung ist gefragt. Und das nicht nur in Deutschland. Seit Jahren berät er Regierungen im Ausland, beispielsweise China beim Aufbau des Emissionshandelssystems. Schon 1980 hat er beim Öko-Institut, wo er heute Forschungskoordinator im Bereich Energie- und Klima-schutz ist, das Konzept der „Energiewende“ mitentwickelt. Gern beziehen sich die Grünen auf Matthes, dessen Meinung aber auch in anderen Parteien zählt. Matthes ist verheiratet mit der Berliner Umweltsenatorin Regine Günther. Klaus StratmannB
ASF
Karriere
60 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Julia Wäschenbach Köln
Der Arbeitsmarkt steht gerade an einem Wendepunkt: Im September hatten Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) festgestellt, dass 390.000 Fachkräfte fehlen. Das sind gut 50.000 mehr als noch vor Corona. Die Zeiten, in denen die Pandemie den Job-
markt eintrübte, sind damit erst einmal vorbei. Die Unternehmen suchen wieder kräftig – bloß finden sie oft nicht die passenden Leute.
Eigentlich Idealbedingungen für Bewerberin-nen und Bewerber. Trotzdem fragt sich so man-cher Kandidat aktuell: „Soll ich mich wirklich jetzt bewerben? Ende des Jahres machen das doch fast alle, oder? Und wer sagt bei steigenden Inzidenzen denn, dass die Coronakrise nicht bald doch wieder der Wirtschaft zu schaffen macht?“
Falsch gedacht, sagen Experten. Hier sind sie-ben Gründe, warum der Arbeitgeberwechsel ge-rade jetzt eine gute Idee ist und dieser November ein besonderer für die Jobsuche ist.
1. Ihre Chancen stehen gut trotz oder wegen CoronaCorona hat den Jobmarkt durcheinandergewir-belt. „Plötzlich passieren Dinge, die man nicht er-wartet hätte“, sagt Job-Expertin Annina Hering vom „Hiring Lab“ der Job-Suchmaschine Indeed. Die Anzahl der offenen Stellen auf dem Portal In-deed liegt demnach aktuell 40 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie.
Die Auswahl für Jobsuchende ist derzeit also groß – viel größer, als es vor der Pandemie um diese Jahreszeit der Fall war. Wer jetzt auf Job-suche geht, hat gute Chancen und nicht viel Kon-kurrenz (siehe Artikel rechts), weil viele Wech-selwillige noch abwarten wollen, bis die Corona-Pandemie endgültig überstanden ist.
2. Jahresend-Flaute ist ein Mythos„Häufig besteht die Annahme, dass gegen Jahres-ende auf dem Bewerbermarkt nicht mehr viel pas-siert“, sagt Emine Yilmaz, Vice President beim Per-sonaldienstleister Robert Half. Das Gegenteil ist richtig: „Besonders in den letzten Wochen des Jah-res kann es sich lohnen, auf Jobsuche zu gehen.“
Unternehmen, die ihr Jahresbudget im No-vember noch nicht ausgeschöpft haben, können zum Beispiel durchaus Interesse daran haben, of-fene Stellen im vierten Quartal zu besetzen. Allein die 40 Dax-Unternehmen haben zusammenge-rechnet laut Indeed derzeit mehr als 18.000 Stel-len ausgeschrieben. Vor allem im IT- und Per-sonalbereich werden Leute gesucht, aber auch In-genieurinnen und Ingenieure sind bei großen Industrieunternehmen weiter gefragt.
3. Im neuen Jahr erwacht die KonkurrenzDer Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze – und der Neuanfänge. Dementsprechend suchen besonders viele Menschen im Januar einen neuen Job. Doch wer seine Jobsuche auf Januar ver-schiebt, auch, weil er vielleicht denkt, dass Un-ternehmen erst im neuen Jahr wieder einstellen, muss sich im Zweifelsfall gegen viel Konkurrenz durchsetzen. Im November dagegen ist das Ver-hältnis von offenen Stellen und Bewerbern we-sentlich günstiger.
4. Pokern Sie ruhig hochFassen Sie Mut, und denken Sie groß! „Gerade, weil der Jobmarkt aktuell so eng ist, hat man die Möglichkeit, Stellen zu ergattern, die man vor ein paar Monaten vielleicht noch nicht bekommen hätte“, sagt Annina Hering von Indeed.
Jobsuchende dürfen ruhig wählerisch sein und auch mehrere Jobangebote einholen, bevor sie sich für das beste entscheiden. Diesen Eindruck bestätigt Emine Yilmaz von Robert Half: „Wir se-
hen, dass viele Unternehmen im Moment einstel-len und gute Bewerber rar sind.“
Das darf sich auch beim Gehalt widerspiegeln. Verhandlungstrainerin Claudia Kimich rät, beim neuen Arbeitgeber ein Plus von zehn bis 20 Pro-zent beim Gehalt draufzuschlagen. „Mit deutlich weniger würde ich mich nicht zufriedengeben.“
5. Es muss nicht mehr das Unternehmen vor Ort seinIn der Corona-Pandemie hat sich das Arbeiten aus dem Homeoffice erfolgreich etabliert. „Man kann sich also in einem viel größeren Radius bewerben und nicht bloß in der Stadt, in der man wohnt“, sagt Job-Expertin Yilmaz. „Das hat Vorteile für beide Seiten.“
Fast zehn Prozent aller Stellenausschreibun-gen enthalten laut Indeed aktuell den Hinweis, dass Homeoffice möglich ist. Viele Arbeitgeber seien dafür offener geworden, sagt Indeed-Exper-tin Annina Hering: „Wenn es nicht in der Stel-lenanzeige steht, würde ich auf jeden Fall danach fragen.“
Wer am 1. Januar einen neuen Job antreten will, kann so auch erst einmal von zu Hause aus arbeiten und den Umzug später angehen.
6. Gute Kontakte sind der Schlüssel zum Erfolg„Es ist branchen- und positionsabhängig, ob eine klassische Bewerbung oder das Netzwerk der bessere Weg zum neuen Job ist“, sagt Emine Yil-
Bewerbung
Gesucht – und nicht gefunden
Jobs für Hochqualifizierte gibt es gerade mehr als genug. Trotzdem zögern viele Bewerber zum Jahresende, ihre Unterlagen einzureichen. Ein Fehler.
Experten verraten, was Sie diesen November bei der Jobsuche beachten müssen.
Wir sehen, dass viele Unternehmen
im Moment einstellen und gute Bewerber rar sind.
Emine YilmazRobert Half
Karriere
61WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
maz vom Personaldienstleister Robert Half. „Dennoch lässt sich beobachten, dass Bewerber mit guten Kontakten erfolgreicher sind.“
Unternehmen setzten verstärkt auf Empfeh-lungen und Referenzen, sagt sie. Außerdem hilft das Netzwerk, Infos über den Job, das Anforde-rungsprofil und den Bewerbungsprozess einzu-holen.
Gerade im Herbst finden besonders viele Jobmessen, Karrieretage und Absolventenkon-gresse statt. Bei der Jobsuche zum Jahresende empfehle es sich auch, Weihnachtsfeiern rele-vanter Branchenverbände zu besuchen und Kontakte zu knüpfen, sagt Yilmaz – sofern es die Pandemie zulässt.
7. Es kann schneller gehen als gedacht„Viele Unternehmen sind schon relativ lange auf der Suche nach Fachkräften“, sagt Indeed-Ex-pertin Annina Hering. „Deshalb gibt es sicher-lich einige, die schnell einstellen wollen.“
Besonders Stellen für kurzfristigen Bedarf sind flott vergeben, sagt Emine Yilmaz von Ro-bert Half. Etwa, damit jemand noch am Jahres-abschluss mitarbeiten kann. Umgekehrt gilt: „Es kann sein, dass sich gerade aufgrund der Weihnachtszeit und der Jahresabschlüsse die Bewerbungsphase und -gespräche zeitlich hi-nauszögern.“
Bei allem Eifer bei der Jobsuche sollten Be-werber natürlich auch immer ihre eigene Kün-digungsfrist im Auge behalten. Wer zum neuen Jahr einen Job haben will und drei Monate Kün-digungsfrist hat, ist schon auf die Kulanz des bisherigen Arbeitgebers angewiesen, um vor-zeitig aus seinem Arbeitsvertrag herauszukom-men.Mitarbeit: Lazar Backovic
D er Fachkräftemangel in Deutschland verschärft sich. Zwei Drittel aller Un-ternehmen suchen derzeit qualifi-ziertes Personal. Das geht aus einer
am Donnerstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Ende 2020 hatten nur 54 Prozent der Firmen damit gerechnet, dass ihnen in diesem Jahr Per-sonal fehlt. Für die Umfrage hatte das Mei-nungsforschungsunternehmen Civey von August bis Oktober insgesamt 7500 Ent-scheiderinnen und Entscheider befragt.
Auch wenn der Arbeitsmarkt sich da-mit wieder deutlich zugunsten der Arbeit-nehmer entwickelt hat, fürchten viele Be-werber die Konkurrenz: „Wer sich wohl noch beworben hat? Und welche Fähigkei-ten die anderen Kandidaten mitbringen?“
Solche Gedanken schießen auch Top-Bewerberinnen und -Bewerbern durch den Kopf, bevor sie ihre Unterlagen ein-reichen. Eine exklusive Auswertung der Jobplattform Indeed für das Handelsblatt macht nun Hoffnung. Die Zahlen zeigen: Es gibt sie noch – die Top-Jobs, bei denen sich die Konkurrenz in Grenzen hält.
Indeed hat dafür aktuelle Stellenprofile mit einem Jahresgehalt von mindestens 70.000 Euro analysiert, die auf der Job-plattform deutlich weniger Resonanz er-hielten als der Durchschnitt. Entscheidend für die Einordnung war die Zahl der Klicks auf die Online-Stellenanzeigen.
Die meisten Jobs mit hohen Gehältern und wenig Konkurrenz sind im Tech- und IT-Bereich angesiedelt. Aber auch andere Jobprofile auf der Liste stechen heraus – und locken mit sechsstelligen Gehältern.
Digitalisierung schafft JobsSo sind beispielsweise die Bewerbungen auf Oberarztstellen verglichen mit dem Vorjahr um 90 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig liegt das Salär dort im Schnitt bei 185.000 Euro. Ähnlich sieht es bei Ja-va-Softwareentwicklern, Cloud-Architek-ten und Oberbauleitern aus. Hier sind Ge-hälter von bis zu 85.000 Euro realistisch.
Auch in den Bereichen E-Commerce, Cloud, SAP-Beratung und IT-Sicherheit haben Jobsuchende gute Karten, genom-men zu werden und dabei Top-Gehälter einzustreichen.
„Die Pandemie hat die Bedeutung und Zukunftsfähigkeit von digitalen Geschäfts-modellen deutlich untermauert“, ordnet Annina Hering, Arbeitsmarktexpertin beim Indeed Hiring Lab, die Ergebnisse ein. „So ist es wenig überraschend, dass Jobsuchende mit einschlägigen IT-Quali-fikationen im Vergleich am wenigsten Wettbewerb um neue Stellen fürchten müssen.“
Indeed hat für die Auswertung soge-nannte Mediangehälter ermittelt. Dabei werden extrem hohe und extrem niedrige Gehaltsangaben in einer Jobgruppe für die Berechnung ausgeklammert.
Wer jedoch denkt, dass hochbezahlte Jobs automatisch wenig Bewerber anzie-hen, der irrt sich. So verdient ein „Data Scientist“ beispielsweise laut Indeed ein Mediangehalt von 75.000 bis 80.000 Euro, allerdings ist die Resonanz auf einen freien Job in dem Bereich 91 Prozent höher als der Durchschnitt.
Ähnlich sieht es bei Fachkräften im Personalbereich aus, den sogenannten Hu-man Resources Specialists. Hier gab es zu-letzt 58 Prozent mehr Bewerber als auf ein Durchschnittsstelleninserat auf Indeed. Lazar Backovic
Karrierechancen
Kaum Bewerber, viel GehaltEine exklusive Auswertung zeigt: Es gibt sie noch – die Top-Jobs mit wenig
Konkurrenz. Bei diesen gut bezahlten Stellen ist die Bewerberresonanz stark gesunken.
Senior-Softwareentwickler Java
Cloud-Architekt
Oberarzt
Oberbauleiter
Solution Architect
Senior-Java-Developer
Cloud-Engineer
SAP-Entwickler
Senior Consultant
Security Consultant
Software-Architekt
SAP-Berater
E-Commerce-Berater
DevOps-Engineer
Verkäufer Sanitär und Heizung
Embedded Softwareentwickler
(Senior) Key-Account-Manager
Senior-Projektmanager
Scrum Master
Big Data Engineer
IT Security Specialist
IT-Projektmanager
Projektleiter
Data-Engineer
Handelsvertreter
70.000
72.500
185.000
85.000
95.000
70.000
75.000
80.000
90.000
70.000
82.500
70.000
72.500
70.000
70.000
70.000
97.500
80.000
75.000
75.000
75.000
100.000
70.000
72.500
100.000
Mediangehaltim Jahr
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-91 %
-91 %
-90 %
-89 %
-88 %
-83 %
-82 %
-82 %
-80 %
-79 %
-79 %
-78 %
-76 %
-73 %
-72 %
-71 %
-71 %
-63 %
-58 %
-57 %
-57 %
-57 %
-47 %
-46 %
-43 %
25 Jobs mit Top-Bezahlung und wenig Konkurrenz
HANDELSBLATT*Entwicklung im Zeitraum Oktober 2020 bis September 2021;
Stand: Oktober 2021 • Quelle: Indeed
Bewerber-interesse*
Gute Bezahlung lockt nicht immer
Berufs-bezeichnung
Get
ty Im
ages
/fSt
op
Karriere
60 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Julia Wäschenbach Köln
Der Arbeitsmarkt steht gerade an einem Wendepunkt: Im September hatten Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) festgestellt, dass 390.000 Fachkräfte fehlen. Das sind gut 50.000 mehr als noch vor Corona. Die Zeiten, in denen die Pandemie den Job-
markt eintrübte, sind damit erst einmal vorbei. Die Unternehmen suchen wieder kräftig – bloß finden sie oft nicht die passenden Leute.
Eigentlich Idealbedingungen für Bewerberin-nen und Bewerber. Trotzdem fragt sich so man-cher Kandidat aktuell: „Soll ich mich wirklich jetzt bewerben? Ende des Jahres machen das doch fast alle, oder? Und wer sagt bei steigenden Inzidenzen denn, dass die Coronakrise nicht bald doch wieder der Wirtschaft zu schaffen macht?“
Falsch gedacht, sagen Experten. Hier sind sie-ben Gründe, warum der Arbeitgeberwechsel ge-rade jetzt eine gute Idee ist und dieser November ein besonderer für die Jobsuche ist.
1. Ihre Chancen stehen gut trotz oder wegen CoronaCorona hat den Jobmarkt durcheinandergewir-belt. „Plötzlich passieren Dinge, die man nicht er-wartet hätte“, sagt Job-Expertin Annina Hering vom „Hiring Lab“ der Job-Suchmaschine Indeed. Die Anzahl der offenen Stellen auf dem Portal In-deed liegt demnach aktuell 40 Prozent über dem Niveau vor der Pandemie.
Die Auswahl für Jobsuchende ist derzeit also groß – viel größer, als es vor der Pandemie um diese Jahreszeit der Fall war. Wer jetzt auf Job-suche geht, hat gute Chancen und nicht viel Kon-kurrenz (siehe Artikel rechts), weil viele Wech-selwillige noch abwarten wollen, bis die Corona-Pandemie endgültig überstanden ist.
2. Jahresend-Flaute ist ein Mythos„Häufig besteht die Annahme, dass gegen Jahres-ende auf dem Bewerbermarkt nicht mehr viel pas-siert“, sagt Emine Yilmaz, Vice President beim Per-sonaldienstleister Robert Half. Das Gegenteil ist richtig: „Besonders in den letzten Wochen des Jah-res kann es sich lohnen, auf Jobsuche zu gehen.“
Unternehmen, die ihr Jahresbudget im No-vember noch nicht ausgeschöpft haben, können zum Beispiel durchaus Interesse daran haben, of-fene Stellen im vierten Quartal zu besetzen. Allein die 40 Dax-Unternehmen haben zusammenge-rechnet laut Indeed derzeit mehr als 18.000 Stel-len ausgeschrieben. Vor allem im IT- und Per-sonalbereich werden Leute gesucht, aber auch In-genieurinnen und Ingenieure sind bei großen Industrieunternehmen weiter gefragt.
3. Im neuen Jahr erwacht die KonkurrenzDer Jahreswechsel ist die Zeit der guten Vorsätze – und der Neuanfänge. Dementsprechend suchen besonders viele Menschen im Januar einen neuen Job. Doch wer seine Jobsuche auf Januar ver-schiebt, auch, weil er vielleicht denkt, dass Un-ternehmen erst im neuen Jahr wieder einstellen, muss sich im Zweifelsfall gegen viel Konkurrenz durchsetzen. Im November dagegen ist das Ver-hältnis von offenen Stellen und Bewerbern we-sentlich günstiger.
4. Pokern Sie ruhig hochFassen Sie Mut, und denken Sie groß! „Gerade, weil der Jobmarkt aktuell so eng ist, hat man die Möglichkeit, Stellen zu ergattern, die man vor ein paar Monaten vielleicht noch nicht bekommen hätte“, sagt Annina Hering von Indeed.
Jobsuchende dürfen ruhig wählerisch sein und auch mehrere Jobangebote einholen, bevor sie sich für das beste entscheiden. Diesen Eindruck bestätigt Emine Yilmaz von Robert Half: „Wir se-
hen, dass viele Unternehmen im Moment einstel-len und gute Bewerber rar sind.“
Das darf sich auch beim Gehalt widerspiegeln. Verhandlungstrainerin Claudia Kimich rät, beim neuen Arbeitgeber ein Plus von zehn bis 20 Pro-zent beim Gehalt draufzuschlagen. „Mit deutlich weniger würde ich mich nicht zufriedengeben.“
5. Es muss nicht mehr das Unternehmen vor Ort seinIn der Corona-Pandemie hat sich das Arbeiten aus dem Homeoffice erfolgreich etabliert. „Man kann sich also in einem viel größeren Radius bewerben und nicht bloß in der Stadt, in der man wohnt“, sagt Job-Expertin Yilmaz. „Das hat Vorteile für beide Seiten.“
Fast zehn Prozent aller Stellenausschreibun-gen enthalten laut Indeed aktuell den Hinweis, dass Homeoffice möglich ist. Viele Arbeitgeber seien dafür offener geworden, sagt Indeed-Exper-tin Annina Hering: „Wenn es nicht in der Stel-lenanzeige steht, würde ich auf jeden Fall danach fragen.“
Wer am 1. Januar einen neuen Job antreten will, kann so auch erst einmal von zu Hause aus arbeiten und den Umzug später angehen.
6. Gute Kontakte sind der Schlüssel zum Erfolg„Es ist branchen- und positionsabhängig, ob eine klassische Bewerbung oder das Netzwerk der bessere Weg zum neuen Job ist“, sagt Emine Yil-
Bewerbung
Gesucht – und nicht gefunden
Jobs für Hochqualifizierte gibt es gerade mehr als genug. Trotzdem zögern viele Bewerber zum Jahresende, ihre Unterlagen einzureichen. Ein Fehler.
Experten verraten, was Sie diesen November bei der Jobsuche beachten müssen.
Wir sehen, dass viele Unternehmen
im Moment einstellen und gute Bewerber rar sind.
Emine YilmazRobert Half
Karriere
61WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
maz vom Personaldienstleister Robert Half. „Dennoch lässt sich beobachten, dass Bewerber mit guten Kontakten erfolgreicher sind.“
Unternehmen setzten verstärkt auf Empfeh-lungen und Referenzen, sagt sie. Außerdem hilft das Netzwerk, Infos über den Job, das Anforde-rungsprofil und den Bewerbungsprozess einzu-holen.
Gerade im Herbst finden besonders viele Jobmessen, Karrieretage und Absolventenkon-gresse statt. Bei der Jobsuche zum Jahresende empfehle es sich auch, Weihnachtsfeiern rele-vanter Branchenverbände zu besuchen und Kontakte zu knüpfen, sagt Yilmaz – sofern es die Pandemie zulässt.
7. Es kann schneller gehen als gedacht„Viele Unternehmen sind schon relativ lange auf der Suche nach Fachkräften“, sagt Indeed-Ex-pertin Annina Hering. „Deshalb gibt es sicher-lich einige, die schnell einstellen wollen.“
Besonders Stellen für kurzfristigen Bedarf sind flott vergeben, sagt Emine Yilmaz von Ro-bert Half. Etwa, damit jemand noch am Jahres-abschluss mitarbeiten kann. Umgekehrt gilt: „Es kann sein, dass sich gerade aufgrund der Weihnachtszeit und der Jahresabschlüsse die Bewerbungsphase und -gespräche zeitlich hi-nauszögern.“
Bei allem Eifer bei der Jobsuche sollten Be-werber natürlich auch immer ihre eigene Kün-digungsfrist im Auge behalten. Wer zum neuen Jahr einen Job haben will und drei Monate Kün-digungsfrist hat, ist schon auf die Kulanz des bisherigen Arbeitgebers angewiesen, um vor-zeitig aus seinem Arbeitsvertrag herauszukom-men.Mitarbeit: Lazar Backovic
D er Fachkräftemangel in Deutschland verschärft sich. Zwei Drittel aller Un-ternehmen suchen derzeit qualifi-ziertes Personal. Das geht aus einer
am Donnerstag veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Ende 2020 hatten nur 54 Prozent der Firmen damit gerechnet, dass ihnen in diesem Jahr Per-sonal fehlt. Für die Umfrage hatte das Mei-nungsforschungsunternehmen Civey von August bis Oktober insgesamt 7500 Ent-scheiderinnen und Entscheider befragt.
Auch wenn der Arbeitsmarkt sich da-mit wieder deutlich zugunsten der Arbeit-nehmer entwickelt hat, fürchten viele Be-werber die Konkurrenz: „Wer sich wohl noch beworben hat? Und welche Fähigkei-ten die anderen Kandidaten mitbringen?“
Solche Gedanken schießen auch Top-Bewerberinnen und -Bewerbern durch den Kopf, bevor sie ihre Unterlagen ein-reichen. Eine exklusive Auswertung der Jobplattform Indeed für das Handelsblatt macht nun Hoffnung. Die Zahlen zeigen: Es gibt sie noch – die Top-Jobs, bei denen sich die Konkurrenz in Grenzen hält.
Indeed hat dafür aktuelle Stellenprofile mit einem Jahresgehalt von mindestens 70.000 Euro analysiert, die auf der Job-plattform deutlich weniger Resonanz er-hielten als der Durchschnitt. Entscheidend für die Einordnung war die Zahl der Klicks auf die Online-Stellenanzeigen.
Die meisten Jobs mit hohen Gehältern und wenig Konkurrenz sind im Tech- und IT-Bereich angesiedelt. Aber auch andere Jobprofile auf der Liste stechen heraus – und locken mit sechsstelligen Gehältern.
Digitalisierung schafft JobsSo sind beispielsweise die Bewerbungen auf Oberarztstellen verglichen mit dem Vorjahr um 90 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig liegt das Salär dort im Schnitt bei 185.000 Euro. Ähnlich sieht es bei Ja-va-Softwareentwicklern, Cloud-Architek-ten und Oberbauleitern aus. Hier sind Ge-hälter von bis zu 85.000 Euro realistisch.
Auch in den Bereichen E-Commerce, Cloud, SAP-Beratung und IT-Sicherheit haben Jobsuchende gute Karten, genom-men zu werden und dabei Top-Gehälter einzustreichen.
„Die Pandemie hat die Bedeutung und Zukunftsfähigkeit von digitalen Geschäfts-modellen deutlich untermauert“, ordnet Annina Hering, Arbeitsmarktexpertin beim Indeed Hiring Lab, die Ergebnisse ein. „So ist es wenig überraschend, dass Jobsuchende mit einschlägigen IT-Quali-fikationen im Vergleich am wenigsten Wettbewerb um neue Stellen fürchten müssen.“
Indeed hat für die Auswertung soge-nannte Mediangehälter ermittelt. Dabei werden extrem hohe und extrem niedrige Gehaltsangaben in einer Jobgruppe für die Berechnung ausgeklammert.
Wer jedoch denkt, dass hochbezahlte Jobs automatisch wenig Bewerber anzie-hen, der irrt sich. So verdient ein „Data Scientist“ beispielsweise laut Indeed ein Mediangehalt von 75.000 bis 80.000 Euro, allerdings ist die Resonanz auf einen freien Job in dem Bereich 91 Prozent höher als der Durchschnitt.
Ähnlich sieht es bei Fachkräften im Personalbereich aus, den sogenannten Hu-man Resources Specialists. Hier gab es zu-letzt 58 Prozent mehr Bewerber als auf ein Durchschnittsstelleninserat auf Indeed. Lazar Backovic
Karrierechancen
Kaum Bewerber, viel GehaltEine exklusive Auswertung zeigt: Es gibt sie noch – die Top-Jobs mit wenig
Konkurrenz. Bei diesen gut bezahlten Stellen ist die Bewerberresonanz stark gesunken.
Senior-Softwareentwickler Java
Cloud-Architekt
Oberarzt
Oberbauleiter
Solution Architect
Senior-Java-Developer
Cloud-Engineer
SAP-Entwickler
Senior Consultant
Security Consultant
Software-Architekt
SAP-Berater
E-Commerce-Berater
DevOps-Engineer
Verkäufer Sanitär und Heizung
Embedded Softwareentwickler
(Senior) Key-Account-Manager
Senior-Projektmanager
Scrum Master
Big Data Engineer
IT Security Specialist
IT-Projektmanager
Projektleiter
Data-Engineer
Handelsvertreter
70.000
72.500
185.000
85.000
95.000
70.000
75.000
80.000
90.000
70.000
82.500
70.000
72.500
70.000
70.000
70.000
97.500
80.000
75.000
75.000
75.000
100.000
70.000
72.500
100.000
Mediangehaltim Jahr
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
-91 %
-91 %
-90 %
-89 %
-88 %
-83 %
-82 %
-82 %
-80 %
-79 %
-79 %
-78 %
-76 %
-73 %
-72 %
-71 %
-71 %
-63 %
-58 %
-57 %
-57 %
-57 %
-47 %
-46 %
-43 %
25 Jobs mit Top-Bezahlung und wenig Konkurrenz
HANDELSBLATT*Entwicklung im Zeitraum Oktober 2020 bis September 2021;
Stand: Oktober 2021 • Quelle: Indeed
Bewerber-interesse*
Gute Bezahlung lockt nicht immer
Berufs-bezeichnung
Get
ty Im
ages
/fSt
op
Literatur
62 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Mom
ent/
Get
ty Im
ages
[M]
Bestseller
Meistverkaufte Wirtschaftsbücher in Deutschland1. (1) Napoleon Hill: Think and Grow Rich Finanzbuch, München 2018, 320 Seiten, 14,99 Euro
2. (-) Carsten Maschmeyer: Die sechs Elemente des Erfolgs Finanzbuch, München 2021, 304 Seiten, 22,00 Euro
3. (3) B. Wallstabe-Watermann: Anlegen mit ETF Stiftung Warentest, Berlin 2020, 176 Seiten, 19,90 Euro
4. (5) Ashlee Vance: Elon Musk – Die Biografie Finanzbuch, München 2015, 368 Seiten, 19,99 Euro
5. (-) Thomas Piketty: Der Sozialismus der Zukunft C. H. Beck, München 2021, 232 Seiten, 16,95 Euro
6. (7) Beate Sander: Der Aktien- und Börsenführerschein Finanzbuch, München 2020, 336 Seiten, 29,99 Euro
7. (8) Gerd Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs Campus Verlag, Frankfurt 2018, 416 Seiten, 32,00 Euro
8. (10) Hava Misimi: Money Kondo Edition Michael Fischer / EMF Verlag, Igling 2021, 256 Seiten, 12,00 Euro
9. (-) Mario Lochner: Warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Finanzbuch, München 2021, 272 Seiten, 18,00 Euro
10. (2) Marc Friedrich: Die größte Chance aller Zeiten Finanzbuch, München 2021, 384 Seiten, 22,00 Euro
Die Bestsellerliste wird monatlich von Campo-Data erhoben. Ausgewertet werden die Zahlen von Buchhandlungen, Verlagen und Internetverkäufen. Die aktuelle Liste berücksichtigt den Verkauf vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober 2021.
Wege zum Erfolg: Investor Carsten Maschmeyer identifiziert sechs entscheidende Faktoren.
Gesellschafts-modell: Der Ökonom Thomas Piketty entzaubert den Kapitalismus.
Annette Kehnel: Wir konnten auch
anders. Blessing,
München 2021,488 Seiten,
24 Euro
Akshat Rathi (Hrsg.): Klima ist für alle da.
Übersetzung: Larissa Rabe,
Blanvalet, München 2021,
320 Seiten, 18 Euro
Benjamin Grant, Timothy Dougherty: Unsere Erde vorher
und nachher.Übersetzung:
Nina Goldt, Dumont, Köln 2021, 288 Seiten, 38 Euro
Claudia Panster Düsseldorf
Alle scheinen sich einig, dass die Klimakrise das drängendste Thema ist, die wichtigste Auf-gabe der kommenden Jahre. Ziele gibt es also. Über den Weg aber gehen die Meinun-
gen auseinander – wie ein Blick auf acht aktuelle Bücher zur Klimakrise zeigt.
1. Annette Kehnel: „Wir konnten auch anders“Der Aachener Dom ist das beste Bei-spiel für Baustoffrecycling. Mehr als 20 verschiedene Naturwerksteine wurden verwendet, dazu zahlreiche großformatige Steine von älteren Bau-ten, die als sogenannte Spolien wie-derverwendet wurden. So funktionier-te Kreislaufwirtschaft schon im Mit-telalter.
Der Aachener Dom ist nicht das einzige Beispiel aus der Historie, an-hand dessen Annette Kehnel in „Wir konnten auch anders“ zeigt, was der Mensch aus seiner eigenen Vergan-genheit in Sachen Nachhaltigkeit ler-nen kann. Klöster waren schon vor an-derthalb Jahrtausenden eine Gemein-schaft, die sich in Sharing-Economy übte. Schon in der Vormoderne zeug-ten Secondhandmärkte in Paris davon, wie die damalige Mode von Upcycling und Trödlern geprägt war. Und allen geläufig ist wohl der Philosoph Dioge-nes in der Tonne, der den freiwilligen Verzicht als Weg zur Freiheit und zum guten Leben begründete.
Historikerin Kehnel, die mit ihrem Buch auf der Shortlist des NDR-Sach-buchpreises steht, frönt jedoch keines-falls einem „Früher war alles besser“. Sie will die Perspektive weiten, sich der Vergangenheit zuwenden, „um
die Zukunft besser in den Blick neh-men zu können. Denn nichts sei pro-blematischer als die „Kurzfristigkeit der Gegenwart“. Klar, das ist bequem, schließlich hat man sich in der Gegen-wart ganz gut eingerichtet. Es hätte schlimmer kommen können. Aber wie könnte es bessergehen?
Fortschritt, Wachstum, Wohl-stand – diese Zauberformeln aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind laut Keh-nel mittlerweile überholt. Die Zeiten des Homo oeconomicus, des rationa-len Nutzenmaximierers, seien vorbei. Dabei sei nicht das Wirtschaften das Problem, „sondern unser eindimen-sionales Verständnis davon, was Wirt-schaften heißt“.
2. B. Grant, T. Dougherty: „Unsere Erde vorher und nachher“Benjamin Grant und Timothy Doug-herty haben die Perspektive gewech-selt. Sie blicken von oben auf die Erde – und zeigen anhand von 250 Satelli-tenaufnahmen, wie die Menschen die Welt verändert haben und wie diese dadurch ins Ungleichgewicht geraten ist. Der Band ist Teil eines Projekts, das den Menschen den sogenannten Overview-Effekt nahebringen will: je-nes Gefühl, das Raumfahrer empfin-den, wenn sie aus dem All auf die Erde hinabblicken – voll Ehrfurcht und Dankbarkeit für den Planeten.
Entsprechend kommt das Buch ohne viele Worte aus, die Bilder spre-chen größtenteils für sich. Sie zeigen, wie durch Brandrodung Agrarflächen entstehen, wie durch neue Staudäm-me ganze Landstriche mit der Zeit un-ter Wasser verschwinden, wie Acker-flächen und Wiesen innerhalb weniger Jahrzehnte Betonwüsten weichen mussten. Die Auswirkungen von
Konsum, Urbanisierung, Transport-wesen und Umweltkatastrophen wer-den hier auf einen Blick erschreckend sichtbar.
3. Akshat Rathi: „Klima ist für alle da“Aber wo sind die Positivbeispiele? Hat sich wirklich noch nichts gewandelt? Doch, sagt Akshat Rathi, in London ansässiger Journalist bei Bloomberg News, der nicht nach Sündenböcken sucht, sondern nach Vorbildern. Nach jenen, die den Klimawandel als Chan-ce begreifen, etwas besser zu machen. In „Klima ist für alle da“ zeigt Rathi 60 junge Menschen aus 50 Ländern aller Kontinente. Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten, die als Vorbilder taugen. Jedem ist ein Kapitel gewidmet. Es sind engagierte, rührende, ermutigen-de Geschichten.
Von Raina Ivanova etwa, einer Schülerin aus Hamburg, die 2019 mit Greta Thunberg und 14 weiteren Ju-gendlichen in New York eine Be-schwerde beim UN-Kinderrechtsaus-schuss einreichte. Von Lesein Mutun-kei, einem Schüler aus Kenia, der jedes Mal, wenn er beim Fußball ein Tor ge-schossen hat, einen Baum pflanzt – und schon Hunderte überzeugt hat, es ihm gleichzutun. Von Carlos Zackhras, Student von den Marshall-inseln, dessen Heimat nur 0,00001 Prozent der weltweiten CO2-Emissio-nen verursacht. Aber in dessen Hei-mat die Menschen nicht nur gegen Dengue-Fieber und Grippe kämpfen, sondern auch mit den immer höher werdenden Wellen, die die Insel über-schwemmen.
Sie allein können das Klima nicht retten, das weiß auch Rathi, aber sie machen Mut – und stecken womög-lich an.
Erderwärmung
Die Geschichte unseres Überlebens
63WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Zu kaum einem Thema erscheinen derzeit so viele Bücher wie zum Klima. So unterschiedlich ihre Ansätze sind, eines eint die Autoren: Ihre Werke sind ein
Appell, dass wir mehr tun müssen. In Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
Elizabeth Kolbert: Wir Klimawandler.
Übersetzung: Ulrike Bischoff,
Suhrkamp, Berlin 2021, 239 Seiten,
25 Euro
Christiana Figueres, Tom Rivett Carnac:
Die Zukunft in unserer Hand.
Übersetzung: Henning Dedekind, C.H. Beck,
München 2021, 216 Seiten, 22 Euro
Svend Andersen mit Marc Bielefeld:
Der Weg aus der Klimakrise. Quadriga, Köln 2021, 320 Seiten,
20 Euro
Fred Vargas: Klimawandel –
ein Appell. Übersetzung:
Waltraud Schwarze, Limes,
München 2021,288 Seiten, 14 Euro
Marc Engelhardt (Hrsg):
Die Klimakämpfer.Penguin,
München 2021,336 Seiten, 16 Euro. Das Buch erscheint
am 9. November.
4. Marc Engelhardt: „Die Klimakämpfer“Manche Menschen „lamentieren nicht über drohende Gefahren. Sie warten nicht darauf, dass jemand an-deres für sie aktiv wird. Sie lassen sich nicht lähmen aus Angst vor dem, was auf uns zukommt. Sondern sie kämp-fen für das Klima, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.“
Und genau dabei haben der freie Journalist Marc Engelhardt und seine Kolleginnen und Kollegen vom Jour-nalistennetzwerk Weltreporter diese Menschen begleitet. Das Engagement gegen den Klimawandel, das wird in „Die Klimakämpfer“ deutlich, ist nicht nur Angelegenheit der jungen Generation. Die Autoren berichten auch von Florence Nishida, 83, die den Menschen in ihrem Viertel in Los An-geles beibringen will, wie man Obst und Gemüse anbaut, um ihnen zu zeigen, wie sehr ihr Leben von dem der Erde abhängig ist. Oder von Seu Fiado, brasilianischer Kleinbauer ohne Schulbildung, der jahrelang mehr Wald rodete, um mehr Felder zu schaffen, dann aber anfing umzuden-ken. Heute hat er sich als Klimawärter verpflichtet, seine Plantage aufzufors-ten, „gut ein Hektar Land, auf dem jetzt ganz natürlich CO2 in Sauerstoff umgewandelt wird.“ Fast alle Pro-tagonistinnen und Protagonisten des Buchs verdienen mittlerweile ihr Geld mit dem Kampf gegen die Klimakata-strophe. Das macht Hoffnung, dass es sich lohnt, sich zu engagieren.
5. Fred Vargas: „Klimawandel – ein Appell“Dabei ist das jetzige Leben auch ge-mütlich. „Wir würden gerne so wei-termachen, denn es leuchtet ja ein, mit blinkenden Turnschuhen in ein
Flugzeug zu steigen ist entschieden lustiger, als Kartoffeln zu hacken. Das auf jeden Fall. Aber nun sind wir an-gekommen. Bei der Dritten Revolu-tion.“ Die Dritte Revolution, das ist für Fred Vargas der Klimawandel, den die Menschheit stoppen muss. Genau, die bekannte Krimiautorin aus Frankreich, die seit ihrer Rede beim Klimagipfel in Helsinki 2008 auch als wichtige Stimme des Kli-maaktivismus gilt.
Vargas, promovierte Archäozoo-login, hat diesen Text als Ausgangs-punkt genommen für ihr Buch, in dem sie an die Menschen appelliert, sich selbst zu informieren und nicht alles einfach der Regierung zu glau-ben. Diese Trennung jedoch treibt sie etwas zu weit. Wir, die guten Bürger, sie, die bösen Politiker – ist der Klimawandel nicht eher eine Gemeinschaftsaufgabe? Doch, das gibt dann letztlich auch die Autorin zu. Und stellt von der Bekämpfung des internationalen Steuerbetrugs bis zu Isolierschäumen in Gebäuden eine lange Liste an To-dos zusam-men.
6. Elizabeth Kolbert: „Wir Klimawandler“ Und noch eine große Autorin: Eliza-beth Kolbert, Pulitzerpreisträgerin. Die amerikanische Wissenschafts-journalistin hält sich nicht mit langem Vorgeplänkel auf, sondern geht sofort rein in ihre Kapitelstruktur, für die sie sich der Elemente bedient – Wasser, Erde, Luft. Ihr Buch ist eine große Re-portage, sie geht hin zum Problem, beobachtet, beschreibt. Wie die Men-schen immer wieder die naturgegebe-nen Zustände an ihre Bedürfnisse an-passten. Und die Natur sich zurück-holte, was sie braucht.
Kolbert erzählt von einem Besuch in Islands Lavafeldern, wo Expertin-nen und Experten um Edda Aradóttir versuchen, CO2 in Gestein zu spei-chern. Oder von Ruth Gates, die in ei-ner Bucht nahe dem Marine Corps Base Hawaii daran forscht, stressresis-tente Korallenriffe für Australien zu züchten. Kolbert erlebt viele solcher Geschichten, mal Augen öffnend, mal Hoffnung gebend, die den Leser vor allem eines lehren: Demut.
7. Svend Andersen: „Der Weg aus der Klimakrise“ Die hat Svend Andersen schon von Berufs wegen. Andersen, ein in Kana-da lebender Deutscher, ist Treibhaus-gasbuchhalter. Ja, diesen Beruf gibt es wirklich. Andersen hat sich den Kli-maschutz zur Lebensaufgabe ge-macht, beschäftigt sich tagtäglich „mit dem Kern des Problems“, mit den Emissionen, mit ihren Ursachen und mit Methoden, sie zu reduzieren. Er blicke verwundert auf die Untätigkeit der Masse, schreibt er in „Der Weg aus der Klimakrise“. Womöglich sei es spannender, über Waldbrände zu berichten, Wirbelstürme oder Dürren. Doch dies seien Auswirkungen des Problems, nicht die Ursachen.
Andersen berät mit seiner Agen-tur Städte, Gemeinden und Regierun-gen, wie sie das 1,5-Grad-Ziel einhal-ten können. In seinem Buch hat er nun alle aus seiner Sicht wichtigen As-pekte der Treibhausgasproblematik zusammengetragen – und nimmt dem Leser auch die Illusion, die Emis-sionen allein „durch unser persönli-ches Verhalten ausreichend reduzie-ren zu können“. Dazu brauche es eine größere Kraftanstrengung – von Po-litik, Wirtschaft, Gesellschaft. Die Wege zeigt Andersen konkret auf.
8. C. Figueres, T. Rivett Carnac: „Die Zukunft in unserer Hand“Das tun auch Christiana Figueres und Tom Rivett Carnac. Die Autorin und der Autor von „Die Zukunft in unserer Hand“ sind die maßgeblichen Archi-tekten des Pariser Klimaabkommens von 2015. Figueres, Tochter des drei-maligen Präsidenten von Costa Rica, war sechs Jahre lang Generalsekretärin der UN-Klimarahmenkonvention. Ri-vett Carnac, britischer Umweltöko-nom, damals ihr leitender Berater.
Gemeinsam gründeten sie nach ih-rer Zeit bei der UN das Beratungs-unternehmen „Global Optimism“. Der Name ist Programm. Denn trotz aller Dramatik der Situation, so ihre Auffas-sung, müsse man eine Art mutiger Entschlossenheit an den Tag legen, um Herausforderungen bewältigen zu kön-nen. In „Die Zukunft in unserer Hand“ prägen sie entsprechend den Begriff des „sturen Optimismus“: Wenn alle mit-machen, könne das Projekt Klimawan-del gelingen. Dafür entwerfen die Au-toren einen konkreten Zehn-Punkte-Plan mit Vorschlägen, die jeder befolgen könne, gar solle. Für sofort, heute, morgen, diesen Monat, dieses Jahr, bis 2030.
Klimawandel sei nicht die Aufgabe einer einzelnen Person, einer einzelnen Nation, Klimawandel sei die Aufgabe der gesamten Welt. Seit ein Staat nach dem anderen das Pariser Klimaabkom-men unterzeichnet habe, sind die Au-toren optimistisch, dass das Projekt ge-lingen kann. Wenn jeder seinen Beitrag leistet.
So praxisorientiert das Autorenduo über weite Strecken auch ist, am Ende fordert es den Leser ein wenig pathe-tisch auf, eine neue, ganz eigene Ge-schichte zu erzählen: „Die Geschichte unseres Überlebens. Und eines blühen-den Daseins.“
Literatur
62 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Mom
ent/
Get
ty Im
ages
[M]
Bestseller
Meistverkaufte Wirtschaftsbücher in Deutschland1. (1) Napoleon Hill: Think and Grow Rich Finanzbuch, München 2018, 320 Seiten, 14,99 Euro
2. (-) Carsten Maschmeyer: Die sechs Elemente des Erfolgs Finanzbuch, München 2021, 304 Seiten, 22,00 Euro
3. (3) B. Wallstabe-Watermann: Anlegen mit ETF Stiftung Warentest, Berlin 2020, 176 Seiten, 19,90 Euro
4. (5) Ashlee Vance: Elon Musk – Die Biografie Finanzbuch, München 2015, 368 Seiten, 19,99 Euro
5. (-) Thomas Piketty: Der Sozialismus der Zukunft C. H. Beck, München 2021, 232 Seiten, 16,95 Euro
6. (7) Beate Sander: Der Aktien- und Börsenführerschein Finanzbuch, München 2020, 336 Seiten, 29,99 Euro
7. (8) Gerd Kommer: Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs Campus Verlag, Frankfurt 2018, 416 Seiten, 32,00 Euro
8. (10) Hava Misimi: Money Kondo Edition Michael Fischer / EMF Verlag, Igling 2021, 256 Seiten, 12,00 Euro
9. (-) Mario Lochner: Warum hat mir das niemand früher über Geld verraten? Finanzbuch, München 2021, 272 Seiten, 18,00 Euro
10. (2) Marc Friedrich: Die größte Chance aller Zeiten Finanzbuch, München 2021, 384 Seiten, 22,00 Euro
Die Bestsellerliste wird monatlich von Campo-Data erhoben. Ausgewertet werden die Zahlen von Buchhandlungen, Verlagen und Internetverkäufen. Die aktuelle Liste berücksichtigt den Verkauf vom 1. Oktober bis zum 31. Oktober 2021.
Wege zum Erfolg: Investor Carsten Maschmeyer identifiziert sechs entscheidende Faktoren.
Gesellschafts-modell: Der Ökonom Thomas Piketty entzaubert den Kapitalismus.
Annette Kehnel: Wir konnten auch
anders. Blessing,
München 2021,488 Seiten,
24 Euro
Akshat Rathi (Hrsg.): Klima ist für alle da.
Übersetzung: Larissa Rabe,
Blanvalet, München 2021,
320 Seiten, 18 Euro
Benjamin Grant, Timothy Dougherty: Unsere Erde vorher
und nachher.Übersetzung:
Nina Goldt, Dumont, Köln 2021, 288 Seiten, 38 Euro
Claudia Panster Düsseldorf
Alle scheinen sich einig, dass die Klimakrise das drängendste Thema ist, die wichtigste Auf-gabe der kommenden Jahre. Ziele gibt es also. Über den Weg aber gehen die Meinun-
gen auseinander – wie ein Blick auf acht aktuelle Bücher zur Klimakrise zeigt.
1. Annette Kehnel: „Wir konnten auch anders“Der Aachener Dom ist das beste Bei-spiel für Baustoffrecycling. Mehr als 20 verschiedene Naturwerksteine wurden verwendet, dazu zahlreiche großformatige Steine von älteren Bau-ten, die als sogenannte Spolien wie-derverwendet wurden. So funktionier-te Kreislaufwirtschaft schon im Mit-telalter.
Der Aachener Dom ist nicht das einzige Beispiel aus der Historie, an-hand dessen Annette Kehnel in „Wir konnten auch anders“ zeigt, was der Mensch aus seiner eigenen Vergan-genheit in Sachen Nachhaltigkeit ler-nen kann. Klöster waren schon vor an-derthalb Jahrtausenden eine Gemein-schaft, die sich in Sharing-Economy übte. Schon in der Vormoderne zeug-ten Secondhandmärkte in Paris davon, wie die damalige Mode von Upcycling und Trödlern geprägt war. Und allen geläufig ist wohl der Philosoph Dioge-nes in der Tonne, der den freiwilligen Verzicht als Weg zur Freiheit und zum guten Leben begründete.
Historikerin Kehnel, die mit ihrem Buch auf der Shortlist des NDR-Sach-buchpreises steht, frönt jedoch keines-falls einem „Früher war alles besser“. Sie will die Perspektive weiten, sich der Vergangenheit zuwenden, „um
die Zukunft besser in den Blick neh-men zu können. Denn nichts sei pro-blematischer als die „Kurzfristigkeit der Gegenwart“. Klar, das ist bequem, schließlich hat man sich in der Gegen-wart ganz gut eingerichtet. Es hätte schlimmer kommen können. Aber wie könnte es bessergehen?
Fortschritt, Wachstum, Wohl-stand – diese Zauberformeln aus dem 18. und 19. Jahrhundert sind laut Keh-nel mittlerweile überholt. Die Zeiten des Homo oeconomicus, des rationa-len Nutzenmaximierers, seien vorbei. Dabei sei nicht das Wirtschaften das Problem, „sondern unser eindimen-sionales Verständnis davon, was Wirt-schaften heißt“.
2. B. Grant, T. Dougherty: „Unsere Erde vorher und nachher“Benjamin Grant und Timothy Doug-herty haben die Perspektive gewech-selt. Sie blicken von oben auf die Erde – und zeigen anhand von 250 Satelli-tenaufnahmen, wie die Menschen die Welt verändert haben und wie diese dadurch ins Ungleichgewicht geraten ist. Der Band ist Teil eines Projekts, das den Menschen den sogenannten Overview-Effekt nahebringen will: je-nes Gefühl, das Raumfahrer empfin-den, wenn sie aus dem All auf die Erde hinabblicken – voll Ehrfurcht und Dankbarkeit für den Planeten.
Entsprechend kommt das Buch ohne viele Worte aus, die Bilder spre-chen größtenteils für sich. Sie zeigen, wie durch Brandrodung Agrarflächen entstehen, wie durch neue Staudäm-me ganze Landstriche mit der Zeit un-ter Wasser verschwinden, wie Acker-flächen und Wiesen innerhalb weniger Jahrzehnte Betonwüsten weichen mussten. Die Auswirkungen von
Konsum, Urbanisierung, Transport-wesen und Umweltkatastrophen wer-den hier auf einen Blick erschreckend sichtbar.
3. Akshat Rathi: „Klima ist für alle da“Aber wo sind die Positivbeispiele? Hat sich wirklich noch nichts gewandelt? Doch, sagt Akshat Rathi, in London ansässiger Journalist bei Bloomberg News, der nicht nach Sündenböcken sucht, sondern nach Vorbildern. Nach jenen, die den Klimawandel als Chan-ce begreifen, etwas besser zu machen. In „Klima ist für alle da“ zeigt Rathi 60 junge Menschen aus 50 Ländern aller Kontinente. Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten, die als Vorbilder taugen. Jedem ist ein Kapitel gewidmet. Es sind engagierte, rührende, ermutigen-de Geschichten.
Von Raina Ivanova etwa, einer Schülerin aus Hamburg, die 2019 mit Greta Thunberg und 14 weiteren Ju-gendlichen in New York eine Be-schwerde beim UN-Kinderrechtsaus-schuss einreichte. Von Lesein Mutun-kei, einem Schüler aus Kenia, der jedes Mal, wenn er beim Fußball ein Tor ge-schossen hat, einen Baum pflanzt – und schon Hunderte überzeugt hat, es ihm gleichzutun. Von Carlos Zackhras, Student von den Marshall-inseln, dessen Heimat nur 0,00001 Prozent der weltweiten CO2-Emissio-nen verursacht. Aber in dessen Hei-mat die Menschen nicht nur gegen Dengue-Fieber und Grippe kämpfen, sondern auch mit den immer höher werdenden Wellen, die die Insel über-schwemmen.
Sie allein können das Klima nicht retten, das weiß auch Rathi, aber sie machen Mut – und stecken womög-lich an.
Erderwärmung
Die Geschichte unseres Überlebens
63WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Zu kaum einem Thema erscheinen derzeit so viele Bücher wie zum Klima. So unterschiedlich ihre Ansätze sind, eines eint die Autoren: Ihre Werke sind ein
Appell, dass wir mehr tun müssen. In Politik, Wirtschaft, Gesellschaft.
Elizabeth Kolbert: Wir Klimawandler.
Übersetzung: Ulrike Bischoff,
Suhrkamp, Berlin 2021, 239 Seiten,
25 Euro
Christiana Figueres, Tom Rivett Carnac:
Die Zukunft in unserer Hand.
Übersetzung: Henning Dedekind, C.H. Beck,
München 2021, 216 Seiten, 22 Euro
Svend Andersen mit Marc Bielefeld:
Der Weg aus der Klimakrise. Quadriga, Köln 2021, 320 Seiten,
20 Euro
Fred Vargas: Klimawandel –
ein Appell. Übersetzung:
Waltraud Schwarze, Limes,
München 2021,288 Seiten, 14 Euro
Marc Engelhardt (Hrsg):
Die Klimakämpfer.Penguin,
München 2021,336 Seiten, 16 Euro. Das Buch erscheint
am 9. November.
4. Marc Engelhardt: „Die Klimakämpfer“Manche Menschen „lamentieren nicht über drohende Gefahren. Sie warten nicht darauf, dass jemand an-deres für sie aktiv wird. Sie lassen sich nicht lähmen aus Angst vor dem, was auf uns zukommt. Sondern sie kämp-fen für das Klima, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln.“
Und genau dabei haben der freie Journalist Marc Engelhardt und seine Kolleginnen und Kollegen vom Jour-nalistennetzwerk Weltreporter diese Menschen begleitet. Das Engagement gegen den Klimawandel, das wird in „Die Klimakämpfer“ deutlich, ist nicht nur Angelegenheit der jungen Generation. Die Autoren berichten auch von Florence Nishida, 83, die den Menschen in ihrem Viertel in Los An-geles beibringen will, wie man Obst und Gemüse anbaut, um ihnen zu zeigen, wie sehr ihr Leben von dem der Erde abhängig ist. Oder von Seu Fiado, brasilianischer Kleinbauer ohne Schulbildung, der jahrelang mehr Wald rodete, um mehr Felder zu schaffen, dann aber anfing umzuden-ken. Heute hat er sich als Klimawärter verpflichtet, seine Plantage aufzufors-ten, „gut ein Hektar Land, auf dem jetzt ganz natürlich CO2 in Sauerstoff umgewandelt wird.“ Fast alle Pro-tagonistinnen und Protagonisten des Buchs verdienen mittlerweile ihr Geld mit dem Kampf gegen die Klimakata-strophe. Das macht Hoffnung, dass es sich lohnt, sich zu engagieren.
5. Fred Vargas: „Klimawandel – ein Appell“Dabei ist das jetzige Leben auch ge-mütlich. „Wir würden gerne so wei-termachen, denn es leuchtet ja ein, mit blinkenden Turnschuhen in ein
Flugzeug zu steigen ist entschieden lustiger, als Kartoffeln zu hacken. Das auf jeden Fall. Aber nun sind wir an-gekommen. Bei der Dritten Revolu-tion.“ Die Dritte Revolution, das ist für Fred Vargas der Klimawandel, den die Menschheit stoppen muss. Genau, die bekannte Krimiautorin aus Frankreich, die seit ihrer Rede beim Klimagipfel in Helsinki 2008 auch als wichtige Stimme des Kli-maaktivismus gilt.
Vargas, promovierte Archäozoo-login, hat diesen Text als Ausgangs-punkt genommen für ihr Buch, in dem sie an die Menschen appelliert, sich selbst zu informieren und nicht alles einfach der Regierung zu glau-ben. Diese Trennung jedoch treibt sie etwas zu weit. Wir, die guten Bürger, sie, die bösen Politiker – ist der Klimawandel nicht eher eine Gemeinschaftsaufgabe? Doch, das gibt dann letztlich auch die Autorin zu. Und stellt von der Bekämpfung des internationalen Steuerbetrugs bis zu Isolierschäumen in Gebäuden eine lange Liste an To-dos zusam-men.
6. Elizabeth Kolbert: „Wir Klimawandler“ Und noch eine große Autorin: Eliza-beth Kolbert, Pulitzerpreisträgerin. Die amerikanische Wissenschafts-journalistin hält sich nicht mit langem Vorgeplänkel auf, sondern geht sofort rein in ihre Kapitelstruktur, für die sie sich der Elemente bedient – Wasser, Erde, Luft. Ihr Buch ist eine große Re-portage, sie geht hin zum Problem, beobachtet, beschreibt. Wie die Men-schen immer wieder die naturgegebe-nen Zustände an ihre Bedürfnisse an-passten. Und die Natur sich zurück-holte, was sie braucht.
Kolbert erzählt von einem Besuch in Islands Lavafeldern, wo Expertin-nen und Experten um Edda Aradóttir versuchen, CO2 in Gestein zu spei-chern. Oder von Ruth Gates, die in ei-ner Bucht nahe dem Marine Corps Base Hawaii daran forscht, stressresis-tente Korallenriffe für Australien zu züchten. Kolbert erlebt viele solcher Geschichten, mal Augen öffnend, mal Hoffnung gebend, die den Leser vor allem eines lehren: Demut.
7. Svend Andersen: „Der Weg aus der Klimakrise“ Die hat Svend Andersen schon von Berufs wegen. Andersen, ein in Kana-da lebender Deutscher, ist Treibhaus-gasbuchhalter. Ja, diesen Beruf gibt es wirklich. Andersen hat sich den Kli-maschutz zur Lebensaufgabe ge-macht, beschäftigt sich tagtäglich „mit dem Kern des Problems“, mit den Emissionen, mit ihren Ursachen und mit Methoden, sie zu reduzieren. Er blicke verwundert auf die Untätigkeit der Masse, schreibt er in „Der Weg aus der Klimakrise“. Womöglich sei es spannender, über Waldbrände zu berichten, Wirbelstürme oder Dürren. Doch dies seien Auswirkungen des Problems, nicht die Ursachen.
Andersen berät mit seiner Agen-tur Städte, Gemeinden und Regierun-gen, wie sie das 1,5-Grad-Ziel einhal-ten können. In seinem Buch hat er nun alle aus seiner Sicht wichtigen As-pekte der Treibhausgasproblematik zusammengetragen – und nimmt dem Leser auch die Illusion, die Emis-sionen allein „durch unser persönli-ches Verhalten ausreichend reduzie-ren zu können“. Dazu brauche es eine größere Kraftanstrengung – von Po-litik, Wirtschaft, Gesellschaft. Die Wege zeigt Andersen konkret auf.
8. C. Figueres, T. Rivett Carnac: „Die Zukunft in unserer Hand“Das tun auch Christiana Figueres und Tom Rivett Carnac. Die Autorin und der Autor von „Die Zukunft in unserer Hand“ sind die maßgeblichen Archi-tekten des Pariser Klimaabkommens von 2015. Figueres, Tochter des drei-maligen Präsidenten von Costa Rica, war sechs Jahre lang Generalsekretärin der UN-Klimarahmenkonvention. Ri-vett Carnac, britischer Umweltöko-nom, damals ihr leitender Berater.
Gemeinsam gründeten sie nach ih-rer Zeit bei der UN das Beratungs-unternehmen „Global Optimism“. Der Name ist Programm. Denn trotz aller Dramatik der Situation, so ihre Auffas-sung, müsse man eine Art mutiger Entschlossenheit an den Tag legen, um Herausforderungen bewältigen zu kön-nen. In „Die Zukunft in unserer Hand“ prägen sie entsprechend den Begriff des „sturen Optimismus“: Wenn alle mit-machen, könne das Projekt Klimawan-del gelingen. Dafür entwerfen die Au-toren einen konkreten Zehn-Punkte-Plan mit Vorschlägen, die jeder befolgen könne, gar solle. Für sofort, heute, morgen, diesen Monat, dieses Jahr, bis 2030.
Klimawandel sei nicht die Aufgabe einer einzelnen Person, einer einzelnen Nation, Klimawandel sei die Aufgabe der gesamten Welt. Seit ein Staat nach dem anderen das Pariser Klimaabkom-men unterzeichnet habe, sind die Au-toren optimistisch, dass das Projekt ge-lingen kann. Wenn jeder seinen Beitrag leistet.
So praxisorientiert das Autorenduo über weite Strecken auch ist, am Ende fordert es den Leser ein wenig pathe-tisch auf, eine neue, ganz eigene Ge-schichte zu erzählen: „Die Geschichte unseres Überlebens. Und eines blühen-den Daseins.“
Kunstmarkt
64 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Olga Grimm-Weissert Paris
Als „ein historisches Ereignis ohnegleichen“ bezeichnete die französische Professorin Bénédicte Savoy die Rückgabe von 26 im Jahr 1892 geraubten Werken an die Re-publik Benin durch Frankreich. Die für ih-ren entschiedenen Einsatz für die Resti-
tution geraubten Kulturguts bekannte und oft an-gefeindete Professorin an der Technischen Universität in Berlin äußerte ihre Begeisterung anlässlich der Feier zur Übergabe der Werke am 27. Oktober.
Die drei Königs-Skulpturen aus Holz, aufwen-dig geschnitzte Throne, Türreliefs oder Waffen von Würdenträgern raubte der französische Ge-neral Alfred-Amédée Dodds 1892 im Krieg gegen die Könige von Abomey, die sich gegen die Ko-lonisierung wehrten. Dodds schenkte 26 Objekte französischen Museen. Zuletzt waren sie im Pa-riser „Musée du Quai Branly – Jacques Chirac“ (MQB) ausgestellt, das außereuropäische Kultu-ren präsentiert. Die symbolische Rückgabe fand am 27. Oktober im MQB in Anwesenheit von Staatspräsident Emmanuel Macron statt.
Rein rechtlich gehören die Objekte aber erst nach der Unterzeichnung eines Dokuments zur Übertragung des Eigentums von einem Staat an den anderen wirklich dem Land Benin. Diese ze-remonielle Unterzeichnung ist am 9. November im Élysée-Palast geplant, in Anwesenheit der bei-den Staatspräsidenten Emmanuel Macron und Patrice Talon sowie aller zuständigen Minister. Die verantwortlichen Museumsleute von Benin haben – laut einer Sprecherin des Élysées – bereits
den Abtransport des „Schatzes von Benin“ am gleichen Abend organisiert und planen, die An-kunft in der Hafenstadt Cotonou mit „großem Pomp“ zu feiern.
Man muss dem französischen Staatspräsiden-ten Macron zugestehen, dass er einen ausgepräg-ten Sinn für Dramatisierung und symbolische Gesten von historischer Tragweite hat. Vor vier Jahren löste er mit seiner viel zitierten Rede in Burkina Fasos Hauptstadt Ougadougou europa-weit eine Veränderung des Bewusstseins und der Bewertung von Raubkunst aus. Er forderte, „Be-dingungen zur temporären oder definitiven Rück-gabe des afrikanischen Kulturguts“ zu schaffen.
Macron beauftragte Professorin Bénédicte Savoy und den senegalesischen Wirtschaftsprofes-
sor Felwine Sarr mit der „Mission Macron“. Die beiden Wissenschaftler verfassten den Bericht zur „Restitution afrikanischen Kulturguts“. Dessen Veröffentlichung löste Ende 2018 eine Welle von beißender Kritik vonseiten des Handels aus. „Der Status der Unveränderlichkeit ist ein Prinzip der Republik“, unterstrich der Galerist Frédéric Cas-taing noch bei einem Kolloquium zur Restitution. Die Verantwortlichen der Museen reagierten noch heftiger ob der absehbaren Verluste, aber meist hinter vorgehaltener Beamtenhand.
In der Folge begannen ethnologische Museen der ehemaligen Kolonialmächte Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Deutsch-land sowie Schweizer Museen mit der Inventari-sierung ihrer außereuropäischen Bestände. Die Kontakte zu Wissenschaftlern in den Herkunfts-gesellschaften der ehemaligen Kolonien wurden intensiviert. Im Gegensatz zu den englischen Ko-lonialtruppen, die 1897 in Edo, heute Benin City in Nigeria, Tausende Bronzereliefs raubten, nach London transportierten und großteils – zum Bei-spiel an deutsche Museen – verkauften, sind die französischen Plünderungen des Generals Alfred Amédée Dodds in Abomey im Jahr 1892 nur durch seine Museumsschenkung überliefert.
Obwohl staatliches Kulturgut in Frankreich unveräußerlich, unveränderbar, unübertragbar ist, setzte Präsident Macron mithilfe des Außen-ministeriums durch, dass Parlament und Senat im Dezember 2020 ein Sondergesetz verabschie-deten, das die Übertragung des Eigentums an die Republik Benin legalisiert.
Logischerweise verkündete Präsident Macron bei dem Festakt: „Für uns besteht die Aufgabe da-
Rückgabe von Raubgut
Historische Tragweite Mit viel Sinn für symbolische Gesten gibt Frankreichs Staatspräsident
Emmanuel Macron 26 geraubte Kunstwerke an die Republik Benin zurück. Für die Restitution von Staatseigentum hat er sogar ein Gesetz ändern lassen.
Holzstatuen aus dem Königreich Dahomey: Frankreich gibt 26 Kunst-werke aus dem Museum Quai Branly in Paris an Benin zurück.
acti
on p
ress
Staatspräsident Emmanuel Macron
machte die Restitution zur Chefsache:
Hier vor Reliefs aus dem Glélé-Palast.
acti
on p
ress
Christie’s hatte im März einen Meilenstein der Kunst-marktgeschichte gesetzt mit der Versteigerung von Beeples visuellem Tagebuch „Everyday“ für 69 Millionen Dollar. Jetzt legen der Grafikdesigner Beeple und das Auktionshaus mit „Human One“ nach. Erstmals werden am 9. November eine physische Vier-Kanal-Video-Installati-on und das dazugehörige NFT mit Ether-basierten Kurz-videos versteigert werden. Christie’s geht von einem unveröffentlichten Schätzpreis von über 15 Millionen Dollar aus. Das Besondere an „Human One“ ist, dass beide Versionen – anders als statische Kunstwerke – von Beeple ständig ergänzt und aktualisiert werden, so als pflegte der Künstler einen Dialog mit dem Käufer. sds
Kunstmarkt
65WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
rin, der Zivilgesellschaft, der afrikanischen Jugend den Zugang zu einem Teil ihrer eigenen Ge-schichte in ihren Museen zu ermöglichen.“
Die westafrikanische Bevölkerung hatte be-reits 2006 die Gelegenheit, ihre im 19. Jahrhun-dert geplünderten Kulturgegenstände in der „Fon-dation Zinsou“ in Cotonou (Benin) zu besichti-gen. Das Interesse an den Leihgaben aus Paris war enorm. Das führte zehn Jahre später zur offiziellen Restitutionsforderung durch Präsident Patrice Ta-lon an den französischen Staat. Diesem Rückgabe-gesuch erteilte man eine – rein rechtlich begrün-dete – schnöde Abfuhr.
Der Gründer der „Fondation Zinsou“ ist der Wirtschaftswissenschaftler und Bankier Lionel Zinsou, der auch kurzfristig Benins Premiermi-nister war. Zinsou riet Macron, die Restitutionen ernsthaft anzutreiben.
Seine Tochter Marie-Cécile Zinsou, die die kulturpädagogisch ausgerichtete „Fondation Zin-sou“ in Cotonou leitet, wurde vergangene Woche vom französischen Staatspräsidenten zur Vorsit-zenden des Verwaltungsrats der Villa Medici in Rom ernannt. Die Villa Medici ist Frankreichs kul-turelles Aushängeschild im Ausland schlechthin. Dort ein Stipendium zu erhalten gilt für Künstler und Wissenschaftler als staatliche Anerkennung ersten Rangs. Die Familie Zinsou ist eindeutig überbegabt. Dennoch scheint es, dass Frankreichs Staatsmühlen gelegentlich rasch und ungeniert mahlen.
Das „Soft Power“-Thema der Restitutionen dient in erster Linie wirtschaftlichen Interessen. Benin hat Goldreserven, die Frankreich und Europa nicht der Achse „Chinafrika“ allein zur Ausbeutung überlassen möchten.
B edeuten NFTs das Ende der Kunst und des Kunstmarkts oder ihre Rettung? Das weiß auch Kolja Reichert nicht. Ansonsten lässt
der Kurator an der Bundeskunsthalle in Bonn in seinem Buch „Krypto-Kunst“ jedoch kaum eine Frage zum Thema unbeantwortet. In einem schmalen Bändchen bringt er Theorie und Praxis der Non Fungible Tokens, der durch ei-ne Blockchain abgesicherten Besitzzer-tifikate, so zusammen, dass auch Men-schen, die mit dem Begriff nichts anfan-gen konnten, sich selbst in Expertenrunden nicht verloren fühlen.
Alle wichtigen Aspekte des Phäno-mens, das seit Anfang 2021 die Schlag-zeilen nicht nur der Kunstpublikationen mitbestimmt, werden kenntnisreich be-leuchtet. Wie funktioniert eine Block-chain, was sind NFTs, wer kauft sie, und was ist Kryptokunst überhaupt?
Eines ist für den Autor klar: NFTs lösen in einem Teilbereich das ein, was von der Kunst gern behauptet wird, nämlich dass sie autonom sei. Die Blockchain habe mit „Dezentralen Au-tonomen Organisationen“ – DAO – das Konstrukt einer juristischen Person her-vorgebracht, die basisdemokratische Entscheidungen ohne Vermittler-instanz treffen kann. Dieser Umstand ist nicht banal, betrifft er doch unmit-telbar die Art, wie die mithilfe von NFTs erzeugten und verbrieften Inhalte vermittelt werden. Vermittlung meint in diesem Fall den Besitzerwechsel, also den Handel.
Es wird gern behauptet, Kunst sei ein Spiegel der Gesellschaft. Demnach wä-ren NFTs das passende Kunstvehikel für eine Welt, die nicht mehr auf abstrakten Werten und übergeordneten Prinzipien aufbaut, sondern auf Transaktionalität und Transparenz – innerhalb der Kryp-towelt, deren Regeln Außenstehenden jedoch ebenso unverständlich erscheinen wie den meisten Menschen die unge-schriebenen Regeln der traditionellen Kunstszene. Reichert liefert keine Be-dienungsanleitung zur Navigation auf den verschiedenen Plattformen oder Empfehlungen für den NFT-Markt. Er erklärt vielmehr die Grundlagen des neu-en Feldes und bettet das Phänomen in einen größeren Zusammenhang ein.
Das Potenzial der ErfindungEinfach macht es der Autor seinen Le-sern nicht immer, und bisweilen gleiten die kompakten Formulierungen ins Be-deutungsschwangere, etwa wenn er das Revolutionäre an den digitalen Zertifi-katen erklärt: „NFTs begleiten einen ka-tegorischen Umschlag hinsichtlich des-sen, was ein Kulturgut ist: NFT-Trans-aktionen beziehen sich nicht auf physische Objekte im Raum. Sie bezie-hen sich auf Momente in der Zeit. Der im Smart Contract verzeichnete Zeit-stempel ist der Quell der Aura. An die Stelle physischer Ausdehnung tritt ein Moment in der Geschichte. Gehandelt wird Geschichte selbst.“ Etwas nied-riger hätte man das Phänomen auch aufhängen können. Die Überhöhung macht jedoch deutlich, welches Poten-zial in der Innovation ruht.
Gleichzeitig warnt er vor Gefahren für die Kunst, die besonders dann droh-
ten, wenn NFTs dazu führten, dasssich künstlerische Produktion zu sehran der Nachfrage orientiere, statt ästhe-tischen Ansätzen zu folgen.
Das liegt jedoch weniger in derHandelbarkeit elektronischer Kunst,deren Sammlerkreis in der klassischenKunstszene, die noch auf Repräsenta-tion und Musealität setzt, auch in ab-sehbarer Zeit überschaubar sein dürfte.Vielmehr eröffnet die Verifizierungvon Kunst in einer Blockchain Mög-lichkeiten für die Finanzbranche, in-dem physische Kunstwerke in virtuelleAnteile aufgeteilt werden, die dann aufeigenen Marktplätzen wie Aktien ge-handelt werden können.
Der umfangreiche Quellennach-weis macht das Heft zu einem längerenwissenschaftlichen Aufsatz. Der lässtsich dank der Erfahrung des Autors alsFeuilleton-Redakteur der „FAZ“ gutlesen. Stefan Kobel
Non Fungible Token (NFT)
Kunst, Hype oder Ware?NFTs sind ein heißes Thema, doch kaum jemand in der Kunstwelt
kennt sich mit den digitalen Besitzzertifikaten wirklich aus. Ein neues Buch beleuchtet Grundlagen, Hintergründe und Akteure des Trends .
Kolja Reichert: Krypto-Kunst.
Wagenbach in der Reihe „Digitale
Bildkulturen“ Berlin 2021
80 Seiten, 10 Euro
Beeple „Human One“: Ein Astronaut durchkämmt dystopische Landschaften in der LED-Skulptur.
Chr
isti
e‘s
Ltd.
202
1
Geschnitzter könig- licher Hocker: Er kam durch die Sammlung von Oberst Dodds ins Museum.
acti
on p
ress
Auktion eines Video-NFTs
Umgang in Deutschland Die Rückgabe von Benin-Objekten aus deutschen Museen steht immer noch aus. Doch auf dem langen und bürokratischen Weg dorthin ist im Oktober wenigstens ein „Memo-randum of Understanding“ mit Nigeria unter-zeichnet worden. Noch in diesem Jahr sollen Rahmenvereinbarungen getroffen werden, die zu „Eigentumsübertragungen im zweiten Quartal 2022“ führen dürften, heißt es in einer Mitteilung. Nicht alle geraubten Benin-Bronzen werden zurückgeführt, einige verbleiben in deutschen Museen. „Die Rückgabe soll nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Qualität in den Beziehungen zwischen Nigeria und Deutschland sein.“ Zirkulierende Ausstel-lungsprojekte sollen das unterstreichen.
Der Erforschung von unrechtmäßig entzoge-nem Kulturgut widmet sich das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. Gegründet für im Nationalsozialismus entzoge-ne Kunst, fördert und finanziert es seit 2019 auch Forschung zur Kolonialgeschichte. Kurzfris-tig kann die Herkunftsgeschichte von 90 Benin-Skulpturen aus Museen in Mannheim, München und Bremen untersucht werden. Langfristig werden sechs neue und zwei laufende Projekte mit fast einer Million Euro gefördert. Göttingen etwa entwickelt nichtinvasive Ultraschallmetho-den zur DNA-Analyse aus menschlichem Gebein – ein Anliegen der Herkunftsgesellschaften. sds
Kunstmarkt
64 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Olga Grimm-Weissert Paris
Als „ein historisches Ereignis ohnegleichen“ bezeichnete die französische Professorin Bénédicte Savoy die Rückgabe von 26 im Jahr 1892 geraubten Werken an die Re-publik Benin durch Frankreich. Die für ih-ren entschiedenen Einsatz für die Resti-
tution geraubten Kulturguts bekannte und oft an-gefeindete Professorin an der Technischen Universität in Berlin äußerte ihre Begeisterung anlässlich der Feier zur Übergabe der Werke am 27. Oktober.
Die drei Königs-Skulpturen aus Holz, aufwen-dig geschnitzte Throne, Türreliefs oder Waffen von Würdenträgern raubte der französische Ge-neral Alfred-Amédée Dodds 1892 im Krieg gegen die Könige von Abomey, die sich gegen die Ko-lonisierung wehrten. Dodds schenkte 26 Objekte französischen Museen. Zuletzt waren sie im Pa-riser „Musée du Quai Branly – Jacques Chirac“ (MQB) ausgestellt, das außereuropäische Kultu-ren präsentiert. Die symbolische Rückgabe fand am 27. Oktober im MQB in Anwesenheit von Staatspräsident Emmanuel Macron statt.
Rein rechtlich gehören die Objekte aber erst nach der Unterzeichnung eines Dokuments zur Übertragung des Eigentums von einem Staat an den anderen wirklich dem Land Benin. Diese ze-remonielle Unterzeichnung ist am 9. November im Élysée-Palast geplant, in Anwesenheit der bei-den Staatspräsidenten Emmanuel Macron und Patrice Talon sowie aller zuständigen Minister. Die verantwortlichen Museumsleute von Benin haben – laut einer Sprecherin des Élysées – bereits
den Abtransport des „Schatzes von Benin“ am gleichen Abend organisiert und planen, die An-kunft in der Hafenstadt Cotonou mit „großem Pomp“ zu feiern.
Man muss dem französischen Staatspräsiden-ten Macron zugestehen, dass er einen ausgepräg-ten Sinn für Dramatisierung und symbolische Gesten von historischer Tragweite hat. Vor vier Jahren löste er mit seiner viel zitierten Rede in Burkina Fasos Hauptstadt Ougadougou europa-weit eine Veränderung des Bewusstseins und der Bewertung von Raubkunst aus. Er forderte, „Be-dingungen zur temporären oder definitiven Rück-gabe des afrikanischen Kulturguts“ zu schaffen.
Macron beauftragte Professorin Bénédicte Savoy und den senegalesischen Wirtschaftsprofes-
sor Felwine Sarr mit der „Mission Macron“. Die beiden Wissenschaftler verfassten den Bericht zur „Restitution afrikanischen Kulturguts“. Dessen Veröffentlichung löste Ende 2018 eine Welle von beißender Kritik vonseiten des Handels aus. „Der Status der Unveränderlichkeit ist ein Prinzip der Republik“, unterstrich der Galerist Frédéric Cas-taing noch bei einem Kolloquium zur Restitution. Die Verantwortlichen der Museen reagierten noch heftiger ob der absehbaren Verluste, aber meist hinter vorgehaltener Beamtenhand.
In der Folge begannen ethnologische Museen der ehemaligen Kolonialmächte Frankreich, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Deutsch-land sowie Schweizer Museen mit der Inventari-sierung ihrer außereuropäischen Bestände. Die Kontakte zu Wissenschaftlern in den Herkunfts-gesellschaften der ehemaligen Kolonien wurden intensiviert. Im Gegensatz zu den englischen Ko-lonialtruppen, die 1897 in Edo, heute Benin City in Nigeria, Tausende Bronzereliefs raubten, nach London transportierten und großteils – zum Bei-spiel an deutsche Museen – verkauften, sind die französischen Plünderungen des Generals Alfred Amédée Dodds in Abomey im Jahr 1892 nur durch seine Museumsschenkung überliefert.
Obwohl staatliches Kulturgut in Frankreich unveräußerlich, unveränderbar, unübertragbar ist, setzte Präsident Macron mithilfe des Außen-ministeriums durch, dass Parlament und Senat im Dezember 2020 ein Sondergesetz verabschie-deten, das die Übertragung des Eigentums an die Republik Benin legalisiert.
Logischerweise verkündete Präsident Macron bei dem Festakt: „Für uns besteht die Aufgabe da-
Rückgabe von Raubgut
Historische Tragweite Mit viel Sinn für symbolische Gesten gibt Frankreichs Staatspräsident
Emmanuel Macron 26 geraubte Kunstwerke an die Republik Benin zurück. Für die Restitution von Staatseigentum hat er sogar ein Gesetz ändern lassen.
Holzstatuen aus dem Königreich Dahomey: Frankreich gibt 26 Kunst-werke aus dem Museum Quai Branly in Paris an Benin zurück.
acti
on p
ress
Staatspräsident Emmanuel Macron
machte die Restitution zur Chefsache:
Hier vor Reliefs aus dem Glélé-Palast.
acti
on p
ress
Christie’s hatte im März einen Meilenstein der Kunst-marktgeschichte gesetzt mit der Versteigerung von Beeples visuellem Tagebuch „Everyday“ für 69 Millionen Dollar. Jetzt legen der Grafikdesigner Beeple und das Auktionshaus mit „Human One“ nach. Erstmals werden am 9. November eine physische Vier-Kanal-Video-Installati-on und das dazugehörige NFT mit Ether-basierten Kurz-videos versteigert werden. Christie’s geht von einem unveröffentlichten Schätzpreis von über 15 Millionen Dollar aus. Das Besondere an „Human One“ ist, dass beide Versionen – anders als statische Kunstwerke – von Beeple ständig ergänzt und aktualisiert werden, so als pflegte der Künstler einen Dialog mit dem Käufer. sds
Kunstmarkt
65WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
rin, der Zivilgesellschaft, der afrikanischen Jugend den Zugang zu einem Teil ihrer eigenen Ge-schichte in ihren Museen zu ermöglichen.“
Die westafrikanische Bevölkerung hatte be-reits 2006 die Gelegenheit, ihre im 19. Jahrhun-dert geplünderten Kulturgegenstände in der „Fon-dation Zinsou“ in Cotonou (Benin) zu besichti-gen. Das Interesse an den Leihgaben aus Paris war enorm. Das führte zehn Jahre später zur offiziellen Restitutionsforderung durch Präsident Patrice Ta-lon an den französischen Staat. Diesem Rückgabe-gesuch erteilte man eine – rein rechtlich begrün-dete – schnöde Abfuhr.
Der Gründer der „Fondation Zinsou“ ist der Wirtschaftswissenschaftler und Bankier Lionel Zinsou, der auch kurzfristig Benins Premiermi-nister war. Zinsou riet Macron, die Restitutionen ernsthaft anzutreiben.
Seine Tochter Marie-Cécile Zinsou, die die kulturpädagogisch ausgerichtete „Fondation Zin-sou“ in Cotonou leitet, wurde vergangene Woche vom französischen Staatspräsidenten zur Vorsit-zenden des Verwaltungsrats der Villa Medici in Rom ernannt. Die Villa Medici ist Frankreichs kul-turelles Aushängeschild im Ausland schlechthin. Dort ein Stipendium zu erhalten gilt für Künstler und Wissenschaftler als staatliche Anerkennung ersten Rangs. Die Familie Zinsou ist eindeutig überbegabt. Dennoch scheint es, dass Frankreichs Staatsmühlen gelegentlich rasch und ungeniert mahlen.
Das „Soft Power“-Thema der Restitutionen dient in erster Linie wirtschaftlichen Interessen. Benin hat Goldreserven, die Frankreich und Europa nicht der Achse „Chinafrika“ allein zur Ausbeutung überlassen möchten.
B edeuten NFTs das Ende der Kunst und des Kunstmarkts oder ihre Rettung? Das weiß auch Kolja Reichert nicht. Ansonsten lässt
der Kurator an der Bundeskunsthalle in Bonn in seinem Buch „Krypto-Kunst“ jedoch kaum eine Frage zum Thema unbeantwortet. In einem schmalen Bändchen bringt er Theorie und Praxis der Non Fungible Tokens, der durch ei-ne Blockchain abgesicherten Besitzzer-tifikate, so zusammen, dass auch Men-schen, die mit dem Begriff nichts anfan-gen konnten, sich selbst in Expertenrunden nicht verloren fühlen.
Alle wichtigen Aspekte des Phäno-mens, das seit Anfang 2021 die Schlag-zeilen nicht nur der Kunstpublikationen mitbestimmt, werden kenntnisreich be-leuchtet. Wie funktioniert eine Block-chain, was sind NFTs, wer kauft sie, und was ist Kryptokunst überhaupt?
Eines ist für den Autor klar: NFTs lösen in einem Teilbereich das ein, was von der Kunst gern behauptet wird, nämlich dass sie autonom sei. Die Blockchain habe mit „Dezentralen Au-tonomen Organisationen“ – DAO – das Konstrukt einer juristischen Person her-vorgebracht, die basisdemokratische Entscheidungen ohne Vermittler-instanz treffen kann. Dieser Umstand ist nicht banal, betrifft er doch unmit-telbar die Art, wie die mithilfe von NFTs erzeugten und verbrieften Inhalte vermittelt werden. Vermittlung meint in diesem Fall den Besitzerwechsel, also den Handel.
Es wird gern behauptet, Kunst sei ein Spiegel der Gesellschaft. Demnach wä-ren NFTs das passende Kunstvehikel für eine Welt, die nicht mehr auf abstrakten Werten und übergeordneten Prinzipien aufbaut, sondern auf Transaktionalität und Transparenz – innerhalb der Kryp-towelt, deren Regeln Außenstehenden jedoch ebenso unverständlich erscheinen wie den meisten Menschen die unge-schriebenen Regeln der traditionellen Kunstszene. Reichert liefert keine Be-dienungsanleitung zur Navigation auf den verschiedenen Plattformen oder Empfehlungen für den NFT-Markt. Er erklärt vielmehr die Grundlagen des neu-en Feldes und bettet das Phänomen in einen größeren Zusammenhang ein.
Das Potenzial der ErfindungEinfach macht es der Autor seinen Le-sern nicht immer, und bisweilen gleiten die kompakten Formulierungen ins Be-deutungsschwangere, etwa wenn er das Revolutionäre an den digitalen Zertifi-katen erklärt: „NFTs begleiten einen ka-tegorischen Umschlag hinsichtlich des-sen, was ein Kulturgut ist: NFT-Trans-aktionen beziehen sich nicht auf physische Objekte im Raum. Sie bezie-hen sich auf Momente in der Zeit. Der im Smart Contract verzeichnete Zeit-stempel ist der Quell der Aura. An die Stelle physischer Ausdehnung tritt ein Moment in der Geschichte. Gehandelt wird Geschichte selbst.“ Etwas nied-riger hätte man das Phänomen auch aufhängen können. Die Überhöhung macht jedoch deutlich, welches Poten-zial in der Innovation ruht.
Gleichzeitig warnt er vor Gefahren für die Kunst, die besonders dann droh-
ten, wenn NFTs dazu führten, dasssich künstlerische Produktion zu sehran der Nachfrage orientiere, statt ästhe-tischen Ansätzen zu folgen.
Das liegt jedoch weniger in derHandelbarkeit elektronischer Kunst,deren Sammlerkreis in der klassischenKunstszene, die noch auf Repräsenta-tion und Musealität setzt, auch in ab-sehbarer Zeit überschaubar sein dürfte.Vielmehr eröffnet die Verifizierungvon Kunst in einer Blockchain Mög-lichkeiten für die Finanzbranche, in-dem physische Kunstwerke in virtuelleAnteile aufgeteilt werden, die dann aufeigenen Marktplätzen wie Aktien ge-handelt werden können.
Der umfangreiche Quellennach-weis macht das Heft zu einem längerenwissenschaftlichen Aufsatz. Der lässtsich dank der Erfahrung des Autors alsFeuilleton-Redakteur der „FAZ“ gutlesen. Stefan Kobel
Non Fungible Token (NFT)
Kunst, Hype oder Ware?NFTs sind ein heißes Thema, doch kaum jemand in der Kunstwelt
kennt sich mit den digitalen Besitzzertifikaten wirklich aus. Ein neues Buch beleuchtet Grundlagen, Hintergründe und Akteure des Trends .
Kolja Reichert: Krypto-Kunst.
Wagenbach in der Reihe „Digitale
Bildkulturen“ Berlin 2021
80 Seiten, 10 Euro
Beeple „Human One“: Ein Astronaut durchkämmt dystopische Landschaften in der LED-Skulptur.
Chr
isti
e‘s
Ltd.
202
1
Geschnitzter könig- licher Hocker: Er kam durch die Sammlung von Oberst Dodds ins Museum.
acti
on p
ress
Auktion eines Video-NFTs
Umgang in Deutschland Die Rückgabe von Benin-Objekten aus deutschen Museen steht immer noch aus. Doch auf dem langen und bürokratischen Weg dorthin ist im Oktober wenigstens ein „Memo-randum of Understanding“ mit Nigeria unter-zeichnet worden. Noch in diesem Jahr sollen Rahmenvereinbarungen getroffen werden, die zu „Eigentumsübertragungen im zweiten Quartal 2022“ führen dürften, heißt es in einer Mitteilung. Nicht alle geraubten Benin-Bronzen werden zurückgeführt, einige verbleiben in deutschen Museen. „Die Rückgabe soll nicht das Ende, sondern der Beginn einer neuen Qualität in den Beziehungen zwischen Nigeria und Deutschland sein.“ Zirkulierende Ausstel-lungsprojekte sollen das unterstreichen.
Der Erforschung von unrechtmäßig entzoge-nem Kulturgut widmet sich das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. Gegründet für im Nationalsozialismus entzoge-ne Kunst, fördert und finanziert es seit 2019 auch Forschung zur Kolonialgeschichte. Kurzfris-tig kann die Herkunftsgeschichte von 90 Benin-Skulpturen aus Museen in Mannheim, München und Bremen untersucht werden. Langfristig werden sechs neue und zwei laufende Projekte mit fast einer Million Euro gefördert. Göttingen etwa entwickelt nichtinvasive Ultraschallmetho-den zur DNA-Analyse aus menschlichem Gebein – ein Anliegen der Herkunftsgesellschaften. sds
Kunstmarkt
66 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Nina Schedlmayer Wien
Es war eine lange Suche, die 2021 end-lich von Erfolg gekrönt wurde: Schon seit vielen Jahren wollte der Berliner Galerist Johann König in Wien eine Location eröffnen. Nun fand er sie endlich in einem ehemaligen Ver-
kehrsbüro, einem Art-déco-Gebäude, dem Kleinen Haus der Kunst (KHK), gleich ge-genüber der traditionsreichen Secession.
War vor der Eröffnung von einem 2000 Quadratmeter großen Kunstraum die Re-de, so relativierte sich das bald. Diese Zahl
bezog sich nämlich auf das gesamte KHK, das nur zum Teil von der König Galerie be-spielt wird. Es gehört Martin Ho, einem Wiener Szenegastronomen, dessen Freundschaft zu Ex-Bundeskanzler Sebas-tian Kurz die Wiener Kunstszene stets skeptisch beäugte. Ho organisierte immer wieder Kunstevents teils zweifelhafter Qualität, allerdings eher im privaten Rah-men. Nachhilfe in Sachen guter Kunst kann er sich nun von seinem neuen Partner ho-len. König hat ein Faible für besondere Or-
te. In Berlin machte er die Kirche St. Agnes zum Hotspot der Kunstszene, in der tür-kischen Küstenstadt Bodrum bespielt er ein Haus in einem Ferienklub, in Seoul ein Lu-xuskaufhaus. „Es ist spannend, Kunst in Räumen zu zeigen, die nicht dafür gemacht sind“, sagt König zum Handelsblatt. „In Wien beeindruckte mich neben der Lage die ehemalige Schalterhalle.“ Schon vor der Eröffnung in Wien erzählte König, dass es ihm hier keineswegs um den Verkauf gehe, sondern um die Präsentation von Ausstel-
lungen. Damit wolle er ein niederschwel-liges Angebot schaffen, so der Galerist.
Die aktuelle Schau „One Decade of Fe-male Sculptors“ kuratierte er gemeinsam mit der Leiterin seiner Wiener Dependance, Katharina Abpurg, einer erfahrenen Kunst-marktexpertin. Sie ist bis zum 5. Dezember zu sehen. Nicht nur Werke aus dem eigenen Galerieprogramm verteilen sich in der luf-tigen Halle und der Empore im ersten Stock, sondern auch solche der Wiener Galerien Ursula Krinzinger und Rosemarie Schwarz-wälder. „Ungefähr ein Drittel der Exponate ist verkäuflich, alle anderen kommen aus Privatbesitz“, erzählt König. Wer an dem einen oder anderen Werk Interesse hat, kann es über die Website der Galerie erwer-ben. Unter den Leihgaben ist unter anderen eine Arbeit von Isa Genzken. „Diese würde ich sehr gern zum Verkauf anbieten, da es sehr viele Interessenten gibt. Es gibt sie aber derzeit nicht am Markt.“
„One Decade of Female Sculptors“ prä-sentiert ausschließlich Bildhauerei von Künstlerinnen, die in den vergangenen zehn Jahren entstanden. Schon vor dem Eingang lockt sie mit einem Spiegelobjekt der hippen Berlinerin Alicja Kwade. König: „Die Aus-stellung zeigt, was Skulptur sein kann. Die meisten Menschen denken dabei an Büsten, Statuen oder dergleichen. Hier sieht man viele unterschiedliche künstlerische Posi-tionen, die mit diversen Materialien Skulp-tur realisieren.“
Nun warteten in jüngster Zeit gerade in Wien zahlreiche Ausstellungen mit einer hundertprozentigen Frauenquote auf. Die gelungenen unter ihnen fassten den Fokus enger. So zeigte etwa die Wiener Sammlung Verbund ihre zahlreichen Exponate femi-nistischer Kunst. Dem Belvedere gelang 2019 ein großer Wurf mit der Schau „Stadt der Frauen“, und das Museum für Ange-wandte Kunst lieferte kürzlich einen pro-funden Einblick in die weibliche Seite der Wiener Werkstätte.
Verglichen mit diesen Ansätzen nimmt sich die Schau bei König kuratorisch be-scheiden aus; sie erinnert an bunte Skulp-turenansammlungen bei Kunstmessen. Na-türlich sind internationale große Namen wie Isa Genzken, Katharina Grosse, Sarah Mor-ris oder Jessica Stockholder versammelt, ebenso wie Vertreterinnen der Wiener Sze-ne, darunter Sonia Leimer und Anne Schneider. Allerdings lässt sich kein Schwer-punkt erkennen über die Aussage hinaus, dass auch Frauen Skulpturen produzieren.
Die kommenden Ausstellungen werden Soloshows sein, fast ausschließlich solche männlicher Künstler: Erwin Wurm, Daniel Arsham und Andreas Schmitten sollen kommen, ebenso wie Ulay, dessen Werk mit dem seiner langjährigen Partnerin Ma-rina Abramovic gezeigt wird. Auf Nachfrage, ob in Wien auch mal einer Künstlerin eine Einzelausstellung gewidmet sein wird, er-wähnt König Alicja Kwade. Trotz eines Jahrzehnts weiblicher Bildhauerei ist bei der Frauenquote noch Luft nach oben.
Galerieszene
Debüt mit Künstlerinnen Der Berliner Galerist Johann König hat eine Dependance in Wien
eröffnet. Für die erste Ausstellung kooperiert er mit Wiener Kolleginnen. Nur ein Drittel der Werke ist verkäuflich.
Skulptur von Künstlerinnen: In Wien treffen aufeinander Werke von Ayako Rokkaku, Helen Marten, Alice
Anderson, Jessica Stockholder, Camille Henrot, Brigitte Kowanz
und Chiharu Shiota.
KÖN
IG G
ALE
RIE
; Fot
o: k
unst
-dok
umen
tati
on.c
om; V
G B
ild-K
unst
für
Hen
rot,
Kow
anz,
Shi
ota
Hier sieht man viele
unterschied-liche
künstlerische Positionen,
die mit diversen
Materialien Skulptur
realisieren.
Johann KönigGalerist
Sarah Morris: „No one can play a game alone“ – eine Skulptur aus lackiertem Glas und Marmor.
KÖN
IG G
ALE
RIE
Ber
lin |
Lond
on |
Seou
l | V
ienn
a
Kunstmarkt
67WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
K aum jemandem ist es bewusst: Die Kultur- und Kreativwirt-schaft ist Deutschlands drittgröß-ter Wirtschaftszweig – nach Au-
tomobilindustrie und Maschinenbau. Nachvollziehbar, dass sich elf Teilbran-chen, darunter auch der Bundesver-band Deutscher Galerien und Kunst-händler (BVDG), nun zu einem Bünd-nis zusammengeschlossen haben. Mit der neu gegründeten „Koalition Kul-tur- und Kreativwirtschaft in Deutsch-land (k3d)“ will man endlich seinem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gewicht entsprechend wahrgenom-men werden und mit einem verläss-lichen Ansprechpartner in der Politik rechnen können, und zwar auf Staats-sekretärebene. „Wir wollen nicht mehr ‚nur‘ auf Abteilungsleiterebene Gesprä-che im Bundeswirtschaftsministerium führen, sondern als echter Wirtschafts-faktor auf dem Schirm der Spitze eines solchen Ressorts ankommen“, fordert Birgit Maria Sturm, die Geschäftsfüh-rerin des BVDG auf Nachfrage. Das
ginge natürlich nur in größerem Clus-ter, in dem sich heterogene Kulturwirt-schaftszweige zusammenfänden.
Im k3d-Bündnis treten die privat-wirtschaftlichen Interessenvertreter der Branchen Buch, Design, Kunsthan-del, Verlage, Mode, Musik und Kon-zertveranstaltung gemeinsam an – je-doch ohne feste Verbandsstruktur und ohne die Position eines Dachverbands anzustreben.
Wie nötig es ist, sich politisch an rechter Stelle Gehör zu verschaffen, zeigte sich in der Coronakrise. Der BVDG etwa mäanderte zwischen dem nicht unbedingt kulturnahen BMWi und einem Kulturministerium hin und her, das wiederum nicht Ansprechpart-ner für Wirtschaftsförderung sein durf-te. Die Kulturwirtschaft saß zwischen den Stühlen. Das k3d-Bündnis nutzt die Zeit des Stühlerückens vor der Re-gierungsbildung, um mit Ansprech-partnern in den Parteien Gespräche zu führen und ein Netzwerk aufzubauen.
Was aber wird aus dem Bündnis,
wenn es seine zwei wichtigsten Ziele erreicht hat, wahrgenommen zu wer-den und einen Ansprechpartner zu ha-ben? „Wenn das Ziel einmal erreichtist, dann wollen wir da auch bleiben“,betont Sturm. Es werde neue Themengeben. Und deshalb müsse es für diePolitik selbstverständlich werden, „mit‚uns‘ zu sprechen“. Zum Beispiel auchüber Gesetzgebungsverfahren. Siemüssten künftig verstärkt darauf „ab-geklopft“ werden, ob sie die Kultur-wirtschaft tangieren.
„Es muss ein staatliches Interessedaran geben, den Kulturbetrieb zuschützen“, fordert Sturm. „Wir wollennicht noch einmal erleben, dass in ei-nem Ministerium von wenigen Beam-ten über Jahrzehnte an einem Gesetzgefeilt wird, das dann viel zu spät denBetroffenen kommuniziert wird.“Dann geschehe genau das, was vor einpaar Jahren aus dem Kulturgutschutz-gesetz folgte: „Eine heillose Auseinan-dersetzung zwischen Politik undMarkt.“ Christiane Fricke
Kulturwirtschaft
Deutschlands drittgrößter Wirtschaftszweig bündelt seine KräfteBranchenvertreter aus den Bereichen Kunsthandel, Design, Buch, Verlag, Mode und Aufführungskünste haben
sich zusammengeschlossen. Sie wollen sich mehr Gehör bei der Politik verschaffen.
Auktionshäuser, insbesondere die kleineren, sind für Kunst-freunde Orte überraschender Entdeckungen. Der Münchener Versteigerer Scheublein wird am 3. Dezember eine Reihe von außergewöhnlichen Objekten aufrufen. Die kann, wer auf we-nige Mitbieter stößt, zu günstigen Preisen erwerben.
Ein Tisch wird dem zur Tafel, der Salzschälchen aus Silber in Form von Krabben hinstellt. Der Satz mit vier größeren Krab-ben und das Set aus acht kleineren Krabben sind jeweils auf 1500 Euro geschätzt. Gefertigt hat die dosenartigen Objekte mit Rü-ckenpanzern, die sich öffnen lassen, und mit Augen aus Korallen
das Mailänder Juwelierhaus Buccel-lati. Es steht für kostbare Ge-schmeide und ab 1955 auch für Sil-berobjekte. Wenn bei Tisch nicht über Politik oder Religion gespro-chen werden sollte, bot die Tafel-zier ein willkommenes Gesprächs-thema unter Sitznachbarn, die sich noch nicht kannten. „Conversation pieces“ nennen die Engländer solch ein unverfängliches Gesprächs-angebot.
Schön anzuschauen sind auch 40 Spazierstöcke. Mit ihnen setz-ten vor 150 Jahren Gentlemen und Dandys Statement. Der Knauf ist oft eine kleine Skulptur: sei es ein Memento-mori-Totenkopf oder ei-ne Jagdszene, ein Fabelwesen oder eine erotische Darstellung. Die Schätzpreise liegen hier zwischen 120 und 600 Euro.
Humorvoll charakterisierte Meissens Meistermodelleur Johann
Joachim Kaendler die 16 Musiker seiner „Affenkapelle“. Auk-tionator Michael Scheublein setzt die heiter-ironische Gruppe mit 5000 Euro an. Kleine Gemälde auf Kupfertafeln haben ganz besondere Leuchtkraft und Ausstrahlung. So auch eine „An-betungsszene mit Hirten“. Sie wird inzwischen der vierten Ge-neration der großen flämischen Malerfamilie Francken zuge-schrieben. Kostenpunkt für das liebevoll ausgestattete weih-nachtliche Thema: etwa 12.000 Euro.
Aber auch raffinierter Schmuck, eine Sammlung feiner Bor-deaux-Weine und historisches Spielzeug, etwa vom Lebkuchen-Bäcker Bär aus Nürnberg, finden sich in der Offerte. sds
Auktionshaus Scheublein
Eine Quelle für außerordentliche Objekte
Birgit Maria Sturm lenkt den Bundesverband der Galerien und Kunsthändler
„Wir wollen nicht noch einmal erleben, dass in einem Ministerium von wenigen Beamten über Jahrzehnte
an einem Gesetz gefeilt wird, das dann viel zu spät den Betroffenen kommuniziert wird. Dann geschieht
genau das, was vor ein paar Jahren aus dem Kulturgutschutzgesetz folgte: eine heillose Auseinander-
setzung zwischen Politik und Markt.“
Cla
ra W
enze
l-The
iler
Musikerin: Aus der ironischen „Affenkapelle“ aus Meissen.
Sche
uble
in
Kunstmarkt
66 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Nina Schedlmayer Wien
Es war eine lange Suche, die 2021 end-lich von Erfolg gekrönt wurde: Schon seit vielen Jahren wollte der Berliner Galerist Johann König in Wien eine Location eröffnen. Nun fand er sie endlich in einem ehemaligen Ver-
kehrsbüro, einem Art-déco-Gebäude, dem Kleinen Haus der Kunst (KHK), gleich ge-genüber der traditionsreichen Secession.
War vor der Eröffnung von einem 2000 Quadratmeter großen Kunstraum die Re-de, so relativierte sich das bald. Diese Zahl
bezog sich nämlich auf das gesamte KHK, das nur zum Teil von der König Galerie be-spielt wird. Es gehört Martin Ho, einem Wiener Szenegastronomen, dessen Freundschaft zu Ex-Bundeskanzler Sebas-tian Kurz die Wiener Kunstszene stets skeptisch beäugte. Ho organisierte immer wieder Kunstevents teils zweifelhafter Qualität, allerdings eher im privaten Rah-men. Nachhilfe in Sachen guter Kunst kann er sich nun von seinem neuen Partner ho-len. König hat ein Faible für besondere Or-
te. In Berlin machte er die Kirche St. Agnes zum Hotspot der Kunstszene, in der tür-kischen Küstenstadt Bodrum bespielt er ein Haus in einem Ferienklub, in Seoul ein Lu-xuskaufhaus. „Es ist spannend, Kunst in Räumen zu zeigen, die nicht dafür gemacht sind“, sagt König zum Handelsblatt. „In Wien beeindruckte mich neben der Lage die ehemalige Schalterhalle.“ Schon vor der Eröffnung in Wien erzählte König, dass es ihm hier keineswegs um den Verkauf gehe, sondern um die Präsentation von Ausstel-
lungen. Damit wolle er ein niederschwel-liges Angebot schaffen, so der Galerist.
Die aktuelle Schau „One Decade of Fe-male Sculptors“ kuratierte er gemeinsam mit der Leiterin seiner Wiener Dependance, Katharina Abpurg, einer erfahrenen Kunst-marktexpertin. Sie ist bis zum 5. Dezember zu sehen. Nicht nur Werke aus dem eigenen Galerieprogramm verteilen sich in der luf-tigen Halle und der Empore im ersten Stock, sondern auch solche der Wiener Galerien Ursula Krinzinger und Rosemarie Schwarz-wälder. „Ungefähr ein Drittel der Exponate ist verkäuflich, alle anderen kommen aus Privatbesitz“, erzählt König. Wer an dem einen oder anderen Werk Interesse hat, kann es über die Website der Galerie erwer-ben. Unter den Leihgaben ist unter anderen eine Arbeit von Isa Genzken. „Diese würde ich sehr gern zum Verkauf anbieten, da es sehr viele Interessenten gibt. Es gibt sie aber derzeit nicht am Markt.“
„One Decade of Female Sculptors“ prä-sentiert ausschließlich Bildhauerei von Künstlerinnen, die in den vergangenen zehn Jahren entstanden. Schon vor dem Eingang lockt sie mit einem Spiegelobjekt der hippen Berlinerin Alicja Kwade. König: „Die Aus-stellung zeigt, was Skulptur sein kann. Die meisten Menschen denken dabei an Büsten, Statuen oder dergleichen. Hier sieht man viele unterschiedliche künstlerische Posi-tionen, die mit diversen Materialien Skulp-tur realisieren.“
Nun warteten in jüngster Zeit gerade in Wien zahlreiche Ausstellungen mit einer hundertprozentigen Frauenquote auf. Die gelungenen unter ihnen fassten den Fokus enger. So zeigte etwa die Wiener Sammlung Verbund ihre zahlreichen Exponate femi-nistischer Kunst. Dem Belvedere gelang 2019 ein großer Wurf mit der Schau „Stadt der Frauen“, und das Museum für Ange-wandte Kunst lieferte kürzlich einen pro-funden Einblick in die weibliche Seite der Wiener Werkstätte.
Verglichen mit diesen Ansätzen nimmt sich die Schau bei König kuratorisch be-scheiden aus; sie erinnert an bunte Skulp-turenansammlungen bei Kunstmessen. Na-türlich sind internationale große Namen wie Isa Genzken, Katharina Grosse, Sarah Mor-ris oder Jessica Stockholder versammelt, ebenso wie Vertreterinnen der Wiener Sze-ne, darunter Sonia Leimer und Anne Schneider. Allerdings lässt sich kein Schwer-punkt erkennen über die Aussage hinaus, dass auch Frauen Skulpturen produzieren.
Die kommenden Ausstellungen werden Soloshows sein, fast ausschließlich solche männlicher Künstler: Erwin Wurm, Daniel Arsham und Andreas Schmitten sollen kommen, ebenso wie Ulay, dessen Werk mit dem seiner langjährigen Partnerin Ma-rina Abramovic gezeigt wird. Auf Nachfrage, ob in Wien auch mal einer Künstlerin eine Einzelausstellung gewidmet sein wird, er-wähnt König Alicja Kwade. Trotz eines Jahrzehnts weiblicher Bildhauerei ist bei der Frauenquote noch Luft nach oben.
Galerieszene
Debüt mit Künstlerinnen Der Berliner Galerist Johann König hat eine Dependance in Wien
eröffnet. Für die erste Ausstellung kooperiert er mit Wiener Kolleginnen. Nur ein Drittel der Werke ist verkäuflich.
Skulptur von Künstlerinnen: In Wien treffen aufeinander Werke von Ayako Rokkaku, Helen Marten, Alice
Anderson, Jessica Stockholder, Camille Henrot, Brigitte Kowanz
und Chiharu Shiota.
KÖN
IG G
ALE
RIE
; Fot
o: k
unst
-dok
umen
tati
on.c
om; V
G B
ild-K
unst
für
Hen
rot,
Kow
anz,
Shi
ota
Hier sieht man viele
unterschied-liche
künstlerische Positionen,
die mit diversen
Materialien Skulptur
realisieren.
Johann KönigGalerist
Sarah Morris: „No one can play a game alone“ – eine Skulptur aus lackiertem Glas und Marmor.
KÖN
IG G
ALE
RIE
Ber
lin |
Lond
on |
Seou
l | V
ienn
a
Kunstmarkt
67WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
K aum jemandem ist es bewusst: Die Kultur- und Kreativwirt-schaft ist Deutschlands drittgröß-ter Wirtschaftszweig – nach Au-
tomobilindustrie und Maschinenbau. Nachvollziehbar, dass sich elf Teilbran-chen, darunter auch der Bundesver-band Deutscher Galerien und Kunst-händler (BVDG), nun zu einem Bünd-nis zusammengeschlossen haben. Mit der neu gegründeten „Koalition Kul-tur- und Kreativwirtschaft in Deutsch-land (k3d)“ will man endlich seinem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gewicht entsprechend wahrgenom-men werden und mit einem verläss-lichen Ansprechpartner in der Politik rechnen können, und zwar auf Staats-sekretärebene. „Wir wollen nicht mehr ‚nur‘ auf Abteilungsleiterebene Gesprä-che im Bundeswirtschaftsministerium führen, sondern als echter Wirtschafts-faktor auf dem Schirm der Spitze eines solchen Ressorts ankommen“, fordert Birgit Maria Sturm, die Geschäftsfüh-rerin des BVDG auf Nachfrage. Das
ginge natürlich nur in größerem Clus-ter, in dem sich heterogene Kulturwirt-schaftszweige zusammenfänden.
Im k3d-Bündnis treten die privat-wirtschaftlichen Interessenvertreter der Branchen Buch, Design, Kunsthan-del, Verlage, Mode, Musik und Kon-zertveranstaltung gemeinsam an – je-doch ohne feste Verbandsstruktur und ohne die Position eines Dachverbands anzustreben.
Wie nötig es ist, sich politisch an rechter Stelle Gehör zu verschaffen, zeigte sich in der Coronakrise. Der BVDG etwa mäanderte zwischen dem nicht unbedingt kulturnahen BMWi und einem Kulturministerium hin und her, das wiederum nicht Ansprechpart-ner für Wirtschaftsförderung sein durf-te. Die Kulturwirtschaft saß zwischen den Stühlen. Das k3d-Bündnis nutzt die Zeit des Stühlerückens vor der Re-gierungsbildung, um mit Ansprech-partnern in den Parteien Gespräche zu führen und ein Netzwerk aufzubauen.
Was aber wird aus dem Bündnis,
wenn es seine zwei wichtigsten Ziele erreicht hat, wahrgenommen zu wer-den und einen Ansprechpartner zu ha-ben? „Wenn das Ziel einmal erreichtist, dann wollen wir da auch bleiben“,betont Sturm. Es werde neue Themengeben. Und deshalb müsse es für diePolitik selbstverständlich werden, „mit‚uns‘ zu sprechen“. Zum Beispiel auchüber Gesetzgebungsverfahren. Siemüssten künftig verstärkt darauf „ab-geklopft“ werden, ob sie die Kultur-wirtschaft tangieren.
„Es muss ein staatliches Interessedaran geben, den Kulturbetrieb zuschützen“, fordert Sturm. „Wir wollennicht noch einmal erleben, dass in ei-nem Ministerium von wenigen Beam-ten über Jahrzehnte an einem Gesetzgefeilt wird, das dann viel zu spät denBetroffenen kommuniziert wird.“Dann geschehe genau das, was vor einpaar Jahren aus dem Kulturgutschutz-gesetz folgte: „Eine heillose Auseinan-dersetzung zwischen Politik undMarkt.“ Christiane Fricke
Kulturwirtschaft
Deutschlands drittgrößter Wirtschaftszweig bündelt seine KräfteBranchenvertreter aus den Bereichen Kunsthandel, Design, Buch, Verlag, Mode und Aufführungskünste haben
sich zusammengeschlossen. Sie wollen sich mehr Gehör bei der Politik verschaffen.
Auktionshäuser, insbesondere die kleineren, sind für Kunst-freunde Orte überraschender Entdeckungen. Der Münchener Versteigerer Scheublein wird am 3. Dezember eine Reihe von außergewöhnlichen Objekten aufrufen. Die kann, wer auf we-nige Mitbieter stößt, zu günstigen Preisen erwerben.
Ein Tisch wird dem zur Tafel, der Salzschälchen aus Silber in Form von Krabben hinstellt. Der Satz mit vier größeren Krab-ben und das Set aus acht kleineren Krabben sind jeweils auf 1500 Euro geschätzt. Gefertigt hat die dosenartigen Objekte mit Rü-ckenpanzern, die sich öffnen lassen, und mit Augen aus Korallen
das Mailänder Juwelierhaus Buccel-lati. Es steht für kostbare Ge-schmeide und ab 1955 auch für Sil-berobjekte. Wenn bei Tisch nicht über Politik oder Religion gespro-chen werden sollte, bot die Tafel-zier ein willkommenes Gesprächs-thema unter Sitznachbarn, die sich noch nicht kannten. „Conversation pieces“ nennen die Engländer solch ein unverfängliches Gesprächs-angebot.
Schön anzuschauen sind auch 40 Spazierstöcke. Mit ihnen setz-ten vor 150 Jahren Gentlemen und Dandys Statement. Der Knauf ist oft eine kleine Skulptur: sei es ein Memento-mori-Totenkopf oder ei-ne Jagdszene, ein Fabelwesen oder eine erotische Darstellung. Die Schätzpreise liegen hier zwischen 120 und 600 Euro.
Humorvoll charakterisierte Meissens Meistermodelleur Johann
Joachim Kaendler die 16 Musiker seiner „Affenkapelle“. Auk-tionator Michael Scheublein setzt die heiter-ironische Gruppe mit 5000 Euro an. Kleine Gemälde auf Kupfertafeln haben ganz besondere Leuchtkraft und Ausstrahlung. So auch eine „An-betungsszene mit Hirten“. Sie wird inzwischen der vierten Ge-neration der großen flämischen Malerfamilie Francken zuge-schrieben. Kostenpunkt für das liebevoll ausgestattete weih-nachtliche Thema: etwa 12.000 Euro.
Aber auch raffinierter Schmuck, eine Sammlung feiner Bor-deaux-Weine und historisches Spielzeug, etwa vom Lebkuchen-Bäcker Bär aus Nürnberg, finden sich in der Offerte. sds
Auktionshaus Scheublein
Eine Quelle für außerordentliche Objekte
Birgit Maria Sturm lenkt den Bundesverband der Galerien und Kunsthändler
„Wir wollen nicht noch einmal erleben, dass in einem Ministerium von wenigen Beamten über Jahrzehnte
an einem Gesetz gefeilt wird, das dann viel zu spät den Betroffenen kommuniziert wird. Dann geschieht
genau das, was vor ein paar Jahren aus dem Kulturgutschutzgesetz folgte: eine heillose Auseinander-
setzung zwischen Politik und Markt.“
Cla
ra W
enze
l-The
iler
Musikerin: Aus der ironischen „Affenkapelle“ aus Meissen.
Sche
uble
in
Georg Weishaupt Düsseldorf
Material-Experten, die Chefs von Spezi-alinstituten, Uniprofessoren: Alle schüt-telten den Kopf. Niemand hielt das für möglich, was Georg Wellendorff vorhat-te. Der Mitinhaber des gleichnamigen Luxusschmuck-Unternehmens wollte
ein Armband ohne den sonst üblichen Verschluss herstellen. „Hauptantrieb für mich war meine Frau“, erzählt Wellendorff. „Sie wünscht sich seit 17 Jahren endlich einen Verschluss, den sie bequem selbst anlegen kann“ – also ein Armband ohne das bei hochwertigen Gold-Schmuckstücken übliche Schloss.
Jetzt, 17 Jahre später, ist es ihm gelungen. Der 53-jährige Goldschmiedemeister hat ein neues Ma-terial entwickelt. Er nennt es „Federndes Gold“. Und diese Innovation ist für das Familienunterneh-men aus Pforzheim eine Chance, sich gegenüber den internationalen Luxusuhren- und Schmuck-Gruppen zu profilieren.
Denn damit kann es den Kunden etwas bieten, was kein Konkurrent im Sortiment hat: Das auf-wendig bearbeitete Gold ist so elastisch, dass sich das Armband wie eine edle Spirale leicht um den Arm legen lässt. Gleichzeitig hält es dort auch, oh-
ne dass ein zusätzliches Schloss benötigt wird. Das Beispiel zeigt, dass neue Technologien in der Schmuckbranche nicht von internationalen Luxus-riesen wie LVMH oder Kering kommen müssen. Im Gegenteil: Der Mittelständler schafft es, mit einem unbeirrbaren Willen, seiner jahrzehntelan-gen Erfahrung und seiner finanziellen Unabhän-gigkeit eine neue Technologie auf den Markt zu bringen.
Zumal sich auch die großen Luxushäuser schwertun mit wirklichen Innovationen. „Emotio-nen, Design, Marketing und Markenimage spielen eine viel größere Rolle als technische Innovatio-nen“, sagt Sebastian Boger, Luxusexperte der Bos-ton Consulting Group (BCG). „Deshalb ist der An-teil der Investitionen in wirkliche Innovationen in der Schmuckbranche deutlich geringer als in an-deren Branchen“, weiß Boger.
Wie viel Wellendorff in die neue Technologie investiert hat, kann er selbst nicht sagen. „Solche Innovationen gelingen nur, wenn man nicht dau-ernd auf die Kosten schaut“, sagt der Geschäftsfüh-rer. Und daraus spricht eben auch der schwäbische Familienunternehmer, der sich jahrelange For-schungsarbeit leisten kann.
Denn er hat wie sein Bruder Christoph, mit dem er sich die Geschäftsführung teilt, immer spar-sam gewirtschaftet und alles solide finanziert. Das haben die beiden Brüder von ihrem Vater Hans-Peter und ihrer Mutter Eva gelernt. Diese haben das 1893 gegründete Unternehmen, das einst Adelshäuser und reiche Bürger belieferte, seit den siebziger Jahren modernisiert. Sie investierten in
computergesteuerte Maschinen, verzichteten aber nicht auf die auch heute noch wichtige Handarbeit.
Die Eltern beraten ihre beiden Söhne immer noch. Die führen das Unternehmen bereits seit 1999 und sind ein eingespieltes Team: Christoph ist in der Geschäftsführung für den Vertrieb und Georg für die Produktion zuständig.
Georg Wellendorff hat vor allem einen unbe-irrbaren Glauben daran, neue Ideen umsetzen zu können. „Ich beschäftige mich durchschnittlich zwei Tage pro Woche mit Innovationen“, verrät er. Vieles, was er sich ausdenkt, kommt aber nie in eine der zwölf Boutiquen, die Wellendorff vor
allem in Deutschland betreibt. „Von 20 Ideen brin-gen wir letztlich nur etwa eine in unsere Geschäf-te“, räumt er ein. Zu den Schmuckstücken, die es geschafft haben, gehört etwa die sogenannte Gold-kordel, die aus Dutzenden Goldfäden gesponnen wird, oder der Ring, der aus zwei drehbaren Teilen besteht, oder jetzt das federnde Gold. Alle drei Ent-wicklungen hat sich die Familie patentieren lassen.
Der Glaube an seine Ideen findet bei Experten Anerkennung. „Ich habe der Familie Wellendorff damals gesagt, dass sich federndes Gold nicht her-stellen lässt“, sagt etwa Carlo Burkhardt, Direktor des Instituts für strategische Technologie- und Edelmetalle an der Hochschule Pforzheim. „Doch sie hat sich dadurch nicht beirren lassen.“
Erst vor dreieinhalb Jahren kam, nach vielen anderen Versuchen, ein Mitarbeiter mit einer neu-en, vielversprechenden Idee zu Georg Wellendorff. Die hat er dann mit einem kleinen Team aus Chef-designer, Halbzeugspezialisten und dem Chefkon-strukteur weiterverfolgt. Sein Tipp für andere Mit-telständler: „Suche dir die besten Spezialisten. Nur so können wir Exzellenz erreichen und uns vom Mainstream im Markt absetzen.“
Vor gut einem Jahr gab es den ersten Prototyp. Jetzt wird das neue Armband, das in der typisch-romantischen Wellendorff-Sprache „Umarme mich“ heißt, in den Boutiquen verkauft. Es hat sei-nen Preis, von 10.000 Euro an aufwärts, je nach-dem mit wie viel Brillanten es besetzt ist.
Wie er es mit seinem Team geschafft hat, das Gold so elastisch zu machen, bleibt das Betriebs-geheimnis des Goldschmiedemeisters. Er verrät nur so viel: „Wir haben Härte, Druck und einen speziellen thermischen Prozess miteinander kom-biniert.“ Die Nachfrage sei groß, berichtet er nach den ersten Wochen. So rechnet er „dieses Jahr wie-der mit einem steigenden Umsatz, auch wegen un-serer Innovation“. Selbst im vergangenen Coro-najahr hatte das Schmuckunternehmen „ein gutes
Jahr mit einem guten Ergebnis“, wie er versichert. Zahlen nennt er für sein 128 Jahre altes Unterneh-men mit seinen 160 Mitarbeitern allerdings nicht.
Die Aussichten für hochwertige Schmuckmar-ken sind nach der Schwäche wegen der Coronakri-se jedenfalls gut. McKinsey erwartet, dass der Um-satz der Branche bis 2025 wieder um zehn bis 15 Prozent wachsen wird. Vor allem der Anteil von Markenschmuck dürfte, so die Berater, weiter stei-gen. Dazu zählt auch Wellendorff. Der Senior der Familie erkannte früh, dass es wichtig war, Wel-lendorff als Schmuckmarke aufzubauen. So gelang es dem Unternehmen, sich neben der Familie Scheufele, die vor vielen Jahren die Marke Chopard aus Genf übernahm, als deutsches Unternehmen im gehobenen Schmuckmarkt zu etablieren – und das, obwohl damals viele Juweliere die Markenstra-tegie für aussichtslos hielten.
Den unbeirrbaren Glauben an den eigenen Weg hat der Vater anscheinend erfolgreich auf sei-ne Söhne Christoph und Georg übertragen.
Patentiertes Armband: Die Innovation lassen sich Kunden 10.000 Euro und mehr kosten.
Wel
lend
orf (
3)
Georg Wellendorff
Federndes Gold lässt die Konkurrenz staunen
Der mittelständische Schmuckhersteller entwickelte eine Technologie, mit der er sich vom Mainstream abhebt – und den Luxuskonzernen Paroli bieten will.
Georg Wellendorff: Aus Ideen macht er Erfolge.
Ich habe der Familie Wellendorff damals gesagt, dass sich federn-des Gold nicht herstellen lässt.
Carlo BurkhardtInstitutsdirektor an der Hochschule Pforzheim
Flexibles Material: 17 Jahre dauerte die Entwicklung, die es ermöglicht, hochwertige Armbänder ohne Verschluss herzustellen.
Unternehmer/in des Tages
68 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Inzwischen sind weltweit über 2000 Schwind-Lasersysteme in Augenpraxen und Augenkliniken installiert, bei einer globalen Gesamtzahl von 4500. Pro Jahr werden mittlerweile von allen Anbietern zusammen rund 600 Geräte der Art wie Schwind sie herstellt verkauft, davon
Augenlaser Schwind-Amaris: Das Gerät erlaubt
eine Vielfalt an Behandlungsmög-
lichkeiten.
Schw
ind
eye-
tech
-sol
utio
ns G
mbH
Der Augenlaserhersteller Schwind Eye-Tech-Solutions steht Fi-nanzkreisen zufolge zum Ver-kauf. Interessenten sind aufgeru-fen, noch diesen Monat erste Ge-
bote für die globale Nummer zwei nach Johnson & Johnson abzugeben, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertrau-te Personen. Bei einem Verkauf könnte die Firma aus dem unterfränkischen Kleinostheim, 1958 von Unternehmer Herbert Schwind gegründet, mit rund 400 Millionen Euro bewertet werden, hieß es.
Der heutige Firmenchef Rolf Schwind, dessen Familie weiterhin einen Anteil von knapp 30 Prozent besitzt, will auch künftig an der Firma beteiligt blei-ben. Die Beteiligungsfirma Ardian, die 2016 die Mehrheit erworben hatte, stellt ihre Anteile nun zum Verkauf, die In-vestmentbank Macquarie organisiert den Verkaufsprozess.
Da Schwind auf den Ausbau des Ge-schäfts in Asien setzt, vor allem in Chi-na, wird erwartet, dass sich Finanzinves-toren mit einer asiatischen Niederlas-sung um Schwind bemühen werden. Direkte Wettbewerber wie Carl Zeiss, Alcon oder Ziemer könnten ebenfalls Interesse zeigen, allerdings wäre dem 65-jährigen Rolf Schwind ein Investor als Käufer lieber.
Ardian und Macquarie lehnten Stel-lungnahmen ab. Schwind war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Schwind, anfangs vor allem auf so-genannte ophthalmologische Diagnose-systeme spezialisiert, schwenkte dann auf Augenlasersysteme zur Behandlung von Fehlsichtigkeit und Hornhaut-erkrankungen um, die erstmals 1992 bei Augen-Operationen eingesetzt wurden. Seit 1999 ist die Augenlaserchirurgie das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens.
entfällt etwa ein Viertel auf Schwind selbst. Rund acht Millionen hornhaut-chirurgische Behandlungen haben Au-genärzte mit Lasern der Schwind-Pro-duktfamilie Amaris durchgeführt, die für zwei Drittel der verkauften Lasergeräte steht. Ergänzt wird das Produktportfolio durch Untersuchungsinstrumente und ergänzende Dienstleistungen.
Bei den vom Rat für Formgebung veranstalteten German Innovation Awards 2021 wurde der Femtosekun-denlaser Schwind Atos für seine Tech-nologie, Sicherheitskonzepte und De-sign ausgezeichnet. Das profitable Un-ternehmen mit 150 Mitarbeitern, das seit 1995 von Rolf Schwind geführt wird, erwartet in diesem Jahr ein Betriebser-gebnis (bereinigtes Ebitda) von rund 20 Millionen Euro und könnte mit dem Zwanzigfachen davon bewertet werden.
Unternehmen aus dem Gesund-heitssektor, besonders Medizintechnik-hersteller, sind derzeit bei Investorensehr beliebt. Diese hoffen auf anhaltendeNachfrage nach deren Produkten. Diemeisten Verkäufe von Medizingeräte-herstellern gingen zu Bewertungen vonmehr als dem Zwanzigfachen des Be-triebsergebnisses über die Bühne.
Der Pharma- und Medizintechnik-konzern Baxter vereinbarte im Septem-ber die 10,5 Milliarden Dollar schwereÜbernahme des US-Herstellers vonKrankenbetten und OP-Tischen, Hill-rom, zu einer Bewertung von über20-mal Ebitda. Die amerikanische Sterisschloss im Juni die Übernahme des Me-dizingeräteherstellers Cantel Medicalab, wobei das Zielunternehmen mit fast25-mal Ebitda bewertet wurde. Beimteuersten Zukauf der Unternehmensge-schichte bezahlte Siemens Healthineersvergangenes Jahr für Varian, einen Her-steller von Geräten und Software für diestrahlentherapeutische Behandlung vonKrebs, sogar mehr als das Dreißigfachedes Betriebsgewinns.
Die kleine Branche der Augenlaser-geräte hat sich in den vergangenen Jah-ren durch Fusionen und Übernahmenimmer wieder verändert. Der US-Kon-zern Abbott übernahm den im SiliconValley ansässigen Hersteller von oph-thalmologische Geräte, Optimedica. DieSchweizer Alcon Laboratories kaufte diekalifornische LenSx Lasers, die als Ersteeinen Laser entwickelt hatte, der von derFDA für die Behandlung von grauemStar zugelassen wurde. Beim SchweizerAugenlasergerätehersteller Ziemer warfür gut zehn Jahre die Beteiligungsgesell-schaft BV Holding beteiligt, die ihrenAnteil allerdings in diesem Frühjahr zu-rück an die Gründerfamilie verkaufte.Arno Schütze
Rolf Schwind
Mehrheitsanteil zu verkaufenDer Augenlaserhersteller Schwind, globale Nummer zwei der Branche, sucht neue
Geldgeber. Rund 400 Millionen Euro könnte die Firma durch den Verkauf wert sein.
Firmenchef Rolf Schwind: Die Familie bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt.B
joer
n Fr
iedr
ich
Unternehmer/in des Tages
69WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Georg Weishaupt Düsseldorf
Material-Experten, die Chefs von Spezi-alinstituten, Uniprofessoren: Alle schüt-telten den Kopf. Niemand hielt das für möglich, was Georg Wellendorff vorhat-te. Der Mitinhaber des gleichnamigen Luxusschmuck-Unternehmens wollte
ein Armband ohne den sonst üblichen Verschluss herstellen. „Hauptantrieb für mich war meine Frau“, erzählt Wellendorff. „Sie wünscht sich seit 17 Jahren endlich einen Verschluss, den sie bequem selbst anlegen kann“ – also ein Armband ohne das bei hochwertigen Gold-Schmuckstücken übliche Schloss.
Jetzt, 17 Jahre später, ist es ihm gelungen. Der 53-jährige Goldschmiedemeister hat ein neues Ma-terial entwickelt. Er nennt es „Federndes Gold“. Und diese Innovation ist für das Familienunterneh-men aus Pforzheim eine Chance, sich gegenüber den internationalen Luxusuhren- und Schmuck-Gruppen zu profilieren.
Denn damit kann es den Kunden etwas bieten, was kein Konkurrent im Sortiment hat: Das auf-wendig bearbeitete Gold ist so elastisch, dass sich das Armband wie eine edle Spirale leicht um den Arm legen lässt. Gleichzeitig hält es dort auch, oh-
ne dass ein zusätzliches Schloss benötigt wird. Das Beispiel zeigt, dass neue Technologien in der Schmuckbranche nicht von internationalen Luxus-riesen wie LVMH oder Kering kommen müssen. Im Gegenteil: Der Mittelständler schafft es, mit einem unbeirrbaren Willen, seiner jahrzehntelan-gen Erfahrung und seiner finanziellen Unabhän-gigkeit eine neue Technologie auf den Markt zu bringen.
Zumal sich auch die großen Luxushäuser schwertun mit wirklichen Innovationen. „Emotio-nen, Design, Marketing und Markenimage spielen eine viel größere Rolle als technische Innovatio-nen“, sagt Sebastian Boger, Luxusexperte der Bos-ton Consulting Group (BCG). „Deshalb ist der An-teil der Investitionen in wirkliche Innovationen in der Schmuckbranche deutlich geringer als in an-deren Branchen“, weiß Boger.
Wie viel Wellendorff in die neue Technologie investiert hat, kann er selbst nicht sagen. „Solche Innovationen gelingen nur, wenn man nicht dau-ernd auf die Kosten schaut“, sagt der Geschäftsfüh-rer. Und daraus spricht eben auch der schwäbische Familienunternehmer, der sich jahrelange For-schungsarbeit leisten kann.
Denn er hat wie sein Bruder Christoph, mit dem er sich die Geschäftsführung teilt, immer spar-sam gewirtschaftet und alles solide finanziert. Das haben die beiden Brüder von ihrem Vater Hans-Peter und ihrer Mutter Eva gelernt. Diese haben das 1893 gegründete Unternehmen, das einst Adelshäuser und reiche Bürger belieferte, seit den siebziger Jahren modernisiert. Sie investierten in
computergesteuerte Maschinen, verzichteten aber nicht auf die auch heute noch wichtige Handarbeit.
Die Eltern beraten ihre beiden Söhne immer noch. Die führen das Unternehmen bereits seit 1999 und sind ein eingespieltes Team: Christoph ist in der Geschäftsführung für den Vertrieb und Georg für die Produktion zuständig.
Georg Wellendorff hat vor allem einen unbe-irrbaren Glauben daran, neue Ideen umsetzen zu können. „Ich beschäftige mich durchschnittlich zwei Tage pro Woche mit Innovationen“, verrät er. Vieles, was er sich ausdenkt, kommt aber nie in eine der zwölf Boutiquen, die Wellendorff vor
allem in Deutschland betreibt. „Von 20 Ideen brin-gen wir letztlich nur etwa eine in unsere Geschäf-te“, räumt er ein. Zu den Schmuckstücken, die es geschafft haben, gehört etwa die sogenannte Gold-kordel, die aus Dutzenden Goldfäden gesponnen wird, oder der Ring, der aus zwei drehbaren Teilen besteht, oder jetzt das federnde Gold. Alle drei Ent-wicklungen hat sich die Familie patentieren lassen.
Der Glaube an seine Ideen findet bei Experten Anerkennung. „Ich habe der Familie Wellendorff damals gesagt, dass sich federndes Gold nicht her-stellen lässt“, sagt etwa Carlo Burkhardt, Direktor des Instituts für strategische Technologie- und Edelmetalle an der Hochschule Pforzheim. „Doch sie hat sich dadurch nicht beirren lassen.“
Erst vor dreieinhalb Jahren kam, nach vielen anderen Versuchen, ein Mitarbeiter mit einer neu-en, vielversprechenden Idee zu Georg Wellendorff. Die hat er dann mit einem kleinen Team aus Chef-designer, Halbzeugspezialisten und dem Chefkon-strukteur weiterverfolgt. Sein Tipp für andere Mit-telständler: „Suche dir die besten Spezialisten. Nur so können wir Exzellenz erreichen und uns vom Mainstream im Markt absetzen.“
Vor gut einem Jahr gab es den ersten Prototyp. Jetzt wird das neue Armband, das in der typisch-romantischen Wellendorff-Sprache „Umarme mich“ heißt, in den Boutiquen verkauft. Es hat sei-nen Preis, von 10.000 Euro an aufwärts, je nach-dem mit wie viel Brillanten es besetzt ist.
Wie er es mit seinem Team geschafft hat, das Gold so elastisch zu machen, bleibt das Betriebs-geheimnis des Goldschmiedemeisters. Er verrät nur so viel: „Wir haben Härte, Druck und einen speziellen thermischen Prozess miteinander kom-biniert.“ Die Nachfrage sei groß, berichtet er nach den ersten Wochen. So rechnet er „dieses Jahr wie-der mit einem steigenden Umsatz, auch wegen un-serer Innovation“. Selbst im vergangenen Coro-najahr hatte das Schmuckunternehmen „ein gutes
Jahr mit einem guten Ergebnis“, wie er versichert. Zahlen nennt er für sein 128 Jahre altes Unterneh-men mit seinen 160 Mitarbeitern allerdings nicht.
Die Aussichten für hochwertige Schmuckmar-ken sind nach der Schwäche wegen der Coronakri-se jedenfalls gut. McKinsey erwartet, dass der Um-satz der Branche bis 2025 wieder um zehn bis 15 Prozent wachsen wird. Vor allem der Anteil von Markenschmuck dürfte, so die Berater, weiter stei-gen. Dazu zählt auch Wellendorff. Der Senior der Familie erkannte früh, dass es wichtig war, Wel-lendorff als Schmuckmarke aufzubauen. So gelang es dem Unternehmen, sich neben der Familie Scheufele, die vor vielen Jahren die Marke Chopard aus Genf übernahm, als deutsches Unternehmen im gehobenen Schmuckmarkt zu etablieren – und das, obwohl damals viele Juweliere die Markenstra-tegie für aussichtslos hielten.
Den unbeirrbaren Glauben an den eigenen Weg hat der Vater anscheinend erfolgreich auf sei-ne Söhne Christoph und Georg übertragen.
Patentiertes Armband: Die Innovation lassen sich Kunden 10.000 Euro und mehr kosten.
Wel
lend
orf (
3)
Georg Wellendorff
Federndes Gold lässt die Konkurrenz staunen
Der mittelständische Schmuckhersteller entwickelte eine Technologie, mit der er sich vom Mainstream abhebt – und den Luxuskonzernen Paroli bieten will.
Georg Wellendorff: Aus Ideen macht er Erfolge.
Ich habe der Familie Wellendorff damals gesagt, dass sich federn-des Gold nicht herstellen lässt.
Carlo BurkhardtInstitutsdirektor an der Hochschule Pforzheim
Flexibles Material: 17 Jahre dauerte die Entwicklung, die es ermöglicht, hochwertige Armbänder ohne Verschluss herzustellen.
Unternehmer/in des Tages
68 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Inzwischen sind weltweit über 2000 Schwind-Lasersysteme in Augenpraxen und Augenkliniken installiert, bei einer globalen Gesamtzahl von 4500. Pro Jahr werden mittlerweile von allen Anbietern zusammen rund 600 Geräte der Art wie Schwind sie herstellt verkauft, davon
Augenlaser Schwind-Amaris: Das Gerät erlaubt
eine Vielfalt an Behandlungsmög-
lichkeiten.
Schw
ind
eye-
tech
-sol
utio
ns G
mbH
Der Augenlaserhersteller Schwind Eye-Tech-Solutions steht Fi-nanzkreisen zufolge zum Ver-kauf. Interessenten sind aufgeru-fen, noch diesen Monat erste Ge-
bote für die globale Nummer zwei nach Johnson & Johnson abzugeben, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertrau-te Personen. Bei einem Verkauf könnte die Firma aus dem unterfränkischen Kleinostheim, 1958 von Unternehmer Herbert Schwind gegründet, mit rund 400 Millionen Euro bewertet werden, hieß es.
Der heutige Firmenchef Rolf Schwind, dessen Familie weiterhin einen Anteil von knapp 30 Prozent besitzt, will auch künftig an der Firma beteiligt blei-ben. Die Beteiligungsfirma Ardian, die 2016 die Mehrheit erworben hatte, stellt ihre Anteile nun zum Verkauf, die In-vestmentbank Macquarie organisiert den Verkaufsprozess.
Da Schwind auf den Ausbau des Ge-schäfts in Asien setzt, vor allem in Chi-na, wird erwartet, dass sich Finanzinves-toren mit einer asiatischen Niederlas-sung um Schwind bemühen werden. Direkte Wettbewerber wie Carl Zeiss, Alcon oder Ziemer könnten ebenfalls Interesse zeigen, allerdings wäre dem 65-jährigen Rolf Schwind ein Investor als Käufer lieber.
Ardian und Macquarie lehnten Stel-lungnahmen ab. Schwind war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Schwind, anfangs vor allem auf so-genannte ophthalmologische Diagnose-systeme spezialisiert, schwenkte dann auf Augenlasersysteme zur Behandlung von Fehlsichtigkeit und Hornhaut-erkrankungen um, die erstmals 1992 bei Augen-Operationen eingesetzt wurden. Seit 1999 ist die Augenlaserchirurgie das Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens.
entfällt etwa ein Viertel auf Schwind selbst. Rund acht Millionen hornhaut-chirurgische Behandlungen haben Au-genärzte mit Lasern der Schwind-Pro-duktfamilie Amaris durchgeführt, die für zwei Drittel der verkauften Lasergeräte steht. Ergänzt wird das Produktportfolio durch Untersuchungsinstrumente und ergänzende Dienstleistungen.
Bei den vom Rat für Formgebung veranstalteten German Innovation Awards 2021 wurde der Femtosekun-denlaser Schwind Atos für seine Tech-nologie, Sicherheitskonzepte und De-sign ausgezeichnet. Das profitable Un-ternehmen mit 150 Mitarbeitern, das seit 1995 von Rolf Schwind geführt wird, erwartet in diesem Jahr ein Betriebser-gebnis (bereinigtes Ebitda) von rund 20 Millionen Euro und könnte mit dem Zwanzigfachen davon bewertet werden.
Unternehmen aus dem Gesund-heitssektor, besonders Medizintechnik-hersteller, sind derzeit bei Investorensehr beliebt. Diese hoffen auf anhaltendeNachfrage nach deren Produkten. Diemeisten Verkäufe von Medizingeräte-herstellern gingen zu Bewertungen vonmehr als dem Zwanzigfachen des Be-triebsergebnisses über die Bühne.
Der Pharma- und Medizintechnik-konzern Baxter vereinbarte im Septem-ber die 10,5 Milliarden Dollar schwereÜbernahme des US-Herstellers vonKrankenbetten und OP-Tischen, Hill-rom, zu einer Bewertung von über20-mal Ebitda. Die amerikanische Sterisschloss im Juni die Übernahme des Me-dizingeräteherstellers Cantel Medicalab, wobei das Zielunternehmen mit fast25-mal Ebitda bewertet wurde. Beimteuersten Zukauf der Unternehmensge-schichte bezahlte Siemens Healthineersvergangenes Jahr für Varian, einen Her-steller von Geräten und Software für diestrahlentherapeutische Behandlung vonKrebs, sogar mehr als das Dreißigfachedes Betriebsgewinns.
Die kleine Branche der Augenlaser-geräte hat sich in den vergangenen Jah-ren durch Fusionen und Übernahmenimmer wieder verändert. Der US-Kon-zern Abbott übernahm den im SiliconValley ansässigen Hersteller von oph-thalmologische Geräte, Optimedica. DieSchweizer Alcon Laboratories kaufte diekalifornische LenSx Lasers, die als Ersteeinen Laser entwickelt hatte, der von derFDA für die Behandlung von grauemStar zugelassen wurde. Beim SchweizerAugenlasergerätehersteller Ziemer warfür gut zehn Jahre die Beteiligungsgesell-schaft BV Holding beteiligt, die ihrenAnteil allerdings in diesem Frühjahr zu-rück an die Gründerfamilie verkaufte.Arno Schütze
Rolf Schwind
Mehrheitsanteil zu verkaufenDer Augenlaserhersteller Schwind, globale Nummer zwei der Branche, sucht neue
Geldgeber. Rund 400 Millionen Euro könnte die Firma durch den Verkauf wert sein.
Firmenchef Rolf Schwind: Die Familie bleibt weiterhin am Unternehmen beteiligt.B
joer
n Fr
iedr
ich
Unternehmer/in des Tages
69WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Anzeige
Das Stühlerücken bei der Allianz geht weiter: Der Versicherungskonzern aus München tauscht die Führung seines europäischen Direktversicherers Allianz Direct aus. Philipp Kroetz löst dort zum Jahreswechsel Bart Schlatmann ab. Der Nieder-länder, der das holprig angelaufene Projekt seit mehr als drei Jahren führt, suche „neue Heraus-forderungen außerhalb der Allianz“, teilte das Un-ternehmen am Donnerstag mit. Mit Allianz Direct hat die Allianz ihre Direktversicherer in Deutsch-land, Spanien, den Niederlanden und Italien unter einem einheitlichen Risikoträger und einer ge-meinsamen Marke gebündelt. Der Start zog sich aber länger hin als gedacht, in Spanien ging Allianz Direct als Nachfolger von Fenix Directo erst vor Kurzem an den Markt. Von der Autoversicherung ausgehend, soll das Geschäft auf Hausrat- und Reiseversicherungen ausgedehnt werden. Kroetz arbeitet bisher für die Reise- und Assistance-Spar-te Allianz Partners und beschäftigt sich im Kon-zern seit Jahren mit der Standardisierung von Pro-zessen. Reuters
Philipp Kroetz
Allianz tauscht Führung von Direktversicherer aus
Ein niederländisches Gericht hat den Unterneh-mensteil Tennor Holding B.V. von Hertha-Inves-tor Lars Windhorst für insolvent erklärt. Das Urteil sei bereits am 2. November gefallen, bestätigte ein Sprecher des Finanzgerichts in Amsterdam am Donnerstag. Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Tennor ist hierzulande vor allem bekannt, weil das Unternehmen von Investor Lars Windhorst beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Jahr 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH & Co. KGaA erworben hatte. Im Juli 2020 steckte Tennor weitere 150 Millionen Euro in den Bun-desligisten und stockte damit seine Anteile auf 66,6 Prozent auf. Tennor will gegen die Entschei-dung des Amsterdamer Gerichts vorgehen. „Wir haben Einspruch eingelegt“, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen sei nicht insolvent. dpa
Lars Windhorst
Tennor-Holding des Hertha-Teilhabers insolvent
Philipp Kroetz: Er arbeitete bisher für die Reise- und Assistance- Sparte Allianz Partners.
Alli
anz
Daniel Grieder: Von Tommy Hilfiger zum schwäbischen Traditionskonzern.
Judi
th J
ocke
l/la
if
Lars Windhorst: Der Investor hält über Tennor 66,6 Prozent der Anteile an Hertha BSC.
imag
o im
ages
Wir haben erste große Fortschritte erzielt, vor
allem bei der Stärkung un-serer Marken bei jüngeren Zielgruppen.
Daniel GriederHugo-Boss-Chef
Martin Buchenau Stuttgart
Selten hat ein Chefwechsel in der Mode-branche für so viel Aufsehen gesorgt wie der von Daniel Grieder von Tommy Hil-figer zu Hugo Boss. Und selten zuvor musste ein Modeunternehmen so lange auf
den neuen Chef warten: Die Konkurrenzaus-schlussklausel lief am 1. Juni dieses Jahres ab. Und die Erwartungen konnten nicht größer sein. Mit Tommy Hilfiger war Grieder an Hugo Boss vor-beigezogen. Jetzt wiederum hat Grieder mit dem schwäbischen Modekonzern viel vor. Der kurz vor der Vollendung seines 60. Lebensjahres ste-hende Topmanager will in Metzingen ein Spät-werk hinlegen und mit einer Verjüngungskur der Marke seinen neuen Arbeitgeber auf Wachstum trimmen.
Dafür will er tief in die Tasche greifen. Allein für den Ausbau des Onlinegeschäfts und die Er-neuerung des stationären Einzelhandels will er in den kommenden Jahren 500 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zudem will Grieder 100 Millionen Euro für Marketing und 150 Millionen für die Digitalisierung ausgeben, von der er sich besonders viel erhofft. Gleichzeitig will der Ma-nager die Marken Hugo und Boss deutlich moder-ner machen, um mehr junge Leute anzusprechen.
So tief der Einschnitt durch Corona war, so sehr kann sich Grieder in seinen ersten Monaten bei Deutschlands größtem Modekonzern jetzt über anfänglichen Rückenwind freuen. Bereits 95 Prozent der Geschäfte haben wieder geöffnet. Nach den Wiedereröffnungen hat der Modehänd-ler im dritten Quartal davon profitiert, dass die Kunden nach den Lockdowns in der Pandemie wieder Lust auf neue Kleidung hatten. So stieg der Konzerngewinn auf 53 Millionen Euro, nach vier Millionen im coronabedingt schwachen Vor-jahreszeitraum, wie das Unterneh-men am Donnerstag bei der Vor-lage seiner endgültigen Zahlen mitteilte. Gegenüber dem Ver-gleichsquartal des Vor-Corona-Jahres 2019 stieg das operative Er-gebnis (Ebit) immerhin um drei Prozent auf 85 Millionen Euro.
Das Sorgenkind USA bekommt Grieder in den GriffVor allem das Sorgenkind USA scheint der Neu-Schwabe wieder in den Griff zu bekommen. Wäh-rungsbereinigt verdoppelten sich dort die Verkäufe. Beim substan-zielleren Vergleich mit dem Ni-veau des dritten Quartals 2019 steht immerhin noch ein Plus von 14 Prozent. Auch in Europa liefen die Geschäfte deutlich besser.
Egal ob Business, klassisch oder casual – die Zeiten, da die ex-klusiven Kollektionen von Hugo Boss verschmäht wurden, schei-nen vorerst vorbei. Im dritten Quartal konnte Hugo Boss damit erstmals wieder Umsatz und Er-gebnis im Vergleich zum Vor-Pan-demie-Niveau steigern. „Gleich-zeitig haben wir erste große Fort-schritte bei der erfolgreichen Umsetzung unserer CLAIM 5-Strategie erzielt, vor allem bei der Stärkung unserer Marken bei jüngeren Zielgruppen“, sagt Grie-der. „Der Launch unserer zweiten Kollektion von Boss und Russell
Athletic ist beispielhaft dafür, wie wir gemeinsam als Team das große Potenzial unserer Marken voll ausschöpfen werden.“
Der Marketing-Guru hatte in der Übergangs-zeit vor seinem Wechsel viel Zeit, sich strategi-sche Gedanken zu machen und diese fulminant in einer Onlinekonferenz Anfang August präsen-tiert. So soll sich der Umsatz bis 2025 auf vier Mil-liarden Euro verdoppeln. Bis 2025 strebt der seit Juni amtierende Vorstandschef eine Ebit-Marge von etwa zwölf Prozent an. Auch wenn bislang noch keine großen spektakulären Entscheidungen bekannt sind, so liebäugelt Grieder bereits mit Zukäufen weiterer Marken. Dass Hugo Boss ope-rativ wieder in der Spur ist, kommt nicht über-raschend. Mitte Oktober hatten die Schwaben be-reits die Umsatzsteigerung um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro im dritten Quartal kommuniziert und auch die Jahresprognose beim Ebit von ma-ximal 175 Millionen Euro auf bis zu 200 Millionen Euro erhöht. Im vergangenen Jahr verbuchte Boss noch bei mageren 1,9 Milliarden Euro Jahres-umsatz einen Verlust von 236 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen ein wäh-rungsbereinigtes Umsatzplus auf 2,7 Milliarden Euro in Aussicht.
Die Anleger haben den neuen Boss-Heilsbrin-ger Grieder längst mit Vorschusslorbeeren bedacht. Nachdem die Aktie während der Pandemie auf 19 Euro abgerutscht war, liegt der Kurs seit dem Amtsantritt von Grieder Anfang Juni kontinuier-lich über 45 Euro und inzwischen bei 55 Euro. Noch zwei Euro und der Börsenwert von Hugo Boss hat sich seit dem Tiefpunkt verdreifacht.
Für die Anleger hat sich das Engagement von Grieder jedenfalls jetzt schon gelohnt. Bis zu den Höchstständen von über 110 Euro ist allerdings auch noch Luft. Die Fantasie der optimistischsten Analysten reicht vorerst nur bis 70 Euro.
Daniel Grieder
Verjüngungskur für Hugo Boss
Der neue Chef will mit jüngeren Kunden mehr Wachstum schaffen. Die aktuellen Quartalszahlen bestärken ihn in seinen Plänen.
Unternehmer/in des Tages
70 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Robert Habeck, Annalena Baerbock: Der Bundesvor-stand der Grünen steht vor einer Neuaufstellung.im
ago
imag
es/F
utur
e Im
age
Den beiden Grünen-Vorsitzen-den Annalena Baerbock und Robert Habeck muss spätestens am Wahlabend um 18 Uhr klar gewesen sein, dass sie schon
bald ihren Chefposten räumen müssen. Denn während andere Parteien Wahl-verlierer an ihrer Spitze abstrafen, gel-ten bei den Grünen ganz eigene Geset-ze: Wer in die Regierung aufrückt, darf die Partei nicht mehr anführen. „Minis-ter und Parteivorsitz ist ausgeschlos-sen“, sagte Habeck kürzlich dem Sen-der „Phoenix“ und kündigte gleich Vorstandswahlen für Januar an.
Nicht nur Baerbock und Habeck müssen ihren Posten räumen, sondern fast die gesamte Parteiführung muss sich neu formieren. Denn dem sechs-köpfigen Gremium – auch das sieht die Satzung vor – dürfen maximal zwei Bundestagsabgeordnete angehören. Seit der Wahl sind es aber fünf mit Bundestagsmandat. Wie die Macht-spiele ausgehen, entscheidet sich der-zeit vor allem hinter verschlossenen Türen – glücken die Verhandlungen, dann gilt es als sicher, dass Habeck und Baerbock ins Kabinett wechseln.
Wer welches Amt übernehmen wird, wie der Zuschnitt der Ministe-rien genau aussieht – diese Entschei-dungen stehen und fallen mit der Ant-wort auf die Frage, welcher Partei in der künftigen Ampelkoalition das Fi-nanzministerium zugeschlagen wird. So ist es jedenfalls in Grünen-Kreisen zu hören.
Insider berichten, dass Habeck ge-nauso Anspruch auf den Top-Posten des Bundesfinanzministers erhebt wie FDP-Chef Christian Lindner. Aller-dings mit dem Unterschied, dass die Li-beralen bereits im Wahlkampf deutlich gemacht haben, dass Lindner das ein-flussreiche Amt anstrebt. Die Grünen sind indes in der komfortablen Situa-tion, dass sie als zweitstärkste Ampel-fraktion nach der SPD den Finger für ein Ministerium heben können. Die Wahl könnte auf das Finanzministeri-um fallen. Könnte – denn in Grünen-Kreisen kursiert auch die Möglichkeit, der FDP „die Trophäe“ Finanzressort zu überlassen – als Teil einer „Paketlö-
sung“. Der politische Preis, den die Li-beralen zahlen müssten, könnte dem Vernehmen nach darin bestehen, den Grünen ein „Super-Klimaministerium“ mit zusätzlichen Kompetenzen aus dem Wirtschaftsministerium, etwa den Bereich Energie, zuzugestehen. Für dieses Ressort käme Baerbock infrage. Habeck könnte Innenminister werden. Der Grünen-Chef ist schon länger der Auffassung, dass seine Partei auch die-ses Amt gut ausfüllen könnte. Hinter all den Planspielen steckt die Einsicht, dass die Ampelkoalition nur funktio-nieren kann, wenn alle an einem Strang ziehen und sich Erfolge gönnen.
Personelle NeuaufstellungFür die Parteizentrale der Grünen wür-den geglückte Verhandlungen einen schnellen Machtwechsel bedeuten. Die Parteisatzung sieht vor, dass Mitglie-der des Bundesvorstandes nicht Frak-tionsvorsitzende im Bundestag, in ei-nem Landtag, im EU-Parlament oder Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung oder der EU-Kom-mission sein dürfen. Würden Mitglie-der des Bundesvorstandes in ein sol-ches Amt gewählt, so müssen sie ihren Platz innerhalb von acht Monaten räu-men. Zudem dürfen im Bundesvor-stand nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder Abgeordnete sein.
Damit steht fast der gesamte sechs-köpfige Bundesvorstand vor einer Neu-aufstellung. Denn unabhängig von Ba-erbock und Habeck haben Bundes-geschäftsführer Michael Kellner sowie die Vize-Parteichefs Ricarda Lang und Jamila Schäfer ein Bundestagsmandat errungen. Auf der Suche nach einem Nachfolger-Duo fallen häufig zwei Na-men: Lang und Omid Nouripour. Bei-de würden für die Breite der Partei ste-hen und verschiedene Strömungen in-tegrieren können, stellt ein Grüner fest. Lang, 27, gehört zum linken Flügel der Partei und war im November 2019 in den Bundesvorstand aufgerückt. Zuvor war sie Vorsitzende der Grünen Ju-gend. Im September zog sie erstmals in den Bundestag ein. In ihrer Bewer-bung machte sie sich dafür stark, dass die Grünen vielfältiger würden. Lang
ist die erste offen bisexuelle Abgeord-nete im Bundestag. Bis heute setzt sie sich für dieses Thema ein, übernahm zuletzt für die Grünen die Leitung der Arbeitsgruppe Gleichstellung und Viel-falt in den Ampelsondierungen.
Dass sie bald die zweitstärkste Re-gierungspartei anführen könnte, dürfte viele überraschen. Lang ist noch recht unbekannt, stehe aber für die Zukunft der Grünen, heißt es, sei zudem durch-setzungsstark. Nouripour, 46, wurde im Iran geboren. Der Außenpolitiker sitzt seit 15 Jahren im Bundestag. Zwi-schen 2002 und 2006 war er bereits Mitglied im Bundesvorstand.
Politikwissenschaftler gehen den-noch von einer Machtverlagerung in die Fraktion aus. „Angesichts der Neu-orientierung innerhalb des Parteizen-trums wird die Fraktion sicher die do-minierende Rolle spielen, da es ja auch darum geht, parlamentarische Mehr-heiten für die Koalition herzustellen“, sagte Michael Wehner, Leiter der Frei-burger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Würt-temberg, dem Handelsblatt.
Der wahrscheinliche künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) werde erst einmal versuchen, dringende Fragen mit seinen Ministern und Ministerin-nen zu klären, die wiederum im engen Kontakt zu ihrer Fraktion stünden. „In-sofern wird er den Hörer abnehmen und erst einmal Frau Baerbock oder Herrn Habeck kontaktieren. Die wer-den dann das Nötige veranlassen, um in der Fraktion entsprechende Unter-stützung zu bekommen.“ „Mit Regie-rungsbeteiligung der Grünen rückt das Machtzentrum zurück von der Partei auf die Regierungs- und Fraktionsebe-ne“, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner dem Handelsblatt. „Der neue Partei-vorstand wird keine große Rolle spie-len.“ Das weitere Ansehen der Grünen wird „davon abhängen, wie sie in der Regierung agieren und was sie da zu-stande bringen“, meint Güllner. Er glaubt nicht, dass die Grünen zwin-gend Anspruch auf ein bestimmtes Mi-nisterium erheben müssten: „Sie kön-nen aus jedem Ministerium etwas ma-chen.“ S. Kersting, J. Klöckner, D. Neuerer
Robert Habeck, Annalena Baerbock
Die Macht verschiebt sichWährend die Grünen-Chefs ihre politische Zukunft verhandeln, bereitet
sich die Partei auf neue Köpfe an der Spitze vor. Die Satzung will es so.
Saskia Esken will für zwei weitere JahreSPD-Parteivorsitzende bleiben. Sie ha-be entschieden, ihre „Bewerbung fürdas höchste Parteiamt zu erneuern“,sagte Esken den „Stuttgarter Nachrich-ten“. „Ich sehe meine Aufgabe darin,die SPD zu modernisieren, ihre his-torisch gewachsenen Werte zu stärkenund daraus mit den Mitgliedern und imAustausch mit der Gesellschaft sozial-demokratische Ideen und Positionenzu entwickeln“, sagte Esken weiter.
Am vergangenen Freitag hatte Es-kens Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans angekündigt, auf dem SPD-Parteitag im Dezember nicht mehr fürden Parteivorsitz zu kandieren. Eskenund Walter-Borjans waren 2019 alsTeam für den Parteivorsitz angetretenund hatten nach ihrem überraschendenSieg im Mitgliederentscheid gegen OlafScholz und Klara Geywitz die ersteSPD-Doppelspitze gebildet. Walter-Borjans und Esken wird zwar internangerechnet, Olaf Scholz zum Kanz-lerkandidaten gekürt und der SPD wie-der mehr Geschlossenheit verordnetzu haben. In Teilen der Partei werdendie beiden allerdings bis heute nichtwirklich als Parteivorsitzende akzep-tiert.
Bildungsgipfel mit MerkelEsken hatte sich zudem in der Corona-krise stark um das Thema digitale Bil-dung gekümmert, etwa mit KanzlerinAngela Merkel einen Bildungsgipfelveranstaltet. Viele in der SPD hattendeshalb erwartet, Esken werde im neu-en Kabinett Scholz Bildungsministerin.Die neue Doppelspitze würden dannder bisherige SPD-GeneralsekretärLars Klingbeil und die Ministerprä-sidentin von Mecklenburg-Vorpom-mern, Manuela Schwesig, bilden, er-warteten viele Genossen. Mit einemWechsel Eskens hätte die SPD auchgleich ein weiteres Problem gelöst ge-habt: Es drängen sich nicht gerade vieleSPD-Frauen auf, die als Ministerinneninfrage kommen. Scholz hatte aber an-gekündigt, die Ministerposten der SPDparitätisch mit Frauen und Männern zubesetzen.
Als ausschlaggebend für ihre Ent-scheidung, an der Spitze der Sozialde-mokratie zu bleiben und kein Minister-amt anzustreben, nannte Esken die vorzwei Jahren eingeschlagene Richtungihrer Partei: „Norbert Walter-Borjansund ich haben in den vergangenen zweiJahren viel erreicht. Die SPD ist geeint,erfolgreich und stark wie seit Jahrennicht mehr. Diesen Weg möchte ichgern fortsetzen.“ M. Greive, D. Neuerer
Saskia Esken
Verzicht auf ein Ministeramt
Die SPD-Vorsitzende will sich erneut für den Chefposten in
der Partei bewerben.
Saskia Esken: „Diesen Weg
möchte ich gern fortsetzen.“
imag
o im
ages
/Jür
gen
Hei
nric
h
Politiker/in des Tages
71WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Das Stühlerücken bei der Allianz geht weiter: Der Versicherungskonzern aus München tauscht die Führung seines europäischen Direktversicherers Allianz Direct aus. Philipp Kroetz löst dort zum Jahreswechsel Bart Schlatmann ab. Der Nieder-länder, der das holprig angelaufene Projekt seit mehr als drei Jahren führt, suche „neue Heraus-forderungen außerhalb der Allianz“, teilte das Un-ternehmen am Donnerstag mit. Mit Allianz Direct hat die Allianz ihre Direktversicherer in Deutsch-land, Spanien, den Niederlanden und Italien unter einem einheitlichen Risikoträger und einer ge-meinsamen Marke gebündelt. Der Start zog sich aber länger hin als gedacht, in Spanien ging Allianz Direct als Nachfolger von Fenix Directo erst vor Kurzem an den Markt. Von der Autoversicherung ausgehend, soll das Geschäft auf Hausrat- und Reiseversicherungen ausgedehnt werden. Kroetz arbeitet bisher für die Reise- und Assistance-Spar-te Allianz Partners und beschäftigt sich im Kon-zern seit Jahren mit der Standardisierung von Pro-zessen. Reuters
Philipp Kroetz
Allianz tauscht Führung von Direktversicherer aus
Ein niederländisches Gericht hat den Unterneh-mensteil Tennor Holding B.V. von Hertha-Inves-tor Lars Windhorst für insolvent erklärt. Das Urteil sei bereits am 2. November gefallen, bestätigte ein Sprecher des Finanzgerichts in Amsterdam am Donnerstag. Ein Insolvenzverwalter sei bestellt worden. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet. Tennor ist hierzulande vor allem bekannt, weil das Unternehmen von Investor Lars Windhorst beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC im Jahr 2019 für 224 Millionen Euro 49,9 Prozent der GmbH & Co. KGaA erworben hatte. Im Juli 2020 steckte Tennor weitere 150 Millionen Euro in den Bun-desligisten und stockte damit seine Anteile auf 66,6 Prozent auf. Tennor will gegen die Entschei-dung des Amsterdamer Gerichts vorgehen. „Wir haben Einspruch eingelegt“, sagte ein Sprecher. Das Unternehmen sei nicht insolvent. dpa
Lars Windhorst
Tennor-Holding des Hertha-Teilhabers insolvent
Philipp Kroetz: Er arbeitete bisher für die Reise- und Assistance- Sparte Allianz Partners.
Alli
anz
Daniel Grieder: Von Tommy Hilfiger zum schwäbischen Traditionskonzern.
Judi
th J
ocke
l/la
if
Lars Windhorst: Der Investor hält über Tennor 66,6 Prozent der Anteile an Hertha BSC.
imag
o im
ages
Wir haben erste große Fortschritte erzielt, vor
allem bei der Stärkung un-serer Marken bei jüngeren Zielgruppen.
Daniel GriederHugo-Boss-Chef
Martin Buchenau Stuttgart
Selten hat ein Chefwechsel in der Mode-branche für so viel Aufsehen gesorgt wie der von Daniel Grieder von Tommy Hil-figer zu Hugo Boss. Und selten zuvor musste ein Modeunternehmen so lange auf
den neuen Chef warten: Die Konkurrenzaus-schlussklausel lief am 1. Juni dieses Jahres ab. Und die Erwartungen konnten nicht größer sein. Mit Tommy Hilfiger war Grieder an Hugo Boss vor-beigezogen. Jetzt wiederum hat Grieder mit dem schwäbischen Modekonzern viel vor. Der kurz vor der Vollendung seines 60. Lebensjahres ste-hende Topmanager will in Metzingen ein Spät-werk hinlegen und mit einer Verjüngungskur der Marke seinen neuen Arbeitgeber auf Wachstum trimmen.
Dafür will er tief in die Tasche greifen. Allein für den Ausbau des Onlinegeschäfts und die Er-neuerung des stationären Einzelhandels will er in den kommenden Jahren 500 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zudem will Grieder 100 Millionen Euro für Marketing und 150 Millionen für die Digitalisierung ausgeben, von der er sich besonders viel erhofft. Gleichzeitig will der Ma-nager die Marken Hugo und Boss deutlich moder-ner machen, um mehr junge Leute anzusprechen.
So tief der Einschnitt durch Corona war, so sehr kann sich Grieder in seinen ersten Monaten bei Deutschlands größtem Modekonzern jetzt über anfänglichen Rückenwind freuen. Bereits 95 Prozent der Geschäfte haben wieder geöffnet. Nach den Wiedereröffnungen hat der Modehänd-ler im dritten Quartal davon profitiert, dass die Kunden nach den Lockdowns in der Pandemie wieder Lust auf neue Kleidung hatten. So stieg der Konzerngewinn auf 53 Millionen Euro, nach vier Millionen im coronabedingt schwachen Vor-jahreszeitraum, wie das Unterneh-men am Donnerstag bei der Vor-lage seiner endgültigen Zahlen mitteilte. Gegenüber dem Ver-gleichsquartal des Vor-Corona-Jahres 2019 stieg das operative Er-gebnis (Ebit) immerhin um drei Prozent auf 85 Millionen Euro.
Das Sorgenkind USA bekommt Grieder in den GriffVor allem das Sorgenkind USA scheint der Neu-Schwabe wieder in den Griff zu bekommen. Wäh-rungsbereinigt verdoppelten sich dort die Verkäufe. Beim substan-zielleren Vergleich mit dem Ni-veau des dritten Quartals 2019 steht immerhin noch ein Plus von 14 Prozent. Auch in Europa liefen die Geschäfte deutlich besser.
Egal ob Business, klassisch oder casual – die Zeiten, da die ex-klusiven Kollektionen von Hugo Boss verschmäht wurden, schei-nen vorerst vorbei. Im dritten Quartal konnte Hugo Boss damit erstmals wieder Umsatz und Er-gebnis im Vergleich zum Vor-Pan-demie-Niveau steigern. „Gleich-zeitig haben wir erste große Fort-schritte bei der erfolgreichen Umsetzung unserer CLAIM 5-Strategie erzielt, vor allem bei der Stärkung unserer Marken bei jüngeren Zielgruppen“, sagt Grie-der. „Der Launch unserer zweiten Kollektion von Boss und Russell
Athletic ist beispielhaft dafür, wie wir gemeinsam als Team das große Potenzial unserer Marken voll ausschöpfen werden.“
Der Marketing-Guru hatte in der Übergangs-zeit vor seinem Wechsel viel Zeit, sich strategi-sche Gedanken zu machen und diese fulminant in einer Onlinekonferenz Anfang August präsen-tiert. So soll sich der Umsatz bis 2025 auf vier Mil-liarden Euro verdoppeln. Bis 2025 strebt der seit Juni amtierende Vorstandschef eine Ebit-Marge von etwa zwölf Prozent an. Auch wenn bislang noch keine großen spektakulären Entscheidungen bekannt sind, so liebäugelt Grieder bereits mit Zukäufen weiterer Marken. Dass Hugo Boss ope-rativ wieder in der Spur ist, kommt nicht über-raschend. Mitte Oktober hatten die Schwaben be-reits die Umsatzsteigerung um 42 Prozent auf 755 Millionen Euro im dritten Quartal kommuniziert und auch die Jahresprognose beim Ebit von ma-ximal 175 Millionen Euro auf bis zu 200 Millionen Euro erhöht. Im vergangenen Jahr verbuchte Boss noch bei mageren 1,9 Milliarden Euro Jahres-umsatz einen Verlust von 236 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellt das Unternehmen ein wäh-rungsbereinigtes Umsatzplus auf 2,7 Milliarden Euro in Aussicht.
Die Anleger haben den neuen Boss-Heilsbrin-ger Grieder längst mit Vorschusslorbeeren bedacht. Nachdem die Aktie während der Pandemie auf 19 Euro abgerutscht war, liegt der Kurs seit dem Amtsantritt von Grieder Anfang Juni kontinuier-lich über 45 Euro und inzwischen bei 55 Euro. Noch zwei Euro und der Börsenwert von Hugo Boss hat sich seit dem Tiefpunkt verdreifacht.
Für die Anleger hat sich das Engagement von Grieder jedenfalls jetzt schon gelohnt. Bis zu den Höchstständen von über 110 Euro ist allerdings auch noch Luft. Die Fantasie der optimistischsten Analysten reicht vorerst nur bis 70 Euro.
Daniel Grieder
Verjüngungskur für Hugo Boss
Der neue Chef will mit jüngeren Kunden mehr Wachstum schaffen. Die aktuellen Quartalszahlen bestärken ihn in seinen Plänen.
Unternehmer/in des Tages
70 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Robert Habeck, Annalena Baerbock: Der Bundesvor-stand der Grünen steht vor einer Neuaufstellung.im
ago
imag
es/F
utur
e Im
age
Den beiden Grünen-Vorsitzen-den Annalena Baerbock und Robert Habeck muss spätestens am Wahlabend um 18 Uhr klar gewesen sein, dass sie schon
bald ihren Chefposten räumen müssen. Denn während andere Parteien Wahl-verlierer an ihrer Spitze abstrafen, gel-ten bei den Grünen ganz eigene Geset-ze: Wer in die Regierung aufrückt, darf die Partei nicht mehr anführen. „Minis-ter und Parteivorsitz ist ausgeschlos-sen“, sagte Habeck kürzlich dem Sen-der „Phoenix“ und kündigte gleich Vorstandswahlen für Januar an.
Nicht nur Baerbock und Habeck müssen ihren Posten räumen, sondern fast die gesamte Parteiführung muss sich neu formieren. Denn dem sechs-köpfigen Gremium – auch das sieht die Satzung vor – dürfen maximal zwei Bundestagsabgeordnete angehören. Seit der Wahl sind es aber fünf mit Bundestagsmandat. Wie die Macht-spiele ausgehen, entscheidet sich der-zeit vor allem hinter verschlossenen Türen – glücken die Verhandlungen, dann gilt es als sicher, dass Habeck und Baerbock ins Kabinett wechseln.
Wer welches Amt übernehmen wird, wie der Zuschnitt der Ministe-rien genau aussieht – diese Entschei-dungen stehen und fallen mit der Ant-wort auf die Frage, welcher Partei in der künftigen Ampelkoalition das Fi-nanzministerium zugeschlagen wird. So ist es jedenfalls in Grünen-Kreisen zu hören.
Insider berichten, dass Habeck ge-nauso Anspruch auf den Top-Posten des Bundesfinanzministers erhebt wie FDP-Chef Christian Lindner. Aller-dings mit dem Unterschied, dass die Li-beralen bereits im Wahlkampf deutlich gemacht haben, dass Lindner das ein-flussreiche Amt anstrebt. Die Grünen sind indes in der komfortablen Situa-tion, dass sie als zweitstärkste Ampel-fraktion nach der SPD den Finger für ein Ministerium heben können. Die Wahl könnte auf das Finanzministeri-um fallen. Könnte – denn in Grünen-Kreisen kursiert auch die Möglichkeit, der FDP „die Trophäe“ Finanzressort zu überlassen – als Teil einer „Paketlö-
sung“. Der politische Preis, den die Li-beralen zahlen müssten, könnte dem Vernehmen nach darin bestehen, den Grünen ein „Super-Klimaministerium“ mit zusätzlichen Kompetenzen aus dem Wirtschaftsministerium, etwa den Bereich Energie, zuzugestehen. Für dieses Ressort käme Baerbock infrage. Habeck könnte Innenminister werden. Der Grünen-Chef ist schon länger der Auffassung, dass seine Partei auch die-ses Amt gut ausfüllen könnte. Hinter all den Planspielen steckt die Einsicht, dass die Ampelkoalition nur funktio-nieren kann, wenn alle an einem Strang ziehen und sich Erfolge gönnen.
Personelle NeuaufstellungFür die Parteizentrale der Grünen wür-den geglückte Verhandlungen einen schnellen Machtwechsel bedeuten. Die Parteisatzung sieht vor, dass Mitglie-der des Bundesvorstandes nicht Frak-tionsvorsitzende im Bundestag, in ei-nem Landtag, im EU-Parlament oder Mitglieder der Bundesregierung, einer Landesregierung oder der EU-Kom-mission sein dürfen. Würden Mitglie-der des Bundesvorstandes in ein sol-ches Amt gewählt, so müssen sie ihren Platz innerhalb von acht Monaten räu-men. Zudem dürfen im Bundesvor-stand nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder Abgeordnete sein.
Damit steht fast der gesamte sechs-köpfige Bundesvorstand vor einer Neu-aufstellung. Denn unabhängig von Ba-erbock und Habeck haben Bundes-geschäftsführer Michael Kellner sowie die Vize-Parteichefs Ricarda Lang und Jamila Schäfer ein Bundestagsmandat errungen. Auf der Suche nach einem Nachfolger-Duo fallen häufig zwei Na-men: Lang und Omid Nouripour. Bei-de würden für die Breite der Partei ste-hen und verschiedene Strömungen in-tegrieren können, stellt ein Grüner fest. Lang, 27, gehört zum linken Flügel der Partei und war im November 2019 in den Bundesvorstand aufgerückt. Zuvor war sie Vorsitzende der Grünen Ju-gend. Im September zog sie erstmals in den Bundestag ein. In ihrer Bewer-bung machte sie sich dafür stark, dass die Grünen vielfältiger würden. Lang
ist die erste offen bisexuelle Abgeord-nete im Bundestag. Bis heute setzt sie sich für dieses Thema ein, übernahm zuletzt für die Grünen die Leitung der Arbeitsgruppe Gleichstellung und Viel-falt in den Ampelsondierungen.
Dass sie bald die zweitstärkste Re-gierungspartei anführen könnte, dürfte viele überraschen. Lang ist noch recht unbekannt, stehe aber für die Zukunft der Grünen, heißt es, sei zudem durch-setzungsstark. Nouripour, 46, wurde im Iran geboren. Der Außenpolitiker sitzt seit 15 Jahren im Bundestag. Zwi-schen 2002 und 2006 war er bereits Mitglied im Bundesvorstand.
Politikwissenschaftler gehen den-noch von einer Machtverlagerung in die Fraktion aus. „Angesichts der Neu-orientierung innerhalb des Parteizen-trums wird die Fraktion sicher die do-minierende Rolle spielen, da es ja auch darum geht, parlamentarische Mehr-heiten für die Koalition herzustellen“, sagte Michael Wehner, Leiter der Frei-burger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Würt-temberg, dem Handelsblatt.
Der wahrscheinliche künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) werde erst einmal versuchen, dringende Fragen mit seinen Ministern und Ministerin-nen zu klären, die wiederum im engen Kontakt zu ihrer Fraktion stünden. „In-sofern wird er den Hörer abnehmen und erst einmal Frau Baerbock oder Herrn Habeck kontaktieren. Die wer-den dann das Nötige veranlassen, um in der Fraktion entsprechende Unter-stützung zu bekommen.“ „Mit Regie-rungsbeteiligung der Grünen rückt das Machtzentrum zurück von der Partei auf die Regierungs- und Fraktionsebe-ne“, sagt Forsa-Chef Manfred Güllner dem Handelsblatt. „Der neue Partei-vorstand wird keine große Rolle spie-len.“ Das weitere Ansehen der Grünen wird „davon abhängen, wie sie in der Regierung agieren und was sie da zu-stande bringen“, meint Güllner. Er glaubt nicht, dass die Grünen zwin-gend Anspruch auf ein bestimmtes Mi-nisterium erheben müssten: „Sie kön-nen aus jedem Ministerium etwas ma-chen.“ S. Kersting, J. Klöckner, D. Neuerer
Robert Habeck, Annalena Baerbock
Die Macht verschiebt sichWährend die Grünen-Chefs ihre politische Zukunft verhandeln, bereitet
sich die Partei auf neue Köpfe an der Spitze vor. Die Satzung will es so.
Saskia Esken will für zwei weitere JahreSPD-Parteivorsitzende bleiben. Sie ha-be entschieden, ihre „Bewerbung fürdas höchste Parteiamt zu erneuern“,sagte Esken den „Stuttgarter Nachrich-ten“. „Ich sehe meine Aufgabe darin,die SPD zu modernisieren, ihre his-torisch gewachsenen Werte zu stärkenund daraus mit den Mitgliedern und imAustausch mit der Gesellschaft sozial-demokratische Ideen und Positionenzu entwickeln“, sagte Esken weiter.
Am vergangenen Freitag hatte Es-kens Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans angekündigt, auf dem SPD-Parteitag im Dezember nicht mehr fürden Parteivorsitz zu kandieren. Eskenund Walter-Borjans waren 2019 alsTeam für den Parteivorsitz angetretenund hatten nach ihrem überraschendenSieg im Mitgliederentscheid gegen OlafScholz und Klara Geywitz die ersteSPD-Doppelspitze gebildet. Walter-Borjans und Esken wird zwar internangerechnet, Olaf Scholz zum Kanz-lerkandidaten gekürt und der SPD wie-der mehr Geschlossenheit verordnetzu haben. In Teilen der Partei werdendie beiden allerdings bis heute nichtwirklich als Parteivorsitzende akzep-tiert.
Bildungsgipfel mit MerkelEsken hatte sich zudem in der Corona-krise stark um das Thema digitale Bil-dung gekümmert, etwa mit KanzlerinAngela Merkel einen Bildungsgipfelveranstaltet. Viele in der SPD hattendeshalb erwartet, Esken werde im neu-en Kabinett Scholz Bildungsministerin.Die neue Doppelspitze würden dannder bisherige SPD-GeneralsekretärLars Klingbeil und die Ministerprä-sidentin von Mecklenburg-Vorpom-mern, Manuela Schwesig, bilden, er-warteten viele Genossen. Mit einemWechsel Eskens hätte die SPD auchgleich ein weiteres Problem gelöst ge-habt: Es drängen sich nicht gerade vieleSPD-Frauen auf, die als Ministerinneninfrage kommen. Scholz hatte aber an-gekündigt, die Ministerposten der SPDparitätisch mit Frauen und Männern zubesetzen.
Als ausschlaggebend für ihre Ent-scheidung, an der Spitze der Sozialde-mokratie zu bleiben und kein Minister-amt anzustreben, nannte Esken die vorzwei Jahren eingeschlagene Richtungihrer Partei: „Norbert Walter-Borjansund ich haben in den vergangenen zweiJahren viel erreicht. Die SPD ist geeint,erfolgreich und stark wie seit Jahrennicht mehr. Diesen Weg möchte ichgern fortsetzen.“ M. Greive, D. Neuerer
Saskia Esken
Verzicht auf ein Ministeramt
Die SPD-Vorsitzende will sich erneut für den Chefposten in
der Partei bewerben.
Saskia Esken: „Diesen Weg
möchte ich gern fortsetzen.“
imag
o im
ages
/Jür
gen
Hei
nric
h
Politiker/in des Tages
71WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215
Die Energietransformation führt zu gravierenden geopolitischen Umbrüchen. Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (Irena) hat diese Konsequenzen schon 2019 im bahn-brechenden Report „Eine neue Welt“ auf-gezeigt. Die Transformation wird einerseits Öl und Gas abwerten, andererseits die erneuer-
baren Energien und die benötigten Rohstoffe aufwerten. Neben den Standortbedingungen sind die Verfügbarkeit und der Einsatz von Technologien ganz entscheidend. Damit verschieben sich nicht nur die globalen Handels-ströme, sondern auch die internationalen Machtverhält-nisse grundlegend.
Doch die Energietransformation wird nicht nur geopolitische Prozesse auslösen, sondern umgekehrt werden auch die geopolitischen Entwicklungen den Verlauf der Transformation prägen. Der Aufstieg Chinas und die strategische Rivalität mit der alten Supermacht USA prägen zuneh-mend die neue Welt(un)ordnung. Unter dem bipolaren Spannungsmuster entfalten sich außerdem Konkurrenzen zwischen Regionalmächten. Da der Umbau des Energiesystems weltweit sehr ungleich und zeitver-setzt verläuft, prägen sich Energieregionen aus, die ganz unterschiedlich aufgestellt sind, was die Fragmentierung und Regionalisierung verstärkt.
Die USA werden auch in Zukunft von ihrem diversen Energiereichtum profitieren und den daraus resultieren-den großen Handlungsspielraum nutzen. Ihre Schlüssel-stellung auf dem amerikanischen Kontinent garantiert dort einen natürlichen Einfluss.
Auch China als der große strategische Rivale und Kon-kurrent kann nicht nur auf Rohstoffreichtum und Land-verfügbarkeit setzen, sondern es wirft auch seine zentra-le Stellung in Asien und seine schiere Marktgröße in die Waagschale. Peking hat über seine Seidenstraßeninitiati-ve (Belt and Road Initiative) früh begonnen, angrenzen-de Räume über Lieferketten und Infrastrukturen an sich zu binden.
Die Geopolitik prägt die neuen Energiebeziehungsmus-ter. Die Tatsache, dass die Erneuerbaren weit verteilt sind, schafft mehr Möglichkeiten als in der alten Energie-welt, als die geologische Verfügbarkeit von Öl und Gas strukturbestimmend war. Ein Beispiel für die verstärkte
Kooperation mit ausgewählten Partnern sind länder-umspannende Stromnetze: Die Entscheidung, sich zu vernetzen, schafft „Strom-Schicksalsgemeinschaften“, in denen Risiken und Chancen sich auf alle gleich verteilen. In Osteuropa aber konkurrieren die EU und Russland um Einfluss auf Energienetze und -märkte, was in einer Energieblock-Konfrontation münden könnte.
Die Geopolitik führt auch zu Abkopplung. Lieferketten und Handelsbeziehungen werden weniger unter dem Fokus von Effizienz als zunehmend durch die Brille von Abhängigkeit und Verwundbarkeit betrachtet. Diese
„Versicherheitlichung“ spielt vor allem im Verhältnis zwischen China und den USA eine wichtige Rolle. In einer Welt der zunehmenden Unübersichtlichkeit und Konkurrenz entstehen Sicherheitsdilemma-ta, die aber auch von realen Lieferschwierig-keiten einerseits und hybriden Bedrohun-gen andererseits unterfüttert werden.
Heute erleben wir, dass Machtkonkurren-zen weniger militärisch ausgetragen werden, als vielmehr zwischenstaatliche Konflikte zunehmend auf die Felder der Wirtschaft, Finanzen, Technologien und die Gesell-schaft verlagert werden. Einerseits dienen wirtschaftliche Mittel der Erreichung politischer Ziele, andererseits setzen Staaten auch politische Instrumente wie Sanktio-nen, Handelsschranken oder Cyberattacken ein, um politische und wirtschaftliche Dominanz sowie technolo-gische Vormachtstellung zu erreichen.
Wenn Technologien, Schlüsselkomponenten und asym-metrische Abhängigkeiten in Netzwerken zu zentralen Machtwährungen werden, rutscht die Welt immer tiefer in ein ökonomisches Sicherheitsdilemma. Abschottung, Rückverlagerung und Autonomie werden zuungunsten von globalen Gütern, Kosteneffizienz und Arbeitsteilung vorangestellt. Eine „grüne Globalisierung“ und ein „Big Green Deal“ geraten angesichts partikularer und kurzfristi-ger Vorteilssuche und Nullsummenspiele ins Hintertreffen.
Wirtschaftliche Stärke können jene Länder verbuchen, die Technologien und Leitmärkte entwickeln. Neue Spielfelder im internationalen Kräftemessen entstehen durch die Setzung von Standards und Normen. Wer die Regeln setzt, hat zumindest eine Poleposition und bestimmt eine Zeit lang das Spiel. China verfolgt diese Strategie dezidiert mit seinen Programmen „Made in China 2025“ und „Standards 2030“. Auch US-Präsident Joe Biden richtet seine Politik auf Jobs, Innovation und Modernisierung der Infrastruktur im eigenen Land aus. Wo kann sich Europa hier verorten?
Die EU-Kommission hat mit dem Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent bis 2050 zu machen, einen geopolitischen Anspruch verknüpft. Mit dem „Green Deal“ ist nicht nur die schrittweise Substitution von Kohle, Öl- und Gasimporten verbunden. Es bedarf vielmehr Innovationen und Technologien, um Europas Industrie zu dekarbonisieren, darauf nachhaltige Wohl-fahrt aufzubauen, aber auch Handlungsfähigkeit für
Europa zu bewahren, um außen- und klimapolitische Ziele zu verfolgen.
Russland ist als geografischer Nachbar in Europa und Rohstofflieferant mit im Spiel, auch wenn es sich vom strategischen Partner zum strategischen Rivalen wandelt. Die Verwerfungslinien und Interessengegensätze wer-den im Energiebereich immer deutlicher. Russlands fossilbasiertes Exportmodell unterfüttert das System Putin. Moskau wendet sich deswegen Richtung Asien, das ganz im Sinne des „grünen Paradoxon“ für einen längeren Übergangszeitraum von günstigen Gaspreisen profitieren und zeitweise einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Europa ausspielen könnte.
Die EU wird sich nur behaupten können, wenn sie ihre Marktmacht und -größe in die Waagschale legt. Energie-politisch ist das evident: Europa braucht Importe von grünem Strom und Molekülen. Den Europäern fehlt es an Fläche und sozialer Akzeptanz, um ihren Bedarf allein bereitzustellen. So wird die EU in dem kompetitiven internationalen Umfeld auf strategische Verflechtung und Interessenausgleich setzen müssen. Die bald erwarte-te „Global Gateway Strategie“ der EU ist eine Antwort auf Chinas Seidenstraßeninitiative. Zudem ist ein Aus-tarieren zwischen Standorterhalt und Wirtschaftskoope-ration ein Gebot. Wenn klimaneutrale Elektronen und Moleküle nicht schnell genug und ausreichend verfügbar sind, droht die Verlagerung von Wertschöpfung. Bevor das zu Kettenreaktionen führt und ganze Industrien abwandern, sollten gezielt stabile und nachhaltige Lieferbeziehungen im Interessenausgleich mit Partnern aufgebaut werden. Die Stahlindustrie, einst an der Wiege der europäischen Einigung, ist heute wieder im Fokus.
Nicht zuletzt muss die EU die strukturellen Asymmetrien gegenüber China und den USA überwinden. Dazu gehört nicht nur die staatliche Schützenhilfe für Konzerne. Auch die politischen Entscheidungsprozesse in der EU sind vergleichsweise langwierig und schwierig. Die neue Bundesregierung wird Tatkraft beweisen müssen, um zügig einen tragfähigen und inklusiven Konsens in der EU zu schmieden, um eine Trendumkehr beim Treibhausgas-ausstoß zu erreichen und die Wirtschaft sozial verträglich und nachhaltig in ganz Europa umzubauen.
Das Wechselspiel von Energiewende
und GeopolitikDer Abschied vom fossilen Zeitalter wird zugleich geprägt
vom Übergang in eine neue Weltordnung. Risiken und Nebenwirkungen analysiert Kirsten Westphal.
SWP [M]
Die AutorinKirsten Westphal ist Projektleiterin bei der Stiftung Wissen-schaft und Politik (SWP) in Berlin und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat.
Die bald erwartete „Global Gateway Strategie“ der EU ist eine Antwort auf
Chinas Seidenstraßeninitiative.
Wenn Technologien, Schlüsselkompo-nenten und asymmetrische Abhängig-
keiten in Netzwerken zu zentralen Machtwährungen werden, rutscht die
Welt immer tiefer in ein ökonomisches Sicherheitsdilemma.
Gastkommentar
72 WOCHENENDE 5./6./7. NOVEMBER 2021, NR. 215