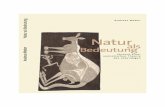„Geplante Forschung“: Bedeutung und Aktualität differenzierungstheoretischer Wissenschafts- und...
-
Upload
uni-bielefeld -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of „Geplante Forschung“: Bedeutung und Aktualität differenzierungstheoretischer Wissenschafts- und...
„Geplante Forschung“:Bedeutung und AktualitätdifferenzierungstheoretischerWissenschafts- und Technikforschung
Marc Mölders
1 Einleitung: Zur Kontextualisierung der „GeplantenForschung“
Wolfgang van den Daele, Wolfgang Krohn und Peter Weingart, die Herausgeberdes Sammelbandes „Geplante Forschung“ (1979), verlagerten im Rahmen der ZiF-Arbeitsgruppe „Wissenschaft zwischen Autonomie und Steuerung“ den Blick aufdas Verhältnis von politischer Steuerung und wissenschaftlicher Erkenntnispro-duktion, nachdem zuvor insbesondere die Vereinbarkeit autonomer Wissenschaftund ökonomischer Verwertungsimperative im Mittelpunkt gestanden hatte. VierEntwicklungen waren für die Vorbereitung des Sammelbandes entscheidend:
In sachlicher Hinsicht schließt der Band unmittelbar an die sogenannte „Fi-nalisierungsdebatte“ (vgl. Böhme et al. 1973) an. In dieser ging es im Kern umdie Frage, woran sich wissenschaftlicher Fortschritt orientiert, genauer gesagt: zuwelchen Phasen wissenschaftsinterne bzw. -externe Probleme ein Fortschreitenveranlassen. Das Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) und die Universi-tät Bielefeld bieten in institutioneller Hinsicht einen weiteren Anknüpfungspunkt.Zum Zeitpunkt des Erscheinens des Sammelbandes sind beide Institutionen nochvergleichsweise jung: 1968 startete das ZiF als erste in dieser Weise zugeschnitteneEinrichtung in Deutschland, die Universitätsgründung erfolgte ein Jahr später. Bei-den lag die Idee Schelskys zugrunde, durch räumliche Nähe Interdisziplinarität zuvereinfachen. Als erster Professor an die seinerzeit einzige Fakultät für Soziologie
M. Mölders (�)Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie,AB Recht und Gesellschaft, 33501 Bielefeld, DeutschlandE-Mail: [email protected]
D. Lengersdorf, M. Wieser (Hrsg.), Schlüsselwerke der Science & Technology Studies, 111DOI 10.1007/978-3-531-19455-4_9, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
112 M. Mölders
Deutschlands wurde bekanntlich Niklas Luhmann berufen. Dessen soziologischeSystemtheorie war noch im Entstehen begriffen, die „Sozialen Systeme“ erschienenerst 1984. Wenn man von einer biographisch weichenstellenden Zeit spricht, so lässtsich dies einerseits auf die Autoren selbst, aber auch auf die Institute, für die sieseinerzeit und später arbeiteten und die sie prägten, beziehen. Wolfgang Krohn undPeter Weingart sollten wenig später über viele Jahre hinweg gemeinsam am Biele-felder Institut für Wissenschafts- und Technikforschung (IWT) arbeiten, das ausdem universitären Forschungsschwerpunkt „Wissenschaftsforschung“ hervorging.Weingart war seit 1973 bereits Professor für Wissenschaftssoziologie, Krohn warnoch bis 1981 Mitarbeiter am Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbe-dingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg1 und wie Wolfgangvan den Daele einer der Autoren der o.a. „Finalisierungsthese“. Letzterer arbeitetezu dieser Zeit ebenso am Starnberger MPI, bevor er 1989 Direktor der Abteilung„Normbildung und Umwelt (ab 2000 „Zivilgesellschaft und transnationale Netz-werke“) am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung Berlin (WZB) wurde. Inunterschiedlichen Kombinationen veröffentlichten die drei Herausgeber weitereStudien zur Wissenschafts- und Technikforschung.
Wesentlicher Anknüpfungspunkt für den vorliegenden Beitrag ist die paradig-menhistorische Bedeutung des Sammelbandes „Geplante Forschung“, in dessenZentrum das Verhältnis von Politik und Wissenschaft steht, ein klassisches The-menfeld der STS. In den folgenden Abschnitten wird es im Wesentlichen um denvon den Herausgebern verfassten Einführungsaufsatz „Die politische Steuerungder wissenschaftlichen Entwicklung“ gehen. Schon oberflächlich betrachtet ver-weist dieser Titel darauf, dass man seinerzeit, sofern es um den Einfluss einesGesellschaftsbereichs auf einen anderen ging, nicht mehr von (kybernetischer) „Re-gelung“ und noch nicht von „Governance“, sondern von „Steuerung“ sprach. DieseZwischenstellung, hierauf wird mein Beitrag hinauslaufen, ist auch heute noch sorelevant, dass nicht nur in nostalgisch-würdigender Absicht von der „GeplantenForschung“ als einem Schlüsselwerk der STS auszugehen ist.
Eine zweite paradigmenhistorische Bedeutung leitet sich aus dem Umstand ab,dass hiermit ebenso ein Grundstein für eine differenzierungstheoretische Wissen-schaftsforschung gelegt wurde, der die spätere Entdifferenzierungsdebatte anstieß.Beide Entwicklungen werden im abschließenden Absatz diskutiert.
1 Für eine interessante Rückschau auf die Geschichte dieses MPI siehe Drieschner (1996).
„Geplante Forschung“ 113
2 Die politische Steuerung der wissenschaftlichenEntwicklung
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe „Wissenschaft zwischen Autonomie und Steue-rung“ untersuchte den Fragekomplex der wissenschaftsinternen und -externenBedingungen einer Steuerbarkeit wissenschaftlicher Entwicklung. Diese Fragestel-lung wurde anhand von Fallstudien operationalisiert, gemein sollte den Fällensein, dass es hierin um staatliche Programme ging, die „implizit oder explizit dieInstitutionalisierung von Forschungsgebieten zum Ziel hatten, die außerhalb deretablierten Disziplinen lagen“ (van den Daele et al. 1979, S. 7). Im Einleitungs-kapitel fassen die Herausgeber die wesentlichen empirischen wie theoretischenSchlussfolgerungen aus den Fallstudien zusammen, die anschließend gesondertausgeführt werden: Biotechnologie, Informatik, Krebs-, Umwelt-, Fusions- undSchwerionenforschung.
Um die im Zentrum stehenden Einflussversuche rekonstruierbar zu machen,wählte man die o.a. Fälle aus, weil es zu ihnen politische Programme gab. Dieseverstanden sich durchweg als ermöglichende Maßnahmen, indem sie Forschungs-organisationen einrichteten, Berufschancen anboten, Finanzmittel zur Verfügungstellten etc., um Entwicklungsmöglichkeiten in die (wissenschaftliche) Welt zubringen, „die ohne diesen Einfluß nicht auf dieselbe Weise eingeschlagen wor-den wäre[n]“ (ebd., S. 15). Als politische Steuerung der Wissenschaft wurdesomit „die durch politische Programme bewirkte Änderung oder Konstruktionvon disziplinären, also in Forschungsprogrammen organisierten Forschungsfel-dern“ definiert (ebd., S. 35). Für die Frage nach den Bedingungen der Steuerbarkeitder Wissenschaft durch politische Programme machten die Autoren Gebrauchvom Drei-Phasen-Modell der disziplinären Entwicklung von Forschungsfeldern(vgl. Böhme et al. 1973).
1. Der Typus explorativer Forschung zeichnet sich vor allem durch Strategien destrial and error aus. Diese Strategien können „durch Programme, die funktionellauf extern relevante Probleme bezogen sind, gesteuert werden“ (van den Daeleet al. 1979, S. 44). In solchen Fällen seien problem- und erklärungsorientierteExplorationen methodisch nahezu äquivalent. Es gibt (noch) kein anleitendes,reifes Paradigma, sodass etwa das Programm zum Screening in der Krebs-Pharmakologie bei den (Krebs-)Forscher_innen nicht auf Widerstand stieß.
2. Der Typus paradigmatischer Forschung ist dadurch gekennzeichnet, dass Pro-bleme der Erklärung forschungsleitend sind. In dieser Phase befinden sichDisziplinen gewissermaßen auf der Suche nach einer verbindlichen (integrie-
114 M. Mölders
renden) Theorie. Hier kann gelingende Forschungsplanung nur die „Form vonKoinzidenzen interner Forschungsfronten mit externer Problemorientierung“annehmen (ebd., S. 45). Die Autoren sprechen in diesem Fall bewusst nicht vonSteuerung, die sie in Bezug auf diesen Forschungstypus nur dort sehen, wo wiein der Zellbiologie aus externen Gründen wissenschaftlich suboptimale Modellegewählt werden, beispielsweise eine epidemiologisch relevante, wissenschaftlichaber wenig interessante Tumorart.
3. In der postparadigmatischen Phase „sind die internen Regulative so wenig selek-tiv, daß die Theorieentwicklung der Disziplin nach externen Gesichtspunktenfortsetzbar ist“ (ebd., S. 47). Für die Krebsforschung bedeutet dies beispielhaft:Man nahm (forschungspolitisch) an, dass eine Erforschung der chemischenKarzinogenese zur Eindämmung von Krebserkrankungen beitragen könnte. Daes nun in Biochemie und Molekularbiologie grundlegende Modelle hierzu gab,konnten diese auch auf die extern gewünschten Probleme bezogen werden.Der theoretischen Weiterentwicklung der Disziplinen steht das nicht – wie imFalle der paradigmatischen Forschung – im Wege, sie kann hierdurch sogarfortschreiten (vgl. ebd., S. 48).
Bei der Entwicklung des Drei-Phasen-Modells wurde der empirisch gewonneneVersuch unternommen, Bedingungen für eine gelingende Steuerung der Wissen-schaft herauszuarbeiten – und das in Bezug auf die Lösung drängender sozialerProbleme (Krebstherapie, Umweltschutz, Energieversorgung usw.). Allerdings sindrezeptionsgeschichtlich (ausführlicher s. u.) die Anschlüsse an die Erklärungen fürdas Scheitern einer politischen Steuerung der Wissenschaft deutlich wirkmächtigergewesen. Solche Steuerungsschranken identifizieren van den Daele et al. in institu-tionellen Resistenzen und kognitiven Defiziten. Institutionelle Resistenzen verortensie dabei nicht allein in der Wissenschaft, vielmehr tendiere diese ebenso wie diePolitik zur Bestandswahrung, zudem seien beide Felder nur im Rahmen jeweiligerTraditionen innovativ (ebd., S. 18). Angriffe auf die Autonomie der Forschung, z. B.hinsichtlich der Problemauswahl, träfen demzufolge strukturlogisch auf Wider-stand. Nur wenn Interventionsversuche Hand in Hand mit der Forschungsagendagingen, sei diese Hürde zu überspringen:
Die gesteuerte Wissenschaft muß methodisch und theoretisch an existierende Wis-senschaft anschließen können, und dafür müssen ,manpower‘ rekrutiert, stabileArbeitszusammenhänge, Kommunikationsformen und Karrierewege eingerichtetwerden (ebd., S. 50).
Gelingt dies nicht, verpuffen politische Steuerungsversuche, fähige Forscher_innenlassen sich nicht rekrutieren, die Resonanz gegenüber Förderungsprogrammen ist
„Geplante Forschung“ 115
mangelhaft oder die ausgeschriebenen Programme werden durch verdeckte ei-gene Forschungsinteressen (Etikettenschwindel) überschrieben (vgl. ebd., S. 51).Im Rahmen der Fallstudien zeigte sich eine solche Resistenz etwa in der Mole-kularbiologie, die sich seinerzeit in der Phase der Theoriedynamik befand. Daspolitisch beabsichtigte Übertragen einige ihrer Konzepte auf höhere Tiersystemeund schließlich den Menschen bedeutete „ein Ausscheren aus der disziplinärenFrontforschung“ (ebd., S. 52).
Kognitive Defizite meinen das Fehlen entscheidender Wissensbestände; einwissenschaftspolitisches Programm kann also daran scheitern, dass trotz Unter-stützung nicht-schließbare Wissenslücken bleiben. In Bezug auf Steuerungsfragenist an dieser Stelle allerdings vor allem der dahinter liegende Mechanismus auf-schlussreich. Besonders an der Krebs-, aber auch an der Fusionsforschung wurdesichtbar, dass der „theoretische und instrumentelle Fortschritt nicht beliebig durchvermehrten Einsatz von Mitteln beschleunigt werden kann“ (ebd.: 19). Dass mehrGeld nicht automatisch zu mehr Erkenntnis (und schließlich: Anwendbarkeit)führt, erscheint heute kaum noch erwähnenswert. Die Erfolge staatlicher Groß-forschung (klassisch: das Manhattan Project) aber hatten ihre Wirkung auf dieForschungspolitik noch längst nicht verloren. Wenn auch nicht im Sinne eines Au-tomatismus kybernetischer Regelung (in diesem Fall: Ist- und Sollwert-Abgleichmit finanziellem Nachjustieren), so ist die Annahme, dass staatliche Förderungvon Großprojekten mit vor allem monetären Mitteln zielführend sein kann, auchin rezenteren Projekten wie dem europäischen Satellitennavigationssystem Galileodeutlich erkennbar (vgl. Weyer 2008).
Betrachtet man die „Geplante Forschung“ nun ihrerseits paradigmenhisto-risch, so wird insbesondere durch die Mechanismen „institutionelle Resistenz“und „kognitive Defizite“ das Scheitern vormaliger Erklärungsangebote kyberne-tischer Provenienz, wie eben skizziert, erklärbar. Die von van den Daele et al.angebotene Steuerungstheorie selbst basiert vor allem auf den Vorarbeiten RobertK. Mertons (1957) und Thomas S. Kuhns (1962). Auf die im Anfangsstadium be-findliche Systemtheorie Luhmanns verweist lediglich eine einzige Fußnote an einerStelle, in der es um die Beteiligung von Wissenschaftler_innen an der Formulie-rung wissenschaftspolitischer Programme geht. Solche Konstellationen werden alsBeispiel für die Luhmann zugeschriebene These erhöhter „Kommunikationslasten“zwischen den ausdifferenzierten Systemen von Politik und Wissenschaft gesehen(vgl. van den Daele et al. 1979, S. 26 f.). Jedoch finden sich in den Ausführungeneinige Überlegungen, die vollauf kompatibel mit der kommunikationsbasiertenSystemtheorie sind. Wesentlich für die Argumentation von van den Daele et al.ist die Annahme, dass eine Rekonstruktion von Effekten politischer Steuerungzahlreiche Übersetzungsstufen impliziert: „Soziale Ziele oder Probleme werden
116 M. Mölders
in politische übersetzt, die politischen in wissenschaftspolitische, und diese intechnische und wissenschaftliche“ (ebd., S. 19; graphisch auf 22 f. dargestellt).Dieses Übersetzungskonzept wird dann auch bei der Erklärung von Steuerungs-problemen in Anschlag gebracht. Dabei zieht der Umstand der Übersetzungkeineswegs zwangsläufig ein Scheitern nach sich, generell aber gelte, dass die„nicht-disziplinären Standards und Ziele der wissenschaftspolitischen Programmein disziplinäre übersetzt [werden]“ (ebd., S. 59). Die wissenschaftsinterne Pro-blemlösung kann dann auch das vormals zunächst soziale, dann politische undschließlich wissenschaftspolitische Ziel lösen. Immer aber werden die Probleme indie Form wissenschaftlich anschlussfähiger Fragestellungen gegossen.
Diese Betonung von Eigensinn bzw. Strukturdeterminiertheit – oder eben Selbs-treferentialität – kommt noch ohne Verweis auf Kommunikation als Grundbegriffdes Sozialen aus, doch auch hierzu finden sich einschlägige Passagen. Zur Er-klärung etwa, warum die Ergebnisse der Fallstudien darauf hinwiesen, dass ininterdisziplinärer Forschung die Fragestellung meist nach Disziplinen getrennt be-arbeitet würde, heißt es, dies zeige einerseits an, dass Disziplinen in der Lage seien,Teilaspekte komplexerer Probleme zu inkorporieren. Aber es „weist andererseitsdarauf hin, daß Wissenschaftler gegen Arbeit in interdisziplinären Gruppen re-sistent sind, weil der Preis der geringen Kommunikation oder der Aufwand, dieKommunikationsbarriere zu überwinden, zu hoch ist“ (ebd., S. 55 f.).
Schon die Fragestellung politischer Steuerung wissenschaftlicher Entwicklungimpliziert ein neues Forschungsprogramm, nämlich eine differenzierungstheoreti-sche Wissenschaftssoziologie. Die Steuerungsfrage kann nur gestellt werden, wenndavon ausgegangen wird, „daß Politik überhaupt von Wissenschaft (und übrigensauch von Wirtschaft) institutionell getrennt ist“ (ebd., S. 32). Nur wenn etwa einegenuin politische Eigenlogik angenommen wird, kann eine Analyse zu dem Schlusskommen, dass die Förderung der Krebsforschung für die Politik auch latente Funk-tionen haben kann. Der (aus politischer Sicht) Umweg über die Wissenschaftermöglicht es, Alternativen in der Zukunft zu versprechen, die dem gegenwär-tigen politischen Handeln Dringlichkeit und Zuständigkeit ersparen, schließlich istes nun an der Wissenschaft, eine Lösung zu erarbeiten. Ebenso entlastet es vonweniger bequem zu vermittelnden Programmen, die in der präventiven Krebs-bekämpfung ansetzen und Änderungen von Lebens- und Arbeitsgewohnheitenverheißen lassen müssten (vgl. ebd., S. 25 f.).
Diese hier noch institutionelle und später kommunikationsbasierte Tren-nung von Politik, Wissenschaft und Wirtschaft wird später in den STS teilweisefundamental abgelehnt und ihrerseits mit Diagnosen einer Entdifferenzierung kon-frontiert. Auf diesen Aspekt der Rekonstruktion der Rezeptionsgeschichte der„Geplanten Forschung“ wird unten zurückzukommen sein.
„Geplante Forschung“ 117
3 Kurzer Abriss der Rezeptionsgeschichte – und Ausblicke
Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits angedeutet, dass und weshalb diesoziologische Systemtheorie an die Konzepte der Arbeitsgruppe „Wissenschaft zwi-schen Autonomie und Steuerung“ anschloss. Luhmanns (1988) Überlegungen indiesem Zusammenhang beschäftigten sich eher mit den „Grenzen der Steuerung“.Hierbei wurde argumentiert, dass selbstreferentiell geschlossene Systeme (wie Po-litik, Wirtschaft, Wissenschaft, Recht etc.) einander allenfalls irritieren, nie aberplanvoll die Zustände fremder Systeme steuern können. Es leuchtet unmittelbar ein,dass die Ergebnisse von van den Daele, Krohn und Weingart naheliegende Beispielezur Erhärtung dieser These sind. Einige der Fallstudien der „Geplanten Forschung“zeigten schließlich eindrucksvoll, dass die wissenschaftlichen Steuerungsobjekte ein„Eigenleben“ führen, wenn die politischen Steuerungsbemühungen „in die Spracheexistierender Disziplinen übersetzt werden“ (van den Daele et al. 1979, S. 20).
Ungeachtet der Beiträge anderer Autor_innen (paradigmatisch: Teubner undWillke 1984), die Luhmanns „Grenzen der Steuerung“ in konstruktiver Weiseausloteten, wurde in der Soziologie vor allem dann an entsprechende differenzie-rungstheoretische Beiträge angeschlossen, wenn es um das Scheitern von Steuerungging. Wie im letzten Abschnitt dargestellt, zeichnete sich der Band „Geplan-te Forschung“ aber gerade dadurch aus, auch über die Bedingungen gelingenderInterventionen Auskunft zu geben. Dennoch ist die paradigmengeschichtlich we-nig später zu beobachtende Dominanz akteurzentrierter Ansätze stets dadurchgerechtfertigt worden, differenzierungstheoretische Konzepte könnten Steuerungs-überlegungen „keinerlei positive Impulse“ geben (Mayntz 1996, S. 154 f.). Für dieSTS war die Umstellung auf akteurzentrierte Ansätze folgenreich und ihrerseitsweichenstellend für das mittlerweile vorherrschende Governance-Paradigma (vgl.Mayntz 2006).
Allerdings finden sich in der jüngeren Vergangenheit auch Beiträge, die dif-ferenzierungstheoretisch ansetzende Erklärungen für gelingende Interventionenzu aktualisieren versuchen (Teubner 2010; Mölders 2014). Diese – paradigmen-geschichtliche – Rückkehr zu Konzepten differenzierungstheoretischer Steuerungwird mit dem Hinweis begründet, das Governance-Paradigma habe die Aus-gangsfrage, wie eigensinnige Gesellschaftsbereiche absichtsvoll in eine bestimmteRichtung zu bringen sind, lediglich verschoben. Denn Interdependenzbewälti-gung als Erklärungsziel von Governance (Benz et al. 2007) beinhaltet in Bezugauf Wissenschaft alles von Selbststeuerung qua peer review bis zum Regime desNew Public Management. Gelingende Interdependenzbewältigung kann das Er-gebnis intentionaler Einsetzung sein oder sich aus normalem Prozessieren herausergeben.
118 M. Mölders
Ebendies war ja die Ausgangsfrage, die die Arbeitsgruppe „Wissenschaftzwischen Autonomie und Steuerung“ umtrieb: Ob und ggf. wie politische Ent-scheidungen einen richtungsändernden Einfluss auf Forschungsprozesse ausübenkönnen. Wissens- und Wissenschaftsregulierung differenzierungstheoretisch, abernicht nur auf Erklärungen eines Scheiterns hin zu analysieren, steht deutlich in derTraditionslinie der „Geplanten Forschung“.
Von einer differenzierungstheoretischen Wissenschaftsforschung zu sprechen,in der Unterscheidungen von konstitutiver Bedeutung sind, leitet über zu der zwei-ten paradigmenhistorischen Bedeutung des hier besprochenen Bandes, nämlich dieeiner Kontrastfolie für die Entdifferenzierungsdiagnosen in den STS. Einen Beginnder Diskussion darüber, ob man Wissenschaft als eine von anderen gesellschaftli-chen Sinnsphären getrennt zu beobachtende Einheit auffassen sollte, kann man inden Laborstudien sehen.2 So machte etwa Karin Knorr-Cetina in ihren Studien zurTeilchenphysik die Beobachtung, dass diese sich ständig zwischen verschiedenenSinnprovinzen bewege, „in denen sie ihre Probleme wieder aufnimmt und einerWeiterbehandlung unterzieht; im differenzierungstheoretischen Sprachgebrauchmuß dies heißen: sie löst ihre Probleme durch Entdifferenzierung“ (1992, S. 414).
Seinen sichtbarsten Höhepunkt erklomm der Streit zwischen Differenzierungs-theorie und den STS im Rahmen der im Oktober 1996 an der Universität Bielefeldveranstalteten Konferenz von EASST und 4S. Auf einem Podium sollte NiklasLuhmann das Wissenschaftsverständnis der Systemtheorie erläutern, das aus Sichtder STS von Bruno Latour kommentiert wurde. Gerald Wagner (1996), der die-se Tagung rezensierte, nannte Luhmanns Vortrag ein Musterbeispiel in punctoKlarheit und Differenziertheit, machte allerdings auch darauf aufmerksam, dassLuhmann fast ausschließlich über seine Theorie im Allgemeinen und nicht, wiethematisch gefordert, von Wissenschaftsforschung im Besonderen sprach. Latourführte aus, dass die STS die Gesellschaft schildere, wie sie sei, weshalb schon dieTheorie/Empirie-Unterscheidung an den STS vorbeiziele und eine so abstrakteTheorie wie die Luhmanns den Blick eher verstelle. Schlimmer noch sei, so Latour,dass Luhmann Wissenschaft durch die System/Umwelt-Unterscheidung purifizie-re, was dem Ansinnen der STS, die Verwobenheit wissenschaftlicher Praktiken mitanderen Logiken aufzuzeigen, zuwiderlaufe. Luhmann antwortete darauf nur, dassdie für Latour so wichtigen technischen Artefakte Umwelt des Sozialen seien, solange über sie nicht kommuniziert werde, dies sei eben die Konsequenz, wenn manauf Kommunikation als Letztelement des Sozialen setze. Latour echauffierte sichzunehmend, Luhmann blieb kühl, schließlich verließ Latour das Podium, wobei erdas Mikrophonkabel ausriss.
2 Vgl. hierzu auch die Beiträge von Kirschner und van Loon i.d.Bd.
„Geplante Forschung“ 119
So erheiternd diese Schilderung klingt, sie macht auch auf die wechselseitigeSprachlosigkeit aufmerksam und kann zudem als ein Indiz dafür gelesen wer-den, dass es sich die Verteidigung der Differenzierungstheorie von Seiten derSystemtheorie vergleichsweise einfach machte, indem sie auf ihre eigene Theo-riearchitektur verwies. Den empirischen Arbeiten der STS im Allgemeinen und derLaborstudien im Besonderen ist vielfach entgegnet worden, dass ihre wertvollenErgebnisse sich auf Interaktions- bzw. Organisationsphänomene beschränken undkeinerlei Rückschluss auf die Ebene der Funktionssysteme beanspruchen könnten.Vielmehr könnten die dort gefundenen Unterscheidungen im Forschungshandelnüberhaupt nur bezeichnet werden, weil diese Kategorien gesamtgesellschaftlich zurVerfügung stehen (Bora 2005).
Im weiteren Verlauf des (Ent-)Differenzierungsstreits erhalten die Diagnosenneue Namen, an den wechselseitig aufeinander gerichteten Argumenten hinge-gen veränderte sich zunächst wenig. Dabei ist insbesondere an die These eines„Mode 2“ (Nowotny et al. 2001) der Wissenschaft zu denken. Dort wird gera-de ins Feld geführt, dass angesichts gestiegener „gesellschaftlicher“ Forderungenan die Wissenschaft die Geltungsbasis wissenschaftlichen Wissens vom Anspruchauf Wahrheit (Modus 1) hin zu einem „sozial robusten“ Wissen entwickelt habe(Modus 2). Diese Wissensform verzichte zwar nicht vollends auf wissenschaftlicheStandards, müsse aber immer auch die gesellschaftliche Akzeptanz wissenschaftli-cher Erkenntnisse bedenken. Hinzu komme die Erwartung, dass wissenschaftlicheNeuerungen kaum mehr als Selbstzweck möglich seien, vielmehr sei die dominanteErwartung, dass sie auch außerhalb der Wissenschaft verwertet werden können.Letztlich wird hieraus geschlossen, dass Gesellschaft und Wissenschaft sich nichtmehr, wie noch im Modus 1, differenzieren lassen.
Gegen diese Position konnte die Differenzierungstheorie darauf verweisen, dasssolange Probleme mit Theorien und Methoden bearbeitet werden, man es un-verändert mit einer wissenschaftlichen Informationsverarbeitung zu tun habe. Obdie zu verarbeitenden Probleme dann aus Anwendungskontexten kommen, sichals inter- oder auch transdisziplinär markieren lassen, ändere hieran nichts (Möl-ders 2011, S. 158 ff.). Allerdings gerät so argumentierend wiederum leicht ausdem Blick, dass und wie sich die Produktionsbedingungen von Wissenschaft wan-deln und welchen Einfluss dies auf die weitere wissenschaftliche Kommunikation(v. a.: Publikationen) hat. Insbesondere mit Blick auf Fragen der Limitationalitätwissenschaftlicher Kommunikation nimmt der Einfluss nicht-wissenschaftlicherOrganisationen messbar zu, hierzu können auch schon Verlage und wissenschaft-liche Zeitschriften zählen (vgl. Franzen 2011). Prinzipiell ist alles erforschbar,nicht aber wissenschaftlich relevant, also muss das Erforschbare eingeschränktwerden – ebendies ist mit Limitationalität angesprochen. Geht es um Aspekte
120 M. Mölders
der Themenwahl, wird kaum von der Hand zu weisen sein, dass Wissenschaft-ler_innen mitunter ökonomischen, politischen oder medialen Kriterien den Vorzuggegenüber originär und ausschließlich wissenschaftlichen geben. Dies ist als einweitreichender Wandel beobachtbar, den man – und hier wiederholt sich das Ar-gument – wiederum nur in den Blick bekommt, wenn man von wissenschaftlichenund außerwissenschaftliche Kriterien, Logiken, Referenzen o.ä. ausgeht.
Auch dieser Diskussionsstrang zeigt, wie aktuell die Themen des Bandes „Ge-plante Forschung“ bis in die Gegenwart sind. Peter Weingart selbst hat in späterenVeröffentlichungen die wechselseitigen Beeinflussungen von Gesellschaftsberei-chen untersucht – also etwa deren Verwissenschaftlichung, Politisierung, Öko-nomisierung, Medialisierung usw. (Weingart 2001). Seine Wahl einer nach wievor differenzierungstheoretischen Perspektive begründete er damit, dass „sie vorder modischen Versuchung bewahrt, komplex erscheinende Wechselverhältnisseals ,Verschmelzung‘ von Systemgrenzen und als Entdifferenzierungsprozesse zusehen“ (Weingart 2010, S. 157).
Doch auch der von vielen innerhalb wie außerhalb der Systemtheorie kri-tisch gesehene Begriff der „strukturellen Kopplung“ von Funktionssystemen wirdin neueren Arbeiten einer Revision unterzogen und durch andere Konzepteersetzt (Kaldewey 2013; Mölders 2012). Was Wissenschaft von anderen Ge-sellschaftsbereichen unterscheidet und wie ggf. wissenschaftsexterne InstanzenEinfluss auf Wissenschaft ausüben können, scheinen Fragen zu sein, die dieWissenschaftsforschung weiter begleiten werden.
Literatur
Benz, Arthur, Susanne Lütz, Uwe Schimank, und Georg Simonis, Hrsg. 2007. Handbuch Go-vernance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: Verlagfür Sozialwissenschaften.
Böhme, Gernot, Wolfgang van den Daele, Wolfgang Krohn. 1973. Finalisierung derWissenschaft. Zeitschrift für Soziologie 2 (2): 128–144.
Bora, Alfons. 2005. Rezension: Helga Nowotny, Peter Scott und Michael Gibbons: Wissen-schaft neu denken. Wissenschaft und Öffentlichkeit in einem Zeitalter der Ungewißheit.Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 57 (4): 755–757.
Drieschner, Michael. 1996. Die Verantwortung der Wissenschaft. Ein Rückblick aufdas Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. In Wissenschaft und Öffentlichkeit, Hrsg. von T. Fischer und R. Seising,S. 173–198. Frankfurt a. M.: Lang.
Franzen, Martina. 2011. Breaking News: Wissenschaftliche Zeitschriften im Kampf umAufmerksamkeit. Baden-Baden: Nomos.
„Geplante Forschung“ 121
Kaldewey, David. 2013. Wahrheit und Nützlichkeit. Selbstbeschreibungen der Wissenschaftzwischen Autonomie und gesellschaftlicher Relevanz. Bielefeld: Transcript.
Knorr Cetina, Karin. 1992. Zur Unterkomplexität der Differenzierungstheorie. EmpirischeAnfragen an die Systemtheorie. Zeitschrift für Soziologie 21 (6): 406–419.
Kuhn, Thomas S. 1962. The structure of scientific revolutions. Chicago: The University ofChicago Press.
Luhmann, Niklas. 1988. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M: Suhrkamp.Mayntz, Renate. 1996. Politische Steuerung: Aufstieg, Niedergang und Transformation
einer Theorie. In Politische Theorien in der Ära der Transformation. Politische Viertel-jahresschrift Sonderheft 26, Hrsg. von K. von Beyme und C. Offe, S. 148–168. Opladen:Westdeutscher Verlag.
Mayntz, Renate. 2006. Governance Theory als fortentwickelte Steuerungstheorie? InGovernance-Forschung. Vergewisserung über Stand und Entwicklungslinien, Hrsg. vonG. F. Schuppert, 11–20. Baden-Baden: Nomos.
Merton, Robert K. 1957. Social theory and social structure. 2. Aufl. New York: Free Press.Mölders, Marc. 2011. Die Äquilibration der kommunikativen Strukturen. Theoretische und
empirische Studien zu einem soziologischen Lernbegriff. Weilerswist: Velbrück.Mölders, Marc. 2012. Differenzierung und Integration. Zur Aktualisierung einer kommuni-
kationsbasierten Differenzierungstheorie. Zeitschrift für Soziologie 41 (6): 478–494.Mölders, Marc. 2014. Das Hummel-Paradox der Governance-Forschung. Zur Erklä-
rung erfolgreicher Wissensregulierung in Verhandlungssystemen. In Wissensregulierungund Regulierungswissen, Hrsg. von A. Bora, C. Reinhardt und A. Henkel, 175–198.Weilerswist: Velbrück.
Nowotny, Helga, Peter Scott, und Michael Gibbons. 2001. Re-thinking science: Knowledgeand the public in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press.
Teubner, Gunther, und Helmut Willke. 1984. Kontext und Autonomie: GesellschaftlicheSelbststeuerung durch reflexives Recht. Zeitschrift für Rechtssoziologie 6 (1): 4–35.
Teubner, Gunther. 2010. Selbst-Konstitutionalisierung transnationaler Unternehmen? ZurVerknüpfung ,privater‘ und ,staatlicher‘ Corporate Codes of Conduct. In Unternehmen,Markt und Verantwortung. Festschrift für Klaus J. Hopt, Hrsg. von S. Grundmann,B. Haar, und H. Merkt, 1449–1470. Berlin: de Gruyter.
van den Daele, Wolfgang, Wolfgang Krohn, und Peter Weingart, Hrsg. 1979. Geplan-te Forschung. Vergleichende Studien über den Einfluß politischer Programme auf dieWissenschaftsentwicklung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
Wagner, Gerald. 1996. Signaturen der Wissensgesellschaften – ein Konferenzbericht. SozialeWelt 47:480–484.
Weingart, Peter. 2001. Die Stunde der Wahrheit? Zum Verhältnis der Wissenschaft zu Politik,Wirtschaft, Medien in der Wissensgesellschaft. Weilerswist: Velbrück.
Weingart, Peter. 2010. Resonanz der Wissenschaft der Gesellschaft. In Ökologische Auf-klärung. 25 Jahre ,Ökologische Kommunikation‘, Hrsg. Von C. Büscher und K. P. Japp,157–172. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
Weyer, Johannes. 2008. Transformationen der Technologiepolitik. Die Hightech-Strategieder Bundesregierung und das Projekt Galileo. In Die europäische Wissensgesellschaft– Leitbild europäischer Technologie-, Innovations- und Wachstumspolitik, Hrsg. vonB. Schefold und T. Lenz, 137–156. Berlin: Akademie Verlag.











![[2015] „L'État, c'est le droit!“ Zur Aktualität der Staatslehre Hans Kelsens im Angesicht sich wandelnder Staatsgewalt](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63259acec9c7f5721c022b24/2015-letat-cest-le-droit-zur-aktualitaet-der-staatslehre-hans-kelsens.jpg)