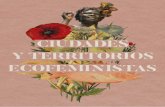Zur Herleitung und Bedeutung von Friedrich Joachim Stengels Querkirchentypus
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Zur Herleitung und Bedeutung von Friedrich Joachim Stengels Querkirchentypus
Herausgegeben von Hans-Christoph Dittscheid und Klaus GüthleinBearbeitet von Petra Tücks
D ie Architektenfamilie
STE,NGE,L
FnrnnnrcH JoacHrv (1 694-L787)
JoHnNN FTEDRTcH (Rooon RopoRowrrscH, 1746-1330 ?)BnTTHASAR WnHELM ( L7 48-1824)
MICHAEL IMHOF VERLAG
Herausgegeben von Hans-Christoph Dittscheül und Kaus Güthlein, bearbeitet wn Petra TikkDie Architektenfamilie StengelFriedrichJoachim (1694-1787),Johann Friedddr (Fi. Fi, 174G1830 ?), Bdthasar Wilhekn (174VL824)Michael Imhof Verlag, Petenberg 20O5.
@ 2005Mchael Imhof Verlag GmbH & Co. KG,Stetdner Straße 25, D-36100 Pete$bergTel. 06 6W 628286; Fax 06 61y'6 36 86
Gestaltung und Reproduktton: Midnel hüof VerlagDruck Meiling Druck, Haldensleben
Pdnted in EU
rsBN 3-937251-88-X
INHAIjTSVERZEICHNIS
Geleitwortdes Ministers fiir Bildung, Kultur und Wissenschaft name
Geleitwortder Präsidentin der Universität des Saarlandes Professorin Dr. Margret Wintermantel
Professor Dipl.-Ing. Dieter Heinz zum 75. Geburtstag
VorwortDie Architektenfamilie Stengel als Gegenstand baugeschichtlicher Forschung unddenkmalpflegerischer Bemühung seit Karl Lohmeyer
r. FRTEDRTCH JOACHTM STENGET (r694-L787\
Michael SanderFriedrich Joachim Stengel als Landmesser
F r ank-Michael S altenb ergerDie frühen Arbeiten FriedrichJoachim Stengels in Usingen, Heftrich und Grävenwiesbach
Kathrtn EilwardtZur Herleitung und Bedeutung von Stengels Querkirchentypus
Martin KlevvitzDie denkmalpflegerische Erhaltung von Ludwigskirche und Schloß in Saarbrückennach dem zweiten Weltkrieg
Gotthard Kiel3lingDer Fürstenstuhl in der Ludwigskirche zu Saarbrücken
losef BauligDer ehemalige barocke Schloßgarten in Saarbrücken - Denkmalpflegerische Aspekte bei der Umgestaltung
Marto TitzeStengels Entwurf ftir Schloß Dornburg - Interpretation und kunstgeschichtlicher Rang
Georgi SmimovDer Fund von Bauplänen des L8. Jahrhunderts für Schloß Dornburg
H an s - C hri sto p h D itts ch ei dSchloß Dornburg an der Elbe - FriedrichJoachim Stengels profanes Meisterwerk im Licht neu entdeckterOriginalentvrnirfe aus der Ermitage in St. Petersburg
lohannes KornowZur Nutzung des Schlosses Dornburg an der Elbe seit seiner Privatisierung
Reinhard SchneiderEin saarländisches Sanssouci - Das untergegangene Neue Schloß in Neunkirchen
Georg SkaleckiDas sogenannte ,,Witwenpalais" in Ottweiler - neue Erkenntnisse
Frank Schneider und Chrtstuf TrepeschUntersuchungen zur Rokoko-Skulptur der Stengel-Zeit - Zum Werk des böhmischen BildhauersJohann Wenzel Grauer
9
11
1,3
t9
27
33
47
63
83
85
115
1.23
155
165
55
7l
ls
rr. JOHANN FRTEDRTCH STENGEL (1746-L83O ?)
Oranna Dimmig
Johann Friedrich Stengel - Fürstlicher Baumeister in Nassau-Saarbrücken von L769 (?) bis L774
Georgi Smirnov
Johann Friedrich Stengel als Architekt in Twer
Swetlana W. Ka zakova-D allmannZurTätigkeit des Architekten Fjodor Fjodorowitsch Stengel in St. Petersburg
III. BALTHASAR WILHELM STENGEL (1748-1828)
Klaus GüthleinBalthasar Wilhelm Stengels Theaterbauten und Theaterentvyüde 21.9
Minoti PaulDie untergegangenen Bauten des Dianenhains (Ludwigsberg im Licht der Dokumente -Das Freilichttheater des Dianenhains 231
OrcnnaDimmigPläne zum Wiederaufbau des Saarbrücker Schlosses von Johann Adam Knipper d. A. 1805und Balthasar Wilhelm Stengel 1806/07 241
Literaturverzeichnis 255
Autorenverzeichnis 267
Schriften- und Werkverzeichnis Dieter Heinz 269
Farbtafeln 275
t75
t9r
zl7
6 l lnHnlrsvERZErcHNrs
Kathrin Ellwardt
ZUR HERLEITUNG UND BEDEUTUNG VON
STENGELS QUERKIRCHENTYPUS
Der Typus
In den Fürstentümern Nassau-Usingen und Nassau-Saar-brücken ist ein erstaunliches Phänomen zu beobachten:An unterschiedlichen Orten des Landes, teilweise weitvoneinander entfernt, welrden über einen Zeitraum vonrund 60 Jahren Kirchen gebaut, die einander so ähnlichsehen, daß man geneigt ist, von einer landestypischenSakralarchitektur zu sprechen. Dieser Nassau-Usingen-Saarbrückensche Kirchentyp ist untrennbar mit demNamen des Baudirektors Friedrich Joachim Stengel ver-bunden.DerTypus, der anhand der realisierten Bauten vorgestelltwerden soll, wirft zwei grundlegende Fragestellungen auf.Zunächst ist der Ursprung der Bauform zu klären, die
Quellen, aus denen Stengel schöpfen konnte, als er dieBauform entwickelte. Darüber hinaus ist zu fragen, wel-
Bedeutung dieser Kirchentyp für die Fürstentümeru-Usingen und Nassau-Saarbrücken besitzt. Wenn
einem Herrschaftsgebiet eine so zeichenhafte Bauform
ickelt und eingesetzt wird, dann verbirgt sich mehr
inter als nur der persönliche Stil eines Architekten.kteristisch fi.ir diese Bauten ist die klare Form des
körpers, die Ubereinstimmung von Innen undEine Breitseite wird durch einen Frontrisalit
1: Crövenwiesboch,Pfarrkirche, Ansicht.
betont, der Turm steht auf der anderen Seite, so daß
schon von außen die innere Raumstruktur deutlich
ablesbar ist. Die kürzere Achse des Baukörpers ist dieHauptachse für Außenbau und Innenraum, es handelt
sich um Querkirchen.l Der Grundriß zeigt einen recht-
eckigen Gemeinderaum, den gegenüber dem liturgischen
Zentrum ein Risalit erweitert. Der Turm wird durch eineMauer abgetrennt, so daß vom Gemeinderaum kein Ein-
blick in den Türmraum möglich ist. Altar und Kanzel ste-hen vor der Turmwand. An den übrigen drei Seiten desRaumes verläuft eine Empore.
Friedrich Joachim Stengel entwickelt diesen Bautyp
während seiner Usinger Zeit für den Neubau der Pfarr-kirche in dem Taunusdorf Grävenwiesbach (Abb. 1).Ende 7736 erhält Stengel den Auftrag, einen Entwurf
nebst Kostenvoranschlag vorzulegen, wonach im dar-auffolgenden Frühjahr mit dem Bau begonnen wird.Bereits am 14. Dezember 1738 kann die Kirche einge-weiht werden.zAnnähernd zeitgleich mit Grävenwies-bach entsteht 1737-L739 der Neubau der Pfarrkirchein Heftrich, wo das Schema der Querkirche in derRaumschale eines traditionellen Längsbaus mit demTurm an einer Schmalseite umgesetzt wird (Abb. 2).
Stengel selbst wiederholt die in Grävenwiesbach gefun-
(Foto: Ellwordt | 993)
133
dene Lösung noch mehrmals, mit Abwandlungen imDetail und in Anpassung an die örtlichen Gegebenhei-ten. Ab 1743 wird in Saarbrücken eine Kirche für die
34 i l . Fnrronrcn Joncnrv SrrNcr l
Abb. 2: Heftrich, ev. Pfonkirche,Ansicht. (Foto: Ellwardt | 993)
reformierte Gemeinde errichtet (Abb. 3).1746 ist der Bauim wesentlichen vollendet bis auf den Turm, der erstL760_7762 fertiggestellt wird. Diese Kirche, die heute denNamen ,,Friedenskirche" trägt, wiederholt das Gräven-wiesbacher Schema in etwas kleineren Dimensionen.Nach der Union der beiden evangelischen Glaubensge-meinschaften wird sie ab I82O zu einer Schule umgebautund eine Zwischendecke eingezogen, so daß von derursprünglichen Innenausstattung nichts erhalten ist.1892 erwirbt die altkatholische Gemeinde das Gebäudeund richtet es wieder als Gotteshaus ein; der Raum erhältnun eine dem katholischen Kultus angemessene Aus-stattung in Längsorientierung. Seit dem Wiederaufbaunach schweren Kriegszerstörungen wird die Friedenskir'che von der altkatholischen und der orthodoxenGemeinde simultan genutzt. Die ganze Struktur desBaukörpers läßt aber kaum einen anderen Schluß zu, alsdaß die originale Raumdisposition der GrävenwiesbacherLösung entsprach und das liturgische Zentrum sich vorder Türmwand befand.3
Die Residenzstadt Saarbrücken wird unter Fürst WilhelmHeinrich in großem Stil umgestaltet. Die Baumaßnah-men gipfeln in der Anlage des Ludwigsplatzes, dessenRandbebauung mit der Kirche im Zentrum ein geschlos-
senes Ensemble bildet. Die Ludwigskirche, StengelsHauptwerk auf dem Gebiet der evangelischen Sakralar-chitektur, entsteht als Pfarrkirche für den Hof und dielutherische Stadtgemeinde in den Jahren L762-1775.Nicht nur von ihren Dimensionen her, sondern auch vonder Ausgestaltung mit den Mitteln der Prachtbaukunst gilt
es folglich, einen wesentlich höheren Anspruch umzu-setzen als bei einer ländlichen Pfarrkirche wie Gräven-wiesbach oder der Kirche einer Minderheit wie der refor-
Abb. 3: Saarbrücken, Friedenskirche, Ansicht. (Foto: Ellwordt 1995)
lr-r,fTTTTn \v m-il-rTiilll l l i l l l l l i l u l l l l i r r i r r rLur| I | | l r iLt_L r I l i i I I
lrllrm= =äll-ilft.tI | l | r t I I | - -_-_-] t__t I i | | i l t I II I l l - l -Lt- ,+-L-- : - - -L- l r - - f -L+t LUI i ;
l r l9 l l i lBl l n l lD I lF l l l lq ld
Abb, 4: lugenheim/Rheinhessen, ev. Pforrkirche, Grundriß.
mierten Gemeinde in Saarbrücken. Der Grundriß derLudwigskirche besitzt die Form eines etwas gestauchtengriechischen Kreuzes, aber grundsätzlich steckt das Gräven-wiesbacher Querkirchenschema noch darin. Der Raumein-
druck entsteht aus der Verschmelzung der beiden Gestal-tungsprinzipien von Kreuzkirche und Quersaal.a
Die Kirche in Jugenheim in Rheinhessen entwirft Sten-gel1768. Nach dreißigJahren greift er hier seinen ersten
Querkirchenbau von Grävenwiesbach in exakt den glei-Proportionen wieder auf. Anstelle der Rechteck-
fenster in einem Haupt- und einem Mezzaningeschoß,
die er in Grävenwiesbach eingesetzt hat, verwendet Sten-gel in Jugenheim hohe segmentbogige Fensterbahnen.
Außerdem verzichtet er auf die Pilasterordnung am Risa-lit. Die Bauleitung liegt zunächst in den Händen seines
Sohnes Johann Friedrich Stengel. Als dieser nach Ruß-land geht, übernimmt Johann Wilhelm Faber das Pro-jekt. Faber beabsichtigt, den Kirchenraum im Inneren als
Llingssaal einzurichten. Das Konsistorium erteilt jedoch
die Anweisung, die Innenausstattung der Kirche sei nach
Stengels Entwurf auszuführen, also in Querrichtung. Bis1775 wird das Kirchengebäude schließlich als Quersaalfertiggestellt (Abb. 4).s
Eine ganze Gruppe von Kirchenneubauten entsteht in
der Grafschaft Saarwerden. Nach langen Verhandlungen
mit dem französischen König Ludwig XV. erreicht Fürst
Mlhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken für seinenI an der Grafschaft Saarwerden 1766 die Aufhebung
des Simultaneums in sechs Gemeinden. In diesen Dör-soll zusätzlich eine zweite Kirche errichtet werden.
den Katholiken die Wahl vorbehalten bleibt, obdie bestehende Kirche übernehmen oder neu bauenlen. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die Kir-
chenneubauten gemeinsam zufinanzieren. Nur in einem
der sechs Dörfer, in Lorentzen, entscheiden sich dieKatholiken für einen Neubau.
Abb. 5: Berg, ev. Pforrkirche, lnnenroum. (Foto: Ellwardt 1999)
Unter den evangelischen Neubauten befindet sich die
Querkirche von Berg, die ebenfalls dem StengelschenGrävenwiesbacher Typus zugehört: Der Bau wird I77Onach einem Entwurf von Friedrich Joachim Stengelbegonnen und bis wahrscheinlich 7773 vollendet.6Sten-gels späteste nachgewiesene Querkirche ist zugleich sei-ne schlichteste, was den Bauschmuck anbelangt. Sie ent-spricht in ihren Großformen und ihrer Innenraumdis-position dem bekannten Schema; allerdings besitzt sienur eine Empore an der Längsseite. Die Verkürzung derFensterbahnen an den Schmalseiten deutet iedoch dar-auf hin, daß die übliche dreiseitige Empore auch hierzumindest geplant gewesen ist.
Zwei weitere späte Querkirchen im Fürstentum Nassau-Saarbrücken entwirft Stengel nicht mehr selbst. Der PIanzu der Kirche in Niederlinxweiler, erbaut 7774-7775,wird seinem Sohn zugeschrieben, wobei es sich um Bal-thasar Wilhelm handeln muß, da sich Johann Friedrichzu iener Zeit bereits in Rußland aufhält. 1784 entstehtdann nahe bei Saarbrücken eine weitere Querkirche inGersweiler nach einem Entwurf von Johann Jacob Lau-temann.T
Herleitung des TYpus
Die Pfarrkirche in Grävenwiesbach, die reformierte Kir-che in Saarbrücken sowie die Pfarrkirchen in Jugenheimund Berg folgen demselben Grundriß- und Raumsche-ma, dessen Ursprung eindeutig festzustellen ist (Abb. 4,Abb. 5). Friedrich Joachim Stengel hat seinen Typusanhand einer Schrift des Architekturtheoretikers Leon-hard Christoph Sturm entwickelt.sSturm veröffentlicht 77IB seinen Traktat ,,VollständigeAnweisung alle Arten von Kirchen wohl anzugeben."Darin spielt er alle möglichen geometrischen Grundriß-figuren durch und kommt zu dem Schluß, die am besten
Zun HERLETTUNC uNo BroruruNC voN srENCrls QuennRCHENTypus I fS
für eine protestantische Kirche geeignete Form sei derquergerichtete rechteckige Saal: ,,Aber dieses ist hingegengewilS / dalS keine Figur auszudencken ist / so ztt innerer
bequemen Eintheilung / uttd ztt guter Bedachung so geschickt
ist / als diese Figur ... / dal3 ich nicltt zweiffle / es werden alle
raisonable Gemiither / wenn sie die Sache wohl iiberlegen
hinkiinffiig dieser Figur mit mir den Vorary vor allen geben."e
Sturms Entwurf zeigt einen rechteckigen Quersaal von 9
Abb. 6: Entwurf zu einer
Querkirche von LeonhordChristoph Sturm aus dessenTroktot von 1718, Ansicht derH o u ptfo ssode u nd C ru nd riß.(aus: Herzog August BibliothekWolfenbüttel: Uf4" 1 2 6)
l . FnrronrcH JoncHrv StrNcer
zu 3 Achsen mit Frontrisalit und rückwärtigem Turm
(Abb. 6). Die Fassade wird über einem Sockelgeschoß von
einer korinthischen Kolossalordnung gegliedert. Das
niedrige Walmdach verschwindet optisch hinter einer
Abb.7: Entwurf zu einer Quer-kirche von Leonhqrd ChristophSturm aus dessen Troktot von1718, Quer- und Löngsschnitt.(ous: Herzog August BibliothekWolfenbütteL Uf4' 1 2 6)
Balustrade. Ein Dreiecksgiebel betont den dreiachsigen
Frontrisalit, in dessen Sockelzone drei Portale in die Kir-
che führen. Zwei weitere Portale setzt Sturm in die Mit-
te beider Schmalseiten. Die Fensterachsen bestehen aus
t /
hohen rechteckigen Fensterbahnen mit quadratischenMezzaninfenstern darüber. Im Innenraum erhalten Altar,Kanzel und Orgel ihren PIatz vor der Turmwand (Abb.
7). Die Proportionen des Rechtecksaales sind mit rund2,6:l stark in die Breite gestreckt. Dadurch kann Sturmdie Emporen mittels Sprengwerken stützenfrei zwischenden Wänden einspannen. Der Risalit nimmt die herr-schaftliche Loge auf, die von außen über Freitreppen zuerreichen ist. Durch die tiefen Emporenanlagen bleibt inder Mitte nur ein relativ kleiner, annähernd quadrati-
scher Freiraum ausgespart. Mit Hilfe von Sichtl inienführt Sturm im Längsschnitt vor, daß von iedem Platzauf und unter den tiefen zweigeschossigen Emporen freieSicht zur Kanzel besteht. Damit weist er nach, daß eineseiner wesentlichsten Forderungen, die er schon in sei-nem ersten Traktat zur protestantischen Kirchenarchi-tektur formuliert hat, von diesem Entwurf erfüllt wird:
,,Denn dqs Allervornehmste / was darinnen geschiehet / istdas Predigen / bey deme allezeit eine grosse Menge des Volckszusammen kömmt / welche alle den Prediger nicht nur gerne
deutlich hören / sondern auch sehen wollen / dazu dennordentlich eingetheilete Sitze nöthig 5in6l.tr \{t
In einer Querkirche, so rechnet Sturm vor, läßt sich beigleicher Grundfläche die größtmögliche Zahl von Sitz-plätzen mit guten Sicht- und Hörbedingungen anordnen.Die Querkirche ist nach frühneuzeitl icher Auffassungbesonders geeignet für den evangelischen Gottesdienst.Eine katholische Kirche braucht einen abgetrenntenChorraum, zu dem nur die Priester Zutritt haben. Ebendies entfällt bei den Evangelischen. Gemäß Luthers Leh-re vom Priestertum aller Gläubigen hat der Pfarrer im
Gottesdienst zwar besondere Aufgaben, aber er gilt alsTeil der Gemeinde, die als Gemeinschaft der Gläubigenverstanden wird. Die Gemeinde soll sich daher, zumin-
dest in der Theorie, um das liturgische Zentrum herumversammeln. Die lange Predigt in den evangelischenGottesdiensten macht die Aufstellung von festemGestühl notwendig. Den Kreis um den Altar und die Kan-zel ganz zu schließen, so daß ein Teil der Gemeinde imRücken des Predigers säße, wäre wenig günstig, aber imHalbkreis bzw. von drei Seiten in einem rechteckigenRaum lassen sich wesentlich mehr Sitzplätze in ausrei-chender Nähe zuKanzel und Altar anordnen als in einemlängsgerichteten Raum mit hintereinander stehendenBankreihen. Durch das Einziehen von einer oder meh-reren zusätzlichen Horizontalebenen gewinnt man nochmehr Plätze. Sturm verwendet in seinem Entwurf zweiausgesprochen tiefe Emporengeschosse, um die Zahl derverfügbaren Sitzplätze bis an die Grenzen des Möglichenzu steigern.Sturm entwirft in seiner Schrift keine ländliche Pfarrkir-che, sondern eine Hof- und Pfarrkirche für eine Resi-
denzstadt, die einer wesentlich größeren Gemeinde Platzbieten muß. Zu den grundsätzlich vorhandenen Aus-stattungsstücken Kanzel, Altar, Orgel, Gemeindegestühlund -empore kommt in einer Residenzkirche noch ein
38 i l . FnrEDRrcH loncHrvr SreNcrr
weiteres Element, für das ein adäquater PIatz im Kir-
chenraum gefunden werden muß: der Herrschaftsstand.Dem Landesherrn als oberstem Kirchenherrn und Lan-
desbischof, der an der Spitze der Rangordnung in derGemeinde steht, gebührt der akustisch wie optisch bestePlatz in der Kirche. Die Lösungsmöglichkeiten sind viel-fältig. Die herrschaftliche Loge kann auf der Westempo-re gegenüber vom liturgischen Zentrum plaziert werden,was in Längsräumen den Nachteil hat, daß der Abstandzum gottesdienstl ichen Geschehen sehr groß ist, oder
seitlich, entweder auf der Empore oder unten im Schiff,wodurch aber die Hauptachse des Raumes verlassen wird,In einem quergerichteten Kirchenraum ergibt sich deroptimale Ort für die Herrschaftsloge geradezu von selbst:in der Hauptachse, gegenüber dem liturgischen Gesche-hen und trotzdem in nicht zu großem Abstand, da dieMittelachse die kürzere Achse des Raumes darstellt. Die
beiden gleichermaßen erwünschten Vorzüge - Nähe undSymmetrie -, die in einer Längskirche gegeneinander
abgewogen werden müssen und immer nur zu Kompro-mißlösungen führen können, lassen sich in einer Quer-kirche problemlos realisieren. Daher sind Querkirchenbesonders geeignet für Residenzkirchen, die für eine Hof-gemeinde und zugleich eine Stadt- oder Dorfgemeinde
ausreichend Platz bieten müssen und in denen ein Herr-
schaftsstand in bevorzugter Lage benötigt wird.rr
Es handelt sich demnach bei der Querkirche zum einenum eine typisch evangelische Raumform, die vonLutheranern wie Reformierten gleichermaßen verwen-
det wird, und zum zweiten um eine besonders geeigne-
te Form für Kirchen, die in irgendeiner Weise von derLandesherrschaft genutzt werden. r2
Grävenwiesbach und Heftrich:Ein Idealentwurf und eine Variante
Kehren wir zurück zu Stengels ersten beiden Querkirchenim Fürstentum Nassau-Usingen. Grävenwiesbach stellteine Umsetzung des Querkirchenentwurfs von Leonhard
Christoph Sturm aus dessen Traktat von 1718 dar, her-
untergefahren auf das Niveau einer dörflichen Pfarrkir-
che. Der Bau ist in den Dimensionen nicht nur wesent-
lich kleiner als Sturms Entwurf, sondern es entfällt auchder ganze herrschaftliche Apparat. An die Stelle des Herr-
schaftsstandes auf der Empore wird in Grävenwiesbachdie Orgel gesetzt (Abb. B). Die Fassaden werden weniger
aufwendig gestaltet. Statt der korinthischen Pilasterord-nung an den Fassaden von Sturms Residenzkirche ver-wendet Stengel für seine beiden frühen Dorfkirchen inGrävenwiesbach und Heftrich ganz lehrbuchgemäß zurAuszeichnung der Risalite die toskanische Ordnung.Damit folgt er der Anweisung von Nicolaus Goldmannzum Gebrauch der Säulenordnungen an Kirchenbauten:
,,Man kann zwar die Kirchen au[3 allerhand Ordnungen bau-
en / iedoch mit dem Unterschiede / auff den Dörffirn kannman aulSen die Tuscanische Art gebrauchen / in den Flecken
Abb.8: Grövenwies-boch, ev. Pfarrkirche,lnnenroum. (Foto:Ellwordt 1993)
Abb. 9: Heftrich, ev.Pforrkirche, I nnenrou m.(Foto: Ellwardt 1993)
die Dorische / in den kleinen Stödten die Ionische / in denFürstlichen Hoff-Städten die Römische / aber in den Haupt-Stödten die Corinthische.t/ t't
In Heftrich steht der Turm an einer Schmalseite desGemeinderaumes, so daß von außen gesehen die Längs-achse des Baukörpers als Hauptachse erscheint. Der Kir-chenraum im Inneren ist jedoch quergerichtet. Vor bei-de Längsseiten sind Risalite mit Dreiecksgiebeln undtoskanischen Pilastern gelegt, welche die Hauptachse desInnenraumes am Außenbau andeuten. Im Inneren wird
ein Risalit durch eine hölzerne Kanzelwand abgetrennt,welche die Kanzel trägt (Abb. 9). Der Altar steht frei davor.Die Orgel steht wie in Grävenwiesbach der Kanzel gegen-über auf der Empore, welche drei Seiten des Raumesumspannt und nur einen kleinen, fast schachtartig wir-kenden Freiraum in der Mitte ausspart. Die Kirche istschon in ihren Abmessungen deutlich kleiner, aber durchdie tiefe Emporenanlage wirkt sie erst recht noch beeng-ter als der lichte, großzügige Saalraum in Grävenwiesbach.Beide Kirchen sind annähernd gleichzeitig geplant undgebaut worden. Für beide Bauten l iegen schon erste Pla-
Zun HFRLEUUNC tJNo BrnturuNC, \ / ( )N \rrN(, i r r Ql ; tRtcl l l i \ l \ r )15 39
nungen durch Johann Jakob Bager vor, als Stengel dieProjekte übernimmt. Ende 1736 erhält Stengel den Auf-trag, die Grävenwiesbacher Kirche zu entwerfen; am 1.März des folgenden Jahres werden die Zeichnungennebst Kostenüberschlag dem Fürsten zur Approbationvorgelegt. Bereits im Februar 1737 präsentiert Stengel denRiß für Heftrich, der am l. März nach Idstein übersandtund erst danach, unmittelbar vor der Grundsteinlegurg,vom Fürsten approbiert wird. Stengel ist aber schon 7734mit dem Heftricher Projekt befaßt, als er die alte Kirchein Augenschein nimmt, aber zunächst von einem Neu-bau nach Bagers Riß ausgeht, welcher allerdings nochüberarbeitet werden müsse. ra
Anhand der Bauakten läßt sich nicht eindeutig ermit-teln, welcher der beiden Entwürfe zuerst entstanden ist.Hat Stengel den Idealentwurf für Grävenwiesbach erstelltund sich in Heftrich an einer Variante versucht, oder hater für Heftrich die Vorgabe bekommen, einen nachaußen hin traditionell längsgerichtet erscheinenden Bauzu entwickeln, und hat die dort gefundene Innenraum-und Fassadenlösung schließlich in Grävenwiesbach kon-sequent ausarbeiten können? Von wem die Vorgabe aus-geht, daß in Heftrich ein Bau entstehen soll, der vonaußen der althergebrachten Kirchenform mit dem Turman einer Schmalseite entspricht, während im Inneren die
,moderne' Raumform des Quersaales zur Anwendungkommt, läßt sich ebensowenig ermitteln wie die Grün-de, die zu dieser Entscheidung führen. Tatsache ist, daßder Gemeinde Heftrich im Vergleich zu anderen Kir-chenneubauten jener Zeit außergewöhnlich viel Mit-spracherecht zugestanden wird. rs
Während Stengel für Grävenwiesbach den IdealentwurfSturms ungehindert umsetzen kann, ist dies in Heftrichoffenkundig nur versteckt möglich - oder aber es handeltsich um eine Weiterführung von Sturms Gedanken, indemStengel die Idealvorstellungen Sturms in Rahmen des tra-ditionellen Längskirchentyps zu verwirklichen sucht.Georg Skalecki liefert eine neue Interpretation zu Sten-gels ersten Querkirchenbauten in Heftrich und Gräven-wiesbach. Seiner Ansicht nach liegen beiden Bauten älte-re Pläne von WerkmeisterJohannJakob Bager zugrunde,die Stengel lediglich überarbeitet und dabei leicht abge-wandelt habe.16 Diese Deutung ist iedoch m. E. nichtschlüssig. Zwar hat Stengel in Heftrich tatsächlich einenEntwurf Bagers verwendet und überarbeitet: ,,Die Heftri-clrcr Kirche kan nctch des Bagers Ri[3 und Überschlag gar wohlvor 18 bilS höchstens 19 htutdert Gulden erbauetwerden, wobeinoch ein wtd anderes in diesem Ril3 zu verbef3ern stünde."l7Daß Bagers Plan für Heftrich jedoch bereits eine Quer-kirche vorgesehen haben sollrs, halte ich für unwahr-scheinlich. Zu Bagers Zeiten ist in Nassau-Usingen, Wies-baden und Idstein keine einzige Querkirche entstanden.Heftrich ist eine Kompromißlösung, die sich sehr wohldamit erklären ließe, daß Stengel einen älteren, nicht vonseiner Hand stammenden Entwurf überarbeitet hat, d. h.den Plan von Bager. Die Bauform legt nahe, daß Bager
einen längsgerichteten Saal mit dem Turm an einerSchmalseite vorgesehen hatte, dessen Großform Stengelbeibehalten mußte. Von Stengel hinzugefugt wären dem-nach die Fassadenrisalite an beiden Längsseiten mit demaufgeblendeten Portikusmotiv, das so große Ahnlichkeit
mit der Grävenwiesbacher Fassade aufweist, und mit ziem-
licher Sicherheit die Querrichtung im Inneren. Dennoch
besteht keinerlei Zweifel, daß Stengel den zur Ausführung
bestimmten Entwurf ftir Heftrich erstellt und die Bauar-
beiten überwacht hat, daß mithin der Kirchenbau in Hef-
trich auf jeden Fall Stengel zuzuschreiben ist.
Grävenwiesbach versteht Skalecki als leichte Variation derin Heftrich durchgeführten ldee.re Die Kirche in Gräven-wiesbach zeigt jedoch eine so klare, konsequente Durch-
fuhrung eines Bau- und Raumideals, daß der ganze Planwie aus einem Guß erscheint, ohne Kompromisse undAnpassungen. Er ist nur erklärbar anhand des Idealent-
wurfs von Leonhard Christoph Sturm aus dessen Traktatvon 1778. Zudem hat Stengel für Grävenwiesbach nach-
weislich einen eigenen neuen Entwurf erstellt.20Der Blick auf den Traktat eines Architekturtheoretikersreicht aber auch für Grävenwiesbach zur Erklärung nicht
aus. Der grundsätzliche Gedanke, evangelische Kirchen-räume in Querrichtung zu orientieren, ist nämlich um1736Iängst nicht mehr unbekannt, da bis dahin in dernäheren und weiteren Umgebung von Nassau-Usingen
schon mehrere Querkirchen errichtet worden sind.Die bekannteste unter ihnen ist die Weilburger Schloßkir-che, erbaut 7707-13 nach einem Entwurf des nassau-weilburgischen Landbaumeisters Julius Ludwig Rothweil,
die mitunter als angebliches Vorbild zur Ableitung von
Stengels frühen Querkirchen herangezogen wird.2' DieResidenz des Grafenhauses Nassau-Weilburg wird unterGraf Johann Ernst ab 77OZ bis zu seinem Tod 1779 ingroßem Stil ausgebaut. In Rothweils Händen liegt die Lei-tung des gesamten Großprojekts, zu dem der Bau einerneuen Hof- und Stadtkirche gehört. Der annähernd qua-
dratische Baukörper, der die Kirche, den Turm und dasstädtische Rathaus in einem Block zusammenfaßt, wird
durch die Obere Orangerie an das Kernschloß angebun-den und stellt den Höhepunkt der Stadtsilhouette dar. In
die von außen richtungslose Mauerschale setzt Rothweileinen quergerichteten Kirchenraum mit Nebenräumenhinein, der - das ist seine Besonderheit - keine offenenEmporen besitzt, sondern Logen für die Angehörigen desHofes und der Geistl ichkeit. An den Längsseiten des Saa-les werden mittig halbkreisförmige Konchen angefügt,die den Kanzelaltar und gegenüber die herrschaftl icheLoge aufnehmen.22Die Schloßkirche in Weilburg als Anregung und Vorbild,
als Erklärungsmuster für Stengels Querkirchentyp her-
anzuziehen, erscheint jedoch sehr weit hergeholt, denndie Gemeinsamkeiten zwischen Weilburg einerseits undHeftrich und Grävenwiesbach andererseits sind nur sehrallgemeiner Art und bestehen lediglich in der Querrich-tung des Gottesdienstraumes. Abgesehen davon ist Weil-
40 l . FnreonrcH JoncHrv SrrNcrr
Abb. 10: Wölfersheim,ev.-ref . Pfarrkirche, Ansicht(Foto: Ellwardt 1993)
burg keineswegs das einzige querorientierte Gotteshaus,
das vor 1737 in der wei teren Umgebung von Usingengebaut worden ist. Zu jener Zeit, als Stengel die Pläne für
Heftrich und Grävenwiesbach entwirft, stehen im
Umkreis von dreißig oder vierzig Kilometern bereits ver-
schiedene Querkirchen.
In Wölfersheim in der Wetterau wird 7717 mit dem Bau
einer Querkirche begonnen, die sich durch ihre sehr auf-
wendige Fassade auszeichnet (Abb. 10). Das Projekt über-
steigt bei weitem die Möglichkeiten der kleinen Graf-
schaft Solms-Braunfels und der Gemeinde, so daß die Kir-
che schließlich als Bauruine ohne Dach siebzehn Jahrelang steht, bis dank des Vermächtnisses eines örtl ichen
Adel igen wieder Geld verfügbar ist . Ab 1737 wird der
angefangene Bau schließlich fertiggestellt. Das heißt:
Genau in derselben Zeit, als Stengel seinen Musterent-
wurf erstellt, wird auch am Braunfelser Hof intensiv über
die Einrichtung einer Querkirche diskutiert. Der Auftraggeht zunächst an den Bauschreiber Johann Wüstenfeld
in Laubach, dessen Pläne jedoch auf Mißfallen stoßen.
Ein zweiter Architekt wird beauftragt, der Braunfelser
Baudirektor Johann Ludwig Knoch, der schließlich den
endgültigen Entwurf für die Innenausstattung liefert.2:r
Aufgrund der geringen Entfernung von Braunfels nach
Usingen wäre es nicht unwahrscheinlich, daß es zwi-
schen den benachbarten Höfen Kontakte gegeben haben
könnte, zumal die endgültige Lösung in Wölfersheim in
manchen Details an Grävenwiesbach erinnert, auch
wenn Nassau-Usingen lutherisch war und Solms-Braun-
fels reformiert.
In der Grafschaft Hanau-Münzenberg ist zwischen 77 72
und 1736 ein regelrechtes landesherrl iches Kirchenbau-programm zuverzeichnen. Die Grafschaft mit ihrer über-wiegend reformierten Bevölkerung steht seit 1642 unter
der Regentschaft des lutherischen Grafenhauses Hanau-Lichtenberg. Der letzte Lichtenberger Graf, Johann Rein-
hard I I I . , bemüht s ich vor al lem in den letzten Jahrenseiner Regierung bis zu seinem Tode 1736, die lutheri-
sche Minderheit im Lande so weit wie möglich zu för-
dern. In den 24 Jahren seiner Regentschaft werden in
Hanau-Münzenberg insgesamt 15 Kirchenneubauten für
lutherische Gemeinden errichtet, die zum Teil erst seit
wenigen Jahren bestehen. Für ein relat iv einhei t l iches
Erscheinungsbi ld dieser Kirchen sorgt der hanauische
Baudirektor Christian Ludwig Hermann. Auffallender-weise sind die größten und bedeutendsten unter diesen
sogenannten,,Reinhardskirchen" querger ichtet . Her-
manns erste Querkirche ist die lutherische Pfarrkirche in
Steinau a. d. Straße, die von 1724-L731 in einer Vorstadt
erbaut wird; aufgrund der Bestimmungen des Hanaui-
schen Religions-Recesses von 1670 und des Widerstan-
des der reformierten Bevölkerungsmehrheit dürfen die
Steinauer Lutheraner nicht innerhalb der Stadtmauer
bauen. In Steinau besi tzt d ie Landesherrschaft e in
Schloß, das mehreren Hanauer Gräfinnen als Witwen-
sitz dient. Steinau ist dadurch als Nebenresidenz einzu-
stufen; die Kirche wird gelegentlich auch vom Hofgenutzt. Da der'Iurm an der Schmalseite steht, erscheint
sie von außen wie ein traditioneller Längsbau, doch der
Raum im Inneren ist quergerichtet, was der Fassadenri-
salit an der Eingangsseite schon andeutet. Die lutheri-
1tt ; , 1 l r t t l t t t t tN(, I 'Ni t Bt t ) f t r t i l t \ ( , ' , ' { ) 41
sche Pfarrkirche in der Altstadt von Hanau, heute Alte
Johanneskirche genannt, ist ein längsgerichteter Saalbaumit dreiseitigem Schluß aus dem 17. Jahrhundert, der ab1727 nach der Seite erweitert und gedreht wird, so daßdie Querachse zur neuen Hauptachse wird. Das Gottes-haus dient nicht nur als Pfarrkirche für die lutherischenEinwohner der Hanauer Altstadt, sondern zugleich alsHofkirche und Grablege des Grafenhauses.Diesen beiden in höfischem Zusammenhang stehenden
Querkirchenbauten folgen zwei ländliche lutherischePfarrkirchen in dem hanauischen Amt Rodheim, das alsExklave unmittelbar am Fuße des Täunus liegt, also nichtallzu weit von Usingen entfernt: Ober-Eschbach(1728-1731) und Rodheim v. d. Höhe (1732-1738). Bei-de wurden von Christian Ludwig Hermann entworfen.Die Kirche in Ober-Eschbach, ein Gebäude über demGrundriß eines gestreckten Achtecks mit einem Dachrei-ter in der Firstmitte, läßt ihre innere Querrichtung höch-stens dadurch erkennen, daß sie mit der Breitseite zurStraße steht. Dagegen zeigt Hermann in Rodheim kon-sequent die innere Querrichtung auch schon von außen(Abb. 11). Das Kirchengebäude der Rodheimer Luthera-ner steht ebenfalls in einer Häuserzeile mit der Längs-
Abb. 11: Rodheim v. d. Höhe, ev. Pforrkirche, Ansicht. (Foto: Ellwordt1 ees)
seite an der Straße, und es erhält zudem einen Fassa-denturm, der die Querachse des Baukörpers nach außenbetont. Die vier vorgestellten Kirchen werden sämtlichfür lutherische Minderheiten in mehrheitlich von Refor-mierten bewohnten Ortschaften erbaut, wobei Konflik-te zwischen den beiden evangelischen Bekenntnisgrup-pen nicht ausbleiben.2a
Auch in Nassau-Dillenburg und in den hessischen Land-grafschaften sind bereits vor 1736 Querkirchen gebautworden. Stengels Bauten stehen in dem Gebiet zwischenLahn- und Dilltal, Taunus, Wetterau, Vogelsberg und Kin-zigtal als Querkirchen keineswegs allein auf weiter Flur.Die Idee liegt sozusagen in der Luft.
Abgesehen davon existiert in der Residenzstadt Usingenselbst schon längst ein quergerichtetes Kirchengebäude.2sIm Zuge der Anlage der Usinger Neustadt ist für die refor-mierten Neubürger, keineswegs nur Hugenotten, ab 1700
ein eigenes Gotteshaus gebaut worden. Die Fassade mitdem polygonalen Turm besitzt Ahnlichkeiten mit einigenHugenottentempeln in Frankreich (2. B. Montpell ier).Das Bauwerk hat eine ähnlich wechselvolle Geschichtevon Umbauten hinter sich wie die Saarbrücker Friedens-kirche, über die ursprünglich geplante Inneneinrichtunggibt iedoch ein Plan des Architekten Benedikt Burtscheraus der Erbauungszeit Auskunft. In dem rechteckigenRaum waren Kanzel und Abendmahlstisch dem Turm-eingang gegenüber an der rückwärtigen Längswand pla-ziert. Gemeindeemporen waren nicht vorgesehen, ledig-lich eine kleine Empore an der inneren Turmwand, diewohl für eine Orgel bestimmt war.26
Stengels Querkirchen in Grävenwiesbach und Heftrich,die eine als konsequente Umsetzung eines Idealentwurfs,die andere als Anwendung von dessen Prinzip in einertraditionellen Raumschale mit dem Turm an einerSchmalseite, nehmen folglich eine Entwicklung in derprotestantischen Sakralarchitektur auf, die im zeitl ichenund regionalen Umfeld betrachtet werden muß.An den genannten Beispielen in Nassau-Weilburg, Solms-Braunfels und Hanau-Münzenberg (und gleichfalls beizahlreichen anderen Kirchenneubauten in diesen undweiteren Territorien) ist zu beobachten, daß die jeweil i-
gen Landesherren und ihre Regierungsbehörden massivin die Planung von Kirchenbauten eingreifen. Von derReformationszeit bis ins 18. Jahrhundert sind die evan-gelischen Landesherren zugleich die Landesbischöfe undobersten Kirchenherren in ihren Territorien. Religions-angelegenheiten sind Bestandteil herrschaftl icher Poli-tik. Kirchenbauten gelten als herrschaftliche Bauaufga-be und unterstehen der Kontrolle des Landbauwesensund des Konsistoriums. Ohne die Genehmigung des Lan-desherrn wird keine Kirche gebaut, in der Regel müssenihm die Entwürfe vorgelegt werden. Zu fragen ist somitnicht nur nach dem persönlichen Stil eines Architekten,
42 l . FnrEDRrcH loncHrrvt Sre Nce I
sondern zunächst und vor allem nach den Ansprüchender Auftraggeber, d. h. des Regenten und seiner Kir-chenbehörde. Stengels Auseinandersetzung mit den Ent-würfen von Leonhard Christoph Sturm dürfte auf einemAuftrag beruhen.
Kirchenarchitektur als Herrschaftszeichen
Mit Stengels Entwurf für Grävenwiesbach hat man nachMeinung des obersten Kirchenregiments in Nassau-Usin-gen und -Saarbrücken offensichtlich den ,idealen' Bau-typ gefunden, das beweist seine häufige Wiederholung.
Er wird in der Folgezeit bewußt und zeichenhaft einge-setzt in der Residenz Saarbrücken und im Grenzgebiet zuanderskonfessionellen Territorien.Eine ganz ähnliche Entwicklung ist in Nassau-Weilburgzubeobachten. Die beiden Landbaumeister Stengel undRothweil hinterlassen ein ähnlich vielfältiges CEuvredurch alle Bauaufgaben hindurch. Im Kirchenbau ent-wickelt jeder von ihnen einen vorbildhaften Bautypusftir evangelisch-lutherische Kirchen, in beiden Fällenquergerichtet. Dieser wird bei späteren Bauten innerhalbdes Landes in Abwandlungen wiederholt, auch von
anderen Architekten, und wird zum ,Markenzeichen' desKirchenbaus in dem betreffenden Territorium. Die Ent-wicklungen in Nassau-Weilburg und Nassau-Saarbrückenverlaufen zeitlich etwas versetzt, aber zunächst weit-gehend unabhängig voneinander.
Im Unterschied zu den Usingen-Saarbrückenschen Lini-
en ist Nassau-Weilburg zwischen dem Dreißigiährigenkieg und dem Wiener Kongreß nicht von Landestei-lungen betroffen. Graf Johann Ernst läßt im Zuge desAusbaus seines Schlosses und seiner Residenzstadt inWeilburg eine neue Hof- und Stadtkirche errichten, dievon ihren Dimensionen und ihrem architektonischenAnspruch her die Erfordernisse des dortigen Hofes erheb-lich übersteigt. Während ftir die Bürgerinnen und Bür-ger die Sitzplätze im Erdgeschoß von Anfang an nichtausreichen, steht der größte Teil der Logen jahrzehnte-
langleer, weil die wenigen adeligen Höflinge bei weitem
nicht so viele Plätze benötigen. Erst mit dem Erlaß einerneuen Stuhlordnung im Jahr 1736 müssen die Hofbe-dienten bürgerlichen Standes, die bis dahin unten zu sit-zenhatten, gegen ihren Willen in die Logen umziehen.zTDer Anspruch, der mit diesem großangelegten Baupro-jektformuliert wird, ist nur vor dem Hintergrund der vonNassau-Weilburg angestrebten Reichsfürstenwürde zuverstehen, dieJohann Ernst zwar 1688 schon angetragenworden ist, die er aber im Unterschied zu Nassau-Usin-gen und Nassau-ldstein wegen des damit verbundenen
Kostenaufwandes damals abgelehnt hat.Als Johann Ernsts Sohn Carl August, der 1737 schließ-lich die Reichsfürstenwürde erhalten hat. sich anstellevon Weilburg eine neue Residenz im linksrheinischen
heimbolanden aufbaut, gehörtdazu auch eine neueHofkirche (errichtet 1739-1744), welche das Weilburger
Vorbild in geringfügig veränderter Fassung wiederholt.Die Kirche der alten Residenz wird gleichsam in die neueResidenz versetzt als Symbol ftir die Kontinuität der Herr-schaft des Grafenbzw. Fürsten von Nassau-Weilburg. CarlAugust betont damit sein Selbstverständnis als Nachfol-ger seines Vaters. Zwar wechselt der Hof seinen Haupt-wohnsitz, aber die Hofgesellschaft bewegt sich zumin-dest in ihrer Kirche nach wie vor in (fast) derselben Archi-tektur.Ab etwa 17 40 bis zum Ende des 18. Jahrhunderts werdenin Nassau-Weilburg eine Reihe von Landkirchen als
Querkirchen errichtet, sowohl in der Umgebung vonWeilburg (Neunkirchen/Westerwald 17 39-774 1, Kubach1763, Atzbach 1766-1767, Gräveneck 7777) als auch umKirchheimbolanden (Göllheim L7 65, Albisheim 1792).Dabei werden Bauformen gewählt, die sich immer mehran Stengels Typus angleichen.Mit dem Bau der Weilburger Schloß- und Stadtkirchewird der Querkirchentypus in Nassau erstmals verwirk-licht, erfährt aber nicht sofort weitere Verbreitung. Erstab dem Ende der 1730er Jahre entstehen weitere Quer-kirchen: Grävenwiesbach, Heftrich und die reformierteKirche in Saarbrücken einerseits, Kirchheimbolandenund Neunkirchen andererseits. Julius Ludwig Rothweilhat in Weilburg eine sehr spezielle Grundriß- und Raum-form konzipiert, die nur für die Residenzkirche in Kirch-heimbolanden wieder aufgegriffen wird. Gleichzeitig bzw.sogar etwas früher entwickelt Stengel seine Idealformanhand der Entrutirfe von Leonhard Christoph Sturm. Dasoft postulierte Abhängigkeitsverhältnis Stengels von denBautenJulius Ludwig Rothweils in der Grafschaft Nassau-Weilburg, vor allem von den Residenzkirchen in Weilburgund Kirchheimbolanden, greift also nicht.Dennoch ist auffallend, daß sich in den nassau-walrami-schen Grafschaften im weiteren Verlauf des 18. Jahrhun-derts ein relativ einheitlicher Querkirchentypus heraus-kristallisiert, da auch in Nassau-Weilburg in der zweiten
Jahrhunderthälfte Bauten entstehen, die dem späten Sten-gel-Typ immer ähnlicher sehen. Bis ins unmittelbare Vor-feld der Französischen Revolution und der Revolutions-kriege werden Kirchen dieses TYps sowohl in Nassau-Saar-brücken (Berg I77O-I773, Niederlinxweiler 177 4-177 5,Gersweiler 1784) als auch in den linksrheinischen Besit-zungen Nassau-Weilburgs (Albisheim 1792) realisiert.
In Neusaarwerden, das bei der Teilung der GrafschaftSaarwerden im Jahre 7745 an Nassau-Weilburg gekom-men ist, wird ftir die reformierte Gemeinde der Stadt von1750-1751 die erste eigene Kirche errichtet.Zs Dem recht-eckigen Quersaal mit einem unvollendeten Turm an derRückseite fehlt allerdings der ansonsten charakteristischeFrontrisalit, der hier durch die Portalrahmung mit dori-schen Pilastern und Dreiecksgiebel ersetzt wird. Mögli-cherweise liegt das Fehlen des Risalites darin begründet,daß der rechteckige Baukörper in einer Flucht mit derübrigen Bebauung des Straßenzuges stehen soll. Der Ent-
Zun HERLETTUNC uNo BeoeuruNc voN srFNCels QurnnRCHENTypus i 43
wurf zu dieser Kirche wird mit Friedrich Joachim Stengelund dem Saarbrücker Baubüro in Verbindung gebracht.Es sind jedoch bisher keinerlei archivalische Belegebekannt, weder für eine Zuschreibung an Stengel odereinen seiner Mitarbeiter noch an einen Architekten ausdem Nassau-Weilburgischen Landbauwesen, so daß dieUrheberschaft ungeklärt bleiben muß. Ganz gleich, wernun tatsächl ich der entwerfende Archi tekt gewesen ist- festzuhal ten bleibt in iedem Fal l , daß in Neusaar-werden beide Entwicklungsstränge zusammentref fen
und ein Gebäude entsteht, das in beide Reihen hin-einpaßt.Die bei seiner ersten Quersaalkirche in Grävenwiesbachgefundene Lösung, die Weiterentwicklung des Sturm-schen Idealentwurfs, greifen Stengel und seine Auftrag-geber wiederholt auf. Alle diese Kirchen werden im
Gebiet der Grafschaft Nassau-Usingen bzw. Nassau-Saar-brücken errichtet. Stengels Querkirchengruppe mußdaher in engem Zusammenhang mit den landesge-
schichtl ichen Ereignissen betrachtet werden. Aus derkomplizierten Vielfalt von Linienteilungen und Erban-fällen im Hause Nassau sei nur das Folgende herausge-griffen: In den nassau-walramischen Landesteilen beste-hen ab 1728 die beiden Hauptlinien Nassau-Weilburg
und Nassau-Saarbrücken-Usingen. Während der Zeit, alsin Usingen die tatkräftige Fürstin Charlotte Amalie dieVormundschaftsregierung für ihre minderjährigen Söh-ne führt (1718-1735), fa l len zwischen l72I und 1728die Grafschaften Wiesbaden-ldstein, Saarbrücken undOttweiler an Usingen. Bis 1744 bleibt Usingen Residenz,danach ziehen Hof und Regierung nach Biebrich bzw.Wiesbaden um. Charlotte Amalie nutzt die Vergrößerungdes Landes nicht aus, sondern veranlaßt 1735 eine erneu-te Teilung in eine Usinger und eine Saarbrücker Linie.Der ältere Sohn Karl behält Usingen, der jüngere, Wil-helm Heinrich, erhält die l inksrheinischen Gebiete mitSaarbrücken, wo er nach seiner Voll jährigkeit ab 7747selbständig regiert. Damit wird Saarbrücken Residenz
einer neuen Linie. Wilhelm Heinrich hat große Pläne fürden Ausbau von Schloß und Stadt und holt Stengel dafürnach Saarbrücken.Die Saarlande, unmittelbare Nachbarn zu Frankreich,waren von der französischen Reunionspolit ik schwerbetroffen. Von 167918O bis zum Frieden von Riiswijk7697 standen Saarbrücken, Ottweiler, Saarwerden undandere unter französischer Herrschaft, die vielfachgewaltsame Rekatholisierungsmaßnahmen durchführte.Der Friedensvertrag, der zwar die Rechte der Protestan-ten grundsätzlich bestätigte, enthält die folgenschwere
,Rijswijker Klausel'am Ende des Artikels IV in dem Frank-reich sich zur Rückgabe aller außerhalb des Elsaß gele-genen reunierten Gebiete verpflichtet. Diese Klausel lau-
tet: ,,Religione tamen Catholica Romana in locis sis resti-tuis in statu quo nunc est, remanente."2e Der König ver-langte also, daß in den ehemaligen Reunionsgebieten diekatholische Religion in den an ihre ursprünglichen Her-
ren zurückgegebenen Orten in dem Stand zu verbleiben
hatte, in dem sie sich 7697 befand.Frankreichs Anspruch auf eine Vorherrschaft bleibt, auchnachdem Fürst Wilhelm Heinrich 77 66 die letzten strit-
t igen Grenzfragen mit Frankreich durch einenGebietstausch geregelt hat, bis zum Ende des Jahrhun-derts spürbar.:J(t Zwar bemühen sich Wilhelm Heinrich
und sein Sohn Ludwig stets um ein gutes Verhältnis zur
französischen Krone, aber an ihrer evangelisch-lutheri-schen Konfession halten sie fest, wenn auch den Refor-mierten und den Katholiken gegenüber eine tolerante
Religionspolit ik ausgeübt wird. Beiden Minderheitengestattet Wilhelm Heinrich die freie Religionsausübung
und den Bau eigener Kirchen. Trotz aller Toleranz gilt
ihm selbst jedoch die lutherische Konfession als unab-dingbarer Bestandteil seiner dynastischen Identität.:r '
Genug der Veranlassung für den Saarbrücker Fürsten, in
seinem Land so zeichenhaft evangelische Kirchenge-
bäude errichten zu lassen, die von seinem Bekenntnis-
stand und von seiner Herrschaft Zeugnis ablegen. Hierwird nun offenkundig eine bestimmte Architektur zumZeichen der Landesherrschaft und zugleich des religiö-
sen Bekenntnisses, dessen Erhalt mit Mühe gegen einenübermächtigen Nachbarn durchgesetzt werden kann.Das Landbauwesen in Saarbrücken liefert die Entwürfefür diese Kirchen in polit ischen wie konfessionellen
Grenzgebieten. Der Bautypus, der in zwei Taunusdörfernausprobiert und in der Residenzstadt zu höchster Voll-endung gebracht worden ist, wird auf dem Land zei-
chenhaft wiederholt, um die Nassau-SaarbrückenscheKirche von weitem erkennbar zu machen. Sobald es poli-
t isch möglich ist, setzt die nassauische Herrschaft ihreZeichen ins Land, gerade an Orten mit unklaren oderschwierigen Machtverhältnissen. Die Wiederholung desGrävenwiesbacher Typus allein mit dem ,persönlichenStil ' des Landbaumeisters Friedrich Joachim Stengel zu
erklären, führt am Kern der Sache vorbei, zumal bei den
späteren Bauten keineswegs gesichert ist, ob die Pläne
tatsächlich von Stengel selbst stammen. Anzunehmenist eher, daß das Saarbrücker Baubüro Anweisung hat,
den einmal gefundenen Musterentwurf, angepaßt an ört-liche Gegebenheiten, für größere Kirchenbauten so oftwie möglich anzuwenden, während für kleine Landkir-
chen in der Regel der längsgerichtete Saal verwendet wer-
den soll.:r2
Die Ludwigskirche mitsamt der Randbebauung des Lud-wigsplatzes ist ein Architektur gewordenes Herrschafts-zeichen und zugleich ein steinernes Glaubensbekennt-nis des Fürsten. Polit ische Souveränität und religiösesBekenntnis werden gleichgesetzt, da sie beide gleicher-
maßen gegen den mächtigen Nachbarn zu behaupten
sind. In diesem Sinne müssen auch die Kirchenneubau-
ten im Land als ebensolche Zeichen verstanden werdenin dem Bestreben des Bauherren und des Architekten,
eine idealtypisch protestantische Kirchenform zu ver-
44 ' l . FRrronrcH JoncHrrvr SrrNcrL
wenden. Im reformierten Nassau-Dillenburg kommt die
Querkirche nur vereinzelt bei einigen wenigen Dorfkir-
chen zur Anwendung, bei denen keine besondere Ver-
anlassung zu einer hervorstechenden, zeichenhaften
Architektur gegeben scheint. Gemeinsam ist dagegen den
Anmerkungen
I Für den Fachbegriff der Querkirche gibt es keine allgemein ver-bindliche Definition. Ich verwende den Begriff ,,Querkirche"ausgehend von der Disposition des Innenraumes für alle Bau-ten, deren liturgisches Zentrum mit Altar und Kanzel sich aneiner Längsseite des Raumes befindet.
2 Umfangreiche Akten aus der Bauzeit im Hessischen Hauptstaats-archiv Wiesbaden (= HHSTA WI), Abt. 135, Nr. 25, Bd. 1,-2. Ygl.dazu Saltenberger 1984/85 u. ders. 1985, Sp. 229-240.
3 Zimmermann 1932, S. 91-93; Heinz 7967, S. 51-119; Ditt-scheid 1975, S. 185f.
4 Da die Ludwigskirche in diesem Band mehrfach ausführlichbehandelt wird, sei hier auf eine detailliertere Betrachtung ver-zichtet. Zur Forschungslage sei auf die einschlägige Literaturverwiesen, zuletzt Heydt 7997; Skalecki 1995, S. 84-86, beidemit weiterführenden Literaturhinweisen.Dittscheid/Glatz 7982, S. 12-1 8.Dittscheid 1975, S. 188; Dimmig 1987, S. 754-162; Skalecki1995, S. 89; Wilbert 1995, S. 166-169; Toursel-Harster/Beck/Bronner 1995, S.47 f . (Berg), S. 115 (Diemeringen), S. 163 f .(Harskirchen) und S. 215 (Lorentzen).
7 Dittscheid 7975, S. 190; Caspary/GötzlKl inge 7984, S. 311 f.(Gersweiler) u. S. 745 (Niederl inxweiler).
8 Dittschei d 197 5, S. 192 f; Saltenberger 1984/85, S. 92 f.9 Sturm 1718, S.32.10 Sturm 1718, S. 26 t.Ygl. dazu Sturm 7772, worin Sturm eben-
falls einen Entwurf für einen Quersaal vorstellt und die Quer-kirche als eine der am besten geeigneten Grundrißformen fürein evangelisches Gotteshaus propagiert.
11 Kießl ing 1995, S. 760, 1,67,236.12 Zwar spielt das zweite Moment bei Stengels Querkirchen mit
Ausnahme der Saarbrücker Ludwigskirche keine Rolle, da keineHerrschaftsstände vorhanden sind, doch andere Beispiele zeigenhinreichend, daß in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ftir Re-sidenz- und Nebenresidenzkirchen mit Herrschaftsstand geradeim hessisch-nassauischen Raum und dessen Umfeld gern dieQuerrichtung gewählt wird: Weilburg l7O7-7713, Wölfersheim1,717-1747, Wabern 1722-<a. 7726, Steinau 7724-7731, Hanau1727-1729, Langenselbold 7727-7735, Kirchheimbolanden77 39-17 44, Erbach 17 47 -17 50. Pirmasens 17 57 -17 60.
13 Goldmann 7696, S. 1.29.14 Bericht Stengels, 7734 März 6. HHSTA WI, Abt. 133, Nr. 30.
Darin umfangreiche Akten zum Kirchenbau in Heftrich.15 ,,Wir communiciren hier bey den von dahiel3igem Herrschafrlichen
Baumeister über den neuen Kirchenbau zu Hefrrich erstatteten Be-rtcht, samt dem gefertigten abris wd Überschlag, mitt dem Ansinnen,
nassauischen Grafschaften der walramischen Linie, daßsie die Querkirche als Zeichen ihrer Herrschaft und ihreslutherischen Bekenntnisses in ihren Residenzen und inOrten in Grenzlage zu Gebieten anderer Konfession ein-setzen. Hier wird eine Bauform zum Herrschaftszeichen.
die Gemeinde Hefrrich durch geruSsame Deputirte vor zubeschei-den, und Ihnen diel3es also vorzuleg,en, mithin sie at ventehmen, obund was sie etwa mit Bestand darbey zu erinnent habert möclten,damit hientechst gnädigster Henschafr das Werck vorseleset= uttdzu einem endlichen Beschlul3 beftrdert werden könne." Kanzlei inUsingen an Idsteiner Convent, 7737 März 1 (Konzept). HHSTAWI, Abt. 133, Nr.30.
,,Es bleibt festzustellen, daß Stengel bei seinen frühen Kirchen-bauten letztlich keine originären eigenen Schöpfungen her-vorbrachte, sondern daß den Kirchen von Grävenwiesbachund Heftrich Pläne von Johann Jakob Bager zugrundelagen,der wiederum Ideen von Julius Ludwig Rothweil und Ideen desArchitekturtheoretikers Leonhard Christoph Sturm verarbeite-te. Stengels Leistung lag darin, diesen Plan und die älterenIdeen überarbeitet und variiert zu haben. Diesem einmal ent-wickelten Grundschema blieb Stengel letztlich bei allen seinenspäteren Kirchenbauten treu, es wurde lediglich modifiziertund den örtlichen Bedingungen angepaßt. Die Kirchen vonGrävenwiesbach und Heftrich, die ersten Kirchenbauten Sten-gels, an denen er zumindest Teile der Planung geleistet hat,verarbeiten somit Ideen, die im Nassauischen bereits vorberei-tet waren." Skalecki 7995, S 65 f.Bericht Stengels, 1734März 6. HHSTA WI, Abt. 133, Nr. 30.Skalecki 1995, S. 64.Skalecki 1,995, S. 70.HHSTA WI, Abt. 135, Nr. 25, Bd. 1.So z.B. Dött 1955, 5.32; Skalecki 7995, S.65.Backes 1,959; Wehrum 7973; Großmann 1983, S. 75-U5; El l-wardt 1999.Kirchenarchiv Wölfersheim Akten Fasz. 18; Fürst zu Solms-Braunfelsisches Archiv Braunfels, Abt. A.61.2, Sign. I IL835.Pfarrarchive Steinau, Ober-Eschbach und Rodheim v. d. H.;Grottker 7984; Wolf 1988, S.445-555.Abbildung im Beitrag von F.-M. Saltenberger in diesem Band.HHSTA WI, Abt. 135 Usingen 17.Ellwardt 7997.Dittscheid 7975, S. 193; Association Sarre-Union 1992; Tour-sel-Harster/Beck/Bronner 1995, S. 385 f.Zit. nach: Vast 1898, S. 232.Hoppstädter/Herrmann 7977, S. 444-459 u. 506-52O; De-mandt 1980, S. 429-435; Vogler 1994, S. 59-174; Thomes1999, S. 299-352; Jung 1999, S. 352-453.Jung 1999,5.422.Schubart 1967, S.54; Dittscheid 7975, S. 193.
76
771879202122
25262728
2930
3132
Zun HERLEITUNC UND BEDEUTUNC VoN STENCEI SQUrnrrncHENTYPr.rS i 45