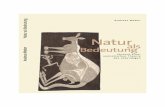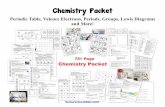Die Bedeutung impliziten und expliziten Wissens für den Fremdsprachenerwerb
-
Upload
ph-karlsruhe -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Bedeutung impliziten und expliziten Wissens für den Fremdsprachenerwerb
Explizites vs. implizites Wissen beim Fremdsprachenlernen (Fremdsprachenerwerb):
Raabe, Horst: „Wie viel Grammatik braucht der Mensch?“ Praktische und theoretische Reflexionen (II).
S. 1:
Theoretische Positionen:
1) Die Interface-Position:
Explizites Wissen kann in implizites Wissen umgewandelt werden.
Explizites Wissen ist nur dann von Nutzen, wenn es in implizites Wissen umgewandelt werden kann.
Implizites Wissen:
Formelhaft oder regelbasiert
Internalisiert, verborgen, unbewusst
Explizites Wissen:
Bewusste Repräsentationen sprachlichen Wissens
2) Die Non-Interface-Position:
Eine Umwandlung expliziten in implizites Wissen ist nicht möglich.
Eine explizite Grammatikvermittlung scheint für den Fremdsprachenlernerfolg nutzlos, wenn nicht sogar hinderlich.
Die Positionen im Einzelnen:
S. 2:
1) Die Interface-Position:
Starke Interface-Position: Grammatik, ja bitte-Position
Vertreter der starken Interface-Position:
u.a. Anderson (Adaptive Control of Thought-Modell/ACT)
Anderson, John R. (1990): The Adaptive Character of Thought. Hillsdale, N.J.: Erlbaum.
These Andersons: bewusste Prozesse sind Grundlage jeglicher Form des Lernens, auch des Sprachenlernens.
Explizites, deklaratives Wissen kann in implizites, prozedurales Wissen überführt werden.
Die Umwandlung von explizitem in implizites Wissen vollzieht sich in drei Stufen:
1. Stufe: Das Wissen liegt als explizites, deklaratives Wissen vor (kognitive Stufe).
2. Stufe: assoziative Stufe
3. Stufe: Das deklarative Wissen ist in prozedurales Wissen überführt worden (autonome Stufe).
Dadurch, dass auf der autonomen Stufe das deklarativrepräsentierte Wissen nicht mehr
aktiviert werden muss, wird das Arbeitsgedächtnis entlastet.Es kommt insgesamt zu einer
kognitiven Entlastung.
Fazit:
Die starke Interface-Position könnte für dasFremdsprachenlernen zutreffen. Für den Erst- undZweitsprachenerwerb scheint diese Position jedoch wenigernachvollziehbar.
Konsequenzen der starken Interface-Position für denGrammatikunterricht:
Es wird von einer positiven Wirkung einer explizitenKognitivierung (einer Bewusstmachung von Regeln) ausgegangen.
Eine explizite Kognitivierung sollte dem automatisierendenÜbungsgeschehen vorangestellt werden.
2) Die Non-Interface-Position (Die „Grammatik, nein danke“-Position):
Wichtigster Vertreter dieser Position: Stephen Krashen
Krashen, Stephen D. (1985): The Input Hypothesis: Issues andImplications. Harlow: Longman.
Krashen, Stephen D. (1994): The input hypothesis and itsrivals. In: Ellis, Nick (Hg.): Implicit and Explicit Learningof Languages. London: Academic Press, 45-77.
These: Eine Überführung expliziten in implizites Wissen istnicht möglich.
Deklaratives sprachliches, also explizites Grammatikwissen undimplizites prozedurales Wissen sind und bleiben voneinandergetrennt gespeichert.
Es gibt keinen Übergang zwischen den beiden Wissensspeichern.
Eine Sprache wird entweder unbewusst oder natürlich erworbenoder aber bewusst und gesteuert erlernt.
Gelerntes Wissen kann nicht zu erworbenem Wissen werden.
Das erworbene implizite Wissen liefert die prozedurale Basisfür die Rezeption und Produktion in der Fremdsprache.
Das gelernte Wissen als deklaratives Wissen besitzt eineMonitorfunktion.
Das deklarative Wissen wird also zur Kontrolle von auferworbenem Wissen beruhenden Äußerungen verwendet.
Das deklarative Wissen kann allerdings nur dann in seinerMonitorfunktion eingesetzt werden, wenn genügend Zeit, hoheKorrektheitsanforderungen und ausreichende Regelkenntnissevorliegen.
Lernende, die von deklarativem Wissen optimal profitieren,werden als „optimal monitor-users“ bezeichnet.
Nach Krashen findet Spracherwerb am besten dann statt, wenn erohne Stress und Angst und mit gutem Selbstvertrauen erfolgenkann. Der affektive Filter sollte niedrig bzw. schwach sein.
Der von Lernern zu verarbeitende Input sollte nach Krashenverstehbarer, also „comprehensible input“ sein.
Kritik an Krashens Ansatz:
Ein direkter Zugriff auf mentale Prozesse ist nicht möglich,daher kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht eindeutigfestgestellt werden, dass explizites, deklaratives Wissen nichtin implizites, prozedurales Wissen umgewandelt werden kann.
Krashens Theorie stellt nur die Verarbeitung des Inputs, nichtjedoch die Produktion von Output in den Vordergrund.
Gerade die Output-Produktion bei gleichzeitigem Feedback kannzu einer flüssigeren Sprachproduktion führen.
Krashens Position kann womöglich die Sprachverarbeitung imAnfangsunterricht erklären, scheint jedoch für eine Erklärungder Sprachrezeption und -produktion fortgeschrittener Lernerwenig geeignet.
Konsequenzen der Position Krashens für denFremdsprachenunterricht:
Die Non-Interface-Position scheint inkompatibel mit expliziterKognitivierung zu sein.
Deklaratives Wissen besitzt im Kontext dieser Theorie lediglicheine Kontroll- und Korrekturfunktion.
Komplexe Regelerklärungen können den affektiven Filter erhöhenund somit das Erwerben einer Fremdsprache erschweren.
„Grammatik ja, aber nur wenn“-Positionen:
schwache Interface-Positionen
Variability-Postionen (Bialystok 1994):
Die verschiedenen Bereiche der Sprachverwendung (Sprechen,Lesen, Schreiben, metasprachliche Aufgaben) werden hinsichtlichihrer kognitiven Anforderungen differenziert:
Explizitheit des Wissens/analysis of knowledge:
Kontrolle des Wissens/cognitive control:
Mit der Zunahme analysierten Wissens erwirbt der Lernende einzunehmend größeres Spektrum an Sprachgebrauch.
Analysiertes sprachliches Wissen kann kreativ verwendet werden.
Nicht analysiertes Wissen wird routiniert verwendet.
Cognitive control:
Der Lerner erlangt eine immer weitgehendere Kontrolle überProzesse der Koordinierung von Formen und Funktionen sowieFormen und Bedeutungen.
Durch Analyse kann implizites Wissen in explizites Wissenüberführt werden.
Explizites Wissen wird durch Automatisierung nicht zwangsläufigzu implizitem Wissen, sondern verbleibt in seiner explizitenRepräsentationsform.
Konsequenzen:
Durch explizite Kognitivierung kann ein positiver Einfluss aufdie Zunahme fremdsprachlicher Kompetenz genommen werden.
Die Regeln müssen auf das Analysiertheitsniveaufremdsprachlichen Wissens, auf dem sich die Lernenden befinden,abgestimmt sein.
Die zu vermittelnden Regeln müssen auf Probleme, die im Kontextdes gegenwärtigen konzeptuellen Repertoires der Lernendenentstehen können, anwendbar sein.
Die Regeln müssen in ihrer Funktion als organisierendes Prinzipabsolut verständlich sein.
Sprachentwicklung
Lernen (learning) Erwerb (acquisition)
gesteuert natürlich
explizit implizit
bewusst unbewusst
Lernen und Erwerb (Edmondson/House 2006)
Edmondson, Willis/House, Juliane (2006): Einführung in dieSprachlehrforschung. Tübingen: Francke.
Teachability-Hypothese:
Pienemann (1989):
Pienemann, Manfred (1989): „Is language teachable?Psycholinguistic experiments and hypotheses“. In: AppliedLinguistics 10 (1989), 52-79.
Die Teachability-Hypothese fußt auf der Beobachtung, dassSprachen in einer festen Abfolge von Entwicklungsstufen, wiesie sich in der Interlanguage der Lernenden (Interimsprache,Lernersprache) zeigen, erworben werden. Diese Stufen können vonden Lernenden nicht übersprungen werden.
Fremdsprachenunterricht kann nur dann erfolgreich sein, wenn erauf den gerade erreichten Entwicklungsstufen der Lernerspracheaufbaut und jeweils nur auf die nächste Entwicklungsstufezielt.
Lernende müssen die Voraussetzung einer psycholinguistischenReife erfüllen.
Neben dieser Entwicklungsachse existiert eine sogenannteVariationsachse (individuelle Abweichungen bedingt durchunterschiedliche Motivation etc.).
Weiterentwicklung der teachability-Hypothese zurproceassability-Hypothese:
In der processability-Hypothese bestimmen nicht mehr nursozialpsychologische Variablen die Variation, sondern es wirdversucht, die Variation präzise auf psycholinguistischer Basiszu erklären.
Konsequenzen aus der teachability-Hypothese:
Die curriculare Selektion und Progression sollte von dertatsächlichen Lernerprogression abhängig gemacht werden.
Lerner würden weniger demotiviert, wenn sie auf der Basis dervon ihnen erreichten Erwerbsphase unterrichtet und beurteiltwürden.
Kognitivierungen werden an die erreichten sprachlichenEntwicklungsstufen angepasst.
Individuell können einzelne Lerner den anderen Lernenden umeine oder mehrere Entwicklungsstufen voraus sein. IndividuelleEntwicklungen sind von den Lehrenden zu beachten.
Lernenden sollte eine Fremdsprache alters- undinteressengerecht vermittelt werden.
Schmidt und die Bewusstheit (Noticing-Hypothese):
Schmidt richtet wieder verstärkt den Fokus auf „grammaticalawareness“, grammatische Bewusstheit und geht davon aus, dassexplizites Grammatikwissen bei der Sprachproduktion einewesentliche Rolle spielt (Schmidt 1992, 206f.).
Schmidt, Richard (1992): „Awareness and second languageacquisition“. In: Annual Review of Applied Linguistics 13, 206-226.
Darüber hinaus liefert er eine Erklärung, warum auch beilernerangepasstem Input Lerninhalte auf dem Weg zum Intakeverloren gehen. Da nur der Input zum Intake werden kann, dervom Lerner bewusst wahrgenommen wird, fällt dem Lehrenden dieRolle zu, die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die zuerwerbenden Formen oder Elemente zu lenken.
„Kein Lernen ohne Bewusstheit!“ (Schmidt 1992, 206; 1994,15ff.) - Hiermit steht Schmidt in völligem Kontrast zu Krashen.Schmidt (ebd.) zerlegt den Begriff der Bewusstheit in vierBestandteile:
Absicht („intention“), die einem Handlungsplan folgt,Aufmerksamkeit („attention“), die durch Stimuli von selbstentsteht,Wahrnehmung („noticing“) in der Rezeption und Produktion,Verstehen („understanding“), das der Lerner im Unterschied zumimpliziten Wissen abrufen und verbalisieren kann.
Schmidt hinterfragt jeden dieser vier Teilbereiche nach seinerNotwendigkeit für das Zweit- und Fremdsprachenlernen. So istabsichtsloses Lernen zwar denkbar, da ungesteuerterSpracherwerb sonst nicht möglich wäre. Aber Lernen ohneAufmerksamkeit und Wahrnehmung ist dagegen nur schwervorstellbar. Unter Noticing versteht Schmidt eine subjektive,noch oberflächliche Bewusstheit zum Lernzeitpunkt (Raabe 2007,33). Wie auch das Modell von Ellis zeigt, ist das, was der Lernendeim Input wahrnimmt, Intake für sein Lernen. Kritisch zu sehenist die Forderung nach Verstehen. Ist denn tatsächlich ohneVerstehen kein Lernen möglich?
Explizites Wissen hilft dem Lernenden, die wesentlichenformalen Aspekte des Inputs zu bemerken, um so den Prozess desIntake und mit diesem den Erwerb impliziten Wissens zu fördern(Raabe 2007, 33).
Raabe, Horst (2007): „Wie viel Grammatik braucht der Mensch?“In: Praxis Fremdsprachenunterricht 6 (2007), 22-35.
Schmidt, Richard (1990): „The role of consciousness in secondlanguage learning“. In: Applied Linguistics 11 (1990), 129-158.
Schmidt, Richard (1994): “Deconstructing Consciousness inSearch of Useful Definitions for Applied Linguistics”. In:
Hulstijn, Jan/Schmidt, Richard (Hrsg.): Consciousness in SecondLanguage Learning. AILA Review, 11-26.
Schlak, Thorsten (1999): „Explizite Grammatikvermittlung imFremdsprachenunterricht? Das Interface-Problem Revisited“. In:Fremdsprachen und Hochschule 56 (1999), 5-33.
Noticing-Hypothese:
Lernen ohne Bewusstheit ist nicht möglich.
Absichtsloses Fremdsprachenlernen ist möglich. Wer vermagabzustreiten, dass beim Hörsehen eines fremdsprachigen Filmsnicht auch Wortschatz erweitert wird?
Lernen ohne Aufmerksamkeit scheint auf sinnvolle Weise nichtmöglich zu sein.
Lernen ohne Gewahrwerden (noticing) scheint unmöglich. Unternoticing versteht Schmidt eine subjektive, durchausoberflächliche Bewusstheit zum Lernzeitpunkt. Was Lernende imInput wahrnehmen ist Intake für das Lernen.
Eine offene Frage bleibt, ob Lernen ohne tiefschichtigeresVerstehen möglich ist.
Wie man sieht, wäre der Nachweis, dass Lernen nicht ohnetiefschichtigeres Verstehen im obigen Sinn möglich ist,gleichzeitig der Nachweis für das Zutreffen der starkenInterface-Position, das heißt der „Grammatik, ja bitte“-Position. Dieser Nachweis ist nicht möglich.
Explizites Wissen hilft dem Lernenden, die wesentlichenformalen Aspekte des Inputs zu bemerken, um so den Prozess desIntake und mit diesem den Erwerb impliziten Wissens zu fördern.
Konsequenzen aus der Noticing-Hypothese nach Schmidt (1995):
Schmidt, Richard (1995): „Consciousness and foreign languagelearning: A tutorial on the role of attention and awareness inlearning”. In: Schmidt, Richard (Hrsg.): Attention andAwareness in Foreign Language Learning. Honolulu, Hawaii:University of Hawaii, 1-63.
Sei dem fremdsprachigen Input gegenüber generell aufmerksam.
Achte auf alle sprachlichen Aspekte, die Dir der fremdsprachigeInput bietet, der gerade zu Deinem Lernstoff gehört. Nichts istda beliebig!
Suche nach Anhaltspunkten dafür, dass fremdsprachige Sprechersich so und nicht anders ausdrücken. Vergleiche DeineÄußerungen mit dem, was fremdsprachige Sprecher in der gleichenSituation sagen würden. Fallen Dir Unterschiede auf, bilde dazuHypothesen und versuche diese zu überprüfen.
Findest Du keine Erklärungen dafür, wie etwas in derFremdsprache prinzipiell funktioniert, versuche wahrzunehmen,wie bestimmte Äußerungen in bestimmten Situationen undKontexten verwendet werden.
Implizites vs. explizites Wissen:
Erika Diehl/Helen Christen/Sandra Leuenberger/IsabellePelvat/Thérèse Studer:
Grammatikunterricht: Alles für die Katz? Untersuchungen zumZweitsprachenerwerb Deutsch. Max Niemeyer Verlag. Tübingen2000.
S. 44:
Frage nach der Rolle der Bewusstheit in L2-Erwerbsprozessen
Im L2-Unterricht dominiert die Annahme, L2-Beherrschung werdeüber Regellernen erworben.
Annahme: Die Möglichkeit einer Durchlässigkeit zwischen dembewussten Lernen formaler Eigenschaften der L2 und dem sichunbewusst vollziehenden Spracherwerbsprozess wird von Krashenradikal bestritten.
Annahme Krashens:
Der Monitor als bewusst operierende Kontrollinstanz kann nurvon fortgeschrittenen L2-Lernern eingesetzt werden, da diesesich im Wesentlichen auf ihr unbewusstes Sprachwissen verlassenkönnen, so dass noch genügend Verarbeitungskapazität für diebewusste Bearbeitung der wenigen Lücken in ihrer Kompetenz zurVerfügung steht.
Bei Krashen herrscht eine strenge non-interface Position vor,d.h. es besteht eine strikte Trennung zwischen Lernen undErwerben.
Die Krashensche Position der Gleichsetzung von Lernen undBewusstheit und Erwerben und Unbewusstheit wird u.a. vonButzkamm scharf zurückgewiesen.
Vgl. Butzkamm, Wolfgang: Psycholinguistik desFremdsprachenunterrichts. Natürliche Künstlichkeit. Von derMuttersprache zur Fremdsprache. Tübingen 1989.
S. 46:
Butzkamm (1989) nimmt eine Skala von Bewusstheitsgraden an.
Das untere Ende der Bewusstheitsskala: ratiomorphemes Wissen
Das obere Ende der Bewusstheitsskala: aufmerksames Bewusstsein
Butzkamm (1993, 102): Psycholinguistik desFremdsprachenunterrichts. 2. Auflage.
„Bewusstsein ist zwar eine neue psychische Qualität, der Wegdahin durchläuft jedoch die gleichen Systeme, die auch dieunbewusst bleibende Information passiert.
„Wo Krashen eine rigide Trennung postuliert, ist vielerleiKonnex“.
Bewusstsein ist „nur die Spitze des Eisbergs (Butzkamm ebd.),eine Insel im Meer unbewusst verlaufenderInformationsverarbeitung.
Bewusste Erkenntnisse und bewusstes Üben können dennoch zueinem effektiven Erwerb führen.
Sie führen zu Automatismen, die das Bewusstsein entlasten undfür weitere Lernprozesse freistellen.
These: auch zunächst unbewusstes Wissen kann zu Bewusstseingebracht werden
These Butzkamms: bewusst-rationale und unbewusst-ratiomorpheLeistungen können sich vielfach verbinden.
Richard Schmidt schlägt vor, auf die Dichotomie „bewusstesLernen vs. unbewusstes Erwerben“ zu verzichten. An die Stelledieser Dichotomie sollte diejenige zwischen „intentionallearning“ vs. „incidental learning“ treten.
These Schmidts: Sowohl beim intentional learning als auch beimincidental learning kann nur dann gelernt werden, wenn derLerner seine Aufmerksamkeit auf spezifische Merkmale der L2richtet. Ohne „noticing“ kann es keinen Lernfortschritt geben.
Schmidt streitet die Möglichkeit unbewussten Lernens im Sinnedes Krashenschens Erwerbens ab.
McLaughlin vertritt eine dezidierte Interface-Position:
Er nimmt an, dass zunächst kontrolliertes Wissen (McLaughlinspricht nicht von explizitem Wissen) durch Üben zu
automatisierten Skills führt. Dieses Wissen findet dann Eingangin das Langzeitgedächtnis.
S. 48:
Interface-Position von Bialystok:
Sie ersetzt das Begriffspaar explizites-implizites Wissen durchdie Dichotomie analysiertes vs. unanalysiertes Wissen.
Beide Wissenstypen sind nach Ansicht Bialystoks in beideRichtungen durchlässig.
Durch Üben kann analysiertes, explizites Wissen implizitwerden.
Implizites, unanalysiertes Wissen kann andererseits durchDeduktion in explizites Wissen überführt werden.
Literatur:
Anderson, John R.: The Adaptive Character of Thought. Hillsdale, N.J. 1990.
Butzkamm, Wolfgang: Psycholinguistik desFremdsprachenunterrichts: von der Muttersprache zurFremdsprache. Tübingen 2002.
Diehl, Erika/Christen, Helen/Leuenberger, Sandra/Pelvat,Isabelle/Studer, Thérèse: Grammatikunterricht: Alles für dieKatz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch. Tübingen2000.
Edmondson, Willis/House, Juliane: Einführung in dieSprachlehrforschung. Tübingen 2006.
Ellis, Rod/Loewen, Shawn/Erlam, Rosemary: “Implicit andExplicit Corrective Feedback and the Acquisition of L2Grammar”. In: Studies in Second Language Acquisition 28 (2006),339-368.
Krashen, Stephen D.: The Input Hypothesis: Issues andImplications. Harlow 1985.
Krashen, Stephen D.: The input hypothesis and its rivals. In:Ellis, Nick (Hg.): Implicit and Explicit Learning of Languages.London Academic Press (1994), 45-77.
Perrig, Walter: „Implizites Lernen“. In: Hoffmann,Joachim/Kintsch, Walter (Hrsg.): Kognition. Band 7: Lernen.Göttingen 1996, 203-234.
Pienemann, Manfred: „Is language teachable? Psycholinguisticexperiments and hypotheses“. In: Applied Linguistics 10 (1989),52-79.
Pienemann, Manfred: Language Processing and Second LanguageDevelopment: Processability Theory. Amsterdam 1998.
Pienemann, Manfred: “Language Processing Capacity“. In:Doughty, Jessica/Long, Michael H. (Hrsg.): The Handbook ofSecond Language Acquisition. Oxford 2003, 679-714.
Raabe, Horst: „Wie viel Grammatik braucht der Mensch?“ In:Praxis Fremdsprachenunterricht 6 (2007), 22-35.
Schlak, Thorsten: „Explizite Grammatikvermittlung imFremdsprachenunterricht? Das Interface-Problem Revisited“. In:Fremdsprachen und Hochschule 56 (1999), 5-33.
Schmidt, Richard: „The role of consciousness in second languagelearning“. In: Applied Linguistics 11 (1990), 129-158.
Schmidt, Richard: „Awareness and second language acquisition“.In: Annual Review of Applied Linguistics 13 (1992), 206-226.
Schmidt, Richard: “Deconstructing Consciousness in Search ofUseful Definitions for Applied Linguistics”. In: Hulstijn,Jan/Schmidt, Richard (Hrsg.): Consciousness in Second LanguageLearning. AILA Review (1994), 11-26.
Wikipedia: „Interface-Hypothesen“
Die Interface-Hypothese ist ein Konzept im Zweitsprachenerwerb,das die möglichen Zusammenhänge zwischen explizitem undimplizitem Wissen beschreibt.
Implizites Wissen ist Wissen, das der Lerner intuitiv besitzt,aber nicht in Worte fassen kann.
Explizites Wissen ist Sprachwissen, das der Lerner besitzt undauch verbalisieren kann.
Es existieren drei grundlegende Positionen im Rahmen derInterface-Hypothese:
Die non-interface Position
Die starke interface-Position
verschiedene schwache interface-Positionen
Kern der non-interface Position:
Es besteht keinerlei Beziehung zwischen implizitem undexplizitem Wissen.
Explizites Wissen kann niemals in automatisiertes implizitesWissen überführt werden.
Diese Position ist weitgehend verworfen worden, so dass sichdie Diskussion vornehmlich auf die starke bzw. schwacheInterface-Position konzentriert.
Die starke Interface-Position:
Explizites Wissen kann grundsätzlich immer in implizites Wissenüberführt werden.
Das explizite Wissen kann durch wiederholtes Üben (practice) inimplizites Wissen überführt werden.
Die schwache Interface-Position:
Explizites Sprachwissen kann bis zu einem gewissen Grad inimplizites Wissen überführt werden.
Begrenzungen sind in Form individueller Entwicklungsfaktorengegeben.
Manfred Raupach: „Explizit/Implizit“ in psycholinguistischenBeschreibungen - eine unendliche Geschichte?“ In: Börner,
Wolfgang/Vogel, Klaus: Grammatik und Fremdsprachenerwerb:Kognitive, psycholinguistische und erwerbstheoretischePerspektiven. Tübingen 2002.
S. 104:
Explizites vs. implizites Wissen nach Bialystok:
Im Zentrum des Sprachlernmodells nach Bialystok stehen dreiRepräsentationsformen sprachlichen Wissens:
Explizites Wissen
Implizites Wissen
Other knowledge (allgemeines Wissen über Sprache, Weltwissen)
Explizites Wissen beinhaltet alle bewussten Fakten, die einLerner über Sprache hat. Das Kriterium der Bewusstheit istdabei die Fähigkeit des Lerners, dieses Wissen zu artikulieren.
Implizites Wissen ist die intuitive Information, auf derenBasis der Lerner agiert, um Äußerungen in der Zielsprache zuproduzieren.
Jede automatisierte und spontane Information ist im implizitensprachlichen Wissen repräsentiert.
Die Unterscheidung zwischen den beiden Wissensbeständen liegtnicht im Inhalt. Die gleiche Information kann in beidenBeständen repräsentiert sein.
Die Funktionen impliziten bzw. expliziten Wissens sindverschieden.
Implizites Wissen geht mit der Fähigkeit zu flüssigerSprachproduktion einher.
Diese Fähigkeit ist für das explizite Wissen nichtnotwendigerweise gegeben.
Das explizite Wissen kann als „Zwischenlager“ für neuaufgenommenes Sprachmaterial dienen.
Bei fortgesetztem Sprachgebrauch kann das im explizitenSpeicher repräsentierte Sprachwissen in implizites Wissenüberführt werden.
Teile des impliziten Wissens können explizit gemacht werden.
Bialystok postuliert eine Interaktion zwischen den beidenWissensspeichern in beide Richtungen.
Bialystok verknüpft das Begriffspaar implizit/explizit mit denFaktoren nicht-analysiert/analysiert.
Implizites Wissen liegt in der Regel in nicht-analysierter Formvor, explizites Wissen in analysierter Form.
Gelegentlich werden explizites Wissen und kontrollierteVerarbeitung und implizites Wissen und automatisierteVerarbeitung gleichgesetzt.
S. 106:
Bei Krashen taucht consciousness in Verbindung mit explizitemWissen auf.
Attention bezieht sich auf den Grad der aktiven Aufmerksamkeit.
Awareness gehört nur zur Aktivierung von explizitem(analysiertem) Wissen, nicht von implizitem (nicht-analysierten) Wissen.
Awareness ist nicht gleichbedeutend mit consciousness.
Awareness refers to depth of understanding.
Edmondson/House (1997, 4) setzen explizites Wissen mitartikulierbarem Wissen gleich.
Edmondson, Willis/House, Juliane (1997): „Zur Einführung in denThemenschwerpunkt“. In: Edmondson,Willis/House, Juliane (1997):Themenschwerpunkt Language Awareness. Fremdsprachen Lehren undLernen 26, 1-8.
S. 107:
Börner (2000, 40) formuliert mit Bezug auf die Wortschatzarbeitfolgendermaßen:
„Explizites Wissen kann benannt und geäußert werden, etwa inForm von Bedeutungsangaben oder Verwendungsregeln“.
Börner, Wolfgang (2000): „Didaktik und Methodik derWortschatzarbeit. Bestandsaufnahme und Perspektiven“. In: Kühn,Peter (Hrsg.): Studien zu Deutsch als Fremdsprache V.Hildesheim.
S. 108:
Stern (1992) stellt den Lernstrategien auf der Lehrerseite dieimpliziten und expliziten Lehrstrategien gegenüber.
Stern, H.H.
In: Allen, P. /Harley, B.: Issues and Options in LanguageTeaching. Oxford 1992.
Neueres Modell von Bialystok (1994):
Die zentralen Komponenten des Modells sind von der UniversalGrammar inspiriert.
Conceptual Representation: enthält Weltwissen und semantischesWissen
Language Representation: enthält die universellen Prinzipienfür natürliche Sprachen (topic, tense etc.)
Language Specific Details (LSD): enthält für jede der demLerner verfügbaren Sprachen Informationen (über das Lexikon,über die grammatischen Strukturen, über pragmatische Regeln undParametersetzungen)
Die konzeptuelle und allgemein sprachliche Repräsentation sindursprünglich implizite Repräsentationen.
Auf dem Wege der Analyse und dem Zuwachs von Wissen undErfahrung auf Seiten des Lerners können diese Repräsentationeneine Umwandlung in explizites Wissen erfahren.
S. 109:
In den sprachspezifischen Bereichen (LSD) wird das Wissen vonvornherein explizit enkodiert.
Es findet eine individuelle Repräsentation für jede spezifischeEinzelsprache statt.
S. 110:
Zum Begriffspaar deklarativ vs. prozedural:
Begriffspaar wurde in den 1980er Jahren aus derKognitionspsychologie übernommen.
Deklaratives Wissen wird als verbalisierbares Wissen (Wissen,dass) definiert.
Dieses Wissen ist in der Regel in der Form „alles oder nichts“vorhanden.
Prozedurales Wissen (Wissen wie) ist nicht verbalisierbar. Eswird allmählich durch die Ausführung von Handlungen/Prozedurenerworben.
Prozedurales Wissen ist die Handlung selbst und nicht dasWissen über die Handlung.
Deklaratives Wissen kann über einzelne Stufen auf dem Weg derProzeduralisierung in prozedurales Wissen überführt werden.
In der Literatur finden sich die Gleichsetzungen deklarativ =explizit und prozedural = implizit.
S. 111:
In der ursprünglichen kognitionspsychologischenCharakterisierung kann sowohl deklaratives als auchprozedurales Wissen explizit als auch implizit repräsentiertsein.
Schmidt (1995) wirft die Frage auf, inwieweit Lernen, also auchimplizites Lernen ohne intention, attention, noticing und understandingüberhaupt möglich sein kann.
Schmidt, Richard (1995): “Consciousness and Foreign LanguageLearning: A Tutorial on the Role of Attention and Awareness inLearning”. In: Schmidt, Richard (Hrsg.): Attention andAwareness in Foreign Language Learning. Honolulu, University ofHawaii, 1-63.
S. 112:
Heutzutage wird zumeist nur noch das Merkmal derVerbalisierbarkeit zur Charakterisierung expliziten Wissensherangezogen.
S. 113:
Börner (1997, 2000) beobachtete bei den von ihm untersuchtendeutschen Lernern des Französischen beim Wortschatzlernen einNebeneinander von implizitem und explizitem Lernen auf fastallen Ebenen eines Lexems.
Bei der Suche nach Übersetzungsäquivalenten aktivieren Lernersowohl implizites als auch explizites Wissen.
(Börner 1997, 63)
Börner, Wolfgang (1997): „Implizites und explizites Wissen imfremdsprachlichen Wortschatz“. In: Edmondson, Willis/House,Juliane (Hrsg.): Themenschwerpunkt: Language Awareness.Fremdsprachen Lehren und Lernen (26), 44-67.
Börner, Wolfgang (2000): „Didaktik und Methodik derWortschatzarbeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven“. In:Germanistische Linguistik (155-156), 29-56.
Die implizit/explizit-Differenzierung ist nicht als Dichotomiezu verstehen, sondern lediglich als Markierung der Eckpunkteeines Kontinuums.
Auch das implizit/explizit-Kontinuum erweist sich alsunangemessen vereinfachtes Konstrukt.
Götze, Lutz: Was leistet das Gehirn beim Fremdsprachenlernen?Neue Erkenntnisse der Gehirnphysiologie zum Fremdsprachenerwerb
Vortrag auf der Fachtagung „Initiativen für denFremdsprachenunterricht an Hamburger Gymnasien“ am 23.4.1997
S. 3:
Rene Descartes ging von einem Dualismus aus und differenziertezwischen der physischen Realität, die von der Wissenschaftbeschrieben wird (res extensa) und der geistigen Realität derSeele (res cogitans).
Die Annahmen Descartes‘ gehen von einem Dualismus von Materieohne Bewusstsein und Geist mit Bewusstsein aus.
Zahlreiche Neurowissenschaftler wandten sich gegen denDescartes’schen Dualismus und gehen stattdessen von einemwechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis von Geist und Materieaus.
Searle (1996, 3) geht davon aus, dass Bewusstsein eingewöhnliches biologisches Phänomen ist. Es sei nichts anderesWachstum, Verdauung oder Gallensekretion.
Bewusstsein werde durch niedrigerstufige neuronale Vorgänge imGehirn verursacht und sei selbst ein Merkmal des Gehirns.
Searle, John R. (1996): „Das Rätsel des Bewusstseins. Biologiedes Geistes - Mathematik der Seele“. In: Lettre (32), 34-43.
S. 4:
Am Beginn von Gedächtnis- und Bewusstseinsbildung stehenelektrische Impulse und physiko-biochemische Prozesse.
Pöppel (1992, 3) geht davon aus, dass das menschliche Gehirnnicht mit einem Computer zu vergleichen ist.
Beim menschlichen Gehirn spielen Bewertungsinstanzen eineentscheidende Rolle.
Beim Computer ist die Informationsverarbeitung unabhängig vonder jeweiligen Bedeutung.
Nur ein Sachverhalt, der für einen Organismus zu einembestimmten Zeitpunkt eine Bedeutung besitzt, hat eine Chance,auf die Ebene des Bewusstseins gehoben zu werden.
Pöppel, Ernst (1992): „Vom Segen der Differenz - der Vorzug desGehirns und der Nachteil des Computers“. In: FrankfurterRundschau , 12.12.1992, 3.
S. 5:
Das menschliche Gehirn bewertet und verwirft Unwichtigessofort.
Es bewahrt Wichtiges und reproduziert es nach Regeln, die nuransatzweise bekannt sind.
Das Bewerten und Auswählen von Inhalten durch das menschlicheGehirn basiert auf einer engen Kooperation zwischen Neocortex,limbischem System und Hirnstamm.
Bewertungsverfahren sind wesentlich von Emotionen und Affektenbestimmt.
S. 6:
Bewertungen (bekannt-unbekannt, wichtig-unwichtig) werden vomHippocampus in Kooperation mit dem limbischen Systemvorgenommen.
Wird eine Information als bekannt und unwichtig eingestuft,gelangt sie nicht in das Bewusstsein.
Informationen, die als unbekannt und unwichtig eingestuftwerden, gelangen allenfalls ins Kurzzeitgedächtnis.
Informationen, die als bekannt und wichtig eingeordnet werden,gelangen auf eine niedrige Stufe des Bewusstseins.
Den höchsten Grad des Bewusstseins erreichen diejenigenInformationen, die als unbekannt (neu) und wichtig eingestuftwerden.
S. 8:
Lediglich Informationen, die für ein Individuum als neu undwichtig gelten, werden im Gedächtnis gespeichert.
Folgende Gedächtnisarten werden differenziert:
deklaratives/explizites Gedächtnis
prozedurales/implizites Gedächtnis
Gedächtnis kategorialen Wissens
Deklaratives Wissen ist in aller Regel von Bewusstseinbegleitet.
Es umfasst auf dem Gebiet der Sprache das Wissen umgrammatische Regeln und Wortbedeutungen (Sprachwissen).
S. 9:
Bedeutung des deklarativen bzw. prozeduralen Gedächtnisses fürden Sprachlernprozess:
Fragestellungen:
Ist der Sprachlernprozess weitgehend unbewusst und erfolgtimplizit auf der Basis einer angeborenen Lernergrammatik?
Ist gegebenenfalls auch für den Erstsprachenerwerb deklarativesWissen von Nutzen?
Ergebnisse:
Die ersten Lernprozesse laufen weitgehend implizit und intuitivab.
Auch beim Kleinkind finden sich aber bereits frühe Ausprägungeneines grammatischen Bewusstseins.
These:
Schon im Alter von sechs Jahren und verstärkt im Alter vonsechs bis zwölf Jahren durchlaufen die KinderSprachlernprozesse, die sowohl deklaratives als auchprozedurales Wissen hervorbringen.
S. 10:
Altersspezifische Unterschiede beim Fremdsprachenerwerb sindbekannt, können jedoch kognitionspsychologisch nicht in jedemEinzelfall eindeutig erklärt werden.
Das Alter von sechs bis zehn Jahren ist für den phonologischenBereich (Aussprache, Intonation, Prosodie) prädestiniert.
Morphologisch-syntaktische Phänomene werden am besten impräpubertären Alter erworben.
Sprachenlernen und Zuhilfenahme erklärende Regeln gelingt ambesten dann, wenn die Muttersprache der Lerner gefestigt istund ein Interesse am Verstehen und Speichern der sprachlichenRegeln besteht.
Hufeisen, Britta: „L1, L2, L3, L4, Lx - alle gleich?Linguistische, lernerinterne und lernerexterne Faktoren inModellen zum multiplen Spracherwerb“. In: Baumgarten,Nicole/Böttger, Claudia/Motz, Markus/Probst, Julia (Hrsg.):Übersetzen, Interkulturelle Kommunikation, Spracherwerb undSprachvermittlung - das Leben in mehreren Sprachen. Festschriftfür Juliane House zum 60. Geburtstag. Didaktik und Methodik imBereich Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift fürInterkulturellen Fremdsprachenunterricht 8, 2/3, S. 97-108.
S. 104:
Metalinguistisches Bewusstsein:
Der multilinguale Mensch entwickelt in Bezug auf seinSprachenlernen ein metalinguistisches Bewusstsein.
Die kognitive Kompetenz unterscheidet multilinguale Sprechererheblich von monolingualen Sprechern.
Ein metalinguistisches Bewusstsein zu haben bedeutet, über denBau von Sprache Bescheid zu wissen.
Ein metalinguistisches Bewusstsein zu haben bedeutet auch, überSprache reflektieren und sprechen zu können und die eigeneSprache analysieren und verändern zu können.
Diese Aktivitäten setzen sprachliche und kognitive Fähigkeitenvoraus.
Metalinguistisches Bewusstsein scheint vor allem für L3-Lernervon besonderer Relevanz zu sein.
Mit jeder weiteren erlernten Sprache wird das metalinguistischeBewusstsein weiter ausgebildet.
Korrekturverfahren: implizit vs. explizit
Die Aufmerksamkeit auf Formen muss auch in kommunikativausgerichteten Unterrichtsphasen gewährleistet sein. Dazulassen sich formenfokussierende Aushandlungen am bestenmithilfe expliziter Korrekturstrategien initiieren.
Unter Rekurs auf Lyster und Mori (2006) schlagen sie vor, dasPrinzip der Gegengewichtung zu beachten, d.h. informenfokussierenden Kontexten eher impliziteres Feedback undin bedeutungsbezogenen Kontexten eher explizitereKorrekturstrategien einzusetzen.
Für unauffällige sprachliche Strukturen eignen sich am ehestenexplizite Korrekturen. Auffälligere Strukturen können eher mitimpliziten Feedbackstrategien wie Recasts korrigiert werden.
Phonetische und lexikalische Fehler lassen sich effektivmithilfe impliziter Feedbackstrategien korrigieren.
Morphosyntaktische Fehler bedürfen in der Regel expliziterenFeedbacks.
Nicht für alle Kinder sind explizit formenfokussierendeFeedbacks gleichermaßen geeignet. Am wenigsten profitierendavon Lernende im frühen Kindesalter und solche mit schwachentwickelter Literalität, aber auch Lernende mit keiner oder
wenig Unterrichtserfahrung oder geringem sprachanalytischenVermögen.
Korrektives Feedback sollte nach Möglichkeit denlernersprachlichen Voraussetzungen angepasst sein(verständlicher Input). Für Lernende einer hohenEntwicklungsstufe und gutem Arbeitsgedächtnis ist der Modus desFeedbacks irrelevant. Lernende einer geringerenEntwicklungsstufe profitieren dagegen mehr von einem explizitenFeedback (vgl. Schoormann/Schlak 2011, 98).
Schoormann, Matthias/Schlak, Torsten (2011): „Zur Komplexitätmündlicher Fehlerkorrekturen“. In: Beiträge zurFremdsprachenvermittlung, 77-105.
Lernende mit hoher Fremdsprachenverwendungsangst sehen sichallein durch die Teilnahme an kommunikativen Aktivitäten einemerhöhten Stress ausgesetzt, was dazu führt, dass sie sich wenigauf den Inhalt von Korrekturen konzentrieren.
Explizite Korrekturen oder Bitten um Erläuterungen kamen in denvon Lochtmann beobachteten DaF-Unterrichtsstunden nicht vor.Insgesamt hat es jedoch in der unterrichtlichen Interaktion denAnschein, als ob zwischen Lehrenden und Lernenden ein Konsensüber die Notwendigkeit mündlicher Fehlerkorrekturen für denSpracherwerbsprozess besteht.
Lochtmann, Katja: „Die mündliche Fehlerkorrektur im DaF-Unterricht“. In: German as a Foreign Language 3, 2003, 1-17.
Hinsichtlich der von Lehrenden eingesetzten Korrekturendifferenziert Lochtmann (2003, 9) des Weiteren zwischendirekten und indirekten Korrekturen, wobei direkte Korrekturenmit einer expliziten Korrektur oder einer isoliertenUmgestaltung verbunden seien. Bei einer expliziten Korrekturwerde der Lernende auf einen Fehler hingewiesen, den eranschließend selbständig korrigieren könne. Im Zuge einerisolierten Umgestaltung hingegen werde die Fehlerkorrektur vonder Lehrkraft vorgenommen, die die Lerneräußerung wiederhole,jedoch anstatt des vom Lerner gemachten Fehlers die richtige
Form einsetze. Eine Expansion der Lerneräußerung finde indiesen Fällen jedoch nicht statt.
Lyster/Ranta (1997) differenzieren zwischen recasts, explizitenKorrekturen, Klärungsaufforderungen, Fehlerwiederholungen,Elizitierungen und metalinguistischem Feedback.
Lyster, Roy/Ranta, Leila: „Corrective Feedback in ClassroomSLA: A Meta-Analysis”. In: Studies in Second LanguageAcquisition 19, 1997, 37-66.
Recasts, die als die im Unterricht am häufigsten eingesetzteFeedbackstrategie verstanden werden können, sind in derunterrichtlichen Interaktion zumeist in einen Prozess derBedeutungsaushandlung eingebunden.
Die Korrekturhandlung des recasts wird definiert als dieWiederholung einer fehlerhaften Lerneräußerung durch denInteraktionspartner oder den Lehrenden, der im Zuge derWiederholung den Fehler des Lerners korrigiert.
Insgesamt sei der recast eher als implizite Korrektur zuverstehen, wenngleich explizite Elemente in derZurverfügungstellung sprachlicher Evidenzen durch den Lehrendenbestehen, und von anderen Korrekturhandlungen, z.B. den promptsabzugrenzen, in deren Kontext keine Korrektur von Seiten derLehrenden erfolgt, sondern eine lehrerseitige Initiierung einerSelbstkorrektur durch den Lerner.
Schoormann/Schlak (2011, 59) betonen, dass recasts von denLernenden wegen ihres impliziten Charakters häufig gar nichtals Korrekturinterventionen der Lehrenden wahrgenommen werden.
Die bislang vorliegenden empirischen Untersuchungen zumKorrekturverhalten und dessen Wirkungen (Long 2007, Lyster 1998vgl. auch Schoormann/Schlak 2011, 56/57) halten zum Teil (Long)implizites korrektives Feedback für erwerbsfördernd, währendandere Studien (Lyster 1998) von einer Überlegenheit einesexpliziten Feedbacks ausgehen.
Long, Michael: Problems in SLA. New Jersey 2007.
Lyster, Roy: “Negotiation of Form, Recasts and ExplicitCorrection in Relation to Error Types and Learner Repair inImmersion Classrooms”. In: Language Learning 48, 1998, 183-218.
Schoormann/Schlak (2011, 73):
In einem formfokussierten Unterrichtskontext bieten sich Formenimpliziten Feedbacks an, während in einembedeutungsfokussierten Kontext explizite Korrekturverfahren zubevorzugen sind.