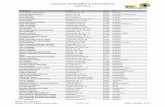Der Diskurs zum Wissens- und Technologietransfer in Deutschland
-
Upload
uni-bremen -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Der Diskurs zum Wissens- und Technologietransfer in Deutschland
1
Frank Meier
Der Diskurs zum Wissens- und Technologietransfer in Deutschland1
Arbeitspapier, Bielefeld, 2005
1 Einleitung
Die hochschul- und wissenschaftspolitische Diskussion in (der Bundesrepublik) Deutschland
ist in weiten Teilen von der Vorstellung geprägt, Wissenschaft und wirtschaftliche
Entwicklung seien eng miteinander verkoppelt, wissenschaftliche Forschung sei Triebkraft
und Voraussetzung ökonomischen Fortschritts. Nicht immer äußert sich diese Annahme
freilich so dramatisch wie noch in der Nachkriegszeit:
„Forschung heißt Leben – ganz einfach, weil wir sonst hoffnungslos dem Elend und
dem Hunger preisgegeben sind. Wir, die Völker der westlichen Welt. Wir, vor allem
das deutsche Volk“ (Stifterverband 1950: 7).
Aus der Annahme eines engen Zusammenhanges von Wissenschaft und wirtschaftlicher
Entwicklung wird gefolgert, dass verstärkt wissenschaftliche Kapazitäten aufzubauen seien
und Wissenschaft eine besondere Priorität in der politischen Agenda zukommen müsse.
Wissenschaft nutzbar zu machen heißt also zunächst einmal, Wissenschaft angemessen zu
fördern.
„Die Ausgaben für Wissenschaft und Forschung sind die entscheidenden Investitionen
in unsere Zukunft. Die großen Probleme, die uns die heutige Welt stellt, können nur
noch mit Hilfe der Wissenschaft bewältigt werden. Andere Länder haben die
Zusammenhänge eher erkannt als wir. Sie bauen planmäßig mit langjähriger
Zielsetzung ihr Hochschulwesen und ihre Forschungseinrichtungen aus – und sie
geben der Wissenschaftspolitik die notwendige Priorität unter den Staatsaufgaben.“
(BMwF 1965: 5)
Der zumindest langfristige Nutzen der Forschung – auch und gerade der teuren
Großforschung – werde sich schon einstellen, „denn die Natur gab immer ihre Früchte“
(Stoltenberg 1967: 12).
„Es hat sich jedoch gezeigt, daß der Umsetzungsprozeß in vielen Fällen nicht so
problemlos und zügig abläuft, wie dies im gesamtwirtschaftlichen Interesse wünschenswert
wäre“ (Wissenschaftsrat 1975: 137). Deshalb entwickelten sich im Laufe der Jahrzehnte
verschiedene Vorstellungen darüber, wie es effektiv und effizient gelingen könnte, der Natur
ihre Früchte zu entreißen, wie es gelingen könnte, plan- und absichtsvoll die Nutzung
wissenschaftlichen Wissens in der Wirtschaft zu forcieren.2
Wir werden im Weiteren die deutschen Transferdiskurse anhand der Leitfrage
untersuchen, wie in ihnen das Problem der planvollen Nutzbarmachung wissenschaftlichen
Wissens für die wirtschaftliche Praxis konstruiert wird. Wir unterscheiden idealtypisch drei
1 Dieses Arbeitspapier ist im Jahr 2005 im Rahmen des von der DFG geförderten und von Georg Krücken
geleiteten Forschungsprojekts „Abschied vom Elfenbeinturm? Eine wissenschafts- und
organisationssoziologische Untersuchung zum universitären Wissens- und Technologietransfer in
Deutschland und den USA“ am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung (IWT) der Universität
Bielefeld entstanden. Siehe zu den Ergebnissen der im Rahmen dieses Projekts durchgeführten Analyse der
Transferdiskurse in Deutschland und den USA auch Krücken/Meier/Müller 2007 und Meier/Müller 2007.
2 Freilich klagt der Wissenschaftsrat 1996 immer noch: „Die Erträge der Hochschulforschung und die
Kompetenz der Hochschulforscher werden für die Entwicklungsfähigkeit der Gesellschaft und die
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft nicht ausreichend genutzt“ (Wissenschaftsrat 1996: 70).
2
grundlegende Modelle dieser Vorstellungen: das Informations- und Dokumentations-Modell,
das Kooperations-Modell und das Blurring-of-Boundaries-Modell (BoB-Modell). Die
deutsche Transferdiskussion soll anhand dieser drei Modelle nachgezeichnet werden. Dabei
wird zwar ein besonderes Augenmerk auf der jeweiligen Rolle der Universitäten liegen, doch
es erweist sich, dass der Diskurs mitunter gar nicht zuvorderst Universitäten adressiert. Dies
gilt insbesondere für das Informations- und Dokumentations-Modell.
2 Das Informations- und Dokumentations-Modell
Universitärer Wissens- und Technologietransfer ist lange Zeit als Problem der Information
und Dokumentation (IuD) begriffen worden, wie sich anhand der Fachdebatte in der
einschlägigen deutschen Zeitschrift „Nachrichten für Dokumentation“ („NfD“; heute
„Information – Wissenschaft und Praxis“) und der wichtigen informationspolitischen
Dokumente3 aufzeigen lässt. Der deutsche Diskurs konnte dabei vielfach an internationale
Bemühungen anschließen (z.B. Unesco 1971; OECD 1971).
Nach dem IuD-Modell kann das umfangreiche in der Welt vorhandene Wissen nur
dann hinreichend verwendet werden, wenn es den potenziellen Nutzern durch spezialisierte
Informations- und Dokumentationsbemühungen in methodischer, technisch fortschrittlicher
und moderner Form bereitgestellt wird, wobei freilich die jeweiligen Inbegriffe technischer
Fortschrittlichkeit im Laufe der Jahre einem erheblichen Wandel unterworfen waren.
Damit korrespondiert auch ein Wandel in der grundsätzlichen Wahrnehmung der
Aufgabe des Staates: Während in den siebziger Jahren die Lösung informationeller Probleme
noch in großen, durch den Staat vorzuhaltenden Infrastrukturen gesehen wurde
(Interministerielle Arbeitsgruppe 1971; BMFT 1975b), wurde Information in den achtziger
Jahren unter geänderten politischen Vorzeichen und angesichts einer kritischen
Wahrnehmung der Erfolge des IuD-Programms 1974-1977 (Bundesrechnungshof 1983;
BMFT 1983) als eine Aufgabe interpretiert, die weit gehend dem Markt überlassen bleiben
sollte. Der Staat soll nur noch subsidiär tätig werden (BMFT 1983; 1985).
Das grundlegende Bezugsproblem der Informationsbemühungen bleibt dagegen über
die Jahre erhalten: IuD – so die Vorstellung – wird deshalb notwendig, weil die quantitative
Entwicklung des Wissens, die vielfach mit Flutmetaphern beschrieben wird, es potentiellen
Nutzern ansonsten unmöglich macht, auf dem neuesten Stand des Wissens zu agieren. Das
gilt schon für spezialisierte Wissenschaftler.
„Wie viel schwieriger ist diese Aufgabe aber für den Betriebsmann, der in erster Linie
die Fabrikation leitet und überwacht und nur beschränkte Zeit dafür findet, sich über
die Ereignisse außerhalb seines Betriebes zu informieren.“ (Matthes 1951: I) (vgl.
auch Schürmeyer 1950: 78, Pietsch 1953: 168)
Neben der reinen Quantität der Publikationen stellen auch die Zunahme der
Publikationssprachen, die mangelnde Aktualität der Veröffentlichungen sowie
„Ballastinformationen“ Informationshemmnisse dar (BMFT 1975b: 12-15). Wenn aber die
potentiellen Nutzer auf Grund solcher Hemmnisse nicht auf dem Stand des Wissens agieren
können, droht Verschwendung:
„Sinnlose Vergeudung von Energie würde es bedeuten, wenn Forscher und Techniker
sich nicht vor allen neuen anlaufenden Arbeiten gründliche Kenntnisse von dem
verschaffen, was andere bereits erreicht oder in Angriff genommen haben. Ein großer
Führer der Wirtschaft hat einmal gesagt: ,Die Arbeit in den Bibliotheken ist billiger
3 Siehe vor allem Bundesrechnungshof 1962, 1983; Lechmann 1967; Interministerielle Arbeitsgruppe 1971;
BMFT 1975b, 1982, 1983, 1985, 1990; BMBF 1996.
3
als in Laboratorien‘. Er wollte zweifelsohne damit sagen, wer sich vorher gründliche
Kenntnisse von dem Stande der Wissenschaft und der technischen Entwicklung auf
seinem Spezialgebiet verschafft hat, spart Umwege, Zeit, Material, und damit letzten
Endes Geld.“ (Schürmeyer 1950: 78) (vgl. auch Balke 1961: 3; Bundesrechnungshof
1962: 23; BMFT 1975b: 59)
Ganz im Sinne dieser Argumentation wird IuD zunächst vorwiegend als ein Beitrag zur
Rationalisierung von Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung gesehen, und so ist die erste
wichtige informationspolitische Schrift in der Bundesrepublik nicht zufällig ein Gutachten des
Bundesrechnungshofs von 1962.
Information und Dokumentation – das klang in den bisherigen Ausführungen schon an
– ist in zweifacher Hinsicht sehr allgemein angelegt. Einerseits geht es – in ungeklärter
Terminologie – um verschiedenste Formen von Wissen, Informationen, Daten, Kenntnissen,
andererseits sind auch die verschiedensten Adressaten angesprochen. In seiner radikalsten
Form wird IuD zur Antwort auf ein generalisiertes Informationsproblem:
„Grundsätzlich sollen Informationen aus allen Wissensgebieten und Lebensbereichen
bedarfsgerecht allen Interessenten zur Verfügung stehen.“ (Interministerielle
Arbeitsgruppe 1971: 17)
Allerdings lassen sich primäre Adressaten-Gruppen unterscheiden: Adressaten der frühen
IuD-Bemühungen sind Fachleute, die selbst – zumindest grundsätzlich – nach externen
Wissensquellen suchen und diese in Form von Fachliteratur verarbeiten können und auch
tatsächlich verarbeiten. IuD ist in dieser Konstruktion nur als Hilfsmittel bei der aktiven
Suche gedacht.
Später werden verschiedene Adressaten-Gruppen nach ihren je spezifischen Bedarfen
unterschieden (BMFT 1975b: 15-18; 1982: 5f.; vgl. auch Toman 1964; Neubauer 1971: 12).
Dabei entwickeln sich – seit den siebziger Jahren – kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
zu einer besonders wichtigen Zielgruppe der IuD-Politik. Während ihnen eine bedeutsame
Rolle im Innovationsprozess zugeschrieben wird, der zunehmend in den Blickpunkt der
Politik gerät (siehe auch Abschnitt 3), diagnostiziert man informationelle Nachteile gegenüber
Großunternehmen, die sich spezialisierte IuD-Abteilungen leisten könnten. IuD soll hier
sowohl für Chancengleichheit im Wettbewerb sorgen als auch Innovationsvorgänge
beschleunigen helfen (BMFT 1975b: 1, 11, 1982: 5; bis hin zu BMBF 1996b).
Die Zielgruppe KMU unterscheidet sich aber insofern von der traditionellen
Zielgruppe „Fachleute“, als weder davon ausgegangen werden kann, dass sie aus eigener
Initiative nach Informationen sucht, noch dass ihr mit der Bereitstellung von Originalliteratur
geholfen ist.
Es werden zwei Ansatzpunkte gesehen, um Abhilfe zu schaffen: Eine grundsätzlich
stärkere Bedarfsorientierung der Angebote (inklusive des Ausbaus spezialisierter
Datenbanken (z.B. Patentdatenbanken)) einerseits, andererseits der Ausbau von
Informationsvermittlungs-Einrichtungen (BMFT 1975b: 18, 37f.; vgl. auch Ockenfeld 1984) –
mit fließendem Übergang zur problemorientierten Technologieberatung.4 Dabei müsse das
Wissen – vor allem sprachlich – in eine für die potenziellen Nutzer verstehbare Form gebracht
werden (vgl. in der Fachdiskussion dazu schon Lübeck (1960: 10); Pietrich (1965: 48);
Neubauer (1971: 12)). Gleichzeitig gilt es, – etwa durch Werbung – die Trägheitsschwelle der
Nutzer zu überwinden, denn: „Information erfordert Aktivität auch auf seiten des Empfängers.
Man kann jemandem ein noch so saftiges Schnitzel vorsetzen, essen muß er es selber“
(Vernimb 1971: 3).
4 Im Grunde vollzieht sich damit schon im IuD-Modell der Wandel zu einem „aktiven“ oder „aktivierten“
Technologietransfer.
4
Trotz aller Bemühungen wird dauerhaft die Unterausnutzung bestehender Potenziale
beklagt: zunächst eine Unterausnutzung des vorhandenen Wissens aufgrund unzureichender
IuD-Infrastruktur und sodann eine Unterausnutzung ebendieser Infrastruktur aufgrund eines
falschen (Informations-)Bewusstseins (BMFT 1982: 28).5
Bereits seit Ende der siebziger Jahre werden die Zusammenhänge von KMU,
Technologie und Information als Beitrag zum „Technologie-Transfer“6 auch im Rahmen einer
speziellen Technologiepolitik für KMU behandelt (insbesondere BMFT/BMWi 1978).
Während also auf der einen Seite Zielgruppen mit ihren besonderen Bedarfen in den
Blick geraten, wird das Spektrum der relevanten Information seit Anfang der achtziger Jahre
auf so genannte „Fachinformation“7 eingeschränkt, die wie folgt definiert wird:
„Fachinformation ist jener wichtige Teil allen Wissens und aller Information, der für
den Fachmann bei der Bewältigung seiner Aufgaben nützlich ist; diese Definition ist
damit nicht scharf abgrenzbar; sie klammert aber weite Bereiche allgemeiner
Information aus, z.B. Informationen, die der Unterhaltung und Werbung oder als
Lehrmaterialien dienen; trotz mancher Unschärfe hat sich der Begriff
Fachinformation als brauchbar erwiesen“ (BMFT 1982: 4; Hervorhebung im
Original).
Der Begriff der Fachinformation ist also nach wie vor sehr allgemein gehalten.8 Er wird nicht
nach Entstehungskontexten eingeschränkt, umfasst sowohl wissenschaftliches Wissen wie
auch andere Wissens- und Informationsformen.9 Umso auffälliger ist, dass eine wichtige
Einschränkung das IuD-Modell durchzieht: Es geht ausschließlich um „vorhandenes Wissen“,
das es – ggf. komprimiert und „in eine für die Praxis verständliche Sprache“ (Pietrich 1965:
48) übersetzt – zugänglich zu machen gilt. Abgesehen von dem hierbei zu Tage tretenden
Wissensbegriff ist im Vergleich mit anderen Modellen (siehe Abschnitte 3 und 4) auffällig,
dass es nicht darum geht, von der Wissenschaft zu verlangen, auf die Bedürfnisse der Praxis
ausgerichtetes Wissen zu generieren.
Ohnehin haben Wissenschaftler – soweit sie keine Informationswissenschaftler sind –
keine besondere Aufgabe innerhalb des IuD-Modells. Sie sind selbst nur Adressaten von IuD.
Allenfalls wird von ihnen erwartet, informative Abstracts zu schreiben, Texte mit Standard-
Thesauri zu verschlagworten oder sich überflüssiger Publikationen zu enthalten (Weinberg
Report 1963)10
. Im Grunde aber soll IuD die Wissenschaftler nicht besonders belasten (z.B.
Bundesrechnungshof 1962: 2), sondern vor allem durch spezialisierte Einrichtungen
durchgeführt werden. Diese sind, das sollte hervorgehoben werden, im Wesentlichen als
selbständige Einrichtungen außerhalb der Hochschulen gedacht. Das IuD-Modell enthält also
auch für die Hochschulen als Organisationen keinerlei neue Anforderungen.
Insgesamt scheint die Thematisierung der speziellen Vermittlungs- und Beratungs-
Angebote für Wirtschaftsunternehmen zunehmend aus dem IuD-Diskurs im engeren Sinne
hinauszuweisen, wiewohl die grundlegende Argumentation mindestens bis zum Programm
der Bundesregierung 1996-2000: „Information als Rohstoff für Innovation“ kontinuiert wird.
Die Informationspolitik der Bundesregierung wandelt sich währenddessen – vor allem auch
5 Dazu kritisch Bundesrechnungshof 1983.
6 Bereits Ehmke (1974: 10) sieht IuD als Beitrag zum „Technologie-Transfer“.
7 Die entsprechenden Programme der Bundesregierung heißen folgerichtig Fachinformationsprogramme.
8 Zu allgemein, wie der Präsident des Bundesrechnungshofes in seinem Gutachten kritisiert
(Bundesrechnungshof 1983: 23ff.).
9 Im Übrigen erlaubt die Tatsache, dass die Nützlichkeit von Fachinformation schon in den Begriff eingebaut
ist, deren Relevanz fast tautologisch zu begründen. Das obige Zitat geht weiter: „Für die Volkswirtschaft ist
die Verfügbarkeit von Fachinformation daher von großer Bedeutung“ (BMFT 1982: 4).
10 Dieser amerikanische Diskursbeitrag ist für die deutsche IuD-Diskussion von einiger Bedeutung (vgl.
Ehmke 1974: 6f.)
5
angesichts neuer technischer Entwicklungen – allmählich von einer Informations- und
Dokumentations- zu einer Informations- und Kommunikationspolitik. Diese ist eingebunden
in Vorstellungen einer entstehenden Informationsgesellschaft, wie sie z.B. im sog
Bangemann-Report (1994) beschrieben wird.
3 Das Kooperations-Modell
Das Kooperations-Modell wird mit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in der deutschen
Forschungs- und Technologiepolitik prominent (Kommission 1977; BMFT/BMWi 197811
)
und bestimmt eindeutig die Transferdiskussion der achtziger Jahre und auch die
Stellungnahmen der großen Wissenschaftsorganisationen zum Wissens- und
Technologietransfer (vor allem Wissenschaftsrat 1986). Ebenso bestimmt es die
Selbstbeschreibungen der in den siebziger und achtziger Jahren gegründeten Transferstellen
(z.B. Allesch et al. 1979). „Die Aufregung um den Technologietransfer“ kulminiert Mitte der
achtziger Jahre und ruft auch Kritiker des staatlichen „Technologietransfer-Aktivismus“
(Staudt 1984a: 15) auf den Plan. Kritisiert wird vor allem ein „naives“ Transfer-Modell.
Neben der Idee der Machbarkeit technischer Entwicklung12
zeichne sich dieses Modell, so die
Kritiker, durch zwei weitere grundlegende Fehlannahmen aus. Zum einen werde davon
ausgegangen, dass Transfer vor allem ein Informationsproblem sei und sich durch mehr und
bessere Informationen lösen lasse, zum anderen gehe das naive Modell von der Existenz einer
„Technologiehalde“13
aus, die durch Transferbemühungen abgeräumt werden könne (Staudt
1984a, 1984b; Kayser 1985). Es ist deutlich, dass sich diese Kritik primär gegen das ohnehin
langsam an Bedeutung verlierende IuD-Modell richtet, während sich zeitgleich das
Kooperations-Modell zum Leitkonzept des Transferdiskurses entwickelt.
Im Gegensatz zum IuD-Modell wird im Kooperations-Modell davon ausgegangen,
dass der Transfer von wissenschaftlichem Wissen in die wirtschaftliche Praxis nur durch den
direkten persönlichen Kontakt zwischen Wissenschaftlern und Praktikern gelingen kann.
Denn:
„Die Diffusion von Innovationen zwischen zwei sozialen Institutionen hängt dabei
entscheidend davon ab, ob Kommunikation auf der Basis persönlicher Kontakte
zustande kommt.“ (Kommission 1977: 283; vgl. auch MWF 1984: 53; aber auch noch
Wissenschaftsrat 1996: 72)
Als Grundproblem werden vor allem – tatsächliche und vermeintliche14
– kulturelle
Differenzen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft identifiziert (Allesch et al. 1979: 48;
MWF 1980: 119). Differenzen, die nur über persönliches Vertrauen zwischen den Beteiligten
überwunden werden können.
„Technologietransfer setzt gegenseitiges Vertrauen der Partner voraus; nur so kann
ein fruchtbringender Austauschprozeß entstehen. Wissenschaftler, die mit kleinen und
mittleren Unternehmen zusammenarbeiten wollen, müssen daher bereit sein, auf deren
Probleme und Denkgewohnheiten einzugehen und dabei für ihre sonstige Arbeit
geltenden Kriterien teilweise zurückzustellen. Unternehmen ihrerseits müssen
11 Der letztgenannte Text verhandelt unter dem Stichwort Technologie-Transfer sowohl IuD als auch
Kooperation – allerdings auffällig unverbunden nebeneinander – und markiert insofern ein
Übergangsstadium der Modelle (vgl. BMFT/BMWi 1978: 34-39).
12 Eine Vorstellung, die bis heute die Forschungs- und Technologiepolitik prägt (vgl. Anlage 3b).
13 Die Abarbeitung an einem naiven Transfermodell, das einst von „Technologiehalden“ ausgegangen war,
wird zu einer Art Folklore des deutschen Transferdiskurses der späten Achtziger (vgl. Streit 1986; MWF
1988: 72; Schmidt 1990; Starnick 1990).
14 Gemeint sind im Diskurs als tatsächlich oder vermeintlich interpretierte Differenzen.
6
Verständnis für wissenschaftliches Arbeiten aufbringen.“ (Forschungskommission
Baden-Württemberg 1983: 24)
Im Gegensatz zum IuD-Modell, das einen linearen und hierarchischen Prozess der
Weiterleitung impliziert, verläuft der Prozess der Nutzbarmachung im Kooperations-Modell
als Dialog zwischen ungleichartigen, aber gleichrangigen Partnern.15
„Zusammenarbeit ist für Hochschulen und Wirtschaft auf Dauer nur fruchtbar, wenn
beide Partner den Austausch von Wissen und Personen gleichermaßen fördern und
"Einbahnstraßen" vermeiden. Das setzt voraus, daß Hochschulen und Wirtschaft auf ihre
spezifischen Aufgaben, Strukturen und Verfahrensweisen Rücksicht nehmen und die
jeweiligen Verantwortlichkeiten klar definieren. Bei der Zusammenarbeit müssen
Hochschulen und Wirtschaft sich als gleichberechtigte Partner anerkennen und ihre
jeweilige Entscheidungsfreiheit wahren. Sie sollten ihre Beiträge zur Kooperation nach
den für sie jeweils spezifischen und typischen Bedingungen leisten.“ (Wissenschaftsrat
1986: 16; vgl. auch MWF 1980: 116f., 119; 1988: 72)
Die Universitäten sollen sich über diesen Dialog an den technologischen Bedarfen vor allem
regionaler KMU orientieren und damit deren Innovationsfähigkeit stärken.
„Aufgabe der Experten ist die Vermittlung zwischen Forschung und Praxis in beiden
Richtungen. Dabei werden einerseits Ergebnisse anwendungsorientierter Forschung in
die betriebliche Praxis vermittelt, wo die Weiterentwicklung zu marktfähigen Produkten
und Verfahren erfolgt. Andererseits werden Problemstellungen der Praxis in die
Universitäten gemeldet, um sie zum Gegenstand von Forschungsbemühungen zu machen.
Technologie-Transfer ist damit eine ständige Kommunikation zwischen Forschung und
Praxis zum Abbau von Vorurteilen und zur gegenseitigen Reflexion. Als Ergebnis erfolgt
die Öffnung der Wissenschaft für eine stärkere Praxisorientierung und eine Förderung
des Verständnisses der Praxis für wissenschaftliche Arbeitsweisen.“ (Allesch et al. 1979:
21)
Das letztgenannte Zitat ist in zwei Hinsichten besonders interessant. Zum einen weckt es
Zweifel daran, wie gleichberechtigt der Dialog tatsächlich gedacht ist. Immerhin sind die
Beiträge der zwei Seiten sehr ungleich verteilt: Die Wissenschaft liefert das gefragte Wissen,
die Unternehmen können lediglich ihre Problemstellungen melden, in der Hoffnung, von der
Wissenschaft wiederum mit Lösungsansätzen versorgt zu werden. Jedenfalls bleibt hier trotz
aller Rückmeldung im Grundsatz ein lineares Innovations-Modell erhalten. Zum anderen
verweist der Text auf die Rolle von Vermittlern. Vermittlungsinstanzen (wie etwa
Transferstellen16
) sollen dabei helfen, Kontakte herzustellen, Verständnis für die jeweils
andere Seite zu schaffen und Missverständnisse auszuräumen:
„Unerläßlich für den Technologietransfer ist der unmittelbare Kontakt zwischen
Technologieanbieter und Technologieempfänger. Diesen unmittelbaren Kontakt
zustande zu bringen und etwaige Hemmnisse beim Dialog ungleicher Partner zu
15 Dies ist freilich auch das Transferideal des Kritikers Staudt. Dieser setzt auf die „vertrauensvolle
Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Praxis, vor allem auf der Basis personenbezogener Kontakte.
Das große Vertrauenspotential, auf dem die personenbezogenen Kontakte gründen, muß wachsen und darf
nicht gestört werden, wenn man den Technologie-Transfer fördern will“ (Staudt 1984b: 28).
16 Transferstellen haben sich immer auch als Einrichtungen verstanden, die eine „Schaufensterfunktion“
wahrnehmen und durch verschiedene Informierungsaktivitäten nach außen auf das Angebot der
Hochschulen aufmerksam machen (Reinhard/Schmalholz 1996: 111f.). Proklamiertes Ziel dieser
Bemühungen war aber grundsätzlich eine Kooperation zu ermöglichen.
7
überbrücken, ist Aufgabe des Technologievermittlers.“ (Forschungskommission
Baden-Württemberg 1983: 24)
Die Einschätzung der Wirksamkeit von Transferstellen war allerdings einem erheblichen
Wandel unterworfen. So erwartete die Kommission für den wirtschaftlichen und sozialen
Wandel von einer weiterentwickelten Förderung der seinerzeit schon in Ansätzen
existierenden Transfereinrichtungen einen entscheidenden „Beitrag zur Modernisierung der
Volkswirtschaft und zur Bewältigung künftiger struktureller Anpassungsprozesse“
(Kommission 1977: 287). Lange galten Transferstellen als organisatorischer Ausweis einer
verstärkten Zusammenarbeit von Universitäten und Wirtschaftsunternehmen. Erst im Laufe
der Zeit sind die optimistischen Einschätzungen der siebziger und frühen achtziger Jahre
nüchterneren Beurteilungen gewichen. Die Entwicklung lässt sich gut an drei Stellungnahmen
des Wissenschaftsrates ablesen, die jeweils im Abstand von ungefähr zehn Jahren publiziert
wurden. Mitte der siebziger Jahre setzte der Wissenschaftsrat noch Hoffnungen in
Vermittlungsinstanzen, die aus heutiger Sicht eher kühn wirken:
„Wenn potentielle Anwender Anwendungsmöglichkeiten nicht erkennen, ist
Vermittlung zwischen Forschungs- und Anwendungsbereich durch Dritte erforderlich,
falls nicht der Forscher selbst diese Funktion übernehmen kann. Der Vermittler
könnte den Anwender auch technisch und betriebswirtschaftlich beraten oder
notwendig werdende zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
übernehmen.“ (Wissenschaftsrat 1975: 29; vgl. auch MWF 1980: 119f.)
Schon 1986 fordert der Rat eher skeptisch:
„Beratungs- oder Technologietransferstellen sollten regelmäßig einer
Erfolgskontrolle unterzogen werden, vor allem dann, wenn Aufgaben wahrgenommen
werden, die über die Informationsvermittlung hinausgehen. Transferstellen sollten nur
dann fortgeführt werden, wenn sie Erfolge vorweisen können.“ (Wissenschaftsrat
1986: 27)17
Zehn Jahre später will der Wissenschaftsrat „vor dem Hintergrund des erheblichen
Aufwandes für solche Transferinstrumente kritisch überprüft“ wissen, inwieweit
Transferstellen tatsächlich Kooperationen in Form projektförmiger Forschung vermitteln
(Wissenschaftsrat 1996: 72).
Das Kooperations-Modell wird – nicht zuletzt in den Begründungs- und
Legitimationsschriften der Transferstellen – in einen Kontext mit Stichworten wie Innovation,
Strukturwandel, KMU und Region gestellt. Das Modell fügt sich damit in eine allgemeine
Debatte um Innovation und Strukturwandel ein. Zwar findet der Innovationsbegriff schon in
einzelnen informationspolitischen Schriften seinen Platz (z.B. BMFT 1975b), aber erst Ende
der siebziger Jahre avanciert er zum Leitbegriff der deutschen wirtschafts- und
technologiepolitischen Diskussion. Vor allem die Kommission für wirtschaftlichen und
sozialen Wandel hebt die Bedeutung aktiver Neuerungstätigkeit (Innovation) für die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hervor, und beklagt eine unzureichende staatliche
Innovationsförderung, namentlich für KMU (insbesondere 255-264). Ganz in diesem Sinn
stellt das forschungs- und technologiepolitische Gesamtkonzept der Bundesregierung für
kleine und mittlere Unternehmen (BMFT/BMWi 1978) den Innovationsbegriff in den
17 Dagegen stellt das Nordrhein-Westfälische Wissenschaftsministerium 1988 klar: „Zahlreiche
Forschungsergebnisse sind der Industrie zugänglich gemacht, Kontakte geknüpft und Zusammenarbeiten
intensiviert worden. An diesem Prozeß haben die Transferstellen einen erheblichen Anteil. Ihre Einrichtung
hat sich bewährt.“ (MWF 1988: 79)
8
Mittelpunkt seiner Argumentation.18
Innovationen sollen KMU die „Anpassung an den
strukturellen Wandel“19
erleichtern (3). Und: „Für die künftige Leistungs- und
Wettbewerbsfähigkeit hat die Innovationstätigkeit, insbesondere die Entwicklung
vermarktungsfähiger neuer Technologien, entscheidende Bedeutung“ (10).
Verstärkte Bemühungen um Technologie-Transfer im Sinne des Kooperations-
Modells wurden zudem explizit als Ausdruck einer „Öffnungspolitik der Hochschulen“
(Bredemeier 1984) verstanden. Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre wird das
Verhältnis von Hochschulen zu ihrer jeweiligen Region auf zahlreichen Symposien beleuchtet
(vgl. Tagungsbände Universität Konstanz 1979, Kellermann 1982, Dt. Städtetag 1982,
OECD/CERI 1982, Webler 1984). Zeitgleich befassen sich Fachzeitschriften wie die
„Informationen zur Raumentwicklung“ oder „Raumforschung und Raumordnung“ mit Fragen
regionalen Technologietransfers und regionaler Innovationsförderung durch Hochschulen
(Engel/Walter 1978; Ganser 1980; Recker 1981; Kistenmacher/Eberle/Hildenbrand 1982;
Priebe 1983; Landfried/Hildenbrand/Fuchs 1983). Im Gegensatz zu älteren Diskussionen zum
Verhältnis von Hochschulen und Region (z.B. Engelbrech 1978) geht es hierbei weniger um
Effekte von Hochschulen auf ihre jeweilige Region als um absichtsvoll erbrachte Leistungen
für diese (Webler 1984: 3f.). Zudem treten die regionalen Innovationspotenziale der
Hochschulen in den Vordergrund (vgl. dazu auch MWF 1980: 94; 1988: 72; Wissenschaftsrat
1988: 25). Herausgearbeitet wird u.a. die besondere Lage von Hochschulneugründungen in
strukturschwachen Regionen (z.B. die Universität Kaiserlautern in der Westpfalz (Kayser
1981; Kistenmacher/Eberle/Hildenbrandt 1982; Landfried/Hildenbrandt/Fuchs 1983)). Aber
auch der mögliche Beitrag der Ruhrgebietshochschulen zum Strukturwandel in ihrer durch
einschneidende wirtschaftliche Umbrüche gekennzeichnete Region wird eruiert (vgl.
Bredemeier 1984; ITZ 1984).
Die Öffnung der Hochschulen gegenüber den Bedürfnissen der regionalen Wirtschaft
wird zwar in der Regel wiederum mit deren Innovationsbedarfen begründet, allerdings weist
die Hochschulforschung Anfang der achtziger Jahre noch auf einen anderen Aspekt hin: Die
Hochschulen befänden sich in einer Legitimationskrise, die verschiedene Ursachen habe,
insbesondere aber drohe Rückbau angesichts eines prognostizierten massiven Rückgangs der
Studierendenzahlen – Webler (1984b: 348) spricht von 40% zwischen 1985 und 1995 – wenn
sich nicht „Neue Aufgaben der Hochschulen“ (Neusel/Teichler 1980) fänden.
„Nach den Anstrengungen um den quantitativen Ausgleich des Studienangebotes und
um die Bewältigung des "Studentenbergs" kann in den neunziger Jahren mit einem
Abnehmen der Studentenzahlen im Bereich der hochschulischen Erstausbildung
gerechnet werden. Damit eröffnen sich für die Hochschulen Chancen und Gefahren,
die in den Diskussionen der sechziger und siebziger Jahre noch keine Rolle gespielt
haben.“ (Neusel/Teichler 1980:8; vgl. auch Steube 1980)
Eine solche neue Aufgabe können die Hochschulen „vor ihren Toren“ (MWF 1980: 94)
finden, indem sie sich gegenüber ihrer Region öffnen:
„Das Verhältnis von Universität und Region ist in jüngster Zeit u.a. dadurch aktuell
geworden, daß sich die Universitäten in einer Krise öffentlicher Wertschätzung
befinden und sich zusätzliche Legitimation durch den Nachweis ihrer
Problemlösungsfähigkeit für regionale Aufgaben und Dienstleistungen erhoffen – im
Gegensatz zu den Zweifeln an den Segnungen der Wissenschaft auf anderen
18 Vgl. Fußnote 11.
19 Im Gegensatz zum Gesamtkonzept behandelt die Kommission Wandel allerdings als etwas, das gestaltet
werden kann und soll.
9
Gebieten.“ (Webler 1984a: 2; vgl. auch Teichler 1982: 37; Ockenfeld 1984; Voelzkow
1988; aber auch Wissenschaftsrat 1988)
Die Öffnung der Hochschulen gegenüber ihrer Region wurde aber nicht nur durch
Transferstellen betrieben, sondern z.B. auch durch „Wissenschaftsläden“ (z.B.
Schlosser/Steffen 1985; Welzer 1991) angestrebt. Wiewohl sich Wissenschaftsläden
durchgängig als eine Art Gegenentwurf zu den Transferstellen stilisieren, ist auffällig, wie
ähnlich sich an dieser Stelle Diskurs und Gegendiskurs sind. Beide betonen die Bedeutung
eines Dialoges ungleichartiger, aber nichtsdestoweniger gleichrangiger Partner sowie die
steigende Relevanz, die Wissenschaft erlangt, soweit sie sich an gesellschaftlichen
Bedürfnissen orientiert. Allerdings unterscheiden sich die beiden Diskurse deutlich
hinsichtlich des Ausmaßes an Wandel der Wissenschaft – und der Gesellschaft als ganzer –
den sie durch Kooperation ermöglicht sehen oder für wünschenswert halten.
Mit dem Kooperations-Modell wird den Wissenschaftlern eine neue Rolle im
Transferprozess zugeschrieben. Sie sollen nicht nur Wissen produzieren, sondern sich um
dessen Transfer selbst in einem kooperativen Dialog mit potentiellen Nutzern bemühen. Das
impliziert auch, dass die Forscher ihre eigenen „Hauptaufgaben“ Forschung und Lehre durch
die im Dialog gewonnen Informationen aus der „Praxis“ beeinflussen lassen oder sie sogar
daran orientieren sollen. Auch die Hochschulen bekommen mit dem Kooperations-Modell
eine neue Aufgabe verordnet, sie sollen sich aktiv um die Anbahnung und Intensivierung von
Kooperationen bemühen, indem sie Vermittlungsinstanzen, wie z.B. Transferstellen,
einrichten.
Allerdings ergeben sich auch Kontinuitäten zum IuD-Modell: Nach wie vor werden
institutionellen Differenzen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft angenommen. Aus der
eher impliziten Unterstellung des IuD-Modells wird hier sogar das zentrale Bezugsproblem.
Zudem versteht auch das Kooperations-Modell wissenschaftliche Forschung als eine klar
separierbare Phase eines im Wesentlichen immer noch linear gedachten Innovationsprozesses.
4 Das Blurring-of-Boundaries-Modell
Seit den neunziger Jahren schließlich deutet sich – vor allem in den Schriften der
Bundesregierung – ein neues Modell an. Forschung wird jetzt – jedenfalls in einigen
Bereichen – als Bestandteil eines umfassenden Innovationsgeschehens gedeutet:
„Forschung ist nicht Selbstzweck. Forschung soll auf lange Frist zu wirtschaftlichem
Wachstum und neuen Arbeitsplätzen führen. Hierzu müssen alle Glieder der
Innovationskette – angefangen mit der Grundlagenforschung bis zur Diffusion neuer
Produkte und Verfahren – miteinander vernetzt sein.“ (BMWi/BMBF 2002: 35)
Dieses als hoch komplex wahrgenommene Innovationsgeschehen, das häufig mit Netzwerk-
und System-Metaphern beschrieben wird, sei – so die Annahme – durch Merkmale wie
Rekursivität, vielfältige Wechselwirkungen der Elemente oder Feedbackschleifen
gekennzeichnet. Im Gegensatz dazu orientierte sich das Kooperations-Modell eher am
Leitbild einer dyadischen Beziehung zwischen Wissenschaftler einerseits und Anwender
andererseits, die bestenfalls durch eine Vermittlung betreut gedacht wurde. In der
komplexeren Situation des Blurring-of-Boundaries-Modells wird nun nicht mehr Vermittlung,
sondern professionelles Management gefordert. Dabei rückt auch die „Effizienz“ des
Transferprozesses ins Blickfeld (BMBF 2000: 56; BMBF/BMWi 2001: 1; BMWi/BMBF
2002: 35). Allerdings kann sich auch eine neuere Forderung nach professionellem
10
Transfermanagement an den Grundvorstellungen des Kooperationsparadigmas orientieren,
wie das folgende Beispiel belegt:
„Hochschulen müssen in die Lage versetzt werden, diesen Austauschprozess
professionell und in gleichberechtigter Kooperation mit den Unternehmen zu
gestalten, zumal er laut Hochschulrahmengesetz neben Forschung und Lehre eine
Kernaufgabe der Hochschulen ist. Dabei gilt es, traditionelle Formen des
Wissenstransfers in moderne Strukturen einer Public Private Partnership zu
überführen. Angesichts der Differenzen im Selbstverständnis und in den Strukturen in
Hochschulen und Unternehmen ist eine tragfähige Kooperationsbasis herzustellen.
Dazu bedarf es eines professionellen Managements, das diese institutionellen
Spezifika ebenso berücksichtigt wie die verschiedenen Ebenen des Austausches.“
(HRK/BDA 2003: 26f.)
Im BoB-Modell wird ein lineares Innovations-Modell (das für das Kooperations-Modell noch
typisch war) ebenso explizit abgelehnt wie die Unterscheidung von Grundlagenforschung und
angewandter Forschung20
:
„Herkömmliche ,Transfer‘-Vorstellungen im Sinne eines linearen Prozesses von der
Grundlagenforschung über die anwendungsorientierte Forschung hin zur Innovation
überzeugen immer weniger. Innovation ist ein vielfältig in die Forschung
rückgekoppelter Prozeß. Partnerschaftliche Zusammenarbeit an gemeinsamen
Projekten ist daher das Zukunftsmodell und nicht Stafettenübergabe von Stufe zu
Stufe.“ (BMBF 1996: 28; siehe auch BMBF 2000: 27, 2004: VI; BMWi/BMBF 2002:
35; BMBF/BMWi 2001: 1)
Auf der zeitlichen Ebene wird angenommen, dass die Kooperation der Forschung
vorausgehen sollte, um etwaige Nutzerinteressen schon in die Forschungsplanung einbeziehen
zu können:
„Gerade auch technisch-wissenschaftliches Wissen muß heute bereits mit Blick auf die
Problemlösung und vorgesehene Anwendung gewonnen werden. Innovationen werden
eine größere Erfolgschance haben, wenn die potentiellen Anwender der FuE-Arbeiten
selbst schon im Hinblick auf das zukünftige Marktpotential mitgestalten können [...]
Forschung als Knotenpunkt im interaktiven Wissenssystem moderner Gesellschaften
gewinnt so nochmals an Bedeutung.“ (BMBF 1996a: 6)
„Für diese Art von Forschung stellt sich die Frage eines effizienten
Technologietransfers; das bedeutet vor allem die rechtzeitige Zusammenarbeit von
Wissenschaft und Wirtschaft bei der Themenstellung und Begleitung von FuE-
Vorhaben“ (BMWi/BMBF 2002: 35)
Dabei entstehen Netzwerke, in denen die Grenzen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
durchlässiger und fließender werden.
„Bisherige Grenzen zwischen öffentlicher Forschung und Wirtschaft durchlässig zu
machen, bleibt damit ein Hauptpunkt für die Gestaltung der Forschungslandschaft.
Forschung muss dort, wo sie für die Wirtschaft relevant ist, mit wachsender
Marktnähe gleitend aus dem öffentlichen Bereich in die Wirtschaft übergehen
können.“ (BMBF 2000: 28)
20 Was im Übrigen nicht bedeutet, dass diese Begriffe nicht verwendet würden (siehe zuletzt BMBF 2004: III).
Vgl. auch den Begriff der „anwendungsbezogenen Grundlagenforschung“ (BMFT1988: 8).
11
Dazu gehört auch, dass gesellschaftliche – und das heißt vor allem: ökonomische – Kriterien
zu Erfolgsmaßstäben der Wissenschaft erklärt werden können:
„Ein wichtiger Erfolgsmaßstab für die deutsche Forschung ist die
Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Denn neue Forschungsergebnisse gereichen erst
dann zur wirtschaftlichen Wertschöpfung, wenn sie in am Markt erfolgreiche
Innovationen umgesetzt werden können.“ (BMBF 2000: 56)
„Forschung ist nicht Selbstzweck. Forschung soll auf lange Frist zu wirtschaftlichem
Wachstum und neuen Arbeitsplätzen führen.“ (BMWi/BMBF 2002: 35; vgl. auch
BMBF 1999: 17f.)
Auch ein anderer wichtiger Aspekt dieses Modells impliziert eine zunehmende Unschärfe
traditioneller institutioneller Grenzen: Häufig werden wirtschaftliche Tätigkeiten der
Hochschulen selbst gefordert: Insbesondere sind dies die Vermarktung von Schutzrechten
(BMBF 1996c; 2000: 56; vgl. dagegen BMFT 1975a: 18) und Ausgründungsaktivitäten
(BMBF 2000: 28; siehe auch Wissenschaftsrat 1996: 72f.;. vgl. dagegen Wissenschaftsrat
1986: 36)(zu beiden Themenfeldern siehe BMBF/BMWi 2001). Die „unternehmerische
Universität“ ist allerdings nicht unumstritten, so stellt der Hochschulverband fest:
„Wissenschaftstransfer ist Kooperation mit Unternehmen. Der Wissenschaftler als
Unternehmer muß die Ausnahme bleiben“ (Hochschulverband 1991: 136).
Die deutsche Forschungs- und Innovationspolitik setzt – der perzepierten
Netzwerkförmigkeit erfolgreicher Innovationstätigkeit angemessen – explizit auf die
Förderung von Netzwerken (Krücken/Meier 2003). Beispiele für solche Aktivitäten sind das
Programm „Förderung von innovativen Netzwerken – InnoNet“ des BMWi, die vom BMBF
getragene Sonderfördermaßnahme InnoRegio – wobei letztere, wie der Name schon vermuten
lässt, explizit regionale Netzwerke fokussiert, oder der Förderwettbewerb
Netwerkmanagement-Ost (NEMO) des BMWA der die Bildung innovativer(!) regionaler(!)
Netzwerke(!) speziell von kleinen und mittleren Unternehmen(!) in den ostdeutschen Ländern
fördert (BMBF 2004: 351). Das BMBF setzt zudem mit Nachdruck auf so genannte
„Kompetenznetze“, die „sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Instrument in der
Förderung entwickelt“ (BMBF 2004: VII) haben. Denn „leistungsfähige Kompetenznetze
sichern die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im internationalen Wettbewerb“ (BMBF
2000: 60). Das BMBF folgt damit Empfehlungen des Rates für Forschung, Technologie und
Innovation (1998: 10), für den „funktionierende Netzwerkstrukturen in Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik“ Voraussetzungen für „Kompetenz im globalen Wettbewerb“
darstellen. Sichtbar gemacht werden die Kompetenznetzwerke mit dem Online-Portal
„kompetenznetze.de“, das gleichermaßen dem internationalen FuE Standortmarketing wie als
Recherchequelle und Kommunikationsplattform dienen soll (BMBF 2000) und mit dem
bezeichnenden Slogan „Innovation braucht Netze“ wirbt. Deshalb kann es nicht überraschen,
dass das BMBF „mehr Innovation durch Kooperation und Vernetzung“ (BMBF 2004: IX)
anstrebt.
Wiederum ändert sich mit dem Modell die Rolle, die der Wissenschaft zugeschrieben
wird: Als Teil eines komplexen, durch vielfältige Rückkopplungen gekennzeichneten
Innovationsgeschehens ist wissenschaftliche Forschung in ein Netzwerk eingebettet, in dem
die Isolierung einer klar unterscheidbaren wissenschaftlichen Identität zunehmend
schwieriger wird. Auch die Hochschule bekommt eine neue Rolle: Sie tritt – im Gegensatz
zum durch klare Rollenteilung bestimmten Kooperations-Modell – selbst als wirtschaftlicher
Akteur auf. Die beiden genannten Veränderungen wirken vor allem darauf hin, dass die
institutionellen Grenzen, die im Kooperations-Modell noch von zentraler Bedeutung waren,
im Blurring-of-Boundaries-Modell zunehmend unscharf erscheinen.
12
5 Die Überlagerung von Modellen
Dass sich drei genannten Modelle analytisch unterscheiden lassen, bedeutet nicht, dass
empirisch vorkommende Texte jeweils genau einem Modell zuzurechnen wären. Als
illustratives Beispiel hierfür sei ein Beitrag von Hans Kurt Tönshoff in der Zeitschrift
„Forschung – Mitteilungen der DFG“ (heute „Forschung – Das Magazin der Deutschen
Forschungsgemeinschaft“) angeführt. Der Autor verknüpft in schneller Folge für alle drei
Modelle typische Aussagen. Das gilt für das IuD-Modell:
„Forschungsergebnisse können nur genutzt werden, wenn sie den potentiellen Nutzern
bekannt sind. Rasche und umfassende Information der „Abnehmer“ ist daher wichtig,
wissenschaftliche Veröffentlichungen der Forscher allein sind meist nicht hinreichend.
Kolloquien, Seminare, Fachtagungen zusammen mit der Wirtschaft helfen, den
Informationsfluß zu verbessern.“ (Tönshoff 1994: 17)
Das Kooperations-Modell:
„Der Transfer von Ergebnissen ist jedoch kein Einbahnstraßen-Problem. Vor allem
durch Zusammenarbeit und unmittelbaren Gedankenaustausch zwischen Empfänger
und Lieferant kommt es zu einem wirkungsvollen Wissensübergang. Der Transfer
erfolgt über Köpfe.“ (Tönshoff 1994: 17)
Und das Blurring-of-Boundaries-Modell:
„Daher müssen Forscher sich fragen, ob die Vorstellung vom Stafettenübergang von
der erkenntnisorientierten zur anwendungsorientierten Grundlagenforschung bis zur
produktorientierten Forschung und Entwicklung noch haltbar ist oder ob nicht
vielmehr nach Instrumenten gesucht werden muß, eine stärkere Vernetzung dieser
Arbeitsgebiete und einen raschen Ergebnisübergang zu erreichen. Eine abgestimmte
Parallelisierung der Anstrengungen in Forschung und Entwicklung könnte sich
schnell wandelnden Märkten eher gerecht werden.“ (Tönshoff 1994: 17)
Dieses Beispiel belegt, dass die älteren Modelle mit der Entstehung und der sich
entwickelnden diskursiven Dominanz neuer Modelle nicht verschwinden. Wichtige Aussagen
und Metaphern – wie im obigen Beispiel die „Einbahnstraße“ des Kooperations-Modells –
werden kontinuiert und können mit anderen Modellen kombiniert werden. Insofern kann auch
nicht behauptet werden, dass das BoB-Modell – zumal in seiner idealtypischen Form – die
traditionelleren Vorstellungen vollständig verdrängt hätte. Hinzu kommt, dass das BoB-
Modell, wie gesehen, im Wesentlichen durch die Schriften der Bundesregierung(en) getragen
wird (vgl. Belege), aber nur sehr begrenzt durch die anderen zentralen Institutionen der
Wissenschaftspolitik. Deshalb kann der Diskurs zum Wissens- und Technologietransfer nur
mit Einschränkungen als eine zeitliche Folge diskursiver Modelle verstanden werden.
13
6 Zusammenfassung
In der deutschen Transferdiskussion können drei grundlegende Modelle der planvollen
Nutzbarmachung wissenschaftlichen Wissens für die wirtschaftliche Praxis idealtypisch
unterschieden werden. Als zeitliche Sukzession gelesen, was wie gesagt nur mit
Einschränkungen zulässig ist, ergibt sich zum einen das Bild zunehmender Verkomplizierung
des Transferprozesses. Ganz zu schweigen von der traditionellen Vorstellung einer quasi
naturwüchsigen und ganz unproblematischen Nutzbarwerdung wissenschaftlichen Wissens,
wird der Prozess vom IuD-Modell, indem nur die Bereitstellung des Wissens problematisch
war, über das Kooperations-Modell, das einen vertrauensbasierten Dialog kulturell differenter
Partner erforderte, bis hin zum Blurring-of-Boundaries-Modell, das einen umfassenden
Innovationsprozess und verschiedenste Feedbackschleifen impliziert, zunehmend komplexer.
Zum anderen entsteht das Bild zunehmender Involviertheit von Wissenschaftlern und
wissenschaftlichen Einrichtungen in den Transfer-Prozess. Im BoB-Modell scheinen sich gar
die institutionellen Grenzen von Wissenschaft und Wirtschaft in einem umfassenden
Innovationsgeschehen aufzulösen.
Literatur
Allesch, J./Fiedler, H./Scheffen, C. (1979): Pilotstudie Technologietransfer. Bericht für die
Zeit vom 1.12.1977-1.12.1978. 3.Auflage. Berlin: TU, Kontaktstelle Planung im
öffentlichen Dienst.
Balke, Siegfried (1961): Wirtschaft und Dokumentation. In: NfD 12, 1: 1-5.
Bredemeier, Willi (1984): Zur Öffnungspolitik der Hochschulen. Das Beispiel des
Innovationsförderungs- und Technologietransfer-Zentrums der Hochschulen des
Ruhrgebietes (ITZ). In: Webler 1984a, 323-346.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (1999): Mut zur Veränderung.
Deutschland braucht moderne Hochschulen. Vorschläge für eine Reform, Bonn.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2000): Bundesbericht Forschung
2000, Bonn.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) (2004): Bundesbericht Forschung
2004, Bonn.
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)/Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) (2001): Wissen schafft Märkte. Aktionsprogramm der
Bundesregierung, Bonn.
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) (1996a):
Bundesbericht Forschung 1996, Bonn.
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) (1996b):
Information als Rohstoff für Innovation: Programm der Bundesregierung 1996-2000,
Bonn.
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) (1996c):
Patente schützen Ideen. Ideen schaffen Arbeit. BMBF-Patentinitiative, Bonn.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1975a): Bundesbericht
Forschung V, Bonn.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1975b): Das Programm der
Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation (IuD-Programm)
1974-1977, Bonn.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1982): Leistungsplan
Fachinformation – Planperiode 1982-1984, Bonn.
14
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1983): Stellungnahme der
Bundesregierung zum Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als
Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über die
Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1985):
Fachinformationsprogramm der Bundesregierung 85-88, Bonn.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1990):
Fachinformationsprogramm der Bundesregierung 1990-1994, Bonn.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) (1993): Bundesbericht
Forschung 1993, Bonn.
Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT)/Bundesministerium für
Wirtschaft (BMWi) (1978): Forschungs- und technologiepolitisches Gesamtkonzept
der Bundesregierung für kleine und mittlere Unternehmen. Bonn.
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)/Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) (2002): Innovationspolitik – Mehr Dynamik für
zukunftsfähige Arbeitsplätze, Bonn.
Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung (BMwF) (1965): Bundesbericht
Forschung I. Bericht der Bundesregierung über Stand und Zusammenhang aller
Maßnahmen zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung in der
Bundesrepublik Deutschland, Bonn.
Bundesrechnungshof (1962): Untersuchung über die wissenschaftliche Dokumentation in der
Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M.
Bundesrechnungshof (1983): Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofes als
Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung über die
Fachinformation in der Bundesrepublik Deutschland, Frankfurt/M.
Deutscher Hochschulverband (1991): Das Berufsbild des Universitätslehrers. Thesen mit
Erläuterungen. Forum des Hochschulverbandes 55, Bonn.
Deutscher Städtetag (Hrsg.) (1982): Zusammenarbeit Stadt/Hochschule. Neue Schriften des
Deutschen Städtetages 46. Köln.
Ehmke, Horst (1974): Information und Dokumentation als gesellschaftspolitische Aufgabe.
In: Deutsche Gesellschaft für Dokumentation: Deutscher Dokumentartag 1973. Verlag
Dokumentation: Pullach bei München, 5-14.
Engel, Wolfgang A./Günter H. Walter (1978): Technologietransfer durch
Innovationsberatung. In: Informationen zur Raumentwicklung 1978: 521-525.
Engelbrech, Gerhard (1978): Regionale Wirkungen von Hochschulen. Schriftenreihe des
Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 6, Bonn.
Forschungskommission Baden-Württemberg (1983): Abschlußbericht.
Ganser, Karl (1980): Der Beitrag der Hochschulen zur Innovationsförderung im ländlichen
Raum. In: Informationen zur Raumentwicklung 1980: 405-408.
High-Level Group on the Information Society (1994): Europe and the Global Information
Society. Bangemann Report Recommendations to the European Council, Brüssel
Hochschulrektorenkonferenz (HRK)/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) (2003): Wegweiser der Wissensgesellschaft. Zur Zukunfts- und
Wettbewerbsfähigkeit unserer Hochschulen.
Innovationsförderungs- und Technologie-Transfer-Zentrum der Hochschulen des Ruhrgebiets
(ITZ) (1984): Endbericht des Modellversuches "Innovationsförderungs- und
Technologie-Transfer-Zentrum der Hochschulen des Ruhrgebietes" (ITZ) zum
31.01.1984.
Interministerielle Arbeitsgruppe beim Bundesminister des Innern (1971): Das
Informationsbankensystem. Vorschläge für die Planung und den Aufbau eines
allgemeinen arbeitsteiligen Informationsbankensystems für die Bundesrepublik
15
Deutschland. Bericht der interministeriellen Arbeitsgruppe beim Bundesministerium
des Innern an die Bundesregierung, Bonn.
Kayser, Armin (1981): Universität Kaiserslautern als Motor für die Region Westpfalz.
Kaiserslautern: Planungsgemeinschaft Westpfalz. Innovationsberatung und
Technologie-Transfer zur Förderung der regionalen Wirtschaft.
Kayser, Peter (1985): Technologie-Transfer. Forderungen – Voraussetzungen – Perspektiven.
Versuch einer kritischen Auseinandersetzung. In: Innovation 2/85, 130-137.
Kellermann, Paul (1982): Universität und Umland. Beziehungen zwischen Hochschule und
Region. Klagenfurter Beiträge zur Bildungswissenschaftlichen Forschung 12,
Klagenfurt.
Kistenmacher, Hans/Dieter Eberle/Manfred Hildenbrand (1982): Innovationsvermittlung
durch neugegründete Hochschulen. Fallbeispiel Universität Kaiserslautern/Region
Westpfalz. In: Informationen zur Raumentwicklung 1982: 567-572.
Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel (1977): Wirtschaftlicher und sozialer
Wandel in der Bundesrepublik Deutschland. Gutachten der Kommission. Göttingen:
Schwartz.
Krücken, Georg/Frank Meier (2003): „Wir sind alle überzeugte Netzwerktäter“. Netzwerke
als Formalstruktur und Mythos der Innovationsgesellschaft. In: Soziale Welt 54: 71-
92.
Landfried, Klaus/Manfred Hildenbrand/Stefan Fuchs (1983): Innovationsförderung durch
Hochschulen. Zur Regionalentwicklung und Hochschulstabilisierung am Beispiel
Kaiserslautern. In: Information zur Raumentwicklung 1983: 349-359.
Lechmann, Heinz (1967): Leitsätze für eine nationale Dokumentations- und
Informationspolitik im Bereich der Wissenschaft und Technik. In: NfD 18, 1: 16-19.
Lübeck, Heinz (1960): Über die Aktivierung verfügbarer Informationen für die
Betriebspraxis. In: NfD 11, 1: 8-12.
Matthes, Max (1951): Wozu benötigt die Industrie Dokumentationsstellen? In:
Dokumentation und Ordnungstechnik für die industrielle Forschung, Sonderdruck der
Rationalisierungs-Gemeinschaft für Dokumentation im Rationalisierungs-Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft (RKW) zur 18. Jahreskonferenz der Internationalen
Vereinigung für Dokumentation in Rom am 15.-21. Sept. 1951: I-V.
Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MWF) (1980):
Bericht und Leitvorstellungen zur Situation und Entwicklung der Forschung in
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MWF) (1984):
Forschung in Nordrhein Westfalen. Forschungsbericht NRW 1984, Düsseldorf.
Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (MWF) (1988):
Forschung in Nordrhein Westfalen 1988. Forschungsbericht, Düsseldorf.
Neubauer, K.W. (1971): Informationsangebot und Informationsverhalten in Bibliothek und
Dokumentation. Tendenzen und Thesen. In: NfD 22, 1: 7-13.
Neusel, Aylâ/Ulrich Teichler (1980): Neue Aufgaben der Hochschulen. Wissenschaftliches
Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung Gesamthochschule Kassel.
Werkstattberichte 3. Kassel.
Ockenfeld, Marlies (1984): Informationsvermittlung und Wissenstransfer. In: Hartmut
Müller/Dietmar Strauch (Hrsg.): Von der Dokumentation zum Wissenstransfer. KtK-
Workshop in Frankfurt am Main 26. und 27. März 1984. DGD-Schrift (KTK-2) 3/84,
41-49.
Organisation for Economic Development Co-operation and Development (OECD) (1971):
Information for a Changing Society. Some Policy Considerations, Paris.
16
Organisation for Economic Development Co-operation and Development (OECD)/CERI
(Hrsg.) (1982): The University and the Community. The Problems of Changing
Relationships, Paris.
Pietrich, Kurt (1965): Wie gelangt die Information an den Verbraucher? In: NfD: 16, 2: 47-
49.
Pietsch, Erich (1953):Warum Dokumentation? NfD 4, 3: 168-169.
Priebe, Klaus-P. (1983): Innovationsberatung und Forschungstransfer durch Hochschulen.
Eine regional- und strukturpolitische Chance? In: Informationen zur Raumentwicklung
1983: 361-369.
Rat für Forschung, Technologie und Innovation (1998): Kompetenz im globalen Wettbewerb.
Perspektiven für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Herausgegeben vom
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Bonn.
Recker, Engelbert (1981): Innovationsberatung durch Hochschulen. In: Raumforschung und
Raumordnung 39: 254-263.
Reinhard, Michael/Heinz Schmalholz (1996): Technologietransfer in Deutschland: Stand und
Reformbedarf. Berlin/München: Duncker und Humblot.
Schlosser, Irmtraud/Margret Steffen (1985): Der Wissenschaftsladen Bielefeld. Ergebnisse,
Ladenpraxis u. Erfahrungen. Materialien des Zentrums für Wissenschaft und Praxis
17, Bielefeld.
Schmidt, Ralph (1990): Informationssysteme und Datenbanken als Hilfsmittel des
Wissenschaftstransfers. In: Hermann J. Schuster (Hrsg.): Handbuch des
Wissenschaftstransfers. Berlin et al.: Springer, 539-551.
Schürmeyer, Walter (1950): Die Bedeutung der wissenschaftlichen Dokumentation für die
Industrie. In: NfD 1, 3/4: 77-79.
Starnick, J. (1990): Technologietransfer und Formen der Kooperation zwischen Hochschule
und Wirtschaft in der Bundesrepublik. In: Bernd Poppenheger/Uwe Bittermann
(Hrsg.): Management-Know-How-Transfer. Unternehmensgründungen in der DDR.
Köln: TÜV Rheinland, 111-127.
Staudt, Erich (1984a): Die Aufregung um den Technologietransfer. Modewort und Strohfeuer
zugleich. In: FAZ vom 9.6.1984, 15.
Staudt, Erich (1984b): Technologie-Transfer. Ein Beitrag zur Strukturierung der Wirtschaft.
In: Innovation 1/84, 24-31.
Steube, Wolfgang (1980): Modelle im Hochschulbereich. In: Neusel/Teichler 1980, 97-109.
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (Hrsg.) (1950): Forschung heißt Arbeit und
Brot. Stuttgart: Steingrüben.
Stoltenberg, Gerhard (1967): Staat – Wissenschaft – Wirtschaft – als Partner – Sicherung der
Zukunft. In: Bundesministerium für wissenschaftliche Forschung (Hrsg.): Staat,
Wissenschaft und Wirtschaft als Partner. Berlin/Wien: Koska, 9-14.
Streit, M.E. (1986): Wissenstransfer Hochschule – Wirtschaft. Transfer-Information 3, 62-68.
Teichler, Ulrich (1982): Regionaler Bezug der Hochschulen im Wandel. In: Kellermann 1982,
15-39.
The President’s Science Advisory Committee (1963): Science, Government, and Information.
The Responsibilities of the Technical Community and the Government in the Transfer
of Information (Weinberg Report). Washington D.C.
Toman, J. (1964): Die verschiedenen Kategorien von Informationsverbrauchern und ihr
Informationsbedarf. In: NfD 15, 4: 176-181.
Tönshoff, Hans Kurt (1994): Die Umsetzung als Kern des Problems. In: Forschung –
Mitteilungen der DFG 1994, H1: 3,17.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) (1971): UNISIST.
Study on the feasibility of a World Science Information System, Paris.
17
Universität Konstanz (1979): Konstanzer Blätter für Hochschulfragen 17, Sonderheft
Universität in der Region.
Vernimb, C. (1971) Über die Zukunft der wissenschaftlichen Information. In: NfD 22, 1: 2-6.
Voelzkow, Helmut (1988): Technologietransfer und Innovationsberatung durch Hochschulen.
Lukács-Institut für Sozialwissenschaften, Arbeitspapiere 12.
Webler, Wolff-Dietrich (Hrsg.) (1984a): Hochschule und Region – Wechselwirkungen.
Weinheim und Basel: Beltz.
Webler, Wolff-Dietrich (1984b): Einführung und Überblick. In: ders. 1984a, 1-17.
Welzer, Harald (1991): Wissenschaftsläden – Ein Kapitel aus der Geschichte reflexiver
Verwissenschaftlichung. In: Gerhard Gamm und Gerd Kimmerle (Hrsg.):
Wissenschaft und Gesellschaft. Tübingen: Edition Diskord.
Wissenschaftsrat (1975): Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu Organisation, Planung und
Förderung der Forschung. Tübingen: Mohr.
Wissenschaftsrat (1986): Stellungnahme zur Zusammenarbeit zwischen Hochschule und
Wirtschaft, Köln.
Wissenschaftsrat (1988): Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu den Perspektiven der
Hochschulen in den 90er Jahren.
Wissenschaftsrat (1996): Thesen zur Forschung in den Hochschulen. Magdeburg, Drs.
2765/96.
Weitere Projektpublikationen zum Transferdiskurs
Krücken, Georg/Meier, Frank/Müller, Andre (2007): Information, Cooperation, and the
Blurring of Boundaries – Technology Transfer in German and American Discourses.
In: Higher Education 53: 675-696.
Meier, Frank/Müller, Andre (2007): Rationalization and the Utilization of
Scientific Knowledge in German and U.S.-American Discourses. In:
Georg Krücken, Anna Kosmützky, Marc Torka (Hrsg.): Towards a
Multiversity? Universities between Global Trends and National
Traditions. Bielefeld: transcript, 201-216.