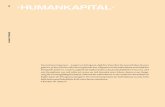Sprachkontakt und Grammatikalisierung
Transcript of Sprachkontakt und Grammatikalisierung
Universität Zürich WS 2003/04
Deutsches Seminar
Schönberggasse 2
8006 Zürich
Seminararbeit
Sprachkontakt und Grammatikalisierung:Am Beispiel der Veränderung der Verbalflexion in
südwalserischen Sprachinseldialekten
Roman Sigg
Randenstrasse 216
8200 Schaffhausen
Fassung von 5. Oktober 2005
Betreut durch Prof. Dr. E. Glaser und Dr. Dr. h. c. P. Zürrer
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 4
1.1 Gegenstand der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2 Geographische Lage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3 Sprachsituation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Literaturlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2 Beschreibung des Phänomens 7
2.1 Flexionssystem in Gressoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.2 Flexionssystem in Issime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.3 Situation in den übrigen Südwalsergemeinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.4 Verbalflexion im Fersental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.5 Verbalflexion in Lusern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 Verbflexion im Walserdeutschen 11
3.1 Entstehung der Konstruktionsvariante im Walserdeutschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.1 Interne Erklärungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.2 Sprachexterne Entwicklungsmöglichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.1 Piemontesischer Einfluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.2.2 Einfluss der italienischen Standardsprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2.3 Weitere „Motoren“ der Grammatikalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4 Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 22
4.1 Sprachwandeltheorien – Sprachkontaktforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2 Natürlichkeitstheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.3 Generative Erklärungsmodelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3.1 Cardinaletti & Starke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.2 Syntaktische Position der Klitka diverse Ansätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3.3 Ein eigener Ansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5 Zusammenfassung und Ausblick 32
Literaturverzeichnis 33
Tabellenverzeichnis 39
3
1 Einleitung
1.1 Gegenstand der Untersuchung
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich mit einer Konstruktion befassen, die in den deutschsprachigen Dia-
lekten sehr selten ist, aber sowohl in den bairischen, wie auch den alemannischen Sprachinseldialekten auftritt.
Es handelt sich um Formen wie:éer geht=er.Im Standarddeutschen, wie auch in vielen Dialekten existieren Sub-
jektverdoppelungskonstruktionen nicht, mit Ausnahme einiger mittel- und südbairischen Varietäten.1 Im Hocha-
lemannischen existiert ebenfalls eine spezielle Variante dieser Konstruktion:Wänn=t m@r duu nid häichunnsch,
dänn . . ..2 Diese Konstruktionsmöglichkeit ist allerdings auf die 2. Person Singular beschränkt. In den romani-
schen Sprachen und Dialekten tritt diese Konstruktion häufig auf und trägt dort die Bezeichnungclitic doubling.
Das Ziel der Untersuchung liegt darin festzustellen, wie dieser Konstruktionstyp in den Sprachinseldialekten
entstand, wann er auftritt, wo er auftritt und in welchem Umfang. Dabei stütze ich mich zum Teil auf eigene
Sprachdaten, die ich in Gressoney St. Jean, Issime, Florutz und Lusern aufgenommen habe und auf die Angaben
in der Literatur. Der Gegenstand der Arbeit verdient eine ausführliche Beschäftigung, allerdings bin ich mir nicht
sicher, dass ich alle Aspekte in der notwendigen Ausführlichkeit behandeln kann. Ich werde mich bei der Analyse
hauptsächlich auf die Situation der Südwalserdialekte beschränken und nur einführend einige Bemerkungen zu
Florutz und Lusern machen.
1.2 Geographische Lage
Bei den untersuchten Sprachinseldialekten handelt es sich um Lokalsprachen, die in einem geografisch eng um-
rissenen Gebiet im nördlichen Italien gesprochen werden. Issime und Gressoney (St. Jean und La Trinité) liegen
im Lystal, einem Seitental des Aostatals, also in der autonomen Provinz Aostatal. Gressoney und Issime bilden
jeweils eigene Sprachinseln mit einem eigenen Dialekt ZÜRRER(1999).3
Die südbairischen Varietäten liegen im Gebiet der Provinz Trento. Das Dorf Lusern ist eine eigene Sprachinsel,
die umliegenden ehemals deutschsprachigen Orte Lavarone und Folgaria sind heute italienischsprachig. Lusern
liegt am westlichen Rand der Hochebene von Asiago südöstlich von Trient. Das Fersental (Valfèrsina) auch
Valle dei Mòcheni genannt, liegt in den südlichen Dolomiten (Lagorai-Gruppe) nordöstlich von Trient. ROWLEY
(1996, 265). Im Fersental wird vor allem in den hochgelegenen nördlichen Gemeinden und Weilern noch der
deutsche Dialekt gesprochen. Es sind dies: Palai, Florutz und Eichleit.
1 Ausserdem gibt es eine Konstruktionsvariante im Westflämischen: vgl. HAEGEMAN (1990).2 Den Hinweis auf diese Konstruktionsvariante verdanke ich PD Dr. P. Gallmann. Vgl. dazu auch WERNER(1999, 58).3 Die Lage der übrigen Walsersprachinseln ist der Karte im Anhang zu entnehmen.
4
Roman Sigg Einleitung 5
1.3 Sprachsituation
Wie der Terminus Sprachinsel bereits impliziert, liegen diese Dörfer inmitten einer mehrheitlich anderssprachi-
gen Umgebung. Im Falle der Walserdörfer Gressoney und Issime handelt es sich hierbei mehrheitlich um Gebiete,
in denen Standarditalienisch, Piemontesisch und im Falle von Issime auch Frankoprovenzalisch gesprochen wird.
Lusern ist eine Sprachinsel in einem Gebiet, wo vor allem Trentinisch, Standarditalienisch, aber auch Ladinisch
gesprochen wird, dagegen ist der Sprachinselstatus von Florutz nicht ganz so ausgeprägt, da es im ganzen Fer-
sental deutschsprachige Gemeinden gibt: Eichleit und Palai. Für das Umland des Fersentals gelten die gleichen
Bedingungen wie für Lusern.
In Gressoney ist der Walserdialekt, das sogenanntetiitsch, am Verschwinden, stärker als im benachbarten
Issime. Dies hat vor allem damit zu tun, dass der Tourismus die Haupteinnahmequelle im Dorf darstellt. Die
Touristen stammen dabei mehrheitlich aus Norditalien. Aus diesem Grund lernen die meisten jungen Gresso-
neyer lieber Standarditalienisch, als den Dialekt, da dies ökonomisch sinnvoller ist. Der Tourismus bringt auch
Zuzüger ins Dorf, die vor allem Italienisch (Standard oder Dialekt) sprechen. Was dazu führt, dass der Dialekt
auch im Dorf nicht mehr selbstverständlich als Umgangssprache verwendet werden kann. Der Dialekt wird in
der alltäglichen Kommunikation immer stärker vom Italienischen verdrängt. Vor allem die jüngere und jüngste
Generation verwendet den Dialekt kaum mehr zur Kommunikation untereinander. Man spricht nur innerhalb der
Familie im Dialekt.4
In Issime liegt die Situation etwas anders, da diese Gemeinde über eine viel stärkere Tradition der Mehr-
sprachigkeit verfügt ZÜRRER (1998, 110). Dies führt dazu, dass der Dialekt in Issime viel stärker gefestigt ist,
auch wenn er von anderen Sprachen konkurrenziert wird. Ausserdem fehlt in Issime der Faktor Tourismus fast
vollständig. Dies führt dazu, dass der Zuwanderungsdruck nicht so stark ist wie in Gressoney.
In Lusern ist die Dialektsituation sehr speziell, da sich die Einheimischen einen grossen Teil des Jahres nicht im
Tal aufhalten, sondern sich auswärts als Bauarbeiter (häufig in der Schweiz) verdingen ROWLEY (1996, 274f.).
Dies führt dazu, dass die Wanderarbeiter neben den heimischen südbairischen und italienischen Dialekten auch
noch die deutsche Standardsprache oder zumindest einen alemannischen Dialekt beherrschen. Allerdings hat der
Dialekt im Dorf heute einen gut gefestigten Status. Dies hat damit zu tun, dass das Dorf relativ abgeschieden
liegt und touristisch nicht interessant ist.
Auch im Fersental scheint der Dialekt relativ gut gefestigt zu sein. Hier ist das Italienische als Kontaktsprache
ebenfalls bekannt, die südlichen Dörfer am Talausgang sind heute italienischsprachig. Die Fersentaler müssen
ebenfalls Arbeit ausserhalb des Tals annehmen. Die einzige einheimische Verdienstquelle ist die Landwirtschaft
und neuerdings etwas Tourismus. Die meisten wandern aber zur Arbeitssuche nicht aus, sondern arbeiten in der
nahen norditalienischen Industrie ROWLEY (1996, 274). Die Fersentaler gelten im übrigen als äusserst sprach-
bewusst. Sie versuchen in starkem Umfang den Dialekt als alltägliches Kommunikationsmittel zu erhalten (z. B.
am Abend im Gasthaus, wie wir auf der Exkursion selber gehört haben). Ausserdem sind sie sich der kleinen
speziellen Unterschiede, welche die einzelnen Dorfdialekte trennen, sehr bewusst. Sie weisen jeweils darauf hin,
dass sie nicht Fersentaler, sondern Florutzer oder Palaier Dialekt sprechen.
4 Gemäss Auskunft der Gewährspersonen Daisy und Valeria (Gressoney).
5
Roman Sigg Einleitung 6
1.4 Literaturlage
Zu den verschiedenen Sprachinseln existieren Beschreibungen und Textsammlungen, die fast 200 Jahre Sprach-
geschichte abdecken. Allerdings sind nicht alle diese Beschreibungen und Textsammlungen von hoher Qualität.
Als sehr gut muss die Literaturlage für Gressoney angesehen werden, für dessen Dialekt sehr gute Beschrei-
bungen von ZÜRRER vorliegen und weitere Literatur wie HOTZENKÖCHERLE (1971), GIACALONE RAMAT
(1989) und GIACALONE RAMAT (1992). Für Rimella liegt die Arbeit von BAUEN (1978) vor. Pomatt wird von
DAL NEGRO (1996) und DAL NEGRO (2000) bearbeitet. Etwas problematischer sieht die Literaturlage zu Issi-
me aus, das nun dank der Arbeit von ZÜRRER(1999) ebenfalls gut dokumentiert ist. Bei den Südbaiern existiert
eine sehr ausführliche Arbeit zu Lusern von TYROLLER (1994). ROWLEY arbeitet an einer neuen Grammatik
zu den Fersentaler Dialekten, allerdings sind die Phänomene, die mich hier interessieren, im Vorabdruck, der
uns zur Verfügung stand, nicht dokumentiert. Auch in seiner älteren Darstellung des Fersentaler Dialekts ROW-
LEY (1986) hat er sich vor allem mit der Phonetik und dem Lexikon, weniger mit dem morphologischen und
syntaktischen System, beschäftigt.
Bei den Textsammlungen sind die Walser im allgemeinen sehr gut vertreten, da sich das Schweizerische Pho-
nogrammarchiv bereits früh um Aufnahmen bemühte. Allerdings kranken gewisse Aufnahmen am Umstand,
dass nicht spontane Rede aufgenommen wurde, sondern vorbereitete Texte, die möglichst interessant in Bezug
auf Vokabular sein sollten. Ausserdem wurden neben normalen Prosaerzählungen (Sagen etc.) auch Mundart-
gedichte und Sprüche aufgenommen, die für syntaktische Untersuchungen ungeeignet sind. Dies ist ein grosses
Problem bei GYSLING & H OTZENKÖCHERLE(1952). Dort sind alle Aufnahmen aus Issime für unsere Zwecke
unbrauchbar, weil es sich dabei um Mundartgedichte, Sprüche oder Reihungen von Wortschatzmaterial handelt.
Bei anderen Textsammlungen fehlt ein ordentlicher sprachwissenschaftlicher Kommentar, da das Material für
volkskundliche Zwecke gesammelt und nach diesem Gesichtspunkt geordnet wurde (WAIBEL , 1985).
6
2 Beschreibung des zu untersuchenden Phänomens
Bei früheren Untersuchungen der Walserdialekte hat ein Sprachwandelphänomen in den letzten Jahren besonde-
re Aufmerksamkeit erregt: die radikale Umgestaltung des Verbflexionssystems, in Verbindung mit Veränderun-
gen auf syntaktischer Ebene: der Einführung von pro-drop und der Basiswortstellung SVO. Bei den bairischen
Sprachinseldialekten tritt zwar ein ähnliches Phänomen auf, ob dies allerdings durch kontaktinduzierten Sprach-
wandel entstanden ist wie bei den Walsern, ist nicht so eindeutig beantwortbar. Denn im mittel- und südbairischen
Sprachgebiet treten teilweise die gleichen Formen auf wie in den Sprachinseln, so dass es sich auch um ein er-
erbtes Phänomen handeln könnte. Diese Frage kann allerdings im Lauf der Arbeit nicht geklärt werden.
2.1 Flexionssystem in Gressoney
Das verbale Flexionssystem von Gressoney kennt zwei Varianten, welche grundsätzlich beide die volle kom-
munikative Leistungsfähigkeit erreichen. Der Unterschied besteht hauptsächlich in der Verwendung. Die „Nor-
malform“ wird gemäss den Beobachtungen von ZÜRRER (1999) vor allem von der älteren Generation und von
stark sprachbewussten Sprechern verwendet, während die jüngere Variante sich bei der jüngeren und mittleren
Generation durchgesetzt hat. Es soll hier betont werden, dass die Sprecher nicht immer ein System anwenden. Es
kann gezeigt werden, dass die Verwendung immer wieder abwechselt. Wir haben es also mit einem Mischsystem
zu tun, das in zwei unterschiedliche Teilsysteme zerfällt. Auf Grund der leichteren Beschreibbarkeit soll hier
so getan werden, als würden die Sprecher idealerweise immer nur eines der zwei Systeme verwenden. Dies ist
tendenziell richtig. Zur Illustration zeige ich hier das Paradigma des Verbstue„tun“ nach ZÜRRER (1999, 320),
siehe dazu Tabelle 1 auf S. 7.
Bei einer Analyse des Bildungssystems für die zwei Verbalparadigmen gelangt man zu folgendem Bildungs-
muster für das ältere Paradigma:
(1) PPRONNOM VERBFINIT
Person, Numerus „Normalform“ jüngere Variante1. Sg. ich tuen (ich) tuen=i2. Sg. duu tuescht (duu) tuescht=Ø3. Sg. eer, dschi, ääs tuet (eer) tuet̄er, (dschi) tuet̄dsch, (ääs)
tuet-s1. Pl. wier tien (wier) tie=ber2. Pl. ier tiet (ier) tied=er3. Pl. dschi tien (dschi) tien=dsch
Tabelle 1:Verbalflexion Gressoney
7
Roman Sigg Beschreibung des Phänomens 8
Also ein ganz normales Flexionssystem wie es auch in der deutschen Standardsprache und den meisten deut-
schen Dialekten und einer grossen Anzahl anderer flektierender Sprachen vorkommt.
Beim jüngeren Flexionstyp sieht das Bildungsmuster etwas anders aus:
(2) PPRONNOM(i) VERBFINIT =KLIT.PPRONNOM(i)
Wir haben hiermit also unter Umständen eine doppelte Subjektsmarkierungundeine doppelte Markierung der
Verbalform im Verbalkomplex vorliegen. Bei genauerer Betrachtung der Verwendungsweise zeigt sich, dass eine
doppelte pronominale Subjektsmarkierung nur unter bestimmten Umständen, bei starker Betonung des Subjekts,
z. B. in Adversativkonstruktionen etc. auftritt. In unmarkierter Verwendung fällt das Subjektspronomen weg; es
tritt eine sogenannte pro-drop-Situation ein. Die Betrachtung einer doppelten Markierung des Subjekts lässt sich
nur bedingt aufrecht erhalten, da wir es hier mit einem Grammatikalisierungsprozess zu tun haben, an dessen
Ende die Umdeutung der klitischen Subjektspronomina zu Flexiven stehen wird bzw. steht:
(3) Lexikalisches Element→ Klitikon → Affix oder spezifisch:
(4) PPRON[stark]→ PPRON[klitisch] → Verbalsuffix
Die Grammatikalisierungstheorie sagt voraus, dass ein lexikalisches Element durch Verlust von „semantischer
Spezifizität“ und phonetischem Material, immer stärker auf seine morphologisch/syntaktische Funktion reduziert
und in seinem positionellen Auftreten immer stärker eingeschränkt wird, so dass als Endpunkt der Entwicklung
die Verwendung als Affix steht (vgl. hierzu bspw. BOSSONG(1998) und HOPPER& T RAUGOTT (1993). Die-
ser Zustand ist zumindest bei der jüngeren Generation der Dialektsprecher in Gressoney erreicht. Die klitischen
Pronomen sind als Affixe reanalysiert. Das bedeutet sie sind positionell gebunden, d. h. wenn das Verb aus seiner
syntaktischen Position bewegt wird, wird das Klitikon mitbewegt; und nicht abtrennbar vom Verbstamm, daraus
folgt: Es kann kein anderes Klitikon dazwischen treten. Als zweites Indiz für die erfolgte Grammatikalisierung
kann angeführt werden, dass die Subjektsmarkierung in betonter Verwendung zusätzlich durch das starke Sub-
jektspronomen erfolgen muss. Wäre das klitische Subjektspronomen nicht als verbales Affix reanalysiert, wäre
zu erwarten, dass es lediglich durch das starke Subjektspronomen ersetzt wird:
(5) *tieben wiir goa z meiland wir gehen nach Mailand5
(6) wiir tien goa z meiland wir gehen nach Mailand
(7) wiir tieber goa z meiland wir gehen nach Mailand
Wie in (5) gezeigt wird, wird eine Satzstellung V1 mit nachgestelltem starken Subjektspronomen in einem nor-
malen Aussagesatz als ungrammatisch empfunden. Das starke Subjektspronomen kommt, sofern keine Topika-
lisierung erfolgt, nur an erster Stelle vor, mit alter Verbflexion (6) oder mit der neuen Variante (7). Neben einer
Subjektsmarkierung mit einem starken Personalpronomen plus enklitisch erweitertem Verb kommt auch die Sub-
jektsmarkierung durch ein Substantiv mit erweiterter Flexion vor, wie das folgende Beispiel aus: ZÜRRER(1999,
321) zeigt:
5 Fettdruck bedeutet im Folgenden, dass der fett gesetzte Ausdruck als besonders betont gelten soll.
8
Roman Sigg Beschreibung des Phänomens 9
Person, Numerus „Normalform“ jüngere Variante1. Sg. ich esse (ich) ess=ich, ess=i2. Sg. dou essischt (dou) essischt=Ø3. Sg. eer, dschii, iis esst (eer) esst=er, (dschii) esst=dsch,
(iis) esst=s1. Pl. wir essen (wir) esse=wer2. Pl. iir essit (iir) essed=er3. Pl. dschii essen (dschii) essen=dsch
Tabelle 2:Verbalflexion Issime
(8) suntaSonntag
zzur
nachtNacht
minmeine
moateneMädchen
gangen=dschgehen=sie
zruggzurück
zzu
meilandMailand
‚Am Sonntagabend gehen meine Töchter zurück nach Mailand.‘
Damit ist ein vollkommen grammatikalisierter Zustand zumindest bei einem Teil der Sprecher recht wahrschein-
lich.
2.2 Flexionssystem in Issime
In Issime zeigen sich die gleichen Phänomene wie in Gressoney. Es kann differenziert werden, welche Alters-
gruppe welches Flexionssystem verwendet. Die ältere und älteste Generation hält am alten System fest,6 die jün-
gere verwendet ein ähnliches System, wie in Gressoney, bei dem die alten verbalen Personalformsuffixe durch
klitische Subjektspronomina im ersetzt bzw. ergänzt wurden:7
Hier handelt es sich wohl um denselben Grammatikalisierungsvorgang. Die enklitischen Subjektspronomina
fungieren nicht mehr als lexikalische Subjektmarkierer mit voller referentieller Bedeutung, sondern lediglich als
verbale Affixe. Tests am Datenmaterial aus Issime führen zu den gleichen Ergebnissen wie in Gressoney, dass die
enklitischen Subjektspronomina nicht mehr vom verbalen Stamm getrennt werden können und Doppelsetzungen
möglich sind, d. h. Subjektsmarkierung durch Pronomina oder Substantiva und enklitisches Subjektspronomen.
2.3 Situation in den übrigen Südwalsergemeinden
Nach der Durchsicht der einschlägigen Literatur (BAUEN, 1978; DAL NEGRO, 1996; DAL NEGRO, 2000; GIA -
CALONE RAMAT , 1989) kann festgehalten werden, dass sich dieses Phänomen mehr oder weniger ausgeprägt in
allen Südwalserdialekten findet. Ich verweise hier auch auf die Zusammenstellung der Daten aus der Erhebung
des SDS in ZÜRRER(1999, 319, fig. 81).
2.4 Verbalflexion im Fersental
Im Fersental ist es etwas schwieriger konkrete Ergebnisse zu präsentieren, da das zu behandelnde Phänomen
von der Literatur bisher übergangen wurde. ROWLEY (1986, 219) präsentiert lediglich eine Liste der starken
6 In der Tabelle als „Normalform“ bezeichnet, Daten aus D’Eischemetöitschu, S. XIX.7 Daten aus ZÜRRER(1999, 358, fig. 83)
9
Roman Sigg Beschreibung des Phänomens 10
Pronomina und der zugehörigen Klitika, aber keine Gesamtsicht der Verbalflexion, abgesehen von einigen For-
menparadigmen. Das hier interessierende Phänomen müsste an einer Schnittstelle von Morphologie und Syntax
angesiedelt werden. Im übrigen wird in dem Buch ein möglichst altertümlicher Dialektstand vermittelt. In ge-
wissen sprachlichen Kontexten ist auch im Fersental ein clitic doubling möglich, wie dies die Erhebung vor Ort
gezeigt hat. Allerdings wird im folgenden auf eine weitere Analyse dieser Phänomene verzichtet.8
2.5 Verbalflexion in Lusern
In Lusern kommt eine Verdoppelungskonstruktion heute nicht mehr vor, bzw. wird von der aktuellen Fachliteratur
nicht erwähnt und konnte bei der Erhebung vor Ort nicht provoziert werden. In BACHER (1976, 199–202) findet
sich allerdings ein Hinweis darauf, dass zumindest in früherer Zeit solche Konstruktionen (bei Inversion mit
Rechtsversetzung des Subjekts oder bei Linksversetzung des Subjekts mit gleichzeitiger Betonung) möglich
waren:
(9) hat’sHat=es
g@volgetgefolgt
sdas
khinKind
d6rder
mam6?Mutter?
‚Hat das Kind der Mutter gehorcht¿
(10) d6rder
puaKnabe
geatgeht
6rer
@nin
d@die
burg@Borgo
betmit
mainmeinem
pruad6r?Bruder?
‚Geht der Knabe in die Borgo mit meinem Bruder¿
Diese Konstruktionen scheinen heute nicht mehr gebräuchlich zu sein, da die Gewährspersonen keine derartigen
Sätze produzieren wollten, obwohl dieser Typ abgefragt wurde. Es scheint sich hier um die Folge eines gestärkten
Sprachbewusstseins zu handeln, dass diese Varianten als nicht mundartlich aus dem Dialekt entfernt hat.
Gemäss mündlicher Auskunft von Prof. Dr. TYROLLER hat diese Art der Verbflexion nur bei Adversativ-
konstruktionen wie in: „wír tun=wir x, íhr aber tut=ihr y“, überlebt. Allerdings wird sie nur eingesetzt, wenn
nicht das ‚überstarke‘ Langpronomenirendri zum Zuge kommt, wie es bei den Aufnahmen vor Ort geschah. Die
Gewährspersonen liessen sich nicht zu einer anderen Konstruktionsform bewegen.
Im übrigen sei auf die hoffentlich bald beendete Dissertation von Agnes KOLLMER hingewiesen, die sich
einigen Problemen der Syntax des Luserner Dialektes auch im Hinblick auf eine Interferenz mit dem Italienischen
annimmt.
8 Die Dissertation von CONT (1987) stellt die im bairischen üblichen Verdoppelungskonstruktionen nicht dar, zeigt aber auf S. 140f. eineKonstruktion aus italienischer Interferenz die zumindest zur obligatorischen Klitisierung des Subjektspronomens führt und damit eineVorstufe zur Grammatikalisierung darstellt.
10
3 Verbflexion im Walserdeutschen
3.1 Entstehung der Konstruktionsvariante im Walserdeutschen
3.1.1 Interne Erklärungsmöglichkeiten
Damit diese Konstruktion überhaupt entstehen kann, müssen verschiedene Grundlagen vorhanden sein. Als ers-
tes muss ein vollständiges klitisches Pronominalsystem existieren. Diese Grundlage ist in allen alemannischen
Dialekten gegeben NÜBLING (1992, 251–268). Als weitere Voraussetzung muss gelten, dass das Subjekt dem
Verb nachgestellt werden kann. Diese Voraussetzung ist im deutschen Aussagesatz, ohne Topikalisierung, nor-
malerweise nicht gegeben. Die übliche Abfolge eines deutschen Aussagesatzes lautet SVO. Allerdings sind In-
versionskonstruktionen in Fragesätzen erlaubt:
(1) Habt ihr ihn gesehen?
(2) Bringt ihr mir das Buch?
Oder im Schweizerdeutschen:9
(3) Händ=@r= @n gsee?
(4) Bring@d=@r=m@r s bu@ch?
Im Schweizerdeutschen zeigt sich deutlich die Anlehnung der klitischen Personalpronomen an ihre Basis: die
Verbform bzw. in Nebensätzen auch an die Konjunktion. Bei der hier angegebenen Form handelt es sich um eine
normale Frage, ohne dass ein Element (Subjekt oder indirektes Objekt) speziell hervorgehoben wird, andern-
falls müsste das starke Personalpronomen stehen. Dieser Spezialfall ist aber allein kein Ausgangspunkt für eine
Grammatikalisierung wie wir sie in Kapitel 2.1 angesprochen haben, da der Fragesatz quantitativ eher selten ist.
Die zweite Möglichkeit das Subjekt in eine Position rechts vom Verb zu bewegen ist mittels einer Topikalisie-
rung. Wenn das Objekt oder das Satzadverbiale (Temporal- oder Lokaladverbiale) eines Aussagesatzes speziell
hervorgehoben werden soll, kann es ins sogenannte Vorfeld des Satzes gestellt werden:
(5) Mir brachte er das Buch.
(6) Das Buch brachte er mir.
(7) Gestern habe ich viel gearbeitet.
(8) Miir hät= @r s bu@ch pròòcht.
(9) S bu@ch hät=@r=m@r pròòcht.9 Es handelt sich hierbei um meinen Dialekt, den man als Nordostschweizerdialekt klassifizieren kann. Die Schreibung folgt DIETH (1938)
mit Zusatz des@. Die übrigen Beispiele folgen dem Transkriptionssystem der jeweiligen Verfasser.
11
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 12
(10) Gescht@r ha=n=i vil gschaff@t.
(11) AmòalEinmal
ischtist
hiähier
gsiigewesen
äein
schùämachärSchuhmacher
ùndund
dämdem
heindschhaben=sie
gseitgesagt
ChaschtalschChaschtalsch
schùemachär.Schuhmacher.
(GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 7, aus Gressoney)
(12) IinIn
äeiner
mättòWiese
häintschhaben=sie
gstròùpftherausgerissen
äeine
mòòrch.Grenzmarke.
(GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 20, aus Rima)
(13) ÄsEin
mòòlMal
òbbeim
tschälljù,Plaudern,
wiëwie
deses
tjööd,tut,
häenschhaben=sie
gwättùdgewettet
ùnund
gschaaed:gesagt:
(GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 25, aus Rimella)
Auch diese Variante der Satzstellung ist im Allgemeinen nicht so häufig, dass der beschriebene Effekt der Gram-
matikalisierung allein daraus abgeleitet werden kann. Ausserdem erklärt sich dadurch noch nicht, wie es im
Walserdeutschen zu (S)VO Sätzen kommt, da das Vorfeld weiterhin obligatorisch gefüllt ist.
Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Im Deutschen existie-
ren auch Aussagesätze mit Verberststellung (V1). Sie sind allerdings im Standarddeutschen verpönt und werden
von den meisten Grammatikern als Phänomene eines restringierten Codes angesehen, also auf den Bereich der
mündlichen Umgangssprache reduziert. In der Mündlichkeit scheinen sie allerdings eine gewisse Häufigkeit und
Regularität zu erreichen (vgl. AUER (1993, 202f.)). Sie scheinen auch über das ganze bundesdeutsche Sprach-
gebiet verbreitet zu sein (ebd.). Im Schweizerdeutschen sieht die Situation wieder etwas anders aus. Hier sind
nur dann Aussagesätze mit V1 gestattet, wenn das Subjekt direkt angesprochen wird, oder sonst eine situati-
onsmässig eindeutige Kodierung des Subjekts und eine eindeutige Verbalform vorliegt (vgl. AUER (1993, 198):
(14) Chasch scho i@choo.
(15) Chum@ grad.
In diesen Fällen kommt es aber auch im Hochalemannischen zur Subjektsellipse.10 Es handelt sich hier um ein
diskurspragmatisches Phänomen.11 Ausgeschlossen ist im hochalemannischen der Fall, bei dem es zum Aus-
fall eines expletiven es als Subjekt kommt, eine Ausnahme stellen möglicherweise Frage-Antwort-Situationen
dar. Genau dieser Fall lässt sich im Schweizerdeutschen wohl kaum provozieren. Ein Satz wie„gibd halt iiber-
all solche und solche“12 wird von den meisten Schweizerdeutschsprechern mit proklitischem expletivem ‚es‘
realisiert:„S’git halt üb@rall därig und därig“.13 Die genannten Phänomene sind jedoch für unser eigentliches
Erklärungsproblem nicht relevant, da beim Ausfall des Subjektspronomens nichts vorhanden ist, das sich an das
Verb klitisieren und grammatikalisieren lässt. Relativ häufig ist aber die folgende Situation: „Zahlreich sind die
Fälle, in denen das Verb in die Spitzenstellung gerückt wird, weil ein schriftsprachlich obligatorisches anaphori-
10 Dieses Phänomen kommt auch im Walliserdeutsch (höchstalemannisch) vor, wie mir lic. phil C. Bucheli anhand des Datenmaterials desNationalfonds-Projekts Dialektsyntax zeigen konnte.
11 WERNER (1999, 59–63) weist allerdings darauf hin, dass das Subjektspronomen der 2. Sg. im Aussagesatz ausgelassen werden kann,wenn es nach dem finiten Verb steht (generell!). Dies ist die unmarkierte Konstruktion.
12 AUER (1993, 196, Bsp. (2)).13 Eine kurze Umfrage bei verschiedenen Dialektsprechern im DS hat diesen Eindruck bestätigt.
12
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 13
sches Pronomen fehlt. In diesem Fall ist die uneigentliche Verbspitzenstellung ein Mittel der Kohäsionsbildung,
das anstelle der Anaphern eingesetzt wird.“(AUER, 1993, 199f. Bsp. 10)14. Hierbei sind insofern Beispiele für
Aufreihungen mit V1 zu beachten, bei denen Adverbiale fehlen können. Als weiterer Ansatzpunkt in eine ähn-
liche Richtung erweisen sich die Satztypen (1) und (3) im Aufsatz von SIMON (1998).15 Satztyp (1) wird von
SIMON als narrativ verwendet charakterisiert, der in „längeren erzählenden Sequenzen“ und „textinitial in Wit-
zen“ auftritt (SIMON, 1998, 138), siehe (16) und (17).
(16) Chumm=i häi. Gseen=i d@ Peet@r vor d@ Tür@lig@. Hät=m@r no Angscht gmacht.
(17) Chunt@n Maa zum Tokt@r. Säit d@ Tokter . . .
Satztyp (3) wird von SIMON (1998) so charakterisiert: „[. . . ] ist durch ein indikativisches Modalverb sollen
oder mögen, ein Subjekt in der 3. Person sowie häufig durch Verwendung einer Abtönungspartikel, v. a. doch,
charakterisiert.“ (SIMON, 1998, 138), siehe dazu (18).
(18) Söll=@r doch mach@, was@r wött, mag@m gar nid zu@lu@g@.
Ich habe für die oben angeführten Satztypen Beispiele aus meinem Dialekt angeführt, aber es dürfte sehr wahr-
scheinlich sein, dass ähnliche Konstruktionstypen auch im mündlichen Walserdeutschen existierten. Allerdings
lässt sich dies wohl nicht ohne grösseren Aufwand belegen. Dazu kommt noch der Effekt, dass bei Frage-
Antwort-Situationen die Antwort in einer Anlehnung an die Fragestruktur mit V1 realisiert wird (ZÜRRER, 1999,
327–329). Auf ein ähnliches Phänomen weist auch PATOCKA (1997, 202) hin. Im kärntnerischen Sprachgebiet
scheinen sich im Frage-Antwort-Kontext V1-Konstruktionen mit enklitisch angehängtem Subjektspronomen ver-
breitet zu haben. Die Forschung geht davon aus, dass diese Konstruktion auf den bairisch-slowenischen Sprach-
kontakt zurückzuführen ist. Betrachten wir die angeführten Verwendungsmöglichkeiten der V1-Konstruktion,
scheint es so gewesen zu sein, dass die Verbspitzenstellung in Verbindung mit pronominalen Subjekten immer
mehr akzeptiert wurde. Bei diesem Prozess dürfte auch eine formale Ähnlichkeit zur italienischen Konstruktion
eine Rolle gespielt haben:
(19) Goat=er z Meilan.
(20) Va a Milano.
(21) Er geht nach Mailand.
Man sieht die Ähnlichkeit der Konstruktion im Walserdeutschen (hier aus Gressoney) und dem Italienischen.
Die Frage, ob es sich hierbei um die Folge einer inneren Entwicklungstendenz der deutschen Dialekte und Um-
gangssprachen allgemein handelt, oder ob es sich um eine Sprachwandelerscheinung handelt, die durch externen
Kontakt hervorgerufen wird, dürfte schwierig zu entscheiden sein. Wie wir AUER (1993), ÖNNERFORS(1997),
PATOCKA (1997)und SIMON (1998) entnehmen können, handelt es sich bei der Verberststellung in Deklara-
tivsätzen um ein Phänomen, das geografisch weit verbreitet ist. Leider gibt ÖNNERFORS(1997) keine statisti-
schen Angaben zur Häufigkeit dieses Satztyps in seinem Korpus. Auf Grund der vielen zitierten Belege lässt sich
14 Ganz ähnlich auch bei PATOCKA (1997, 210)15 SIMON beruft sich dabei auf die Untersuchung von ÖNNERFORS(1997).
13
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 14
aber annehmen, dass der Konstruktionstyp durchaus über eine gewisse quantitative Bedeutung verfügt. AUER
(1993, 219) betont, dass es sich bei diesem Phänomen aus seiner Sicht um eine Angelegenheit der gesprochenen
Sprache handelt. Daher kann man wohl vermuten, dass gerade in den Südwalserdialekten, denen das „Korrektiv“
der Standardsprache fehlt, sich diese Konstruktion stärker zeigen müsste. Dies ist insbesondere dann zutreffend,
wenn es sich dabei um die Bewahrung eines alten Konstruktionstyps handelt. Die Fixierung der Standardsprache
auf V2 ist ein Ergebnis einer Entwicklung, die sich seit dem Mittelhochdeutschen zeigt. Im Althochdeutschen
war die V1 sehr verbreitet. Im Mittelhochdeutschen wurde dieser Typ von der V2 abgelöst, allerdings kam die V1
im 16. Jhd. wieder in Mode. Im 18./19. Jahrhundert scheint sich dann die V2 mit der Satzklammer endgültig eta-
bliert zu haben (vgl. KELLER 1995, 292–295, 421–423, 563–566und EBERT et al. 1993, 293f.). Die Verfestigung
der heutigen Satzstellung mit Verbalklammer wird von einigen Linguisten als eine Folge der präskriptiven Gram-
matikschreibung jener Zeit angesehen. Da den Sprachinseldialekten in Italien aber die Überdachung durch die
deutsche Standardsprache mehrheitlich fehlt, machten sie gewisse Entwicklungstendenzen nicht in vollem Aus-
mass mit. ZÜRRER(1993) zeigt deutlich auf, dass einige der vermeintlichen Neuerungen der Südwalserdialekte,
die unter romanischem Einfluss entstanden seien, bereits weit zurückreichen. Der Status der Verberststellung
lässt sich hierbei aber nur schwer feststellen:
(22) Steid uf und chunt z’sinem Atten.(ZÜRRER, 1993, 31, Bsp.26)
Leider ist damit auch schon das einzige in Frage kommende Beispiel genannt, das von ZÜRRER(1993) aufgeführt
wurde. Weitere Beispiele müssten in den ältesten Textsammlungen gesucht werden (Liste bei ZÜRRER1993, 29).
Auch aus der Sammlung von GYSLING & H OTZENKÖCHERLE(1952) liegen einige Beispiele vor, die deutlich
V1-Stellung zeigen.
(23) BiëlërBieler
hämohat=noch
wëläwollen
hälffähelfen
ùnund
näihn
drusziiä,drausziehen,
aberaber
FranzFranz
ischist
tëiftief
dríngsii,drin=gewesen,
hähat
ninicht
chònno.können.‚Bieler wollte ihm helfen und ihn herausziehen, aber Franz ist tief drin gewesen, er hat nichts [machen]
gekonnt.‘ (GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 9)
(24) MynMeine
aaltùAlten
äein
vòòrdvor
chämhaben
mermir
ältsialsweil
zaalt:erzählt:
SinSind
gschigewesen
zzu
RëmmäljuRimella
wiërvier
häpschùnhübsche
tächtere,Töchter,
ùnnund
wiëwie
gschälljäGesellinnen
chaend-schehaben=sie
chëëbetgehabt
vrëifreilich
ddie
gwëënäGewohnheit
zzu
gaagehen
zzum
ëngertHengert
ùnund
tschälljùnplauderten
älljealle
tschëëmùnzusammen
inin
enein
äseinem
üüsch.Haus.
‚Meine Eltern haben mir jeweils erzählt: Es sind in Rimella vier hübsche Mädchen gewesen , und wie
alle Freundinnen, hatten sie freilich die Gewohnheit zum Hengert zu gehen und plauderten miteinander
in einem Haus.‘ (GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 25)
(25) UndUnd
dùmnaadanach
näämewersnehmen=wir=es
fiirä,vor,
tiewërstun=wir=es
ùfauf
däden
leibtisch.Laibtisch.
Und danach nehmen wir es [Brot] hervor, tun wir es auf den Laibtisch. (GYSLING & H OTZENKÖCHER-
LE, 1952, 40)
14
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 15
Besonders interessant ist hier (25), das auch ein schönes Klitikcluster zeigt.
Aus dem Jahr 1961 liegt eine Probe aus Issime vor (Abdruck in ZINSLI (1970, 416)), die deutlich zeigt,
dass die Verberststellung in der gesprochenen Mundart vorkommt, vor allem durch Weglassung von temporalen
Umstandsangaben(doa)und/oder einer beiordnenden Konjunktion(ùnd):
(26) UndUnd
dedann
gäidgeht
šes
geëngegen
dendie
Angcjhe,Butter,
deden
ChëësKäse
ùndund
didie
Triffili.Kartoffeln.
ÙndUnd
dedann
gäidgeht
šes
imim
HousHaus
ùmum
hannùnhaben
dsdes
Firmis.Frühstücks.
Tringh jëndTrinken
šsie
GgaffKaffee
mimit
Miilc jhMilch
ùndund
dedie
ŠnittiSchnitte
Broad,Brot,
macchùnmachen
šsie
dsdas
ChläippiChläippi[?]
mimit
Angcjhe.Butter.
In den neueren Texten ist eine starke Tendenz zu Konstruktionen mit V1 in den verschiedenen Sprachinseln
auszumachen. Die V1 scheint besonders als Kohäsionsmittel über eine gewisse Beliebtheit zu verfügen, wie die
Beispiele (27) bis (31) zeigen:
(27) Dü hesch tè ghìerd geng den Aabe.Hentsch tè geng den Aabe d altù Wiiber gìzèlt, zèm Hänggert.
(WAIBEL , 1985, 53, Abschnitt b)
(28) Min Mööter, mis Möömi hed mer schi gìzèld.Hedmù geng ghìerd van den èltere Litte.(WAIBEL , 1985,
53, Abschnitt d)
(29) Štäidisüüf du möörgund i kuatra mädsa,mestisgoo al bet der šexju al bet der kaawlu.(BAUEN, 1978,
45, Satz (4))
(30) Kit der waldhaano und nu gläkt en du šakx, und üüf und üüf, šin bek šu altsi gléédne, das da wesswer
dša.Heder gšééd en gänšspu.(BAUEN, 1978, 46, Satz (5) bis (6))
(31) Tuen i ertue d schkoatulu hie. Ecco,brächeberdiischi. (ZÜRRER, 1986, 36, (36))
Damit dürfte es als wahrscheinlich angesehen werden, dass genügend sprachliches Material vorhanden ist, wel-
ches die Klitisierung hervorrufen kann. Ob es sich allerdings bei diesen Sätzen mit Verberststellung um ein altes
Reliktphänomen, oder um eine unter italienischem Einfluss entstandene Konstruktion handelt, kann nicht geklärt
werden. Dies hängt in erster Linie damit zusammen, dass es sich bei diesem Satztyp definitiv um eine Form der
Mündlichkeit handelt. Die ältesten Belege für die Südwalserdialekte liegen aber nur schriftlich vor. Sicher ist
allerdings, dass dieser Satztypus schon in den älteren Tonaufnahmen auftritt.
Ein spezielles Phänomen, das in den meisten Südwalserdialekten zu einer Inversion des Subjektspronomens
führt, ist die Konjunktionund. Diese wird hier wie ein Adverb verwendet. Im heutigen Standarddeutschen und
im normalen Schweizerdialekt ist dies nicht der Fall (32) und (33). Sie stehen im Gegensatz zu den Möglich-
keiten der Südwalserdialekten, wie dies (34) und (35)zeigen, bei denen dieses Phänomen schon in den ältesten
Tonaufnahmen zu beobachten ist:
(32) Ich bleibe hier und Peter geht nach Hause.
(33) Ich bliib@ dòò und d@ Peet@r gòòt häi.
15
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 16
Person, Numerus, Genus Piemontesisch Standarditalienisch1. Sg. mi i mangio io mangio2. Sg. ti it lese tu leggi3. Sg. masc. chiel a scriv egli scrive3. Sg. fem. chila a scriv ella scrive1. Pl. noi (nojàutri) i scrivoma noi scriviamo2. Pl. voi (vojàutri) i cante voi cantate3. Pl. lor (loràutri) a coro essi corrono
Tabelle 3:Verbalflexion im piemontesischen Dialekt und im Standarditalienischen im Vergleich
(34) WirWir
kriägekriegen
jaaja
gaargar
këikeinen
maaMann
ùund
mùässmuss
äeine
mùemiMuhme
blybë.bleiben.
(GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 10)
(35) UnUnd
hëëthat
naaglanachgelassen
ferfür
ëeine
haljbihalbe
stonn.Stunde.
[. . . ][. . . ]
UnUnd
hëdhat
getëëtgetötet
dreedrei
persòònënPersonen
ùndund
dreedrei
hoiwtHäupter
chiie-fe.Kuh-Vieh.(GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 35)
Es bleibt noch festzuhalten, dass GYSLING & H OTZENKÖCHERLE (1952) bei (34) einen Übersetzungsfehler
gemacht haben. Sie stellen fest, dass es hier einen Subjektswechsel gibt: im ersten Hauptsatzwir und im zweiten
pro. Die Verbalform wird von ihnen als 2. Sg. analysiert. Allerdings kann dies nach BOHNENBERGER(1913,
249f.) nicht möglich sein. Es muss sich um eine 1. oder 3. Sg. handeln.
3.2 Sprachexterne Entwicklungsmöglichkeiten
3.2.1 Piemontesischer Einfluss
Soweit zu den Möglichkeiten der internen Erklärung. Es bleibt immer noch, diese Veränderung in der Syntax auf
die Folgen des italienischen Einflusses zurückzuführen. Hier muss zunächst zwischen zwei Varianten gewählt
werden, die Erklärung über den piemontesischen Umgebungsdialekt und die italienische Standardsprache. Im
piemontesischen Dialekt gibt es nämlich ebenfalls eine Subjektverdoppelungskonstruktion (Bsp. aus BRERO,
1987, 54):
Die Grammatik von BRERO (1987, 54) unterscheidet die verschiedenen Formen der Personalpronomina fol-
gendermassen: Die Vollformen nennt BRERO (1987)përnòm soget(Subjektspronomen) oderpërnòm comple-
ment(Ergänzungspronomen), und die phonetisch reduzierten Formen werden alspërnòm dij verb(Verbalpro-
nomen) oder noch expliziter alspërnòm përsonaj verbaj(Verbalpersonalpronomen) bezeichnet. Doppeltes Auf-
treten der Subjektspronomen scheint gemäss den Angaben von BRERO (1987, 54f.) dann vorzuliegen, wenn
auch im Standarditalienischen ein Personalpronomen gesetzt würde. Ansonsten tritt daspërnòm përsonaj ver-
baj alleine auf. Dies ist eine ähnliche Verteilung, wie wir sie schon bei den Walserdialekten gesehen haben.
Ein entscheidender Unterschied liegt allerdings darin, dass die reduzierte piemontesische Form nicht obligato-
risch enklitisch an die Verbalform gebunden wird (vgl. RENZI & VANELLI , 1983, 127f. und 134f.), sondern
16
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 17
allenfalls mit anderen Pronomen Pronominalkomplexe bildet, die üblicherweise vor das Verb zu stehen kom-
men und die man nicht in allen Fällen als im engeren Sinne proklitisch analysieren kann.16 Damit fällt der Weg
einer direkten Lehnkonstruktion ausser Betracht, da im Walserdeutschen die Pronomen klitisiert und enklitisch
angehängt werden. Auch bei der Reanalyse und den Verteilungsbedingungen17 dürfte die piemontesische Kon-
struktion keine Rolle gespielt haben, da es kaum formale Ähnlichkeiten gibt. Eine Reanalyse der Formen aus
dem Standarditalienischen erscheint mir hier plausibler (siehe das folgende Kapitel). Dieses Phänomen existiert
nicht nur im piemontesischen Dialekt, sondern tritt in verschieden starkem Ausmass in allen norditalienischen
Dialekten auf RENZI & VANELLI (1983). Es wird von ihnen festgestellt, dass in vielen Dialekten das Auftreten
von Subjektspronomen obligatorisch ist, dabei handelt es sich meist um die klitischen Formen. Es kann folgende
Generalisierung aufgestellt werden: „Se una varietà fa un uso costante di almeno un pronome soggetto, questo
è quelli di 2. persona.“ (RENZI & VANELLI , 1983, 128). Die norditalienischen Dialekte verwenden also obli-
gatorisch gerade da ein Pronomen, wo dies in den Walserdialekten überhaupt nicht vorkommt, in der 2. Sg.18
Am unwahrscheinlichsten ist eine obligatorischer Ausdruck des Pronomens in der 1. Sg. und Pl. und 2. Pl., auch
dies steht in starkem Gegensatz zu den Daten aus den Walserdialekten, wo gerade die 1. und 2. Pl. besonders
häufig durch den neuen Flexionstyp ausgedrückt werden. ZÜRRER(1999, 318) weist darauf hin, dass er Verdop-
pelungskonstruktionen in der 1. und 2. Pl. bereits 1965/66 in grossem Umfang wahrnehmen konnte.
3.2.2 Einfluss der italienischen Standardsprache
Der Rückgriff auf eine externe Steuerung dieser Sprachwandelerscheinung liegt nahe, da standarditalienische
Aussagesätze in Pro-drop-Situationen in der Tat über die folgende Struktur verfügen:
(36) pro Verb Objekt/Umstandsangabe/Prädikat
(37) proich
lavoroarbeite
sulleauf=den
alpeAlpen
Durch dieses geläufige Vorbild ist es durchaus möglich, dass die Südwalser ihre Satzstruktur dem Italienischen
anpassen. THOMASON & K AUFMAN (1991, 54f.) betonen die Häufigkeit der syntaktischen Entlehnung, gerade
auch im Bereich der Basiswortstellung:
„The evidence we have collected does not support the often implicit assumption, in the literature
on word order change, that word order patterns constitute a fundamental ‚deep‘ structural feature
relatively impervious to foreign influence. On the contrary, word order seems to be the easiest sort
of syntactic feature to borrow or to acquire via language shift.“
Der Einfluss des Italienischen kann also Tendenzen der Dialekte im Bereich der Satzstruktur verstärken und so
die Verwendungshäufigkeit steigern. Der Einfluss der italienischen pro-drop-Konstruktion zeigt sich für uns vor
16 Verb und klitisiertes Pronomen können üblicherweise nicht total verschmelzen, wie es im Walserdeutschen der Fall ist. Die Klitizität desdialektalen Pronomens ist beschränkt auf seine Tonlosigkeit, nicht auf seine Fähigkeit zur Fusion.
17 Dies lässt sich hier nur schwer unterscheiden, da die Verteilungsbedingungen der Doppelsetzung im piemontesischen Dialekt und derSetzung von Subjektspronomen im Standarditalienisch dieselben sind.
18 Eine Doppelsetzung lässt sich bei der 2. Sg. zumindest formal nicht zeigen. Das klitische Pronomen der 2. Sg. lautet genau gleich wieder Auslaut der Flexionsendung, es wäre also nicht hörbar.
17
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 18
allem bei der Analyse der Verdoppelungsformen. Man muss dabei davon ausgehen, dass die Dialektsprecher eine
Form wie in (38) nicht mehr wie in (39) analysieren, sondern wie in (40):
(38) Tuen=i ertue d schkoatulu hie.(= (31))
(39) VERB.PRÄS.1SG=PPRON.NOM.1SG VERB.INF ART SUBSTANTIV.AKK ADVERB
(40) pro VERB.PRÄS.1SG VERB.INF ART SUBSTANTIV.AKK ADVERB
Das heisst heute werden die einfachen Formen von den Sprechern nicht mehr als flektierte Verbform mit enkli-
tischem Personalpronomen gedeutet, sondern als verbaler Präsensstamm mit Flexiv und pro. Diese Deutung hat
zur Folge, dass pronominale Subjekte nur noch in emphatischem (betonten) Gebrauch auftreten:
(41) werwir
šegwersussagen=wir=es
duden
xendu.Kindern.
Wir sagen es den Kindern.(BAUEN, 1978, 67, Satz 12)
(42) SchiSie
hentschhaben=sie
tèdir
gseidgesagt
èsuòfardann
zzu
lache.lachen.
‚Sie haben dir gesagt, du sollst lachen‘ (WAIBEL , 1985, 53)
(43) ii,Ich,
deden
roggeRoggen
maan=imag=ich
niit,nicht,
deden
han=ihabe=ich
ninicht
geere,gerne,
deden
rogge,Roggen,
ischist
sotteso
schweerschwer
zzu
zereernten
ischist
deder
rogge.Roggen.
‚Ich mag den Roggen nicht, der ist so schwer zu ernten.‘ (ZÜRRER, 1999, 341, (d))
(44) eerEr
noanach
demdem
esseEssen
tut=ertut=er
esein
stoosjiwenig
reschte.ausruhen.
‚Er ruht nach dem Essen ein wenig aus.‘ (ZÜRRER, 1999, 341, (e))
(45) iichIch
samstagSamstag
undund
sunnatagSonntag
bin=ibin=ich
gengjeweils
zzu
eischemme.Issime.
‚Samstags und sonntags bin ich jeweils in Issime.‘ (ZÜRRER, 1999, 341, (g))
(46) dschiendriSie
entwegenvon=wegen
ürjunihrem
schoadiSchaden
hen=dschhaben=sie
vilviel
erlitte.erlitten.
‚Wegen ihrem Schaden haben sie viel erlitten.‘ (ZÜRRER, 1999, 341, (i))
Die genannten Beispiele zeigen, dass für verschiedene Sprachinseln Verdoppelungskonstruktionen mit Pronomen
auftreten (Rimella (41), Macugnaga (42), Gressoney (43) und (44) und Issime (45) und (46)). Wenn es sich nun
aber bei dem enklitischen Personalpronomen um ein Flexiv handeln soll, dann muss es auch dann auftreten, wenn
das Subjekt durch ein Substantiv voll ausspezifiziert ist:
(47) ÙndUnd
dùmnaadanach
mùòsmuss
mùman
zäämùmòchùzusammenmachen
dsdas
fyrFeuer
ùndund
erlësche,erlöschen,
suschsonst
chentiskönnte=es
ufstaaaufstehen
äsdas
fyrFeuer
ùndund
dëëdann
alsganze
dòrfDorf
ferbrünnä.verbrennen.
‚Danach muss man das Feuer zusammenkehren und löschen, sonst könnte es wieder aufflackern und das
ganze Dorf verbrennen.‘ (GYSLING & H OTZENKÖCHERLE, 1952, 39)
18
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 19
(48) nungnun
deden
summerSommer
sin=dschsind=sie
zzur
alpu,Alp,
ddie
chüü,Kühe,
unund
nöinicht
hei.heim.
‚Jetzt im Sommer sind sie auf der Alp, die Kühe und nicht zuhause.‘ (ZÜRRER, 1999, 339)
(49) chant=erKann=er
nimmenicht=mehr
weerchu,arbeiten,
deder
profésser,Professor,
vovon
wenwegen
hät=erhat=er
ghägehabt
deeden
intschidént.Unfall.
‚Der Lehrer kann nicht mehr arbeiten, weil er einen Unfall gehabt hat.‘ (ZÜRRER, 1999, 340)
Bei Beispiel (47) bin ich mir nicht sicher, ob die enklitische Form wirklich grammatikalisiert ist. Das Beispiel
(48) stammt aus Issime, (49) aus Gressoney. Es zeigt, dass es sich hierbei um eine Konstruktion mit rechtsver-
schobenem substantivischen Subjekt handelt. Das Subjekt wird wie eine Aposition nachgestellt. Diese Satzstel-
lung tritt übrigens auch im Italienischen auf (FANSELOW & FELIX , 1987, 213–218). Aber auch eine für das
deutsche übliche Satzstellung mit Subjekt in Erstpostion ist möglich:
(50) dischiDiese
preiPreise
vallen=dschgefallen=sie
nöinicht
daden
chiemeraKrämern.
‚Diese Preise gefallen den Händlern nicht.‘ (ZÜRRER, 1999, 345)
(51) suntaSonntag
zzur
nachtNacht
minmeine
moateneMädchen
gangen=dschgehen=sie
zruggzurück
zzu
meiland.Mailand.
‚Sonntagabend gehen meine Töchter zurück nach Mailand.‘ (ZÜRRER, 1999, 344)
(52) unund
derder
vatterVater
häd-erhat=er
teltgesagt.
‚und der Vater hat gesagt.‘ (DAL NEGRO, 2000, 38)
Beispiel (50) aus Issime passt ausgezeichnet zu deutschen Syntaxmuster, bis auf die Voranstellung desnöi ‚nicht‘,
dieses müsste im Deutschen am Satzende stehen. Beispiel (51) aus Gressoney zeigt eine Eigenart der Syntax, die
unter italienischem Einfluss entstanden ist. Die Umstandsangabe kann topikalisiert werden, allerdings führt dies
nicht wie in den übrigen deutschen Dialekten zu einer Inversion des Subjekts, sondern die SV-Abfolge bleibt
erhalten.19 Das Beispiel (52) aus Pomatt zeigt noch einmal die Erhaltung der V2-Stellung nach Konjunktion.
3.2.3 Weitere „Motoren“ der Grammatikalisierung
Damit haben wir also eine Liste von Konstruktionen, die in den Südwalserdialekten eine Grammatikalisierung
ermöglichten. ZÜRRER(1999, 333) sieht in den sog. Kurzverben einsilbige Verben von hoher Frequenz, z. T. als
Auxiliare grammatikalisiert – siehe dazu NÜBLING (1995) und NÜBLING (2000) –, die in der Rede besonders
hochfrequent sind, die Schrittmacher dieser Veränderung. Bei den Kurzverben handelt es sich um die folgen-
den Verben: tun, wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen, gehen, stehen, lassen, fangen, ziehen, sehen,
nehmen, geben, tragen und wissen. Ausserdem gehören auch die Auxiliare sein und haben hierher. Besonders
wichtig ist hier das Verbtue „tun“, das in den meisten alemannischen Mundartgebieten eine hohe Frequenz
aufweist, da in diesen Dialektgebieten viele Verben in der folgenden periphrastischen Form flektiert werden:
(53) ich tu@ goo, du tu@sch lauff@, er tu@t schlòòff@, miir tü@nd los@, i@r tü@nd leer@, sii tü@nd schriib@
19 Erläuterungen zu diesem Problem bei BAUEN (1978, 59f.), ZÜRRER(1995, 349, 354f.), DAL NEGRO(2000, 40–42).
19
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 20
Beschreibung BeispielNormalfom ich tuenNormalform mit pro-drop tuenreanalysierte Form mit Personalpronomenich tuen=ireanalysierte Form mit pro-drop tuen=i
Tabelle 4:Verbale Kontruktionsmöglichkeiten des Verbestun
Im Südwalserischen schient diese Art der Konstruktion äusserst häufig aufzutreten. GIACALONE RAMAT be-
gründet mit dem Verweis auf die hohe Verwendungsrate der tun-Periphrase den Verdacht, dass die walseri-
schen Sprachinseldialekte vom Sprachtod bedroht wären, da es sich bei diesen periphrastischen Konstruktionen
um typische Anzeichen von Sprachverfall und Semisprechertum handle (GIACALONE RAMAT , 1989, 45, 61f.).
Ausgehend von dieser Konstruktion kann GIACALONE RAMAT sicher nicht eine Sprachtodsituation für die süd-
walserischen Dialekte annehmen, sonst müsste das Schweizerdeutsche ebenfalls seit einiger Zeit ausgestorben
sein.20
Wichtig ist die Beobachtung von ZÜRRER, dass diese Verben aufgrund ihrer besonderen Häufigkeit, gerade
auch in Frage-Antwort-Situationen besonders anfällig für eine Grammatikalisierung des klitischen Personalpro-
nomens sind. Nachdem sich die Grammatikalisierung bei den Kurzverben durchgesetzt hat, kann sie leicht durch
analogische Ausweitung(analogic extension)auch auf die anderen Verben übergreifen und die angestammten
Formen verdrängen. Es scheint, dass die Kurzverben sehr anfällig sind für Wandel in die Richtung einer stärkeren
Irregularisierung, Die Kurzverben sind gezwungen, auf Grund der Beschränkungen in der Struktur (1 Silbe als
Maximum), andere Möglichkeiten der Differenzierung zu wählen. Wenn aber diese Strukturbeschränkung auf-
gegeben wird, werden neue Bildungsmöglichkeiten gewonnen. In unserem Beispiel durch eine Reanalyse von
klitischen Personalpronomen als Verbalendungen. Damit wird der sprachliche Druck nach der eindeutigen Zu-
ordnung einer Form(one meaning one form)erfüllt, ohne sich dies durch starke Variation (Unregelmässigkeit)
der Verbalwurzel zu erkaufen (vgl. bspw. die alem. Kurzverbversion von ’haben’ bei NÜBLING 2000, 27). Aus
einer unregelmässigen Form, bzw. in diesem Fall aus einem Bildungsprinzip für eine zahlenmässig eng begrenz-
te Verbklasse, kann aber durch Ausdehnung der Bildungsprinzipien (mittels Analogie) eine regelmässige Form
werden. Das heisst, dass ein neues Bildungsprinzip die bisherige Formenbildung in allen Fällen ablöst, wie dies
hier der Fall ist. ZÜRRER(1999, 367) bemerkt einschränkend: „Auch wenn sich die Formenvielfalt vor allem bei
den Kurzverben manifestiert, lässt sich die Variation auch im Gebrauch der Vollverben nachweisen.“
Die von ZÜRRER angesprochene Formenvielfalt nimmt darauf Bezug, dass sich in den Südwalserdialekten
bisher noch keine Verbalbildung voll durchgesetzt hat. Es gibt Variation, die durch verschiedene Faktoren (so-
ziolinguistisch, grammatisch) gesteuert wird. Es existieren die folgenden Varianten, vgl. Tabelle 4:21
Als zusätzliche Quelle für Variation kann jedes Vollverb „normal“ oder mit Hilfe des Auxiliars ‚tun‘ konjugiert
werden. Das Verb tun scheint in diesen Dialekten eine Grammatikalisierung durchzumachen und den Status ei-
nes grammatischen Funktionswortes einzunehmen. In der Generativen Grammatik22 (vor Minimalistic Program)
20 Im übrigen haben auch die folgenden höchst lebendigen Sprachen die Flexion an ein Auxilar delegiert: Keltisch, Baskisch, Hindi undeinige weitere Sprachen (freundliche Mitteilung von Prof. Dr. P. GALLMANN ).
21 Die Tabelle folgt den Ausführungen von ZÜRRER(1999, 367f.).22 Ich stütze mich hier vorwiegend auf FANSELOW & FELIX (1987); GALLMANN (1990); HAEGEMAN (1995)
20
Roman Sigg Verbflexion im Walserdeutschen 21
könnte man in dieser Verwendung tun nicht mehr als Verb klassifizieren, sondern zur funktionalen Wortart INFL
bzw. I zählen. Die Verteilung der Verwendung folgt ungefähr diesen Richtlinien:
• Normalform — ältere Generation
• reanalysierte Form mit SP — mittlere Generation, jüngere Generation emphatisch
• reanalysierte Form mit pro-drop — jüngere Generation
• Normalform mit pro-drop — jüngere Generation in Anlehnung an die reanalysierte Form mit pro-drop
Die genannten Verwendungsbeschränkungen sind nicht absolut zu verstehen, sondern lediglich als eine ungefähre
Beschränkung der Variation.
21
4 Theoretische Betrachtungen und Erklärungsmodelle zur
Verbalflexion im Walserdeutschen
4.1 Sprachwandeltheorien – Sprachkontaktforschung 23
Der Fall von kontaktinduziertem Sprachwandel (bzw. die Möglichkeit dessen) stellt die allgemeinen Sprach-
wandeltheorien vor gewisse Probleme, bietet ihnen aber auch vereinfachende Erklärungsmöglichkeiten.24 Die
Schwierigkeiten liegen darin, dass das Ideal der Sprachwandeltheorie davon ausgeht, dass sich Sprachen selb-
ständig, ohne äusseren Einfluss entwickeln. Das heisst die Sprachveränderung geht zurück auf interne Faktoren
im Sprachsystem (z. B. bei den Junggrammatikern oder noch rigider bei den Strukturalisten wie z. B. MOUL-
TON) oder auf Veränderungen der kommunikativen Bedürfnisse der Sprachbenutzer, die eine Anpassung des
Sprachsystems notwendig machen (funktionalistische Erklärungsmodelle). Dazu kommt Sprachwandel durch
unvollständigen Erwerb der muttersprachlichen Grammatik und Regelübergeneralisierung (Analogie). In die-
sen Erklärungszusammenhängen wird davon ausgegangen, dass die umliegenden anderen Sprachen und Dia-
lekte den Wandelprozess in einer SPRACHEx nicht beeinflussen können, dass die SPRACHEx also ein diskretes
System darstellt, das keinen Umgebungseinflüssen von aussen ausgesetzt ist.25 Diese Sicht lässt sich in ihrem
Absolutheitsanspruch nicht aufrechterhalten. Schon die Junggrammatiker mussten die Möglichkeit lexikalischer
Entlehnungen eingestehen. Allerdings wurde von ihnen die Auswirkungen von Sprachkontakt auf dieses Gebiet
beschränkt und zusätzlich erlaubt, dass mit dem Lexikonmaterial auch grammatisches Material, nämlich Phone
und Phoneme (damals als Begriff noch nicht etabliert), mitentlehnt wurden. Diese führen allerdings in der Ziel-
sprache kein eigenständiges Dasein, sondern bleiben an das entlehnte Sprachmaterial gebunden und können sich
nicht in das ursprüngliche Sprachmaterial ausbreiten. Ähnlich verhält es sich auch mit Wortbildungsmorphemen,
auch diese bleiben an das Material aus der Lehnsprache gebunden: Sie können nicht autonom entlehnt werden,
sondern nur zusammen mit lexikalischem Material (vgl. PAUL , 1920, 390–403, 22. Kapitel „).
Gegen diese Sicht wurde schon früh Einspruch erhoben und auf das Beispiel des Balkansprachbundes (SCHU-
CHARDT) verwiesen. Daraufhin wurden theoretische Diskussionen über die Möglichkeiten und Beschränkungen
der Entlehnung von sprachlichem Material (v. a. grammatisch) geführt, die zu keiner harten allgemeingültigen
Regel geführt haben (vgl. THOMASON & K AUFMAN , 1991, 14–20). Eine der wichtigsten Beschränkungen,
die für Entlehnungssituationen angeführt wird, lautet: Es ist nicht möglich grammatisches Material aus einer
SPRACHEx in eine SPRACHEy zu entlehnen, wenn nicht schon Wortschatz aus der SPRACHEx in die SPRACHEy
entlehnt wurde (vgl. THOMASON & K AUFMAN , 1991, 21f.)26. Grundsätzlich bleibt mit linguistischen Mitteln
23 Eine Übersicht über verschiedene Theorien ist in DAUSES(1990) und DAUSES(1993) enthalten. Allerdings übt er teilweise vernichtendeKritik an den Theorien und deren Vätern.
24 Böse gesagt schliessen die meisten Sprachwandeltheorien Sprachkontakterscheinungen als nicht erklärbar vom Geltungsbereich aus,andererseits ist alles, was von der Theorie nicht vorhergesagt werden kann, überraschenderweise auf Sprachkontakt zurückzuführen.
25 Diese Sichtweise war natürlich für die Etablierung der genetischen Sprachverwandschaft und der Technik der Rekonstruktion wichtig.26 An der angegebenen Stelle finden sich auch die häufigsten Einwände gegen diese Sichtweise.
22
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 23
nicht erklärbar, warum eine Sprache wann von einer anderen Sprache etwas entlehnt. V. KIPARSKY (1938: 176):
„Die Fähigkeit der sogenannten ‚homogenen‘ Sprachen, Entlehnungen (mots communs de l’Europe) aufzuneh-
men, hängtnicht von der linguistischen Struktur der Sprache, sondern von der politisch-sozialen Einstellung
der Sprecher ab.“27 Damit ist auch schon einer der Eckpunkte der Erklärungsmöglichkeiten abgesteckt: Rein
linguistische Erklärungen für Sprachinterferenzen sind nicht möglich.
In unserem Fall kann auch nicht von einer direkten Entlehnung gesprochen werden, da weder das lexikalische
(zumindest zum überwiegenden Teil bei den Verben) noch das grammatische Material aus dem Italienischen ent-
lehnt wurden. Bei den neuen Flexionsendungen handelt es sich ja von der Materialbasis her betrachtet um die
klitischen Subjektspronomina des Walserdeutschen. Wir können also die Prämisse aufstellen, es handle sich in
unserem Fall um eine Art Lehnsyntax. Damit würden wir natürlich ausschliessen, dass es sich um eine Sprach-
entwicklung handelt, die auch ohne italienischen Einfluss zustande gekommen wäre.28
Gerade der Bereich der Syntax zeigt sich relativ offen gegenüber Entlehnungsphänomenen, im Gegensatz da-
zu steht die Morphologie, wo sich insbesondere die Flexionsmorphologie als sehr resistent gegen Entlehnungen
zeigt (THOMASON & K AUFMAN , 1991, 52–54). Unser Phänomen lässt sich auch zweigeteilt betrachten: Einer-
seits ein Wandel in der Verbalmorphologie, der innerhalb des Dialekts erfolgt und mit Dialektmaterial durchge-
führt wird, andererseits ein Wandel in der syntaktischen Struktur, der ohne den vorhergehenden morphologischen
Wandel nicht möglich wäre und der auf italienischen Einfluss schliessen lässt. Auf diese Abfolge lässt auch die
Beobachtung von ZÜRRER schliessen, der in ZÜRRER (1999, 318) über seine ersten Erhebungen in Gressoney
zu unserem Phänomen schreibt: „Diese Formen verstand mein Gewährsmann ausdrücklich als Normalformen;
trotz der Doppelsetzung des Subjektspronomen hatten sie keinen Hervorhebungscharakter.“ Der morphologische
Wandel ist damit unabhängig vom syntaktischen Wandel erfolgt. Damit haben wir nun ein morphosyntaktisches
System, bei dem die Markierung der grammatischen Kategorie Person sehr aufwändig erfolgt. Diese Art der
Konstruktion, die auch noch eine Kongruenz im Falle von Genus ermöglicht, ist typologisch stark markiert.
Hier setzt nun der Syntaxwandel als „Reparaturmechanismus“ ein. Es stehen sicher mehrere Wandeloptionen
zur Verfügung (Abbau der Flexionsendungen, Aufgabe Genuskongruenz, etc.). Die Sprechergemeinschaft wählt
anscheinend die Nachbildung der italienischen pro-drop-Konstruktion. Diese ist vom Standpunkt der Markiert-
heit zwar besser, aber keinesfalls ideal. Die Sprachkontaktforschung würde diese Wahl mit dem starken sozio-
kulturellen Druck des (Standard-)Italienischen auf die Südwalserdialekte erklären. THOMASON & K AUFMAN
(1991, 75):
. . . Fairly extensive word order changes will occur at this stage, as will other syntactic changes that
cause little categorial alternation. In morphology, borrowed inflectional affixes and categories will
be added to native words, especially if there is a good typological fit in both category and ordering.
Insbesondere auch die letzte Bedingung ist erfüllt, da die alemannischen Dialekte in gewissen Sprechsituationen
auf die overte Realisierung eines Personalpronomens in der 1. und 2. Person Singular verzichten können (wie
weiter vorne angesprochen wurde), eine Artpro-drop-parameterin den Dialekten schon angelegt ist.
Eine weitere Verbesserung bezüglich der Situation der Markiertheit würde erreicht, wenn die Genuskongruenz
zwischen Subjekt und Verb wieder aufgehoben werden würde. Dieser Wandel ist dabei sich zu vollziehen, da
27 Zitiert nach THOMASON & K AUFMAN (1991, 35)28 Diese Frage kann wie unter Kapitel 3.1 nicht seriös geklärt werden.
23
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 24
die Genusunterscheidungen in der 3. Person dabei sind, neutralisiert zu werden. Die drei Genera fallen hier im
Neutrum zusammen (vgl. ZÜRRER, 1999, 254f.). Dies wirkt sich auch im Bereich der Flexion aus, da hier wohl
immer häufiger Sätze wie der folgende auftauchen werden:
(1) UnUnd
deda
darder
maischterMeister
vovon
ladem
macchinaAuto
arìvurut=sankommt=es
devom
kursaLaufen
uund
seet=ssagt=es
muihm
zzu
baituwarten
zzu
nöinicht
machumachen
ladie
multaBusse
worumweil
ähäh
ischtist
iiser
ischtist
enein
oartzatArzt
unund
ischist
siingewesen
zzu
machumachen
unaeine
visita.Visite.
‚Und da erscheint der Besitzer des Autos und sagt ihm, er solle ihm keine Busse geben, weil er ein Arzt
sei und bei einer Visite gewesen ist.‘ (ZÜRRER, 1999, 374)
Die fettgedruckten Stellen zeigen deutlich, dassder maischterzwar immer noch ein Maskulinum darstellt, dass
das grammatische Geschlecht aber weder in der Verbalform noch als Pronomen spezifiziert werden muss (Neu-
tralisierung der Kongruenz). Wir haben es hier mit einem Fall der Unterspezifikation zu tun, der interessanter-
weise von der deutschen Hierarchie abweicht: hier wäre das Maskulinum die unterspezifizierte Form. Dieses
System kommt laut ZÜRRER (1999) immer stärker in Gebrauch. In diesem Fall handelt es sich wohl nicht um
ein Kontaktphänomen aus dem Italienischen oder Piemontesischen, die beide ein ausspezifiziertes Genussystem
(masc. vs. fem.) besitzen, sondern es handelt sich um eine interne Sonderentwicklung der Südwalser Dialekte.
Allerdings mit positiven Auswirkungen auf den Markiertheitsgrad der Sprache.
Wie bereits früher angesprochen wurde, haben wir es beim jetzigen Zustand der Sprache noch nicht mit einem
gefestigten System zu tun. AITCHISON (1995, 11) beschreibt ein solches System folgendermassen:
(a) Multiple options arise.
(b) The balance of power shifts, so that some become more favoured than others.
(c) The options are whittled down. Some become established, others are specialized as minor usages, or wither
away.
(d) The winning option is one in which various pressures all coincide giving an impression of collusion. Where
several options are possible within broader constraints, social pressures dictate the outcome, particularly the
superficial convergence of structures in two different languages.
Im Walserdeutschen scheint es der Fall zu sein, dass wir es in gewissem Sinne mit einer Situation wie unter
(c) beschrieben zu tun haben. Der Wandel hat stattgefunden, die Konstruktion hat sich verfestigt und ausge-
breitet, aber nicht als einzige Möglichkeit. Die alte Konstruktion bleibt daneben weiterhin bestehen. Neben den
schon vorher angesprochenen soziolinguistischen Parametern, die einen Teil der Auftretensrestriktionen darstel-
len, wird diese ältere Konstruktion aber auch immer noch von der jüngeren Generation verwendet. Als Erklärung
dafür bietet sich an, dass sie vor allem bei einem Verb häufiger auftritt: sein. In vielen Beispielsätzen, auch
bei der jüngeren Generation, treten Formen wieischt und nichtischt=er auf, auch wenn die Formen ansonsten
durchgehend auf die neue Weise gebildet werden (vgl. die Übertragung der Bildergeschichte in ZÜRRER 1999,
374). Entweder wurde dieses Verb gar nie vom Wandel erfasst, oder es setzt erneut das Irregularisierungs- und
Kürzungsprinzip ein, das von NÜBLING (2000) postuliert wird.
24
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 25
4.2 Natürlichkeitstheorie
Die Natürliche Morphologie hat sich sehr intensiv mit Sprachwandelphänomenen beschäftigt, allerdings vor-
zugsweise auf dem Gebiet der Flexionsmorphologie von Nomen (v. a. WURZEL, 1984). Die Natürliche Mor-
phologie geht davon aus, dass sprachliche Formen und Strukturen mehr oder weniger „natürlich“ sein können.
MAYERTHALER hat den Natürlichkeitsbegriff gemäss WURZEL (1984, 21) folgendermassen definiert: Ein mor-
phologischer Prozess oder eine Struktur sind dann natürlich, wenn sie weit verbreitet (typologisches Argument)
und/oder im Erstspracherwerb früh erworben (Spracherwerbsargument) und/oder durch Sprachwandel häufig
entstehen. Ausgehend von dieser Definition von Natürlichkeit kann man behaupten, dass der Natürlichkeitsbe-
griff in anderen linguistischen Richtungen wohl mit unmarkiert bezeichnet werden würde. Davon ausgehend
wird definiert, dass gewisse morphologische Konstruktionsprinzipien natürlicher sind als andere (WHEELER,
1993, 96):29
I. Das Prinzip der Systemangemessenheit
II. Das Prinzip der Klassenstabilität
III. Uniformität und Transparenz
IV. Das Prinzip der konstruktionellen Ikonizität
V. Das Prinzip der phonetischen Ikonizität
Die Prinzipien I. und II. werden von WURZEL (1984); WURZEL (1987) als systembezogene Natürlichkeits-
prinzipen bezeichnet. Diese sind innerhalb eines einzelsprachlichen Systems gültig. Wogegen die übrigen Prin-
zipien universal gültig sind, aber in Konkurrenz zu den systembezogenen Prinzipien stehen. Sprachwandel muss
sich also innerhalb der von den Prinzipien erlaubten und ermöglichten Grenzen bewegen.
In unserem Fall prüfen wir zunächst, ob sich die Veränderungen in der Morphologie innerhalb des durch die
Theorie vorgegebenen Rahmens befinden. WURZEL (1987) unterscheidet im Falle der Systemangemessenheit
folgende Faktoren: welche grammatischen Kategorien werden kodiert, Stamm- vs. Grundformflexion, morpho-
logische Typologie, Synkretismen, wie wird die grammatische Kategorie kodiert, Existenz von verschiedenen
Klassen. Dies ergibt folgende Gegenüberstellung:
Bei Betrachtung dieser Faktorenaufstellung ergibt sich, dass sich im Bereich der Systemangemessenheit nur
wenig geändert hat. Im Rahmen der kodierten grammatischen Kategorien ist zusätzlich das Genus in der 3. Sg.
hinzugekommen, allerdings findet hierbei wie im vorherigen Kapitel ausgeführt ein Prozess der Genus-Neu-
tralisierung statt. Eine zweite Entwicklung erweist sich als entscheidender: die Aufhebung des Synkretismus
zwischen der 1. und 3. Pl. Die Bildung der Flexionsklassen ist durch die neuen Suffixe nicht tangiert, da sich
die Flexionsklassen nur auf die unterschiedlichen Partizipformen beziehen. Allerdings kommt es zu einer star-
ken Vereinheitlichung des Suffixsystems. Es gibt also Änderungen in den systemdefinierenden Eigenschaften.
Die Erklärung von WURZEL für diese Veränderungen lässt sich mit unseren Ergebnissen in Einklang bringen,
WURZEL (1987, 68): „System defining morphological change is always due to phonological change.“ In diesem
Fall muss man einfach davon ausgehen, dass die Klitisierung der Subjektspronomen unter dem Druck der Syntax
29 Die Termini folgen denen von WURZEL
25
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 26
Faktoren alte Verbalflexion neue Verbalflexiongrammatische Kategorien Person, Numerus, Tempus Person, Numerus, (Genus), Tem-
pusFlexionsart Stammflexion Stammflexionmorphoplogische Typologie flektierend flektierendSynkretismen? 1. Pl. = 3. Pl. keineArt der Kodierung Flexion plus Stammwechsel (teil-
weise) Sg. zu Pl.Flexion plus Stammwechsel (teil-weise) Sg. zu Pl.
Klassen Existenz von Flexionsklassen Existenz von Flexionsklassen
Tabelle 5:Prinzipien der Natürlichkeitsmorphologie auf die Südwalser Verbalflexion angewendet
zustande kamen. Durch den phonologischen Prozess der Abschwächung, als Folge ihrer unbetonten Stellung,
entstand quasi „sinnloses“ sprachliches Material(junk), insbesondere bei Doppelsetzung des Subjekts, das eine
neue Funktion zugewiesen bekam.
Kollidieren diese Veränderungen mit den systemunabhängigen Natürlichkeitsbedinungen? Die Antwort auf
diese Frage heisst sicher nein. Die Bedingung der Uniformität und Transparenz wird voll eingehalten. Das Prin-
zip one function – one form(Uniformität) kommt durch den Umbau der Verbalflexion mit der Beseitigung des
Zusammenfalls in der 1./3. Pl. voll zur Geltung. Die Transparenz ist ebenfalls gewährleistet, da die Flexive klar
erkennbar sind. Im Bereich des konstruktionellen Ikonismus kommt es ebenfalls zu Veränderungen, die system-
verbessernden Charakter haben. Der Unterschied Singular vs. Plural wird durch eine modulatorische und eine
additive Komponente erreicht. Dies war auch zuvor schon der Fall, allerdings sind die neuen Flexive qualitativ
besser, da sie aus mehr Segmenten bestehen. Das Prinzip der phonetischen Ikonizität scheint für unser Problem
kaum eine Rolle zu spielen (vgl. MAYERTHALER, 1980, 92–107).
Damit hat sich klar gezeigt, dass sich durch den Sprachwandel Verbesserungen in der Struktur der Sprache
ergeben haben, die einen höheren Natürlichkeitswert zur Folge haben. Somit ist durch den Sprachwandel ein
neues, stabiles Flexionssystem entstanden.
4.3 Generative Erklärungsmodelle
Die Generative Grammatik hat sich mit Ausnahmen von LIGHTFOOTselten mit Sprachwandelproblemen befasst.
Generative Ansätze dürften jedoch für unser Problem doch von Interesse sein, da sich Anhänger der Generati-
ven Theorie ausführlich mitclitic doubling, pro-dropund der Syntax von Personalpronomen beschäftigen. Die
genannten Phänomene stellen die Theorie vor gewisse Probleme.
Die Generative Theorie beschäftigt sich bereits seit den 1970er Jahren mit dem Problem der Personalpronomi-
na. Unumstritten war, dass es zwei Klassen von Pronomen gibt: starke und schwache/klitische. Als starke Prono-
men wurden die pronominalen Vollformen bezeichnet, während die schwachen Pronomen als reduzierte Formen
angesehen wurden. Dennoch liessen sich damit nicht alle bekannten Phänomene in den Griff bekommen, z. B.
wann treten phonologisch reduzierte Formen auf, wie ist die Verteilung stark vs. schwach gesteuert, etc. Zwei
Ansätze versuchten dieses Problem zu lösen: ZWICKY (1977)30 und CARDINALETTI & STARKE (1995). Beide
30 ZWICKY , Arnold (1977): On Clitics. In: Phonologica 1976: Akten der dritten Internationalen Phonologie-Tagung. DRESSLER, W.U.;PFEIFFER, O. E. (Hg.). Wien.
26
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 27
Ansätze schlagen anstelle der traditionellen Zweiteilung eine Dreiteilung vor. Da sich der Ansatz von CARDINA -
LETTI & STARKE (1995); CARDINALETTI & STARKE (1996) im Moment durchgesetzt hat, begnüge ich mich
damit, diesen kurz vorzustellen.
4.3.1 Cardinaletti & Starke
CARDINALETTI & STARKE (1996, 23) stellen fest, dass es Pronomen gibt, die sich koordinieren lassen (mit
„und + NP“ ergänzt werden) und solche, bei denen das nicht funktioniert; die sich modifizieren lassen (mit NP
oder Adverb) und solche, die nicht modifiziert werden können; und solche, die verschiedenen Stellungsregeln
gehorchen. Sie zeigen dies anhand von Beispielen aus der deutschen Standardsprache und stellen fest, dass das
Subjektspronomen der 3. Sg. mas. und der 3. Sg. neutr. nicht zur gleichen Klasse der Pronomen gehören. Damit
befinden sie sich noch in den traditionellen Gefilden der Grammatikschreibung. Im Italienischen lässt sich noch
eine weitere Pronominalklasse nachweisen. Damit kommen sie auf ein dreigeteiltes Pronominalsystem, das sie
als universell ansehen:strong pronouns, weak pronouns, clitic pronouns. Weakundclitic pronounswerden von
CARDINALETTI & STARKE auch alsdeficient pronounsbezeichnet.
Welche Eigenschaften haben nun die einzelnen Pronomenklassen? Starke Pronomen haben die Eigenschaft,
dass sie sich nur auf menschliche Referenten beziehen können (+hum-constraint). Schwache Pronomen können
sich auf menschliche und nicht-menschliche Entitäten beziehen (CARDINALETTI & STARKE, 1996, 29). Starke
Pronomen haben ausserdem die Eigenschaft, dass sie an jeder möglichen Position im Satz stehen können, wäh-
rend deficient pronouns nur in bestimmten Positionen auftreten können: „A characteristic of deficient pronouns
is their rigid placement: they cannot appear ‚outside‘ of their clause, e. g. topicalized or dislocated, nor in their
basic (thematic) position“ (CARDINALETTI & STARKE, 1996, 32). Für die klitischen Pronomen gelten noch här-
tere Positionsbedingungen, da es sich bei diesen um syntaktische Köpfe handle: „Clitics behave as heads: when
the verb (a head) to which they are adjacent is displaced, they are displaced along with it“ (CARDINALETTI &
STARKE, 1996, 29f.). D. h. wir haben es hier mit Kopfadjunktion zu tun, das klitische Pronomen kann nur bei sei-
nem syntaktischen Kopf, V0 bzw. I0 oder bspw. COMP, stehen, jede andere Position wäre verboten. Neben diesen
syntaktischen Beschränkungen gibt es auch semantische Beschränkungen. Starke Pronomen können nicht exple-
tiv oder in unpersönlichen Konstruktionen verwendet werden (vgl. CARDINALETTI & STARKE, 1995, 9). Starke
Pronomen brauchen zwingend einen Referenten, s. o., während dieser bei defektiven Pronomen nicht unbedingt
notwendig ist (vgl. CARDINALETTI & STARKE, 1995, 14ff.).
Zusammenfassend gehen CARDINALETTI & STARKE (1995, 36f.) davon aus, dass sich die Pronomen syntak-
tisch folgendermassen verhalten:
(2) strong pronouns non-deficient XPs
weak pronouns deficient XPs
clitic pronouns deficient X0s
Damit sind die syntaktischen Eigenschaften geklärt, aber es ist noch nichts über die Oberflächenrepräsentation
dieser Struktureigenschaften gesagt. In beiden Artikeln wird klar darauf hingewiesen, dass sich die unterschied-
lichen strukturellen Eigenschaften zwischen starken und defektiven Pronomen nicht zwingend an der Oberfläche
wiederspiegeln müssen. Allerdings kann es vorkommen, dass sich die starke, die schwache und die klitische
27
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 28
Form tatsächlich unterscheiden, dies muss aber nicht der Fall sein. Für CARDINALETTI & STARKE ist klar, wie
die Beispiele (3) und (4) zeigen, dass klitische Formen an der Oberfläche nicht von syntaktischen Klitika erzeugt
werden müssen.
(3) S isch gu@t.
(4) Ès isch gu@t.
Gemäss ihrer Theorie dürfte die Form in (3) nicht grammatisch sein, da an dieser Position keine klitischen Pro-
nomen erlaubt sind. Dieses Problem lässt sich in den Griff bekommen, wenn man diesess als starkes Pronomen
analysiert, das erst in der PF (Phonetische Form) klitisiert wird. Damit lässt sich diese Klippe umschiffen.
Als Verteilungsregel der verschiedenen Pronomenklassen heisst es bei ihnen: „Choose the most reduced“
(CARDINALETTI & STARKE, 1996, 33). Das heisst, wenn immer möglich wird ein klitisches Pronomen verwen-
det, sonst ein schwaches und wenn dies auch nicht möglich ist, ein starkes. Diese Regel favorisiert das Auftreten
von klitischen oder sogar Ø-Elementen (pro).
Anwendung auf die Südwalserflexion
Wenn wir nun die Theorie von CARDINALETTI & STARKE anwenden wollen, müssen wir klären, wie der Status
der verschiedenen Pronomen nun genau aussieht. Bei den Vollformen müssen wir herausfinden, ob es sich um
strongoderweak pronounshandelt.Strong pronounszeichnen sich gemäss der Theorie dadurch aus, dass sie
an jeder Stelle stehen können, an denen eine volle NP stehen darf, dass sie sich ausschliesslich auf menschliche
Referenten beziehen, sowie dass sie koordinier- und modifzierbar sind.
Auf die Positionsbedingung werde ich am Schluss genauer eingehen. Die Erfüllung der +hum Beschränkung
kann an und für sich von keinem der Pronomen exklusiv geschafft werden. Man muss davon ausgehen, dass
es eine homophone starke und schwache Variante gibt. Wie Beispiel (45) zeigt lässt, sich leicht ein starkes
Pronomen mit Modifikation (Ergänzung der NP mit Temporaladverb etc.) finden. Ein Beispiel mit Koordination
konnte ich im vorhandenen Material nicht auf Anhieb finden. Die gezeigten Beispiele sollten aber deutlich genug
illustrieren, dass die vollformigen Subjektspronomen zumindest potentiellstrong pronounssein können. Sie sind
auch positionell nicht irgenwie gebunden.
Sehr einfach sieht die Sache bei den klitischen Subjektspronomen aus. Diese können sich auf nicht mensch-
liche Referenten beziehen, sind weder modifizierbar noch koordinierbar und haben ein extrem eingeschränktes
positionelles Auftreten: sie können eigentlich nur direkt nach dem finiten Verb auftreten, d. h. direkt an ihrem
host. Damit ergäbe sich eine gute Möglichkeit die Grammatikalisierung dieser klitischen Pronomen zu Flexions-
suffixen zu erklären.
4.3.2 Syntaktische Position der Klitka diverse Ansätze
Gemäss der Theorie von CARDINALETTI & STARKE handelt es sich bei syntaktischen Klitika um Köpfe (X0).
Diese müssen obligatorisch Kopfpositionen besetzen und können nicht zu eigenen Phrasen projizieren. Betrach-
tet man nun die Position und Verteilung der klitischen Subjektspronomen im Satz, erscheint dies nicht unwahr-
scheinlich. Man könnte postulieren, dass es sich dabei um eine X0 handelt, die an I0 (bzw. je nach theoretischem
28
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 29
Standpunkt an V/I) rechtskopfadjungiert bzw. in dieser Adjunktionsposition basisgeneriert wurde. Damit lässt
sich die enge Verbindung zwischen Verb und Subjektionspronomen ganz gut erklären:
Sollte sich diese Vermutung mit den theoretischen Postulaten in Einklang bringen, könnte man von der Kopf-
adjunktion an I0 ausgehend eine Fusion bzw. Grammatikalisierung postulieren. Dies würde bedeuten, dass die
Adjunktion verschwinden würde und wir nur noch einen Kopf I0 vorfinden würden.
Bei einer Durchsicht der einschlägigeren theoretischen Arbeiten zeigt sich, dass dies nicht so leicht ist. Zumin-
dest ist mir bisher kein Theorieansatz bekannt, der das zu untersuchende Phänomen adäquat abhandeln würde.
ABRAHAM & W IEGEL (1993, 24) gehen davon aus, dass Subjektspronomen nur an den Kopf COMP klitisiert
werden können, von Verdoppelungskonstruktionen ist bei ihnen gar keine Rede. Eine Klitisierung an COMP
kommt bei den Walserdialekten als Ausgangsphänomen wohl nicht in Frage (vgl. oben).
WEISSS(1998) behandelt zwar Verdoppelungskonstruktionen, allerdings sind Verdoppelungen des Subjekts
im Bairischen nur in bestimmten syntaktischen Umgebungen möglich, die nicht völlig mit den Südwalserdaten
übereinstimmen; WEISSS(1998, 123):31
(5) wenn’sd duaf Minga kimsd
(6) wenn’sdaf Minga kimsd
Wie man sehen kann, haben wir hier wirklich Klitikverdoppelung bzw. -verdreifachung (wenn man die Fle-
xionsendung des Verbs mitzählt). Problematisch an einer Übertragung seiner (und aller anderen) Analyse auf
unsere Phänomene ist die Obligatorizität des Klitikons an der Konjunktion. Diese ist für das Walserdeutsche
nicht gegeben. Man müsste sich für diese Analysen damit behelfen, dass das Klitik in CP basisgeneriert wird
und allenfalls an ein leeres COMP klitisiert bzw. kopfadjungiert wird und dann an I0 bewegt und adjungiert wird.
Solche Operationen mit leeren Kategorien sind zwar theoretisch durchaus möglich, aber empirisch nicht immer
ganz befriedigend.
In neueren theoretischen Arbeiten, die demMinimalitstic Programvon CHOMSKY folgen, scheint sich immer
mehr die Ansicht auszubreiten, dass Subjektspronomen (insbesondere auch klitische Formen) ausserhalb der
engeren Satzstruktur (VP) in funktionalen Projektionen erzeugt werden und von da aus an ihre Landepositionen
bewegt werden. Dies zeigt sich zum Beispiel sehr schön bei den Vorschlägen von WERNER (1999, 124). Aber
auch bei ihrem Vorschlag bleibt das Problem, dass sich die Subjektsklitika lediglich an Konjunktionen anlehnen
können.
Das Hauptproblem aller oben angesprochenen Arbeiten ist, dass diese Art der Konstruktion in den deutschen
Dialekten (und anderen germanischen Sprachen bspw. Westflämisch) zwar sehr wohl auftritt, allerdings auf den
Nebensatz beschränkt ist. Diese Beschränkung gilt in den Südwalserdialekten gerade nicht: Klitikaverdopplung
kann auch im Hauptsatz auftreten. Ausserdem hat der Nebensatz der Südwalserdialekte eine etwas andere Struk-
tur:
(7) COMP (TOP) SUBJEKT/pro VERBFINIT =KLIT PPRONNOM OBJEKT
Die Südwalserdialekte haben somit die italienische (S)VO-Stellung auch im Nebensatz übernommen. Wenn wir
31 Es ist zu beachten, dass-sd im Bairischen ein enklitisches Subjektspronomen der 2. Sg. darstellt und homonym ist mit dem Verbalsuffix
29
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 30
uns dann in Erinnerung rufen, welche Positionsbeschränkung in der Syntax Wackernagel bereits im 19. Jahrhun-
dert für das Auftreten der Klitika postuliert hatte, nämlich die zweite Position im Satz, ist klar, weshalb Klitika
in den übrigen deutschen Dialekten im Nebensatz immer direkt an der Konjunktion stehen. Es stellt sich nun
allerdings die Frage, warum das Klitikon im Nebensatz der Walserdialekte nicht eben auch in der Wackernagel-
Position steht. Wir müssen also davon ausgehen, dass die bisher gemachten Vorschläge wohl andere Dialekte sehr
gut beschreiben, uns aber nicht weiterhelfen. Die Pronominalsyntax der Südwalserdialekte folgt offensichtlich
einem anderen System.
4.3.3 Ein eigener Ansatz 32
Ausgehend von den oben angesprochenen Überlegungen und dem Datenmaterial gehe ich davon aus, dass in den
Südwalserdialekten Subjektsklitika in einer Adjunktsposition SKL0 zu I0 obligatorisch basisgeneriert werden.
Das heisst, wenn ein Satz generiert wird, wird diese Position in jedem Fall besetzt. Diese Annahme ist konsistent
mit dem Dialekt vor der Reanalyse. Die Besetzung dieser Stelle kann auch durch ein phonologisch leeres Element
erfolgen. Sie muss allerdings erfolgen, da zwischen SKL0 und I0 Kongruenz bezüglich Person und Numerus
herrschen soll. Im weiteren ist obligatorisch eine Position SpecI gefüllt. Dies ist die Position, in der pro, bzw.
volle Pronomen oder nominale Subjekte auftreten müssen. Elemente, die sich in SpecI befinden, müssen mit I0
in Person und Numerus, sowie mit SKL0 zusätzlich zu Person und Numerus im Genus kongruieren.
In diesem System wird SpecI nur in den Fällen lexikalisch (volle DP bzw. NP) gefüllt, in dem dies vom Sprach-
benutzer so vorgesehen ist, d. h. wenn das Subjektsklitikon nicht über genügend semantische oder syntaktische
Reichweite verfügt, z. B. bei einer Betonung des Subjekts oder der Neueinführung des Referenten. Tritt jedoch
nur pro auf, so hat der Sprecher keine volle DP/NP aus dem Lexikon selektiert und der Position SpecI wird
strukturell pro zugewiesen. Die strukturelle Zuweisung ist nötig, da SpecI gemäss Theorie nicht leer sein darf
(GALLMANN , 1990, 129, Verweis auf EPP (Extended Projection Principle von CHOMSKY).
Zu einem bereits früher angesprochenen Problem muss ich hier erneut Stellung nehmen: Es gibt keine Kliti-
kaverdoppelung in der 2. Sg. Dieses Problem ist sehr schwerwiegend, da in allen anderen Dialekten, sowohl den
oberdeutschen wie auch den norditalienischen, das Auftreten von Verdoppelungen in der 2. Sg. gerade typisch
ist, wie WERNER (1999, 59) betont, dazu auch ABRAHAM & W IEGEL (1993) und WEISSS(1998): Syntax und
für das Italienische RENZI & VANELLI (1983). Die klitische Form des Subjektspronomen der 2. Sg. müssted
oder verhärtett (siehe (siehe BOHNENBERGER, 1913, 215) heissen. Wenn wir nun die Flexionsform eines Verbs
betrachten, sehen wir, dass dieses folgendes Flexiv aufweist:-scht. Damit ist klar, dass wir eine klitische Form
der 2. Sg. an der Oberfläche aus rein phonotaktischen Gründen nicht sehen können. Trotz des Umstands, dass aus
dem genannten Grund eine positive Evidenz für das Vorhandenseins einer Verdoppelungskonstruktion in der 2.
Sg. nicht möglich ist, behaupte ich gestützt auf die Daten der umliegenden deutschen und italienischen Dialekte,
dass auch in der 2. Sg. diese Konstruktion vorhanden ist.
Für die weitere Entwicklung lässt sich nun vorhersagen, dass sich I0 und SKL0 verschmelzen werden, bzw. die
bisherigen Flexionsaffixe in I0 werden mit SKL0 fusioniert und es bilden sich in I0 neue Flexionsaffixe (Gram-
matikalisierung). Damit wird der Kopf SKL0 obsolet und verschwindet aus der Syntax. Ab diesem Zeitpunkt
32 Ich weise warnend darauf hin, dass es sich hierbei nur um eine Skizze handelt, die noch genauer geprüft und besser ausformuliert werdenmüsste.
30
Roman Sigg Erklärungsmodelle zur Verbalflexion 31
können wir nicht mehr von Subjektverdoppelungskonstruktionen sprechen, da die einstigen Subjektspronomen
grammatikalisiert und reanalysiert wurden und lediglich nochagreement-markerdarstellen.
31
5 Zusammenfassung und Ausblick
Es lässt sich festhalten, dass wir es hier offensichtlich mit einem syntaktischen System zu tun haben, das wohl
eindeutig auf Sprachkontakterscheinungen zurückzuführen ist. Daneben spielt die Grammatikalisierung und die
Entwicklung von syntaktischen Besonderheiten eine Rolle. Interessant ist der Umstand, dass es in allen umlie-
genden Dialekten ähnliche Subjektverdoppelungskonstruktionen auftreten, dass diese aber nicht völlig deckungs-
gleich sind. Mithin muss die Möglichkeit einer Entlehnung der Konstruktion abgelehnt werden. Es scheint so zu
sein, dass sich durch den Einfluss von Tendenzen im Walserdeutschen und dem Kontakt mit dem Italienischen,
bzw. dem piemontesischen Dialekt ein eigenes, neues System gebildet hat.
Ob es sich hierbei um Auflösungstendenzen der Sprache handelt, wie GIACALONE RAMAT (1989) gestützt auf
DORIAN (1973) glaubt, ist meiner Meinung nach nur von sekundärem Interesse. Intensiver Sprachkontakt kann
zu Sprachtod führen, muss aber nicht. Meines Erachtens lässt sich Sprachtod nicht anhand von syntaktischen
Konstruktionen definieren, sondern zeigt sich allein darin, wie sich die Sprecher zu ihrer Sprache stellen.
Eine weitere Analyse dieser Erscheinung, insbesondere im Dialektvergleich mit den umliegenden norditalie-
nischen Dialekten, aber auch im Vergleich mit den südbairischen Sprachinseln erachte ich als wünschenswert.
Dazu müssten aber erweiterte Befragungen vorgenommen werden. Diese sollten auch besser vorbereitet werden,
als die Kurzbefragungen, welche ich auf der Exkursion durchführte. Daneben müssten die bereits vorliegenden
Textsammlungen und Grammatiken zu den Dialekten noch einmal ausführlich geprüft werden.
Im weiteren wäre es interessant zu wissen, wie sich die aktuelle Grammatiktheorie zu diesen Ergebnissen
stellt. Dies würde ebenfalls weitere intensive Arbeit erfordern.
32
Literaturverzeichnis
ABRAHAM , Werner & Anko WIEGEL (1993): Reduktionsformen und Kasussynkretismus bei deutschen und
niederländischen Pronomina. In: Dialektsyntax. Hrsg. v. Werner ABRAHAM & Josef BAYER. Band 5.
Opladen: Westdeutscher Verlag, 12–49.
ABRAHAM , Werner (1996): Personalpronomina, Klitiktypologie und die Struktur des Mittelfeldes. In: Deutsch
- typologisch. Hrsg. v. Ewald LANG & Gisela ZIFONUN. Berlin, New York: Mouton de Gruyter
(= Jahrbuch des IDS 1995,), 428–472.
A ITCHISON, Jean (1995): Tadpoles, Cuckoos, and Multiple Births: Language Contact and Models of Change.
In: Linguistic Change under Contact Conditions. Hrsg. v. Jacek FISIAK . Berlin, New York: Mouton de
Gruyter (= Trends in Linguistics: Studies and Monographs, 81), 1–14.
ANDRÈ, Irene (1988): Greschóneytitsch: vocabolario italiano-titsch. Gressoney St. Jean: Centro Studi e Cultura
Walser, XXXI, 287.
AUER, Peter (1993): Zur Verbspitzenstellung im gesprochenen Deutsch. In: Deutsche Sprache: Zeitschrift für
Theorie, Praxis, Dokumentation, 21, 193–222.
BACHER, Josef (1976): Die deutsche Sprachinsel Lusern Mit einem Vorwort von Maria Hornung. Wien:
Verband d.Wiss.Ges.Österreichs (= Quellen u. Forschungen zur Geschichte, Litteratur u. Sprache
Österreichs u. seiner Kronländer, 10.).
BAUEN, Marco (1978): Sprachgemischter Mundartausdruck in Rimella (Valsesia, Piemont). Bern, Stuttgart:
Haupt (= Sprache und Dichtung, 28).
BERRUTO, Gaetano (1974): Piemonte e Valle d’Aosta. Pisa: Pacini Editore (= Profilo dei dialetti italiani, 1).
BOHNENBERGER, Karl (1913): Die Mundart der deutschen Walliser im Heimattal und in den Aussenorten.
Frauenfeld: Huber (= , Beiträge zur Schweizerdeutschen Grammatik).
BOSSONG, Georg (1998): Vers une typologie des indices actanciels: Les clitiques romans dans une perspective
comparative. In: Atti del XXX Congresso Internazionale della Società di Linguistica Italiana, Pavia,
26-28 settembre 1996. Hrsg. v. Paolo RAMAT & Elisa ROMA. Rom: Bulzoni (= Pubblicaziioni della
Società di Linguistica Italiana, 39), 9–43.
BRERO, Camillo (1987): Gramàtica piemontèisa: métrica e prosodìa dla poesìa piemontèisa. Turin: A
l’Ansëgna dij Brandé.
CAMPBELL , Lyle & Alice C. HARRIS (1995): Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. Cambridge:
Cambridge University Press (= Cambridge Studies in Linguistics, 74).
33
Roman Sigg Literaturverzeichnis 34
CAMPBELL , Lyle & Martha C. MUNTZEL (1987): The Structural Consequences of Language Death. In:
Investigating Obsolence: Studies in Language Contraction and Death. Cambridge: Cambridge University
Press (= Studies in the Social and Cultural Foundations of Language, 7).
CARDINALETTI , Anna & Michal STARKE (1995): The Typology of Structural Deficiency: On the three
Grammatical Classes. In: FAS Papers in Linguistics, 1, 1–55.
CARDINALETTI , Anna & Michal STARKE (1996): Deficient Pronouns: A View from Germanic: A Study in the
Unified Description of Germanic and Romance. In: Studies in Comparative Germanic Syntax. Hrsg. v.
Samuel David EPSTEIN, Steve PETER & Hoskuldur THRÁINSSON. Dordrecht: Kluwer, 21–65.
COMRIE, Bernard (1989): Language Universals and Linguistic Typology: Syntax and Morphology. Oxford:
Blackwell.
CONT, Peter (1987): Italienische Interferenzen im sogenannten Zimbrischen / Fersental in Oberitalien.
Dissertation, Universität Innsbruck, Innsbruck.
COOPER, Kathrin (1995): Null Subjects and Clitics in Zurich German. In: Topics in Swiss German Syntax.
Hrsg. v. Zvi PENNER. Bern etc.: Peter Lang, 59–72.
DAL NEGRO, Silvia (1996): Fenomeni di grammaticalizzazione e decadenza linguistica nel titsch di Formazza.
In: Linguistica e Filologia: Nuova Serie, 2, 123–134.
DAL NEGRO, Silvia (2000): Altertümlichkeit, Sprachwandel und Sprachtod: Das Gleichnis vom Verlorenen
Sohn in zwei piemontesischen Walserdialekten. In: Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 17,
28–52.
DAUSES, August (1990): Theorien des Sprachwandels: Eine kritische Übersicht. Stuttgart: Steiner.
DAUSES, August (1993): Prognosen sprachlichen Wandels: Möglichkeiten und Grenzen der erklärenden
Philologie. Stuttgart: Steiner.
DIETH, Eugen & Christian SCHMID-CADALBERT (1986): Schwyzertütschi Dialäktschrift: Dieth-Schreibung.
Aarau: Sauerländer (= Lebendige Mundart, 1).
DIETH, Eugen (1938): Schwyzertütschi Dialäktschrift: Leitfaden einer einheitlichen Schreibweise für alle
Dialekte nach den Beschlüssen der Schriftkommission der Neuen Helvetischen Gesellschaft Gruppe
Zürich. Zürich: Orell Füssli.
DORIAN, Nancy C. (1973): Grammatical Change in a Dying Dialect. In: Language, 49, 413–438.
EBERT, Robert Peter et al. (1993): Frühneuhochdeutsche Grammatik. Tübingen: Niemeyer (= Sammlung kurzer
Grammatiken germanischer Dialekte. A, Hauptreihe, 12).
FANSELOW, Gisbert & Sascha W. FELIX (1987): Sprachtheorie, Band 2: Die Rektions- und Bindungstheorie.
Tübingen: Francke (= UTB, 1442).
34
Roman Sigg Literaturverzeichnis 35
GALLMANN , Peter (1990): Kategoriell komplexe Wortformen: Das Zusammenwirken von Morphologie und
Syntax bei der Flexion von Nomen und Adjektiv. Tübingen: Niemeyer (= Reihe Germanistische
Linguistik, 108).
GIACALONE RAMAT , Anna (1989): Per una caratterizzazione linguistica e sociolinguistica dell’area Walser. In:
Lingua e Communicazione simbolica nella cultura Walser: Atti del VIo Convegno di Studi Walser,
Gressoney St.14.–15. ottobre 1988. Hrsg. v. Enrico RIZZI . Anzola d’Ossola: Fondazione Arch. Enrico
Monti, 37–66.
GIACALONE RAMAT , Anna (1992): The Pairing of Structure and Function in Syntactic Development. In:
Internal and External Factors in Syntactic Change. Hrsg. v. Marinel GERRITSEN& Dieter STEIN. Berlin,
New York: Mouton de Gruyter (= Trends in Linguistics: Studies and Monographs, 61), 317–339.
GYSLING, Fritz & Rudolf HOTZENKÖCHERLE(1952): Walser Dialekte in Oberitalien in Text und Ton:
Begleittexte zu den Sprechplatten des Phonogramm-Archivs der Universität Zürich. Frauenfeld: Huber.
HAEGEMAN, Liliane M. V. (1990): Subject Pronouns and Subject Clitics in West Flemish. In: The Linguistic
Review, 7, 333–363.
HAEGEMAN, Liliane M. V. (1995): Introduction to Government and Binding Theory. Oxford: Blackwell
(= Blackwell Textbooks in Linguistics, 1).
HOCK, Hans Henrich (1991): Principles of historical linguistics. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.
HOPPER, Paul John & Elizabeth Closs TRAUGOTT (1993): Grammaticalization. Cambridge [etc.]: Cambridge
University Press (= Cambridge Textbooks in Linguistics,), XXI, 256.
HOTZENKÖCHERLE, Rudolf (1971): Die südwalserisch-ennetbirgischen Mundarten im Spiegel ihrer
Verbalformen. In: Festschrift fur Paul Zinsli. Hrsg. v. Maria BINDSCHEDLER, Rudolf
HOTZENKÖCHERLE& Werner KOHLSCHMIDT. Bern: Peter Haupt, 79–98.
KELLER, Rudolf E. (1995): Die deutsche Sprache und ihre historische Entwicklung. Hamburg: Buske.
LEISS, Elisabeth (2004): Ansätze zu einer Theorie des Sprachwandels auf morphologischer und syntaktischer
Ebene. In: Sprachgeschichte. Band 2.4. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 850–860.
LEXER, Matthias von (1992): Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart: Hirzel.
L INTY, Alberto (1988): D’Eischemtoitschu: vocabolario italiano-töitschu. Gressoney St. Jean: Centro Studi e
Cultura Walser.
LOPORCARO, Michele (1996): Italienische Dialektologie und allgemeine Sprachwissenschaft. In: Vox
Romanica, 55, 16–32.
MAYERTHALER, Willi (1980): Aspekte der Analogietheorie. In: Kommunikationstheoretische Grundlagen des
Sprachwandels. Hrsg. v. Helmut LÜDTKE. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 80–130.
35
Roman Sigg Literaturverzeichnis 36
MAYERTHALER, Willi (1999): Syntaktische Aspekte des Sprachkontakts. In: Sprachkontakte im Alpenraum:
Minderheiten und Lokalsprachen: Tagungsberichte des Symposiums Kodifizierung und Ausarbeitung
einer Grammatik des Zimbrischen und Fersentalerischen, Trento 7. Mai 1999. Hrsg. v. Hans TYROLLER.
Trento: Autonome Region Trentino-Südtirol, 15–21.
MERKLE, Ludwig (1975): Bairische Grammatik. München: Heimeran.
MORANI, Moreno (1998): Le Pomatter Tietsch et la linguistique historique. In: Mehrsprachigkeit im
Alpenraum. Hrsg. v. Iwar WERLEN. Aarau, Frankfurt a. M. Salzburg: Sauerländer (= Reihe
Sprachlandschaften, 22), 113–119.
NÜBLING , Damaris (1992): Klitika im Deutschen: Schriftsprache, Umgangssprache, alemannische Dialekte.
Tübingen: Narr (= Script Oralia, 42).
NÜBLING , Damaris (1995): Kurzverben in germanischen Sprachen: Unterschiedliche Wege – gleiche Ziele. In:
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, 62, 127–154.
NÜBLING , Damaris (2000): Prinzipien der Irregularisierung: Eine kontrastive Analyse von zehn Verben in zehn
germanischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer (= Linguistische Arbeiten, 415).
ÖNNERFORS, Olaf (1997): Verb-erst-Deklarativsätze: Grammatik und Pragmatik. Stockholm: Almqvist
Wiksell International (= Lunder germanistische Forschungen, 60), 269.
PATOCKA , Franz (1997): Satzgliedstellung in den bairischen Dialekten Österreichs. Bern, Frakfurt a. M.: Lang
(= Schriften zur Deutschen Sprache in Österreich, 20).
PAUL , Hermann (1920): Prinzipien der Sprachgeschichte. Halle a. Saale: M. Niemeyer.
RENZI, Lorenzo & Laura VANELLI (1983): I pronomi soggetto in alcune varietà romanze. In: Scritti linguistici
in onore Giovan Battista Pellegrini. Pisa: Pacini Editore, 121–145.
ROWLEY, Anthony R. (1986): Fersental (Val Fèrsina bei Trient/Oberitalien). Tubingen: Niemeyer (= Phonai,
Monographien, 18 = 31 [d. Gesamtw.).
ROWLEY, Anthony R. (1994): Die Mundarten des Fersentals. In: Studien zur Dialektologie III: Die deutschen
Sprachinseln in den Südalpen. Mundarten und Volkstum. Hrsg. v. Maria HORNUNG. Hildesheim: Olms
(= Germanistische Linguistik, 124/125), 145–160.
ROWLEY, Anthony R. (1996): Die Sprachinseln der Fersentaler und Zimbern. In: Handbuch der
mitteleuropäischen Sprachminderheiten. Hrsg. v. Ludwig M. EICHINGER & Robert HINDERLING.
Tübingen: Narr, 263–285.
SCHMIDT, Karl Heinz (1980): Typologie und Sprachwandel. In: Kommunikationstheoretische Grundlagen des
Sprachwandels. Hrsg. v. Helmut LÜDTKE. Berlin, New York: Mouton de Gruyter, 20–36.
36
Roman Sigg Literaturverzeichnis 37
SCHWEIZER, Bruno (1939): Zimbrische Sprachreste: Texte aus Giazza (Dreizehn Gemeinden ob Verona). Halle
a. Saale: M. Niemeyer (= Deutsches Ahnenerbe, Reihe B: Fachwissenschaftliche Untersuchungen.
Arbeiten zur Germanenkunde, 5).
SIMON , Hans Joachim (1967): Beobachtungen an den Mundarten Piemonts. Heidelberg: Winter.
SIMON , Horst J. (1998): KinnanS Eahna fei heid gfrein.Über einen Typ von Verb-Erst-Aussagesätzen im
Bairischen. In: Deutsche Grammatik - Thema in Variationen: Festschrift Hans Werner Eroms. Hrsg. v.
Karin DONHAUSER& Ludwig M. E ICHINGER. Heidelberg: Winter (= , 1), 137–154.
SPENCER, Andrew (1991): Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammar.
London: Blackwell.
STARKE, Michal (1996): Germanische und romanische Pronomina: stark – schwach – klitisch. In: Deutsch –
typologisch. Hrsg. v. Ewald LANG & Gisela ZIFONUN. Berlin, New York: Mouton de Gruyter (= IDS
Jahrbuch 1996,), 405–427.
SUÑER, Margarita (1992): Subject Clitics in the Northern Italian Vernaculars and the Matching Hypothesis. In:
Natural Language and Linguistic Theory, 10, 641–672.
THOMASON, Sarah Grey & Terrence KAUFMAN (1991): Language Contact, Creolization, and Genetic
Linguistics. Berkeley: University of California Press.
TYROLLER, Hans (1994): Die Sprachinselmundart von Lusern. In: Studien zur Dialektologie III: Die deutschen
Sprachinseln in den Südalpen. Mundarten und Volkstum. Hrsg. v. Maria HORNUNG. Hildesheim: Olms
(= Germanistische Linguistik, 124/125).
WAIBEL , Max (1985): Die volkstümliche Ueberlieferung in der Walserkolonie Macugnaga (Provinz Novara.
Basel: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde (= Schriften der Schweizerischen Gesellschaft für
Volkskunde, 70), XIV, 264.
WEISSS, Helmut (1998): Syntax des Bairischen:Studien zur Grammatik einer natürlichen Sprache. Tubingen:
Niemeyer (= Linguistische Arbeiten, 391), VII, 291.
WERLEN, Iwar (1990): Kasus und Wortstellung in alemannsichen Dialekten. In: Alemannische Dialektologie
im Computer-Zeitalter. Hrsg. v. Marthe PHILIPP. Göppingen: Kümmerle (= Göppinger Arbeiten zur
Germanistik, 535), 165–190.
WERNER, Ingegerd (1999): Die Personalpronomen im Zürichdeutschen. Stockholm: Almqvist Wiksell
International (= Lunder germanistische Forschungen, 63).
WHEELER, Max W. (1993): On the Hierarchy of Naturalness Principles in Inflectional Morphology. In: Journal
of Linguistics, 29, 95–111.
WIESINGER, Peter (1989): Die Flexionsmorphologie des Verbums im Bairischen. Wien: Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften (= Österreichische Akademie der Wissenschaften:
Philosophisch-historische Klasse: Sitzungsberichte, 523).
37
Roman Sigg Literaturverzeichnis 38
WURZEL, Wolfgang Ullrich (1984): Flexionsmorphologie und Natürlichkeit: Ein Beitrag zur morphologischen
Theoriebildung. Berlin Ost: Akademie-Verlag (= Studia Grammatica, 21).
WURZEL, Wolfgang Ullrich (1987): Naturalness in Inflection: System-Dependent Morphological Naturalness
in Inflection. In: Leitmotifs in Natural Morphology. Hrsg. v. Wolfgang Ulrich DRESSLER. Amsterdam,
Philadelphia: John Benjamins (= Studies in Language Companion Series, 10), 59–98.
ZEHETNER, Ludwig (1985): Das bairische Dialektbuch. München: Beck, 301.
ZINSLI , Paul (1970): Walser Volkstum in der Schweiz, in Vorarlberg, Liechtenstein und Piemont: Erbe, Dasein,
Wesen. Frauenfeld, Stuttgart: Huber, 549.
ZIRMUNSKIJ, Viktor M. (1962): Deutsche Mundartkunde: Vergleichende Laut- und Formenlehre der deutschen
Mundarten. Band 25, Akademie der Wissenschaften: Veröffentlichungen des Instituts für deutsche
Sprache und Literatur. Berlin Ost: Akademie-Verlag, XV, 662.
ZÜRRER, Peter (1982): Wörterbuch der Mundart von Gressoney: mit einer Einführung in die Sprachsituation
und einem grammatischen Abriss. Frauenfeld: Huber (= Beiträge zur schweizerdeutschen
Mundartforschung, 24).
ZÜRRER, Peter (1986): Deutscher Dialekt in mehrsprachiger Gemeinschaft: d. Sprachinselsituation von
Gressoney (Valle d’Aosta, Italien). Stuttgart: Steiner (= Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik.
Beihefte, 53).
ZÜRRER, Peter (1993): Sprachwandelphänomene in Sprachinseln. In: Alemannisch in der Regio: Beiträge zur
10. Arbeitstagung alemannischer Dialektologen in Freiburg i. Brsg. Hrsg. v. Volker SCHUPP. Goppingen:
Kümmerle (= Göppinger Arbeiten zur Germanistik, 593), 25–40.
ZÜRRER, Peter (1995): Der Verlorene Sohn bei Walsern und Zimbern: Zur Syntax früher Mundarttexte. In:
Scritti di Linguistica e Dialettologia in onore di Giuseppe Francescato. Triest: Edizione Ricerche,
345–359.
ZÜRRER, Peter (1996): Deutsche Sprachinseln im Aostatal. In: Handbuch der mitteleuropäischen
Sprachminderheiten. Hrsg. v. Ludwig M. EICHINGER & Robert HINDERLING. Tübingen: Niemeyer,
287–310.
ZÜRRER, Peter (1997): Systemveränderung in Südwalser Sprachinseldialekten. In: Syntax und Stilistik der
Alltagssprache: Beitrage der 12. Arbeitstagung zur Alemannischen Dialektologie, 25. bis 29. September,
Ellwangen/Jagst. Hrsg. v. Peter LÖFFELAD & Arno RUOFF. Tübingen: Niemeyer (= Idiomatica, 18),
155–169.
ZÜRRER, Peter (1998): Sprachkontakt in Sprachinseln. In: Mehrsprachigkeit im Alpenraum. Hrsg. v. Iwar
WERLEN. Aarau, Frankfurt a. M., Salzburg: Sauerländer (= Reihe Sprachlandschaft, 22), 97–113.
ZÜRRER, Peter (1999): Sprachinseldialekte: Walserdeutsch im Aostatal (Italien). Aarau, Frankfurt a. M.,
Salzburg: Sauerländer (= Reihe Sprachlandschaft, 23).
38
Tabellenverzeichnis
1 Verbalflexion Gressoney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 Verbalflexion Issime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3 Verbalflexion im piemontesischen Dialekt und im Standarditalienischen im Vergleich . . . . . . 16
4 Verbale Kontruktionsmöglichkeiten des Verbestun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5 Prinzipien der Natürlichkeitsmorphologie auf die Südwalser Verbalflexion angewendet . . . . . 26
39