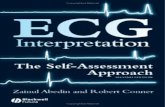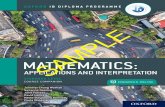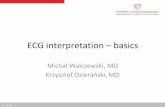Regel und Regelanwendung. Wissenstransfer in Lehrwerken und das Problem der Interpretation
Transcript of Regel und Regelanwendung. Wissenstransfer in Lehrwerken und das Problem der Interpretation
RALF KLAUSNITZER Regel und Regelanwendung. Wissenstransfer in Lehrwerken und das Problem der Interpretation Ich sagte von der Anwendung eines Wortes: Sie sei nicht überall von Regeln begrenzt. Aber wie schaut denn ein Spiel aus, das überall von Regeln begrenzt ist? dessen Regeln keine Zweifel eindringen lassen; ihm alle Löcher verstopfen. – Können wir uns nicht eine Regel denken, die die Anwendung der Regel regelt? Und einen Zweifel, den jene Regel behebt – und so fort?
Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, § 84 Was haben die um 335 v. Chr. als Vorlesungsskript fixierte Poetik des Aristoteles mit ihrem Programm, „der Sache gemäß“ zuerst das zu untersuchen, „was das erste ist“,1 und die vermutlich um 325 v. Chr. entstandenen Elemente (Στοιχεῖα; Stoicheia) des Euklid mit ihrer Darstellung des mathematischen Wissens auf der Basis von Axiomen, Definitionen und Postulaten gemeinsam? Was verbindet die Differenzierung von historischen Artefakten in „Traditions-“ und „Überrest-quellen“ in Johann Gustav Droysens Vorlesungen über Enzyklopädie und Metho-dologie der Geschichte, deren „Grundriß“ 1867 erschien,2 mit den Verfahren der grammatischen und historischen Interpretation in der Encyklopädie und Metho-dologie der philologischen Wissenschaften von August Boeckh, die in wirkungs-mächtigen Vorlesungen zwischen 1809 und 1865 in Heidelberg und Berlin vorgetragen wurde? Und welche Gemeinsamkeit bestehen zwischen Karl Lothar Wolfs Lehrbuch Theoretische Chemie, das mit dem Nebentitel Eine Einführung vom Standpunkt einer gestalthaften Atomlehre erstmals 1941 erschien, und Wolf-gang Kaysers „Einführung in die Literaturwissenschaft“ Das sprachliche Kunst-werk, die erstmals 1948 und (wie Wolfs Lehrwerk) mehrfach wieder aufgelegt wurde?
1 Aristoteles: Poetik 1447a8; hier zitiert nach der Übersetzung von Manfred Fuhrmann,
Stuttgart 1982, S. 5. Vgl. aber die Übertragung von Arbogast Schmidt in Aristoteles: Werke in deutscher Übersetzung. Begründet von Ernst Grumach, hg. von Hellmut Flashar. Bd. 5: Poetik, Berlin 2008, S. 3: „Was Dichtung als Kunst ist und was ihre Arten sind, welche be-stimmte Potenz eine jede hat und wie man einheitliche Handlungen [Mythen] komponie-ren muss, wenn eine Dichtung kunstgemäß verfasst sein soll, außerdem wie viele und welche Elemente etwas zu Dichtung machen – darüber wollen wir sprechen und ebenso auch über die anderen Gesichtspunkte, die bei einer methodischen Untersuchung von Dichtung beachtet werden müssen. Wir beginnen, dem natürlichen Gang der Methode fol-gend, zuerst mit den ersten ,allgemeinsten‘ Bestimmungen.“
2 Die als Historik bekannt gewordenen Vorlesungen wurden 1937 erstmals vollständig veröf-fentlicht; sie gelten als „der erste umfassende methodische Kanon der modernen Ge-schichtswissenschaft, der vor allem auf dem Wege der internen Lehrtradition der Historiker traditionsbildend wurde“, so Herbert Schnädelbach: Geschichtsphilosophie nach Hegel. Die Probleme des Historismus, München 1974, S. 91f.
2
Auch wenn die hier aufgeführten Texte verschiedene Entstehungsgeschichten und je eigene Gegenstände und Verfahren aufweisen, lassen sich doch übergrei-fende Eigenschaften feststellen. Zum einen hinsichtlich ihres Inhalts: Sie enthal-ten ein zu ihrer Entstehungszeit gültiges und gleichsam ‚stabiles‘ Wissen, das grundlegende Begriffe und Verfahrensweisen einer Wissenschaftsdisziplin bzw. eines Fachgebiets ebenso umfasst wie exemplarische Erläuterungen und präg-nante Beispiele. Zum anderen hinsichtlich ihrer Form: Weitgehend entproblema-tisierte Kenntnisse und Methoden sind so fixiert und gestaltet, dass sie von nachrückenden Generationen aufgenommen und nachvollzogen, in veränderten Situationen aktualisiert und also modifiziert angewendet werden können. In die-ser Einheit von Inhalt und Form traten bzw. treten die genannten Texte als Lehrwerke in Erscheinung; sie funktionierten (und funktionieren) in institutio-nellen Rahmen als Formate für die Vermittlung und instruierte Anwendung re-gelgeleiteter Umgangsformen mit epistemischen Dingen. So bilden sie eine zentrale, wenngleich nicht die einzige Institution der für Wissenschaft und Kul-tur fundamentalen Prozesse, mit denen Wissensbestände fixiert und von einer Generation an die nächste weitergegeben werden, um die mit besonderen (wis-senschaftlichen) Geltungsansprüchen verbundenen Thematisierungsweisen von Welt auf Dauer zu stellen.
Dieser generationenübergreifende Wissenstransfer umfasst komplexe Vor-gänge des Lehrens und Lernens, die keineswegs als eindimensionale Transport-bewegungen eines bereitstehenden Wissens aus einem Herkunftsbereich (etwa dem druckschriftlich fixierten Lehrbuchtext bzw. dem Kopf eines als Lehrer auf-tretenden Wissensträgers) in einen Zielbereich (den Schädel eines Schülers bzw. Studenten) zu verstehen sind. Im Gegenteil: Lehrwerke und die durch sie initi-ierten, angeleiteten oder unterstützten Prozesse von Wissenstransfer funktionie-ren als aktive Konstruktionsleistungen symbolischer Ordnungen und regelge-leiteter Prozeduren, die eine mehrgliedrige Relation aufweisen. Sie führen (auf noch näher zu bezeichnende Weise) Begriffe ein, mit denen Beobachtungen an individuellen Entitäten wie z.B. Texteigenschaften oder historischen Konstella-tionen benannt, verallgemeinert und intersubjektiv mitteilbar gemacht werden können. Lehrwerke und der von ihnen dirigierte Wissenstransfer basieren auf kategorialen Ordnungen zur Reduzierung von Komplexität; sie tragen durch die Bereitstellung und Einübung von Konzepten dazu bei, invariante Eigenschaften in divergierenden Aspekten und disparaten Erscheinungen auffinden und be-nennen zu können. Doch übernehmen die von Lehrwerken vermittelten Begriffe nicht nur die Funktion, Ungleiches vergleichbar zu machen und damit notwen-dige Komplexitätsreduktionen zu instruieren. Sie stellen zugleich ein System für die regelhafte Verständigung über Phänomene bereit, die nach den Vorgaben ka-tegorialer Ordnungen beobachtet und benannt werden konnten; sie sichern also wechselseitige Bezugnahmen auf die gemachten Wahrnehmungen und damit die interindividuelle Verständigung innerhalb eines durch kategoriale Ordnungen und spezifischen „Denkstil“ geprägten „Denkkollektivs“.
3
Die Kategorisierungsleistungen von Lehrwerken stehen in einer unmittelbaren und eigentlich nur heuristisch zu separierenden Verbindung mit der Vermittlung von Prozeduren und Verfahren. Diese gleichfalls an bestimmte Regeln gebunde-nen Verfahren umfassen unterschiedliche Praktiken einer Wissenschaft: Sie rei-chen von der nur scheinbar einfachen, tatsächlich aber immens voraussetzungsreichen Beobachtung (etwa an Texten, Kontexten und Text-Kontext-Konstellationen) über deren Beschreibung und Deutung bis zur Zitier-weise, die ihrerseits mehrfach dimensionierte Funktionen der Beglaubigung übernimmt und zugleich Lizenzen zur Positionierung innerhalb eines fraktio-nierten Wissenschaftssystems bereitstellt. Vermittelt werden regelgeleitete Ver-fahren explizit und implizit, so etwa durch Erklärung und exemplarische Demonstration, Imitation und (fehlerhaftes) Üben anhand von Beispiel.3 Die Verfahrenskomponente von Lehrwerken ist untrennbar verbunden mit einem kaum zu überschätzenden, durch Lehrbücher und Einführungen ebenfalls zu transferierenden Wissen bzw. Können: mit den hochgradig komplexen Vermö-gen der Übertragung und Anwendung, die eine Aktualisierung von Konzepten und Verfahren in veränderten Situationen gewährleisten sollen. Diese im Fol-genden als Applikationskomponente bezeichnete Eigenschaft von Lehrwerken bildet eine zentrale, unter Umständen nur schwer greifbare Leistung didakti-scher Instruktionen; umfasst sie doch die Vermittlung jener Einheit von Regel und Regelanwendung im Umgang mit (neuen) Gegenständen bzw. Konstellati-onen, die schon in den philosophischen Überlegungen zur Modernisierung der preußischen Universitäten um 1810 und in philologischen Lehrwerken des 19. Jahrhunderts mit Begriffen wie „Takt“ und „Methode“ zur „Beurtheilungsfähig-keit der Fälle der Anwendung“ konzeptualisiert wird.4
Diese Komponenten bewirken im Verbund mit anderen, hier nicht weiter zu thematisierenden Faktoren den Gewinn distanzierter Beobachterpositionen, die rekursive Observationen spezifisch zugeschnittener Gegenstandsbereiche er-lauben und als Kennzeichen einer wissenschaftlich professionalisierten Praxis
3 Vor allem die Bestände eines sog. impliziten Wissens und Könnens entwickeln sich lang-
sam und stetig sowie zumeist ohne explizite Formulierung von Regeln, und zwar primär durch Verfahren des gewöhnlich fehlerhaften Übens anhand von Beispielen, vgl. Manfred Spitzer: Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens, Heidelberg 2007, S. 59, 65, 71, 73.
4 Eine frühe Formulierung findet sich bei Johann Gottlieb Fichte: Deducirter Plan einer zu Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt, die in gehöriger Verbindung mit einer Akade-mie der Wissenschaften stehe [1807], in: Johann Gottlieb Fichte’s sämmtliche Werke, hg. v. J. H. Fichte, Bd. 8, Berlin 1846, § 5, S. 100 f.: „Man studiert ja nicht, um lebenslänglich und stets dem Examen bereit das Erlernte in Worten wieder von sich zu geben, sondern um dasselbe auf die vorkommenden Fälle des Lebens anzuwenden, und so es in Werke zu ver-wandeln; es nicht bloss zu wiederholen, sondern etwas Anderes daraus und damit zu ma-chen: es ist demnach auch hier letzter Zweck keineswegs das Wissen, sondern vielmehr die Kunst, das Wissen zu gebrauchen. Nun setzt diese Kunst der Anwendung der Wissen-schaft im Leben noch andere der Akademie fremde Bestandteile voraus, Kenntnis des Le-bens nemlich und Uebung der Beurtheilungsfähigkeit der Fälle der Anwendung […]“.
4
gelten können. Lehrwerke leisten diese Darstellung und Übung distanzierter und distanzierender Verfahren, indem sie die Trias von Kategorisierung, Verfah-ren, Applikation einführen und vorführen – durch Definitionen und wiederholte Erläuterungen ebenso wie durch Demonstrationen und Beispiele. Explikation und Exemplifikation, Entfaltungen des Begriffs und Erläuterungen an Mustern bilden die bereits durch Aristoteles genutzten und bis in die Gegenwart verwen-deten Vermittlungsformen von (wissenschaftlichem) Wissen.
Auf die spezifisch entproblematisierenden Leistungen eines ‚Lehrwissens‘, das ein problemorientiertes und problemgenerierendes ‚Forschungswissen‘ in jenen ‚Aggregatzustand‘ transformiert, der eine gelingende Vermittlung an Stu-dierende erlaubt und den Vorgang des Lernens als ‚Verlernen‘ und ‚Umlernen‘ programmiert, soll an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden.5 Im Mittel-punkt der nachfolgenden Überlegungen stehen vielmehr die Spannungsverhält-nisse von Regelwissen und Regelanwendung, von denen Lehrwerke und die durch sie initiierten Umgangsweisen mit epistemischen Dingen in besonderer Weise geprägt sind. Ohne die weitreichenden Dimensionen des Regel-Begriffs umfassend darzustellen zu können, soll danach gefragt werden, wie philologi-sche bzw. literaturwissenschaftliche Lehrwerke konstitutive und regulative Re-geln formulieren und anwendungsfähig vermitteln. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die in Lehrwerken vermittelten Begrifflichkeiten und Ver-fahren für die Interpretation von Texten – gehören die Praktiken der Bedeu-tungszuweisung doch zu den zentralen Gegenständen professionalisierter Textumgangsformen.
Vorgegangen wird in einer Schrittfolge, die systematische Erörterungen und historische Beispiele verbindet. In einem ersten Abschnitt werden wesentliche Elemente des zu Grunde gelegten Regelbegriffs vorgestellt, um in einem zweiten Abschnitt knappe Hinweise auf die Aristotelische Poetik zu geben, mit der be-reits frühzeitig kategoriale Ordnungen für distanzierte Textumgangsformen und Schrittfolgen für die Behandlung von Verständnisproblemen entstanden. Ein dritter Abschnitt widmet sich der Encyklopädie und Methodologie der philologi-schen Wissenschaften von August Boeckh, die der Schüler von Friedrich August Wolf zwischen 1809 und 1865 in wirkungsmächtigen Vorlesungen in Berlin vor-trug. Hier ist an ausgewählten Beispielen zu zeigen, welche spezifischen Initiali-sierungs- und Stopp-Regeln der Interpretation diese Variante einer kulturwissenschaftlich erweiterten Philologie entwickelte.
5 Vgl. dazu Michael Kämper-van den Boogaart, Steffen Martus, Carlos Spoerhase: Entprob-
lematisieren: Überlegungen zur Vermittelbarkeit von Forschungswissen, zur Vermittlung von „falschem“ Wissen und zur Funktion literaturwissenschaftlicher Terminologie, in: Zeitschrift für Germanistik N.F. 20 (2011), S. 8-24.
5
1. Konstitutive und regulative Regeln
Wenn wir von Regeln sprechen, können wir uns auf verschiedene Dinge bezie-hen: Auf bestimmte Regelmäßigkeitsannahmen über Naturerscheinungen oder auf Regularien in sozialen Zusammenhängen. In diesem letztgenannten Sinn las-sen sich Regeln als reflektierte bzw. prinzipiell reflektierbare Handlungsschema-ta begreifen. Ihre besondere Qualität – und damit auch ihr Unterschied zu regelhaften Abläufen in natürlichen Zusammenhängen, die in der Form von ‚Bauernregeln‘ ebenso formuliert werden wie in der Form von Gesetzen – er-gibt sich aus dem Umstand, dass sie an Praktiken der Interaktion zwischen menschlichen Individuen, Kollektiven und Institutionen gebunden sind und mehr umfassen als nur schlichte Handlungskompetenz. Regeln sind formulierte bzw. formulierbare Handlungskonditionen: Sie treten auf, wenn Bedingungen für die Ausübung von Handlungen festgestellt werden.
Grundsätzlich lassen sich zwei Arten einer solchen Konditionierung von Handlungen unterscheiden. Regulative Regeln funktionieren als einschränkende Bestimmung zulässiger Ausübungen und setzen bestimmte Kompetenzen vo-raus.6 Konstitutive Regeln schaffen diese Bereiche zulässiger Ausübungen und machen kompetente Handlungsvollzüge in ihnen überhaupt erst möglich. Um diese Bestimmungen an einem (immer wieder herangezogenen) Beispiel zu il-lustrieren: Während die Regeln des Straßenverkehrs eine Tätigkeit – die Bewe-gung von Subjekten im öffentlichen Raum – ordnen und damit einen Bereich regulieren, dessen Denkbarkeit, Möglichkeit und Wahrnehmbarkeit unabhängig von diesen Regeln ist, entsteht die Praxis des Schachspiels allein durch gewisse Spielregeln. Mit anderen Worten: Wenn ein Bereich erst und nur durch seine Regeln entsteht, liegen konstitutive Regeln vor.7
6 Vgl. John Rawls: Two concepts of rules, in: Philosophical Review 64 (1955), S. 3–32. Nicht
näher zu diskutieren ist hier die Frage, ob schon eine Handlungskompetenz, also das Ver-fügen über ein Handlungsschema, als Fähigkeit verstanden werden kann, Handlungsvoll-züge im Sinne von Aktualisierungen des Schemas regelgeleitet hervorzubringen. Hier muss der Hinweis genügen, dass sich auf der Ebene von Handlungskompetenzen noch keine Be-dingungen an ihre Ausübung (und damit regulative Regeln zur einschränkenden Bestim-mung zulässiger Ausübungen) artikulieren lassen. Dazu bedarf es weiterer Kompetenzen und vor allem des Verfügen über schematische Zusammenhänge zwischen Handlungs-schemata. Auf dieser Stufe entsteht die Alternative zwischen den ontischen Modalitäten „Können“ (eine Aktualisierung selbst wählen) und „Müssen“ (zu einer Aktualisierung ge-zwungen werden) bzw. den deontischen Modalitäten „Dürfen“ (eine Aktualisierung wird freigegeben) und „Sollen“ (zu einer Aktualisierung verpflichtet sein).
7 Konstitutive Regeln wurden unter dem Namen ‚constitutive rules‘ von Searle untersucht und in ihrer Opposition zu den ‚regulative rules‘ erörtert, vgl. John R. Searle: How to deri-ve ‚Ought‘ from ‚Is‘, in: Philosophical Review 71 (1964), S. 43-58; ders.: What is a speech act?, in: Max Black (Hg.): Philosophy in America, London 1964, S. 121–139. Die Termino-logie wurde allerdings nicht von ihm eingeführt; und auch der konzepthistorische Hinter-grund ist weiterreichend. Die Regelbezogenheit von Schachfiguren wurde wohl erstmals von dem Mathematiker J. Thomae thematisiert; nach ihm ist eine Schachfigur „durch ihr Verhalten gegen die Spielregeln bestimmt“; J. Thomae: Gedankenlose Denker, in: Jahresbe-
6
Der konstitutive Charakter von Regeln hat verschiedene Aspekte. Hinsichtlich ihrer Seinsweise sind konstitutive Regeln ‚gegenstandsbestimmend‘; sie begrün-den eine bestimmte Praxis, die aus aus distinkten und miteinander verbundenen Einheiten („Praxemen“) besteht. Das Schachspiel hat etwa die Einheiten Läufer, Rochade, Schachmatt; das Sprachspiel Literaturwissenschaft kennt Einheiten wie Text und Zeichen, Funktion und Bedeutung, Interpretation und Dekonstrukti-on. In semantischer Hinsicht sind konstitutive Regeln ‚sinnbestimmend‘, d.h. sie legen den Sinn bzw. die Intension der Praxembezeichnungen fest, indem sie Termini fixieren, die jeweilige Praxeme bezeichnen. Praxembezeichnungen des Schachspiels sind u.a. ‚Läufer‘, ‚Rochade‘, ‚Schachmatt‘; Praxembezeichnungen der Literaturwissenschaft sind u.a. ‚Text‘ und ‚Zeichen‘, ‚Bedeutung‘, ‚Interpre-tation‘.
Konstitutive Regeln lassen sich weitergehend unterscheiden: Es gibt norma-tive bzw. deontische Regeln (z. B. „Der König soll dem Schach entzogen wer-den“; „Wissenschaftliche Behauptungen mit dem Anspruch auf intersubjektive Geltung sollen begründet werden“) und deskriptive bzw. adeontische Regeln (z. B. „Schachmatt liegt vor, wenn der König unter Schach ist und sich durch keinen Zug dem Schach entziehen kann“; „Die Einlösung von Geltungsansprüchen wis-senschaftlicher Aussagen erfolgt durch Argumente oder durch deiktische Zeige-handlungen.“)
Die gleichsam fundamentierende Funktion konstitutiver Regeln wird klarer, wenn man die Legitimität von Regelverletzungen thematisiert. Eine Frage wie „Kann man die Regel, die das Schachmatt festlegt, verletzen?“ ist bei Interesse an der Selbsterhaltung des so konstituierten Spiels ebenso unangebracht wie die Frage nach der Zulässigkeit von Plagiaten bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Wer den König trotz Schachmatt-Position weiter bewegt, spielt vielleicht weiter – doch kein Schach mehr. Und wer Inhalte und Formulierungen aus fremden Arbeiten ohne Nachweis in die eigene Dissertation übernimmt, bewegt sich au-ßerhalb des auf dokumentierte Eigenleistungen programmierten Systems Wis-senschaft und muss mit dem Ausschluss aus einer auch durch symbolische Gratifikationen zusammengehaltenen Gemeinschaft rechnen (selbst wenn die Doktorwürde nicht unbedingt als Eintrittskarte für eine wissenschaftliche Karri-ere erworben wurde). Mit anderen Worten: Konstitutive Regeln können nicht
richte der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 15 (1906), S. 435. Auch nach Edmund Husserl werden Schachfiguren konstituiert durch „die Spielregeln, welche ihnen ihre feste Spielbedeutung geben“, E. Husserl: Logische Untersuchungen II/1, I, § 20 (1901, 21913, S. 69). Die an Regeln gebundene Bedeutung von Schachfiguren betont Ludwig Wittgenstein: Philosophische Bemerkungen. Zweiter Anhang, Oxford 1964, S. 327f.: „Ich kann nicht sa-gen: das ist ein Bauer und für diese Figur gelten die und die Spielregeln. Sondern die Spiel-regeln bestimmen erst diese Figur: der Bauer ist die Summe der Regeln, nach welchen er bewegt wird“ (Hervorhebungen im Original). Prägnant auch ders.: Philosophische Untersu-chungen I, § 31: „Wenn man jemandem die Königsfigur im Schachspiel zeigt und sagt ‚Das ist der Schachkönig’, so erklärt man ihm dadurch nicht den Gebrauch dieser Figur, – es sei denn, daß er die Regeln des Spiels schon kennt.“
7
verletzt werden, ohne dass sich das Spiel im Ganzen ändert bzw. endet – was gravierende und an dieser Stelle noch nicht zu thematisierende Folgen haben kann. Weil die Einhaltung von Regelverletzungen im Wissenschaftssystem mit-unter schwierig ist – denn Kontrollen können überaus aufwändig ausfallen und immer nur stichprobenartig sein – müssen gerade die konstitutiven Regeln tief in das Selbstverständnis der hier handelnden Akteure eingelassen werden: Eben da-rum sind Sanktionen so hart und bereits ab dem ersten Semester durchzusetzen. Wichtig für die Ausgestaltung eines durch konstitutive Regeln ermöglichten Handlungszusammenhangs sind schließlich Regeln, die als einschränkende Be-stimmung zulässiger Bewegungen funktionieren und bestimmte Kompetenzen voraussetzen. Diese regulativen Regeln basieren auf der grundlegenden Akzep-tanz konstituierender Spielzüge und deren Anwendung in variierenden Situatio-nen. Sie legen fest, wie nach Maßgabe der grundlegenden Regeln je individuelle Einsätze realisiert werden können – so etwa im Schach die Nutzung einer be-stimmten Eröffnungsvariante (und deren Beantwortung); so etwa im Sprachspiel Literaturwissenschaft die Verwendung einer bestimmten ‚Methode‘ beim Um-gang mit Texten und Konstellationen.
Angesichts des hier nur kursorisch dargestellten Begriffsfeldes dürfte klar geworden sein, worin Bedeutung und Funktion von Lehrwerken bestehen: Sie instruieren Wissenschaftsnovizen in einen regelhaft strukturierten Zusammen-hang, dessen grundlegende Begrifflichkeiten ihnen erst einmal ebenso unklar sind wie seine basalen Operationen. Geleistet werden diese Instruktionen im Wesentlichen durch die bereits genannten Prozesse der Bereitstellung eines ka-tegorialen Apparats und eines Verfahrenswissens sowie der Vermittlung von ap-plikativen Fähigkeiten. Um es noch einmal zu wiederholen: Lehrwerke fixieren terminologisch und methodologisch diversifizierte Umgangsformen mit episte-mischen Dingen, indem sie die als grundlegend erachteten und also ‚stabilisier-ten‘ Wissensbestände fest- und didaktisch vorstellen; sie konstituieren somit jene disziplinären Wissensbestände, die in gleichsam kanonisierter Gestalt be-wahrt und zur Disziplinierung nachwachsender Generationen eingesetzt werden (können). Nicht nur damit bündeln sie die anfänglich ungeübte und zerstreute Aufmerksamkeit von Wissenschafts-Novizen zu einem Verhalten zielgerichte-ten Wahrnehmens, das nach und unter Anleitung nun Details entdecken und be-schreiben kann, die vorher verborgen blieben. Schließlich schaffen Lehrwerke einen unter Umständen lebenslangen Sozialverbund von Wissensakteuren, in dem sie die strukturelle Asymmetrie zwischen Lehrenden und Studierenden durch performative Aktionen und rhetorische Verfahren aufheben und zugleich zementieren: Wie schon die jetzt näher zu betrachtende Poetik des Aristoteles zeigt, erzeugen instruierende Texte mit zum Teil sehr speziellen Praktiken der Adressierung und Exemplifizierung eine virtuelle Gemeinschaft, in der Autor und Leser bzw. Wissensträger und Wissenserwerber auf besondere Weise ver-bunden sind.
8
Alle diese Leistungen der Verdichtung, der Bündelung und der Vergemeinschaf-tung erbringen Lehrwerke vor allem durch die Formulierung von Normen. Die-se explizit formulierten Regeln treten in unterschiedlichen Varianten auf. Zum einen gibt es Normen, die eine bestimmte Fortsetzung des Spiels vorschreiben und also syntagmatische Instruktionen leisten: „Der König unter Schach soll sich dem Schach entziehen“; „Übernahmen aus fremden Texten sind nachzuwei-sen“. Zum anderen gibt es Regeln, die mögliche Fortsetzungsweisen des Spiels auf paradigmatische Art bestimmen: „Der Läufer soll diagonal gezogen werden“; „Der Nachweis der Übernahme fremder geistiger Inhalte erfolgt durch Anmer-kungen in der Form xy“.8 In gleicher Weise lassen sich Normen für das in den textinterpretiereden Disziplinen zentrale Interpretationsproblem unterscheiden. Zu finden sind syntagmatische Vorschriften für eine bestimmte Spielfortset-zung: so etwa in der schon von Aristoteles formulierten Anweisung, bei proble-matischen Bedeutungszuschreibungen auf distanziert reflektierte Weise vorzugehen und Verständnisprobleme durch Prüfung der Darstellungsabsicht, durch Analyse der Sprachverwendung oder durch ästhetische Lizensierung zu lösen (Poetik, 1460b 6-1461b 26). Zugleich gibt es paradigmatische Instruktio-nen für mögliche Fortsetzungsweisen interpretativer Textumgangsformen, bei-spielsweise in der Forderung des Stagiriten, widersprüchliche Textbefunde durch eine auf die Darstellungsgesamtheit bezogene Perspektive zu erklären und dabei die „Erfordernisse der Dichtung“ ebenso einzubeziehen wie die von bestimmten Konventionen geleiteten Intentionen des Autors („die Absicht, das Bessere dar-zustellen“) und ein zur Verfügung stehendes Weltwissen („die allgemeine Mei-nung“).9
Mit dem Namen des Aristoteles und seinem nur fragmentarisch überliefer-ten Lehrwerk über „die Dichtkunst selbst und ihre Gattungen“ sind Hinweise gefallen, die eine Überleitung zum nächsten Abschnitt der Überlegungen erlau-ben. Denn die um 335 v. Chr. fixierte Poetik kann als ein Ausgangspunkt für die Entwicklung jenes Sprachspiels gelten, an dem Philologen und Literaturforscher seit über zwei Jahrtausenden laborieren. Die im Folgenden zu überprüfende These ist, dass hier Regeln für den Umgang mit Texten fixiert werden, die so-wohl konstitutive als auch regulative Qualitäten gewinnen: Die Poetik des Aristo-teles initialisiert regelgeleitete Textumgangsformen auf der Basis distanzierter
8 Es ist ein Hinweis auf die Komplexität von Regelkreisen, dass Praktiken bzw. Spielzüge
mehreren konstitutiven Spiel-Regeln folgen – so etwa, wenn der Verfasser einer universitä-ren Qualifikationsschrift die von ihm aus der bisherigen Forschung ermittelten Stand-punkte zu einer Problemstellung auflistet und die Darstellungen ihrer Urheber (einer syntagmatischen Regel folgend) dadurch dokumentiert, dass er (einer paradigmatischen Regel folgend) eine Anmerkung setzt und die Herkunft der wörtlich bzw. paraphrastisch übernommenen Inhalte belegt.
9 So prägnant in Poetik 1461b10-12, hier nach der Übersetzung von Manfred Fuhrmann (wie Anm. 1), S. 93: „Aufs Ganze gesehen muß man das Unmögliche rechtfertigen, indem man entweder auf die Erfordernisse der Dichtung oder die Absicht, das Bessere darzustellen, oder auf die allgemeine Meinung zurückgreift.“
9
Beobachtung und schafft auf diese Weise die Praxis einer Zeit und Aufmerksam-keit investierenden Philologie, die ihre Liebe zum Wort in ihren Namen einträgt und deren erste zünftige Vertreter in der Bibliothek von Alexandria sich nicht ohne Grund auf Aristoteles berufen.10 Dieses Lehrwerk formuliert zugleich Spielzüge für Umgangsformen, die im Rahmen eines so konstituierten Hand-lungszusammenhangs möglich sind – auch für das drängende Problem des Ver-stehens und Interpretierens von Texten, die aufgrund der historischen und kulturellen Differenz zwischen Entstehung und Rezeption unverständlich ge-worden sind.
2. Konstitutive und regulative Regeln in Aristoteles’ Poetik
Die besondere Bedeutung der um 335 v. Chr. fixierten und nur unvollständig er-haltenen Schrift des Aristoteles über die Dichtkunst muss an dieser Stelle wohl nicht noch einmal erläutert werden. Als wichtigste und folgenreichste Darstel-lung des antiken Wissens über poetische Texte prägt bzw. definiert sie Begriffe und Verfahrensweisen, die noch heutige Umgangsformen mit Literatur bestim-men. Auch den Charakter als Lehrwerk wird man der Poetik kaum absprechen können: Was Aristoteles um 335 v. Chr. den Angehörigen seiner Bildungsein-richtung Lykeion vortrug und als Teil seiner esoterischen, d. h. nicht für die Öf-fentlichkeit gedachten Lehre aufzeichnen ließ, verweist sowohl im systematischen Anspruch (mit der gleich zum Auftakt demonstrierten Behand-lung der „Dichtkunst selbst“ und ihrer Gattungen) als auch in ihrem internen Aufbau auf innerschulische Gebrauchszwecke.11 In dieser mehrfach dimensio-nierten Qualität – einerseits systematisierte Reflexion über allgemeine Eigen-
10 Als „Anfang“ und Grundlagenstifter wird Aristoteles bereits von antiken Philologen be-
zeichnet; vgl. Rudolf Pfeiffer: Geschichte der klassischen Philologie. Von den Anfängen bis zum Ende des Hellenismus [History of Classical Scholarship, 1968], Reinbek bei Hamburg 1970, S. 92f. Eine kritische Prüfung und Präzisierung der Auffassungen über das Verhältnis von alexandrinischer Philologie und dem Peripatos gibt Pfeiffer an späterer Stelle; ebd., S. 115-125.
11 Die nach Aristoteles’ Rückkehr nach Athen und Gründung des Lykeon wohl um 335 v. Chr. entstandene Poetik war zunächst nur für den innerschulischen Gebrauch bestimmt; sie zählt zu den esoterischen Schriften und wurde im 1. Jh. v. Chr. im Rahmen der Ge-samtausgabe aristotelischer Lehrschriften durch Andronikus von Rhodos – der auch die Werke von Aristoteles’ Schüler und Freund Theophrast herausgab – in Rom veröffentlicht. Gleichwohl war die primär für den Unterricht mit vermutlich fortgeschrittenen Schülern bestimmte Poetik nicht das erste Lehrwerk für den Umgang mit Texten. Ein Lehrbuch der Sophistik als der systematisierten Darstellung von Techniken und Effekten überzeugender Rede soll schon der aus Sizilien stammende Rhetor Corax verfasst haben. Auch der um 480 v. Chr. entstandene Mustervortrag Verteidigung der Helena des Sophisten Gorgias, der die Überzeugungskraft der Poesie an die Möglichkeiten manipulativer Täuschung aufgrund begrenzter menschlicher Einsicht bindet, kann als Teil pädagogischer Instruktionen ver-standen werden, mit deren Hilfe der kalkulierte Einsatz sprachlicher Effekte in Reden lehr- und lernbar gemacht werden sollte.
10
schaften und Wirkungsweisen literarischer Texte, andererseits ein Lehrwerk zur Vermittlung eben dieser wesentlichen Kategorien und Verfahren zu sein – mar-kiert Aristoteles’ Poetik den Einsatzpunkt einer Entwicklung, die über verschie-dene Etappen bis zu den diversen Textumgangsformen der gegenwärtigen Literaturwissenschaft reicht. Nicht ohne Grund wird sie in zahlreichen Lehr-werken als eine Grundlage des nachfolgend praktizierten Handelns mit Texten und Konstellationen aufgeführt; sie bildet ein wesentliches kategoriales Reser-voir und einen unverzichtbaren methodologischen Rückversicherungsraum für literaturwissenschaftliche Einführungen und Lehrbücher bis in die Gegenwart.12
Diese besonderen Qualitäten gewinnt die nur fragmentarisch überlieferte Poetik auch deshalb, weil sie den Endpunkt komplexer und historisch überaus bedeutsamer Vorgänge markiert. In deren Verlauf formieren sich zum einen die Konzepte zur Beschreibung und Erklärung eines Gegenstandsbereichs, für den Aristoteles selbst noch nach einem Terminus sucht.13 Das Aristotelische Lehr-werk schließt zum anderen langfristige Transformationsprozesse im Umgang mit ästhetischen Artefakten ab und fixiert ein spezifisches Verhalten zu literari-schen Texten: Die Poetik besiegelt die seit den Verständniskrisen angesichts der homerischen Epen im sechsten vorchristlichen Jahrhundert einsetzenden und in ihrer kulturellen Tragweite kaum zu überschätzenden Reflexions- und Differen-zierungsprozesse zwischen ‚Poesie‘ und ‚Wissen‘ – nicht zuletzt durch den Ge-
12 So schon bei Wilhelm Scherer (Poetik [11888]. Mit einer Einleitung und Materialien zur
Rezeptionsanalyse, hg. v. Gunter Reiss, Tübingen 1977), der Aristoteles’ Poetik als „Werk von weit reichendem Ruhm und weit reichender Macht“ (S. 31) bezeichnet und es als „au-ßerordentliches Werk, zum Theil von ewigem Gehalt“ (S. 35) würdigt. Bemerkenswerter Weise stellt Scherer vor allem die beobachtend-deskriptiven Leistungen der Poetik heraus: „Trotz der Beschränkung auf Griechisches scheint es doch nicht daran gebunden, sondern so sehr auf die Wahrheit und das Wesen der Dinge zu dringen, daß vieles unumstößlich beobachtet oder doch wenigstens als nützlicher Fortschritt in der Beobachtung dieser Dinge anzusehen ist.“ Auf die Aristotelische Poetik beziehen sich noch aktuelle Einfüh-rungen, so Alo Allkemper und Norbert Otto Eke: Literaturwissenschaft, Paderborn 2004 [UTB basics], S. 63–66; auch wenn das eher deskriptiv vorgehende Lehrwerk des Aristote-les hier auf S. 64 als „Regelpoetik“ bezeichnet wird) oder bei Sabina Becker, Christine Hummel u. Gabriele Sander: Grundkurs Literaturwissenschaft, Stuttgart 2006, S. 37, wo nach kurzem Abriss des 2.500 Jahre alten Nachdenkens über das „Wesen des Schönen, sei-ne Produktion und Rezeption“ (S. 37) ebenso knapp wie fragmentarisch das Reflexions-wissen von Poetik und Rhetorik referiert wird.
13 Aristoteles: Poetik 1447a30–1447b10, hier nach der Übers. v. Manfred Fuhrmann, bibliogr. erg. Ausg., Stuttgart 1994, S. 5–7: „Diejenige Kunst, die allein die Sprache in Prosa oder in Versen […] verwendet, hat bis jetzt keine eigene Bezeichnung erhalten. Denn wir können keine Bezeichnung angeben, die folgendes umgreift: die Mimen des Sophron und Xe-narchos, die sokratischen Dialoge sowie – wenn jemand mit diesen Mitteln die Nachah-mung bewerkstelligen will – die jambischen Trimeter oder elegischen Distichen oder sonstigen Versmaße. Allerdings verknüpft eine verbreitete Auffassung das Dichten mit dem Vers, und man nennt die einen Elegien-Dichter, die anderen Epen-Dichter, wobei man sie nicht im Hinblick auf die Nachahmung, sondern pauschal im Hinblick auf den Vers als Dichter bezeichnet.“
11
winn jener distanzierten Beobachterperspektive, die das je Individuelle und In-kommensurable poetischer Produktionen und die ihnen korrespondierenden äs-thetischen Erfahrungen begrifflich zu bündeln und zu bearbeiten erlaubt. Anders gesagt: Indem Aristoteles die noch von seinem Lehrer Platon als „Täu-schung“ verurteilte Dichtung von den Geltungsansprüchen anderer Darstel-lungsweisen kategorial unterscheidet und die ihr eigenen Wirkungen mit Allgemeinbegriffen erfasst, bringt er jene Konzepte und Verfahren hervor, die es möglich machen, die zuerst mit Gewissheitsansprüchen verbundene und später skeptisch disqualifizierte Poesie in ihren ästhetischen Effekten zu beobachten, systematisch zu beschreiben sowie in Beziehungen zu anderen Texten bzw. ver-schiedenartigen Kontexten zu setzen. Eine nicht zu unterschätzende Dimension dieser kategorialen Ordnungen und regelgeleiteten Verfahren ist ihre Genese in Zusammenhängen eines institutionalisierten Wissenstransfers. Denn wie er-wähnt, entsteht diese Schrift als eine Art Vorlesungsskript in jener Bildungsein-richtung, die Aristoteles nach seiner Rückkehr nach Athen um 336 v. Chr. begründet und im Musenhain in der Nähe des Tempels des Apollon Lykeios an-siedelt. Hier unterrichtet er in den Morgenstunden seine Schüler (die als ‚Peripa-tetiker‘ bekannt werden, weil sie ihrem beim Lehren durch die Wandelhalle Peripatos wandernden Lehrer folgen); in den nachfolgenden Stunden liest er auch vor öffentlichem Publikum. Möglicherweise kursieren bereits zu dieser Zeit schriftlich festgehaltene Lektionen. Vermutlich um 335 v. Chr. wird die Schrift Über die Poetik als ein unfertiges und mehrfach überarbeitetes Vorlesungsskript aufgezeichnet; sie fungiert als Lehrwerk, das nicht für die Öffentlichkeit, son-dern für einen mit Aristoteles’ Konzepten und Verfahren bereits vertrauten Schülerkreis bestimmt ist.14 Doch ist diese Darstellung nicht das einzige Zeugnis für die Beschäftigung des Stagiriten mit der Dichtkunst. Während ein von Aris-toteles verfasster und publizierter Dialog Über die Dichter, den er selbst andeu-tungsweise erwähnt (Poetik 1454b18) und das aus sechs Büchern bestehende Werk über Probleme der Homerischen Epen – von dem im Kapitel 25 der Poetik die Rede ist – verloren gingen, blieb nur die für den Unterrichtsbetrieb geschrie-bene Poetik erhalten; jedoch als ein Werk, dem – von den ersten Kommentaren der neuzeitlichen Rezeption ab etwa 1550 bis in die Gegenwart – der Vorwurf
14 Zur Bestimmung der Abfassungszeit vgl. S. Halliwell: Aristotle’s Poetics, London 1986,
S. 300-324. Nach Aristoteles’ Tod wurden viele der sog. Pragmatien (Lehrschriften) in eine Stadt in der Nähe Troias gebracht und von dort erst Anfang des 1. Jh.s wieder nach Athen zurückgeholt. Als die Römer im Jahr 86 die Stadt eroberten, fiel diese Textsammlung in die Hände von Sulla, der sie mit nach Rom nahm; hier wurde durch Andronikus von Rhodos jene Gesamtausgabe erstellt, die die Grundlage des bis heute überlieferten Textkorpus bil-det. Die nicht mehr ganz aufklärbaren Umstände der Erhaltung der Lehrschriften erläutert Hellmuth Flashar: Aristoteles, in: ders. (Hg.): Ältere Akademie – Aristoteles – Peripatos, Ba-sel 22004, S. 180 f.
12
gemacht wird, dunkel, begrifflich unklar und voll innerer Widersprüche zu sein.15
Im Folgenden kann es nicht darum gehen, die Leistungen bzw. Fehlleistun-gen der Aristotelischen Beschäftigung mit Dichtung herauszuarbeiten.16 Auch die seit der Renaissance zu verzeichnenden Versuche der Übernahme Aristoteli-scher Lehrstücke in eigene Poetik-Entwürfe sollen hier nicht thematisiert wer-den. Die anschließenden Überlegungen konzentrieren sich vielmehr auf jene diskursiven und performativen Strategien eines Werkes, das von seinem Autor als ein Lehrwerk, d. h. als eine didaktisierte Einführung in Kategorien und Ver-fahren des distanzierten Umgangs mit poetischen Texten konzipiert wurde. Die These ist, dass die um 335 v. Chr. entstandene Poetik ein Resultat von kompli-zierten und historisch langwierigen Entwicklungen darstellt, in deren Verlauf ei-ne ‚wilde‘, ursprünglich mit kultisch-religiösen Praktiken verbundene und seit den Vorwürfen Solons und Platons als „Schein“ und „Lüge“ disqualifizierte Poe-sie gleichsam ‚domestiziert‘ wurde – wobei die von Aristoteles verwendeten bzw. eingeführten kategorialen Ordnungen und Regeln als wesentliche Mittel zur Ka-nalisierung und Mediatisierung ästhetischer Energien funktionieren. Anders ge-sagt: Die Poetik kann als ein Lehrwerk gelesen werden, das gravierende Probleme im Umgang mit poetischen Texten reflektiert und zu deren Bewältigung nun Kategorien und regelgeleitet Verfahren entwirft, die auf eine epistemische Be-wältigung dieser kulturellen Problemsituation zielen. Die konstitutiven und re-gulativen Regeln, die dieses Lehrwerk einführt, um den Status und die Funktionsweise der heftig umstrittenen Poesie zu klären, sind Resultat und zu-gleich Katalysator eines grundlegend veränderten Umgangs mit poetischen Tex-ten: Gegen moralische Disqualifikation und erkenntnistheoretische Abwertung eröffnet Aristoteles’ Poetik neue, empirisch begründete und kategorial sortie-rende Zugangsweisen zu jenem Gegenstandsbereich, den wir heute als Literatur bearbeiten.
15 Die seit der Renaissance erhobenen Vorwürfe des Mangels an begrifflicher Klarheit, zahl-
reicher innerer Widersprüche und Ungereimtheiten sowie konfuser Systematik bündelt die Einleitung von Arbogast Schmidt in Aristoteles’ Poetik (wie Anm. 1), S. 45–48: „Stellt man diese Kritikpunkte nebeneinander und fasst sie zusammen, muss es unverständlich erschei-nen, wie man einem Buch mit diesen substantiellen Schwächen solche Beachtung hat schenken können.“ (S. 45)
16 Festzuhalten bleibt, dass die Poetik nicht den Anspruch erhob, eine philosophische bzw. „theoretische“ Darstellung der Dichtkunst zu liefern. In Aristoteles’ Lehrwerk (wie bei seinen frühneuzeitlichen Nachfolgern) ist das Wissen über Dichtung – den Bestimmungen der in der Metaphysik (1025b 18–1026a) entwickelten Wissenstypologie folgend – ein Ele-ment des produktiven Wissens und nicht Teil des praktischen oder theoretischen Wissens. Denn als veränderlicher Gegenstand ist Dichtung per definitionem nicht theoriefähig. Auf diese besonderen epistemischen Qualitäten der Poetik verweist auch Schmidt (wie Anm. 1, S. 198): „Das Interesse an Dichtung ist vielmehr wirklich eine theōría, aber eine theōría, die auf die Erkenntnis eines bestimmten einzelnen Handelns ausgerichtet ist, indem sie dieses Handeln aus seinen inneren Zielsetzungen begreift. Die theōría ist daher nicht rein ‚theore-tisch‘, sondern ein konkretes Denken mit einem Erkenntnis- und Gefühlsaspekt.“
13
Die Entwicklungsbedingungen dieses neuartigen Zugangs zur Poesie sind bekannt. Sie ergeben sich aus einer folgenschweren Trennungsgeschichte, die in der griechischen Kultur zwischen dem achten und dem dritten vorchristlichen Jahrhundert vor sich geht und sowohl den Status als auch die Behandlung jenes heute als ‚Literatur‘ bezeichneten Gegenstandsbereichs radikal verändert: Eine ursprünglich mündlich tradierte ‚Kunde‘, die als Form des kollektiven Gedächt-nisses fungierte, wird im neuen Medium der Schrift aufgezeichnet und unter dem Druck von empirischen Beobachtungen und historiographischen Recher-chen von Gewissheitsansprüche entbunden; sie muss als Dichtung moralisch und epistemisch begründete Vorwürfe der „Täuschung“ und „Lüge“ in Kauf nehmen, bevor Aristoteles die folgenreiche Separation der Bereiche „Wissen“ und „Poesie“ legitimiert und damit autonome Sektoren sichert, von deren nun eigenständiger Bearbeitung die professionalisierte Liebe zum Wort noch heute profitiert.17 In diesem Prozess übernimmt die Poetik als Lehrwerk mehrfach di-mensionierte Aufgaben: Aristoteles’ Darstellung nimmt bisher umlaufende Be-griffe (wie z. B. die schon von den Sophisten gebrauchten Termini zur Beschreibung von Texteffekten oder den schon von Platon verwendeten Mime-sis-Begriff) auf und erzeugt durch ihre systematisierte bzw. neu festgelegte Ver-wendung den kategorialen Apparat für die versachlichte und distanzierte Bearbeitung eines kulturellen Problems, das so zu einem Gegenstand epistemi-scher Verhandlungen wird. Zugleich und untrennbar mit der Kategorisierung verbunden, entwickelt die Aristotelische Poetik spezifische Beobachtungsformen und -formate, die auf fortgesetzten Unterscheidungen beruhen und die Bearbei-tung weiterer Gegenstandsbereiche gestatten. Nicht nur auf diese Weise schafft die Poetik eine virtuelle, durch analogen Begriffsgebrauch und rekursive Opera-tionsweise verbundene Gemeinschaft von Spezialisten für Texte und sprachliche Zeichen: eine Community, die durch Prozesse intergenerationellen Wissens-
17 Die Bedingungen für diesen mehrere Jahrhunderte dauernden Prozess zwischen Ver-
schriftlichung der Homerischen Epen und Aristoteles’ Reflexionen sind komplex und können hier nur in Ansätzen nachgezeichnet werden. Aus medienhistorischer Perspektive haben dazu vor allem auch die Vertreter der sog. Toronto-Schule gearbeitet, etwa Jack Goody: Literalität in traditionalen Gesellschaften, Frankfurt a.M. 1981; ders.: Die Logik der Schrift und die Organisation von Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1990 [The Logic of Writing and the Organization of Society, Cambridge 1987]; Walter Ong: Oralität und Literalität. Die Technologisierung des Wortes, Opladen 1987 [Orality and literacy. The technologizing of the word, New York 1982] sowie Eric Havelock: Preface To Plato. A History of the Greek Mind, Cambridge and London 1963; ders.: The Literate Revolution in Greece and its Cultu-ral Consequences, Princeton 1982; ders.: Als die Muse schreiben lernte, Frankfurt a.M. 1992 [The Muse Learns to Write, New Haven and London 1986]. Aus fiktionalitätstheoretischer Perspektive instruktiv dazu Wolfgang Rösler: Die Entdeckung der Fiktionalität in der An-tike, in: Poetica 12 (1980), S. 289-319; umfassend Heinz Schlaffer: Poesie und Wissen. Die Entstehung des ästhetischen Bewußtseins und der philologischen Erkenntnis. Erweiterte Aus-gabe, Frankfurt a.M. 2005. Nicht zu vergessen bleibt schließlich die wissenschaftshistori-sche Rekonstruktion dieses Prozesses, geleistet vor allem von Rudolf Pfeiffer: Geschichte der klassischen Philologie(wie Anm. 10).
14
transfers gestiftet wird und vom dritten vorchristlichen Jahrhundert bis in die Gegenwart reicht.
Um diese besonderen Leistungen des aristotelischen Lehrwerks rekonstru-ieren zu können, empfiehlt sich ein genauerer Blick auf Voraussetzungen und Konditionen der vorausgehenden Trennungsgeschichte. Als ihr Ausgangspunkt gilt eine ursprüngliche Einheit von poetischer und epistemischer Welterschlie-ßung. Texte, die wir heute als ‚literarisch‘ bezeichnen, stellen – den von Maurice Halbwachs bereits 1950 entwickelten Überlegungen zum kollektiven Gedächtnis folgend – ursprünglich mündlich tradierte Überlieferungen dar, deren Inhalte (vorrangig Göttergenealogien und Heldengeschichten) als ‚gewiss‘ galten und geglaubt wurden. Oral tradierten Texten bzw. ihren Sängern schrieben die Grie-chen ein Wissen zu, das durch die Musen als den Töchtern von Erinnerungsgöt-tin Mnemosyne und Götterchef Zeus garantiert wurde.18 Die Auflösung dieser (vermuteten) Einheit von Poesie und Wissen vollzog sich in einem langwierigen und komplizierten Prozess, an dem sowohl die Formierung der Schriftkultur und der Umgang mit anderen kulturellen Überlieferungen als auch neuartige empirische Beobachtungsverfahren beteiligt waren: Die um 800 v. Chr. einset-zende Aufzeichnung der bislang mündlich umlaufenden Überlieferung mit der von den Phöniziern übernommenen und perfektionierten Lautschrift und die damit verbundene Differenzierung von Formen (Prosa statt metrisch regulierter Verse) eröffnete nicht nur neue Bewahrungsmöglichkeiten und Zugangschancen von bzw. zu Wissen; sie schuf zugleich eine bis dahin ungekannte Sensibilität für Inkonsistenzen in der bislang unhinterfragt geltenden Überlieferung: Nun konnten Widersprüche zwischen Texten bzw. Textelementen festgestellt wer-den. Auch der Kontakt mit fremden Kulturen und deren Überlieferung relati-vierte die eigenen Wissensbestände und Überzeugungen. Die sich verdichtenden Zweifel mündeten in Gewissheitsdefizite, die man auf unterschiedliche Weise ar-tikulierte und bewältigte. Sind die Musen im homerischen Epos omnipräsent und allwissend (Ilias 2, V. 484–487; auch Odyssee 1, V. 1; Ilias 1, V. 1), werden ihre epistemischen Garantien in der um 700 v. Chr. entstandenen Götterlehre des Hesiod (Theogonie V. 27 f.) schon markant eingeschränkt. Um 600 v. Chr. verkündet der Politiker Solon, der selbst Jamben und Elegien schreibt und darin moralische und politische Probleme reflektiert, die Dichter verkündeten viel Unwahres (pseudos) und formuliert damit eine Ausgrenzungsmaxime, die nach Aristoteles’ Zeugnis (Metaphysik 983a) zum Sprichwort wurde. Auch wenn ver-schiedene Versuche zur Schlichtung dieser Zweifel an den Geltungsansprüchen der Überlieferung einsetzen und allegorische Interpretationen der Homer-Texte die ‚Wahrheit‘ des Epos retten sollten, war eine grundlegende Skepsis nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Die von Aristoteles’ Lehrer Platon vorgebrachten Dis-qualifikationen und Exklusionen der Poesie markieren ihren Gipfel: Im Dialog Ion stellt der platonische Sokrates dem enthusiastisch inspirierten Rhapsoden
18 So auch Rösler: Die Entdeckung der Fiktionalität (wie Anm. 17).
15
das Zeugnis aus, kein sicheres Wissen im Sinne spezialisierter Kenntnisse zu be-sitzen und allein im Zustand des Wahns singen zu können (Ion 533e–534c); das um 370 v. Chr. niedergeschriebene Hauptwerk erklärt mit einem Bündel von epistemologischen und moralischen Argumenten den notwendigen Ausschluss des nachahmenden Künstlers aus dem Idealstaat (Politheia 377d, 598e–601b, 602b–603b).
Abgeschlossen wird die Separationsgeschichte von Poesie und Wissen schließlich durch Differenzierungsleistungen, die für den hier zu verhandelnden Zusammenhang von geradezu fundamentaler Bedeutung sind. Platons Schüler Aristoteles grenzt nicht nur die Geltungsansprüche des poetischen Textes von der Zielstellung historischer Darstellungen ab, indem er postuliert, „daß der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere, was geschehen könnte“.19 Zugleich wertet er die von seinem Lehrer Platon als „Täuschung“ verurteilte Poesie dezi-diert auf und rückt sie in die Nähe der eigenen Disziplin, in dem er die als „Nachahmung von Handlungen“ bestimmte Dichtung als „etwas Philosophi-scheres und Ernsthafteres“ der Historiographie gegenüberstellt und auszeichnet: „denn die Dichtung teilt mehr das Allgemeine, die Geschichtsschreibung hinge-gen das Besondere mit“.20
Fixiert wird diese Ehrenrettung der Poesie in einer Schrift, als deren durch-gängige Absicht eine „Domestikation der wilden Poesie“ erkannt wurde: Gegen den vom Zauber der Dichtung ergriffenen und sie darum mit den Mitteln der Vernunft in die Schranken weisenden Platon habe Aristoteles’ Poetik die Poesie auf menschliche Fähigkeiten und Ziele reduziert und damit rational verkürzt:
Die Vorzüge des als ‚göttlich‘ angesehenen Sängers Homer erklärt sie al-lein durch techne und physis; poetische Sprache dient wie jede andere le-diglich zur Mitteilung von Gedanken; Dichtung hat die Aufgabe, menschliche Verhältnisse mittels künstlerischer Technik abzubilden; die kathartische Erschütterung befördert die Gesundheit des Körpers und der Seele; der Begriff des Wahrscheinlichen beruhigt über solche dichterische
19 Aristoteles: Poetik 9, 1451 a36–38, hier nach der Übersetzung von Manfred Fuhrmann (wie
Anm. 1), S. 29. 20 Auch in seinem zwischen 348 und 322 v. Chr. entstandenen philosophischen Hauptwerk
erklärt Aristoteles die Kunst zum Ergebnis eines Erfahrungswissens über allgemeine Zu-sammenhänge; vgl. Aristoteles: Metaphysik I 21, 981a, hier zitiert nach der Übers. v. Thomas Alexander Szlezak, Berlin 2004, S. 3: „Kunst entsteht, wenn aus den vielen Be-obachtungen der Erfahrung eine allgemeine Ansicht über alle ähnlichen Dinge entsteht.“ Die Erhebung der Poesie zu einem Medium des Allgemeinen beruht auf einer Rangord-nung des Wissens, die der Kunst (als kognitiv begründetes Hervorbringen) eine wichtigere Position zuweist als der bloßen Erfahrung, vgl. ebenda, 981b, S. 4: „Gleichwohl meinen wir, daß jedenfalls das Wissen und das Verstehen der Kunst in höherem Maße zukommt als der Erfahrung, und wir halten die Vertreter der Kunst für weiser als die nur Erfahrenen, in der Überzeugung, daß die Weisheit sich bei allen auf Grund des Wissens einstellt; und so urteilen wir, weil die einen die Ursachen kennen, die anderen nicht. Denn die Erfahre-nen wissen zwar das Daß ,einer Sache‘, das Warum aber wissen sie nicht; die anderen ken-nen das Warum und die Ursache.“
16
Einfälle, die die Grenzen der Wirklichkeit überschreiten; an die Stelle des göttlichen Schicksals tritt der Nexus menschlicher Aktionen; der Mythos ist als Handlungsgerüst nützlich. Solche kluge Verharmlosungen, mit de-nen Aristoteles die Dichtung nach ihrer Verurteilung durch Platon rehabi-litieren wollte, wirkten so überzeugend, daß sich die europäische Literaturgeschichte zweitausend Jahre lang in diesem blinden Spiegel wie-derzuerkennen versuchte – und das mit Erfolg, da sie ja zum großen Teil nach den aristotelischen Regeln angefertigt wurde.21
Diese starken Thesen über die konstruktiven Leistungen des Aristoteles, der „Komposition und Wirkung von Poesie berechenbar und damit von Rhetorik ununterscheidbar gemacht“ habe,22 sollen hier nicht diskutiert werden. Sie ge-winnen jedoch neues Licht, wenn man sich noch einmal die kulturellen Voraus-setzungen und epistemischen Konditionen des aristotelischen Textes vergegenwärtigt, der als ein Lehrwerk die bereits erwähnten Funktionen der Verdichtung, Bündelung und Vergemeinschaftung zu erfüllen hatte. Vor diesem Hintergrund stellen sich die ‚domestizierenden‘ Umgangsformen mit Literatur in der Poetik als Leistungen dar, die adressaten- und kommunikationsspezifisch zu situieren sind. Drei Hinweise müssen genügen, um dieses Problem näher ein-zukreisen:
(a) Aristoteles und sein poetologisches Lehrwerk sind Produkte einer ‚Schriftkultur‘, die es erlaubt, distanzierte und segmentierende Beobachtungen an Texten vorzunehmen. Nicht ohne Grund war Aristoteles in der Platonischen Akademie als der „Leser“ bzw. der „Lesende“ bekannt.23 Nicht zufällig postuliert er in der Poetik, die Wirkung der Tragödie erschließe sich auch ohne Agon und Schauspieler (1450b16–20) und die vollkommene Fabel entfalte ihre Wirkung unabhängig von der Anschauung durch das Auge, d. h. bereits beim Lesen (1453b1–14; 1462a11–14, 17 f.). Dieser Bezug auf Schrift als Trägermedium der literarischen Kommunikation kann in seinen epistemischen Dimensionen und didaktischen Konsequenzen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Hatte noch sein Lehrer Platon im Dialog Phaidros die Überlegenheit von Mündlichkeit be-tont und die zu „Vergessenheit“ und „Schein-Weisheit“ führende Kunst des Schreibens abgelehnt, so privilegiert Aristoteles eine Aufzeichnungspraxis, die individualisierte und rekursive Operationen erlaubt: für Lehrende wie für Studie-rende. Die Lektüre eines auf Papyrus bzw. Pergament fixierten Textes macht aber nicht nur wiederholte Beobachtungen und deiktische Zeigehandlungen („So steht es geschrieben“) möglich. Im privaten Leseakt formiert sich zugleich ein neues bzw. qualitativ verändertes Bewusstsein von den Leistungen und Lizenzen von Texten: Im Unterschied zur face-to-face-Kommunikation der oralen Über-lieferung, die auf der Präsenz eines physisch anwesenden Individuums beruht,
21 Schlaffer: Poesie und Wissen (wie Anm. 17), S. 79. 22 Ebd., S. 79. 23 Vgl. Ingemar Düring: Aristoteles. Darstellung und Interpretation seines Denkens, Heidelberg
1966, S. 8 f.
17
das persönlich für seine Rede einsteht und sich für die zumindest subjektive Wahrheit dessen verbürgt, was es sagt,24 setzt die entzerrte Kommunikationssi-tuation der Schrift diesen gemeinsamen Bezugs- und Situationsrahmen außer Kraft. An Stelle der Bindung an einen vorgegebenen Anlass und Ort treten je-weils individuelle zeitliche und lokale Gegebenheiten, die der Leser selbst fest-legt. Bestimmt wird von ihm auch das Tempo der Rezeption – er kann langsamer oder schneller lesen, Pausen einschalten, überspringen, wiederholen. Rekursive Lektüren schriftlicher Texte setzen also eine differentielle Kommunikation in Gang – und mithin aktive Vorstellungsbildungen eines Rezipienten, der ange-sichts einer fehlenden Wirklichkeit (des Sprechers) die Möglichkeiten von Schrift-Welten imaginiert.25
(b) Schriftlich vorliegende Texte und die durch sie ermöglichten Beobach-tungsverfahren erschöpfen sich jedoch nicht in wiederholten Lektüren und aktiv produzierten Vorstellungen. Sie ermöglichen und erzeugen zugleich Distanzie-rungsformen, die – im Unterschied zu den Präsenz-Erfahrungen im athenischen Dionysus-Theater, das Aristoteles auch besuchte – kognitive Einstellungen ent-stehen lassen. Diese kognitiven Einstellungen gegenüber artifiziellen Gegen-ständen wie Tragödie und Epos sind an einen begrifflichen Apparat und an ein differenzierendes Vorgehen gebunden, die ihrerseits auf erkenntnistheoretischen Fundamenten ruhen. Denken ist nach Aristoteles das Erfassen von identifizier-baren Bestimmungen: Um zu erkennen, was ist und nicht vielmehr nicht ist, müssen Einzelmomente aus einer Gesamtheit herausgehoben und unterschieden werden. Die in der Poetik vorkommenden Kategorien zur Beschreibung der „Dichtkunst selbst“ und ihrer Arten können so als Ergebnisse von Reflexions-leistungen gelten, die auf Unterscheidungen beruhen und ein strukturiertes Wis-senssystem aufbauen. Schon die Gegenstandsbestimmung im ersten Satz der Poetik – „Von der Dichtkunst selbst und von ihren Gattungen, welche Wirkung eine jede hat und wie man die Handlungen zusammenfügen muß, wenn die Dichtung gut sein soll, ferner aus wie vielen und was für Teilen eine Dichtung 24 Dieser Situationsrahmen bewirkt die Einbindung und zugleich Restriktion der Vorstel-
lungstätigkeit auf der Seite der Zuhörer; limitiert also den Raum der Möglichkeiten. Er wird kanalisiert durch Faktoren wie Anlass und Ambiente; Erscheinung und Vortragsweise des Redenden; Gesten, explizite Verweise auf das Hier und Jetzt; vorgegebenes Tempo der Rezeption etc.
25 Prägnant dazu unter Bezug auf die Entstehung eines Fiktionalitätsbewusstseins Rösler: Entdeckung der Fiktionalität (wie Anm. 17), S. 317: „An die Stelle des – sei es glaubend, sei es zweifelnd – nachvollziehenden tritt also das schöpferische Subjekt, das im Lesevor-gang aktiv an der Hervorbringung des Werkes mitwirkt. Freiheit impliziert hierbei nicht allein das Recht auf eine individuelle ‚Lesart‘, auch auf Verweigerung, sondern nicht zuletzt das Recht auf Differenzierung. Denn aus der Perspektive des Lesers stellte sich ja eine sachliche bzw. historische Wahrheit des Textes keineswegs notwendig als Voraussetzung für das Zustandekommen jener spezifischen ästhetischen Erfahrung dar, die ihm das Lesen ermöglicht; sie kann im Gegenteil gänzlich unerheblich sein. Nicht, daß es so war oder ist, ist dann von Belang, sondern daß es so sein oder gewesen sein könnte – das Aristotelische Theorem von Fiktionalität ist das Theorem eines Lesers.“
18
besteht, und ebenso auch von den anderen Dingen, die zu demselben Thema ge-hören“ – demonstriert die Anwendung einer kategorialen Ordnung, die etwas unterscheiden kann, weil es ein Eines (Ganzes) observiert, das mit sich identisch und also von anderen verschieden ist, das Teile hat, die als Teile dieses Ganzen einander gleich, im Unterschied voneinander aber verschieden und also ähnlich sind. Identität und Verschiedenheit, Ganzheit und Teil, Gleichheit und Ähnlich-keit sowie Anfang, Mitte, Ende sind Konzepte, die eine kategoriale Ordnung von nun schriftlich fixierten Texten erlauben und zugleich die Kriterien darstel-len, die lehrhaft-demonstrierend vermittelt werden, um das epistemische Han-deln von Schülern zu orientieren.
(c) Auf Unterscheidungen beruhende kategoriale Ordnungen sind ‚ein‘ Re-sultat von Schriftkultur und rekursiver Lektüre; ein weiteres Ergebnis ist der Gewinn einer ästhetischen Erfahrung, für die Aristoteles zwar noch keinen eige-nen Begriff hat, doch in ihren Wirkungen kennt. Schon der erste Satz seiner Schrift formuliert die leitende Frage, wodurch es der Dichtung gelingt, anders als die Mischung von Ordnung und Kontingenz, in der so genannten Wirklich-keit eine „durchformte Einheit“ zustande zu bringen, damit „die Dichtung gut sein soll“; und also eine Einheit bildet, bei der alle Teile in einem notwendigen oder wahrscheinlichen Zusammenhang miteinander stehen und kein Teil fehlen, vertauscht oder hinzugefügt werden könnte, ohne dass das Ganze als Ganzes sich ändern würde (Poetik 1451a30–35). Ästhetische Erfahrung ist hier also pri-mär die Erfahrung der organischen und je einmaligen „Einheit“ des Kunstwerks. Die komplexen Einheitsbedingungen einer poetischen Komposition entwickelt der Stagirit systematisch in der Folge der einzelnen Kapitel. Damit stellt er die kategorialen Grundlagen für einen operationalisierbaren Umgang mit Texten be-reit – die zugleich die rational zugänglichen Aspekte ästhetischer Erfahrungen erfassen lassen.
Nach diesen knappen Hinweisen werden die didaktischen Dimensionen der Poetik deutlicher. Als Lehrwerk funktioniert der Aristotelische Text aufgrund seiner Kategorisierungs-, Verfahrens- und Applikationskomponenten, die Le-sern bzw. Schülern einen mehr oder weniger systematischen Begriffsapparat, ein Verfahrenswissen auf der Basis fortgesetzter Unterscheidungen sowie Anwen-dungs- und Übertragungsregeln anbieten. Als Lehrwerk funktioniert dieses Vor-lesungsskript aber auch aufgrund einer Darstellungslogik, die – wie bei anderen Einführungs- und Lehrwerken – der Forschungslogik komplementär entgegen-gesetzt ist. Lehrwerke gehen von grundlegenden und abstrakten sowie weitge-hend entproblematisierten Bestimmungen aus und steigen zu konkreten Zusammenhängen auf; sie nutzen Beispiele zur Illustration allgemeiner und weitgehend ‚stabiler‘ Begriffe und Aussagen. Im Unterschied zu den demonstra-tiven, vom Abstrakten zum Konkreten aufsteigenden Darstellungsformen eines Lehrwissens laufen Logik und Präsentation der Forschung in anderen Bahnen: Forschungsbeiträge nehmen ihren Ausgang von explizit formulierten Problem-stellungen einer ausdifferenzierten Wissenschaftslandschaft; sie ordnen sich in
19
spezialisierte Diskurse ein und suchen nach Beschreibungen und Erklärungen, die zunächst eine partikulare Konstellation analysieren, um danach vom Einzel-nen und Besonderen zum Allgemeinen fortzuschreiten. Doch nicht nur mit dem demonstrierten Aufstieg vom Abstrakten zum Konkreten hat die Aristotelische Poetik ein Darstellungsprinzip vorgegeben, das für nachfolgende Lehrwerke ver-bindlich werden sollte. Ebenso wichtig ist die Formulierung von regulativen Re-geln für den Umgang mit Texten, die aufgrund der historischen und kulturellen Differenz zwischen Produktion und Rezeption problematisch bzw. ‚unverständ-lich‘ wurden – und darum eine besondere Herausforderung für die Interpretati-on darstellen.
Einschlägig für das Problem des interpretativen Umgangs mit poetischen Texten in der um 335 v. Chr. niedergeschriebenen Poetik des Aristoteles ist ohne Zweifel das Kapitel 25, das dem (verlorenen) Werk über Probleme der Homer-Interpretation korrespondiert und die Schwierigkeiten im Verständnis der Ho-merischen Epen behandelt. Dieses Kapitel bezieht sich direkt auf die im sechsten vorchristlichen Jahrhundert einsetzenden Verständniskrisen angesichts der ar-chaischen Werke, die auf verschiedene Weise bewältigt werden konnten: zum ei-nen dadurch, dass man Homer kritisierte und ihm inkorrekte Aussagen oder interne Widersprüche nachwies;26 zum anderen indem man die anfechtbaren Textelemente allegorisch, historisch oder philologisch interpretierte. 27 Im Un-terschied zur Homerkritik – etwa seines Zeitgenossen Zoilos von Amphipolis, der eine verlorene Schrift Gegen die Dichtung Homers verfasste – entwirft Aris-toteles drei Verfahren, um die Probleme mit den epischen Texten zu lösen: Zum 26 Neben den Vertretern der noch jungen Philosophie wie Xenophanes und Heraklit sind es
vor allem die Repräsentanten der sich gleichfalls herausbildenden Historiographie, die sich kritisch zu Homers Epen verhalten. Sie werten die poetische Überlieferung quellenmäßig aus, korrigieren dabei Übertreibungen und innere Widersprüche: Hekataios verringert die Anzahl der Aigyptos-Söhne von fünfzig auf unter zwanzig; Herodot lässt Helena den Tro-janischen Krieg in Ägypten statt in Troja überdauert haben; Thukydides argwöhnt, die Ili-as vermittle von der Größe jenes Krieges eine unangemessene Vorstellung (rekonstruiert aber letztlich die relative Größe des griechischen Heeres vor Troja mit den Zahlen Ho-mers). Vgl. dazu mit Literaturangaben Rösler: Die Entdeckung der Fiktionalität (wie Anm. 17), hier S. 299f.
27 Das Verfahren einer apologetisch-allegorischen Homer-Interpretation wurde durch den noch ins sechste vorchristlich Jahrhundert zurückreichenden Theagenes von Rhegion be-gründet; sie kann als das gleichsam positive Gegenstück zu der von Xenophanes und Her-aklit geübten Kritik aufgefasst werden und rettet Homer als Naturphilosoph bzw. als physikus. Hierbei stellt sich etwa das feindliche Aufeinandertreffen der Götter im 20. Buch der Ilias die Beschreibung physikalisch-meteorologischer Vorgänge dar, in der Apollon, Helios und Hephaistos das Feuer, Poseidon und Skamandros das Wasser, Artemis den Mond und Hera die Luft bezeichnen. Komplexere Systeme, die auch die Heroen einbezie-hen, kommen später dazu: Der Anaxagoras-Schüler Metrodor von Lampsakos (zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts) stellt beispielsweise Zuordnungen auf, nach denen Achill als die Sonne, Hektor als der Mond; Agamemnon als Äther; Demeter als die Leber; Dionysos als die Milz und Apollon als die Galle figurieren. Dazu ebenfalls Rösler: Die Entdeckung der Fiktionalität (wie Anm. 17), S. 297-299.
20
einen durch Prüfung der Darstellungsabsicht (ein Dichter kann die Dinge dar-stellen, wie sie sind, oder wie sie zu sein scheinen, oder wie sie sein sollen); zum anderen durch Rekurs auf sprachliche Aspekte, zum dritten durch eine Argu-mentation, die einen ‚Fehler‘ als ästhetisch unerheblich erweist.
Damit lassen sich die zentralen Gewinne des Aristotelischen Lehrwerks knapp bilanzieren: Die durch das Prinzip der fortlaufende Unterscheidung ge-wonnenen Beobachtungsperspektiven sind Ergebnis wie Katalysator von regel-haften Umgangsformen, mit und in denen sich (instutionell auf Dauer gestellte und also professionalisierte) Praxisformen ausbilden können. Sie treiben zu-gleich Regularien von Spielzügen innerhalb dieser Praktiken hervor – in dem sie limitierende und spezifizierende Imperative für mögliche Operationen formulie-ren. Die Anschlüsse an diese Vorleistungen waren vielfältig – was nun am exemplarischen Fall zu zeigen ist.
3. „Erkennen des Erkannten“. August Boeckhs „Encyklopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften“
Als im April 1809 der klassische Philologe Friedrich Creuzer einem Ruf nach Leiden folgt und die Universität Heidelberg verlässt (um aber schon im Oktober an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren), nutzt der zu diesem Zeitpunkt gerade erst 23jährige August Böckh diese Chance. Der Schüler des berühmten Hallenser Philologen Friedrich August Wolf und Freund Schleiermachers war erst 1807 auf ein Extraordinariat an Creuzers Seminar berufen worden und er-hielt zwei Jahre später die ordentliche Professur. Nun kündigt er zum Sommer-semester 1809 unter dem Titel Encyclopaediam antiquitatis litterarum exponet easque recte tractandi viam ac rationem monstrabit eine Vorlesung an, die er in insgesamt 26 Semestern bis zum Jahr 1865 vor insgesamt 1696 eingeschriebenen Hörern wiederholen wird. Die materiale Grundlage dieser wirkungsmächtigen Lektionen, die er nach Berufung an die neu gegründete Berliner Universität ab 1811 auch in der preußischen Hauptstadt halten soll, ist ein 1809 niederge-schriebenes Heft mit dem „in Einem Zuge entworfenen Grundriss seines Sys-tems“, das mit Randbemerkungen und Einlagen ergänzt sowie mit Hilfe von Vorlesungsnachschriften schließlich postum zusammengefasst und als Enzyklo-pädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften ediert wird. 28
Diese Edition sollte „im Sinne Boeckh’s vor Allem ein Handbuch für die akademische Jugend“ sein.29 Die Wirkungen blieben nicht aus. Boeckhs Konzep-tion einer umfassenden Philologie als dem „Erkennen des vom menschlichen Geist Producirten, d. h. des Erkannten“30 beeinflusste das Selbstverständnis der deutschen Geisteswissenschaften nachhaltig; Rezeptionszeugnisse finden sich
28 Ernst Bratuschek: Vorwort, in: August Boeckh: Encyklopädie und Methodologie der philo-
logischen Wissenschaften, hg. von Ernst Bratuschek. Leipzig 1877, S. III. 29 So der sorgfältige Editor Ernst Bratuschek, ebd., S. V. 30 Boeckh: Encyklopädie und Methodologie (wie Anm. 28), S. 10.
21
bei Wilhelm Dilthey, Georg Simmel, Max Scheler und noch bei Hans Georg Gadamer.
Ausgangspunkt dieses Lehrwerks ist die Situation eines Faches im Um-bruch. Denn die Philologie hatte trotz beeindruckender Leistungen früherer Generationen eine eigentliche disziplinäre Identität noch nicht gefunden; im Fä-cherkanon der frühneuzeitlichen Universität mit Theologie, Jura, Medizin war sie ebenso wenig fest verankert wie im Trivium (Grammatik, Dialektik, Rheto-rik) und im Quadrivium (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik). Auch wenn vielleicht gerade dieser Verzicht auf eine ausgeprägte Kontur den Erfolg philologischer Arbeitsformen gewährleistet hatte, wurde im Zuge der epistemi-schen und institutionellen Umstellungen um 1800 eine Neuausrichtung not-wendig. Dabei erwies sich gerade der Erfolg von Einzelakteuren wie Richard Bentley oder Friedrich August Wolf als hinderlich für die weitere Entfaltung ei-ner Disziplin, die auf Wachstum umstellte und ihre Inhalte lehr- und lernbar machen musste: Wenn die Philologie zur Leitwissenschaft der historischen Dis-ziplinen berufen war, erwies sich die Bestimmung eines umfassenden systemati-schen Regelwerks als unumgänglich.31
In dieser Situation platziert August Boeckh sein Lehrwerk. Und zwar mit durchaus programmatischem Charakter. Er vermisst das gesamte theoretische und praktische Feld der Philologie und liefert die grundlegenden Bestimmungen neuer bzw. erweiterter Textumgangsformen. Zum einen definiert er den Gegen-standsbereich neu; zum anderen formuliert er ein umfassendes Regelwerks im Umgang mit den neu reflektierten Arbeitsfeldern. Ähnlich aporetisch argumen-tierend wie die Platonischen Dialoge und geschult an der Aristotelischen Me-thode der fortlaufenden Unterscheidung nähert er sich zunächst dem Objektbereich der Philologie durch Ausschluss einseitiger bzw. ungenügender Bestimmungen: Philologie ist nicht Altertumsstudium, nicht nur Studium der Sprache oder der Literatur, nicht Polyhistorie. Auch in der Kritik geht die Idee der Philologie nicht auf. Zum Studium der Humanität trägt sie bei – aber es füllt sie nicht aus und kennzeichnet sie nur unmaßgeblich. Gegen nur aggregative, d.h. unzusammenhängende und beschränkende Auffassungen von Philologie zentriert Böckh die „eigentliche Aufgabe der Philologie“ neu. Sie ziele auf nicht weniger als auf das „Erkennen des vom menschlichen Geist Produzierten, das heißt des Erkannten“ – was die Philologie zur Grundlagenwissenschaft im Um-gang mit der Gesamtheit der intellektuellen Artefakte überhaupt macht: „Der Philologe muss ein naturphilosophisches Werk wie den platonischen Timaeos ebensogut verstehen und erklären können wie Aesops Fabeln oder eine griechi-sche Tragödie“, postuliert Boeckh und erklärt, die „ganze Geschichtsschrei-bung“ verfahre philologisch. Das gesprochene oder geschriebene Wort zu
31 Zu den Hintergründen prägnant und zahlreichen Literaturhinweisen Lutz Danneberg: Alt-
philologie, Theologie und die Genealogie der Literaturwissenschaft, in: Thomas Anz (Hg.): Handbuch Literaturwissenschaft, Bd. III: Literaturwissenschaft als Institution, Stutt-gart, Weimar 2007, S. 3-25.
22
erforschen, sei der „ursprünglichste philologische Trieb“; die Philologie er-scheint als „eine der ersten Bedingungen des Lebens, ein Element, welches in der tiefsten Menschennatur und in der Kette der Kultur als ein ursprüngliches aufge-funden wird“.32
Obwohl es an dieser Stelle verführerisch wäre, den ideengeschichtlichen Voraussetzungen und Konsequenzen dieses erweiterten Philologie-Begriffs nachzugehen, soll nach etwas Andrem gefragt werden. Denn die hier konzeptua-lisierten aktiven Leistungen in der „Erkenntnis des Erkannten“, in denen „mehr Produktion in der Reproduktion (liegt) als in mancher Philosophie, welche rein zu produzieren vermeint“,33 beruhen auf Regeln, die nähere Aufmerksamkeit verdienen. Dieses regelhafte Vorgehen will der lehrende Philologe August Boeckh vermitteln; und zwar durch die Verbindung der zwei Zentralbegriffe, die den Titel seines postum veröffentlichten Werkes prägen: durch „Enzyklopädie“ und „Methodologie“. Aufschlussreicherweise liefert Boeckh im vierten Ab-schnitt seiner Einleitung eine bezeichnende Reflexion zum „Verhältniss der Encyklopädie zur Methodik“. Hier erklärt er die enzyklopädischen Abschnitte seines Lehrwerks als Elemente zur Herstellung einer grundlegenden Ordnung („Die Encyklopädie gibt den Zusammenhang der Wissenschaft an; sie entwirft das Ganze mit grossen Strichen und Zügen“); und hier grenzt er das methodi-sche Vorgehen scharf von der Übersichtsdarstellung enzyklopädischen Zu-schnitts ab:
Wer aber eine Wissenschaft studiren will, kann unmöglich gleich auf das Ganze ausgehen. Die Encyklopädie kann auch nicht etwa dadurch eine Methodik vertreten, dass man die Disciplinen nach der encyklopädischen Ordnung studirt. Wäre dies möglich, so würde es doch zweckwidrig sein. Die Encyklopädie geht von den allgemeinsten Begriffen aus; der Studiren-de kann davon nicht ausgehen, sondern muss den entgegengesetzten Gang nehmen. Während die Encyklopädie das Einzelne aus dem Allgemeinen ableitet und erklärt, muss der Studirende gerade erst das Einzelne als Basis und Stoff der Ideen kennen lernen , und kann erst von hier aus zu dem Allgemeinen aufsteigen, wenn er wirklich die Wissenschaft sich selbst bil-den, nicht blos anlernen will.
Die „Vertiefung in das Einzelne“ ist ein erster zentraler Hinweis auf die metho-dischen Prinzipien, die im ersten Hauptteil („Formale Theorie der philologi-schen Wissenschaft“) vermittelt werden. Sie finden sich – auch typograhisch 32 Alle Zitate Boeckh: Encyklopädie und Methodologie (wie Anm. 28), S. 10f. 33 Ebd., S. 14., Orthographie im Original: ebd. „In Wahrheit hat die Philologie einen höheren
Zweck; er liegt in der historischen Construction des ganzen Erkennens und seiner Theile und in dem Erkennen der Ideen, die in demselben ausgeprägt sind. Hier ist mehr Produc-tion in der Reproduction als in mancher Philosophie, welche rein zu produciren vermeint; auch in der Philologie ist das productive Vermögen eben die Hauptsache, ohne dasselbe kann man nichts wahrhaft reproduciren, und dass die Reproduction ein grosser Fortschritt und eine wahre Vermehrung des wissenschaftlichen Capitals ist, zeigt schon die Erfah-rung.“
23
besonders markiert – in den Abschnitten „Methodologischer Zusatz“, die jedem Kapitel des ersten Abschnitts („Theorie der Hermeneutik“) angeschlossen sind. Darstellungstechnisch umgesetzt wird diese Verbindung in einer Abfolge, die zuerst die Varianten der Interpretation („Grammatische Interpretation“ und „Historische Interpretation“, „Individuelle Interpretation“ und „Generische In-terpretation“) erläutert und danach Hinweise auf die Applikation der theoretisch eingeführten Termini und Verfahren gibt.
Die Gesamtheit der so vermittelten Regeln des Verstehens kann an dieser Stelle nicht diskutiert werden. Hinzuweisen ist jedoch auf Boeckhs didaktische Reflexionen zum Verhältnis von Regel und Regelanwendung, die ein zentrales Problem des interpretativen Umgangs mit Texten betreffen. Sie gehen von der (auch durch Schleiermacher und seine romantischen Freunde mehrfach ausge-sprochenen) Überzeugung aus, dass eine „mechanische Anwendung hermeneuti-scher Vorschriften“ kaum produktive Textumgangsformen gewährleiste; vielmehr müssten „die Regeln, deren man sich beim Auslegen selbst lebendig bewusst wird, durch Uebung so geläufig werden, dass man sie bewusstlos beo-bachtet, und sich doch zugleich zu einer bewussten Theorie zusammenschlies-sen, welche allein die Sicherheit der demonstrativen Auslegung verbürgt“.34 Ergebnis dieser Kombination aus „bewusstlosem“ und zugleich theoretisch ver-siertem Tun ist jene besondere Praxis der Auslegung, die noch Wilhelm Dilthey als „kunstmäßig“ deklariert und von Boeckh mit vielsagenden (und in der Zeit vielfach gebrauchten) Begriffen konzeptualisiert wird: „Bei dem ächten herme-neutischen Künstler wird diese Theorie selbst in das Gefühl aufgenommen und es entsteht so der richtige Takt, der vor spitzfindigen Deuteleien bewahrt.“35 Es ist kaum ein Zufall, dass unmittelbar nach dieser Passage die hermeneutische Maxime des Besserverstehens eingeführt wird, die gleichfalls eine längere Vorge-schichte hat. Von nachhaltiger Bedeutung für die regulativen Instruktionsleis-tungen ist freilich die Verknüpfung dieses zentralen Imperativs der Hermeneutik mit einer Reflexion von Stopp-Regeln der Interpretation. Denn das Lehrwerk des August Boeckh fixiert nicht nur die Forderungen nach einer nomologischen Kenntnis der handlungsleitenden Regeln beim Verfassen von Texten und damit verbundene Einsichten in die gleichsam hinter dem Rücken des Autors ablau-fenden Gesetzmäßigkeiten, sondern er legt auch Kriterien für Varianten des Missverstehens und der Überinterpretation fest:
Der Schriftsteller componirt nach den Gesetzen der Grammatik und Stilis-tik, aber meist nur bewusstlos. Der Erklärer dagegen kann nicht vollstän-dig erklären ohne sich jener Gesetze bewusst zu werden; denn der Verstehende reflectirt ja; der Autor producirt, er reflectirt nur dann über sein Werk, wenn er selbst wieder gleichsam als Ausleger über demselben steht. Hieraus folgt, dass der Ausleger den Autor nicht nur eben so gut,
34 Ebd., S. 87. 35 Ebd.
24
sondern sogar besser noch verstehen muss als er sich selbst. Denn der Ausleger muss sich das, was der Autor bewusstlos geschaffen hat, zu kla-rem Bewusstsein bringen, und hierbei werden sich ihm alsdann auch man-che Dinge eröffnen, manche Aussichten aufschliessen, welche dem Autor selbst fremd gewesen sind. Auch dieses objectiv Darinliegende muss der Ausleger kennen, aber er muss es von dem Sinne des Autors selbst als et-was Subjectivem unterscheiden; sonst legt er, wie die allegorische Erklä-rung im Platon, die Erklärung der Alten im Homer und sehr vieler Ausleger im Neuen Testament ein, statt aus; es findet also dann ein quan-titatives Missverstehen statt, mau versteht zu viel. Dies ist ebenso fehler-haft wie das Gegentheil, der quantitative Mangel an Verständniss, welcher eintritt, wenn man den Sinn des Autors nicht völlig auffasst, wenn man al-so zu wenig versteht. Ausserdem kann man qualitativ missverstehen; dies geschieht, wenn man etwas anderes versteht, als der Autor meint, also die Vorstellungen desselben mit andern verwechselt, was auch besonders bei der allegorischen Erklärung, z. B. bei falscher Auslegung einer vorhande-nen Allegorie stattfindet.36
Das längere Zitat ist gerechtfertigt, denn es belegt die intrikaten Probleme im Umgang mit den Initialisierungs- und den Stopp-Regeln bei Interpretationen. Ihre Dimensionen können freilich nur angedeutet werden. Immens vorausset-zungsreich ist etwa schon die Forderung, das, „was der Autor bewusstlos ge-schaffen hat, zu klarem Bewusstsein (zu) bringen“ und das „objectiv Darinliegende“ zugleich „von dem Sinne des Autors selbst als etwas Subjectivem (zu) unterscheiden“. Denn diese Verstehensnorm beruht auf kontrafaktischen Imaginationen, die einen komplexen Interpretationsvorgang leiten und dazu den Umgang mit Wissen von und aus Texten auf komplexe Weise regulieren. Um nämlich diese Leistungen vollbringen zu können, muss der Philologe etwas er-werben und zugleich etwas aufgeben: Zum einen hat er – in nicht selten aufwen-digen Verfahren – Erfahrungs- und Wissensbestände zu akkumulieren, die sowohl dem historischen Autor und seinen Zeitgenossen als auch späteren In-terpreten zugänglich waren; zum anderen hat er diese Kenntnisse und seine ei-genen, aus der retrospektiven Position erwachsenden Informationsüberschüsse zu kontrollieren, um ungerechtfertigte Anachronismen zu vermeiden und ver-stellende Zuschreibungen auszuschließen. Nur auf diese methodisch regulierte Weise lassen sich kognitive Asymmetrien verringern und Varianten historischer Zeitgenossenschaft herstellen – die aber stets auf einer simulativen Rezeptions-haltung beruhen.37 Hier nur anzumerken bleibt, dass Boeckh nicht der Urheber dieser Interpretationsmaximen ist: Sie wurzeln in dem im Rahmen der interpreta-
36 Ebd., S. 87f. 37 Später wird dieser Imperativ reformuliert durch Wilhelm Dilthey: Die Entstehung der
Hermeneutik (1900): Indem der Interpret seine „eigne Lebendigkeit gleichsam probierend in ein historisches Milieu versetzt“, ist er in der Lage „von hier aus momentan die einen Seelenvorgänge zu betonen und zu verstärken, die anderen zurücktreten zu lassen und so eine Nachbildung fremden Lebens in sich herbeizuführen.“
25
tio grammatico-historica ausgebildeten Konzept eines sensus auctoris et primorum lectorum (auditorum), das die einem Text zuschreibbaren Bedeutungen auf die Sinnhorizonte beschränkt, die historischen Adressaten prinzipiell mitteilbar und verständlich gewesen waren. In der Neuzeit findet sich diese Interpretationsre-gel unter anderem bei Boecks akademischem Lehrer Friedrich August Wolf, der mit den 1795 veröffentlichten Prolegomena ad Homerum die moderne Homer-Kritik einleitete: „Was erforderlich ist, dass man bei der Erklärung eines jeden Schriftstellers, sich in das ganze Zeitalter und in eine Reihe von Dingen versetzt und auch im Stande ist, sich in den Kreis zu versetzen, worin die Verfasser schrieben.“38 Ähnlich formuliert es sein Schüler an anderer Stelle. Der „Sinn ei-ner Mittheilung“ sei bedingt durch die „realen Verhältnisse“, unter denen diese erfolgt und „deren Kenntnisse bei denjenigen vorausgesetzt wird, an welche sie gerichtet sind. Um eine Mittheilung zu verstehen, muss man sich in diese Ver-hältnisse hineinversetzen“,39 heißt bei Boeckh vor der Formulierung eines Impe-rativs, der als „sehr wichtiger Kanon der Auslegung“ hervorgehoben und typographisch besonders markiert ist: „man erkläre nichts so, wie es kein Zeit-genosse könnte verstanden haben“.40
Auch wenn hier nur ein sehr kursorischer Blick auf das einflussreiche Lehr-werk der klassischen Philologie geworfen werden konnte, sollte doch klar ge-worden sein, welche Prinzipien der Regel und der Regelanwendung sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts – nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Formie-rung der modernen Forschungsuniversität Humboldt’scher Prägung – ausbilden und verstetigen. Die grundlegenden Einführungswerke erbringen dabei einen kaum zu überschätzenden Beitrag: Sie ermöglichen und sichern das Sprachspiel Wissenschaft, in dem sie den Novizen ebenso wie den etablierten Angehörigen klar und deutlich machen, was auf dem Spiel steht. Im Fall der sich modernisie-renden Altphilologie und der sich konstituierenden Neuphilologien zeigen sie, wie sich ihre Textumgangsformen von anderen möglichen Praktiken unterschei-det: durch Fragestellungen und Argumente, regelgeleitete Verfahren und sys-tematisch strukturierte Lösungsangebote. Indem sie diese Arbeitsformen auf der Basis fortgesetzter Investition von Zeit und Aufmerksamkeit vorführen und einüben, ermöglichen Lehrwerke den Gewinn eines Wissens über Literatur, das sich von anderen Wissensformen unterscheidet. Grundlegend dafür sind Verhal-tensformen, die etwas sichtbar und kommunizierbar machen, was sonst überse-hen wird: kleinste Details eines Textes und abgelegene Kontextelemente, Sprachstufen und Schreibvarianten. Die tendenziell selektionslose Sensitivität der Philologie und ihre auf lang anhaltenden Kontakt mit dem Beobachtungsge-genstand angelegten Einstellungen vermögen so Eigenschaften zu entdecken, die anderen Textumgangsformen verschlossen bleiben; sie können historische Vor-
38 Friedrich August Wolf: Vorlesung über die Encyklopädie der Alterthumswissenschaft [1798],
hg. von J. D. Gürtler, Leipzig 1839, S. 283. 39 Boeckh: Encyklopädie und Methodologie (wie Anm. 28), S. 82. 40 Ebd., S. 106; Hervorhebung im Original.
26
urteile überwinden und Grenzen des Horizonts erweitern. Damit sind wissen-schaftliche Bearbeitungsweisen von Literatur (und auch die sie ermöglichenden Lehrwerke) stets abhängig von Ressourcenzuteilungen und öffentlicher Akzep-tanz. Um in dieser Situation überzeugend wirken und wissenschaftlich (bzw. so-gar kulturell) relevant in Erscheinung treten zu können, müssen Lehrwerke Ein-Einstellungen und Regeln ebenso vermitteln wie strukturelle Fähigkeiten zur Entfaltung und Lösung von Problemen und Zusammenhängen – und den Studie-renden also (exemplarisch) zu zeigen, warum es sich lohnt, Begriffe und Schritt-folgen zu erlernen und anzuwenden.
***
Im Sommersemester 1919 bietet Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff an der Berliner Friedrich-Wilhlems-Universität seine Vorlesung „Einführung in die Philologie“ an, die sein Schüler Wolfgang Schadewaldt als Apophtegma mit-schreibt und später publiziert. Als der berühmte Philologe auf die besondere Be-deutung der Interpretation zu sprechen kommt, erklärt er den Studierenden die Relevanz der vielgepriesenen „philologischen Methode“:
Da kommen die Herren Harnack und Roethe zu mir und sagen: ‚Ja, Sie sind fein raus, Sie haben die ‚Philologische Methode‘! – Aber diese geprie-sene ‚Philologische Methode‘: die gibt’s doch gar nicht, die gibt es so we-nig, wie eine Methode, Fische zu fangen. Der Wal wird harpuniert, der Hering im Netz gefangen. Der Butt wird getreten, der Lachs wird ge-spießt, die Forelle geangelt. Wo bleibt da die Methode, Fische zu fangen? – Und überhaupt die Jägerei! Vielleicht gibt’s da so etwas wie eine Metho-de. Aber, meine Damen und Herren (mit schalkhaft blitzenden Augen): es ist doch schließlich ein Unterschied, ob man Löwen jagt oder Flöhe fängt.41
Wenn unter erfolgreichen Methoden angemessen angewendete Regelsysteme verstanden werden können, dürfte klar sein, welche Leistung die regulierten In-struktionen von Lehrwerken zu erbringen haben: Sie machen uns nicht nur den Unterschied zwischen Wal und Hering, Butt und Lachs klar, sondern zeigen auch, was Harpune und Netz, Spieß und Angel sind. Die Anwendung dieser Ge-rätschaften aber muss geübt werden – denn es ist noch nichts gefangen, wenn die Regel bewusst ist und artikuliert werden kann. Dazu braucht es Zeit und Tole-ranz. Und Strukturen, die auch fehlerhafte Versuche tolerieren.
41 Wolfgang Schadewaldt: Die ‚philologische Methode‘. Ein Apophtegma von Ulrich von
Wilamowitz-Moellendorff niedergeschrieben für Wolfgang Schmid auf dessen Wunsch als Diskussionsbeitrag für eine Aussprache über die Philologische Interpretation, in: ders.: Hellas und Hesperien, Zürich, Stuttgart 21970, Bd. 2, S. 606-607.