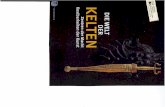Effets des cendres volantes sur le développement des résistances mécaniques des bétons préfabriqués
Die Stadt Mainz um 800 - Handelszentrum des Rhein-Main-Gebietes und Ausgangspunkt des Rhein-Donau...
Transcript of Die Stadt Mainz um 800 - Handelszentrum des Rhein-Main-Gebietes und Ausgangspunkt des Rhein-Donau...
Römisch-Germanisches ZentralmuseumForschungsinstitut für Archäologie
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Leibniz-Institut für Photonische Technologien
Universität Leipzig
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Sonderdruck aus MoSaikSteine – Forschungen amRömisch-Germanischen Zentralmuseum, Band 11
Peter Ettel · Falko Daim · Stefanie Berg-Hobohm Lukas Werther · Christoph Zielhofer (Hrsg.)
Großbaustelle 793Das Kanalprojekt Karls des Großen zwischen Rhein und Donau
Begleitbuch zur Ausstellung im Museum für Antike Schiffahrt des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz30. April 2014 bis 10. August 2014und in der Säulenhalle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in München1. September 2014 bis 12. Oktober 2014
Mit Beiträgen von
Stefanie Berg-Hobohm · Ronald Bockius · Jens Bussmann · Peter Ettel Dorothea Feiner · Carolin Haase · Achim Hack · Franz Herzig · André Kirchner Britta Kopecky-Hermanns · Ludger Körntgen · Christian Later · Eva Leitholdt Thomas Liebert · Sven Linzen · Michael Schneider · Mechthild Schulze-Dörrlamm Andreas Stele · Lukas Werther · Timm Weski · Andreas Wunschel · Christoph Zielhofer
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 2014
Redaktion: Lukas Werther, Christoph Zielhofer, Stefanie Berg-
Hobohm
Bildbearbeitung und Satz: Claudia Nickel (RGZM)
Umschlaggestaltung: Fuhrer Visuelle Gestaltung og, Wien,
und K. Hölzl (RGZM) unter Verwendung der Miniatur Bau der
Fossa Carolina (Bl. 20r) aus der Würzburger Bischofschronik
des Lorenz Fries (M. ch. f. 760) der Universitätsbibliothek
Würzburg
Bibliografische Information
der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliogra-
fische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de
abrufbar.
ISBN 978-3-88467-232-7
ISSN 1861-2938
© 2014 Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
Mainz.
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch
begrün de ten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des
Nach drucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funk- und
Fernsehsen dung, der Wiedergabe auf fotomechanischem
(Fotokopie, Mikro kopie) oder ähnlichem Wege und der Spei-
cherung in Daten ver arbeitungs anlagen, Ton- und Bild trägern
bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vor be halten.
Die Vergü tungs an sprüche des § 54, Abs. 2, UrhG. werden
durch die Verwer tungs gesellschaft Wort wahrgenommen.
Druck: betz-druck GmbH, Darmstadt
Printed in Germany
iii
Inhaltsverzeichnis
VII Vorwort Falko Daim
IX Prolog Stefanie Berg-Hobohm · Peter Ettel
Eva Leitholdt · Lukas Werther Christoph Zielhofer
1 Archäologische Forschungsgeschichte der Fossa Carolina
Stefanie Berg-Hobohm
5 Naturräumliche Gunstlage der Fossa Carolina
Christoph Zielhofer · André Kirchner
9 Das rezente Erscheinungsbild des Karlsgrabens
Stefanie Berg-Hobohm · Lukas Werther
13 Der Karlsgraben als Defensionslinie während des spanischen Erbfolge-krieges
Stefanie Berg-Hobohm
15 Durchbruch der europäischen Haupt wasserscheide. Der zentrale Bereich der Fossa Carolina – offene Wasserflächen und Verlandungsgeschichte
Eva Leitholdt · Christoph Zielhofer Jens Bussmann · Andreas Stele
21 Zum Bauplan der Fossa Carolina. Die Verschiebung der Wasserscheide als wasserbauliches konzept
Christoph Zielhofer · Eva Leitholdt
25 Staudamm und Stausee zur Regu-lierung des Wasserstands in der Fossa Carolina? Hinweise auf den holozänen Rezatverlauf
Stefanie Berg-Hobohm · Britta Kopecky-Hermanns
29 Der Karlsgraben im Fokus der Geophysik
Sven Linzen · Michael Schneider
33 Der Karlsgraben im Fokus der Archäologie
Lukas Werther · Dorothea Feiner
41 Der Karlsgraben im Fokus der Dendroarchäologie
Franz Herzig · Lukas Werther
45 Siedlungsentwicklung und Kultur-landschaft im Umfeld des Karlsgrabens
Lukas Werther
53 Der Bau des Karlsgrabens nach den Schriftquellen
Achim Hack
63 Das altmühltal als frühmittelalter-licher Siedlungs- und Wirtschaftsraum
Christian Later
67 Sicherung der Verkehrswege durch Burgen und Herrschaftszentren
Peter Ettel
73 Die frühmittelalterlichen Zentren Würzburg und Karlburg am Main
Peter Ettel · Andreas Wunschel
75 Die Stadt Mainz um 800. Handelszentrum des Rhein-Main-Gebietes und Ausgangs punkt des Rhein-Donau-Schifffahrtsweges
Mechthild Schulze-Dörrlamm
79 Regensburg – Metropole an der Donau
Peter Ettel · Andreas Wunschel
81 Binnenfahrzeuge im Karolingerreich Ronald Bockius
87 Künstliche Schifffahrtswege. Wasserbau und hydrotechnische Einrichtungen im Altertum
Ronald Bockius
95 kanalbau und künstliche Wasserführung im Frühmittelalter – eine ausnahme?
Lukas Werther
99 Frühmittelalterliche Uferverbaue und Stauvorrichtungen im südlichen Mittelfranken
Thomas Liebert
iV
103 Schleuse oder Bootsrutsche? an-mer kungen zur Überwindung von Staustufen
Timm Weski
105 Schiffsreisende im frühen Mittelalter Achim Hack
107 Was »Karl« geladen hatte. Trans-portgüter auf frühmittelalterlichen Wasserwegen anhand der Schriftquellengattung Urbar
Carolin Haase
111 Gütertransport auf Binnengewässern im Fokus der Archäologie
Andreas Wunschel
113 Der Karlsgraben im Rahmen von Königs herrschaft und Kaisertum Karls des Großen
Ludger Körntgen
121 Literatur
129 Verzeichnis der autorinnen und autoren
75
Die Stadt Mainz um 800Handelszentrum des Rhein-Main-Gebietes und Ausgangs punkt des Rhein-Donau-Schifffahrtsweges
Mechthild Schulze-Dörrlamm
Zur Regierungszeit Karls des Großen war Mainz die einzige Stadt im gesamten Rhein-Main-Ge-biet und das Handelszentrum dieses landwirt-schaftlich geprägten Großraumes. Wiesbaden sowie Darmstadt existierten damals noch nicht, und der Königshof Frankfurt am Main sollte erst unter Ludwig dem Frommen (814-840) zur Pfalz ausgebaut werden. Zu den Vorzügen von Mainz zählten der Schutz, den ihr die gut erhaltenen Stadtmauern aus der Römerzeit boten und ihre verkehrsgünstige Lage am Rhein gegenüber der Mündung des Mains – den zwei wichtigs-ten Schifffahrtswegen damaliger Zeit. Auf die Stadt liefen außerdem mehrere Straßen zu, de-ren Nutzer hier den gefährlich breiten Strom an mehreren Stellen überqueren konnten. Fähren bei der alten Römerbrücke in Mainz setzten nach Kastel über, die Furt in Weisenau verband das linksrheinische mit dem rechtsrheinischen Gebiet südlich des Mains, und bei Biebrich konnte man entweder in den Rheingau oder zu den heißen Quellen in Wiesbaden und bis in die Wetterau gelangen. Durch das Projekt Karls des Großen von 793, den Rhein und die Donau mit einem Kanal zu verbinden, wäre Mainz auch zum westlichen Ausgangspunkt dieses langen, letztlich bis in den mittleren Donauraum und an die Nordgrenze des Byzantinischen Reiches füh-renden Wasserweges geworden. Als Herrscher hat Karl nicht nur die wirtschaft-liche Entwicklung, sondern auch die kirchliche Bedeutung der Stadt nach Kräften gefördert. Er bestimmte das Kloster St. Alban zum neu-en, geistigen Zentrum im Osten seines Reiches, als Gegengewicht zu dem berühmten Kloster Saint-Denis im Westen. Mit finanziellen Mitteln und einer besonders wertvollen, künstlerischen Ausstattung unterstützte er deshalb den Neu-bau der Klosterkirche (787-805). Diese blieb bis zum frühen 11. Jahrhundert die größte Kirche und der wichtigste Versammlungsort der Stadt. Während Karls Regierungszeit ist Mainz 782 ständiger Sitz eines Erzbistums und in der Fol-ge auch zum Metropolitansitz der flächenmäßig größten Kirchenprovinz der gesamten Christen-heit geworden.Der Versuch, ein Bild der Stadt Mainz in der Zeit um 800 zu entwerfen (Abb. 1), kann sich aus
Mangel an modernen, archäologischen For-schungen derzeit nur auf die Auswertung von Schriftquellen, einiger Altgrabungen des frühen 20. Jahrhunderts sowie von Einzelfunden stüt-zen und ist entsprechend hypothetisch. Fest steht, dass das von der Römermauer um-schlossene Stadtgebiet für die geschrumpfte
Abb. 1 Entwurf einer topographischen Karte von Mainz in der Zeit um 800. – (Graphik M. Weber, RGZM).
76
Einwohnerzahl der Karolingerzeit viel zu groß war. Allem Anschein nach konzentrierte sich die innerstädtische Besiedlung auf einen breiten Streifen entlang der Rheinufermauer im Osten. Große Teile der nördlichen und westlichen In-nenstadt wurden landwirtschaftlich genutzt. Dort könnten aber auch die Höfe der bedeu-tenden, ostfränkischen Adelsfamilien zu suchen sein. Zumindest lassen darauf die Standorte der adeligen Eigenkirchen St. Lambertus und St. Brigida sowie der zwei innerstädtischen Klöster schließen. Während das Udenmünster offenbar den Nantharen zu verdanken war, ist das Alt-münster von Bilhildis, der zweiten Gemahlin des Thüringerherzogs Hetan I., 691/694 als eines der ältesten Frauenklöster des Rheinlandes ge-gründet worden. Innerhalb des dicht bebauten Stadtzentrums zeichnet sich eine grobe Dreiteilung ab. Im Besitz des Erzbischofs befand sich der größte Teil der südlichen Innenstadt mit dem Bischofshof und der zugehörigen Kathedralgruppe. Dazu zählten drei Kirchen unterschiedlicher Funktion, die alle westlich des heutigen Domes im Bereich der Jo-hanniskirche gestanden hatten. Es handelte sich um den frühmittelalterlichen Dom St. Martin, die kleine Taufkirche St. Johannes Baptist sowie die Leutkirche St. Maria, in der Bischof Lullus 754 die Blutreliquie des erzbischöflichen Missionars und Märtyrers Bonifatius begraben ließ.Der nördliche Abschnitt der innerstädtischen Bebauungszone befand sich anscheinend in der
Hand des Königs. Wichtigstes Indiz dafür ist die mit Rankenreliefs verzierte Seitenlehne eines typischen Königthrones, die in der Stadioner-hofstrasse aufgefunden wurde (Abb. 2). Die soeben veröffentlichten Thesen, wonach das Kalksteinfragment ein unvollendetes Werkstück ohne historische Relevanz oder sogar nur eine römische Tischplatte gewesen sei, werde ich in Kürze widerlegen. Als Überrest eines Herrscher-thrones aus dem späten 8. Jahrhundert bezeugt dieser Fund vielmehr, dass Karl der Große da-mals in Mainz nicht nur Urkunden ausgestellt, sondern auch eine Königspfalz errichtet hatte. Diese lag auf dem höchsten, hochwasserfreien Gelände der Innenstadt nahe dem Rheinufer und zugleich an jener alten Straße, die direkt auf die Steinpfeiler der Römerbrücke zuführte. Die hölzernen Aufbauten der Brücke hat Karl erneuern lassen, um einen gefahrlosen Per-sonen- und Warenverkehr über den Strom zu ermöglichen. Nachdem sie aber schon bei der Fertigstellung 813 abgebrannt waren und der Kaiser bald darauf (28. Januar 814) verstarb, ist in Mainz Jahrhunderte lang keine neue Rhein-brücke mehr erbaut worden.Über Struktur und Ausdehnung der Mainzer Königspfalz lassen sich derzeit keine konkre-ten Angaben machen. Die Voraussetzung dafür böte nur eine großflächige Forschungsgrabung, die nicht nur dringend nötig, sondern innerhalb der Kirchenruine St. Christoph und in ihrem un-bebauten Vorgelände auch durchaus möglich wäre. Da St. Christoph als Eigenkirche des Kö-nigs gilt, deren Pfarrbezirk aus dem 9. Jahrhun-dert stammen soll, dürften dessen Grenzen die Lage und den Umfang des karolingischen Kö-nigsgutbezirks und somit auch der Pfalz anzei-gen. Aller Erfahrung nach muss die Anlage aus mindestens einem Steingebäude bestanden ha-ben, das sowohl ein Neubau als auch ein reno-vierter Baukomplex aus der Römerzeit gewesen sein kann. In der Nähe dürfte auch die Mainzer Münzstätte gestanden haben, in der Karl der Große seit der Münzreform von 793/794 seine schweren Denare prägen ließ. Im Siedlungsbereich zwischen dem Dombezirk im Süden und der Königspfalz im Norden stan-den die Häuser der wohlhabenden Kaufleute und der teilweise aus Friesland stammenden Fernhändler, die sich um ihre Pfarrkirche St. Quintin scharten. Auf dem schmalen Ufer-streifen vor der römischen Stadtmauer hatten außer Handwerkern sicher auch Rheinschiffer und Fischer ihre Holzbauten errichtet, weil sie dort ihre Boote überall an das flache Ufer zie-hen konnten. Reste dieser Einstraßensiedlung sind bei Ausgrabungen »Am Brand« und in der
Abb. 2 Rekonstruktion des karolingischen Königthrons aus drei Kalksteinplatten, dessen linke Seitenlehne in der Mainzer Stadionerhof-straße aufgefunden wurde. – H. der Lehne 74 cm. GDKE Landesmuseum Mainz. – (Graphik J. Ribbeck, RGZM).
77
Löhrstraße zwar erfasst, aber nur unzureichend oder gar nicht erforscht worden. Immerhin konnten »Am Brand« mehrfach die Reste einer Befestigung aus Eichenpfählen als Beweis dafür freigelegt werden, dass diese Rheinufersiedlung vom mittleren 7. Jahrhundert bis frühen 8. Jahr-hundert mit einer Holz-Erde-Mauer (?) gesichert worden war. Funde von Halbfabrikaten und Fertigprodukten aus Buntmetall belegen, dass am Rheinufer im späten 8. bis frühen 9. Jahrhundert Werkstät-ten standen, in denen vor allem preiswerter Kleidungsschmuck für die einfache Bevölkerung der Stadt und des Umlandes produziert wurde. Hergestellt hat man dort nachweislich auch ver-
goldete Bronzegüsse mit Tierornamenten im sog. Tassilokelchstil, das typische Tracht- und Reitzubehör von mutmaßlich adeligen Kriegern. Teile ihrer wertvollen Ausrüstung – Schwerter, Flügellanzen, Sporen und Steigbügel (Abb. 3-4) – wurden mehrfach aus dem Rhein gebaggert. Die meisten Güter, mit denen die Mainzer han-delten, bestanden aus organischen Materialien und sind deshalb spurlos vergangen. Nachwei-sen kann man jedoch ihren blühenden Wein-handel mit dem Rheinmündungsgebiet, weil man die hölzernen Weinfässer aus Rheinhessen in Dorestad (NL) als Brunnenfassungen weiter-verwendet hat. Zusätzliche Hinweise liefern die Verbreitungsbilder von Gegenständen aus Ke-ramik, Glas, Bein und Metall, wie der dekora-tiven Bronzeschlüssel mit großem, kreuzverzier-ten Ovalgriff. Sie scheinen in Mainz hergestellt (Abb. 5) und überwiegend im Rheinland ver-kauft worden zu sein, sind aber auch über das Rheinmündungsgebiet hinaus bis nach London und vereinzelt sogar bis nach Südskandinavien gelangt. Am besten spiegelt sich der Handel mit den Ländern im Norden (Friesland, Angelsach-sen), Osten (Franken, Oberfranken) und Süden (Oberrheingebiet, Bodenseeraum, Italien) in zahlreichen Silbermünzen unterschiedlichster Herkunft, die in Mainz zutage gekommen sind. Eine besonders aufschlussreiche Quelle für die Handelsgeschichte stellt der größte Münzschatz karolingischer Zeit mit einem Gewicht von 8-10 kg dar, der zwischen 795 und 800 in einem Lederbeutel am Rheinufer in Biebrich vergraben worden ist. Unter den Tausenden Denaren be-fand sich sogar ein 790/791 in Nordafrika (Tunis)
Abb. 3 Aus dem Rhein bei Mainz: Sporenpaar der zwei-ten Hälfte des 8. Jahrhun-derts aus vergoldeter Bronze mit Tierornamenten im sog. Tassilokelchstil. GDKE Lan-desmuseum Mainz. – (Foto © GDKE Landesmuseum Mainz, U. Rudischer). – H. 14,2 cm.
Abb. 4 Aus dem Rhein bei Mainz: eiserner Steigbügel der zweiten Hälfte des 8. Jahr hunderts mit einer Streifentauschierung aus Messing. GDKE Landesmuse-um Mainz. – (Foto © GDKE Landesmuseum Mainz, U. Rudischer). – H. 17 cm.
Abb. 5 Bronzener Dreh-schlüssel des 8./9. Jahrhun-derts aus Mainz, dessen großer, durchbrochener Ovalgriff mit einem gleich-armigen Kreuz verziert ist. RGZM. – (Foto V. Iserhardt, RGZM). – H. 11 cm.
78
geprägter Dirham des Kalifen Harun al-Raschid, der wohl beim Transport seines Elefanten Abul Abbas zur Aache ner Kaiserpfalz auf dem Rhein bis hierher gelangt war. Auch andere Personen, die aus der Fremde nach Mainz gekommen und zum Teil für immer in der Stadt geblieben sind, haben archäologi-sche Spuren hinterlassen. Dabei handelt es sich zumeist um Gegenstände angelsächsischer Her-kunft, die von Missionaren oder von Pilgern auf ihrer Reise nach Rom, aber vielleicht auch von
Fernhändlern mitgebracht worden sein könn-ten. Einzigartig ist ein kunstvoll aus Bronze gegosse-ner Drehschlüssel mit einem Ringgriff, auf dem sich zwei Raubtiere drohend gegenüberstehen (Abb. 6). Ihre Schwänze in Gestalt eines großen Schlangenkopfes beißen in den Schaft mit fünf-eckigem Bart und drei Zinken. Da der Schlüssel wegen dieser schräg zur Mitte geneigten Zinken gar nicht funktionsfähig war, hatte er vermut-lich einer wohlhabenden Frau als dekoratives Schmuckstück oder Unheil abwehrendes Amu-lett gedient.Zu den wertvollsten Schmuckstücken aus Mainz zählt ein Goldfingerring, dessen gewölb-te Kopfscheibe mit dem Profilkopf Christi im Kreuz sowie vier kauernden Einzeltieren im sog. »Trewhiddlestil« des späten 8. bis 9. Jahrhun-derts verziert ist (Abb. 7). Er muss einer bedeu-tenden Persönlichkeit gehört haben, womög-lich einem jener hochrangigen Geistlichen, die seit der Karolingerzeit die Geschicke der Stadt maßgeblich mitbestimmt haben.
Abb. 6 In Main z gefun-dener Drehschlüssel des 8.-9. Jahr hunderts aus Bronze guss mit einem hohlen Ringgriff, auf dem sich zwei vollplastische Raubtiere mit schlangenköp-figen Schwänzen drohend gegenüberstehen. Die Augen aller Tierköpfe waren mit blauen Glas einlagen verziert. RGZM. – (Graphik M. Weber, RGZM). – H. 7 cm.
Abb. 7 Goldfingerring des späten 8. bis 9. Jahrhunderts aus Mainz, dessen gewölbte Kopfscheibe mit nielliertem Kreuzdekor im angelsächsi-schen »Trewhiddle stil« verziert ist. RGZM. – (Foto V. Iserhardt, RGZM; Zeichnung L. Linden-schmit, RGZM). – H. 2,4 cm.
121
Literatur
AllgemeINe uND IN verSchIeDeNeN BeIträgeN zItIerte lIterAtur
F. Beck, Der Karlsgraben. Eine historische, topo-graphische und kritische Abhandlung (Nürn-berg 1911).
S. Berg-Hobohm / B. Kopecky-Herrmanns, Na-turwissenschaftliche Untersuchungen in der Umgebung des Karlsgrabens (Fossa Carolina). Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 52, 2012, 403-418.
R. Berndt (Hrsg.), Das Frankfurter Konzil von 794. Kristallisationspunkt karolingischer Kul-tur. Akten zweier Symposien (vom 23. bis 27. Februar und vom 13. bis 15. Oktober 1994) anläßlich der 1200-Jahrfeier der Stadt Frank-furt am Main. Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 80 (Mainz 1997).
W. Czysz, Die ältesten Wassermühlen. Archäo-logische Entdeckungen im Paartal bei Dasing (Thierhaupten 1998).
J. A. Döderlein, Fossa Caroli Magni prope Weis-senburg Noricarum a peregrinantibus conspici-enda. Fol. 2 Bog. (Weissenburg 1705).
M. Eckoldt, Schiffahrt auf kleineren Flüssen Mitteleuropas in Römerzeit und Mittelalter. Schriften des Deuschen Schiffahrtsmuseums 14 (Oldenburg, Hamburg, München 1980).
G. Eggenstein u. a. (Hrsg.), Eine Welt in Bewe-gung. Unterwegs zu Zentren des frühen Mittel-alters [Ausstellungskat. Paderborn, Würzburg] (München 2008).
D. Ellmers, Frühmittelalterliche Handelsschiff-fahrt in Mittel- und Nordeuropa. Offa-Bücher N. F. 28 (Neumünster 1972).
K. Elmshäuser, Kanalbau und technische Was-serführung im Mittelalter. Technikgeschichte 59, 1992, 1-26.
K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasser-wege. Zur Schiffahrt des Mittelalters. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 58 (Ham-burg 2002).
K. Elmshäuser, Facit Navigium. Schiffahrt auf Seine, Marne, Mosel und Rhein in Quellen zur frühmittelalterlichen Grundherrschaft. In: K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasser-wege. Zur Schiffahrt des Mittelalters. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 58 (Ham-burg 2002) 22-53.
P. Ettel, Karlburg – Roßtal – Oberammerthal. Studien zum frühmittelalterlichen Burgenbau in Nordbayern. Frühgeschichtliche und provin-zialrömische Archäologie. Materialien und For-schungen 5 (Rahden / Westf. 2001).
P. Ettel, Der frühmittelalterliche Zentralort Karl-burg am Main mit Königshof, Marienkloster und zwei Burgen in karolingisch-ottonischer Zeit. In: J. Macháček / Š. Ungerman (Hrsg.), Früh geschichtliche Zentralorte in Mitteleuropa. Internationale Konferenz und Kolleg der Alex-ander-von-Humboldt-Stiftung zum 50. Jahres-tag des Beginns archäologischer Ausgrabungen in Pohansko bei Břeclav, 5.-9.10.2009. Studien
zur Archäologie Europas 14 (Bonn 2011) 459-478.
P. Ettel, Der Main als Kommunikations- und Handelsweg im Frühmittelalter – Fossa Caroli-na, Burgen, Königshöfe und der überregiona-le Handelsplatz Karlburg. In: F. Bittmann u. a. (Hrsg.), Flüsse als Kommunikations- und Han-delswege. Marschenratskolloquium 2009, 5.-7. November 2009, Deutsches Schiffahrtsmuse-um, Bremerhaven. Siedlungs- und Küstenfor-schung im südlichen Nordseegebiet 34 (Rah-den / Westf. 2011) 201-226.
J. Fried, Karl der Große. Glaube und Gewalt. Eine Biographie (München 2013).
H. Grewe, Die Wasserversorgung der Kaiser-pfalz Ingelheim am Rhein im 8./9. Jahrhundert. In: M. Aufleger u. a. (Hrsg.), Wasser auf Burgen im Mittelalter. Geschichte der Wasserversor-gung 7 (Mainz 2007) 191-199.
K. Grewe, Der Karlsgraben bei Weißenburg i. B. und der Fulbert-Stollen von Maria Laach. Zwei große Wasserbauprojekte des Mittelalters in Deutschland. In: U. Lindgren (Hrsg.), Euro-päische Technik im Mittelalter 800 bis 1400. Tradition und Innovation. Ein Handbuch (Berlin 1996) 111-115.
K. Grewe, Water Technology in Medieval Ger-many. In: P. Squatriti (Hrsg.), Working with Water in Medieval Europe. Technology and Re-source-Use. Technology and Change in History 3 (Leiden, Boston, Köln 2000) 129-160.
K. Grewe, Tunnels and Canals. In: J. P. Oleson (Hrsg.), The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World (Oxford 2008) 319-336.
D. Hägermann, Karl der Große und die Schiff-fahrt. In: K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasserwege. Zur Schiffahrt des Mittelalters. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 58 (Hamburg 2002) 11-21.
M. Hardt, Die Donau als Verkehrs- und Kom-munikationsweg zwischen der ostfränkischen Residenz Regensburg und den Zentren an der mittleren Donau im 9. Jahrhundert. In: S. Freund / M. Hardt / P. Weigel (Hrsg.), Flüsse und Flusstäler als Wirtschafts- und Kommu-nikationswege. Siedlungsforschung 25 (Bonn 2007) 103-120.
P. Haupt, Die karolingische Wasserleitung bei Ingelheim, Kr. Mainz-Bingen. In: M. Aufleger u. a. (Hrsg.), Wasser auf Burgen im Mittelalter. Geschichte der Wasserversorgung 7 (Mainz 2007) 183-189.
H. H. Hofmann, Fossa Carolina. Versuch einer Zusammenschau. In: W. Braunfels (Hrsg.), Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben. 1: Per-sönlichkeit und Geschichte (Düsseldorf 1965) 437-453.
H. H. Hofmann, Kaiser Karls Kanalbau. »Wie Künig Carl der Große unterstünde die Donaw vnd den Rhein zusammenzugraben« (Sigmarin-gen 1969).
W. E. Keller, Karlsgraben. Naturpark Altmühl-tal. Reihe Gelbe Naturpark-Taschenbuch-Führer (Treuchtlingen 1986).
W. E. Keller, Der Karlsgraben – Fossa Carolina. 1200 Jahre Kanalbau vom Main zur Donau (Treuchtlingen 1993).
W. E. Keller / L. Schnabel, Vom Main zur Do-nau. 1200 Jahre Kanalbau in Bayern. Karlsgra-ben, Ludwig-Donau-Main-Kanal, Rhein-Main-Donau-Kanal (Bamberg 1984).
R. Koch (Hrsg.), Fossa Carolina – 1200 Jahre Karlsgraben. Denkmalpflege-Informationen D 19 (München 1993).
R. Koch, Neue Beobachtungen und Forschun-gen zum Karlsgraben. Jahrbuch des Histori-schen Vereins für Mittelfranken 1994/1995 (1996), 1-16.
R. Koch, Fossa Carolina. Neue Erkenntnisse zum Schiffahrtskanal Karls des Großen. In: K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasser-wege. Zur Schiffahrt des Mittelalters. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 58 (Ham-burg 2002) 54-70.
R. Koch, Probleme um den Karlsgraben. In: J. Ha berstroh / G. Riedel / B. Schönewald (Hrsg.), Bay ern und Ingolstadt in der Karolingerzeit. Bei-träge zur Geschichte Ingolstadts 5 (Ingolstadt 2008) 266-281.
R. Koch / G. Leininger (Hrsg.), Der Karlsgraben – Ergebnisse neuer Erkundungen (München 1993).
H.-J. Küster, Pollenanalytische Untersuchungen im Bereich des Karlsgrabens. Das Archäologi-sche Jahr in Bayern 1993 (1994), 135-138.
E. Leitholdt / A. Krüger / C. Zielhofer, The medi-eval Peat Layer of the Fossa Carolina – Evidence for bridging the Central European Watershed or climate control? Zeitschrift für Geomorpho-logie N. F. 58 Suppl. 1, 2014, 189-209.
E. Leitholdt / C. Zielhofer / S. Berg-Hobohm u. a., Fossa Carolina: The First Attempt to Bridge the Central European Watershed – A Review, New Findings, and Geoarchaeological Challenges. Geoarchaeology 27, 2012, 88-104.
R. Molkenthin, Straßen aus Wasser. Technische, wirtschaftliche und militärische Aspekte der Bin-nenschifffahrt im Westeuropa des frühen und hohen Mittelalters. Geschichte 68 (Berlin 2006).
J. F. Niermeyer / C. van de Kieft / J. W. J. Bur-gers, Mediae latinitatis lexicon minus. A-L (Darm-stadt ²2002).
S. Patzold, Ich und Karl der Große. Das Leben des Höflings Einhard (Stuttgart 2013).
W. D. Pecher, Der Karlsgraben. Wer grub ihn wirklich? Eine Streitschrift (Treuchtlingen 1993).
J. Röder, Fossatum Magnum – Der Kanal Karls des Großen. Berichte der Bayerischen Boden-denkmalpflege 15/16, 1974/1975 (1977), 121-130.
H. Schmidt-Kaler, Erläuterungen zur Geologi-schen Karte von Bayern 1:25000, Blatt 7031 Treuchtlingen (München 1976).
122
H. Schmidt-Kaler, Geologie und Landschafts-ent wicklung im Rezat-Altmühl-Bereich. In: R. Koch / G. Leininger (Hrsg.), Der Karlsgraben – Ergebnisse neuer Erkundungen (München 1993) 8-10.
M. Schulze-Dörrlamm, Mainz im 9. und 10. Jahr hundert. In: W. Wilhelmy (Hrsg.), Glanz der späten Karolinger. Hatto I. – Erzbischof von Mainz (891-913); von der Reichenau in den Mäuseturm [Ausstellungskat. Mainz]. Publika-tionen des Bischöflichen Dom- und Diözesan-museums Mainz 3 (Regensburg 2013) 88-107.
K. Schwarz, Der »Main-Donau-Kanal« Karls des Grossen. Eine topographische Studie. In: J. Werner (Hrsg.), Aus Bayerns Frühzeit. Fried-rich Wagner zum 75. Geburtstag. Schriftenrei-he zur bayerischen Landesgeschichte 62 (Mün-chen 1962) 321-328.
K. Schwarz, Führer zu bayerischen Vorge-schichts-Exkursionen. 1: Limes, Karlsgraben, Gelbe Bürg, Hesselberg im Raum Ansbach, Weissenburg, Dinkelsbühl (Kallmünz 1962).
K. Spindler (Hrsg.), Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland. 14: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Archäologie und Geschichte (Stuttgart 1987).
K. Spindler, Der Kanalbau Karls des Großen. Seine Reflexion in den mittelalterlichen Quellen und der aktuelle archäologische Forschungs-stand. In: K. Spindler (Hrsg.), Mensch und Natur im mittelalterlichen Europa. Archäologische, hi-storische und naturwissenschaftliche Befunde. Schriftenreihe der Akademie Friesach 4 (Kla-genfurt 1998) 47-99.
P. Squatriti, Digging Ditches in Early Medieval Europe. Past and Present 176, 2002, 11-65.
L. Werther, Mensch und Umwelt im Früh- und Hochmittelalter – Archäologische Forschungen im Schwarzachtal. Heimatkundliche Streifzüge. Schriftenreihe des Landkreises Roth 31, 2012, 80-86.
C. Westerdahl (Hrsg.), The significance of Por-tages. Proceedings of the first international conference on the significance of Portages, 29th Sept.-2nd Oct. 2004, in Lyngdal, Vest-Agder, Norway. BAR International Series 1499 (Oxford 2006).
C. Zielhofer / E. Leitholdt, Zeitliche Rekonstruk-tion der mittelalterlichen Weiherphasen im zentralen Grabenbereich der Fossa Carolina. In: P. Ettel / L. Werther (Hrsg.), Zentrale Orte und zentrale Räume des Frühmittelalters in Süd-deutschland. Tagung des RGZM und der Fried-rich-Schiller-Universität Jena vom 7.-9.10.2011 in Bad Neustadt an der Saale. RGZM – Tagun-gen 18 (Mainz 2013) 113-124.
SpezIelle lIterAtur Der eINzelBeIträge
Berg-Hobohm, Archäologische Forschungs-geschichte
A. Buchner, Reise auf der Teufels-Mauer: Eine Untersuchung über die Überbleibsel der Römi-schen Schutz-Anstalten im jenseits der Donau gelegenen Rhaetien; Nebst einer Abhandlung über den Carls-Kanal; Bruchstücke aus der baierischen Geschichte (Regensburg 1818) bes. 92-104.
A. A. C. Cammerer, Naturwunder, Orts- und Län der – Merkwürdigkeiten des Königreiches Bay ern: für Vaterlandsfreunde, so wie für kunst- und naturliebende Reisende (Kempten 1832) bes. 100-102.
G. Z. Haas, Dissertatio historica de danubii et rheni coniunctione a carolo magno tentata (Re-gensburg 1726).
J. D. Köhler / J. D. Tyroff, Fossa Caroli Magni ab Almoni in Radantiam pro Coniunctione Rheni et Danubii (Nürnberg 1765).
W. Pirckheimer, Germaniae ex variis scriptoribus perbrevis explicatio (Nürnberg 1632).
C. Redenbacher, Pappenheim und Ellingen, der Solenhofener Steinbruch und Fossa Carolina (München 1844).
Berg-Hobohm, Defen sionslinie
Oettinger, Handbuch des Pionierdienstes. 2, 1, 2. Th. 1. Abth. oder Vollständige Anleitung zur Feldbefestigung für Offiziere aller Waffen (1838).
K. F. Peschel, Die Kriegsbaukunst im Felde. Ein Leitfaden für den Unterricht in Militair-Schulen und als Handbuch für die Officiere aller Waffen (1832).
U. Troitzsch, Entfaltung von Macht und Pracht. In: W. König (Hrsg.), Propyläen Technikge-schichte. 3: Mechanisierung und Maschinisie-rung; 1600 bis 1840 (Berlin 1997) 218-248.
F. Willax, Die Weißenburger Linie – 1704. 1. Teil. Villa nostra. Beiträge zur Weißenburger Stadt-geschichte 8, 1977, 73-84.
F. Willax, Die Weißenburger Linie – 1704. 2. Teil. Villa nostra. Beiträge zur Weißenburger Stadt-geschichte 9, 1978, 85-92.
Leitholdt · Zielhofer · Bussmann · Stele, Durch-bruch der hauptwasserscheide
H.-P. Blume / F. Scheffer / P. Schachtschabel (Hrsg.), Lehrbuch der Bodenkunde (Heidelberg u. a. 2002).
L. von Post, Das genetische System der orga-nogenen Bildungen Schwedens. Comité Inter-national de Pédologie, IVème Commission pour l’Europe 22, 1924, 287-304.
H. Sponagel (Hrsg.), Bodenkundliche Kartieran-leitung (Stuttgart 52005).
M. E. Tucker, Sedimentary Petrology. An Intro-duction to the Origin of Sedimentary Rocks (Malden, Mass. 32005).
Zielhofer · Leitholdt, Bauplan der Fossa Carolina
C. Zielhofer, Schutzfunktion der Grundwas-serüberdeckung im Karst der Mittleren Alt-mühlalb. Eichstätter Geographische Arbeiten 13 (München 2003).
C. Zielhofer, Hydrographical and hydrochem-ical characteristics of karst water components (southern Franconian Jura) – a contribution to fresh water protection and karst morphogene-sis. Zeitschrift für Geomorphologie N. F. Suppl. 136, 2004, 113-134.
C. Zielhofer u. a., Fossa Carolina: an Early Me-dieval canal for connecting European shipping
routes – Evidence for a summit canal as the fi-nal water engineering concept (in Vorb.).
Berg-Hobohm · Kopecky-Hermanns, Stau-damm und Stausee
P. M. Grootes, Untersuchungsergebnisse der 14C-Datierungen für das Bayerische Landes-amt für Denkmalpflege. Leibniz-Labor für Al-tersbestimmung und Isotopenforschung der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel [unpubl. Bericht, Kiel 2009].
M. Hilgart, Geomorphologisch-bodenkundliche Untersuchung im Umfeld des Karlsgrabens (Fossa Carolina), Lkr. Weißenburg-Gunzenhau-sen. Gutachten für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege [unpubl. Bericht, 1999].
B. Kopecky-Hermanns, Geoarchäologisch-bo-denkundliches Gutachten zur Bohrprospektion im Bereich der geplanten Ortsumfahrung Det-tenheim, südöstlich der »Fossa Carolina«, Lkr. Weißenburg-Gunzenhausen [unpubl. Bericht, 2011].
H. Rittweger, Botanische und zoologische Ma-kroreste in Bohrkern-Proben aus dem Bereich des Karlsgrabens, Ortsumfahrung Weißen-burg–Dettenheim (Bayern). Gutachten im Auf-trag des Bayerischen Landesamtes für Denk-malpflege [unpubl. Bericht, 2009].
Linzen · Schneider, Fokus geophysik
S. Berg-Hobohm / J. Fassbinder / S. Linzen, Neue Forschungsergebnisse am Karlsgraben durch geo physikalische Messmethoden. Denkmalpfle-ge-Informationen 157 (im Druck).
S. Linzen / V. Schultze / A. Chwala / T. Schüler / M. Schulz / R. Stolz / H.-G. Meyer, Quantum De tec tion Meets Archaeology – Magnetic Pro-spec tion with SQUIDs, Highly Sensitive and Fast. In: M. Reindel / G. A. Wagner (Hrsg.), New Technologies for Archaeology. Multidisci-plinary Investigations in Palpa and Nasca, Peru (Berlin, Heidelberg 2009) 71-85.
M. Schneider / R. Stolz / S. Linzen / M. Schiff-ler / A. Chwala / M. Schulz / S. Dunkel / H.-G. Meyer, Inversion of geo-magnetic full-tensor gradiometer data. Journal of Applied Geophy-sics 92, 2013, 57-67.
Werther · Feiner, Fokus Archäologie
H. Ellenberg, Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und histori-scher Sicht (Stuttgart 51996).
Herzig · Werther, Fokus Dendroarchäologie
M. G. Baillie / J. R. Pilcher, A simple crossdating program for tree ring research. Tree-Ring-Bulle-tin 33, 1973, 7-14.
F. Herzig, Zum Stand der dendrochronologi-schen und holzanatomischen Untersuchungen an den frühmittelalterlichen Bauhölzern aus Greding-Großhöbing. Beiträge zur Archäologie in Mittelfranken 4, 1998, 247-256.
F. Herzig, Stand der dendrochronologischen Aus wertungen Greding-ICE-Trasse Oktober 2004. Beiträge zur Archäologie in Mittelfran-ken 7, 2004, 77-80.
123
F. Herzig, Dendroarchäologie. Mensch und Um welt – eine Wechselwirkung, eingraviert in Holz. Bericht der Bayerischen Bodendenkmal-pflege 50, 2009, 225-236.
M. Hilgart / M. Nadler, Talauen als Archiv. Geo-archäologische Untersuchungen bei der Alt-mühl-Renaturierung im Raum Gundelsheim /Trom metsheim. Stadt Treuchtlingen und Ge-meinde Alesheim, Landkreis Weißenburg-Gun-zenhausen, Mittelfranken. Das Archäologische Jahr in Bayern 2004 (2005), 120-122.
E. Hollstein, Mitteleuropäische Eichenchronolo-gie. Trierer dendrochronologische Forschungen zur Archäologie und Kunstgeschichte. Trierer Grabungen und Forschungen 11 (Mainz 1980).
QuellenAnnales regni Francorum, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Hannover 1895).
Annales qui dicuntur Einhardi, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Han-nover 1895).
De Vita S. Sualonis Dicti Soli, ed. O. Holder-Egger, MGH Scriptores (in folio) 15, 1 (Berlin 1887) 151-163.
Werther, Siedlungsentwicklung und Kultur-landschaft
M. Beck / C. Merthen, Zwischen Hain und Him-melreich – Die Reihengräber von Weißenburg. Frankenbund, Gruppe Weißenburg i. Bay. 4 (Weißenburg 2013).
U. Beier, Weißenburger Flurnamenbuch. Vom Gal genberg ins Himmelreich. Weißenburger Hei matbücher 4 (Weißenburg 1995).
M. Borgolte, Die Grafen Alemanniens in mero-wingischer und karolingischer Zeit. Eine Proso-pographie. Archäologie und Geschichte 2 (Sig-maringen 1986).
W. Czysz (Hrsg.), Die Römer in Bayern (Ham-burg 2005).
W. Czysz, Die Römerstraße zwischen Maihin-gen und Marktoffingen und die Geschichte der Landschaft im Ries. Das Archäologische Jahr in Bayern 2012 (2013), 80-83.
H. Dannheimer, Die germanischen Funde der späten Kaiserzeit und des frühen Mittelalters in Mittelfranken. Germanische Denkmäler der Völkerwanderungszeit A 7 (Berlin 1962).
C. Dasler, Forst und Wildbann im frühen deut-schen Reich. Die königlichen Privilegien für die Reichskirche vom 9. bis zum 12. Jahrhundert. Dissertationen zur mittelalterlichen Geschichte 10 (Köln u. a. 2001).
F. Eigler, Weißenburger Reichsforst und Pap-penheimer Mark. Zeitschrift für Bayerische Lan-desgeschichte 39, 1976, 353-377.
F. Eigler, Weißenburg und sein Umland im Jah-re 793. Villa nostra. Weißenburger Blätter 2, 1993, 5-23.
F. Eigler, Die früh- und hochmittelalterliche Be-siedlung des Altmühl-Rezat-Rednitz-Raums. Eichstätter geographische Arbeiten 11 (Mün-chen 2000).
P. Fleischmann, Die handgezeichneten Karten des Staatsarchivs Nürnberg bis 1806. Bayeri-sche Archivinventare 49 (München 1998).
H.-W. Goetz, Die »private« Grundherrschaft des frühen Mittelalters im Spiegel der St. Galler Traditionsurkunden. In: B. Kasten (Hrsg.), Tätig-keitsfelder und Erfahrungshorizonte des länd-lichen Menschen in der frühmittelalterlichen Grundherrschaft (bis ca. 1000) [Festschr. D. Hä-germann]. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirt schaftsgeschichte Beihefte 184 (Stuttgart 2006) 111-137.
W. Hartung, Bertolde in Baiern. Alamannisch-baierische Adelsverflechtungen im 8. und 9. Jahr hundert. In: I. Eberl / W. Hartung / J. Jahn (Hrsg.), Früh- und hochmittelalterlicher Adel in Schwaben und Bayern. Regio 1 (Sigmaringen-dorf 1988) 115-160.
R. Koch, Das archäologische Umfeld der Fossa Carolina. Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühge-schichte 23, 1990, 669-678.
R. Koch, Notgrabungen in der ehemaligen Pfarrkirche St. Martin von Weißenburg i. Bay-ern. Das Archäologische Jahr in Bayern 1992 (1993), 140-142.
J. Letzener, Historia Caroli Magni (Hildesheim 1603).
M. Nadler, Weißenburg vor den Römern – Ausgrabungen im Gewerbegebiet Süd. Das Archäologische Jahr in Bayern 2011 (2012), 31-33.
M. Nadler, Eine mittelneolithische Hofstelle in Weißenburg i. Bayern. Das Archäologische Jahr in Bayern 2012 (2013), 20-22.
R. Schuh, Die germanische und slawische Be-siedlung Frankens im Lichte der Ortsnamen. In: J. Merz / R. Schuh (Hrsg.), Franken im Mit-telalter. Francia orientalis, Franconia, Land zu Franken: Raum und Geschichte. Hefte zur Bay-erischen Landesgeschichte 3 (München 2004) 25-41.
B. Schwineköper, »Cum aquis aquarumve decursibus«. Zu den Pertinenzformeln der Herrscherurkunden bis zur Zeit Ottos I. In: K.-U. Jäschke / R. Wenskus (Hrsg.), Festschrift für Helmut Beumann zum 65. Geburtstag (Sigma-ringen 1977) 22-56.
B. Steidl, Die römische Fernstraße Augsburg – Isartal mit frühmittelalterlicher Neubauphase im Freisinger Moos bei Fürholzen. Bayerische Vor-geschichtsblätter 78, 2013, 163-194.
E. Weinlich, Alte und neue Keramikfunde der späten Kaiser- und der Völkerwanderungszeit in Mittelfranken. Zur germanischen Besiedelung der südlichen Frankenalb. Beiträge zur Archäo-logie in Mittelfranken 4, 1998, 179-210.
L. Werther, Der Königsgutkomplex Salz und das Neustädter Becken – ein frühmittelalter-licher Zentralraum im Wandel der Zeit. In: P. Ettel / L. Werther (Hrsg.), Zentrale Orte und zentrale Räume des Frühmittelalters in Süd-deutschland. Tagung des RGZM und der Fried-rich-Schiller-Universität Jena vom 7.-9.10.2011 in Bad Neustadt an der Saale. RGZM – Tagun-gen 18 (Mainz 2013) 89-112.
T. Zotz, Beobachtungen zur königlichen Grund-herrschaft entlang und östlich des Rheins vor-nehmlich im 9. Jahrhundert. In: W. Rösener (Hrsg.), Strukturen der Grundherrschaft im frü-hen Mittelalter. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 92 (Göttingen 1989) 74-125.
Quellen
Annales regni Francorum, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Hannover 1895).
Annalium Salisburgensium additamentum, ed. W. Wattenbach, MGH Scriptores (in folio) 13 (Hannover 1881) 236-241.
Chartularium Sangallense I., ed. P. Erhart un-ter Mitwirkung von K. Heidecker und B. Zeller (St. Gallen 2013).
Ein bayerisches Mirakelbuch aus der Karolin-gerzeit. Die Monheimer Walpurgis-Wunder des Priesters Wolfhard, ed. A. Bauch, Quellen zur Geschichte der Diözese Eichstätt 2 = Eichstätter Studien N. F. (Eichstätt 1979).
Die Urkunden Konrad I., Heinrich I. und Otto I., ed. T. Sickel, MGH Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser 1 (Hannover 1879).
Die Urkunden Arnolfs, ed. P. F. Kehr, MGH Die Urkunden der deutschen Karolinger 3 (Berlin 1940).
Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karl-manns und Ludwigs des Jüngeren, ed. P. F. Kehr, MGH Die Urkunden der deutschen Karolinger 1 (Berlin 1934) 285-327.
Urkundenbuch St. Gallen, ed. W. Wartmann, 1863: Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. Theil I. Jahr 700-840 (Zürich 1863).
Hack, Schriftquellen
S. Abel / B. Simson, Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem Großen. 2: 789-814 (Leipzig 1883).
C. A. Baader, Lexikon der verstorbenen baie-rischen Schriftsteller des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts (Augsburg, Leipzig 1825).
M. Becher, Eine verschleierte Krise. Die Nach-folge Karl Martells 741 und die Anfänge der karolingischen Hofgeschichtsschreibung. In: J. Laudage (Hrsg.), Von Fakten und Fiktionen. Mittelalterliche Geschichtsdarstellungen und ihre kritische Aufarbeitung. Europäische Ge-schichtsdarstellungen 1 (Köln, Weimar, Wien 2002) 95-133.
F. Beck, Die Fossa Carolina. Eine historische, topo graphische und kritische Abhandlung. Programm zum Jahresbericht des K. Wittelsba-cher-Gymnasiums in München für das Schuljahr 1910/11 (München 1911).
J. F. Böhmer / E. Mühlbacher / J. Lechner, Die Regesten des Kaiserreichs unter den Karolin-gern 751-918 (924) (Innsbruck ²1908).
C. Brühl, Fodrum, gistum, servitium regis. Stu-dien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den frän-kischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frank-reich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Kölner Historische Abhandlun-gen 14 (Köln, Graz 1968).
RGA 26 (2004) 165-175 s. v. Schleppstrecke (D. Elmers / E. Nyman).
R. Enders, Johann Alexander Döderlein und die Schulgeschichte Frankens. Villa nostra. Weißen-burger Blätter 22, 1987, 205-216.
124
A. Gauert, Zum Itinerar Karls des Großen. In: W. Braunfels (Hrsg.), Karl der Große. Lebens-werk und Nachleben. 1: Persönlichkeit und Ge-schichte (Düsseldorf 1965) 307-321.
A. Th. Hack, Codex Carolinus. Päpstliche Epis-tolographie im 8. Jahrhundert. Päpste und Papsttum 35 (Stuttgart 2006-2007).
W. Hartmann, Die Synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien. Konzilienge-schichte, Reihe A, Darstellungen (Paderborn u. a. 1989).
H.-H. Kortüm, Weltgeschichte am Ausgang der Karolingerzeit: Regino von Prüm. In: A. Scha-rer / G. Scheibelreiter (Hrsg.), Historiographie im frühen Mittelalter. Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-schung 32 (Wien, München 1994) 499-513.
M. McCormick, Les annales du haut moyen âge. Typologie des sources du moyen âge occi-dental 14 (Turnhout 1975).
R. McKitterick, Karl der Große (Darmstadt 2008).
R. Molkenthin, Die Fossa Carolina. Technikge-schichte 65, 1998, 1-26.
W. D. Pecher, Henry van de Velde. Das Gesamt-werk. 1: Gestaltung (München 1981).
W. D. Pecher, Künstlers Shit. Kunst, die keiner braucht (München 2012).
H. Schefers (Hrsg.), Einhard. Studien zu Leben und Werk. Dem Gedenken an Helmut Beu mann gewidmet. Arbeiten der Hessischen His to-rischen Kommission N. F. 12 (Darmstadt 1997).
E. Schubert, Hans Hubert Hofmann (mit einem Schriftenverzeichnis, erstellt von D. Karasek). Jahrbuch für fränkische Landesforschung 39, 1979, 209-231.
E. Seyler, Die Drususverschanzungen bei Dei-senhofen (München ²1900).
E. Seyler, Terrae limitaneae. In Fortsetzung von »Agrarien und Exkubien«. Eine zweite Unter-suchung über römisches Heerwesen (München 1901).
E. Seyler, Agrarien und Exkubien. Eine Unter-suchung über römisches Heerwesen (München ²1902).
E. Seyler, Burgställe. Eine Untersuchung über römisches Heerwesen (Berlin 1903).
E. Seyler, Die Römerforschungen. Leistungen und Irrtümer (Nürnberg 1907).
E. Seyler, Die Mönchsfabel von der Fossa Caro-lina (Nürnberg 1907).
E. Seyler, Des Zollerngeschlechtes römische Herkunft und ihre Folgeerscheinungen im frü-hen Mittelalter (Nürnberg 1911).
E. Seyler, Geist und Methode. Forderungen der Zeit an unsere »Denker« und »Dichter« (Leipzig 1917).
K. Spindler, Der Mann im Eis. Neue sensationel-le Erkenntnisse über die Mumie aus den Ötzta-ler Alpen (München 2000).
Thesaurus Linguae Latinae 1-10 (A-P) (Leipzig 1900-2002).
W. Wattenbach / W. Levison / H. Löwe, Deutsch-lands Geschichtsquellen im Mittelalter. Vorzeit und Karolinger (Weimar 1952-1990).
Quellen
Annales Alamannici, ed. W. Lendi, Untersu-chungen zur frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Annalen. Scrinium Friburgense 1 (Freiburg i. Ü. 1971) 146-182.
Annales Guelferbytani, ed. W. Lendi, Untersu-chungen zur frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Annalen. Scrinium Friburgense 1 (Freiburg i. Ü. 1971) 147-181.
Annales Mosellani, ed. J. M. Lappenberg, MGH Scriptores (in folio) 16 (Hannover 1859) 491-499.
Annales Maximiniani, ed. G. Waitz, MGH Scrip-tores (in folio) 13 (Hannover 1881) 19-25.
Annales qui dicuntur Einhardi, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Han-nover 1895).
Annales regni Francorum, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Hannover 1895).
Annales sancti Emmeramni maiores, ed. H. Bress lau, MGH Scriptores (in folio) 30, 2 (Leipzig 1934) 733-741.
Reginonis abbatis Prumensis Chronicon, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 5 (Hannover 1890).
Die Urkunden Ludwigs des Deutschen, Karl-manns und Ludwigs des Jüngeren, ed. P. F. Kehr, MGH Die Urkunden der deutschen Karolinger 1 (Berlin 1934) 285-327.
Later, Das Altmühltal
A. Gairhos, Späte Merowingerzeit im Ingolstäd-ter Raum. Die Bestattungsplätze Etting-Sand-feld, Etting-Ziegelsaumäcker, Großmehring-Straßgwender und Enkering-Mauergarten. Beiträge zur Geschichte Ingolstadts 6 (Ingol-stadt 2010).
J. Haberstroh, Frühes Mittelalter an der Schut-ter – Eine klösterliche cella in der villa rustica von Nassenfels, Lkr. Eichstätt. Vorbericht über die Ausgrabungen 2002 bis 2006. Germania 87, 2009, 221-263.
M. Hensch, Tollunstein – Die Burg an der Alt-mühl. 1300 Jahre Siedlungskontinuität am Dollnsteiner Burgfelsen. Das Jurahaus 13, 2007/2008 (2007), 93-108.
V. Herrmann, Rheinfränkischer Landesausbau in Nordbayern am Beispiel der karolingisch-ot-tonischen Burg »Greuth«, Lkr. Roth. Germania 86, 2008, 729-761.
Ch. Later, Die Propstei Solnhofen im Altmühltal. Untersuchungen zur Baugeschichte der Kirche, zur Inszenierung eines früh- und hochmittel-alterlichen Heiligenkultes und zur Sachkultur. Materialhefte zur Bayerischen Archäologie 95 (Kallmünz / Opf. 2011).
Ch. Later, Reaktionen eines lokalen Zentrums auf den Wandel von Wirtschaftsfaktoren am Beispiel der curtis, cella und Propstei Solnhofen im Altmühltal. In: P. Ettel / L. Werther (Hrsg.), Zentrale Orte und zentrale Räume des Frühmit-telalters in Süddeutschland. Tagung des RGZM und der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom 7.-9.10.2011 in Bad Neustadt an der Saale. RGZM – Tagungen 18 (Mainz 2013) 309-332.
Ch. Later, Siedlungsarchäologische Beobach-tungen zur systematischen Erschließung einer Durchgangsregion in der jüngeren Merowin-ger- und Karolingerzeit am Beispiel des Alt-mühltals. In: M. Helmbrecht / U. Jecklin-Tisch-hauser / Ch. Later (Hrsg.), Stadt, Land, Fluss. Infrastruktur und Distributionssysteme in Spät-antike und Frühmittelalter. Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmit-telalter 8 (Lübeck 02.-03. September 2013). Studien zu Spätantike und Frühmittelalter 7 (in Vorb.).
W. Sage, Die Domgrabung Eichstätt. In: K. H. Rieder / A. Tillmann (Hrsg.), Eichstätt. 10 Jahre Stadtkernarchäologie. Zwischenbilanz einer Chance [Ausstellungskat.] (Kipfenberg 1992) 19-30.
Ettel, Sicherung der verkehrswege
K. Böhner, Hof, Burg und Stadt im frühen Mit-telalter. In: K. Spindler (Hrsg.), Führer zu ar-chäologischen Denkmälern in Deutschland. 14: Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Archäo-logie und Geschichte (Stuttgart 1987) 168-246.
P. Ettel, Der kirchliche Burgenbau im frühen Mittelalter (7.-11. Jh.) aus archäologischer Sicht. In: J. Zeune (Hrsg.), Burg und Kirche. Herrschaftsbau im Spannungsfeld zwischen Politik und Religion. Veröffentlichungen der Deutschen Burgenvereinigung B 13 (Braubach 2013) 95-113.
W. Hübener, Die Orte des Diedenhofener Ka-pitulars von 805 in archäologischer Sicht. Jah-resschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte 72, 1989, 251-266.
W. Janssen / L. Wamser, Neue Ausgrabungen aus dem Michelsberg, Neustadt a. Main. Das Archäologische Jahr in Bayern 1982 (1983), 135-139.
H. Losert, Die Ausgrabungen im Pfarrgarten zu Hallstadt. Berichte des Historischen Vereins Bamberg 117, 1981, 21-26.
D. Rosenstock, Siedlungsgeschichte im Früh-mittelalter. In: U. Wagner (Hrsg.), Geschichte der Stadt Würzburg. 1: Von den Anfängen bis zum Ausbruch des Bauernkriegs (Stuttgart 2001) 51-61.
W. Sage, Archäologische Forschungen in Forch-heim. Jahresbericht der Bayerischen Bodendenk-malpflege 30/31, 1989/1990 (1994), 336-351.
L. Wamser, Befestigte Anlagen des frühen bis späten Mittelalters in den Ruinen des Römer-kastells Miltenberg-Altstadt. In: H. W. Böhme (Hrsg.), Burgen der Salierzeit. 2: In den südli-chen Landschaften des Reiches. Monographien des RGZM 26 (Sigmaringen 1991) 235-244.
L. Wamser, Die Würzburger Siedlungsland-schaft im frühen Mittelalter. Spiegelbild der naturgegebenen engen Verknüpfung von Stadt- und Bistumsgeschichte. In: J. Lenssen / L. Wamser (Hrsg.), 1250 Jahre Bistum Würzburg [Würzburg 1992] 39-48.
J. Zeune, Die Babenburg des 9./10. Jahrhun-derts. In: L. Hennig (Hrsg.), Geschichte aus Gru-ben und Scherben. Archäologische Ausgrabun-gen auf dem Domberg in Bamberg. Schriften des Historischen Museums Bamberg 26 (Bam-berg 1993) 43-51.
125
Ettel · Wunschel, Würzburg und Karlburg
J. Lenssen / L. Wamser (Hrsg.), 1250 Jahre Bis tum Würzburg. Archäologisch-historische Zeug nisse der Frühzeit [Ausstellungskat.] (Würz burg 1992).
R. Obst, Die Besiedlungsgeschichte am nord-westlichen Maindreieck vom Neolithikum bis zum Ende des Mittelalters. Würzburger Arbei-ten zur Prähistorischen Archäologie 4 (Rahden /Westf. 2012).
U. Wagner (Hrsg.), Geschichte der Stadt Würz-burg. 1: Von den Anfängen bis zum Ausbruch des Bauernkriegs (Stuttgart 2001).
A. Wunschel, Archäologie im Würzburger Alt-stadtkern. Untersuchungen am ehemaligen Domherrenhof Uissigheim [unpubl. Magisterar-beit, Univ. Bamberg 2011].
QuellenAnnales regni Francorum, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Hannover 1895) 92-94.
W. Störmer, Franken von der Völkerwande-rungszeit bis 1268. Dokumente zur Geschichte von Staat und Gesellschaft in Bayern 2, 1 (Mün-chen 1999).
Schulze-Dörrlamm, mainz
P. Berghaus, Schatzfund karolingischer Silber-münzen. In: H. Roth / E. Wamers (Hrsg.), Hes-sen im Frühmittelalter. Archäologie + Kunst [Ausstellungskat. Frankfurt a. M.] (Sigmaringen 1984) 228-232.
L. Falck, Mainz im frühen und hohen Mittelalter (Mitte 5. Jahrhundert bis 1244). Geschichte der Stadt Mainz 2 (Düsseldorf 1972).
M. Schulze-Dörrlamm, Der Mainzer Königs-thron aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrhun-derts. Archäologisches Korrespondenzblatt 34, 2004, 571-587.
M. Schulze-Dörrlamm, Archäologische Denk-mäler des karolingischen Mainz. In: M. Drey-er / J. Rogge (Hrsg.), Mainz im Mittelalter (Mainz 2009) 17-33.
M. Schulze-Dörrlamm, Die karolingische Chor-schranke und die porta aurea der Klosterkirche St. Alban (787-805) bei Mainz. Jahrbuch des RGZM 54, 2007 (2010), 629-661.
M. Schulze-Dörrlamm, Zwei ungewöhnliche Bronzeschlüssel der Karolingerzeit – ein Amu-lettschlüssel aus Mainz und ein »Petrusschlüs-sel« aus Alzey. In: N. Krohn / U. Koch (Hrsg.), Grosso Modo. Quellen und Funde aus Spät-antike und Mittelalter [Festschr. G. Fingerlin]. Forschungen zu Spätantike und Mittelalter 1 (Weinstadt 2012) 189-202.
E. Wamers, Die frühmittelalterlichen Lesefunde aus der Löhrstraße (Baustelle Hilton II) in Mainz. Mainzer Archäologische Schriften 1 (Mainz 1994).
E. Wamers, Weitere Lesefunde aus der Löhrstra-ße (Baustelle Hilton II) in Mainz. Mainzer Archäo-logische Zeitschrift 5/6, 1998/1999, 241-272.
Ettel · Wunschel, regensburg
A. Boos / S. Codreanu-Windauer / E. Winter-gerst, Regensburg zwischen Antike und Mit-telalter. In: M. Angerer / H. Wanderwitz (Hrsg.), Regensburg im Mittelalter. Beiträge zur Stadt-
geschichte vom frühen Mittelalter bis zum Be-ginn der Neuzeit. Regensburg im Mittelalter 1 (Regensburg 21998) 31-44.
S. Codreanu-Windauer, Neue Ergebnisse zur frühen Stadtbefestigung Regensburgs. In: I. Ericsson / H. Losert (Hrsg.), Aspekte der Ar-chäologie des Mittelalters und der Neuzeit [Festschr. W. Sage]. Bamberger Schriften zur Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 1 (Bonn 2003) 86-94.
L.-M. Dallmeier / U. Kirpal, Neue Forschungen am Regensburger Donauufer. Das Archäologi-sche Jahr in Bayern 2010 (2011), 132-134.
H. Fehr / I. Heitmeier (Hrsg.), Die Anfänge Bay-erns. Von Raetien und Noricum zur frühmit-telalterlichen Baiovaria. Bayerische Landesge-schichte und europäische Regionalgeschichte 1 (St. Ottilien 2012).
R. Gschlößl, Ein Bohlenweg am Ufer. Bayerische Archäologie 4, 2013, 10.
R. Röber, Zwischen Antike und Mittelalter. The-sen zur Ausgestaltung und räumlichen Entwick-lung ausgewählter Bischofssitze an Rhein und Donau. In: U. Gross / A. Kottmann / J. Schesch-kewitz (Hrsg.), Frühe Pfalzen – frühe Städte. Neue Forschungen zu zentralen Orten des Früh- und Hochmittelalters in Süddeutschland und der Nordschweiz. Ergebnisse eines Kollo-quiums am 28. und 29. April 2009 im Rathaus zu Ulm. Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 58 (Esslingen am Neckar 2009) 103-136.
P. Schmid, König – Herzog – Bischof. Regens-burg und seine Pfalzen. In: L. Fenske (Hrsg.), Pfalzen – Reichsgut – Königshöfe. Deutsche Königspfalzen 4 = Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11, 4 (Göttingen 1996) 53-83.
E. Wintergerst / S. Codreanu-Windauer, Regens-burg – eine mittelalterliche Großstadt an der Donau. In: A. Wieczorek / H.-M. Hinz (Hrsg.), Europas Mitte um 1000 [Ausstellungskat. Bu-dapest u. a.] (Stuttgart 2000) 179-183.
QuellenAnnales regni Francorum, ed. F. Kurze, MGH Scriptores rerum Germanicarum 6 (Hannover 1985).
Arbeonis episcopi Frisingensis Vitae sanctorum Haimhrammi et Corbiniani, ed. B. Krusch, MGH Scriptores rerum Germanicarum 13 (Hannover 1920).
Capitularia regum Francorum I, ed. A. Boretius, MGH Leges (Hannover 1883).
Capitularia regum Francorum II, ed. A. Boretius, MGH Leges (Hannover 1890).
Bockius, Binnenfahrzeuge im Karolingerreich
B. Arnold, Pirogues monoxyles d’Europe cen-trale. Construction, typologie, évolution 1. Ar-chéologie Neuchâteloise 20 (Neuchâtel 1995).
D. Bischop, Die Bremer Balge im frühen Mit-telalter. In: F. Bittmann u. a. (Hrsg.), Flüs-se als Kommu nikations- und Handelswege. Marschenrats kolloquium 2009, 5.-7. Novem-ber 2009, Deut sches Schiffahrtsmuseum, Bre-merhaven. Sied lungs- und Küstenforschung im südlichen Nord see gebiet 34 (Rahden / Westf. 2011) 359-378.
R. Bockius, Antike Prahme. Monumentale Zeugnisse keltisch-römischer Binnenschiffahrt aus der Zeit vom 2. Jh. v. Chr. bis ins 3. Jh. n. Chr. Jahrbuch des RGZM 47, 2000 (2003), 439-493.
R. Bockius, Abdichten, Beschichten, Kalfatern. Schiffsversiegelung und ihre Bedeutung als In-dikator für Technologietransfers zwischen den antiken Schiffbautraditionen. Jahrbuch des RGZM 49, 2002 (2003), 189-234.
F. Bonnet, Le canal romain d’Avenches. Rapport sur les fouilles exécutées en 1980 et 1981. Bul-letin de l’Association Pro Aventico 27, 1982, 3-55.
O. Crumlin-Pedersen, Viking-Age Ships and Ship building in Hedeby / Haithabu and Schles-wig. Ships & Boats of the North 2 (Schleswig, Roskilde 1997).
W. Dammann, Rheinschiffe aus Krefeld und Zwammerdam. Das Logbuch 10, 1974, 4-10.
D. Ellmers, Baumschiff und Oberländer. Ar-chäologie, Ikonografie und Typenbezeichnung einer mittelalterlichen Binnenschiffsfamilie. In: K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasser-wege. Zur Schiffahrt des Mittelalters. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 58 (Ham-burg 2002) 97-106.
D. Ellmers / R. Pirling, Ein mittelalterliches Schiff aus dem Rhein. Die Heimat 43, 1972, 45-48.
D. Gräf, Boat Mills in Europe from Early Medi-eval to Modern Times. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie mit Landesmuse-um für Vorgeschichte 51 = Bibliotheca Molino-logica 19 (Dresden 2006).
O. Höckmann, Eine Schiffsmühle aus den Jah-ren um 760 n.Chr. in Gimbsheim, Kr. Alzey-Worms. Mainzer Archäologische Zeitschrift 1, 1994, 191-209.
O. Höckmann, Eine Schiffsmühle aus Gimbs-heim (Kreis Alzey-Worms). In: Die Franken. Wegbereiter Europas. Vor 1500 Jahren: König Chlodwig und seine Erben [Ausstellungskat. Mannheim, Paris, Berlin] (Mainz 21997) 293-318.
P. Hoffmann / D. Ellmers, Ein Frachter aus der Zeit Karls des Großen. Bremer Archäologische Blätter N. F. 1990/1991, 33-37.
A. van Holk, Some remarks on flat-bot-tomed boat-finds from the Netherlands. In: K. Brandt / H.-J. Kühn (Hrsg.), Der Prahm aus dem Hafen von Haithabu. Beiträge zu antiken und mittelalterlichen Flachbodenschiffen. Schrif-ten des Archäologischen Landesmuseums Er-gänzungsreihe 2 (Neumünster 2004) 105-123.
E. Jansma, Dendrochronologisch onderzoek van het scheepje »Utrecht 6«. DCCD rapportnummer 2013502. www.academia.edu/3995546/Jans ma_E._2013_Dendrochronologisch_onderzoek_ van_het_scheepje_Utrecht_6 (13.02.2014).
E. Karali, Erase and Rewind. Reconstructing the Bremen Eke [unpubl. Masterarbeit, Univ. South Denmark 2013].
Th. Moritz, Die Ausgrabungen in der Bremer Altstadt 1989. Bremisches Jahrbuch 70, 1991, 191-206.
R. Mücke, Weserlastkähne im archäologischen Befund. Deutsches Schiffahrtsarchiv 34, 2011, 35-86.
126
O. Nakoinz, Wrack 4 von Haithabu. Ein Prahm des 12. Jahrhunderts und seine Parallelen im Ostseeraum. Archäologisches Korrespondenz-blatt 35, 2005, 123-142.
J. Opladen-Kauder, Ein karolingischer Flußkahn aus Kalkar-Niedermörmter. Archäologie im Rheinland 1993 (1994), 98-99.
J. Obladen-Kauder / A. Peiss, Ein Flußkahn aus der Zeit Karls des Großen. In: H. G. Horn u. a. (Hrsg.), Fundort Nordrhein-Westfalen. Millio-nen Jahre Geschichte [Ausstellungskat. Köln, Münster, Nijmegen]. Schriften zur Bodendenk-malpflege in Nordrhein-Westfalen 5 (Mainz 2000) 378-379.
T. Pflederer, Dokumentation neuerer Einbaum-funde in Bayern. Berichte der Bayerischen Bo-dendenkmalpflege 50, 2009, 45-69.
R. Pirling, Römer und Franken am Niederrhein. Katalog-Handbuch des Landschaftsmuseums Burg Linn in Krefeld (Mainz 1986).
R. Pirling / G. Buchwald, Ein Schiff aus karolin-gischer Zeit und seine Konservierung. Naturwis-senschaften 61/9, 1974, 396-398.
R. Pohl-Weber, Die Bremer Eke. Fund eines mit-telalterlichen Binnenschiffs. Bremisches Jahr-buch 51, 1969, 8-11.
M. Rech, Übersicht der Schiffsfunde auf Bre-mer Gebiet. Bremer Archäologische Blätter N. F. 1990/1991, 25-32.
R. Reinders, Drie middeleeuwse rivierschepen gevonden bij Meinerswijk (Arnhem) opgra-vingsverslagen 5, 6 en 7. Flevobericht 221 (Le-lystad 1983).
A. Van de Moortel, Medieval boats and ships of Germany, the Low Countries, and north-east France – archaeological evidence for shipbuilding traditions, shipbuilding resources, trade, and communication. In: F. Bittmann u. a. (Hrsg.), Flüsse als Kommunikations- und Han-delswege. Marschenratskolloquium 2009, 5.-7. November 2009, Deutsches Schiffahrtsmuse-um, Bremerhaven. Siedlungs- und Küstenfor-schung im südlichen Nordseegebiet 34 (Rah-den / Westf. 2011) 67-104.
K. Vlierman, Kleine bootjes en middeleeuws scheepshout met constructiedetails. Scheepsar-cheologie 2 = Flevobericht 404 (Lelystad 1996).
K. Vlierman, Scheeps- en stadsarcheologie. De be te kenis van schees(hout)vondsten in Neder-land se middeleeuwse steden. In: P. J. Wolte-ring / W. J. H. Verwers / G. H. Scheep stra (Hrsg.), Middeleeuwse toestanden. archeologie, ge-schiedenis en monumentenzorg [Festschr. H. Sar fatij] (Hilversum 2002) 119-148.
Bockius, Künstliche Schifffahrtswege
J. D. Anderson, Roman military supply in north-east England. An analysis of and an alternative to the Piercebridge Formula. BAR British Series 224 (Oxford 1992).
D. J. Blackman, Ancient harbours in the Medi-terranean. Part 1. International Journal of Nau-tical Archaeology 11, 1982, 79-104.
D. J. Blackman, Ancient harbours in the Medi-terranean. Part 2. International Journal of Nau-tical Archaeology 11, 1982, 185-211.
R. Bockius, Ein römischer Stockanker aus Tra-jans Donaukanal beim Eisernen Tor, Serbien. Archäologisches Korrespondenzblatt 30, 2000, 97-116.
L. Bonnamour, Les ponts romains de Chalon-sur-Saône. Etude préliminaire de la pile no 3. Gallia 57, 2000, 273-306.
F. Bonnet, Le canal romain d’Avenches. Rapport sur les fouilles exécutées en 1980 et 1981. Bul-letin de l’Association Pro Aventico 27, 1982, 3-55.
M. Eckoldt, Über das römische Projekt eines Mosel-Saône-Kanals. Deutsches Schiffahrts-archiv 4, 1981, 29-34.
S. Froriep, Ein Wasserweg in Bithynien. Bemü-hungen der Römer, Byzantiner und Osmanen. Antike Welt 17, Sondernummer 2, 1986, 39-50.
G. Garbrecht, Wasserspeicher (Talsperren) in der Antike. Antike Welt 17, Sondernummer 2, 1986, 51-64.
G. Garbrecht, Historische Wasserbauten in Ost-anatolien – Königreich Urartu, 9.-7. Jh. v.Chr. In: Chr. Ohlig (Hrsg.), Wasserbauten im König-reich Urartu und weitere Beiträge zur Hydro-technik in der Antike. Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft (DWhG) e. V. 5 (Norderstedt 2004) 1-103.
F. Gardner Moore, Three Canal Projects, Roman and Byzantine. American Journal of Archaeolo-gy 54, 1950, 97-111.
P. Hoffmann, Die Suche nach der rechten Form. Rekonstruktion des karolingischen Flussschiffes Karl. Restauro 112, Heft 8, 2006, 508-513.
P. Hoffmann, Conservation of Archaeological Boats and Ships – personal experiences (Lon-don 2013).
B. S. J. Isserlin, Mozia (Trapani). Scavi eseguiti nel 1970. Notizie degli scavi di antichità 8/25, 1971, 770-774.
B. S. J. Isserlin, The Cothon at Motya. Archaeo-logy 27, 1974, 188-194.
B. S. J. Isserlin / J. du Plat Taylor, Motya. A Phoe-nician and Carthaginian City in Sicily. A report of the excavations undertaken during the years 1961-65 on behalf of the University of Leeds, the Institute of Archaeology of London Uni-versity and Fairleigh Dickinson University, New Jersey. 1: Field Work and Excavation (Leiden 1974).
B. S. J. Isserlin u. a., The Canal of Xerxes on the Mouth of the Athos Peninsula. The Annual of the British School at Athens 89, 1994, 277-284.
H. Kalcyk / B. Heinrich / J. Knauss, Die Meliora-tion des Kopaisbeckens in Böotien. Antike Welt 17, Sondernummer 2, 1986, 15-38.
V. H. Karastathis / S. P. Papamarinopoulos, The detection of the Xerxes Canal by the use of shallow refraction seismics – preliminary results. Geophysical Prospection 45, 1997, 389-401.
J. W. de Kort, Het Kanaal van Corbulo: onder-zoek naar een Romeinse waterweg in de ge-meente Leidschendam-Voorburg tussen 1989 en 2010. Westerheem 62/5, 2013, 233-243.
L. S. Leshnik, The Harappan »Port« at Lothal. Another View. American Anthropologist N. S. 70, 1968, 911-922.
J. P. Oleson, The technology of Roman har-bours. International Journal of Nautical Archae-ology 17, 1988, 147-158.
J. P. Oleson, Irrigation. In: Ö. Wikander (Hrsg.), Handbook of Ancient Water Technology. Tech-nology and Change in History 2 (Leiden, Bo-ston, Köln 2000) 183-215.
R. R. Rao, Lothal. A Harappan Port Town (1955-1962). Memoirs of the Archaeological Survey of India 78, 1-2 (New Delhi 1979-1985).
C. A. Redmount, The Wadi Tumilat and the »Canal of the Pharaos«. Journal of Near Eas-tern Studies 54, 1995, 127-135.
T. de Ridder, De oudste deltawerken van West-Europa. Tweeduizend jaar oude dammen en duikers te Vlaardingen. Tiijdschrift voor Water-staatsgeschiedenis 8/1, 1999, 10-22.
T. de Ridder, Wassermanagement in römischer Zeit: Die ältesten Deltawerke in Westeuropa. In: M. Fansa (Hrsg.), Kulturlandschaft Marsch. Na-tur, Geschichte, Gegenwart. Vorträge anlässlich des Symposiums in Oldenburg vom 3. bis 5. Juni 2004. Schriftenreihe des Landesmuseums für Natur und Mensch 33 (Oldenburg 2005) 60-67.
M. Schaloske, Untersuchungen der sabäischen Bewässerungsanlagen in Mārib. Antike Tech-nologie 3 = Archäologische Berichte aus dem Yemen 7 (Mainz 1995).
H. Schörner, Künstliche Schiffahrtskanäle in der Antike. Der sogenannte antike Suez-Kanal. Sky-llis 3, 2000, 28-43.
M. Serban, Trajan´s Bridge over the Danube. In-ternational Journal of Nautical Archaeology 38, 2009, 331-342.
N. A. F. Smith, Roman Canals. Transactions of the Newcomen Society 4, 1977-1978, 75-86.
A. Trevor Hodge, Reservoirs and Dams. In: Ö. Wikander (Hrsg.), Handbook of Ancient Water Technology. Technology and Change in History 2 (Leiden, Boston, Köln 2000) 331-339.
Ö. Wikander (Hrsg.), Handbook of Ancient Wa-ter Technology. Technology and Change in His-tory 2 (Leiden, Boston, Köln 2000).
Ch. Wikander, Canals. In: Ö. Wikander (Hrsg.), Handbook of Ancient Water Technology. Tech-nology and Change in History 2 (Leiden, Bo-ston, Köln 2000) 321-330.
Werther, Kanalbau im Frühmittelalter
RGA 26 (2004) 165-175 s. v. Schleppstrecke (D. Elmers / E. Nyman).
S. Freund, Flüsse und Wege. Theoretische und praktische Probleme der Kommunikation in vormoderner Zeit. Siedlungsforschung 25, 2007, 33-35.
I. H. Garipzanov, Annales Guelferbytani: Chan-g ing Perspectives of a Local Narrative. In: R. Cor-radini / M. Diesenberger (Hrsg.), Zwischen Nie-der schrift und Wiederschrift. Hagiographie und Historiographie im Spannungsfeld von Kom pendienüberlieferung und Editionstech-nik. Denkschriften. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse 405 = Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 18 (Wien 2010) 123-138.
127
T. F. Glick / S. J. Livesey / F. Wallis, Medieval sci-ence, technology, and medicine. An encyclo-pedia. Routledge encyclopedias of the Middle Ages 11 (New York, London 2005).
D. Hägermann, Technik im frühen Mittelal-ter zwischen 500 und 1000. In: D. Häger-mann / H. Schneider (Hrsg.), Landbau und Hand werk 750 v. Chr. bis 1000 n. Chr. Propylä-en-Technikgeschichte 1 (Berlin 1997) 317-505.
Y. Henigfeld / J.-J. Schwien / M. Werlé, L’apport de l’archéologie à la connaissance de la ville médiévale: le cas de Strasbourg. In: J. Chape-lot (Hrsg.), Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour un avenir. IXe congrès international de la Société d’Archéologie Médi-évale (Vincennes, 16-18 juin 2006) (Paris 2010) 351-368.
RGA 16 (2000) 221-222 s. v. Kanhave-Kanal (N. A. Jørgensen).
T. Kind, Das karolingerzeitliche Kloster Fulda – ein »monasterium in solitudine«. Seine Struk-turen und Handwerksproduktion nach den seit 1898 gewonnenen archäologischen Daten. In: J. Henning (Hrsg.), Post-Roman towns, trade and settlement in Europe and Byzantium. 1: The heirs of the Roman west. Millennium-Stu-dien 5, 1 (Berlin 2007) 367-409.
T. Kind, Pfahlbauten und merowingische curtis in Fulda? In: W. Hamberger (Hrsg.), Geschichte der Stadt Fulda. 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Alten Reiches (Fulda 2009) 45-68.
T. Kohl, Lokale Gesellschaften: Formen der Ge-meinschaft in Bayern vom 8. bis zum 10. Jahr-hundert. Mittelalter-Forschungen 29 (Ostfildern 2010).
T. Liebert, Siedlungskomplex Großhöbing – Mühlen und Bootsländen als Einrichtungen ländlicher Zentralorte. In: P. Ettel / L. Werther (Hrsg.), Zentrale Orte und zentrale Räume des Frühmittelalters in Süddeutschland. Tagung des RGZM und der Friedrich-Schiller-Universität Jena vom 7.-9.10.2011 in Bad Neustadt an der Saale. RGZM – Tagungen 18 (Mainz 2013) 141-159.
D. Lohrmann, Mühlenbau, Schiffahrt und Fluß-umleitungen im Süden der Grafschaft Flandern-Artois (10.-11. Jahrhundert). Francia 12, 1984, 149-192.
T. Rünger, Zwei Wassermühlen der Karolinger-zeit im Rotbachtal bei Niederberg. Bonner Jahr-bücher 212, 2012, 167-217.
P. Squatriti (Hrsg.), Working with Water in Me-dieval Europe. Technology and Resource-Use. Technology and Change in History 3 (Leiden, Boston, Köln 2000).
F. A. Stylegar / O. Grimm, Ein spätkaiser- und völkerwanderungszeitlicher Kanal in Spange-reid, Südnorwegen. Archäologisches Korre-spondenzblatt 3, 2003, 445-455.
M. Wyss, Die Klosterpfalz Saint-Denis im Licht der neuen Ausgrabungen. In: L. Fenske (Hrsg.), Splendor palatii. Neue Forschungen zu Pader-born und anderen Pfalzen der Karolingerzeit. Deutsche Königspfalzen 5 = Veröffentlichun-gen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 11, 5 (Göttingen 2001) 175-192.
Quellen
Annales Guelferbytani, ed. W. Lendi, Untersu-chungen zur frühalemannischen Annalistik. Die Murbacher Annalen. Scrinium Friburgense 1 (Freiburg 1971) 147-181.
Gregor von Tours, Miracula et opera minora, ed. B. Krusch, MGH Scriptores rerum Merovin-gicarum 1, 2 (Hannover 1885).
Epistolae Merowingici et Karolini aevi I, ed. W. Gundlach und E. Dümmler, MGH Epistolae 3 (Berlin 1892).
Vita s. Sturmi abbatis Fuldensis, ed. G. H. Pertz, MGH Scriptores (in folio) 2 (Hannover 1829).
Vita s. Emmerami episcopi Ratisbonensis, ed. B. Krusch, MGH Scriptores rerum Germani-carum in usum scholarum separatim editi 13 (Hannover 1920).
Die Urkunden Konrads III. und seines Sohnes Heinrich, ed. F. Hausmann, MGH Die Urkun-den der deutschen Könige und Kaiser 9 (Wien, Köln, Graz 1969).
Liebert, Frühmittelalterliche Wasserbau-technik
Th. Liebert, Technik des frühen Mittelalters. Wassermühlen und sonstige Wasserbauwerke im fränkisch-bajuwarischen Grenzgebiet bei Greding, Mittelfranken [unpubl. Diss., Univ. Bamberg 2011].
Weski, Schleuse oder Bootsrutsche
P. Böss, Wehr und Stauanlagen (Berlin 1927).
E. Neweklowsky, Die Schiffahrt und Flößerei im Raume der oberen Donau 1. Schriftenreihe des Institutes für Landeskunde von Oberösterreich 5 (Linz 1952).
E. Neweklowsky, Die Schiffahrt und Flößerei im Raume der oberen Donau 2. Schriftenreihe des Institutes für Landeskunde von Oberösterreich 6 (Linz 1954).
G. Spies, Technik der Steingewinnung und der Flußschiffahrt im Harzvorland in der frühen Neuzeit. Braunschweiger Werkstück B 14 = 83 (Braunschweig 1992).
G. Staun ton, Des Grafen Macartney Gesandt-schaftsreise nach China, welche Er auf Befehl des jetzt regierenden Königs von Großbritanni-en, Georg des Dritten, in den Jahren 1792 bis 1794 unternommen hat. Dritter Theil, mit Kup-fern (Berlin 1800).
H. Stettner, Treideln – treilen – trekken – jagen – bomätschen. Vormaschineller ufergebundener Schiffsantrieb durch Seilzug auf Flüssen, Ka-nälen und in schmalen Hafenzufahrten – Eine kommentierte Bildauswahl. 1. Teil: Deutsches Schiffahrtsarchiv 25, 2002, 383-423; 2. Teil: Deutsches Schiffahrtsarchiv 26, 2003, 43-47; 3. Teil: Deutsches Schiffahrtsarchiv 33, 2010, 157-173.
L. Ch. Sturm, Gründliche und practische Un-terweisung wie man Fang-Schleusen und Roll-Brücken nach der besten Art von Holz und Stein stark, beständig und bequem bauen sollte (Augspurg 1715).
Hack, Schiffsreisende im frühen mittelalter
P. Dräger, Zwei Moselfahrten des Venantius For-tunatus (carmina 6, 8 und 10, 9). Kurtrierisches Jahrbuch 39, 1999, 67-88.
F. Pauly, Die Bistümer der Kirchenprovinz Trier. 2: Die Stifte St. Severus in Boppard, St. Goar in St. Goar, Liebfrauen in Oberwesel, St. Martin in Oberwesel. Germania Sacra N. F. 14 (Berlin, New York 1980).
Quellen
Venantius Fortunatus, De navigio suo, ed. F. Leo, MGH Auctores Antiquissimi 4, 1 (Berlin 1881) 242-244.
Wandalbert von Prüm, Vita et Miracula sanc-ti Goaris, ed. H. E. Stiene, Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters 11 (Frankfurt a. M., Bern 1981).
Haase, Schriftquellengattung urbar
K. Elmshäuser, Facit Navigium. Schiffahrt auf Seine, Marne, Mosel und Rhein in Quellen zur frühmittelalterlichen Grundherrschaft. In: K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasser-wege. Zur Schiffahrt des Mittelalters. Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums 58 (Ham-burg 2002) 22-53.
D. Hägermann, Anmerkungen zum Stand und den Aufgaben frühmittelalterlicher Urbar-forschung. Rheinische Vierteljahrsblätter 50, 1986, 32-58.
D. Hägermann, Quellenkritische Bemerkungen zu den karolingerzeitlichen Urbaren und Güter-verzeichnissen. In: W. Rösener (Hrsg.), Struktu-ren der Grundherrschaft im frühen Mittelalter. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte 92 (Göttingen 1989) 47-73.
Lexikon des Mittelalters 8 (1997) 1286-1289 s. v. Urbar (D. Hägermann).
P. Hoffmann, Konservierung und Präsentation des Flußschiffes Karl im Deutschen Schiffahrts-museum. In: K. Elmshäuser (Hrsg.), Häfen, Schiffe, Wasserwege. Zur Schiffahrt des Mit-telalters. Schriften des Deutschen Schiffahrts-museums 58 (Hamburg 2002) 86-96.
W. Metz, Zur Geschichte und Kritik der frühmit-telalterlichen Güterverzeichnisse Deutschlands. Archiv für Diplomatik 4, 1958, 183-206.
Quellen
Inventarium omnium bonorum eorumque red-dituum monasterii sanctimonalium s. Iuliae brixiensis, ed. G. Porro Lambertenghi, Monu-menta historiae Patriae 13 (Turin 1873) Nr. 419. 706-727.
Die Mettlacher Güterrolle, ed. H. Müller, Zeit-schrift für die Geschichte der Saargegend 15, 1965, 110-146.
Das Prümer Urbar, ed. I. Schwab, Rheinische Urbare 5 = Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde 20 (Düsseldorf 1983).
Le polyptyque et les listes de cens de l’abbaye de Saint-Remi de Reims (IXe-XIe siècles), ed. J.-P. Devroey (Reims 1984).
128
Wunschel, gütertransport auf Binnengewäs-sern
M. Eckoldt / H.-G. Braun, Flüsse und Kanäle. Die Geschichte der deutschen Wasserstrassen (Hamburg 1998).
M. Grünewald / S. Wenzel (Hrsg.), Römische Landnutzung in der Eifel. Neue Ausgrabungen und Forschungen. RGZM – Tagungen 16 (Mainz 2012).
L. Grunwald, Anmerkungen zur Mayener Kera-mik produktion des 9. bis 12. Jahrhunderts. Archäo logische Nachweise – Wirtschafts ge-schichtliche Aussagen – Historische Ein bin-dun gen. In: L. Grunwald / H. Pantermehl / R. Schreg (Hrsg.), Hochmittelalterliche Ke ra-mik am Rhein. Eine Quelle für Produktion und Alltag des 9. bis 12. Jahrhunderts. RGZM – Ta-gungen 13 (Mainz 2012) 143-160.
F. Mangartz, Römischer Basaltlava-Abbau zwi-schen Eifel und Rhein. Monographien des RGZM 75 = Vulkanpark-Forschungen 7 (Mainz 2008).
M. McCormick, Origins of the European econo-my. Communications and commerce, A.D. 300-900 (Cambridge 2001).
R. Röber (Hrsg.), Einbaum, Lastensegler, Dampf-schiff. Frühe Schifffahrt in Südwestdeutschland. ALManach 5/6 (Stuttgart 2000).
S.-H. Siemers, Das Tor zur Welt – Lorschs Rhein-hafen Zullestein. In: Kloster Lorsch. Vom Reichs-kloster Karls des Großen zum Weltkulturerbe der Menschheit [Ausstellungskat. Lorsch] (Pe-tersberg 2011) 66-75.
H. Steuer, Der Handel der Wikingerzeit zwi-schen Nord- und Westeuropa aufgrund archäo-logischer Zeugnisse. In: K. Düwel u. a. (Hrsg.), Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. 4: Der Handel der Karolinger- und Wikingerzeit. Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-hi-storische Klasse 156 (Göttingen 1987) 113-197.
QuellenWandalbert von Prüm, Vita et Miracula sanc-ti Goaris, ed. H. E. Stiene, Lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters 11 (Frankfurt a. M., Bern 1981).
Körntgen, Königsherrschaft und Kaisertum
M. Becher, Die Kaiserkrönung im Jahr 800. Eine Streitfrage zwischen Karl dem Großen und
Papst Leo III. Rheinische Vierteljahrsblätter 66, 2002, 1-38.
M. Becher, Karl der Große. Beck’sche Reihe 2120 (München 42004).
P. Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die Begründung des karolingischen Kaisertums. Beiträge zur Geschichte und Quel-lenkunde des Mittelalters 9 (Sigmaringen 1988).
W. Hartmann, Karl der Große. Urban-Taschen-bücher 643 (Stuttgart 2010).
W. Pohl, Die Awarenkriege Karls des Großen 788-803. Militärhistorische Schriftenreihe 61 (Wien 1988).
R. Schieffer, Neues von der Kaiserkrönung Karls des Großen. Bayerische Akademie der Wissen-schaften, Philosophisch-Historische Klasse, Sit-zungsberichte 2, 2004 (München 2004).
R. Schieffer, Die Karolinger. Urban-Taschenbü-cher 411 (Stuttgart 52014).
Ch. Stiegemann / M. Wemhoff (Hrsg.), 799 Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Große und Papst Leo III. in Paderborn [Ausstel-lungskat. Paderborn] (Mainz 1999).
St. Weinfurter, Karl der Große. Der heilige Bar-bar (München 2013).
129
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Stefanie Berg-HobohmBayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4
80539 München
Ronald BockiusRömisch-Germanisches Zentralmuseum
Forschungsbereich und Museum für Antike Schiffahrt
Neutorstr. 2b
55116 Mainz
Jens BussmannUniversität Osnabrück
Institut für Geographie
Seminarstraße 19 ab
49074 Osnabrück
Falko DaimRömisch-Germanisches Zentralmuseum
Forschungsinstitut für Archäologie
Ernst-Ludwig-Platz 2
55116 Mainz
Peter EttelFriedrich-Schiller-Universität Jena
Bereich für Ur- und Frühgeschichte
Löbdergraben 24 a
07743 Jena
Dorothea FeinerFriedrich-Schiller-Universität Jena
Bereich für Ur- und Frühgeschichte
Löbdergraben 24 a
07743 Jena
Carolin HaaseFriedrich-Schiller-Universität Jena
Historisches Institut
Fürstengraben 13
07743 Jena
Achim HackFriedrich-Schiller-Universität Jena
Historisches Institut
Fürstengraben 13
07743 Jena
Franz HerzigBayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Am Klosterberg 8
86672 Thierhaupten
André KirchnerUniversität Leipzig
Institut für Geographie
Johannisallee 19 a
04103 Leipzig
Britta Kopecky-HermannsBüro für Bodenkunde und Geoarchäologie
Obere Achstraße 46
86668 Karlshuld
Ludger KörntgenJohannes Gutenberg Universität Mainz
Historisches Seminar, Mittelalterliche Geschichte
Jakob-Welder-Weg 18
55128 Mainz
Christian LaterBayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4
80539 München
Eva LeitholdtUniversität Leipzig
Institut für Geographie
Johannisallee 19 a
04103 Leipzig
Thomas Liebert Schwalbenhof 4
90574 Roßtal
Sven LinzenLeibniz-Institut für Photonische Technologien
Albert-Einstein-Straße 9
07745 Jena
Michael SchneiderLeibniz-Institut für Photonische Technologien
Albert-Einstein-Straße 9
07745 Jena
130
Mechthild Schulze-DörrlammRömisch-Germanisches Zentralmuseum
Forschungsinstitut für Archäologie
Ernst-Ludwig-Platz 2
55116 Mainz
Andreas SteleUniversität Osnabrück
Institut für Geographie
Seminarstraße 19 ab
49074 Osnabrück
Lukas Werther Friedrich-Schiller-Universität Jena
Bereich für Ur- und Frühgeschichte
Löbdergraben 24 a
07743 Jena
Timm WeskiBayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4
80539 München
Andreas WunschelFriedrich-Schiller-Universität Jena
Bereich für Ur- und Frühgeschichte
Löbdergraben 24 a
07743 Jena
Christoph ZielhoferUniversität Leipzig
Institut für Geographie
Johannisallee 19 a
04103 Leipzig