Marginale Möglichkeiten. Nathan Birnbaums europäisch-jüdische Alternativen
Transcript of Marginale Möglichkeiten. Nathan Birnbaums europäisch-jüdische Alternativen
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 21
Caspar Battegay
Marginale Möglichkeiten Nathan Birnbaums europäisch-jüdische Alternativen1
Vielleicht wäre die Geschichte der Juden anders verlaufen, wäre sie anders geschrieben worden.
Fritz Heymann, 19372
I. Potenzialität und Marginalität
Das Zeitalter der Ideologien und vielleicht auch das der Ideen ist end-gültig vorbei. Dagegen erleben Fiktionen alternativer Geschichtsver-läufe im Film und in der Literatur einen Boom3 – als hätten wir eine Sehnsucht nach einem Anderen als dem Realen, das aber politisch nicht mehr artikuliert werden darf, ohne unter Ideologieverdacht zu geraten. Eine Figur, die selbst in Vergessenheit geraten ist, die aber die-ses mangelnde Bewusstsein für die Kontingenz politischer Ordnungen wachrufen und dabei auch mithelfen könnte, das komplexe Verhältnis von Imagination und Geschichte, von Ideologie und Politik exempla-risch neu zu überdenken, ist der Publizist, Politiker und homme de lettre Nathan Birnbaum,4 der als »der jüdische Ideologe angesehen werden kann.«5 Speziell die hier vorgeschlagene Lektüre von Birnbaums völlig vergessenem utopischem Fragment mit dem Titel Nach tausend Jahren. Aus dem Entwurf zu einem jüdischen Roman kann ein solches Vorhaben stützen.
Dabei geht es nicht um ein »Was-wäre-gewesen-wenn …?«, sondern um eine Analyse von »Figuren der Potenzialität«, also »jener Möglich-keiten, die in das gegenwärtig Wirkliche und den Bestand seiner Posi-tivitäten eingelagert sind.«6 Das Denken dessen, das historisch auch möglich gewesen wäre, zeigt die Relativität des Geschichtsverlaufs und der realen gesellschaftlichen und politischen Ordnungen und Zustände. Die bei Birnbaum immer angestrebte »Plausibilisierung von Möglich-keiten«7 – die am ausführlichsten Robert Musil in seinem großen
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 22
22 | Caspar Battegay
Romanprojekt unternimmt –, also das Bewusstsein von Kontingenz und Potenzialität, schärft den Blick dafür, dass auch die jetzt erlebte Realität einmal bloße Möglichkeit – sei es Ideologie oder bloß Phan-tastik – gewesen sein mochte. Diese Perspektive hat seine Formel im Musil’schen »Möglichkeitssinn« gefunden. Dieser ist eben die Fähig-keit, »alles, was ebensogut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist.«8 Einfacher ausge-drückt stellt er fest: »Nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein.« In Birnbaums Variante ist der »Möglichkeitssinn«, so werde ich im Fol-genden argumentieren, nicht zu trennen von einer freiwilligen oder unfreiwilligen Marginalität.
In einem programmatischen Aufsatz mit dem Titel »Die juedische Renaissance-Bewegung« gibt Birnbaum 1902 in der Monatsschrift Ost und West seiner Überzeugung Ausdruck, dass Politik und Parteipolitik im Kern immer auf Figuren angewiesen sind, die Alternativen außer-halb der jeweiligen Partei aufzeigen. Diese Figuren bewegen sich not-wendigerweise am Rand:
Nur, wer sich mitten in den Werkeltagen des privaten oder parteimässi-gen Agitierens zu einem Feste der Gedanken und Betrachtungen über die treibenden Kräfte der Geschichte zurückzuziehen vermag, wird seinem Thun und dem seiner Partei die Wendungspunkte zeigen können, an denen nicht in gerader Linie vorbeigeschossen werden darf. Allerdings gerade in der Partei werden sich die wenigsten nach solchem Feste wieder einrenken können […]. Man will von den Nörglern, den Zauderern, den Theoretikern nichts wissen, die mit ihren blassen Gedanken jede That ankränkeln.9
Birnbaum spricht hier nicht nur von der Notwendigkeit einer aktiven Selbstabsonderung, vergleichbar mit Zarathustras Rückzug aus der Menschenwelt, sondern auch von einer passiv erlittenen Marginali-sierung. Alfred Döblin, der Birnbaum kurz vor dessen Tod besuchte, erinnert sich in einem Nachruf auch an diese Randständigkeit: »Er, der alte Riese, ist wie immer einsam gewesen.«10 Aus verschiedenen Gründen ein marginalisierter und vergessener Denker, hat Birnbaum aber wiederum aktiv die Dezentralisierung zum Gesetz seines Lebens und seines Werks gemacht. Max Landau spricht von »verstreuten Zei-tungsartikeln, Eintagsblättern, ephemeren Flugschriften, ohne star-ken Nach klang und schnell versickernd in der Vergeßlichkeit des Tages […].«11 Landau charakterisiert Birnbaums Biografie folgender-
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 23
Marginale Möglichkeiten | 23
maßen: »Keine ganze, runde Leistung, kein abgeschlossenes System. Keine Schule, kein Apostel, keine inspirierte Bewegung. Ein bruch-stückhaftes Leben, zusammengesetzt aus Widersprüchen […], fern von der breiten Heerstraße des Volkes.«12 Mit dieser bewussten Margi-nalität steht das Denken des »Wendungspunktes« und der Potenziali-tät in einem dialektischen Abhängigkeitsverhältnis, das in diesem Aufsatz genauer entwickelt werden soll. Wenn in Birnbaums unein-heitlichem, mindestens von drei sich ausschließenden ideologischen Strömungen geprägtem Werk eine Kontinuität festgestellt werden kann, dann ist es die von seinen Jugendjahren bis zu seinem Tod an -haltende Bereitschaft, politische, religiöse und kulturelle Alternati-ven, also mit seinem Wort »Wendungspunkte«, zu formulieren. Es soll im Folgenden gezeigt werden, dass sich Judentum für Birnbaum nur in diesem »Möglichkeitssinn« sinnvoll formiert. Das heißt, dass Birn-baum entgegen der verbreiteten Rede von der »jüdischen Identität« Judentum, als etwas zu verstehen scheint, das eben gerade nicht in einer Identität, sondern immer in einer unaufhebbaren Differenz begründet ist.
II. Kontinuität und Alterität
Nathan Birnbaum, geboren 1864 in Wien und gestorben 1936 in Sche-veningen (heute ein Stadtteil Den Haags), ist eine Gestalt, die nach 1945 meistens bloß in Fußnoten zur europäisch-jüdischen Geistesgeschichte auftaucht. Doch den Zeitgenossen war sein intellektueller Rang durch-aus bewusst. Bereits als sehr junger Student in Wien ist Birnbaum einer der wichtigsten Vordenker des Zionismus.13 Er ist Redakteur der Zeitschrift Selbst-Emancipation (18851893), Mitgründer der ersten jüdi-schen Studentenverbindung Kadimah und einer der Hauptredner am ersten Zionistenkongress 1897 in Basel, wo er sich in Opposition zu Theodor Herzl für ein vorwiegend kulturelles Verständnis des jüdi-schen Nationalerwachens, und nicht primär für eine territoriale Poli-tik, einsetzt. Ab 1900 – auch im Zusammenhang mit der schwierigen und schließlich unmöglichen Beziehung zu Herzl14 – setzt er sich für eine jüdische Autonomie in Österreich-Ungarn und für die jiddische Sprache ein. Er zieht mit seiner Familie nach Czernowitz, also an die Peripherie des Reiches, aus Birnbaums Sicht jedoch in das Zentrum des
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 24
24 | Caspar Battegay
jüdischen Lebens. 1907 kandidiert er als Reichsratsabgeordneter (also für das Abgeordnetenhaus des Parlaments der cisleithanischen Hälfte der Doppelmonarchie) für eine lockere Koalition jüdischer Nationalis-ten in Galizien, doch verliert er in seinem Bezirk die Wahl gegen den mit Betrug und Einschüchterungen arbeitenden Kandidaten der polni-schen Konservativen.15
Besser bekannt als diese Episode ist heute wohl die seiner Zeit weit vorauseilende Kritik des westlichen und westjüdischen Eurozentris-mus.16 Die damit verbundenen politischen Konzepte und Vorstellun-gen zu Staat und Nation, die der Tendenz der europäischen Politik teilweise entschieden zuwiderliefen, Birnbaums selbst deklarierte Rolle als »Nörgler« und Theoretiker, ist bis heute nicht gewürdigt wor-den. In diesem Aufsatz werde ich im dritten Teil ansatzweise darauf eingehen. Mit der Überzeugung, dass das sogenannte Ostjudentum das authentische Judentum verkörpere, geht im Unterschied zu anderen Intellektuellen wie Arnold Zweig oder Joseph Roth, die ähnliche Sicht-weisen vertraten, ein Bekenntnis zur religiösen Tradition einher. Wäh-rend des Ersten Weltkriegs deklariert Birnbaum sich öffentlich als Gläubiger (das Wort »orthodox« lehnt er ab).17 Gegenüber des histori-schen Trends zur Säkularisierung, der die Mehrheit der jüdischen Intellektuellen dieser Generation mehr oder weniger prägt, geht Birn-baum den umgekehrten Weg einer religiösen Rejudaisierung. Er gilt bis heute als Inbegriff eines baal t’schuwah,18 also eines Büßers oder Umkehrers, eines Ge- und Verwandelten. Von 1919–1922 bekleidet er sogar das Amt des Generalsekretärs der Agudath Israel, einer einfluss-reichen politischen Vereinigung der Orthodoxie, die gegen den Zionis-mus opponiert.
Ist Birnbaum am Anfang seiner Karriere überzeugter Materialist, propagiert er später ein biblisches und traditionell religiöses Weltbild und tritt entschieden gegen jeglichen Nationalismus ein. Zentral wird für ihn das Projekt der aulim [= die Aufsteigenden], einer Art spirituel-ler Liga, die das Judentum in der Erwartung des Messias zur Halacha zurückführen soll. In dieser Zeit gibt er in Berlin die Zeitschrift Der Aufstieg (19301932) und im niederländischen Exil die Zeitschrift Der Ruf (19341936) heraus, in der unter anderem auch bekannte Autoren wie Alfred Döblin oder Schalom Ben Chorin [Fritz Rosenthal] Artikel, Glos-sen und Rezensionen veröffentlichen. Beide Periodika sind faszinie-rende, bis lang kaum ausgeschöpfte Archive jüdischen intellektuellen
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 25
Marginale Möglichkeiten | 25
Lebens am Vorband der Shoah, deren Schatten sich in den zuweilen verzweifelten Texten zur Lage des deutschen Judentums abzeichnet. Dieser Periode seines Lebens werde ich mich im vierten Teil dieses Auf-satzes zuwenden.
Birnbaums gesamter Nachlass befindet sich heute im Archiv, das sein ältester Sohn Salomon in Toronto angelegt hat und der Enkel David weiterführt. Das Archiv zeigt, dass Birnbaum in all seinen Trans-formationen ein äußerst produktiver Schreiber ist. Er ist ein glänzen-der Rhetoriker und Stilist, der sich in allen Lebensphasen mit der kul-turellen Elite seiner Zeit austauscht. Er hat Tausende von Briefen, Hunderte von Artikeln, Dutzende Aufsätze und Essays, verschiedene kurze Dramen, unzählige Gedichte, ein Entwurf zu einem »Bibelfilm« mit dem Titel Um Ninive und ein Fragment zu einem utopischen Roman hinterlassen.
Es ist dieses Romanfragment, welches das Bewusstsein der Potenzi-alität in besonders prägnanter Weise zum Ausdruck bringt und das im nächsten Abschnitt analysiert werden soll – nicht zum Zweck einer Flucht ins vermeintlich Exotische, sondern um die theoretische Per-spektive anhand eines Textes zu überprüfen, der Marginalität, Alteri-tät und Potenzialität geradezu paradigmatisch engführt. Die Analyse soll auch die methodische Grundannahme dieses Aufsatzes untermau-ern. Nach dieser kann nicht von drei unterschiedlichen »Phasen« in Birnbaums Denken gesprochen werden. Vielmehr machen Diskonti-nuität und Brüche dieses Denken erst aus und treiben es an. Das Ver-bindende von Birnbaums verschiedenen sich widersprechenden Positi-onen ist die Überzeugung von der Notwendigkeit der »Wendungspunkte«, einer auch in sich selbst differenzierenden Alterität.
»Dem ewig – Anderen« überschreibt Joseph Carlebach (18831942), der damalige Oberrabbiner von Hamburg, seinen Nachruf auf Birn-baum in der letzten Nummer des Ruf. Darin geht Carlebach auch auf Birnbaums Pseudonym »Mathias Acher« ein, das dieser vor allem in seinen zionistischen Schriften, zuweilen auch später, benutzt. Das hebräische Wort acher bedeutet »der Andere«, ist aber vor allem die Bezeichnung für den Häretiker Elischa ben Abuja (um 70 u.Z.), also ein in der jüdischen Tradition negativ besetzter Titel, den sich Birn-baum vielleicht nach Carlebachs Deutung »in einer psychologischen Selbstschau des Trotzes, der Absonderung und Herausforderung« zu -gelegt hatte.
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 26
26 | Caspar Battegay
Ein Gedicht mit dem Titel »Ahasver und Acher (Vision am Meere)«, das 1903 in der Zeitschrift Ost und West erscheint, legt nahe, dass Birn-baum mit diesem Pseudonym ein unaufhebbares, intrinsisches Anders-sein für sich in Anspruch nimmt. Das Gedicht beschreibt, wie ein lyri-sches Ich am düsteren Meer steht und sich darin spiegelt. Doch das gespiegelte Bild im Meer führt nicht zur Identifikation, sondern schafft eine unheimliche Differenz: »Ich bin es nicht! / Ein andrer ist mein Spiegelbild, / Bin selbst ein andrer – / Acher bin ich, / Elischa ben Abuja, / Bin Ahasver und Acher, / Beide sind wir eins, / Jahrtausende schon eins …« Ahasver, der Ewige Jude, stellt einen zeitüblichen Topos für die Entfremdung des Judentums und für das anhaltende Exil dar. Er ist der nicht authentische Jude.19 Birnbaum verbindet dieses Bild mit der traditionellen Gestalt des Abtrünnigen, eines Juden, der selbst anders sein will als die Juden. Beide Figuren verweisen damit nicht bloß auf die Differenz des Judentums gegenüber seiner Umwelt, son-dern auch auf eine Differenz innerhalb des Jüdischen selbst, auf eine Spaltung oder einen Aufschub der Tradition.
Mit dem Bild des Anderen im Spiegel kann man diese Differenz auch als eine unheimliche und für das frühe 20. Jahrhundert typische Selbstwahrnehmung, auch in sich selbst noch anders zu sein, verstehen. Es ist diese moderne Unmöglichkeit der Identifikation, die Birnbaums ideologische Wendungen innerlich immer antreibt. Bezeichnender-weise endet das zitierte Gedicht ebenfalls mit einem Sich-Umwenden: »Beklommen tret’ ich fort vom Strand / Und zieh landeinwärts gegen Süden …« Im Kontext des Publikation muss die Himmelsrichtung Süden als Metapher einer zionistischen Sehnsucht gedeutet werden. Doch ist das Moment der Umkehr auch der eigentliche Birnbaum’sche Moment an sich. Birnbaums Zeiteinheit ist nicht die Phase, sondern der »Wendungspunkt«. Sein Denken wird nach jeder Wendung durch den Augenblick der Umkehr an sich bestimmt und nicht durch das, wohin er sich eigentlich gewendet haben müsste, was auch noch für seine Hinwendung zur Religion gilt. So stellt Carlebach fest: »Nicht die Statik der Orthodoxie: die ewige Dynamik der Teschuwa war Birn-baums Lebensluft und Lebensodem.«
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 27
Marginale Möglichkeiten | 27
III. Dynamik der Nation
Der Text Nach tausend Jahren. Aus dem Entwurf zu einem jüdischen Roman erscheint zuerst in der Neuen Zeitung, verteilt über vier Ausgaben zwi-schen dem 23. August und dem 13. September 1907,20 also einige Jahre vor Birnbaums öffentlichem Bekenntnis zur Religion, aber schon nach seiner Abwendung vom politischen Zionismus. Nach tausend Jahren ist allerdings nicht der erste erzählende Prosatext Birnbaums. Bereits 1885 veröffentlicht er in der Selbst-Emancipation einen Fortsetzungsro-man mit dem Titel Simson Rafaelowitsch und in den folgenden Jahren einige Novellen. Anders als die anderen Stücke befindet er dieses jedoch wertvoll genug, um es in seine 1910 in Czernowitz publizierten zweibändigen Ausgewählten Schriften zur jüdischen Frage aufzunehmen.21
Die Handlung von Birnbaums Text ist in einer weit entfernten Zu -kunft angesiedelt, in der es keine Nationalstaaten mehr gibt. Die Juden leben auf der ganzen Welt in verschiedenen Zentren verstreut, auch in Nordamerika, wo sie die Jiddisch sprechende Metropole »Mojesches-todt« errichtet haben. Die anderen globalen Lebensmittelpunkte des prosperierenden Volkes sind London, Wien, »Neu-Babel« sowie »Salonik, Stambul, Jeruscholajim« und vor allem das osteuropäische Wilna. Um von Stadt zu Stadt zu reisen, benutzen die Menschen öffentliche Luft-schiffe, die wie Busse »mit rasender Geschwindigkeit«22 in einem dich-ten Netz um die ganze Welt operieren. Mit dieser Vorstellung fügt sich Birnbaum in einen aeronautischen Diskurs um Luftschiffe ein, der viele Utopien der Jahrhundertwende begleitet und der, wie Clemens Peck gezeigt hat, auch für Herzl »zu einem buchstäblichen ›Leitmotiv‹ der zionistischen Utopie avanciert.«23 Wie die anderen großen Völker der Zeit – etwa die Tschechen oder die Japaner – besitzen die Juden kein kohärentes Territorium, haben aber trotzdem eine autonome politische Struktur. Vor allem haben sie sich ihre »nationale Kultur«, die »jüdische Art«, bewahrt.24 Birnbaum vertritt im Roman keinen Multikulturalis-mus, den er auch in einem seine USA-Reise von 1908 verarbeitenden Essay mit dem Titel »Der Amerikanismus und die Juden« ablehnt. In den USA hatte er auch eine Aufführung von Israel Zangwills gerade aktuel-lem Theaterstück The Melting Pot gesehen. Doch Birnbaum wollte eben keinen »Schmelztiegel«, sondern eine transterritoriale Gesellschaft mit rotierendem Zentrum, in der die verschiedenen Nationen in sich über-lappenden und durchdringenden Gebieten doch auf sich selbst bezogen
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 28
28 | Caspar Battegay
leben (eine lose Struktur, die assoziativ mit dem Verkehrsmittel oder Verbindungsmedium des Luftschiffs verbunden ist). Zur Zeit der Roman-handlung findet die jüdische Nationalversammlung in Wilna statt. Die politische sowie die spirituelle Agenda des jüdischen Commonwealth ist stark umstritten. Während der politische Mainstream ein säkulares Ver-ständnis von jüdischer Nationalität hat und eine individuelle Religiosi-tät vertritt, fordert eine kleine aber lautstarke Minderheit mit charisma-tischen Anführern eine Rückkehr zum rabbinischen Gesetz. Der Text bricht damit ab, dass die Mehrheit der Nationalversammlung diese kol-lektive Rückwendung zur Tradition ablehnt.
Wie jede historisch gewordene Utopie scheint auch Birnbaums ver-gessene Zukunft eine Art Paralleluniversum zu schildern. Der Bruch, der die Welt des 21. Jahrhunderts von dieser unmöglich gewordenen Alternative der Geschichte trennt, kann erstens mit dem Untergang Österreich-Ungarns und zweitens mit der Shoah und dem sogenannten »tausendjährigen Reich« erklärt werden. Gerade im Habsburgerstaat sieht Birnbaum wie auch andere jüdische Intellektuelle der Zeit ein Bollwerk gegen die »nationalistische Brutalität«, die »sich mit voller, ungeteilter Wucht auf uns werfen könnte« und preist Österreich-Ungarn als »großes, praktisches Musterbeispiel höheren, freieren Zu -sammenlebens der Völker«.25
Die Weltgeschichte hat bekanntlich Birnbaums Ängsten recht gege-ben, wenn auch nicht seinen Idealen. Für den heutigen Leser ist es daher mehr als befremdlich, dass Birnbaums Zukunftsroman ebenfalls vom Ende des deutschen Judentums ausgeht. Auf ihrer Reise durch Europa besuchen die Protagonisten der Story – der alte amerikanisch-jüdische Politiker Irmi Woldmann und seine zwei Enkelkinder – unter anderem auch Frankfurt, »die größte Stadt des deutschen Volkes«26. Die drei Weltreisenden schlendern durch die Metropole, sie »schritten mit Staunen und Unbehagen durch den Wirbel und die Lust.« Dabei stellen sie fest, dass in Frankfurt die »Würde« fehlt, »die unser Amerika so reichlich hat.«27 In Deutschland scheint ein Element der Bevölke-rung verloren gegangen zu sein. Welches das ist, wird schnell klar. Auf einmal betreten sie nämlich eine menschenleere, ruhige und verödete Gegend. Sie kommen in einen wilden, verzaubert anmutenden Garten, in dem eine unheimliche Stimmung herrscht: »Eine Toteninsel mitten in der Stadt!«28 Sie klettern über eine graue Steinmauer und finden dahinter im hohen Gras einen riesigen Grabstein:
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 29
Marginale Möglichkeiten | 29
Eine große Steinplatte, viereckig, auf einer Seite gerundet, mit einem riesi-gen Sprung quer durch und mehrfach abgebröckelt, lag unter einer mäch-tigen Zypresse. Und tausende kleine Kieselchen lagen auf ihr und Millio-nen Ameisen hasteten durch die Kieselchen hindurch. / »Lejser, weißt du, wo wir sind?« fragte endlich der Alte mit schwerer Stimme. Und behutsam strich er an einer Stelle die Steinchen weg. […] Noch waren sie deutlich zu lesen – die hebräischen Lettern. Eine Jahreszahl: 6134. »Weißt du nun, wo wir sind?« fragte er wieder und seine Stimme zitterte von einem Schmerze der seinesgleichen nicht kennt auf dieser Erde. »Auf dem Friedhofe des Judentums in Deutschland!« Und die Tränen der Seele des jüdischen Volkes rannen durch seine Worte. / »Großvater!« / »Es war ein langer Todeskampf, Lejser, und im ganzen voll Heldenhaftigkeit …« / Ganz still und stumm war es ringsum geworden. Die alten Bäume nickten auch nicht mehr; sie lauschten. Und doppelt neugierig lauschten sie, als sie plötzlich Klänge ver-nahmen, die irgendwo in ihrer Erinnerung ein dunkles Leben führten, Klänge, die auf Deutschlands Erde schon Jahrhunderte lange nicht gehört worden waren – – – – – – – – / »Jissgadal wejisskadasch schmej rabbo …«29
Birnbaum erwartet den Untergang der deutschen Judenheit für das Kalenderjahr 2373 [das Äquivalent zum jüdischen Jahr 6134]. Andere Details seiner Beschreibungen kommen aber beängstigend nahe an die Realität, etwa wenn man das merkwürdige Grabmal mit der Architektur des Berliner Holocaust Memorials oder des Berliner Jüdischen Museums vergleicht, das bekanntlich auf einer Seite vom sogenannten »Garten des Exils« umgeben ist. Beides sind Grabmäler nicht nur des deutschen, son-dern des europäischen Judentums: »Toteninsel[n] mitten in der Stadt«.
Doch Birnbaum war kein Prophet des Holocausts. Er hatte seinen erstaunlichen Text vermutlich als eine Art Anti-Herzl-Buch konzipiert und wollte die Entfremdung und kreative Leere des deutschen Juden-tums zeigen. Explizit artikuliert er seine kritische Sicht auf Theodor Herzl in einer Rezension zu dessen zionistisch-utopischem Roman Altn-euland, zuerst publiziert in der Wiener Wochenschrift Die Zeit und eben-falls in die Ausgewählten Schriften aufgenommen, die in ihren großen Zügen der berühmten Kritik Achad Haams folgt.30 Abgesehen vom zwei-felhaften literarischen Wert von Herzls Romans kritisiert Birnbaum daran drei Punkte. Erstens bemängelt er die allzu kurze »Frist, binnen welcher das Märchen Wirklichkeit geworden sein soll«.31 Es benötige weit mehr als dreißig Jahre, um eine neue Gesellschaftsform, nämlich die angestrebte »Wiedergeburt eines seit zwei Jahrtausenden entwur-zelten Volkes«32 zu erreichen. Zweitens meint er, dass Herzls jüdischer Staat in Wahrheit ein Konstrukt von »bürgerlich jüdischen Köpfen des
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 30
30 | Caspar Battegay
Westens«33 sei. Es schließe die Mehrheit des zeitgenössischen europäi-schen Judentums aus, also die jiddisch sprechenden sogenannten Ostju-den mit ihrer ganz eigenen kulturellen Tradition. Von einem organi-schen »Volk« könne bei Herzls Juden deshalb nicht die Rede sein.
Drittens sei Herzl vollkommen in einer »mechanistischen Auffas-sung befangen.« Die Geschwindigkeit und die Effizienz, mit der Herzl die Transformation der jüdischen Gemeinschaft und die Kolonisation Palästinas schildere, sei einem Denken der Planmäßigkeit geschuldet,34 das eine (fiktive) jüdische volonté generale voraussetzt: »[…] planmä-ßige – etwas ganz anderes als geschichtlich sich vollziehende – Einheit im Wollen und Handeln setzt eine völlige Einheit im Empfinden vor-aus. Eine solche ist aber bei keinem Volke, am allerwenigsten bei den heutigen Juden, vorhanden.«35 Während Herzl also von einer sprung-haften, plötzlichen Veränderung aufgrund des allgemeinen Willens (»Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen!«) ausgeht, sieht Birnbaum die zionistische Transformation des Judentums als langfristigen evoluti-ven Prozess eines organisch sich entwickelnden Volkes.
Birnbaums Herzl-Kritik und sein eigener (nicht zu Ende geführter) Versuch, einen utopischen Roman zu schreiben, markieren denn auch Birnbaums Wendung vom Zionismus zum ethnizistisch gefärbten Dias-pora-Autonomismus, wie er sich etwa im bereits angeführten Aufsatz zum »Amerikanismus« artikuliert und wie er ihn kurzzeitig auch real-politisch in seiner Kandidatur für das österreichische Abgeordneten-haus im Mai 1907 verfolgt. Nach tausend Jahren erscheint nur drei Monate nach diesem gescheiterten politischen Versuch, unter dem Pseudonym Mathias Acher und damit auch als eine Art literarisches Gegenstück zu einer Artikelfolge mit dem Titel »Nationale Autonomie«, die teilweise gleichzeitig unter der Abkürzung »B.« erscheint.
Offenbar unter dem Schock der Wahlfälschungen und des offen zutage tretenden nationalen Chauvinismus beschreibt Birnbaum eine neue, ideale Verfassung für Österreich-Ungarn, nach der jedem »Volk« weitreichende politische, erziehungspolitische, kulturelle und gesetzge-berische Unabhängigkeit zugesprochen werden soll. In seinen Artikeln widmet er sich verschiedenen institutionellen Detailfragen, geht auf tagesaktuelle Debatten ein und setzt sich auch mit verschiedenen Geg-nern der Idee der »nationalen Autonomie« in Österreich-Ungarn ausein-ander, vor allem mit Positionen des tschechischen Nationalismus, die eine Abspaltung von der k.u.k.-Monarchie anstrebten. Im Allgemeinen
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 31
Marginale Möglichkeiten | 31
würde mit dem Konstrukt der »nationalen Autonomie« »die Naturmacht des Volkstums gebändigt, ihres blinden Wütens entkleidet und in der Entfaltung ihrer wohltätigen Kräfte gefördert«.36 Birnbaum will also »den naiven Kosmopoliten einer vergangenen Epoche«37 genauso entge-genwirken, wie den verschiedenen nationalistischen Separatisten.
Nach tausend Jahren beschreibt eine utopische Zeit, in der dieses ide-ale Österreich-Ungarn der »nationalen Autonomie« auf die ganze Welt übertragen worden ist. Die Reisenden besuchen auch Palästina, wo es demensprechend weder einen »Judenstaat« gibt, noch eine unter jüdi-scher Leitung genossenschaftlich organisierte »Neue Gesellschaft«, wie sie Herzl beschreibt, der potenziell alle Menschen ungeachtet ihrer Religion oder Herkunft beitreten können.38 Vielmehr ist Palästina genauso organisiert wie die restliche Welt, nämlich mit territoriumslo-sen Nationen. So findet auf dem Boden des Landes Israel gerade auch die »arabische Nationalversammlung« in friedlicher Koexistenz mit den Juden statt. Aber auch in ferner Zukunft kommt diesem Land im jüdischen Emotionshaushalt ein exzeptioneller Status zu. Berele, die junge Enkeltochter Irmi Woldmanns, träumt bereits unterwegs »von den goldenen Getreidefeldern, den dunklen, geheimnisvollen Zedern-wäldern, von den weißen, stillen Dörfern, von den bunten Städten, die sich im blauen Meere spiegelten, von dem gewaltigen Jaffa und dem von heiligen Schauern erfüllten Jeruscholajim.«39 Erst mit dem Besuch in Palästina wird vollends deutlich, dass die globalisierte nationale Autonomie zu einem über Hunderte von Jahren andauernden kultu-rellen Aufschwung des Judentums geführt, der auch dessen religiö-sen Gehalt berührt hat. Während des Besuchs wird gerade »das große Fest des 9. Aph« gefeiert. Das religiöse Fest zur Erinnerung an die Tem-pelzerstörung wird von säkularer Kultur begleitet, es scheint seines melancholischen Charakters enthoben und zu einem rauschenden Volksfest geworden zu sein.
Aus allen Teilen des Landes waren Tondichter, die Dichter, die Bildner, die Darsteller und Sänger gekommen, und vor den Augen und Ohren allen Volkes wetteiferten sie in ihrer Kunst. […] Und Reigentänze wogten in fei-erlichen Rhythmen. Dann aber ging plötzlich ein Lachen durch’s Volk, ein glückliches, fruchtbares Lachen. Und die Paare fanden sich in Reinheit und Schönheit. Wilde Leidenschaften pochten an dünnen Wänden – und doch brachen die Wände nicht ein und die Leidenschaften wurden nicht zahm und schal …40
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 32
32 | Caspar Battegay
Bei allem zeitgebundenen Kitsch geht es Birnbaum in der Beschrei-bung des idealen Judentums – und von idealen jüdischen Jugendlichen in ihrem Sexualverhalten – um ein Gleichgewicht von Tradition und Moderne, von partikularem Judentum und Universalität, von Westen und orientalischem Israel. Dieses Gleichgewicht ist aber nicht als stati-scher Zustand gedacht, sondern als Dynamik eines Austauschs zwi-schen verschiedenen Polen. Zwar bestünde gerade im heiligen Land die Gefahr, dass das religiöse Element überhandnehme und mit ihm eine gewisse »Schlummerlust«, aber, so legt Birnbaum dem Politiker Irmi Woldmann in den Mund, diese Gefahr sei begrenzt, »weil doch wieder unser westliches Leben hineinströmt. Man fühlt den Atem Jeruschola-jims in Mojschestodt und Wilna, aber auch den Atem Mojschestodts und Wilnas in Jeruscholajims …«41
»Wilna« und »Mojschestodt« stehen für ein westlich geprägtes, säkulares und national orientiertes (das heißt jiddisch sprechendes) Judentum, das auch einen kulturellen Austausch mit den anderen Nationen pflegt. »Jeruscholajim« dagegen steht für ein orientalisches, traditionsbezogenes (hebräisch sprechendes) und ein in sich selbst zen-triertes Judentum. Diese beiden Pole sind jedoch in einer stetigen Hin- und Herbewegung, in einer stetigen Um- und Zuwendung verbunden. So wie der Abfall vom Judentum im Westen durch den »Atem« des Ostens verhindert wird, so wird auch die schädliche Selbstbezogenheit des Ostens durch den »Atem« des Westens aufgehoben. Diese gegensei-tige dynamische Inspiration von Tradition und Moderne bildet das Ju -dentum. Das andauernde Umwenden ist also nicht nur Birnbaums in -dividueller »Lebensodem«, wie Carlebach schreibt, sondern bildet auch die innere Dialektik dessen, was bei Birnbaum Judentum heißt. Dieses versteht er weder als abstraktes Moralgesetz, noch als ideale Wesen-heit, sondern nach dem Bild des Atemaustauschs als fortlaufenden organischen Prozess, der sprachliche und andere kulturelle Faktoren mit religiösen harmonisiert. Obwohl sich Birnbaum in seiner Kritik davon absetzt, zeigt gerade die Atem-Metaphorik seines Romanfrag-ments, dass er Herzls Vorstellungen doch näher stand. Altneuland ist ja bereits dem Namen nach als Modell einer Zirkulation von modernen und traditionellen Elementen angelegt und oft auch in Körpermeta-phern und anthropomorphen Bildern beschrieben. An einer Stelle heißt es bei Herzl: »Jerusalem war ein gewaltiger Körper geworden und atmete Leben!«42
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 33
Marginale Möglichkeiten | 33
Aus heutiger Sicht erscheint Birnbaums literarischer »Entwurf« von 1907 mit seiner vitalistischen Metaphorik also sicherlich nicht weniger kurios und antiquiert als Herzls Altneuland, stilistisch und erzählerisch ist der Text von nicht weniger zweifelhafter Qualität und oft in ähnliche problematische Phantasmen verstrickt. Was ihn jedoch im politisch-ideologischen Gehalt des Textes klar von Herzl unterscheidet und was noch heute bemerkenswert ist, ist die konsequente Entkoppelung des Territoriums vom Phänomen Judentum im speziellen und vom Begriff der Nation im allgemeinen. Boden und Territorium sind bei Birnbaum allen Nationen und Menschen zukommende Grundlagen, während Kul-tur, Religion und Sprache jeweils der Nation zukommende und die Nation in einem steten dynamischen Prozess bildende menschliche Grö-ßen sind. Der politische Begriff, dem Birnbaums Konzept heute am nächsten kommen würde, ist der binationale Staat. Damit wäre Birn-baum zumindest im Nahen Osten oder auch in Osteuropa auch heute noch – oder wieder – in einer krass marginalen Position wiederzufinden.
IV. »Ackerland statt Territorium«
Knapp 27 Jahre später, im April 1934, publiziert Birnbaum in seiner »unabhängigen jüdischen Zeitung« Der Ruf einen Leitartikel mit dem Titel »Kaddisch nach dem deutschen Judentum?«. Darin geht er auf sein damaliges »Phantasiestück« ein. Er zitiert die Stelle seines eigenen früheren Textes, an der sein Protagonist das Kaddisch für das deutsche Judentum spricht. Die Realität schien die Fiktion auf unheimliche Weise einzuholen: »Wird es wirklich dahin kommen? […] Stehen wir wirklich vor dem Untergang des um das Ganze so verdienten deut-schen Judentums? Das ist die bange Frage die heute fast jeden, der sich auch nur noch ein bisschen jüdisches Gefühl hat, durchzittert.«43 Es ist selbstverständlich, dass die Machtergreifung der Nationalsozialisten und die Diskriminierung und Bedrängung der jüdischen Deutschen durchgängig das dominante Thema der Texte im Ruf bilden. Doch wie unter anderem aus den Briefwechseln mit Alfred Döblin und Schalom Ben Chorin hervorgeht, war Birnbaum sehr darauf bedacht, dass die Zeitung im nationalsozialistischen Deutschland erscheinen konnte. Offenbar war mit der Bedrohung primär nicht der militante Rassenan-tisemitismus gemeint.
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 34
34 | Caspar Battegay
Und wen die Sache tiefer angeht, der denkt dabei, wie ich in meinem Phantasiestück, nicht an den Untergang durch allmähliges Aussterben und Fortwandern infolge widriger äusserer Anstösse – dann wäre das zwar noch immer der Verlust einer der interessantesten Ausprägungen der Judenheit, aber dieser Tod wäre wenigstens ein ehrenvoller – sondern an den Untergang durch von innen ausgehenden Schwund der religiös-natio-nalen Substanz.44
Birnbaum beklagt als religiöser Ideologe vor allem den »Schwund der religiös-nationalen Substanz«, den er als die größere Bedrohung als den Nationalsozialismus ansieht, weil sie das Judentum von innen her gefährde. Jedoch mache die politische Wende nun vollends deutlich, wie absurd die »fixe Idee« – also die Position der »deutschen Staatsbürger jüdischen Gaubens« – geworden sei. »Was sind das für merkwürdige Hel-den, die angesichts der hammerwuchtigen, Illusionen zertrümmernden Geschehnisse der letzten Zeit, nicht die Kraft haben, einem an sich nicht unbegreif lichen Verbundenheitsgefühle […] mit harter Hand zu weh-ren!«45 Birnbaum war nicht blind gegenüber der unerhörten Bedrohung, im Gegenteil sah er klar, dass die »Vernichtung immer näher an uns heranrückt«, wie er drei Monate später im Ruf formuliert.46 Doch »Ende und Wende der Emanzipation«, so der Titel einer Artikelfolge Döblins im Ruf, waren für Birnbaum nicht bloß im staatlich subventionierten Antisemitismus begründet, sondern im mangelnden Bewusstsein der »Eigenbedeutung« des Judentums. Mit prophetischem Gestus fordert er:
Einen Sturm braucht man, der in diese schlapp gewordene Judenheit hin-einfährt, so dass sie die jüdischen Güter wieder hervorholt, sie durch-forscht, sie lebt, an ihnen schöpferisch wird und Würde gewinnt. Persön-lichkeiten sind nötig, die solchen Sturm entfesseln, die ein schon in Agonie liegendes Volk ins Leben zurückrufen können.47
Die Frage stellt sich, wie Birnbaum sich diese Wiederbelebung vor-stellt. Was ist unter dem »Sturm« zu verstehen, der ein sterbenskran-kes Volk »ins Leben« zurückholen kann?
Döblin, der sich Mitte der 1930er Jahre stark für die sogenannte Freiland-Bewegung, den jüdischen »Neu-Territorialismus« engagiert,48 artikuliert eine Formel zur Wiederbelebung, die auch Birnbaum inter-essierte: »Absonderung von den alten Staatenvölkern, Gewinnung von Land, Normalisierung des eigenen Lebens.« Als Nachsatz zu diesem Programm bemerkt er: »Unverändert bestehen wird bleiben, bis ein gewisser Endzustand erreicht ist, die alte Orthodoxie.«49
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 35
Marginale Möglichkeiten | 35
Gerade dieser »alten Orthodoxie« aber rechnet sich Birnbaum zu. Seine Vorstellungen gehen ebenfalls in Richtung freiwilliger »Absonde-rung«, doch im Gegensatz zum Territorialismus geht es ihm in der geforderten »Wendung in der Geschichte des Golus«50 um eine zu er -langende »Moschiachwürdigkeit«51 des Judentums, um eine religiöse Sammlung und Besinnung in Erwartung des Messias, die in Palästina, aber auch überall sonst stattfinden könnte. In einem Aufsatz, der 1927 im Buch Im Dienste der Verheissung erscheint und 1936 in Birnbaums letzter selbstständiger Publikation Rufe wieder abgedruckt ist, sieht er diese Wendung in einer so genannten »Verländlichung« des Juden-tums. Birnbaum hegt die ziemlich vage Vorstellung agrarischer, theo-kratisch verfasster Gemeinschaften in der Diaspora.
Heraus aus jenen Städten, in denen der Mensch die Berührung mit dem offenen Lande verliert, heraus aus den Berufen, die nicht unmittelbare Naturbezwingung zum Gegenstand haben, hinaus in die Arbeit am Stoffe der Welt, hinaus vor allem auf die Felder, um zu säen, zu ernten und Ernte zu bergen! Hinaus überall hin, wo bei solcher Arbeit ein jüdisches Zusam-mensein in Massen möglich ist! Dort überall hinaus mit den gehetzten, geplagten, verzweifelten, wartenden Massen […] sie zu erziehen, zu schu-len, umzugestalten, zu einem Arbeits- und Bauernvolk zu machen.52 [Her-vorhebung im Original]
Mit dem gewohnten Pathos der Wandlung, das Birnbaums Schrei ben fast immer charakterisiert, nimmt er eine Position ein, die man als reaktionär bezeichnen könnte und der – angesichts dessen, dass Birn-baum selbst immer in großen Städten gelebt und ein typischer Intel-lektueller ohne Bezug zum »Stoffe der Welt« war – auch etwas Zwie-spältiges anhaftet, die aber vor allem bewusst marginal ist. Einerseits kritisiert er an den Zionisten die Zentralität des »Staatsgedankens« in Eretz Israel, an »uns Überlieferungstreuen« andererseits das Desinter-esse an den Fragen jüdischer Politik. Im kurzen Aufsatz »Der Weg« formuliert er seine Forderung, in Form der rhetorischen Frage auch seine eigenen Zweifel, an deren Realisierung: »Auch sie [die »Masse« der gesetzestreuen Juden] träumt von nichts anderem als von dem bal-digen und ziemlich wohlfeil zu gewinnenden Golusende. Wie soll sie da für Ackerland statt für Territorium und für eine ›Hierarchie‹ statt für gemütliche Anarchie zu gewinnen sein?«53 Mit »Hierarchie« meint Birnbaum seine hier nicht ausführlich zu erörternde Idee einer geist-lich-spirituellen, autoritär strukturierten Supragemeinde des Juden-
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 36
36 | Caspar Battegay
tums, die er in verschiedenen Publikationen verficht. Diese konserva-tive Seite seiner Überzeugung kann als »Okzidentalismus« bezeichnet werden, also jene traditionelle abendländische Feindschaft gegenüber dem modernen Abendland und seiner liberalen, aufklärerischen Er -rungenschaften und Symbole.54
Doch Birnbaums später Standpunkt erschöpft sich nicht in einem reaktionären Fundamentalismus. Die Formel »Ackerland statt Territo-rium« muss nicht allein als neoromantische Sehnsucht nach Authenti-zität, sondern gerade als Ablehnung des heilsgeschichtlich aufgelade-nen Zusammenhangs von Volk und Land verstanden werden und als Pragmatismus im Umgang mit Land und Boden. Die Verwerfung des Territoriums in Birnbaums religiösem Denken schließt an die Utopie der globalisierten nationalen Autonomie im frühen Romanentwurf an. Während um 1907 aber vor allem die Sprache (Jiddisch) die Essenz der diasporischen Nation bildet, sind es nun 1934 die Verheißung Gottes, die Halacha und die Messias-Erwartung. Ironischerweise besetzt der späte Birnbaum damit die Position der fundamentalistischen Gegen-spieler des Protagonisten aus Nach tausend Jahren, die er dort als impli-ziter Erzähler noch für gefährlich hält und strikt ablehnt. Der Offen-barung und dem offenbarten Gesetz kommen das Primat vor allen anderen Instanzen wie Kultur, Staat oder Territorium zu. Das jüdische Land an sich wird in eine messianische Zeit verlegt. In der »Verländli-chung« des Judentums ist zwar die Idee der Landgewinnung enthalten, aber nicht in der Form des territorial verfestigten Nationalstaates.
Die Abseitigkeit dieser Position Mitte der 1930er Jahre ist Birnbaum selbst vollkommen klar, wie seine konstanten Hinweise auf das Unpo-puläre seiner Ansichten zeigen. Doch um Verwirklichung konnte es diesem messianischen Ideologen nicht ausschließlich gehen. Vielmehr versteht er sich noch kurz vor seinem Tod als acher, als der immer Andere, um aus dieser Randposition heraus »alles, was ebensogut sein könnte, zu denken«, also mit dem »Möglichkeitssinn« die scheinbare Gegebenheit politischer Strukturen aufzubrechen. Wie die Idee der »nationalen Autonomie« mehr einen »Wendungspunkt« des Zionismus zeigt als eine wirklichkeitsfähige politische Option, so zeigt die Ideolo-gie der »Verländlichung« eine marginale Möglichkeit jüdischer Tradi-tion, die nur als Möglichkeit überhaupt bestehen kann.
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 37
Marginale Möglichkeiten | 37
V. Epilog 2012
Auf der Biennale von Venedig 2011 wurde der Staat Polen durch die israelischen Künstlerin Yael Bartana vertreten.55 Zusammen mit dem polnischen Politaktivisten und Intellektuellen Sławomir Sierakowski hatte Bartana das semifiktive Projekt des »Jewish Renaissance Move-ment in Poland« entwickelt, also einer »Jüdischen Renaissance-Bewe-gung in Polen«, dessen wichtigster Teil drei Filme bilden, die 2007, 2009 und 2011 entstanden sind. Obwohl der Titel das suggerieren könnte, beziehen sich die beiden nicht auf Birnbaum. Jedoch erscheint das Projekt wie ein später Reflex auf die in diesem Aufsatz erörterte Theorie von Birnbaums marginalem »Möglichkeitssinn«. Der erste Film mit dem Titel Mary Koszmary (Albträume) zeigt Sierakowski, wie er in einem leeren und halb verfallenen Stadion auf Polnisch eine Rede an die abwesenden Juden hält. Darin fordert er dazu auf, dass 3,3 Millio-nen Juden nach Polen einwandern sollen, um damit eine durch die Shoah und die kommunistische Gewaltherrschaft verloren gegangene ethnisch-kulturelle Vielfalt Polens wieder herzustellen. Die »Rück-kehr« der Juden stellt für ihn eine Utopie multikultureller Diversität Europas dar.
Der zweite Film, Mur i wieża (Mauer und Turm) zeigt im Stil zionisti-scher Propaganda-Filme der israelischen Gründerjahre fiktive junge Pioniere, die ein Kibbuz in der Warschauer Innenstadt errichten, und zwar dort, wo im Zweiten Weltkrieg das Ghetto gestanden hatte. Unter den verwunderten Blicken polnischer Passanten wird ein Wachturm errichtet. Eine Lehrerin hält Polnisch-Unterricht für die Israelis ab. Eine kurze Sequenz, in der ein Pionier Stacheldraht an die Holzmauer anbringt, macht schlagartig die Ambivalenz der gezeigten Situation deutlich, führt die Polarität nicht nur zwischen Israel und Polen, son-dern auch zwischen Galut und Ghetto, gelobtem Land und Ausschwitz vor. Diese Ambivalenz spielt Bartana in Zamach (Ermordung), dem drit-ten Film der Serie, am ausführlichsten durch. An der fiktiven Abdan-kungszeremonie auf den von Unbekannten ermordeten Anführer des zu einer großen, nicht nur Juden beteiligenden politischen Bewegung angewachsenen »Jewish Renaissance Movement«, werden verschiedene Reden gehalten, die unterschiedliche reale Positionen hinsichtlich jüdischer Identität zwischen Israel und Diaspora in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts artikulieren. Sierakowskis utopisch-idealistische
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 38
38 | Caspar Battegay
Vorstellungen sind nun, wie sich an seiner gespielten Beerdigung zeigt, zu einer Ideologie geronnen, die in unterschiedlicher Weise für politi-sche Zwecke in Anspruch genommen wird.
An einer Podiumsdiskussion anlässlich der Ausstellung der Filme in der Art Gallery of Ontario (AGO) in Toronto am 27. Januar 2012, sagte Sierakowski, dass es ihm bei der Idee einer Einwanderung von 3,3 Mil-lionen Juden nach Polen weniger um Möglichkeiten der Realisierbar-keit des monströsen Vorhabens geht, sondern um die Bedingung seiner Möglichkeit, also gerade umgekehrt um einen realen Zustand der Potenzi-alität. Das »Jewish Renaissance Movement in Poland« fordert dazu auf, die politische Realität nicht als gegeben, sondern in einem dialekti-schen Prozess mit Ideologie, der poetischen und der politischen Imagi-nation verbunden, also kurz: als veränderbar zu denken. In dieser For-derung treffen sich Bartana und Sierakowski mit Nathan Birnbaum. Denn wenn es heute – gleichsam nach tausend Jahren – ein ernst zu neh-mendes Erbe dieses zionistischen und religiösen Ideologen gibt, dann ist es seine Eigenschaft, Möglichkeiten, seien sie auch noch so margi-nal, vollkommen ernst zu nehmen und damit paradoxerweise die Potenzialität als das wirklich Wirkliche zu begreifen.
1 Jytte und David Birnbaum danke ich für die warmherzige Gastfreundschaft und die Gelegenheit, das in jeder Hinsicht außergewöhnliche »Nathan & Salo-mon Birnbaum Archive« in ihrem Haus in Toronto, Ontario, zu besuchen. Einige Resultate dieses unvergesslichen Aufenthalts sind in diesen Aufsatz ein-geflossen.
2 Fritz Heymann: Der Chevalier von Geldern. Eine Chronik vom Abenteuer der Juden, Ams-terdam: Querido 1937, S. 22.
3 Die Popularität des »alternate-history«-Genres belegt aus jüdischer Perspektive am besten der Roman The Yiddish Policemen’s Union von Michael Chabon (2006), vgl. Adam Rovner: »Alternate History: The Case of Nava Semel’s Isralands and Michael Chabon’s The Yiddish Policemen’s Union«, in: Partial Answers 9,1 (2011) 131–152.
4 Zu Nathan Birnbaum gibt es wenig Forschungsliteratur, allerdings seit einiger Zeit eine exzellente historische Biografie von Jess Olson: Nation, Peoplehood, and Religion in the Life and Thought of Nathan Birnbaum, unver. Diss., Stanford 2006; diese Arbeit wird voraussichtlich 2012 auch als Buch erscheinen. Auf die intellektuelle Bedeutung Birnbaums weist Olson zwar immer wieder hin, bietet jedoch keinen genauen Blick auf die Texte. Dieser Aufsatz ist dennoch in vielen Vorarbeiten Olsons Dissertation verpflichtet, was jeweils explizit ausgewiesen ist.
5 Ari Ofengenden: »Hybridität, Okzidentalismus und Neo-Orthodoxie bei Nathan Birnbaum«, in: Jüdische Literatur als europäische Literatur. Europäizität und jüdische
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 39
Marginale Möglichkeiten | 39
Identität 18601930, hg. von Caspar Battegay / Barbara Breysach, München: edition text + kritik 2008, S. 206–215, hier S. 208 (Schriften der Gesellschaft für europä-isch-jüdische Literaturstudien, Bd. 1).
6 Burkhardt Wolf: »Literarischer Möglichkeitssinn der Moderne«, in: Das Mögliche Regieren. Gouvernementalität in der Literatur- und Kulturanalyse, hg. von Roland Inner-hofer / Katja Rothe / Karin Harrasser, Bielefeld: transcript 2011, S. 19–30, hier S. 21.
7 Ebd. 8 Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften. Roman, in: Ders.: Gesammelte Werke, Bd.
I, hg. von Adolf Frisé, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1978, S. 16. 9 Nathan Birnbaum: »Die juedische Renaissance-Bewegung«, in: Ost und West. Illust-
rierte Monatsschrift für modernes Judentum 11 (1902), H. 9, S. 581–582.10 Alfred Döblin: »Zum Tod von Nathan Birnbaum«, in: Ders.: Schriften zu jüdischen
Fragen, hg. von Hans Otto Horch in Verbindung mit Till Schicketanz, München: dtv 1997 [Walter Verlag 1995], S. 344–347, hier S. 345 [Rückübertragung aus dem Jiddischen, original erschienen in: Naie Stimme, Warschau 1937, Nr. 2, S. 12–13].
11 Max Landau: »Nathan Birnbaum und das jüdische Volk«, in: Vom Sinn des Juden-tums. Ein Sammelbuch zu Ehren Nathan Birnbaums, hg. von A. E. Kaplan / Max Landau, Frankfurt am Main: Hermon 1924, S. 73–90, hier S. 80.
12 Ebd.13 Vgl. hierzu ausführlich Eleonore Lappin-Eppel: »Nathan Birnbaum und der
österreichische Zionismus 1882–1918«, in: Chilufim. Zeitschrift für jüdische Kulturge-schichte 7 (2009), S. 19–41; sowie immer noch grundlegend Joachim Doron: »Jüdi-scher Nationalismus bei Nathan Birnbaum (18831897)«, in: Jüdische Integration und Identität in Deutschland und Österreich 18481918, hg. von Walter Grab, Tel Aviv: Institut für Deutsche Geschichte der Universität Tel Aviv 1984, S. 199–256.
14 Für die Aufarbeitung dieser Auseinandersetzung vgl. Jess Olson: »The late Zio-nism of Nathan Birnbaum: The Herzl Controversy Reconsidered«, in: AJS Review 31 (2007), H. 2, S. 241–276.
15 Vgl. hier sehr genau Olson: Nation (siehe Anm. 4), S. 154–160.16 Steven E. Aschheim: Brothers and Strangers. The East European Jew in German and Ger-
man Jewish Consciousness 18001923, University of Wisconsin Press 1982.17 Vgl. Nathan Birnbaum: Vom Freigeist zum Gläubigen. Ein Vortrag von Dr. Nathan Birn-
baum, Zürich: Verlag »Arzenu«, Agudas Jisroel Jugend-Organisation 5679 [= 1918/19].
18 Vgl. Chaim Nussbaum; The Essence of Teshuvah. A Path to Repentance, Northvale, N. Y.: Jason Aronson 1993, Part I.
19 Vgl. Alfred Bodenheimer: Wandernde Schatten. Ahasver, Moses und die Authentizität der jüdischen Moderne, Göttingen: Wallstein 2002.
20 Die nur knapp ein Jahr existierende, von September bis Dezember 1906 und von Juni bis September 1907 erscheinende Neue Zeitung wurde von Birnbaum in Wien herausgegeben. Er war Chefredaktor und für die Mehrzahl der Beiträge verant-wortlich. Die Zeitschrift war also – wie auch die verschiedenen anderen von Birn-baum herausgegebenen Peridodika – eine ganz auf ihn zugeschnittene Publika-tionsplattform. In der Zeit, in der Birnbaum als Parlamentskandidat tätig war, erschien die Neue Zeitung nicht.
21 Nathan Birnbaum: »Nach tausend Jahren. Aus dem Entwurf zu einem jüdischen Roman«, in: Ders.: Ausgewählte Schriften zur jüdischen Frage, hg. auf Initiative eines Komités, Czernowitz: Verlag der Buchhandlung Dr. Birnbaum & Dr. Kohut 1910, Bd. 2, S. 329–351.
22 Ebd., S. 333.
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 40
40 | Caspar Battegay
23 Clemens Peck: Altneuland. Biographie einer Utopie, Universität Salzburg: Unver. Diss. 2010, S. 276.
24 Nathan Birnbaum: »Der Amerikanismus und die Juden«, in: Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 93–106, hier S. 101.
25 Nathan Birnbaum: »Die jüdische Nation in Österreich«, in: Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 145–162, hier S. 159.
26 Birnbaum, Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 331.27 Ebd., S. 332.28 Ebd.29 Ebd.30 Vgl. Clemens Peck: Altneuland (siehe Anm. 23), S. 236–241; sowie Barbara Schä-
fer: »›Über einem Hypocaust erbaut‹. Zu Herzls Roman Altneuland«, in: Menorah. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte 1993, hg. Julius H. Schoeps / Ludger Heid, in Verbindung mit Arno Herzig / Hans Otto Horch, München, Zürich: Piper 1993, S. 79–89.
31 Nathan Birnbaum: »Altneuland«, in: Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 272–276, hier S. 274.
32 Ebd., S. 275.33 Birnbaum: Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 275.34 Vgl. das Kapitel »Plan und Poesie« bei Caspar Battegay: Das andere Blut. Gemein-
schaft im deutsch-jüdischen Schrei ben, Weimar, Köln, Wien: Böhlau 2011, S. 242–249.35 Birnbaum: Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 274.36 B.: »Nationale Autonomie«, in: Neue Zeitung, 2.8.1907.37 B.: »Nationale Autonomie IV«, in: Neue Zeitung, 30.8.1907.38 Zur Ambivalenz und Komplexität der Herzel’schen Vorstellungen vgl. Eva Lezzi:
»Kolonialphantasien in der deutsch-jüdischen Literatur um 1900«, in: Dialog der Disziplinen. Jüdische Studien und Literaturwissenschaft, hg. von Eva Lezzi / Dorothea M. Salzer, Berlin: Monopol 2009, S. 437–479.
39 Birnbaum: Ausgewählte Schriften (siehe Anm. 21), Bd. 2, S. 340.40 Ebd., Bd. 2, S. 341–342.41 Ebd., Bd. 2, S. 342–343.42 Theodor Herzl: Altneuland, in: Ders.: Gesammelte Zionistische Werke. In fünf Bänden,
Tel Aviv: Hozaah Ivrith 1934, Bd. 5, S. 216; Vgl. dazu ausführlich Peck: Altneuland (siehe Anm. 23), S. 291.
43 Nathan Birnbaum: »Kaddisch nach dem deutschen Judentum?«, in: Der Ruf (L’Appel). Unabhängige juedische Zeitung Nr. 5/1, 1934, S. 1–2, hier S. 1.
44 Ebd.45 Ebd.46 Nathan Birnbaum: »Auserwählt!«, in: Der Ruf (L’Appel). Unabhängige juedische Zei-
tung, erste Julinummer 1934.47 Birnbaum: »Kaddisch« (siehe Anm. 43), S. 2.48 Für den Territorialismus ist Palästina nur eines der möglichen Länder, in denen
Juden sich ansiedeln könnten. Als Abspaltung aus der zionistischen Bewegung unter dem Schriftsteller Israel Zangwill (1864–1926) um 1905 gegründet, hatte er jedoch nie große Erfolge und die Organisation wurde nach Zangwills Tod auf-gelöst. Erst 1931 gab es erneute Bestrebungen, die territorialistische Bewegung als so genannter »Neu-Territorialimus« zu aktivieren. Döblin ist eine der führen-den Intellektuellen dieser Bewegung. Vgl. Hans Otto Horch: »Nachwort des Her-ausgebers«, in: Döblin: Schriften zu jüdischen Fragen (siehe Anm. 10), S. 525–578.
www.claudia-wild.de: Bodenheimer_Breysach Band 5/03.09.2012/Seite 41
Marginale Möglichkeiten | 41
49 Alfred Döblin: »Ende und Wende der Emanzipation«, in: Ders.: Schriften zu jüdi-schen Fragen (siehe Anm. 10), S. 280–292, hier S. 288.
50 Nathan Birnbaum: »Verländlichung«, in: Ders.: Im Dienste der Verheissung, Frank-furt am Main: Hermon Verlags-Aktiengesellschaft 1927, S. 57–72, hier S. 62 [Nathan Birnbaum: »Verländlichung«, in: Ders.: Rufe. Sieben Aufsätze, Antwerpen: Uitgeverij »Messilo« 1936, S. 21–30.]
51 Ebd., S. 63.52 Ebd., S. 62.53 Nathan Birnbaum: »Der Weg«, in: Ders.: Im Dienste der Verheissung (siehe Anm. 49),
S. 79–82, hier S. 79.54 Vgl. Ofengenden, »Hybridität« (siehe Anm. 5).55 Vgl. den Ausstellungskatalog A Cookbook for Political Imagination, hg. von Sebastian
Cichocki / Galit Einat, Warschau: Zachęta National Gallery of Art / Sternberg Press 2011.

























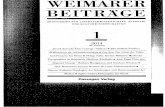






![["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63356a48a1ced1126c0ac8ca/jewish-regional-organization-in-the-rhineland-the-kehillot-shum-around-1300.jpg)

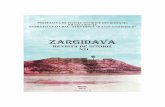

![Ernesto Nathan Rogers e a polêmica da arquitetura brasileira [Ernesto Nathan Rogers and the polemic of Brazilian Architecture], Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631af0aebb40f9952b023b15/ernesto-nathan-rogers-e-a-polemica-da-arquitetura-brasileira-ernesto-nathan-rogers.jpg)





