Widerstand/Dt.-jüdische Beziehungen nach dem Krieg/Israel
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Widerstand/Dt.-jüdische Beziehungen nach dem Krieg/Israel
Jüdisches Leben/ Antisemitismus/ Konzentrationslager/ Widerstand/Dt.-jüdische Beziehungen nach dem Krieg/Israel Bitte beachten Sie, dass zu den ab Seite 59 genannten Filmtiteln im Bundesarchiv kein benutzbares Material vorliegt. Gern können Sie unter [email protected] erfragen, ob eine Nutzung mittlerweile möglich ist. - Eiko-Woche 31/1914 ...An jüdisch-polnische Bevölkerung wird von deutschen Soldaten Brot verteilt. - Glaubensketten (Spielfilm/1916) Schauspiel aus dem jüdischen Ghetto in früherer Zeit. Nach dem Tode des alten Ghettoschnorrers Leiser Menscher tritt sein Sohn an seine Stelle. Er erhält durch den Rabbi die Erlaubnis, fürs Ghetto Einkäufe in der Stadt zu besorgen. Da sieht er, der weder lesen noch schreiben kann, zum erstenmale ein Theatervorstellung. Er faßt den Entschluß, das Ghetto und seine Mutter zu verlassen und Schauspieler zu werden. Der Möch Paulus lehrte ihm vorher das Lesen und Schreiben. Er schneidet sich die Peies ab, kürzt den Kaftan und flieht. Nach fünf Jahren ist er unter dem Namen Theodor Tews ein berühmter Hofschauspieler, verleugnet seinen Glauben, heiratet die Tochter des jüdische Bankiers Salamonis und wird vom Fürsten geadelt. Sein Heimatghetto hat ihn als Abtrünnigen verflucht, seine Mutter wird gemieden, daher entschließt sie sich, ihren Sohn aufzusuchen. Sie wird von Dora empfangen, die nun erfährt, daß ihr Mann Jude ist. Mutters Bitte, zurück ins Ghetto zu kommen, schlägt er ab, doch seine Frau mit ihrem Buben geht mit der Mutter durch und zieht ins Ghetto. Als er dies erfährt, verzichtet er auf Rang und Stellung, will auch ins Ghetto, wird jedoch vom Wächter fortgewiesen und beschließt sein Leben im Kloster beim Prior Paulus und schreibt ein Buch: "Glaubensketten". Gezeigt wird: Kaddisch am Totenbett; typische Ghetto-Gasse mit alten gestikulierenden Juden; Rabbiner-Stube/Schreibstube, Reden mit den Händen; Schnorrer im jüdischen Haushalt, am Tisch; Ghetto-Tor, -Bewachung und-Mauern; Durchsetzung der Orthdoxi mit Strafandrohung; Generations-, Emanzipations- und Glaubenskonflikt; Unterschied zwischen Ghettoleben und Außenwelt; Assimilation als Prozess und Abkehr vom Glauben der Väter; assimilierte Juden; Rückkehr zur Orthodoxi; Wiederaufnahme ins Ghetto und Abweisung als Strafe; Konvertierung zum Katholizismus und Eintritt ins Kloster als Bruder Theodor - Die fünf Frankfurter (SPF/1922) Die Geschichte der Familie Rothschild - vom Aufstieg des Frankfurter Stammvaters Maier Amschel (Teil 1) und seinen fünf Söhnen Maier Amschel Jr., Salomon, Karl, Nathan und Jacob (Teil 2). Es wird die Entwicklung des Frankfurter Bankhauses und der Geschäftshäuser in Wien, Paris, Rom und London geschildert, ebenso die Erhebung des Hauses Rothschild in den Adelsstand. ...Schloß, Festsaal, Ball; draußen über der Stadt Kanonendonner. Die Gäste fliehen. Soldaten kommen ins Schloß; sie zwingen den Diener den "Tresor" zu öffnen, doch der kurfürstliche Schatz wurde vorher rausgenommen. Der Kurfürst flieht mit 2 Gästen in einer Kutsche. Sie rasen davon und werden von 2-3 Reitern verfolgt und beschossen. Jüd. Familie am Tisch, Fritz Hirsch-Maier Amschel Rothschild sen. und seine Frau Gudula-Frida Richard mit 3 Kindern; der Vater liest aus einem Buch vor. Der Kurfürst mit den Gästen klopft an Maier Amschel Rothschild's Tür; sie werden ins Haus gelassen und im Keller versteckt. Jüd. Viertel/Gasse. Die Bewohner fliehen in ihre Häuser, nachdem sie die Bekanntmachung des Oberst Friscard-Emil Rameau: "Wenn innerhalb dreier Stunden der Versteck des kurfürstlichen Schatzes nicht bekannt gegeben wird, so wird das Ghetto in Brand gesteckt - General Ungeranu, gezeichnet Oberst Friscard, Kommandant" gelesen haben. Der Kommandant und die Soldaten kommen ins Haus von Maier Amschel Rotschild; sie durchsuchen das Haus; er wird festgenommen; seine Frau erscheint auf der Treppe und verabschiedet sich von ihm. Draußen auf der Straße die aufgebrachte Menschenmenge und Soldaten. Maier Amschel Rotschild wird an die Wand gestellt und wird von Friscard aufgefordert, das Versteck zu verraten. (Ende, unvollst., Fragment, =216,1 m)
- Frühling in Palästina (1928) Bilder vom Aufbau der jüdischen Heimstätte. - Makkabäer (1929) (unvollständig) ... der Makkabi-Welt-Verband (jüdische Sportbewegung) ist In 20 Kreise geteilt. Sportler beim Waldlauf; Hindernislauf (?), Zieleinlauf. Langlauf im Stadion. Zieleinlauf. Handballspiel. Stabhochsprung; Sprint; Staffellauf. Weitsprung. Wandergruppen im Wald; Rast, Essen und Trinken in gemeinsamer Runde. Gitarre und Flötenspieler am Seeufer. Zeltlager, morgendliches Waschen. Passanten schauen einem Straßenmusikanten mit Affen zu. Im Gebirge; Aufmarsch ... Das Makkabi-Sportfest in Mährisch-Ostrau (Tschechoslowakei) im Sommer 1929: Jüdische Sportsleute aus aller Welt sammeln sich in Mährisch-Ostrau. Der tschechische Kreis des Makkabi-Weltverbandes ist der Veranstalter. Makkabi Festkanzlei. Sportler in Zivil. ...anrollender Zug; winkende Sportler. Werbung mit Plakaten. Das Jugendmeeting eröffnet denTurntag. Josef Jekuteli, der Führer des Makkabi - Erez Israel. Truppe jüdischer Reiter. Präsidium und Ehrengäste. Die Delegierten der Länder ziehen durch die Straße. Fahnendelegation des Makkabi Mähren. Gruppen aus Deutschland und Jugoslawien. Filmreporter filmt den Aufmarsch von einem Lichtmast aus. Beim Weitsprung: Dr.Zander (Makkabi Mährisch-Ostrau), Dr. Hübsch (Hakoah Wien), Kamerling (Bar Kochba Leipzig). Die Sportler beim Sprung. (Zeitlupe) ...Der Kunstmaler Ludwig Blum, (Makkabi-Jerusalem) bei Übungen am Hochreck. ...Aufstellung zur Siegerehrung, Redner, Fahnengruppe. - Antwerpen 1930 ... In Antwerpen feiert man die Weltausstellung. Aufmarsch von Gruppen jüdischer Sportler, Marsch durch die Straßen von Antwerpen. - Ein Lämmchen/Chad Gadjo. Ein altjüdische Sinngedicht (1930) Alte jüdische Sage als Schlußgesang zum Osterfest - Rund um den Erdball (1930) ... Nach der Ausbootung bei Haifa fährt das Auto auf vielbeschrittener Karawanen- straße nach Damaskus, der Hochburg des Islams. ... Auf der Landstraße nach Jerusalem begegnet man Volkstypen verschiedenster Art. Blick vom Oelberg auf Jerusalem.Der Felsendom wurde im 7. Jahrhundert nach Christi gebaut auf dem Platz, wo ehemals der jüdische Tempel stand. An den Mauerresten des ehemaligen Tempels halten die Juden ihre Gebetsübungen ab. ... Durch das südliche Palästina, dem Schauplatz der Kämpfe um den Suez-Kanal im Weltkrieg, nach Kairo... (R.1) - Hertzberger-Film Nr.001: Familien Kutschera, Katz; Kurt Gerron; Laval, Briand, Brüning (1931-39) Privatfilm über Beispiele jüdischen Lebens: Familienfeiern, Urlaub. - Die erste Makkabiah (1932) ...EREZ ISRAEL: Betende Gläubige an der Klagemauer in Jerusalem. Im neuen Jerusalem steht das Haus des Keren Kayemeth Leisrael (Jüdischer Nationalfonds) Hebräische Universität. Im Hafen von Haifa. In der Bucht von Haifa laufen Tag und Nacht die Bagger, die den Hafen fertigstellen. Taucher überwachen auf dem Meeresgrund den Fortgang der Baggerarbeiten. ...Im Frühjahr 1932 fand zum ersten Male die Makkabiah (Makkabi - Kampfspiele) in Erez Israel statt. Von Triest fuhr das offizielle Makkabi-Schiff ab. Es hatte die Mann- schaften der Mitteleuropäischen Länder an Bord. Abschiedswinken; Besatzung und Sportler in ihren Uniformen; alle mit Davidstern an den Sportdress. Während der Fahrt. Land in Sicht!: Küste; Hafen. Jaffa. Boote der Makkabim aus Erez Israel fahren zur Begrüßung entgegen. ...Im großen Hof des Herzl-Gymnasiums sammeln sich die Teilnehmer zum Aufmarsch durch Tel-Aviv. Der Zug am Meer ...Die Makkabi – Kampfspiele. Empfang der Ehrengäste. Der Bürgermeister der Stadt Tel Aviv. Der High Commissioner. Der Vorbeimarsch der Länder. Die Fahne der
Makkabiah wird gehißt. Sportkämpfe: Frauen beim Diskus; Lauf; Ansager, Männer Diskus; wartende Sportler; Langlauf; Gymnastik der Massen. Abmarsch der Sportler; Kinder- und Jugendgruppen. ...Eine Woche lang dauerten die Makkabi-Kampfspiele, die in verschiedenen Städten des Landes durchgeführt werden. Abfahrt eines Schiffes aus einem Hafen. Männer- mannschaft unter jüdischer Flagge - Palestinska kronika (1932) ...Makkabi- (oder Makkabäer-) Sportfest in Tel Aviv (Sprache: tschechisch) - Zinsknechtschaft (1932) Rede von Gottfried Feder zur Wahl 1932 Ausschnitte: ...“Dieser Gedanke richtet sich ganz zielsicher gegen die Gewalten, die den Weltkrieg verschuldet haben. Denn hinter den kriegführenden Mächten sehen wir aufsteigen das grinsende Gesicht des Juden, der mit seinem Geld die Welt in den Krieg hinein- gehetzt hat.“ ...“ Erst kommt mein Volk und dann die anderen alle! Erst meine Heimat, dann die Welt! Es ist viel wichtiger, daß ein deutscher Arbeiter Arbeit findet, als daß irgendein Jude im Welthandel draußen seinen Profit und seine Prozente einstreicht.“ ... „Dazu gehört natürlich, daß wir die Banken verstaatlichen. Schon wie einmal der Herrgott, schon wie einmal Christus die Tem... die Juden aus dem Tempel hinaus- gejagt hat, so werden auch wir die Juden aus den Banken hinauswa...jagen und das gesamte Geld- und Kreditwesen verstaatlichen. Das ist die Voraussetzung für die Brechung der Zinsknechtschaft. „ - Bildberichte 1932 – 1933 ...Boykott jüdischer Geschäfte in Halle: SA-Männer mit Propagandaschildern stehen vor jüdischen Geschäften in der Innenstadt. (Geschäfte „Sobel“, Wohlwert“, A. Huth & Co.“, „Rosenberg“, „Sponner“). Schilder mit den Aufschriften „Keinen Pfennig dem Judenkapital. Kauft nicht in den Warenhäusern u. Einheitspreisläden“, „Deutsche! Kauft nur in deutschen Geschäften“ und „Zur Abwehr der jüdischen Greuel- und Boykotthetze. Deutsche kauft bei Deutschen“. Eine junge Frau wird von einem SA-Mann daran gehindert, ein jüdisches Geschäft zu betreten. - Bis 5 nach 12 (1953) ...Goebbels spricht bei der Bücherverbrennung 1933: „Deutsche Männer und Frauen! Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende“ (R.2) ...Boykott jüdischer Geschäfte am 1.4.1933. Rufe „Deutsche, macht Euch frei von der Judentyrannei“ und „Deutsche, wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ (R.2) - Deutschland erwacht (1933) ...Göring (Preußischer Innenminister) spricht, am Schreibtisch sitzend: ...“Ich werden den Kampf gegen Schmutz führen für die Sauberkeit und die gute deutsche Sitte. Die Städte müssen wieder gesäubert werden von jenen volks- und rassetrennenden Erscheinungen, die durch ihre zersetzende Tätigkeit deutsche Sitten untergraben und das Laster geprägt haben. Unser besonderes Augenmerk aber gilt dem Volk und Reich zerstörenden Kommunismus; ihm habe ich den schärfsten Kampf angesagt“ ... - Hitler an der Macht (1960) ...Judenboykott am 1.4.33: SA mit Fahnen auf Lastwagen. Fenster mit Schild „Achtung, Juden!“ und Totenkopf; Schild „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ Rufe:„Deutsche! Macht Euch frei von der Judentyrannei!“ und „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ - Hitlerrede in Siemensstadt (1933) Rede am 10.11.1933, u.a. „...Der Völkerstreit und der Haß untereinander, er wurde gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine wurzellose internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt, die nicht will, daß sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen
Boden haben, auf dem sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso in Brüssel sein können, übermorgen in Paris und dann wieder in Prag oder Wien oder in London, und die sich überall zu Hause fühlen.“ (Zwischenruf aus dem Publikum: „Juden!“). „Es sind die einzigen, die wirklich als Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können...“ - Hitlers Aufruf an das deutsche Volk (1933) ...Einleitung: Hetzrede von Goebbels am 10.2.1933 im Sportpalast gegen die jüdische Presse: „...Wenn die jüdische Presse darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun den Reichskanzler auf allen deutschen Sendern sprechen läßt, so können wir darauf nur zur Antwort geben: Wie Ihr es uns vorgemacht habt, so machen wir es jetzt nach...“ „...Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen, wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung... (Beifall)...Beide müssen einander ergänzen. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben auf versteckte Drohungen die Nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können; wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen – sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden...“ .(Beifall).....Und wenn wieder andere jüdische Zeitungen der Meinung sind, sie können jetzt so mit fliegenden Fahnen zu uns herüberschwenken, dann können wir nur zur Antwort geben: Isidor, stürzen Sie sich nicht in Unkosten, es... (das Ende des Satzes „...ist vollkommen zwecklos...“ geht im Beifall unter. ...Es wird auch der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil um- zulügen. Wenn die Rote Fahne es in typisch jüdischer Frechheit wagt zu behaupten, dass unser Kamerad Maikowski und der Schupowachtmeister Zau...Zauritz von unseren eigenen Kameraden erschossen worden seien... (Empörung bei den Zuhörern, Pfui-Rufe) so muss ich sagen: diese jüdische Frecheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Wir werden den Herren vom Liebknecht-Haus bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben...“ (R.1) - Die letzten 60 Jahre Weltgeschehen (BRD/1950) ...Judenboykott 1.April 1933 in Berlin, Unruhen. (1.Mai 1929 am Bülow Platz) (R.4) - Kaufmann, nicht Händler (1933) Film vom 1.Deutschen Handelstag in Braunschweig mit einer Rede des Präsidenten des Deutschen Industrie- und Handelstages, Dr. von Renteln . Mit Trickteilen (Juden fliegen durch das Bild), die den Anteil der Juden an verschiedenen Berufssparten zeigen. Redeausschnitt: „Wenn man den Dingen klar ins Auge schauen will, dann muß man erkennen, daß in den letzten 14 Jahren im deutschen Volk, und insbesondere im deutschen Handel, ein furchtbarer Schaden angerichtet worden ist. Nach dem Kriege ergossen sich die Heuschreckenschwärme der Ostjuden über das deutsche Land. Sie trugen ihren zer- setzenden Einfluß in die Kreise des deutschen Handels. Aber keineswegs nur in den Handel trugen sie ihren raffenden Geist. Sie vergewaltigten auch die deutsche Kultur, zersetzten die Literatur, nisteten sich im Theaterwesen ein, verunstalteten die Wissenschaft an den Hochschulen, verunglimpften die deutsche Kunst, machten sich die deutsche Presse hörig, zerstörten das deutsche Rechtsleben und vernichteten unsere Ehrauffassung, vergifteten den Geist der deutschen Wirtschaft, schufen das Glücksrittertum in der Industrie, beuteten die Bauern und Arbeiter aus und würdigten den deutschen Handel herab. Auf allen Lebensgebieten des deutschen Volkes zerschlugen sie überall die Sitte und das deutsche Wesen mit ihrem raffenden, spekulationslüsternen Geist der Verantwortungs- losigkeit.“ (R.2) - The Nazi Plan II (1945) ...Judenboykott in Berlin am 1.4.1933: die große jüdischen Kaufhäuser am Vor- abend mit regem Betrieb, am Tag des Boykotts geschlossen. SA mit Transparenten „Deutsche wehrt Euch“. Ansprache von Goebbels im Lustgarten. (Org. Ton) ...Jüdische Demonstration in New York. - Actualités Fox Movietone (3) ...Kurzer Ausschnitt aus der Rede von Goebbels am 1.4.33 im Lustgarten zum Judenboykott.
Plakat „Deutsche, verteidigt Euch gegen die jüdischen Greuelpropaganda, kauft nur bei Deutschen!“ Darunter steht der gleiche Text in englischer Sprache. SA-Leute auf Last- wagen mit Schildern „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden“ und „Juden raus!“ und mit Hakenkreuzfahne fahren durch eine Straße. Sprechchöre „Deutsche! Kauft nicht bei Juden!“. SA-Mann steht vor einem Leiser-Schuhgeschäft. SA-Leute rufen „Deutsche! Macht Euch frei von der Judentyrannei!“. Anbringen eines Plakates an einem Möbelgeschäft. SA-Mann malt den Davidstern an ein Schaufenster. Geschäft der Gebrüder Alster mit dem Wort „Jude“ und dem Davidstern am Schaufenster. SA-Mann mit dem Plakat um den Hals „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden.“ - Deulig-Tonwoche 66/1933 ... Große jüdische Geschäfte am Ku-Damm am Vorabend des Boykotts, „normaler“ Betrieb: Am Tag des Boykotts - heruntergelassene Jalousien. Berlin. (Juden-Boykott). Sprecher: "Trotz Boykott Ruhe und Ordnung in Berlin." Die grossen jüdischen Ge- schäfte am Vorabend: Tietz, Grünfeld Kurfürstendamm, Wertheim u. a. am Tag des Boykotts, dieselben Geschäfte mit herabgelassenen Gittern, geschlossen, SA-Männer vor Geschäften, man sieht Glasscherben. Gruppen von SA mit Transparenten, Auf- rufe gegen jüdische Geschäfte "Deutsche wehrt euch! kauft nicht bei Juden! Als Gegensatz hierzu wird eine Demonstration in New York gezeigt, eine Gruppe von Rabbinern auf einer Treppe nimmt den Vorbeimarsch ab. - Fox Tönende Wochenschau 1932/33 ...Boykott jüdischer Geschäfte in Berlin. Sprechchöre „Deutsche! Kauft nicht bei Juden!“; Davidstern wird an das Fenster eines Geschäftes gemalt. Schilder: „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“; „Deutsche, verteidigt Euch gegen die jüdische Greuelpropaganda und kauft nur bei Deutschen!“ (Das Gleiche steht auf dem Schild auch in englischer Sprache); „Achtung, Deutsche! Diese jüdischen Inhaber der 5 P.S. Läden sind Schädlinge und Totengräber des deutschen Handwerks! Sie zahlen dem deutschen Arbeiter Hungerlöhne! Der Hauptinhaber ist der Jude Nathan Schmidt“ ... Goebbelsrede im Berliner Lustgarten (Org.Ton) zum Boykott jüdischer Geschäfte am1.4.1933: Heil-Rufe. „Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen! In einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Unsere Partei und unser Führer! Heil! Heil! Heil!“ - Unser 1000 jähriges Meisenheim und unser 100 jähriges Heimbacher Brunnenfest (1934/35) ...Spruchband am Untertor „Juden sind hier unerwünscht“. Anschlagkasten an einer Hausecke mit Beschriftung „Die Juden sind unser Unglück“. (R.1) - Der Frankentag auf dem Hesselberg, 2. Teil (1934) ... Wir wollen nicht Haß erzeugen gegen andere Völker! Wir reichen jedem Volke die Hand!... (ZT-Ende). Streicher und junges Mädchen am Rednerpult - ZT:...aber der Jude ist es, der nicht den Frieden will (ZT-Ende). ...ZT: Wir haben zurückgefunden zur Stimme unseres Blutes! (ZT-Ende); Zuhörer. Streicher wischt sich die Glatze. - Gauschule I Franken des nationalsozialitischen Lehrer-Bundes in Henfenfeld Kreis Hersbruck bei Nürnberg (1934) [sic!] ...Stadtrat Pg. Fink spricht über die Judenfrage. Zwischentitel: Die Judenfrage ist der Schlüssel zur Weltgeschichte. - Hitlers erste Regierungszeit (1933 o. 1934) ... In einem Konzentrationslager (vermutlich Oranienburg). Häftlinge in einem offe- nen Geviert, in der Nähe einer Wohnsiedlung, das von einem Stacheldrahtzaun umfasst ist. Die Häftlinge werden von einem SA-Mann mit Armbinde "Hilfspolizei" zum Antreten befohlen. Der SA-Mann meldet die Häftlinge einem SA-Führer, daneben SA-Mann mit Gewehr als Wache. Häftlinge mit SA-Mann als Vorturner bei gemeinsamen Freiübungen, SA-Wache daneben. Häftlinge beim Wäschewaschen und bei der Essensausgabe. Als Unterbringung dient anscheinend ein altes Fabrikgebäude. Im Hintergrund ein Wachturm. - Nur nicht weich werden, Susanne! (Spielfilm/1934)
Thema Arbeitslosigkeit. Die Direktoren Sally Gold und Archinowitz der Filmfirma, bei der Susanne eine Komparsenrolle erhält, sind in der Halbwelt etabliert und betreiben mit Billigung eines hohen Polizeibeamten einen ilegalen Spielclub. Mit Hilfe von Susanne werden die Machenschaften aufgedeckt. Es hat inzwischen eine politische Wende gegeben und die Korruption ist beseitigt. Tendenz des Films, das Filmmilieu der Weimarer Republik als Vorwand für antisemitische Beeinflussung zu verwenden. - Triumph des Willens (1934) ...Julius Streicher spricht: “ Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse achtet, geht zugrunde“ (R.4) - Ufa-Tonwoche 195/1934 ...New York: Protestkundgebung der Deutsch-Amerikaner gegen den Boykott deutscher Waren. Sprecher auf der Kundgebung: Das amerikanische Volk will Frieden mit dem deutschen Volk. Störenfried sei das Judentum. - Land der Verheißung (Land of promise) (Palästina/1934/35) Film über das zionistische Einwanderungswerk und Siedlungswerk in Palästina. Gezeigt werden die Leistungen der jüdischen Siedler bei der Modernisierung von Wirtschaft, Infrastruktur, Bildungs, Alltagskultur und politischem Leben Palästinas. Der Film betont die Bedeutung Palästinas als Heimstätte für die Juden der Welt und fordert diese auf, die zionistischen Gruppen und die Einwanderung zu unterstützen. - Bildbericht Nr. 12 (1935) ... 1000 Jahre Allstedt - 10 Jahre NSDAP (Ortsgruppe Allstedt): Galgen mit daran hängender Puppe (mit Bart und Homburger), offensichtlich als Diffamierung der Juden - Landvolk in Not (1936) ...Redeausschnitt: „Landvolk in Not! Verständnislos stand in der Systemzeit der Bauer der Katastrophenpolitik zahlloser Parteien und Berufsorganisationen gegenüber. Denn sinnlose Einfuhr zerstörte ihm die Lebensgrundlage. Schon auf dem Halm gehörte die Ernte dem Juden. Die übrigen Erzeugnisse konnte der Bauer nicht absetzen. Er wurde zum Ausbeu- tungsobjekt artfremder Schmarotzer, die sich überall dort mästen, wo kapitalistische Auflösung und Verfall die Menschen entwurzeln. Diese Schmarotzer beherrschten die Börsen und machten sie zu Spielbällen, in denen das Brot des deutschen Volkes als Spieleinsatz diente. So ergaunerten sich diese unsozialen Elemente auf Kosten der Schaffenden mühelos Riesengewinne, die sie dann in Vergnügungslokalen in zweifelhafter Gesellschaft verpraßten. Dazu werden Bilder gezeigt, die den Typ des Juden symbolisieren. Mit dem Ausdruck „zweifelhafte Gesellschaft“ sind Schwarze gemeint. - Kreisappell in Merseburg am 25. August 1935 ...Über eine Straße gespannte Transparente mit den Aufschriften „Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter“ und „Ein Jud und eine Laus ist wie die Pest im Haus“. Infokasten der Zeitung „Der Stürmer“. - Trachten auf dem Reichsbauerntag in Goslar 1935 Rede von Staatssekretär Herbert Backe auf der Haupttagung: „Ich stelle nur fest, dass aber eine gemeinsame große Linie durch alle Völker geht und in allen künftigen Wirtschaftsgestaltungen zu verfolgen sein wird. Die Völker empfinden national und die Völker beginnen zu empfinden sozialistisch. Im vollendeten Widerspruch zu dieser Entwicklung befindet sich nun das Judentum. Es bangt darum, dass die ihm arteigene freizügige Wirtschaft auch in ihrer Entartung und Erstarrung, wie wir sie kennengelernt haben, erhalten bleibt und hiervon die Machtstellung, ja die Stellung des Judentums überhaupt abhängt.“ - Reichsparteitag Nürnberg 1935 ...Antisemitische Hetzrede von Goebbels auf dem Reichsparteitag in Nürnberg. (Org. Ton) (siehe auch Echo der Heimat, Folge 5) - Die Stadt der Verheißung (1935)
„Es stehe klar für alle Zukunft, dass das deutsche Bauerntum nicht wieder Lust hat, unter die Gesetze des jüdischen Spekulantentums zu gehen und eher bereit ist, mit Adolf Hitler unterzugehen als sich nochmal unter die Knute zu beugen.“ (R.1) - The Nazi Plan II (1945) und - Nürnberg und seine Lehre (1947) ...Verkündung der Nürnberger Gesetze auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1935 durch Göring (Org. Ton) - Ufa-Tonwoche 257/1935 ...Goebbels spricht auf dem 10.Parteitag des Gaues Essen in Essen-Mülheim: „Ihr begeht in feierlicher Weise den 10. Gründungstag Eures Gaues, und ich kann mit Stolz von mir sagen, ich bin damals auch mitten unter Euch gestanden. Wie Unrecht Ahben jene, die da glauben, sich erhaben heute über uns hinwegsetzen zu können. Juden...(Text unverständlich) ... in der Reichshauptstadt gegen einen antisemiti- schen Film offen zu protestieren. Da allerdings ist der Augenblick gekommen, wo wir sagen ‚Bis hierher und nicht weiter‘. Nicht die Auslandspresse, sondern wir regieren Deutschland...“ - Ufa-Tonwoche 264/1935 ...Rede von Goebbels auf dem Reichsparteitag : „Während der Nationalsozialismus eine neue Fassung und Formung der europäischen Kultur in die Wege leitet, ist der Bolschewismus die Kampfansage des von Juden geführten internationalen Unter- Menschentums gegen die Kultur an sich. Er...er ist nicht nur ...er ist nicht nur anti- bürgerlich; er ist antikulturell. Er bedeutet in der letzten Konsequenz die absolute Vernichtung aller wirtschaftlichen, sozialen, staatlichen, kulturellen und zivilisatorische Errungenschaften des Abendlandes zugunsten einer wurzellosen und nomadenhaften internationalen Verschwörerclique, die im Judentum ihre Reprä- sentanz gefunden hat...“ - Appell des Kreises Liebenwerda in Falkenberg 1936 ...Schild am Bahnhof: "Juden kehrt! Euer Weg nach Palästina führt nicht durch diesen Ort." Bunte Veranstaltung des Fernsehsenders Paul Nipkow (1936) ... Ansager bringt humoristische Anspielung auf Konzentrationslager - Echo der Heimat, Folge 3 (1936) ...Reichsparteitag 1935. Hitler am 15.05. 1935 zur Annahme der Nürnberger Gesetze: „Ich schlage dem Reichstag die Annahme der Gesetze vor, die Ihnen Parteigenosse Reichstagspräsident Göring verlesen wird. Das 1. Und 2. Gesetz tragen eine Dankes- Schuld an die Bewegung ab, unter dessen Symbol Deutschland die Freiheit zurück- Gewonnen hat“. (R.3) - Echo der Heimat, Folge 5 (1936) ...Antisemitische Hetzrede von Goebbels auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 1935. (Org. Ton) ...Was wir unter Idee und Weltanschauung im allgemeinen zu verstehen pflegen, hat mit dem, was man Bolschewismus nennt, gar nichts zu tun. Es handelt sich bei ihm um einen pathologischen, verbrecherischen Wahnsinn, nachweisbar von Juden erdacht und von Juden geführt mit dem Ziel der Vernichtung der europäischen Kulturvölker und der Aufrichtung einer internationalen jüdischen Weltherrschaft über sie.... (R.3/4) ...Prozeß gegen den Attentäter David Frankfurter vor dem Graubündener Kantons- gericht (R.6) - Echo der Heimat, Folge 6 (1936) ... Hitler trifft zur Eröffnung eines neuen Teilstücks der Autobahn ein. Er besteigt ein Podium und spricht (vermutlich zum 1000. km am 27.9.36): "Das neue deutsche Reichsautostrassennetz ist nicht nur in seiner Anlage das Gewaltigste was es in dieser Art auf der Welt gibt, das Vorbildlichste was es gibt, es wird auch mehr als alles andere mithelfen die deutschen Gaue, die deutschen Lande miteinander zu
verbinden und in eine Einheit zu zwingen. Da können dann diese Menschen hergehen und im Ausland ihre dummen Zeitungsartikel herunterlesen, in denen sie zusammen- schmieren, was sie an Lügen erfinden können. Am Ende kommt doch der und jener, und es sind heute schon tausende, und zehn- und hunderttausende, die gerade über diese Strasse fahren; der kommt nach Deutschland und dann muss er sagen: 'Herrgott, was für einen Judenschwindel haben wir die ganze Zeit jetzt gelesen. Es ist ja ganz anders." (Beifall). - Wilna (1936) ...im Ghetto in Wilna. - Deulig-Tonwoche 257/1936 ...Gemeinsame Tagung der Reichskulturkammer und der Organisation „Kraft durch Freude“. Rede von Goebbels über die Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Kulturleben (Org.Ton) „Wir haben eine deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, ein deutsches...?... und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden...“ - Die Straßen Adolf Hitlers - Die Alpenstraße (1936/37) ...Den Bauarbeiten ist das Lied „Brüder in Zechen und Gruben“ unterlegt; u.a. heißt es im Text: „Hitler ist unser Führer. Ihn lohnt goldener Sold, der von den jüdischen Thronen vor seine Füße rollt“ (R.2) - Eröffnung der antibolschewistischen Ausstellung in Nürnberg 1937 Eröffnung der „Großen antibolschewistischen Ausstellung“ der Reichspropagandalei- tung der NSDAP im Rahmen des Reichsparteitages am 05.09.1937 in der Norishalle. ...Eröffnungsansprache von Stabsleiter Hugo Fischer über „das Judentum als Träger des Bolschewismus“, die bolschwistischen Zersetzungsversuche in Westeuropa am Beispiel Spaniens und die damit verbundene Weltgefahr, sowie zur Ausstellung selbst (Org.Ton). Dabei führt er u.a. aus: „Als vor zwei Jahren von dieser Stadt aus die Gesetze zum Schutze des deutschen Blutes, der deutschen Ehre verkündet wurden, als damit das Judentum als Schädling an unserem Volkskörper gebranntmarkt und in seinem unheilvollen Wirken Einhalt geboten wurde, da hat man in den sogenannten demokratischen Staaten für diese Maßnahmen kein Verständnis aufbringen wollen. Wir haben in Deutschland keine Veranlassung gehabt uns da in unseren Schritten irgendwie beirren zu lassen. Das Hetzgeschrei, das sich außerhalb unserer Grenzen gegen die Nürnberger Gesetze erhob, erwies sich zu deutlich als eine Waffe der gleichen Kreise, die bei uns von diesen Gesetzen betroffen wurden, als daß wir ihm irgend eine Bedeutung hätten beimessen können. ... Diese Ausstellung offenbart die völlige Unwahrheit alles dessen, was die bolschewistische Propaganda über die auf ihrem eigenen Boden geschaffenen paradiesischen Zustände zusammenlügt. ... Und schließlich enthüllt diese Ausstellung den verhängnisvollen Zusammenhang zwischen der bolschewisti- schen Seuche und dem Judentum, auf den wir Nationalsozialisten unermüdlich hinweisen. Die Köpfe, die von den Wänden auf Sie herabschauen, beweisen diesen Zusammenhang eindrucksvoller, als es mit Worten geschehen kann. Dies Antlitz, tausendfältig und doch immer wieder das gleiche, ist das Antlitz des Weltfeindes.“ (Film des Deutschen Fernseh-Rundfunks, hergestellt im Zwischenfilmverfahren). - Festliches Nürnberg (1937) ...Streicher spricht in der Kongreßhalle (Org.Ton) „...Als wir im Jahre 1927 zum ersten Reichsparteitag in der Hauptstadt des Frankenlandes zusammenkamen, da schaute es in Nürnberg noch nicht so aus wie heute. Der vom jüdischen Weltfeind gezüchtete Haß hatte uns Nationalsozialisten jener Tage als Räuber- und Mörderbanden verleumdet...“ (R.1) - Opfer der Vergangenheit (1937) ...Bilder aus der Irrenanstalt Buch bei Berlin, ausführliche Befragung einer geistes- kranken Jüdin, die „noch in der Krankheit ihre Rasse erkennen läßt“. - Pimpfe erleben den Grenzlandwinter (1937)
... "Dann kam ein Tag ...Wilhelm Gustloff von Judenhand ermordet!". Fahnenappell; Die Flagge wird auf Halbmast gesetzt; Pimpfe hören am Volksempfänger die Hitler- Rede. Der Herbergsvater erzählt den Jungen aus den Kampfjahren der NSDAP; alte NS-Zeitungen mit Schlagzeilen gefallener Nazis; Nachtübung mit Fackeln - Deulig-Tonwoche 287/1937 ...Eröffnung der Autobahnabschnitts Dresden - Meerane. Hitler spricht „...Juden- schwindel und Geschmiere...“ - Berlin 1938 ... Synagoge in der Oranienburger Straße, jüdische Geschäfte (Buchhandlung Moses Gonzer, jüdische Fleischerei, Textilgeschäft Sally Rosner). Orthodoxer Jude vor einem Hauseingang. - Beseitigung der Brandruine der Dresdner Synagoge unter Mitwirkung der Technischen Nothilfe Ortsgruppe Dresden (1938) Sprengung der Dresdner Synagoge, die während der Kristallnacht in Brand gesteckt wurde. Die Abrißarbeiten erstreckten sich auf den Zeitraum vom 11.-30. November 1938. ... Aufnahmen der ausgebrannten Synagoge. Sprengung des Eckpfeilers eines Treppen- hauses. Schutt und Steine werden auf LKW's verladen. Zerlegung verklemmter Eisenträger mit dem Brennschneidegerät. Vorbereitung und Sprengung des Nord-Ost-Pfeilers. Sprengung des Treppenhauses. Einsatz der Motorwinde zum Umziehen von Wänden - Front der Kameradschaft. Das Deutsche Turn- und Sportfest in Breslau 1938 (Tonfilm) ...Goebbels spricht auf der abendlichen Feierstunde des Deutschtums im Ausland auf dem Breslauer Schloßplatz: ...„Im Übrigen kümmert uns das Gegeifer des Weltjudentums nicht im geringsten. Wir stehen fest auf unseren eigenen Füßen. Wir lassen uns gar nicht irre und nicht nervös machen.“ (R.5) - Gauparteitag in Königsberg (1938) ... Rede des Stellvertreters des Führers, Rudolf Hess, auf der Großkundgebung, in der er u.a. ausführt: " Die Menschen haben wieder Arbeit und Brot ... (unverständlich) ... und niemand denkt daran etwa auszuwandern, außer vielleicht Juden, die leider zu wenig auswandern“ (Beifall) ... „Deutschland wäre wehrlos geblieben,“ .... „wenn nicht der Nationalsozialismus dem Verräter den Boden entzogen hätte im Volk, wenn er die Verräter nicht dorthin geschickt hätte, wo sie hingehören: in die Konzentrations- lager " (Beifall). (R.2) - Ich habe meine Pflicht getan (1938) Jüdische Geschäfte, ein Fenster des Cafés „Rembrandt“ mit Aufkleber „Jüdisches Geschäft“. (R.6) Einzelne und Gruppen von Juden, Geschäfte mit hebräischer Beschriftung. Karrikatur eines jüdischen Verlegers (R.6) - Jeder soll es wissen! (1938) Werbefilm für Leiser-Damenschuhe und freundliche Bedienung im Fachgeschäft. Betonung der Arisierung des einst jüdischen Geschäfts. - Juden ohne Maske (1938) Reichspropagandafilm der NSDAP mit montierten Ausschnitten aus den Spielfilmen "Der Mörder Dimitri Karamasoff" (1931) und "M - Mörder unter uns" (1931). ... u.a. verliest Göring die Nürnberger Rassengesetze - Der neue Weg (1938) PR: Palästina-Filmstelle der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, Berlin - Schon seit 50 Jahren... (1938) Boehner-Werbefilm für das arische! (im Text der Zensurkarte extra erwähnt) Stoffhaus Thierbach, Spezialhaus für Kleiderstoffe, Johann-König-Straße, Dresden - Wort und Tat (1938)
...alter Jude mit Kaftan in einer Berliner Straße. - Abbruch der Synagoge in München (1938/39) ... Abbruch der Synagoge am Lenbachplatz - Schönes Bielefeld (1938) Amateurfilm. 16mm, stumm ... Brennende Synagoge am 9.Nov.1938. Zuschauer an Fenstern und Balkonen, Einsturz der Kuppel - Ostmark-Wochenschau A 32/1938 ...Reichsstatthalter Seyß-Inquart eröffnet in Wien die Ausstellung „Der ewige Jude“: „Der Augenblick der Eröffnung dieser Ausstellung und der Übergabe an die Öffentlichkeit bietet die Gelegenheit darüber nachzudenken, welchen Sinn diese Ausstellung haben soll. Zum ersten werden wir, wenn wir durch die Räume gehen werden, erinnert an die Zeit, da das, was uns jetzt nur mehr von den Wänden herabschaut, noch einmal eine grausame und eine grausige Wirklichkeit war. Wenn wir heute, besonders in der Ostmark, an die Fragen der Arisierung herangehen, so soll die ganze Welt sich darüber ins Klare kommen, dass der Nationalsozialismus nicht vernichtet und nicht zertrümmert. Der Nationalsozialis- mus baut auf. Unserer Generation ist die Aufgabe gestellt, die endgültigen Lebensrechte und Lebensvoraussetzungen des deutschen Volkes sicher zu stellen. Die Vorsehung hat uns die Gewähr für den Weg gegeben. Die Vorsehung hat uns den Führer gegeben. Und in der Hand des Führers zu sein und diesen Weg des deutschen Volkes dem Führer nach- zugehen, das allein bedeutet die sicherste Gewähr, dass wir unser Ziel erreichen werden.“ Hinter dem Rednerpult ein Spruch an der Wand „Ich war (in Wien) vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden. Mein Kampf“ Gang durch die Ausstellung: Bilder jüdischer Künstler, Fotos und Karikaturen von Juden. - Paramount Journalen 15/1938- 1939 ... Jüdische Flüchtlinge aus Deutschland leben in einem Lager in Wiringerwaard/ Holland. (R.2) ...Ein Asyl für jüdische Flüchtlinge in Basel. (R.2) ...In Belgien erhalten jüdische Flüchtlinge Unterricht und Arbeit. (R.2) - Paramount Journalen 43/1938 ...Jüdische Flüchtlinge fahren an Bord des Dampfers „Flandres“ nach Kuba. Andere kommen aus Belgien und Frankreich mit der „St. Louis“ nach England (R.1) - Tobis-Wochenschau 48/1938 ...Trauerfeier für den erschossenen Gesandtschaftsrat Ernst von Rath in der deutschen Botschaft Paris. Überführung des Sarges nach Düsseldorf. Trauerfeier in der Rheinlandhalle in Anwesenheit Hitlers. Ribbentrop hält die Gedenkrede (Org.Ton). (Auslösung der Reichskristallnacht) - Ufa-Tonwoche 429/1938 ... Trauerfeier für den deutschen Gesandtschaftsrat Ernst vom Rath in Düsseldorf. Foto des Attentäters Herschel Seibel Grünspan (Grynszpan). - Ufa-Tonwoche 435/ 1938 ... Premiere des Films „Pour le merite“ in Berlin mit Hitler und Karl Ritter. Im Foyer des Ufa-Palastes die Aufschrift:“ Juden haben keinen Zutritt“ - Universal News (1938) ...Jüdische Kinder in England Aktualita Böhmen Cechy 1938/1942 ... Protektorat Böhmen und Mähren - Protektoràt Cechy a Morava: Plakat. Ein Betriebs- gelände. Ankunft einer Delegation auf dem großen Platz, Arbeiter sind in großen Gruppen angetreten. Auf einer Tribüne (im Hintergrund die Hakenkreuzfahne) sitzen und stehen Zivilpersonen; ein Mann am Rednerpult. An der Vorwand der Tribüne sind zwei Plakate angebracht; auf dem einen ist deutlich ein Davidstern zu erkennen (offensichtlich handelt es sich um eine antisemitische Veranstaltung innerhalb der Betriebseinrichtung). Redner liest vom Blatt ab. - Faschingszug in Hof 1939 (16mm Amateuraufnahmen,stumm)
Amateurfilm über den Faschingsumzug 1939 in Hof. Karnevalsumzug mit zwei Wagen mit antisemitischen Sujets (Motivwagen mit der Aufschrift: „Freimaurer und Juden Hand in Hand, jetzt zieh’n sie ins gelobte Land“ und Wagen „Juden zum Nordpol“). - Des Reiches erster Soldat (1939) ... Polen: Fahrt vorbei an entgegenkommenden Zivilgefangenen; Gruppen von Juden mit Schaufeln bei Aufräumarbeiten. ...Gruppen von Juden bei Aufräumungsarbeiten. - 3. Deutsche Monatsschau (1939) ...Fritz Kuhn, der Präsident des Amerika-deutschen Bundes, spricht auf einer Veran- staltung in New York. Der Jude Grünbaum, der versuchte auf die Bühne zu gelangen, wird von Männern in Uniform heruntergezerrt. - Ich habe meine Pflicht getan (1939) ...Jüdische Geschäfte, ein Fenster des Café Rembrand mit Aufkleber "Jüdisches Geschäft". Einzelne und Gruppen von Juden, Geschäfte mit hebräischer Beschriftung. Karikatur (jüdischer Verleger) (R.6) - Jahre der Entscheidung (1936/39) ... SA mit Fahnen, marschierend, dagegengeschnitten Ost-Berliner Juden in Kaftan. (R.2) - Polenreise des Dr. Frank (1939) ... Blick auf Krakau und die Burg, Straßenbilder der Stadt, polnische Menschen, darunter Juden im Straßenleben. - Religiöse Zeremonien bei jüdischen Soldaten (1939) ...in einer Scheune ein jüdisches Gebetszeremoniell mit provisorischen Utensilien: zwischen Strohballen steht ein Holztischaltar mit jüdischem Leuchter, hinter dem ein Soldat mit Umhang ein jüdisches Gebet zelebriert umgeben von weiteren Soldaten. Blechmarke des Durchführenden am 'Altar'. Junger Soldat mit Pullover, Schlips, Soldatenschiffchen und Kissen mit (Juden-)Stern und Aufschrift (nicht lesbar) am Arm. Gebets-Textrollen und weitere Utensilien während des Zeremoniells. Die einzelnen Teilnehmer/Soldaten während der Andacht. Das Gebetsbüchlein in Hebräisch - Schicksalswende (1939) ...Juden werden gezeigt. Namen jüdischer Familien mit ihren Schlössern. Synagoge in Prag. - Deulig-Tonwoche 370/1939 ...6.Jahrestag der Machtergreifung. Hitlers Rede gegen die Juden. „Wenn es dem inter- nationalen Judentum nochmals gelingen sollte, die Welt in einen Krieg zu stürzen, wird dies mit der Vernichtung der Juden enden“. - Tobis-Wochenschau 38/1939 ... Feldzug in Polen. Juden werden an eine Mauer gestellt. Jüdische Menschen (R.1) - Tobis-Wochenschau 39/1939 ...Ghetto mit polnischen Juden. - Tobis-Wochenschau 41/1939 ... Jüdische Menschen in Polen bei Aufräumungsarbeiten (R.2) - Ufa-Tonwoche 439/1939 ...Hitler spricht am 6.Jahrestag der Machtergreifung im Sportpalast (Rede gegen die Juden):..."Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, daß das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit den anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein: Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. (Beifall) Die Völker wollen
nicht mehr auf den Schlachtfeldern sterben, damit diese wurzellose internationale Rasse an den Kriegen verdient. Über die jüdische Parole ' Proletarier aller Länder vereinigt euch! ' wird eine höhere Erkenntnis liegen: Schaffende Angehörige aller Nationen - erkennt euren gemeinsamen Feind! " (Beifall) - Ufa-Tonwoche 444/1939 ...Feier im Madison Suare Garden in New York zum Gedächtnis George Washingtons. Der Präsident des Deutsch-Amerika-Bundes, Fritz Kuhn, hält eine Rede. Der Jude Grünbaum versucht einen Überfall auf Kuhn. Er stürmt auf die Bühne, wird aber von Personenschützern zusammengeschlagen. - Ufaton-Woche 471/38/1939 ...Polenfeldzug. Gefangene polnische Zivilisten mit erhobenen Händen an einer Hauswand in Bromberg. Ein Pole wird abgeführt. Juden werden abgeführt. (K.T.): ie Juden haben sich in vielen Fällen der Aufhetzung und Anstiftung zum Mord an Deutschen schuldig gemacht (K.T.Ende). Juden auf einem LKW. Gruppe von Juden, einzelne groß im Bild. (R.1) - Ufaton-Woche 472/39/1939 ... Polen: Rückkehr von geflüchteten Volksdeutschen in ihre Dörfer. Zerstörte Häuser in einem Dorf. Die Synagoge des Ortes ist erhalten. ...Polen: Ghetto mit polnischen Juden. Fröhliche Gesichter. Juden auf einem Sammel- platz in einem Lager. Gesichter einzelner jüdischer Gefangener. Gruppen von Juden bei Aufräumungsarbeiten, beim Grabenausheben und beim Verladen von Pflastersteinen. - Ufaton-Woche 474/41/1939 ... Zerstörte Häuser in einem polnischen Dorf, die Synagoge, die unzerstört ist. (R.2) ...Ghetto mit polnischen Juden. Einzelne Typen. (Kommentar: ostjüdisches Untermen- schentum...). Juden in einem Lager. Gruppe polnischer Juden bei Aufräumarbeiten, beim Graben ausheben und beim Verladen von Pflastersteinen. Kommentarton: Zurück nach Polen: Das schwierigste Problem, vor das sich die Zivil- verwaltung in den besetzten Gebieten gestellt sieht, ist die Judenfrage. Aus diesen Ghettokaschemmen ist auf deutsche Soldaten geschossen worden. Die Strafe folgt dem Verbechen auf dem Fuß. – Dieses ostjüdische Untermenschentum hat seit jeher Westeuropa das internationale Verbrechergesindel geliefert. Von hier aus wurden die Demokratien mit Taschendieben, Zuhältern, Rauschgift- und Mädchenhändlern, internationalen Bankschiebern und Hetzjournalisten versorgt. – Das sind dieselben Juden, deren Brüder, Söhne und Vettern in London und Paris für die Humanität und Zivilisation das große Wort führen. – Nur wenn man sie richtig arbeiten läßt, werden sie plötzlich sehr zurückhaltend. (R.1) - Ufaton-Woche 476/1939 ... Die zerstörte Stadt Warschau. Zerstörte Häuser. Bombentrichter. Warschauer Bevölkerung, darunter auch Juden bei Aufräumungsarbeiten in den zerstörten Stadtvierteln. - Ufaton-Woche 480/1939 ...Mannequins beim Vorführen neuer Hutmoden in den USA. Hüte in Form von Bomben, Granaten, Geschützen und Flugzeugen werden gezeigt. Kommentar: Die jüdischen Kapitalisten machen aus dem Krieg ein Geschäft. - Mit dem Stab der 257. Inf.Div. im Krieg (1939/40) Der Stab der 257. Infanteriedivision - der Berliner Bären-Division - in Polen (Oberschlesien und Südpolen) vom Beginn des Polenfeldzuges bis Ende 1939; in der Pfalz, im Saarland und Frankreich (Lothringen bzw. Département Moselle) von Ende 1939 bis zum Beginn des Westfeldzuges (Mai 1940) ... Polen: bärtiger Jude mit Armbinde und Davidsstern darauf. ...Polen: Straße, Haustüren mit Davidsstern, Passanten, deutscher Soldat; älterer bärtiger Jude mit Hut, rauchend, mit Armbinde; jüngerer bärtiger Jude mit Hut und Armbinde (hellblauer Davidsstern auf weißem Grund); dritter Jude. Geschäftsschild an einem Haus " Glaser. Szklarz.(5) M. Stern " ; bärtiger Jude schaut aus der Tür. Bettelmädchen. Zwei polnische Polizisten im Gespräch mit einem bärtigen Juden (mit Armbinde: Davidsstern). Juden, Häuser mit Davidsstern, deutsche Soldaten. ... Polnische Passanten; einzelner eiliger bärtiger Jude mit Armbinde
- Tätigkeit der Polizei im Generalgouvernement (1939/44) ... Auf einem Markt wird eine Razzia durchgeführt, die Polizei durchsucht die Stände und kontrolliert die angebotenen Waren. Ein polnischer Polizist schreibt einen polni- schen Juden auf, eine Gruppe polnischer Zivilisten wird unter Bewachung zum Kriminialkommissariat Miechow geführt. - Actualités Movietone Fox (19) ...jüdischer Synagogendienst (R.2) - Lebensmittel-Sonderverkaufsstelle für Juden in der ehem. Gastwirtschaft "Zum Kriegsberg" (1941) - Eisenbahnanlagen zerstört… (1940) ...Grenzbeamte lassen Flüchtlingen und ausgewanderte Juden nach Kontrolle passieren. ...Juden bei Straßenarbeiten, „Jüdische Typen“ bei Aufräumungsarbeiten, u.a. Steinestapeln. - Der ewige Jude (1940) Darstellung der Juden in Geschichte und Gegenwart in der faschistischen Propaganda. Dieser vom Leiter der Abteilung Film im Propaganda-Ministerium Dr. Fritz Hippler gestaltete Film kann als der wichtigste antijüdische Dokumentarfilm des NS-Regimes angesehen werden. Der Film polemisiert anhand von Aufnahmen ostjüdischer Typen, wie man sie in den polnischen Städten vorfand, gegen die jüdische Rasse und entwickelt anhand dieser Darstellungen einen Rückblick auf die innerpolitische deutsche Geschichte nach dem ersten Weltkrieg, wobei dem Judentum maßgebender Einfluss und die Schuld an der Revolution und dem wirtschaftlichen und kulturellen Verfall zugesprochen wird. Zur Verstärkung der Tendenz sind neben Statistiken Teile aus dem amerikanischen Spielfilm "The House of Rothschild" (1934), aus dem polnisch-jüdischen Spielfilm "Der Purymspieler" (1935) und Aufnahmen vom "Schächten" von Schlachtvieh eingeschnitten. Der Film enthält wertvolle Dokumentar-Aufnahmen aus der Revolutionszeit, der Nationalversammlung in Weimar 1919 und aus den 20er Jahren. Er schliesst mit der Reichstagsrede Hitlers am 30.01.1939 in der Hitler den Untergang des Judentums prophezeit, falls es ihm gelänge, nochmals einen Krieg zu entfesseln. Im einzelnen enthält der Film folgende Dokumentaraufnahmen: Rolle 1 und 2: Jüdische Typen in polnischen Städten. Kommentarton zitiert Richard Wagner. Armseliges häusliches Leben bei jüdischen Familien. Jüdische Gebetsgemeinschaft mit Vorbeter. Juden, die nach dem Feldzug in Polen zu Aufräumarbeiten eingesetzt wurden. Handel auf der Straße (Kommentar: Der Jude drücke sich um werteschaffende Arbeit). Dagegengestellt (arische) Arbeiter an der Werbank, Handwerker, Bauern. Bilder aus Palästina. Juden an der Klagemauer in Jerusalem. Die zionistische Flagge. Karte: Entwicklung und Verbreitung des Judentums seit vorchristlicher Zeit (Zeichentrick). Rolle 3 und 4: Juden werden mit Ratten verglichen, die auch überall als Schädlinge auftreten und sich rasch vermehren. Jüdischer Anteil an Verbrechen (Statistiken). Jüdische Typen. Jüdische "Namensaristokratien", in Berlin. Fotos Rothschilds (hierzu Teil des amerikanischen Spielfilms). New York, Börse, Börsenbetrieb. Fotos Köpfe Baruch, Kahn, Warburg, Frankfurter, La Guardia, Morgentau. Der französische Politiker Leon Blum, Filmaufnahmen im Gespräch mit Freunden. Der britische Staatssekretär Hoare Belisha. Berlin, November 1918. Revolutionäre Soldaten am Brandenburger Tor. Unter den Linden, am Schloß. Weimar. Wahlen zur Nationalversammlung 1919. Demonstrationen. Redner. Landsberg und Scheidemann gehen zur Nationalversammlung 1919. Der preussische Ministerpräsident Hirsch auf dem Weg zur Nationalversammlung. Theodor Wolf, der Chefredakteur des "Berliner Tageblatt" und Georg Bernhard vom Ullstein-Verlag in Weimar. Hugo Preuß auf der Straße gehend. Walter Rathenau an seinem Schreibtisch arbeitend. Der Berliner Polizei-Vizepräsident Bernhard Weiß. Demonstrationszüge, Redner, Klara Zetkin auf einer Kundgebung sprechend. Unruhen 1930. Fotos bzw. Bilder von Karl Marx, Lasalle, Rosa Luxemburg, Leviné, Nissen und dem Juden Grynspan. 5 und 6 Rolle: Statistik über Anteil der Juden in freien Berufen in Berlin. Ärzte, Juristen usw. Aufnahmen aus der Krisenzeit 1930/32. Wohnungselend. Fotos von Sklarek, Kutisker, Barmat u.a.
Expressionistische Bilder und Plastiken u.a. von Georg Groß und anderen bekannten Expressionisten. Fotos: Einstein, Hirschfeld, Tucholski, Nelson, Gebr. Rotter, Robert Klein. Filmaufnahmen mit Originalton: Max Reinhard bei Regiebesprechungen. Filmszenen mit den Schauspielern Ehrlich, Morgan, Kurt Gerron, Rosa Valetti, Curt Bois, Kortner (in die Brüder Karamasoff), Bassermann, Peter Lorre (Szene aus M.), der Regisseur Richard Oswald auf dem Regiestuhl während einer Filmaufnahme. Richard Tauber bei seiner Abreise in die USA. Ernst Lubitsch bei einem Besuch in Berlin. Der Schriftsteller Emil Ludwig nach Überreichung des Ehrendoktorhutes im Gespräch. Charly Chaplin bei seinem Besuch in Berlin wird von der Volksmasse mit Begeisterung begrüßt. Eingeschnitttene Aufnahmen von Bildern der Renaissance mit christlichen Motiven. Dagegen Szenen aus dem jüdischen Spielfilm "Der Porymspieler". Rolle 7 und 8: Jüdische (wahrscheinlich polnische) Schule mit Rabiner als Lehrer. Rabinerschule (Zitate aus dem Talmud). Aufnahmen von einem Gottesdienst in einer Synagoge (Thora-Rolle wird herumgetragen und von den Gläubigen geküsst). Schächtung von Schlachtvieh. Gefesselte und nicht gefesselte Tiere werden geschächtet. Dagegen das Gesetz der NADAP. Gesetz zu Schutz des deutschen Blutes. wehende Hakenkreuzfahnen. Reichstag am 30.01.1939. Hitler spricht über das Judenproblem: "Wenn es dem internationalen Judentum nochmals gelingt, einen Krieg zu entfesseln, wird das Ergenis die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa sein." Begeisterter Beifall. Köpfe von Hitlerjungen und-mädchen. Parteitag. Wehrmachtparade. Fahnen. - HJ SIEHT RUMÄNIEN (1940) ... Schild: Wer beim Juden kauft ist ein Volksverräter! - JUD SÜSS (Spielfilm/1940) Politischer Film mit stark antijüdischer Aussage um den jüdischen Finanzmann Joseph Süß-Oppenheimer, Geheimer Finanzrat des Herzogs Karl Alexander von Württemberg. - Der Jude im Regierungsbezirk Zichenau 1940 Leben im jüdischen Ghetto, u.a. ein Mann mit einem gelben runden Fleck auf dem Mantel, Geschäfte, Wasser holen, jüdischer Friedhof, Grabsteine mit hebräischer Schrift, Begräbnis eines Juden Kameraschwenks über das jüdische Ghetto von Zichenau; Gruppe jüdischer Kinder vor einem Holzhaus; Pferdewagen fährt durch eine Straße, gefolgt von einer Kutsche; ein Mann, mit gelbem runden Fleck auf dem Mantel (als Kennzeichen für Juden), geht an der Kamera vorüber und zieht seine Mütze. Schilder an Geschäften: ''Mützenmacher Hersz Pokorski'' darunter ''Jüdische Werkstatt''; ''Lebensmittelgeschäft Hersch. Mendel Dancygier'' darunter ''Jüdisches Geschäft''; ''Schuhmacher Szyman Fater'' und ''Schneider Chaim Grinberg''; im Ladeneingang stehen zwei Juden; Kinder schauen durch das Fenster einer Schuhmacherwerkstatt, der Schuster bei der Arbeit. Gruppe jüdischer Kinder vor der Kamera; Juden kochen auf einem eisernen Ofen im Hinterhof Kälberfüße; ein Mann trägt im Joch Wassereimer; jüdische Menschen an der Wasserstelle, Eimer werden am Brunnen gefüllt; alte Frau geht an der Kamera vorüber, beladene Pferdewagen fahren vorbei; Juden mit dem gelben Fleck auf dem Rücken kehren die Straße; Pferdewagen fahren vorüber, ein Kutscher zieht seine Mütze. Jüdische Menschen vor ihrem Wohnhaus; Gesichter jüdischer Menschen (nah); eine Frau begibt sich über die Außenstiege in ihre Wohnung; jüdische Bewohner lugen aus Öffnungen der maroden Holzhäuser hervor; Gesichter jüdischer Mädchen (nah); ältere Juden verlassen eine Kellerwohnung. Jüdischer Friedhof in Zichenau; Detailaufnahmen einzelner Grabsteine mit hebräischer Beschriftung; Begräbnis eines Juden; der Sarg wird von vier Juden auf der Schulter getragen, gefolgt von der Trauergemeinde; der Trauerzug auf dem jüdischen Friedhof; der Tote wird aus dem Sarg gehoben und im Leichentuch ins Grab gelegt, das Grab wird mit Erde zugeschüttet. - Konzentrationslager Posen (1940) " Konzentrationslager Posen " in Frakturbuchstaben über dem Eingang zur Festung in Posen. SS-Leute (Totenkopf-SS) verlassen die Festung durch das Tor. Ein SS-Wachposten im
Schnee; Eingangstor mit SS-Runen und ein Schilderhaus; Schild: " Eintritt nur mit Genehmigung der Sicherheitspolizei oder des Lagerkommandanten "; Schild " Wache " über einer Pforte, Wache beim Raustreten, Wachappell; SS-Leute verlassen durch das Tor die Festung. Sie spazieren auf den verschneiten Wällen vor dem Festungsgraben. Blick auf die Sperranlagen an Wall und Graben (spitze, gebogene Eisenstangen, Stacheldraht), die hinter Offizieren vom Spaziergang in die Festung zurückkehrenden SS-Leute; Doppelposten rücken durch das Tor ein. (Ursprungsmat. von Höffkes) - Die Rothschilds (Spielfilm/1940) Der Film zeigt den Aufstieg der jüdischen Bankiersfamilie Rothschild zu einer euro- päischen Macht. Historischer Roman mit politischer Tendenz. - VOM BÄUMELEIN, DAS ANDERE BLÄTTER HAT GEWOLLT (1940) Ein kleiner Tannenbaum träumt davon, Blätter zu haben. Die goldenen Blätter werden von einem Räuber gestohlen, der als antisemetische Karikatur eines Juden dargestellt wird. Die gläsernen Blätter zerbricht der Wind und die grünen frißt die Ziege. Er ist froh, als er zum Schluß wieder seine alten Nadeln hat. - Ufaton-Woche 505/20/1940 ...Tran und Helle: politische Bildung durch Bücher. Gegenüberstellung „jüdischer“ und „nationalsozialistischer“ Bücher. (Antisemitismus) - Die Deutsche Wochenschau 528/43/1940 ...Kundgebung der „Nasjonal Samling“ in Oslo. Quisling fordert u.a. ein Verbot der Tätigkeit von Freimaurern und Juden. - SPRAWOZDANIE FILMOWE Z GENERALNEGO GUBERNATORSTWA NR. 2 (1941) ...Schifffahrt auf der Weichsel. Fahrgäste gehen an Land. Juden als Lastträger - Ankunft von Magdeburger Juden im Warschauer Ghetto - Mein Krieg (1940) ... PR: Amateurfilm ...1940: Kameraschwenk über Häuserruinen in einer Stadt; Jüdinnen mit gelbem Punkt als Kennzeichen auf dem Rücken; parkende Pferdefuhrwerke; auf dem Markt- platz; Gruppe von Jungen; einer davon mit dem gelben Fleck auf dem Rücken hält einen Rutenbesen in der Hand, Wochenmarkt; Wasserträger mit zwei Eimern am Joch; vorübergehende jüdische Männer ziehen vor dem Kameramann ihre Mützen; Juden holen Wasser von der Pumpe, zwei Jüdinnen bedienen den Schwengel; Straßenladen mit Schild am Ladeneingang " Jüdisches Geschäft "; Juden stehen oder sitzen an einer Hauswand; jüdische Kinder (26 m) ...1941: Im Ghetto. Drei Angehörige des jüdischen Ordnungsdienstes grüßen mit der Hand am Mützenschirm; bärtige jüdische Männer mit großem Davidstern auf der Brust gehen die Straße entlang und bleiben teilweise vor der Kamera stehen; einer von ihnen nimmt dabei militärische Haltung an. Erschließung H.-G.Voigt (Go/04.04.2001) - Bei der Feldgendarmerie der 6. Armee (1940) ...Gruppe deutscher Soldaten, von einem Offizier geführt, besichtigt ein Dorf dt./poln. Straßenschild "Judenstraße/Zydowska"; schlammige Straßen, jüdische Dörfler, bärtig, tragen Armbinden mit Davidsstern. ...Ukrainischer Wegweiser "Lwiw" (= poln. Lwów=Lemberg); Kirchen, Synagoge - Reichsführer Hanns Oberlindober (1940/43) (Serie: Filmarchiv der Persönlichkeiten) ... Wir waren sogar in Warschau, haben auch versucht, bei den Polen unsere Gedan- kengänge zu vertreten und haben immer einen Gedanken vorausgestellt, nämlich den Gedanken, dass der vergangene Krieg, der Weltkrieg von 1914-1918, weder vom deutschen Volk, noch vom französischen, noch vom englischen Volke gewonnen sei, sondern dass die einzigen Sieger die internationalen Juden, Freimaurer, Pluto- kraten gewesen seien. (Org.Ton) (R.2)
- Ausbildungslager der Waffen-SS Sankt Andreas bei Sennheim (Cernay) im Elsaß (1941) ...Die SS-Leute lesen das " Mülhauser Tageblatt " mit der Schlagzeile" Entweder wir oder die Juden ". (R.1) - Juden bei der Arbeit in Breslau (1941) ... Einsatz von Juden bei Bauarbeiten in Breslau: Juden bei Schachtarbeiten an einem mit Brettern versteiften Graben; Abladen von Ziegeln von einem LKW; ein Jude noch mit dem Davidstern auf der Brust. Verladung von Ziegeln auf eine Lore. - Juden, Läuse, Wanzen (1941) Faschistischer Filmbericht über die sozialen Zustände im Warschauer Ghetto. - Judendeportation in Stuttgart 1941 ... Lebensmittellieferung (in großen Mengen) an eine "Sonderverkaufstelle für Juden", Aufnahmen aus einer Metzgerei. Packen, Gepäck wird geordnet und in einer Halle gesammelt. Koffer mit Aufschrift: "Ruth Sara Lex". Essensausgabe (Suppe). - Judenexekution in Libau 1941 ... 1. Zwei Männer warten ein Doppeldecker-Flugzeug (kurz). Mehrere Juden (Männer) steigen von einem Lastwagen. Sie tragen Zivilkleidung, die vorne und hinten gekenn- zeichnet ist. Es ist ein Grab ausgehoben, in dem sie in erschossen werden. In einiger Entfernung steht eine Gruppe Zuschauer, darunter auch derjenige, von dem diese Privataufnahmen sind. Erde wird in das Grab geschaufelt. Zwei Männer auf Fahrrädern (kurz). - Mit dem Stab der 257. Inf.Div. im Krieg (1939/41) / Farbe ... Polen: Haustüren mit dem Davidsstern, mehrere jüdische Männer - OPFER RUSSISCHER MASSAKER IM BALTIKUM UND IN SÜDRUßLAND (1941) ...Exhumierung von Leichen nach dem Einmarsch deutscher Truppen in Lemberg am 30.6.1941. Frauen säubern mit Besen und Zweigen die verschmutzten Leichen. Juden exhumieren die Leichen aus einem Masesngrab auf dem Hof des Brigidski- Gefänsnisses. Ein Zivilist prügelt mit einem Stock auf Juden ein. Ein am Boden liegen- der Mann wird getreten. Ein frau schlägt mit einem Stock auf ihn ein. Deutscher Soldat mit wienender Frau, die vorher geprügelt hat. Der Gefängnishof mit den Leichenfunden. Ein Zivilist prügelt wieder auf Juden ein. Ein anderer Jude wird durch Schläge zu Fall gebracht. Weitere Prügelszenen von Zivilisten mit weißen Armbinden Auf am Boden leigende Juden. Frauen bei der Leichensäuberung. Kameraschwenks Über dne Gefängnishof voller Leichen. Gefängnismauer mit Spuren von Einschüssen. Fassade des Brigiski-Gefängnisses mit leeren Fensterhöhlen und Brandspuren. - Ostland - deutsches Land (1941) ...Gruppen- und Einzelaufnahmen von männlichen und weiblichen polnischen Juden mit Judenstern. - Riga nach der Einnahme durch deutsche Truppen, Juli 1941 ...Zivilisten mit "ostjüdischem" Aussehen bei Aufräumungsarbeiten vor der zerstörten und ausgebrannten Peters-Kirche in der Innenstadt Rigas, Männer schaufeln in einem Wäldchen Sand, eine jüdische Frau sammelt russische Propagandapapierfetzen von der Wiese einer Gartenanlage; K-Ton: "Jüdische Schmarotzer müssen Aufräumungs- arbeiten vornehmen." - Rund um die Freiheitsstatue (1941) Deutscher Propagandafilm, der anhand amerikanischer Originalwochenschauen dekadente Erscheinungen und soziale Ungerechtigkeiten der amerikanischen Gesellschaft einer "jüdischen Ausbeuterclique" anlastet. (Im Kommentar findet man Ausdrücke wie amerikanisch-jüdische Ausbeuterclique, jüdische Hintermänner, deswegen ist das Ziel der jüdischen Kapitalisten und ihres Roosevelt die Vernichtung Deutschlands, jüdisch-geistige Verkümmerung, Judenherrschaft) - Transport der Juden zum Krakauer Ghetto (1941) - Unser Sturm 11/m 21 (1941)
...Juden-Ghetto in Warschau: eine Gruppe von Juden, auch eine Fahrradtaxe kommt aus einer Nebenstraße, überquert eine breite Straße, an einem deutschen Posten vorbei (auf dem Weg in den anderen Teil des Ghettos) ...jüdische Bürger mit einer Armbinde an einem dt. Posten vorbei, über die Straße gehend. Auch Fahrradtaxen und ein überfüllter Pferdebus zweier jüdischer Fuhrun- ternehmer -Kochen Feller (Kochenfellerka) vom kleinen ins große Ghetto (später Holzbrücke) fahrend. Eine Straßenbahn im Bild. Ortslage: die Straße Chlodna, Ecke Zelazna, mit Blick nach Westen. ...ein deutscher Posten und polnischer (jüdischer !) Polizist (mit Schirmmütze, Jackett, Armbinde, Reithosen und- stiefel) weisen einem jüdischen Greis den Weg (den anderen nach); Er geht zwischen zwei (jüdischen) Polizisten hindurch (im Ghetto ?!) ...-jüdische Polizisten führen die Straße entlang Juden heran. Dt.Posten und polnischer Polizist führen jüdischen Greis zwischen sich heran. Der Deutsche drängt den Juden zum Ghettoeingang. Polnischer (?) Passant hebt grüßend vor ihm den Hut und durchquert unbehelligt die Gruppe der Juden. Judentypen: vier bärtige Juden (groß) im Bild ...Blick durch Stacheldraht über eine Schlucht auf die Ruine einer Bahnhofshalle. Schild oder Aufschrift auf einer Mauer ""Warschau Hbf."" - Actualités Mondiales 515/29/1941 ...Ostfront: Mittelabschnitt, Gebiet um Lemberg: Sitz der GPU. Zerstörtes Gebäude, aus Fenstern dringender Rauch. Zivilisten tragen unter deutscher Aufsicht verstüm- melte Leiche aus dem GPU-Gebäude. Platz mit einer endlosen Zahl von aufgereihten Toten. Verhaftung eines Juden. Wird von Zivilisten durch ein Spalier von Menschen getrieben und Deutschen übergeben.Gesichter von „Untermenschen“ (R.1) ...Ostfront: Nordabschnitt/ Ortsschild „ Janova“: Synagoge und Portal mit hebräischer Inschrift. Synagoge, Innenraum. Gruppe jüdischer Männer (R.2) - Actualites Mondiales 516/30/1941 ...Paris: Nathan-Prozeß (Bernard Tanenzaft). Aufnahmen aus dem Gerichtssaal. Richter betreten den mit Zuschauern gefüllten Gerichtssaal. Nathan auf der Anklage- bank. Verhüllt Gesicht mit einer Zeitung. Nathan verläßt Anklagebank. Scheut vor der Kamera zurück. Plenum des Gerichts. Nathan auf der Anklagebank (Prozeß gegen den Geschäftsmann Bernard Tanenzaft, genannt B. Nathan) (R.1) - Actualités Mondiales 50/1941 ..." Prozess Nathan " : Der Anwalt und sein Klient Bernard Nathan im Flur des Pariser Justizpalastes. Foyer in einem oberen Geschoss des Gerichtsgebäudes; Treppe, französische Polizisten.Das Gerichtsgebäude von außen. Der Angeklagte auf seiner Bank, mit einem Schriftsatz; mit seinem Verteidiger im Gespräch. Gerichts- verhandlung. (Bernard Nathan stand im Juni 1941 in Paris vor Gericht und wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt.) - Actualités Mondiales 59/1941 ...Eröffnung der Ausstellung „Der Jude in Frankreich“ in Paris. Rundgang - Actualités Mondiales 66/1941 (ungeschnittenes Material) ...Zerstörte Synagoge in Paris nach einem Sprengstoffanschlag. Verwüstungen im Innenraum. Herausgebrochene Fenster und Türen. Hebräische Schriftzüge über dem Eingangsportal. Die Deutsche Wochenschau 538/1/1941 ... Rückblick auf das Jahr 1939. Durch Warschau fahrende Straßenbahnen. Aufschrift an einerm Straßenbahnfenster: "Nur für Juden - Tylko dla Zydow". - Die Deutsche Wochenschau 558/1941 ... Festung Belgrad: Gruppen und einzelne Typen von Juden. Die Juden bei Aufräu- ) mungsarbeiten. Steine werden von Hand zu Hand weiter transportiert. Schutt und Geröll wird mit den Händen, teilweise auch mit Hilfe von Schüsseln und Schaufeln, beseitigt. (R.1) - Die Deutsche Wochenschau 559/22/1941 ... Rolle 1: Gefangenenlager in Griechenland, darunter emigrierte Juden
- Die Deutsche Wochenschau 566/29/1941 ...Einnahme von Jonava. Juden werden zusammengetrieben. Die Synagoge. Das jüdische Ghetto mit jüdischen Typen. (R.3) - Die Deutsche Wochenschau 567/30/1941 ...Einmarsch der dt. Truppen in Riga am 01. Juli 1941. Juden steigen mit Schaufeln in einen LKW. Unter SS-Bewachung schaufeln sie im Wald ein Massengrab. Leichen lettischer Nationalisten werden im Freien nebeneinander gelegt. Bevölkerung besichtigt die Leichen. Tote werden in Särge gelegt und eingebettet. Kinderleichen. Weinende Frauen. ...Judenpogrom in Riga. Ein Jude wird von mehreren Zivilisten geschlagen und mißhandelt. Ein SS-Mann fotografiert dabei. Ein anderer wird über die Straße geschleift. SS-Soldaten schauen zu. Die brennende Synagoge in Riga. - Die Deutsche Wochenschau 568/31/1941 ... Exhumierung von Leichen in Lemberg (Lwow). Juden legen die ausgegrabenen Leichen nebeneinander. - Die Deutsche Wochenschau 570/33/1941 ...Gefangennahme der jüdischen Bevölkerung in der zerstörten Stadt Balti (Belzy), Bessarabien/UdSSR: Flug über die zerstörte Stadt Balti: ausgebombte Häuser und Straßenzüge. Leichen liegen in den Straßen; Hinweis auf Sowjetische Geheimpolizei (GPU). Die jüdische Bevölkerung von Balti wird abgeführt und in Sammellager deportiert: darunter Frauen, Kinder und alte Männer. Scheinbar endloser Gefan- genenzug auf einer Landstraße, Juden tragen Bündel bei sich (R.1) ... Jüdische Bevölkerung bei Aufräumungsarbeiten in Smolensk: Gesichter von Juden in Nahaufnahme. Schaufeln werden ausgegeben. Juden mit Stern müssen mit bloßen Händen und Schaufeln Trümmer in den Straßen von Smolensk beseitigen. Kehren und Abtransport von Schutt mittels Leiterwagen. Schuttberge. Menschenmenge vor einer Kirche. Kirchen die als Lagerhallen bzw. Kraftwerk genutzt werden. (R.3) - Die Deutsche Wochenschau 579/42/1941 ... Kiew: Gefangene sowjetische Zivilisten, darunter Juden (antikommunistischer und antisemitischer Kommentar) - Als Geistlicher bei der Wehrmacht im Kaukasus (1941/42) ...Rundblick über Landschaft im Schnee, Dorf. Juden (Männer, Frauen, Kinder mit Armbinden) über Brücke gehend. ...Marktplatz, viele Menschen; bärtiger Mann (Jude?) [kurz] ...Straße, Juden mit Armbinde, als Passanten; z.T. auf der Brücke (!); Panjewagen, Kirche im Hintergrund; zahlreiche Juden mit Armbinden als Passanten. - AMATEURAUFNAHMEN DES RITTERKREUZTRÄGERS WALTER NEUER VON SEINER FAMILIE UND SEINEM EINSATZ IM RUßLAND-FELDZUG 1941/42 ... Ghetto-, außerpolnische Shtetl- oder außerpolnische Dorf mit Markt-Aufnahmen(?) : Wasserträger grüßt, Juden bieten Ihre Waren an, Geschäfte mit Judenstern gekenn- zeichnet, Juden lassen sich fotografieren, verarmte Gestalten, Alltagsaufnahmen, Kinder, alte Menschen, Markt, Armbinden mit Judenstern, Personenstudien, Männer grüßen und nehmen Kopfbedeckung ab. - Ankunft von Magdeburger Juden im Warschauer Ghetto (1942) - Aus erster Quelle (1942) Werbung für die arisierte Zigarrenfabrik Walter E. Beyer, vormals Loeser & Wolff. Die Besitzübernahme wird kabarettistisch dargestellt. - Burgenland (1942) ... geschlossenes jüdisches Geschäft von Samuel Kerpel & Söhne –Gemischtwaren; heruntergelassene Fensterlade. (Kommentarton: ... Juden, dessen Häuser und Ghettos abgerissen werden ...). Männer beim Abriß eines großen Gebäudes, hier einer mit Spitzhacke beim Abtragen einer Ziegelmauer, andere stehen im Keller- geschoß und Seitentrakten (R.1)
- Dreharbeiten in Theresienstadt (1942) ...Soldat vor einem Schild „Sperrgebiet“, Theater- und Kabarettszenen und Mario- nettentheater mit Publikum, Fußballspiel im Freien, das Kamerateam bei Aufnahmen - Aufnahmen vom Warschauer Ghetto zu Tagebuchaufzeichnungen von Stanislaw Wrossitzki (1942/43) - Ghetto (1942/43) Nicht fertiggestellter faschistischer Propagandafilm über das Warschauer Ghetto, wobei besonders der Kontrast zwischen den reichen und armen Juden herausge- stellt wird. Dabei gibt der Film reale Eindrücke über das soziale Elend im Ghetto. - Ghetto - Restmaterial (1942) Ausgewählte, geschnittene Restmaterialien des Ghetto-Films. Vorspann der Reichsfilmarchivs: "Geheime Kommandosache!" ...Arrestanstalt "Gesiowka"; Frau mit lockigem Haar, dahinter junge Mädchen; Frauengruppe mit kurzgeschorenen Haaren; Männer und Jungen in der Gemeinschaftszelle; Kinder werden vom jüdischen Ordnungsdienst auf den Hof getrieben, dabei wird auf die Jugendlichen mit Schlagstöcken eingeschlagen (von innen aufgenommen); Männergruppe auf dem Hof der Arrestanstalt, im Mittelpunkt ein verängstigter Arrestant mit freiem Oberkörper; junge Männer liegen oder sitzen an die Wand gelehnt in der Gemeinschaftszelle; Kameraschwenk über große Gruppe von Männern und Frauen in der Arrestzelle, einzelne verängstigte Gesichter (nah); Gruppe von Kindern in der Arrestzelle; Tafel mit Aufschrift: "Der Obmann des Judenrates in Warschau / Verwaltung des Jüdischen Wohnbezirks in Warschau / Ordnungsdienst Arrestanstalt den 2.V.1942 Stand: 1442 / Männer: 773 / volljährige Sträflinge 20 Untersuchungshäftl. 490 / minderjährige Sträflinge 14 Untersuchungshäftl. 249 / Frauen 669 / volljährige Sträflinge 21 Untersuchungshäftl. 434 / minderjährige Sträflinge 19 Untersuchungshäftl. 155 / im Krankenhaus 52" (deutsch / polnisch). Angehöriger des Ordnungsdienstes öffnet die Tür mit der Aufschrift "Durchgangszelle" und treibt im Laufschritt junge Männer heraus; Armbinde mit Aufschrift "Judenrat Warschau Ordnungsdienst" (deutsch / polnisch); Gesichter männlicher Häftlinge mit kurzgeschorenen Haaren (nah), sie wenden ihren Kopf vom Profil nach vorn. (54 m) (siehe "Ghetto" Szene 41) ...Toter liegt auf dem Bürgersteig; jüdische Passanten gehen z.T. achtlos an dem Toten vorüber (links im Bild ein Kameramann mit einer Arriflex beim Drehen); drei uniformierte PK-Männer vom Filmteam bei Dreharbeiten vom anderen Blickwinkel; zwei Männer mit zweirädriger Sargkarre halten an, legen den ausgemergelten Leichnam in eine Holzkiste und schieben sie in den Sargkasten; die Sargkarre wird entlang der Ghettomauer geschoben; Begegnung mit einer Fahrradrikscha, deren Fahrer vor dem links im Bild stehenden SS-Mann die Mütze zieht. (38 m) (siehe "Ghetto" Szene 27) ... Altwarenmarkt auf der Gänsestraße; Bretterbuden als Verkaufsstände, davor Strassen- händler mit Textilien über den Armen; Menschengruppen vor den Buden. (3 m) (siehe "Ghetto" Szene 37) ... Zwei ausgemergelte Leichen liegen in der Toreinfahrt einer Apotheke, Passanten gehen achtlos vorüber; Leichenkommando schiebt zweirädrige Karre heran und verlädt die Toten auf die offene Karre (im Hintergrund PK-Kameramann der Luftwaffe mit einer Arriflex); Abtransport der Leichen entlang der Ghettomauer; einer der Toten fällt herunter und wird vom Rinnstein wieder auf die Karre gehoben; jüdischer Ordnungsdienst öffnet das Ghettotor, die beladene Leichenkarre passiert; Garage mit offenen Flügeltüren, in der die Leichen auf Lattenrosten gestapelt werden; Männliche Ghettobewohner werfen in der Garage die ausgemergelten Leichen auf einen Haufen; männliche Leichen werden auf dem Lattenrost übereinander gelegt; Leichenhaufen (nah), an Handgelenken oder Füssen befinden sich angebundene Zettel; Verladen der Leichen auf zweirädrige Karren; Zug von fünf Leichenkarren zum Massengrab; Die Leichen werden einzeln über eine Rutsche in die Grube verbracht; Männer vom Judenrat beaufsichtigen die Massenbeisetzung; Staplung der Leichen in der Grube (nah); zum Schluß wird über den Leichenberg Packpapier gebreitet und Sand darauf geschippt. (207 m) (siehe "Ghetto" Szene 27 und 28) ... Neu angekommene Juden aus Deutschland am 14.4.1942 im Warschauer Ghetto; die Deportierten begeben sich mit Handgepäck und Rucksäcken in ein Gebäude; Schild: "Der Obmann des Judenrates in Warschau Verwaltung des Jüdischen Wohnbezirks in Warschau Aufnahmelager" (deutsch / hebräisch). Mann im Mantel mit Judenstern als Aufsichtsperson am Türeingang; die Menschen betreten einzeln das Gebäude. (39 m) .. Schild: "Der Obmann des Judenrates in Warschau Verwaltung des Jüdischen Wohnbezirks in Warschau". Angehörige des Warschauer Judenrates mit Armbinde betreten das Gebäude und begeben sich den Treppenaufgang hinauf; Plakate gegen den Hunger (Jiddisch) und gegen das
Fleckfieber (polnisch). (26 m) (siehe "Ghetto" Szene 2) ...Kofferaufschrift: "Margarete Sara Katz / Magdeburg / Kaiser Friedrich Str. 28". Die neu Angekommenen sitzen dicht gedrängt in einem großen Raum; ältere Menschen liegen auf einem Notlager; Mütter verpflegen ihre Kinder; Kamerafahrt über die Gesichter der in einer Reihe sitzenden Menschen; Registrierung der Neuankömmlinge. (52 m) ... Mitglieder des Warschauer Judenrates betreten das Zimmer des Obmanns und nehmen vor dessen Schreibtisch Platz; Obmann Adam Czerniaków (nah) im Gespräch mit den Mitgliedern des Judenrates; Zimmerinterieur mit Bildern und jüdischem Leuchter, u.a. ein Gemälde des polnischen Marschalls Józef Pilsudski; Czerniaków verabschiedet die Besucher mit Handschlag; sie verlassen das Zimmer. (56 m) (siehe "Ghetto" Szene 2) ... Straßenleben im Warschauer Ghetto; mit Fischen beladene Karre; junger Mann prügelt auf der Straße auf ein Kind ein; Straßenhandel an primitiven Fischständen. (26 m) ... Einsatz der Ghettopolizei; Passanten werden zusammengetrieben; Ghettopolizist schlägt mit Gummiknüppel auf eine Menschenansammlung ein und treibt sie auseinander; ein festgenommener junger Mann wird abgeführt; auf einen weiteren jungen Ghettobewohner wird eingeschlagen, danach wird er abgeführt; auf einen bereits festgenommenen Mann prügelt ein Polizist mit dem Schlagstock ein; eine gestürzte alte Frau erhebt sich von der Straße; ein Festgenommener wird über den Bürgersteig geschleift; Passanten werden zuammengedrängt und eine Straße hinabgetrieben; Straßenverkehr im Ghetto; ein weiterer Ghettobewohner wird abgeführt. (73 m) ... Menschenauflauf in einer Ghettostraße; jüdischer Ordnungsdienst treibt Passanten vor sich her; auf der Straße liegende Jungen in zerlumpter Kleidung stehen auf und gehen weiter, angetrieben von Angehörigen des Ordnungsdienstes; gefallene ältere Frauen werden aufgehoben; sich wehrender junger Mann wird abgeführt; während die Menschen durch die Straße getrieben werden, steht ein PK-Filmberichter mit seiner Arriflex-Kamera auf einem Stuhl und dreht die Szene; Angehöriger des Ordnungsdienstes prügelt mit dem Schlagstock auf einen jungen Mann ein, der danach abgeführt wird; weitere junge Männer werden abgeführt und in die Arrestanstalt gebracht. (63 m) ... Schild: "Obmann des Judenrates in Warschau. Verwaltung des Jüdischen Wohnbezirks in Warschau Ordnungsdienst Arrestanstalt". Angetretene Arrestanten auf dem Hof der "Gesiowka", Kamerafahrt über deren Gesichter (nah); angetretene Jugendliche und Kinder in zerlumpter Kleidung, teilweise barfuß; Arrestanten beim Rundgang auf dem Hof der Arrestanstalt unter der Aufsicht des Ordnungsdienstes (z.T. Nahaufnahmen der Vorbeiziehenden) (106 m) (siehe "Ghetto" Szene 41) ... Außenansicht der Arrestanstalt mit Schilderhäuschen und Posten in der Gesia Straße; Altwarenmarkt in der Gänsestraße (Totale) und Schwenk zur danebenliegenden Arrestanstalt mit hohen Mauern; Menschenmassen auf dem Markt (Totale); vorbeifahrende Straßenbahn mit Davidstern und Aufschrift "Muranów Leszno" (von oben aufgenommen); Straßenhändler mit über den Armen hängenden Textilien; Arrestanten beim Rundgang auf dem Hof der "Gesiowka";Kameraschwenk zum Marktplatz voller Menschen. (34 m) ... Arrestanten rennen aus dem Anstaltsgebäude, angetrieben vom jüdischen Ordnungsdienst, einige stürzen dabei; Arrestantinnen verlassen ruhigeren Schritts das Gebäude unter der Aufsicht von weiblichen Angehörigen des Ordnungsdienstes. (42 m) (siehe "Ghetto" Szene 41) - Das Warschauer Ghetto (1942/43) - Im Warschauer Ghetto (1942/43) Inszenierter Dokumentarfilm, der in propagandistischer Absicht auf den unterschied- lichen Lebensstandard dort lebender reicher und armer Judenaufmerksam machen will. ... Deutsche Wachposten öffnen Ghetto-Tor, ein LKW fährt herein.Ghettobewohner setzen Verstorbene im Massengrab bei: Von einem Wagen werden nackte Tote zur Grube geschleppt u. am Grubenrand abgelegt. Ein bärtiger Mann blickt vor einem Geschäft in die Kamera. Eine Frau sortiert Zeitungspapier. Ein Verkaufsstand für Brot. Der Ladentisch ist gegen Diebstahl mit Draht abgesichert. Gemüsestände. Straßenhändler verkauft Porzellanteller. Kamerafahrt über Stände mit Kartoffeln, Fleisch, Alteisen, Töpfe u. Tassen. Gemüsestand mit Zwiebeln. ...Straßenleben im Ghetto. Straßenbahn mit Davidstern fährt um Kurve. Im Hintergrund Fahrradrikschas. ... für den gestorbenen Herman Czerwinski am 19.05.1942. Der Sargwagen gefolgt von großer Trauergemeinde, u.a. begleiten Ghettopolizisten den Trauerzug ...Deutscher Feldpolizist kontrolliert Papiere eines Pferdekutschers. Junger Mann in abgerissener Kleidung. Deutscher Unteroffizier verläßt einen jüdischen Fleischladen. Leeres Fenster eines Bäckerladens. Zwei hungrige Kinder in abgerissener Kleidung vor Fleischladen, den eine gut gekleidete junge Frau betritt (gestellte Szene). Beide zerlumpten Kinder (div. Einst). Die junge Frau betritt wieder den Laden (gestellte
Szene). Beide Kinder betrachten die Schaufensterauslagen u. gehen weg. Fleisch- stücke in Schaufenster (nah). ... junge Frau an Straßenstand. Kinder auf Straße. Deutscher Feldpolizist kommt ins Bild. Ghettobewohner mit eingefallenen Gesichtszügen. Ghettobewohner gehen über Brückentreppe, die über Straße führt ...Pferdeomnibus u. Fahrradrikschas mit Fahrgästen auf Straße, sie fahren auf Straße entlang der Ghettomauer. Junge sitzt an Bordsteinkante u. legt sich hin: schlafende Ghettobewohner an Bordsteinkante. Passanten eilen vorüber. Bettelnde Kinder sitzen auf Bürgersteig. Nahaufnahmen zweier bettelnder Mädchen u. an der an der Bord- steinkante liegende Ghettobewohner (nah). Zwei völlig ausgezehrte Kinder sitzen an Hauswand. Ghettobewohner verladen Hausrat auf zweirädrige Karre, sie heben Korb darauf u. schieben Karre über Kopfsteinpflaster. Ausgemergelte Kinder in verschlissener Kleidung liegen an einer Hauswand - Die Juden von Dombrowa (1942) Straßenpassanten mit Davidstern und Aufschrift ‘‘ Jude ‘‘ (Kennzeichen für Juden im deutschen Reichsgebiet) gehen am geschlossenen Scherengitter einer Schuhmacherei vorüber; weitere jüdische Passanten, dabei ein Schutzpolizist mit Tschako; große Menschenansammlung; junge Männer und Frauen kommen aus einem Hauseingang; dicht gedrängte Menschenmenge in einer engen Straße; Gesichter jüdischer Männer und Frauen; jüdische Menschen mit Stern ziehen an der Kamera vorüber; Menschengruppen mit z.T. lachenden Gesichtern; einzelne Gesichter (nah); jüdische Passanten vor der Schuhmacherei; zwei Männer bleiben stehen und setzen sich auf Anweisung des Kamera- mannes in Bewegung; Angehöriger des jüdischen Ordnungsdienstes mit zwei jungen Männern; ein Mann schleppt eine verschlissene alte Couch; gut gekleidete Jüdin mit ihrer kleinen Tochter; Kinder stehen im Hauseingang und beobachten die vorbeigehenden Passanten; Gruppe von Kindern mit Davidstern; Kinder auf den Straßen im jüdischen Viertel mit verkommenen Häusern; junger Mann trägt ein Joch mit gefüllten Wassereimern; Kuhhandel auf der Straße; Pferdedroschke mit aufgemaltem Davidstern und Schild: ‘‘ Komitee ... Dombrowa O/S ‘‘; Gesichter sich unterhaltender Juden an der Droschke. In der jüdischen Schneiderwerkstatt; der jüdische Meister geht von Tisch zu Tisch und prüft die fertiggestellte Ware; junge Männer arbeiten an Singer-Nähmaschinen; Schneider- werkstatt mit jüdischen Frauen; junge Frauen sitzen an Nähmaschinen, schneiden Stoffe zu oder nähen mit der Hand; der ‘‘ arische ‘‘ Chef am Eingang des Arbeitssaals; nähende Frauen mit Davidstern. Kameraschwenk über eine jüdische Menschengruppe auf der Straße; Gesichter einzelner Juden (nah); jüdische Menschen stehen an einer Mauer, andere eilen an ihnen vorüber. - Kampf dem Fleckfieber (1942) ... Trickkarte zur Verbreitung des Fleckfiebers und seines Erregers, Karte Polen (als angeblich zentrales Verbreitungsgebiet Europas). Juden vor der Kamera, einer halbnackt, Szene Kleiderhandel, Markt, Bahnhof. K-Ton: "Sie gefährden damit den deutschen Soldaten, wenn er mit der verlausten Bevölkerung in Berührung kommt." (R.1) - Pressburg und die Slowakei (1942) ... Ungeschnittenes Material Bilder aus Preßburg, Aufschrift "Nichtjüdisches Geschäft" Kontrolle an der Straßensperre. Eingeschlagene Schaufensterscheiben in jüdischen Geschäften. (R.1) - Warschau, Ghetto, März 1942 Straßenszenen aus dem Warschauer Ghetto,u.a. die hölzerne Fußgängerbrücke (angeschnitten) und Verkehr am Ghetto-Tor darunter (sich öffnendes Maschendraht- Tor, polnische Polizisten, Rollstuhlfahrer und andere Gefährte). -Zusammenlegung der letzten Juden in Dresden in das Lager am Hellerberg am 23/24. Nov. 1942 ...Abholen des Gepäcks; Schild: Sporergasse; Aufnahmen von Mülltonnen; Hausrat wird in LKW geladen; Koffer werden eingeladen, Namen stehen auf Koffern: Johanna ( Sara Saslawski; Juden tragen Koffer aus den Häusern ...Schild: Städtische Entfeuchtungsanstalt; Aufnahme von Juden mit Koffern auf Straße; "Wagen-Halle"2; Familie mit kleinen Kindern; Frau zieht den Kindern die Schuhe aus; Frauen tragen Kinder auf dem Arm; Gepäck; Schild: (Gepäckaufschrift?) Sali Goldberg;
Gepäck wird ordentlich gestapelt; Aufschrift auf Rucksack: M. Sara Dawid; Jüdische Frauen sammeln ihre Mäntel und Schuhe ein. Frauen ziehen einfache Holzpantoffeln an. Frauen mit Kindern. Haare der jüdischen Frauen werden von anderen Frauen (Aufseherinnen?) durchgesehen. SS steht am Bahnhof. ...Nackte Männer, sitzend und stehend in einem Innenraum. Männer in weißen Kitteln (einer mit Judenstern). Männer werden von Mann in weißem Kittel(ebenfalls mit Juden- stern) untersucht ( er schaut nach Läusen auf dem Kopf, unter den Armen und im Intimbereich). Männer verlassen das Gebäude auf Holzschuhen. Aufschrift: Bella Sybilla Sara Klein. Frauen verlassen das Gebäude, ebenfalls auf Holzschuhen. Das Gehen mit den Holzpantoffeln bereitet ihnen Schwierigkeiten. Großaufnahme einer Frau mit Kopftuch. Frauen mit Gepäck stehen wartend an einem Gebäude ...ZT: Ankunft am Hellerberg: Jüdische Männer und Frauen gehen eine Straße entlang. Menschen steigen über eine Leiter aus einem LKW aus. Jüdische Männer und Frauen gehen mit Gepäck eine schlammige Straße entlang, ihnen wird von einem jüdischen Ordner der Weg gezeigt. Gepäck und Hausrat unordentlich vor dem Gebäude verstreut. Gepäckstück: Käte Sara Voss. Frau mit zwei Mädchen, diese schieben einen Kinder- wagen und halten Puppe in der Hand. Jüdische Frauen und Männer in einer Art Büro, Papiere werden durchgesehen. Aufnahme von Gebäuden (Baracken?) ...ZT: Einige Beispiele jüdischer Ordnung: Unordentliche Ansammlung von Hausrat. Hochbetten. Beutel, Koffer und Haushaltsgeräte in den Räumlichkeiten. Kofferaufschrift: Rita Sara Schneck. Mädchen ordnet Tücher in einen Schrank ein. Jungen waschen ihre Hände. Eine Frau legt Hemden/Wäsche zusammen. Ein jüdischer Mann schreibt etwas. Küchenarbeit (Kartoffeln werden geschält). Großküche. Soldat probiert die Suppe. Zwei Jungen holen Kohle. Aufnahme eines kleinen Mädchens. Mann telefoniert, Büro(?) - KZ-Insassen. Oranienburg; unbekannter Ort (1942/44) - Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag von Dietrich Eckart in Neumarkt (1943) ...Spruch von D.E. im Straßenbild: „Dem Juden nicht unterliegen heißt ihn besiegen!“ - Herr Roosevelt plaudert (1943) Deutscher Propagandafilm, der anhand amerikanischer Originalwochenschauen die Verantwortung für den zweiten Weltkrieg den Vereinigten Staaten und den die amerikanische Gesellschaft dominierenden Juden anlastet. - Ufa-Auslandstonwoche 612/1943 ...Eine zu Pferd haltende Gruppe von Kosaken in deutscher Uniform mit Truppenfahne, auf der Fahne russische Inschrift "1. Ataman-Kosakenregiment aus Sinegorje" sowie ein Adler mit Hakenkreuz und die russische Inschrift "Im Namen des orthodoxen Christentums ziehen die treuen Söhne vom Don in den entschlossenen Kampf gegen die Juden" - Hier spricht London (1944) Kurzfilm der deutschen Luftwaffe (mit Spielhandlung), der darauf abzielt, Auslands- meldungen der BBC als „jüdische Lügen“ zu diskreditieren. - Judendeportation in Budapest (1944) ...Deportationszug ungarischer Juden durch die Rákócsi-Straße in Budapest. - Maidanek (UdSSR/1944) Sowjetischer Dokumentarfilm über das befreite Konzentrationslager Majdanek und die Ermittlung der Außerordentlichen polnisch-sowjetischen Untersuchungskommission. Aufnahmen aus dem am 23. Juli 1944 von polnischen und sowjetischen Truppen befreiten Konzentrationslager Majdanek bei Lublin. ...Konzentrationlager Maidanek: Aufnahmen aus dem befreiten Lager, deutsche Gefangene, Arbeiten der Untersuchungskommission beginnen unmittelbar nach der Befreiung. Verhör des SS-Rottenführers Theodor Schöllen (geb. 22.4.1904, gehängt 3.12.1944) …Öffnung von Massengräbern im Zuge der Untersuchungen. ...Aussage des polnischen Zeugen Andrzej Stanislawski, laut Kommentarton zum Massenmord an 18400 Häftlingen am 3.11.43, zu dem lautstarke Musik gespielt wurde (Anmerkung: Es handelt sich um die unter dem Codenamen "Erntefest"
bekannte Abschlussaktion der Aktion Reinhardt", bei der jüdische Gefangene der Lager Trawinki und Poniatowa getötet wurden) ..Aussage des polnischen Zeugen Tadeusz Budzen, laut Kommentarton zur Vernichtung von 1200 griechischen Intelektuellen. ...Die Untersuchungskommission besichtigt Gaskammern auf dem Lagergelände. ...Aussagen des SS-Obersturmführers Anton Thernes (geb.8.2.1892, gehängt 3.12.1944, stellvertretender Leiter der Abteilung IV-Verwaltung) laut Kommentarton: von SS- Obersturmbannführer Dr. Rindfleisch Mitteilung erhalten, dass am 21.10.1943 300 Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren vergast wurden. ...Aussage des holländischen Zeugen Anton Benem: laut Kommentaton am ersten Tag seiner Haft im April 1943 Zeuge der Ermordung von 200 Gefangenen. ...Aussage von Kapos Hein Stalp (geb. 5.6.1913, gehängt 3.12.1944): laut Kommen- tarton im Juli 1944 wurden 32 Mann Bedienungspersonal der Gaskammer selbst vergast, um Zeugen zu beseitigen. ...Aufnahmen des von den Deutschen nur unvollständig beseitigten Krematorium- Gebäudes und seiner Vebrennungsöfen, Kommentarton: 68.000 Menschen wurden hier verbrannt ...Lagergebäude mit den persönlichen Habseligkeiten, die den Opfern von den Deutschen abgenommen wurden; Besichtigungen eines Schuhmagazins unter der Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden der Untersuchungskommission Kudrjawcew (auch: Kudriawcew). ...Aussagen des Rottenführer Hermann Vogel (geb.2.7.1902, gehängt 3.12.1944): laut Kommentarton: 1944 in kurzer Zeit 18 Waggons mit Beutegut versandfertig nach Deutschland gemacht; Ziel war Zuchthaus Plötzensee. ...Ausweisdokumente verschiedener europäischer Staaten. ...Trauerfeier in Lublin am 6.8.1944: religiöse Zeremonie unter Leitung von Prälat Dr. Kruszinski. Enthüllung einer Gedenktafel für die Opfer. - Warschauer Ghetto (1942) Im Warschauer Filmarchiv zusammengestelltes Material über das Leben im Ghetto und dem nach dem Aufstand niedergebrannten jüdischen Wohnbezirk - U-Boot Bunker im Bau (1944) Bau des U-Boot-Bunkers (der U-Boot-Bunkerwerft) "Valentin" in Bremen-Farge mit Fremdarbeitern und KZ-Häftlingen. - Die Deutsche Wochenschau 718/25/1944 ... Juden in aller Welt: in Moskau bei einer Preisverleihung, in amerikanischen Städten als Straßenhändler, an der Börse, der jüdische Bürgermeister von New York, La Guardia. - Europa-Woche 90/1944 ...Einsatz der deutschen Wehrmacht gegen Slowaken. Männer und Frauen (Kommentar: ...aufgegriffene Aufständische....das sind die Soldaten Stalins: Juden und Mischlinge...) - Der Führer schenkt den Juden eine Stadt (1944/45) Fragment eines Propagandafilms der SS für das Ausland über das KZ Theresienstadt. Häftlinge bei der Arbeit und in der „Freizeit“. Verhüllung der tatsächlichen Zustände in Theresienstadt. (mehr Szenen siehe „Theresienstadt“) - Theresienstadt (1944) Kurzinhalt: Ein von der SS, resp. vom Zentralamt zur Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren in Auftrag gegebener Propagandafilm, der ein falsches Bild von den Zuständen im KZ Theresienstadt geben und die Außenwelt darüber täuschen sollte, was wirklich m mit den europäischen Juden geschah. Gezeigt werden Häftlinge in diversen "Rollen" bei der Arbeit und in der Freizeit. Alle Häftlinge tragen zivile Kleidung, meistens mit dem vorgeschriebenen Judenstern. Es werden zahlreiche inhaftierte Prominente gezeigt, um dem Ausland gegenüber zu belegen, daß sie noch leben. Mit Ausnahme der tschechischen Kameramänner waren alle Mitwirkende am Film Häftlinge. Fast alle daran beteiligten jüdischen Personen, produzierende wie dargestellte, sind nach Fertigstellung des Films nach Auschwitz transportiert und dort ermordet worden.
Der Film war ursprünglich ca. 90'-95' lang und bestand aus 38 Sequenzen. Erhalten sind in den überlieferten Fragmenten die (vollständigen wie unvollständigen) Sequenzen 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15-17 und 26-37. Ihre Laufzeit zusammengenommen beträgt 25'57''. Zusätzlich zu dem o.g. Fragmenten sind überliefert sehr kurze Filmstreifen (2-5 Bildfelder), die sich zuordnen lassen zu Sequenzen 1, 2, 6, 7, 16, und Einzelbilder, die sich zuordnen lassen zu Sequenzen 3-5, 8-10, 13, 20, 22, 24, 25.(Siehe K/254864) Außerdem liefern die Skizzen von Jo Spier weitere Bildinformationen zu den unvollstädig oder nicht erhaltenen Sequenzen des Films. Rekonstruktion: siehe Registerkarte: Anmerkungen Auftretende Personen: Karel Fischer (Dirigent); Jo Spier (Maler, Zeichner, Holland); [Frau] Görtz (Gräfin, Holland); Paul Eppstein (Vorsitzender des Ältestenrates der Juden / Soziologe, Mannheim, Berlin); Alfred Meissner (Jurist, ehem. Minister, Tschechoslowakei); Georg Gradnauer (ehem. Reichsinnenminister und Ministerpräsident, Sachsen); Léon Meyer (ehem. Handels- marineminister, Frankreich); Johann Georg Franz Hugo Friedländer (Feldmarschall, Österreich); Emil Sommer (Generalmajor, Österreich); Max Friediger (Mitglied des Ältestenrates der Juden / Oberrabbiner, Dänemark); Clara Schultz (Witwe eines Flotten-Kommandeurs, Dänemark); Julie Salinger (Opernsängerin, Hamburg); Benjamin Murmelstein (Mitglied des Ältestenrates der Juden / Rabbiner, Wien); Leo Baeck (Mitglied des Ältestenrates der Juden / Rabbiner, Berlin); Desider Friedmann (Mitglied des Ältestenrates der Juden / Jüdische Kultusgemeinde, Wien); David Cohen (Mitglied des Ältestenrates der Juden / Joodsen Raads, Amsterdam); Phillip Kozower (Mitglied des Ältestenrates der Juden, Direktor der Post im KZ Theresienstadt / Jüdische Kulturgemeinde, Berlin); Kurt Gerron (Regisseur, Schauspieler); Rudolf Grabower (Richter, München; Hochschullehrer, Berlin); Franzi Schneidhuber (Witwe des SA-Obergruppenführers August Schneidhuber, München); Elly von Bleichröder (Tochter des Bankiers James von Bleichröder, Berlin); [Frau] von Hennicke (?); Leon Neuberger (Oberst a.D., Österreich); Rudolf Saudek (Bildhauer, Leipzig); Heinrich Klang (Richter / Hochschullehrer, Wien); Ernst Kantorowicz (Hochschullehrer, Frankfurt am Main); Emil Utitz (Hochschullehrer, Rostock, Halle, Prag); Hermann Strauss (Hochschullehrer, Berlin); Otto Stargardt (Landgerichtsrat, Berlin); Alexander Cohn (Jurist, Berlin); Alfred Philippson (Hochschullehrer, Bern, Halle, Bonn); Alfred Klein (?, Jena); Artur Stein (Historiker, Prag); Leo Taussig (Hochschullehrer, Prag); Maximilian Adler (Hochschullehrer, Prag); Karel Ancerl (Dirigent); Ernst Rosenthal (Detektivabteilung im KZ Theresienstadt / Geschäftsführer vom Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, Berlin); Fritz Gutmann (?, Berlin); Julius Moritz (?, Berlin); Karl Meinhard (Theaterdirektor, Berlin); Karl Löwenstein (Bankier, Berlin); Leo Löwenstein (Unternehmer, Aachen); Heinrich Gans (Polizeirat, Wien); Heinrich Dessauer (?, Wien); Ove Meyer (Industrieller, Kopenhagen); Morits Oppenhejm (?, Kopenhagen); Melanie Oppenhejm (?, Kopenhagen); Franz Kahn (Jurist, stellvertr. Leiter der Jüdischen Kultusgemeinde, Prag); Robert Mandler (Jüdische Kultusgemeinde, Prag); Erich Springer (Leiter der Chirurgie im KZ Theresienstadt / Arzt, Prag); Elisabeth Czech (Witwe eines ehem. Ministers, Tschechoslowakei); Hans Krása (Komponist, Prag); Pavel Haas (Komponist, Brno); [Frau] Cohen (Frau von David Cohen); [Frau] Kozower (Frau von Phillip Kozower); [1. Kind] Kozower (Kind von Phillip Kozower); [2. Kind] Kozower (Kind von Phillip Kozower) Langinhalt: 1. Titelsequenz, unvollständig erhalten: Konzert - 39'' Der von Karel Fischer geleitete Chor singt Felix Mendelssohn-Bartholdys "Elias"; Zuschauer, darunter Jo Spier (Maler, Zeichner, Holland) und die Gräfin Görtz (Holland) (div. Einst., nah) --- 2. Sequenz, unvollständig erhalten: Geschichte von Theresienstadt - 51'' Zeichnungen der Festung Theresienstadt von Jo Spier - Zeitgenössischer Blick über die Stadt --- 3. Sequenz, nicht erhalten: Jazz im Musikpavillon - Stadtplatz mit Jazzband in einem Musikpavillon, die Zuhörer stehen oder sitzen auf Parkbänken --- 4. Sequenz, nicht erhalten: Kaffeehaus-Terrasse
- Terrasse mit Sonnenschirmen, Kellnerinnen servieren Getränke, Leute spazieren in dem sich anschließenden Garten auf und ab. Im Bild: Paul Eppstein (Vorsitzender des Ältestenrates der Juden / Soziologe, Mannheim, Berlin); Alfred Meissner (ehem. Minister, Tschechoslowakei), Georg Gradnauer (ehem. Reichsinnenminister und Ministerpräsident, Sachsen), Léon Meyer (ehem. Handels- Handelsmarineminister, Frankreich), Johann Georg Franz Hugo Friedländer (Feldmarschall, Österreich), Emil Sommer (Generalmajor, Österreich), Max Friediger (Mitglied des Ältestenrates der Juden / Oberrabbiner, Dänemark), Clara Schultz (Witwe eines Flotten-Kommandeurs, Dänemark) --- 5. Sequenz, nicht erhalten: Kaffeehaus - Abend im Kaffeehaus mit Musik und Tanz --- 6. Sequenz, unvollständig erhalten: Freizeit auf den Stadtwällen - 93'' Menschen im Freien bei Gymnastik, beim Lesen, Zeichnen, Stricken, Schachspielen, auf Parkbänken und Wiese, einzeln und in Gruppen (div. Einst., z.T. nah) --- 7. Sequenz, unvollständig erhalten: Sport - 31'' Sport auf einer der Basteien: Leichtathletik der Männer, Frauen spielen Handball (div. Einst.) --- 8. Sequenz, nicht erhalten: Theater - Bühnenszenen aus Jacques Offenbachs "Hoffmanns Erzählungen" und aus dem jiddischen Stück "In mitt'n Weg", im Publikum: Julie Salinger (Opernsängerin, Hamburg) --- 9. Sequenz, nicht erhalten: Beginn eines Werktages - Der Stadtplatz am Beginn eines Werktages: Gruppen singender Männer und Frauen mit geschulterten Spaten und Rechen marschieren singend zur Arbeit --- 10. Sequenz, erhalten: Die jüdische Selbstverwaltung - 128'' Eine Sitzung des Ältestenrates, die Mitglieder hören einer Rede des Vorsitzenden Paul Eppstein zu, u.a. im Bild: Benjamin Murmelstein (Rabbiner, Wien), Leo Baeck (Rabbiner, Berlin), Desider Friedmann (Jüdische Kultusgemeinde, Wien), David Cohen (Joodsen Raads, Amsterdam), Phillip Kozower (Direktor der Post im KZ Theresienstadt / Jüdische Kulturgemeinde, Berlin), Max Friediger (17 Einst., z.T. nah, z.T. Kamerafahrt) --- 11. Sequenz, unvollständig (Anfang) erhalten: Gericht der jüdischen Selbstverwaltung - 10'' Hinweisschilder "Gericht", "19", "Rathausg.", ? (Staatsanwalt) spricht, Zuschauer im Gerichtssaal (3 Einst.) - Gerichtsverhandlung --- 12. Sequenz, nicht erhalten: Die Bank der jüdischen Selbstverwaltung - Geschäfte an den Bankschaltern, der Banktresor --- 13. Sequenz, nicht erhalten: Läden - Leute warten auf die Öffnung der Geschäfte, Kunden in einem Herrenbekleidungsgeschäft --- 14. Sequenz, nicht erhalten: Postamt - Leute, die Pakete aus vielen verschiedenen Ländern abholen; ein Paket wird in der Unterkunft eines Ehepaares ausgepackt --- 15. Sequenz, unvollständig erhalten: Gesundheitswesen - 52'' Operation; Krankenhaussaal mit Ärzten und Patienten; Patienten in Betten im Garten der Klinik (div. Einst., z.T. groß) --- 16. Sequenz, unvollständig erhalten: Kindererholungsheim - 50'' Kinder im Park essen belegte Brote und Obst, Kinder trinken, fröhliche Kindergesichter; Schwenk über Kinder auf Liegen (div. kurze Einst., z.T. groß) - 48'' Schild: "Zum Spielplatz"; Kinder marschieren in Zweierreihe durch Park, spielen im Sand, im Planschbecken; Kinder auf Schaukeln; Kinder steigen Treppe hoch (div. Einst.) - 21'' Schwenk über Kinderbetten im Freien, Kinder auf Schaukelpferden (div. Einst., z.T. nah) --- 17. Sequenz, unvollständig erhalten: Kinderoper "Brundibár" - 102'' Schlußszene aus Kinderoper "Brundibár" von Hans Krása (Prag). Kinderchor auf Bühne, Schwenk über singende, z.T. kostümierte Kinder; Zwischenschnitte: Zuschauer (div. Einst. z.T. nah)
--- 18. Sequenz, nicht erhalten: Feuerwehr - Die Feuerwehr der jüdischen Selbstverwaltung: Feueralarm, der Löschwagen verläßt die Feuerwehrstation, die Feuerwehrmänner löschen ein Feuer --- 19. Sequenz, nicht erhalten: Eisenbahnbau - Gleisarbeiter reparieren einen Schienenabschnitt --- 20. Sequenz, nicht erhalten: Landwirtschaftliche Arbeit - Gärtnerei außerhalb der Stadt: Gemüse und Kartoffeln, Seidenraupenzucht. Enten- und Geflügelhaltung. Ernte, eine Dreschmaschine bei der Arbeit. Das Wirtschaften auf dem Ackerland --- 21. Sequenz, nicht erhalten: Zentralküche - Verpflegung: in einer Zentralküche wird das Essen zubereitet, Essenausgabe auf Lebensmittelkarten, essende Leute im gemeinsamen Speisesaal --- 22. Sequenz, nicht erhalten: Varieté - Freilichtvarieté auf einer Wiese außerhalb der Ghettomauern: es treten auf eine Tänzerin, ein Musikduo (Akkordeon und Violine), ein deutsches Kabarett-Trio, eine Sängerin sowie Kurt Gerron selbst. Im Bild: Rudolf Grabower (Richter, München; Hochschullehrer, Berlin), Phillip Kozower, Frau Franzi Schneidhuber (Witwe des SA-Obergruppenführers August Schneidhuber, München), Elly von Bleichröder (Tochter des Bankiers James von Bleichröder, Berlin), [Frau] von Hennicke (?), Leon Neuberger (Oberst a.D., Österreich) --- 23. Sequenz, nicht erhalten: Schwimmen - Schwimmen im Flußbad der Eger --- 24. Sequenz, nicht erhalten: Wäscherei - Zentrale Wäscherei --- 25. Sequenz, nicht erhalten: Tischlerei - Maschinentischlerei in einer früheren Reitschule: das Sägen von Holz, die Herstellung von Brettern und von Bauteilen für Holzbaracken --- 26. Sequenz, unvollständig (Ende) erhalten: Werkstatt - 10 m Werkstatt eines Huf- und Wagenschmieds: Hufschmied beim Beschlagen des Vorderhufes einer Kuh, Mann mit Judenstern führt Kuh am Strick (div. Einst., z.T. nah) --- 27. Sequenz, erhalten: Schmiedewerkstatt - 13 m Mehrere Schmiede bearbeiten glühendes Eisen mit Schmiedehämmern, die Esse mit lodernden Flammen (div. Einst., z.T. nah) - 06 m Mehrere Schweißer beim Schweißen verschiedener Maschinenteile (div. Einst., z.T. nah) - 10 m Arbeiter dengelt Sensenblatt an Werkbank; bearbeitet Metallteile an Fräsmaschine und Drehbank (div. Einst., z.T. nah) --- 28. Sequenz, erhalten: Atelier - 05 m Frau beim Töpfern an einer Drehscheibe (div. Einst., z.T. nah) - 05 m Frau modelliert auf Ateliertisch kleines Pferd aus Ton (div. Einst., z.T. nah) - 13 m Rudolf Saudek (Bildhauer, Leipzig) bei der Arbeit an großer Brunnenfigur. Musik aus "Pariser Leben" von Jacques Offenbach. (div. Einst., .z.T. nah) --- 29. Sequenz, erhalten: Werkstätten - 02 m Herstellungs- und Reparaturwerkstätten in hölzernen Baracken außerhalb der Stadt (div. Einst.) - 19 m Arbeiter mit Judenstern in Taschnerwerkstatt beim Zuschneiden und Herstellen von Taschenteilen (div. Einst.) - 25 m Näherinnen, zum Teil an Nähmaschine, in großem Saal; fertiggestellte Teile werden verpackt (div. Einst.) - 10 m Schneider beim Bügeln von Kleidungsstücken, ein Schneider heftet Hose zusammen, Schneider nähen in großem Raum an Nähmaschinen und mit der Hand (div. Einst.) - 07 m Schuster nähen Schuhe, zum Teil an Nähmaschinen, bearbeiten Schuhmaterial an Arbeitsständer mit Schusterhammer und Locheisen (div. Einst.) - 09 m Schuster stehen gemeinsam auf und gehen zum Ausgang der Werkstatt
- 15 m Frauen und Männer verlassen inkleinen Grüppchen und einzeln ihre Baracken, gehen auf Straße mit Hochspannungsmasten, im Hintergrund die Baracken. Musik aus Mendelssohns "Sommernachtstraum" (div. Einst.) --- 30. Sequenz, erhalten: Fußballspiel - 06 m Viele Menschen eilen auf Toreinfahrt zu, gehen durch Toreinfahrt, Zuschauer lehnen sich aus Arkaden im ersten Stock (div. Einst.) - 11 m Ligasieger gegen Pokalsieger (lt. H.G. Adler). Spieler laufen durch Zuschauerreihen auf Spielfeld im Innenhof einer ehemaligen Kaserne, der "Dresdner Kaserne", stellen sich mit dem Rücken gegeneinander auf, Schiedsrichter begrüßt Mannschaftsführer mit Handschlag, Auslosung der Mannschaft, die den Anstoß ausführt; Zwischenschnitte: Die Zuschauer befinden sich dichtgedrängt rings um das Spielfeld, und in den Arkaden des Gebäudes in den oberen Stockwerken (div. Einst.) - 21 m Anstoß, Spielszenen: Spieler holt Ball aus Zuschauerreihe mit jungen Frauen, Eckball, Torschuß und Tor, Zwischenschnitte: Zuschauer (div. Einst., nah) - 07 m Anstoß, Seiteneinwurf, Kopfballszene (Schwenk) - 32 m Kopfballduell, Torszenen, Seiteneinwurf, Ende des Spiels, Zwischenschnitte: Zuschauer (div. Einst., z.T. nah, z.T. Schwenk, z.T. Vogelperspektive) - 04 m Menschen verlassen Spielstätte durch Toreinfahrt, zahlreiche Menschen auf der Straße (div. Einst.) --- 31. Sequenz, erhalten: Zentralbad - 10 m Männer duschen in zwei gekachelten Duschkabinen (div. Einst.) - 01 m Männer mit Judenstern verlassen Holzbau mit Aufschrift "Zentralbad", einige mit uniformähnlicher Kleidung (kurze Hose, Hemd mit Schulterklappen, Schlips, Halbtotale) --- 32. Sequenz, erhalten: Zentralbücherei - 04 m Straße mit wenigen Passanten, Mann liest im Gehen in einem Buch, älterer Mann öffnet Glastür und betritt Bibliothek (div. Einst.) - 11 m Älterer Mann betritt Bibliotheksraum, Schwenk durch Bibliotheksräume, Benutzer stehen zwischen Bücherregalen und unterhalten sich. Im Bild u.a. David Cohen, Heinrich Klang (Richter / Hochschullehrer), Ernst Kantorowicz (Hochschullehrer, Frankfurt), Desider Friedmann (div. Einst.) --- 33. Sequenz, erhalten: Vortrag Emil Utitz - 18 m Vortrag: Emil Utitz (Hochschullehrer, Rostock, Halle, Prag) an einem Rednerpult, Zwischenschnitte von Zuhörern (nah), unter ihnen: Leo Baeck, Hermann Strauss (Hochschullehrer, Berlin), Otto Stargardt (Landgerichtsrat, Berlin) und jur. Alexander Cohn (Jurist, Berlin), Alfred Philippson (Hochschullehrer, Bern, Halle, Bonn), Alfred Klein (?, Jena), Heinrich Klang, Benjamin Murmelstein, Artur Stein (Historiker, Prag), Leo Taussig (Hochschullehrer, Prag), Maximilian Adler (Hochschullehrer, Prag), Franzi Schneidhuber, Elly von Bleichröder. Musik: Violinsonate oder Trio von Felix Mendelssohn-Bartholdy (div. Einst., z.T. Schwenk) --- 34. Sequenz, erhalten: Konzert - 50 m Karel Ancerl dirigiert "Studie für Streichorchester" von Pavel Haas, Zwischenschnitte: Zuhörer an Tischen mit kleinen Blumengestecken, u.a. Ernst Rosenthal (Detektivabteilung im KZ Theresienstadt / Geschäftsführer des Reichsbund Jüdischer Frontsoldaten, Berlin), Fritz Gutmann (?, Berlin), Julius Moritz (?, Berlin), Karl Meinhard (Theaterdirektot, Berlin), Karl Löwenstein (Bankier, Berlin), Leo Löwenstein (Unternehmer, Aachen), Rudolf Saudek, Heinrich Gans (Polizeirat, Wien), Heinrich Dessauer (?, Wien), Ove Meyer (Industrieller, Kopenhagen), Morits Oppenhejm (?, Kopenhagen), Melanie Oppenhejm (?, Kopenhagen), Franz Kahn (Jurist, stellvertr. Leiter der Jüdischen Kultusgemeinde, Prag), Robert Mandler (Jüdische Kultusgemeinde, Prag), Erich Springer (Leiter der Chirurgie im KZ Theresienstadt / Arzt, Prag), Elisabeth Czech (Witwe eines ehem. Ministers, Tschechoslowakei), Hans Krása, Pavel Haas (Komponist, Brno) (div. kurze Einst., z.T. nah, z.T. Kamerafahrt) - 09 m Nach Ende des Konzerts geben sich Karel Ancerl und Pavel Haas unter Applaus die Hand, Zuhörer (div. Einst.) --- 35. Sequenz, erhalten: Gärten - 02 m Bachufer, im Wasser schwimmen Blätter, drei Jungen sitzen am Wasser (Schwenk, div. Einst.) - 31 m Schrebergärten am Festungsgraben unterhalb der Stadtmauer, zahlreiche Leute bei verschiedenen Gartenarbeiten, überwiegend Blumengießen (div. Einst., z.T. nah) --- 36. Sequenz, erhalten: Gemeinschaftsunterkünfte
- 17 m Außenanlagen der Wohnbaracken mit Bewohnern, überwiegend Frauen und Kinder: auf Bänken, sich unterhaltend, lesend (div. Einst.) - 37 m Wohnbaracke des Frauenheims innen, Schwenk über breiten Mittelgang zu einzelnen Parzellen mit Holztischen und Holzbänken, Doppelstockbetten trennen Parzellen, z.T. mit Tüchern verhängt; verschiedene Frauen und junge Mädchen beim Lesen, bei Handarbeit (Stricken, Nähen), Unterhaltung in kleinen Gruppen, Kartenspielen, unter ihnen eine Schwester in Tracht (div. Einst., z.T. nah, z.T. Kamerafahrt) --- 37. Sequenz, unvollständig (Anfang) erhalten: Abendessen einer "Familie" - 02 m "Familie" an Eßtisch in Wohnraum, zwei gerahmte Bilder an den Wänden: Großeltern (dargestellt von David Cohen und Frau (Amsterdam), Eltern und zwei Mädchen (dargestellt von Phillip Kozower, seiner Frau und seinen Kindern), Tisch gedeckt --- 38. Sequenz, nicht erhalten: - Schlußmontage --- K-Ton (- Sequenzen): - 2 "In den Jahren 1780 bis 1790 wurde nach Plänen von Sebastian Vauban, dem Festungsbaumeister der britischen Armee am Zusammenfluß der Eger und Elbe in Böhmen eine Festung erbaut. Die Festung wurde nach dem Vorbild eines altrömischen Castellums angelegt mit einer Hauptstraße, die durch zwei Tore abgeschlossen wird. Die Kaserne mit ihrem viereckigen Canapé mit der typischen Bauweise der österreichischen Militärarchitektur imperialer und nachimperialer Bauweise. Die südländische Bauweise der Häuser und Kasernen wurde von italienischen Baumeistern geschaffen. Zur Erinnerung an seine verstorbene Mutter Theresia." - 6 "In den Parks der alten Festung verbringt bei strahlender Sonne jeder gerne ein paar Stunden seiner Freizeit. Am Abend bei Sport und Spiel." - 15 "Die Krankensäle sind mit allem Notwendigen versehen. Im Park des Krankenhauses können die Kranken bei schönem Wetter [in der Sonne] liegen." - 16 "Am Stadtrand ist ein Erholungsheim für genesende Kinder [untergebracht]. Alle Kinder von Theresienstadt finden in den Parks und auf Spielplätzen Möglichkeiten für ihr Treiben. Auch ein Planschbecken ist da." - 26-27 "Die Erhaltung und Erneuerung von Maschinen und Geräten verschiedenster Art macht eine Reihe von Werkstätten unentbehrlich, in denen die Schmiede und Schlosser, die Mechaniker und Elektriker arbeiten. ... Für Arbeiter verschiedener Berufe und Handwerker gibt es auch in Theresienstadt Möglichkeiten, ihre Tätigkeit fortzusetzen." - 28 "Auch die Kunst und das Kunstgewerbe kommen zu ihrem Recht. Bildhauer Rudolf Saudek beim Entwurf einer Brunnenanlage." - 29 "Eine kleine Barackenstadt ist das Arbeitszentrum. Dem allgemeinen Wohl dienende Arbeiten aller Art werden von Männern und Frauen in Einsatzgruppen in sogenannten Hundertschaften durchgeführt. Die Gruppen werden je nach Bedarf für die verschiedenen Aufgaben bestimmt und umgeschult. Jeder arbeitsfähige [...] hat sofort die Möglichkeit, [sich] in den Arbeitsprozeß rasch und reibungslos einzugliedern. Die Werkstätten der Taschner und Schneider, der Schneiderinnen und Weißnäherinnen, der Schuster und anderer Handwerker sind hier unter der Leitung von Fachkräften in vollem Betrieb." - 29 "Wenn der Arbeitstag endet und der Feierabend beginnt, strömen aus den verschiedenen Vorwerken und Arbeitsbaracken die Arbeiter und Arbeiterinnen wieder in die Stadt zurück. Die Gestaltung der Freizeit ist jedem einzelnen überlassen." - 30 "Oft nimmt der Strom der Heimkehrenden nur eine Richtung: zur größten Sportveranstaltung in Theresienstadt, zum Fußballwettspiel. Um die Zuschauermenge fassen zu können, findet das Wettspiel immer auf dem Hof einer früheren Kaserne statt. Wegen des etwas beschränkten Spielraumes sind die beiden Mannschaften nur je sieben Mann stark. Trotzdem wird von Anfang bis zum Ende den begeistert mitgehenden Zuschauern ein hartes Spiel geliefert." - 31 "Ein Dampfbad steht der Bevölkerung zur Verfügung." - 32 "Die reich ausgestattete Zentralbücherei enthält neben schöngeistiger auch reichhaltige wissenschaftliche Literatur [und] wird den verschiedensten Ansprüchen gerecht." - 33 "Abendvorträge über wissenschaftliche und künstlerische Themen haben ihren ständigen [...] Zuhörerkreis." - 34 "Musikalische Darbietungen werden von allen Kreisen der Einwohnerschaft gerne besucht. In einem Konzert wird ein Werk eines in Theresienstadt lebenden jüdischen Komponisten aufgeführt." - 35 "In den Schrebergärten der Familien gibt es ständig zu jäten und zu gießen, wächst hier doch ein willkommener Zuschuß für den Küchenzettel."
- 36 "Der Feierabend ist hier die richtige Zeit des privaten Lebens. Vor und in den Wohnungen wird noch geplaudert, gelesen oder gespielt. Alleinstehende Frauen und Mädchen machen es sich in ihrem Frauenheim gemütlich." Quelle: Cinematographie des Holocaust: www.cine-holocaust.de, Sichtungsprotokoll, Holocaust-Findbuch H.-G.Voigt - Theresienstadt (Fragment der Szenen 1,2,6,7,15,16,17) ...1. Titelsequenz, unvollständig erhalten: Konzert Der von Karel Fischer geleitete Chor singt Felix Mendelssohn-Bartholdys "Elias" ...2. Sequenz, unvollständig erhalten: Geschichte von Theresienstadt Zeichnungen der Festung Theresienstadt von Jo Spier, Zeitgenössischer Blick über die Stadt ...6. Sequenz, unvollständig erhalten: Freizeit auf den Stadtwällen Menschen im Freien bei Gymnastik, beim Lesen, Zeichnen, Stricken, Schachspielen, auf Parkbänken und Wiese, einzeln und in Gruppen ...7. Sequenz, unvollständig erhalten: Sport Sport auf einer der Basteien: Leichtathletik der Männer, Frauen spielen Handball ...15. Sequenz, unvollständig erhalten: Gesundheitswesen Operation; Krankenhaussaal mit Ärzten und Patienten; Patienten in Betten im Garten der Klinik ...16. Sequenz, unvollständig erhalten: Kindererholungsheim Kinder im Park essen belegte Brote und Obst, Kinder trinken, fröhliche Kindergesichter; Schwenk über Kinder auf Liegen.'' Schild: "Zum Spielplatz"; Kinder marschieren in Zweierreihe durch Park, spielen im Sand, im Planschbecken; Kinder auf Schaukeln; Kinder steigen Treppe hoch. Schwenk über Kinderbetten im Freien, Kinder auf Schaukelpferden ...17. Sequenz, unvollständig erhalten: Kinderoper "Brundibár" Schlußszene aus Kinderoper "Brundibár" von Hans Krása (Prag). Kinderchor auf Bühne, Schwenk über singende, z.T. kostümierte Kinder; Zwischenschnitte: Zuschauer - Theresienstadt – Einzelsujets: Ansprache von Eppstein in Anwesenheit des Juden- rates (1945) - Der Vorletzte Akt (BRD/1965) ...Brundibar – die Kinderoper von Theresienstadt - Die Deportation der Juden aus dem Weißmeergebiet (Bulgarien/ca. 1945) - Im Land der Adler und Kreuze (DDR/1980) ...Judenboykott 1933 in Berlin (18 m/Aus: Fox Tönende Wochenschau (1933) (R.2) ...Deportierung der Juden aus Balti (R.7) ...Massenexekutionen von Juden bei Libau 1941 (R.7) - An den Gräbern ermordeter NS-Opfer (1945) ...Ein Friedhof bei Bautzen. Dort wurden in einer Kiesgrube dreiundvierzig jüdische Frauen auf dem Transport von Auschwitz nach Buchenwald erschossen. ... Im Konzentrationslager Ravensbrück, Mauer mit Gedenkkränzen. - Auschwitz (Oswiecim) (UdSSR/1945) Konzentrationlager Ausschwitz nach der Befreiung ...Befreite Gefangene im Lager, Lageransichten, Panorama "Buna", Luftaufnahme Lager Birkenau, Lageplan Birkenau, Konstruktionszeichnungen Krematorien, Lageransicht Birkenau; Ältere Frauen in Baracke, Lageransichten Stammlager, Zaunanlagen, Privatfotos von Opfern, ausgemergelte Überlebene, Leichen, Evakuierung von Überlebenden, Familienangehörige des jugoslawischen Ministers Dr. Anton Manjic (Olga, Navanka, Olek Manjic); Überlebende Kinder der Zwillings- versuche Mengeles im Stammlager; Spuren von Leichenverbrennungen, zerstörtes Krematorium V, Giftflaschen, Zyklon-Behälter; Ermittlungen der sowjetischen Untersuchungskommision; Wissenschaftler als Häftlinge in Auschwitz, "Todesblock" im Stammlager; Effektenlager "Kanada": Frauenhaarballen, Zahnprothesen, Zahn- zangen; Hinterlassenschaften ermordeter Opfer: Brillen, Kleiderberge, Schuhwerk, Bürsten, Rasierpinsel, Stammlager: Koffer; Leichengrube; Trauerfeier mit Beisetzung von Opfern; Untersuchung von Kindern, Frauen und Männern durch sowjetische Ärzte, z.T. Opfer grausamer Behandlung durch Wachmannschaften, z.T. durch Hunger ent-
kräftet; Fotos von deutschen SS-Angehörigen, die in Auschwitz eingesetzt waren - Bilder aus einem KZ-Vernichtungslager (1945) (Obrawalde/Meseritz nach der Kapitulation) ...In einer Krankenstube werden Kinder aus dem Lager von Ärzten untersucht. Eine Kommission besichtigt Zellen und verschiedene andere Räumlichkeiten einer Haftanstalt. Säcke mit der Aufschrift "Anstalt Obrawalde". Freigelände mit einer großen Anzahl von Grabstellen, die nur jeweils mit einem Schild mit Nummer gekennzeichnet sind. Leichen in offenen Särgen. In einer Halle eine große Menge von aufgetürmten Leichen. Große Kofferstapel, Berge von Menschenhaar und künstlichen Gebissen werden von der Kommission besichtigt. Säcke mit der Aufschrift "KL Aus den 228 - Kg 22". - Buchenwald Concentration Camp (USA/1945) - Evakuierungstransport Auschwitz - Kolin am 24.01.1945 Eisenbahntransport von Häftlingen aus dem KZ Auschwitz in offenen Güterwagen am 24.01.1945. der Zug fährt auf dem verschneiten Gelände des Bahnhofs von Kolin an der Kamera vorüber (aufge-nommen vom erhöhten Kamerastandort; die Häftlinge in den Waggons sind nicht als solche erkennbar). - De hvide busser (Dänemark/1945) Bericht über die Rettung von KZ-Häftlingen 1945, die mit Hilfe der dänischen "Weißen Busse" von Neuengamme nach Dänemark verbracht wurden. Dieser dänische Dokumentarfilm wurde 1945 von dem freien Pressefotografen Svend Thy Christensen gedreht, der an verschiedenen Fahrten der weißen Busse zwischen Dänemark und Neuengamme teilnahm und diese Fahrten trotz Verbotes der SS filmte. Der Film wurde in Dänemark und Schweden als Material bei Film- und Vortragsveran- staltungen von Christensen genutzt. ... Aufnahmen aus den KZs Auschwitz, Theresienstadt, Mauthausen und Bergen-Belsen (unbekannte Aufnahmen). Ankunft der schwedischen weißen Busse in Haderlslev, Dänemark. Während die weißen schwedischen Busse KZ-Häftlinge aus den verstreuten Lagern in Neuengamme sammelten, wurde eine Quarantänestation in Padborg auf dänischem Boden errichtet. Aufnahmen aus dem KZ Auschwitz. Quarantänelager in Padborg: Errichtung des Quarantänelagers. Padborg vor der Ankunft der Häftlinge. Holzgeneratorwagen. Vorbereitung der Rettungsfahrten ...Dänische weiße Busse auf dem Weg durch Deutschland mit freigegebenen KZ- Gefangenen. Busse auf einer Straße (in Dänemark?). Rast (in Dänemark?). Busfahrer, die sich gegen Läuse pudern ...Quarantänelager in Padborg: Krankenschwestern. Besuch des Grafen Bernadotte und Inspektion der Quarantänestation durch SS-Obersturmbannführer Danziger (mit Ledermantel). Festliches Mittagessen mit Graf Bernadotte. Aufnahmen aus einem Krematorium. Begräbnis in Padborg. Dänische weiße Busse in Deutschland. Rast: Zum Schutz vor Luftangriffen werden Fahnen ausgelegt. ..Dänische Rote-Kreuz Einheiten bringen geschwächte Frauen aus Ravensbrück in einen Zug. Innenaufnahmen des Zuges. Schwedisches Rote-Kreuz-Personal. Aufnahmen aus Friedrichsruh (?). Ankunft eines Güterwagens mit weiblichen Gefan- genen in Padborg. KZ Gefangene bei der Ankunft in Dänemark. Aufnahmen aus einem KZ; Aufnahmen aus dem KZ Bergen-Belsen. Gerettete Frau in Padborg. Im KZ geborene Babies werden gepflegt. Weibliche Gefangene in Dänemark. Aufnahmen aus einem KZ. Weibliche Gefangene besteigen einen Zug. Versorgungs- lager in Dänemark. Baronesse Wedell-Wedellsborg in Padborg. Zug mit KZ-Gefan- genen. Abfahrt von Padborg nach Kopenhagen. Ausschnitte eines fremden Films über die Konzentrationslager - Nazi Concentration Camps (1945) Filmaufnahmen der Alliiierten über die befreiten KZ’s ...Leipzig-Thekla, Penig, Ohrdruf, Hadamar (R.1) ...Meppen (Kriegsgefangenen-Stammlager VI/C), Münster (Kriegsgefangenen- Stammlager VI/F), Breendonck, Nordhausen (Dora, Mittelbau II“), Mauthausen (R.2) ...Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen (R.3) - Le Retour (Frankreich/ca. 1945) Dokumentarfilm mit französischem K-Ton über die Befreiung von Kriegsgefangenen, KZ-Häftlingen, Zwangsarbeitern und ihre Rückkehr in die Heimat, vor allem nach
Frankreich ...Befreiung KZ Dachau: Proviant wird am Fenster einer Baracke unter Aufsicht zweier Amerikaner an Gefangenen verteilt Gefangener ißt warme Suppe. Ehemalige KZ – Insassen steigen auf Lkw, einige werden hinaufgehoben. Im Lazarett werden in Betten liegende KZ-Häftlinge untersucht. Ein auf einem Bett liegender Mann freut sich über die erste Zigarette. - Die Todesmühlen (1945) Filmaufnahmen der Alliierten über die befreiten KZ’s ... Auschwitz, Ohrdruf, Buchenwald, Majdanek, Mauthausen, Bergen-Belsen (R.1) ...Hadamar, Mauthausen, Bergen-Belsen, Auschwitz, Holsten, Flossenbürg (R.2) Laut Beschreibung in MAVIS 578799 gezeigte Orte: Leipzig-Thekla, Penig (Sachsen), Ohrdruf (Kreis Gotha), Hadamar, Meppen, Münster, Breendonck, Nordhausen, Maut- hausen, Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. - Ein Jahr später (1946) ... Konzentrationslager, KZ-Häftlinge, Leichenberge. Der Augenzeuge 18/1946 bitte kontaktieren Sie progress.film ... Kinder suchen ihre Eltern, u.a. Karl Weiss, Auschwitz, wurde im KZ von den Eltern getrennt. - Todeslager Sachsenhausen (1946/47) ... Aufbau des paramilitärischen Apparates der NSDAP, das Spitzeltum, die Ver- schleppung ins KZ Sachsenhausen, die Maßnahmen zur Lagersicherung. Der Kom- mentar führt aus, dass unter dem Spruch am Lagertor "Arbeit macht frei" die Häftlinge zur Zwangsarbeit gezwungen wurden und erläutert die Leiden der Häftlinge und schließlich die Befreiung durch die Rote Armee. Er gibt dann einen Überblick über andere Vernichtungslager und beschreibt die Ermordung der Gefangenen in Sach- senhausen und betont dabei die Ermordung von russischen Kriegsgefangenen sowie von anderen internationalen Häftlingen. Im Anschluss werden die Strafmaß- nahmen gegen die Häftlinge erklärt, der Aufbau des Lagers, die Hinrichtungen, das systematische Töten, die Logistik des Vernichtungssystems. Dies wird gestützt durch eine Zeugenbefragung eines ehemaligen Henkers durch sowjetische Soldaten, der die Funktionsweise der Tötungsmaschinerie erklärt (O-Ton), dazu sind die ver- schiedenen Tötungsräume zu sehen (kurz dazwischen geschnitten: Fotos, die von SS-Leuten geschossen wurden, um die Hinrichtungen zu dokumentieren). Die Aus- führungen des Henkers werden vom OFF-Kommentar kommentiert. Dann werden einige der Täter vorgeführt. - Frauen in Ravensbrück (1967) - Nürnberg und seine Lehre (1947) ...Der russische Ankläger vernimmt den Zeugen General Lahusen, Mitarbeiter von Canaris. Lahusen sagt über eine Besprechung mit Hitler in Hitlers Salonwagen aus. Entsprechende Bilder eingeblendet. Canaris habe Hitler vor den Erschiessungen der Zivilbevölkerung und der Vergasung von Juden gewarnt und gesagt, die Welt werde die Deutschen verantwortlich machen (hierzu Brände, nackte Menschen im KZ, Autoabgase werden in die Gaskammer geleitet, erhängte Zivilisten. Die Ortschaft Oradour mit ausgebrannten Häusern, Leichenberge, der Ort Bande in Belgien, die Höhlen von Calisto in Italien, eine Liste von erschossenen Geiseln, Leichenberge, der Ort Lidice nach der Niederbrennung, Häuser werden gesprengt). Ankläger schildert die Zustände in den KZ-Lagern. Lagerkommandant Rudolf Höss sagt als Zeuge aus, er habe die Leitung von Lager Auschwitz bis zum 01.12.1943 innegehabt (Flugaufnah- men vom Lager), Verbrennungsöfen, Schlafsaal mit Häftlingen (Aufnahmen in "Nacht und Nebel"), medizinische Experimente an Häftlingen, ein Arzt am Bett eines nackten Häftlings, Leichenberge. Der französische Ankläger nimmt zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit Stellung. (R.2) ... Maßnahmen gegen die Juden. Juden bei Zwangsarbeit. Judenboykott 1933 in den Strassen von Berlin, SA auf Lastwagen fordert in Sprechchören auf, nicht beim Juden zu kaufen. Göring verliest vor dem Reichstag in Nürnberg die Nürnberger Gesetze. Hitler als Zuhörer (Org.Ton), weiterhin Hess, Neurath, Frick als Zuhörer. Massnahmen im Ghetto von Warschau, Verfolgung der Juden, Vernichtung des Ghettos, Juden
werden niedergeschlagen und aus Kanälen herausgeholt. Nackte Juden im KZ, Leichenberge, Berge von Goldringen und Goldzähnen, angeblich in der Reichsbank in Frankreich eingelagert. Auszug aus Leys Testament vor seinem Freitod wird verlesen. Der Angeklagte Frank über die Judenvernichtung. „Tausend Jahre werden vergehen, bevor diese Schuld von Deutschland weggenommen wird“. Die Verteidiger beim Kreuz- verhör. Streicher wird zur Auswirkung einer Wochenschrift "Der Stürmer" befragt, er behauptet, die Wochenzeitung hätte nicht solche Wirkung getan, wie man behauptet (Originalton). Kaltenbrunner wird als Zeuge über die KZs vernommen (Originalton), Rosenberg wird als Zeuge vernommen (Originalton), Räder wird als Zeuge vernommen (Originalton). Göring als Zeuge behauptet, über das Ausmass der Judenvernichtung nicht unterrichtet gewesen zu sein (OrgTon). ...Schlusserklärungen der Hauptangeklagten (OrgTon). Frank: trage nach diesen Monaten des Prozesses ein Gefühl tiefer Scham in sich. Funk: er habe einen seeli- schen Zusammenbruch erlitten, als er das Ausmass der Judenvernichtung erfahren habe im Prozess "Ich empfand eine tiefe Scham." (R.2) - Der Augenzeuge 41/1947 bitte kontaktieren Sie progress.film ...Das einzige überlebende Kind der Berliner jüdischen Gemeinde Peter Dattel. - Lang ist der Weg (Dokumentar-Spielfilm/1948) Schicksal einer jüdischen Familie während der Jahre 1929 bis 1947. Die Sprache des Films ist teilweise jiddisch und polnisch mit deutschen Untertiteln. ...Überfall auf Polen. Bekanntmachungen aller Maßnahmen gegen die Juden. Zeremonie des Tischgebets am Sabbatt. Zusammenziehen der Juden im Ghetto. Abtransport der Juden mit Güterwagen in die KZ’s. Der Sohn der Familie, David, flieht auf dem Transport. (R.1) ...Die Mutter und der Vater im Konzentrationslager. Dokumentaraufnahmen von der Befreiung der Konzentrationslager. Der Sohn, der bei Partisanen gekämpft hat, macht sich Kriegsende auf die Suche nach seiner Familie. (R.2) ...Nachforschungen beim „Jüdischen Komitee“ in Warschau. Der Sohn erfährt, daß sein Vater umgebracht wurde, seine Mutter aber aus dem KZ Dachau entlassen wurde. (R.3) ...David heiratet im D.P.Camp Landberg eine junge Deutsche, die aus Polen vertrieben wurde, nach jüdischem Brauch (kurz). Über Radio und Lautsprecher wird im D.P. Camp der Jüdische Kongreß übertragen. Dokumentaraufnahmen vom Jüdischen Kongreß, der die Einreisemöglichkeiten nach Israel und die Auflösung der Lager verlangt. (R.4) ...David findet seine Mutter in einem Sanatorium wieder. (R.5) - Welt im Film 139/1948 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Cuxhaven: Überführung von im KZ umgekommenen Norwegern.Matrosen tragen die Särge. Spalier von norwegischen und englischen Matrosen. Die Särge werden auf ein Schiff getragen. Geistlicher hält an Bord eines Zerstörers eine Andacht. Matrosen an Deck angetreten bei Ehrenbezeugung. - Welt im Film 238/1949 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ...In Anwesenheit von Bundespräsident Heuß und dem amerikanischen Hochkommissar McCloy findet in Wiesbaden eine Veranstaltung für christlich-jüdische Zusammenarbeit statt. - Welt im Film 240/1949 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Dachau - Weihe für KZ-Gräber: Trauerfeier. Weihbischof Dr. Neuhäusler, Ober- rabiner Dr. Ohrenstein und Oberkirchenrat Daumiller sprechen. Kreuz als Mahnmal. - Ehrung für die 1933 - 1945 ermordeten Juden auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee ca. 1950 (AvT) (ehemals Woche E 556) ... Viele Menschen im Eingangsbereich und im Arkadengang des Jüdischen Friedhofs. Eine Gruppe Männer geht auf den Gedenkstein für die ermordeten Juden zu. In der Mitte des Arkadengangs jüdische Fahnen und Symbole. Die Gruppe verharrt still vor dem Gedenkstein. In der Gruppe auch Walter Ulbricht.Ein Rabbiner spricht am Gedenkstein. Ein Radioreporter hält ihm das Mikrofon hin.Viele Bezirksgruppen der VVN (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes) mit ihren Fahnen, auch Fahnen mit dem Davidstern sind zu sehen. Die Kamera schwenkt über die versammelte
große Menschenmenge. Der Rabbiner am Gedenkstein.Riesengroße Kränze werden herangetragen und am Gedenkstein abgelegt.Die Kamera schwenkt vom Gedenkstein auf die Kranzschleife des Präsidenten der DDR - Der Augenzeuge 16/1950 bitte kontaktierenSie progress.film ... Kundgebung zum internationalen Befreiungstag mit ehemaligen Häftlingen des Konzentrationslagers in Oranienburg. Der dänische Widerstandskämpfer Heimann ?, die polnische Partisanin Walinskaja, der tschechoslowakische Gesundheitsminister Pater Plojhav. Kranzniederlegung am Ehrenmal der Gefallenen der Sowjetarmee. - Der Augenzeuge 38/1951 bitte kontaktierenSie progress.film ... Internationaler Gedanktag für die Opfer des Faschismus: die Todeszelle im ehe- maligen KZ-Lager Buchenwald, die Zelle Ernst Thälmanns, das Krematorium. Eine chinesische Jugenddelegation legt einen Kranz nieder. Die Grabstelle der Ermordeten; Gedenkfeier im ehemaligen KZ-Lager Ravensbrück; Kranzniederlegung am Ehrenmal in Treptow. Delegationen ausländischer Widerstandskämpfer. Gedenkfeier in Wedding in Westberlin, Gedenkfeier auf dem August-Bebel-Platz. - Welt im Film 343/1951 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ...Armenbescherung, veranstaltet von der Gesellschaft für deutsch-jüdische Zusammenarbeit - Der Augenzeuge 37/1952 bitte kontaktierenSie progress.film ... Weihe der wiederaufgebauten Synagoge in Erfurt durch Rabbiner Wiesenburg. - Enthüllung einer Gedenktafel zum 9. Jahrestag der Ermordung Ernst Thälmanns im KZ Buchenwald 18. 8. 1953 (AvT) (ehemals Woche E 1134) ...Das Torhaus des KZ Buchenwald. Über dem Eingang eine Losung: Erfüllt Ernst Thälmanns Vermächtnis - Festigt die Freundschaft zur Sowjetunion. Durch das Tor kommt ein Demonstrationszug mit Fahnen und Kränzen. Er biegt nach rechts Richtung Krematorium. Am Weg ein großes Thälmann-Porträt. An der Spitze des Zuges Irma Gabel-Thälmann, Paul Wandel u. a. Der Zug biegt zum Krematorium ein. Viele große Kränze werden mitgetragen. Eine Gruppe FDJlerinnen. Eine Gruppe Sowjetsoldaten. Kamera schwenkt am Schornstein des Krematorium herunter auf zwei brennende Feuerschalen und viele Menschen. Eine helle Flamme in einer Feuerschale vor dem Schornstein des Krematoriums. Die Demonstranten im Hof des Krematoriums. Weitere Kränze werden von Jungen Pionieren hereingetragen. Zwei Rotarmisten mit einem Kranz. Gruppe Junger Pioniere. Sitzende und stehende Demonstranten, dabei auch sowjetische Offiziere. Paul Wandel am Rednerpult. Zuhörende Menschen. Im Hinter- grund die noch verdeckte Gedenktafel. Paul Wandel entfernt das Tuch von der Tafel, verharrt vor der Tafel und liest dann laut den Text: Ewiger Ruhm dem großen Sohn des deutschen Volkes, dem Führer der deutschen Arbeiterklasse Ernst Thälmann, der am 18. August 1944 an dieser Stelle vom Faschismus ermordet wurde. Ein sowjetischer Offizier am Rednerpult. Dabei ein Volkspolizist als Dolmetscher. An der Hausmauer unter der Tafel werden Kränze niedergelegt. Ausländische Jugendliche legen einen Kranz der ausländischen Delegationen des Zentralhauses der Jungen Pioniere Oberhof nieder. Die Jugendlichen vor der Tafel - Fox Tönende Wochenschau 43/36/1953 ...Aufnahmelager der jüdischen Gemeinde für jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa in Berlin-West, Interview mit einer geflohenen Frau - Der Augenzeuge 17/1954 bitte kontaktierenSie progress.film ... Internationaler Befreiungstag in Buchenwald: auf dem ehemaligen Gelände des KZs Buchenwald treffen sich anläßlich des intern. Befreiungstages ehemalige Inhaftierte. Aufnahmen vom Lagerzaun. Internationale Flaggen. Colonel Manhes übergibt die Flagge des ehemaligen französischen Widerstandes an seinen Landsmann Fix. Ehrenhain. Delegationen legen Kränze nieder. Der ehemalige Appellplatz. Erde aus kleinen Kübeln wird von je einem Internationalen Delegationsmitglied auf den Platz des Ehrenhains geschüttet. - Israel, Staat der Hoffnung (BRD/1955) Fischer mit Netzen und einfachem Holzboot am Strand des See Genezareth. Tel Aviv: Gegründet "vor 45 Jahren". Einwanderung nach Palästina: Zionisten, Flüchtlinge.
Verkehrskontrolle; Straßenszene von Tel Aviv, Einwanderer aus unterschiedlichen ändern. Zeitungsstand, Bücher. Jugendliche zeichnen etwas. Gymnastik. Weitzmann Institute of Science: Forschung, die dem Aufbau des Landes zugute kommt. Kranken- haus, Sozialversicherung. Wiedergutmachungsabkommen mit der BRD -> Kauf von Röntgengeräten. Hotels am Strand von Tel Aviv. Menschen am Strand. Freizeitge- staltung am Shabbat; kein Busverkehr. Haifa: Gebäude; Fischereiflotte, Schiffsbau. Einwanderer aus Nordafrika kommen an Land. Einwanderung vor 1948. Aufnahme- lager für Neueinwanderer. Industrie in Israel. Anstieg der Exporte von 1950-54. Bau von Wohnsiedlungen und Wasserleitungen/Bewässerungsanlagen. Entwässerung von Sümpfen. Gemüse- und Obstanbau. Pflanzen von Bäumen. Pflügen eines Feldes mit einem Esel. Kibbutzim. Kuhherde wird von einem Cowboy getrieben. Traktor auf dem Feld. Landarbeiter. Kindererziehung in den Kibbutzim. Ernte von Zitrusfrüchten. Transport mit dem Schiff. Eine Siedlung nahe Tel Aviv, gegründet von Berliner Juden. Naharia, 1935 von deutschen Juden gegründet. Hebräischun- terricht für Einwanderer. (562 m) (R.1) ...Schulen für in Israel geborene Kinder. Straßenbau. Straße zum Toten Meer. Bohrungen nach Öl und Wasser. Andere Rohstoffe. Totes Meer: Abbau von Mineralien. Chemische Industrie bei Haifa. Arabische Nomaden bei Beerscheba. Verschleierte Frauen beim Arzt. Beduinen reiten auf Eseln und Kamelen. Vertei- digung der Landesgrenzen. Grenzzwischenfälle. Minensuche. Wehrdienst in Israel. Frauen beim Militär exerzieren mit Rock. Jerusalem: Straßenaufnahmen. Hinter- grundinformation über den Waffenstillstand mit den arabischen Nachbarn Israels. UN-Abgesandte. Mandelbaum-Tor: Übergang nach Jordanien (Bethlehem etc.) Deutsche Ordensschwestern betreuen christliche Waisenkinder. Hebräisch- unterricht für die Ordensschwestern. Benediktinerkloster, Patres gehen spazieren. Stadtmauer von Jerusalem. Vergleich mit Berliner Mauer. Freiheitsglocke. Anerkennung Israels durch 62 andere Staaten. Unabhängigkeitstag. Ansprache Ben Gurions im Stadion. Flughafen Tel Aviv; Flugzeug von El Al. Nazareth in Galiläa, heute eine arabische Stadt. Soldatenfriedhof aus dem 1. Weltkrieg. Berg Tabor: Wallfahrtsort christlicher Pilger. Kanaan: Frauen tragen Wasser- behälter. Franziskanerkloster auf dem Berg, auf dem Jesus die Bergpredigt hielt. Grab von Theodor Herzl. Spielende Kinder. (505 m) - Der Augenzeuge 16/1955 bitte kontaktierenSie progress.film ... Weimar/Buchenwald: Gedenkveranstaltung zum 10. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen KZ auf dem Ettersberg. Kranzniederlegung am Mahnmal. Oberst Dombrowski (Polen), ein ehemaliger Häftling spricht (ohne Org.Ton). Herrmann Matern hält die Gedenkrede (ohne Org.Ton) - Fox Tönende Wochenschau 62/38/1955 ... Israel: Frau Frieda Kroetzik wird im Kreise der Familie Zamari das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland durch einen Postboten zugestellt (wegen Rettung jüdischer Menschen vor der Deportation im 3. Reich) - Nacht und Nebel (Frankreich/1955/56) (DDR-Fassung) ...Landschaftsaufnahmen mit Stacheldrahtzäunen, ehemalige KZs (F). ...Wachtürme, Lagertore und Baracken von KZs. 4. Juden werden mit erhobenen Händen aus dem Warschauer Ghetto geführt und deportiert (Fotos). Juden werden in Viehwaggons verladen. Die Waggontüren werden geschlossen. Abfahrt des Zuges. 5. Die überwucherten Schienen, auf denen früher die Züge mit den Häftlingen rollten. (F) 6. Fotos aus den KZs. Nackte Männer vor der Gaskammer. Die verschiedenen Kennzeichen der Häftlinge. 7. Die Lager im heutigen Zustand. Pritschen in einer Schlafbaracke. (R.1) II: 8. Häftlinge auf ihren Pritschen. Zum Morgenappell spielt die Lagerkapelle. Zwangsarbeit im Schnee und im Hochsommer. Die Todestreppe am Eingang zum Steinbruch Mauthausen. Die unterirdischen Rüstungswerke, arbeitende Häftlinge (Fotos). Essende Häftlinge. 9. Die Latrinen (F) 10. Lagertore mit den Inschriften "Arbeit macht frei", "Jedem das Seine".
Überraschung im Lager: ein Sinfonieorchester, ein Zoo, Treibhäuser (Fotos). Aus einem Invalidenblock kommen Krüppel. 11. Tote Häftlinge. Häftlinge im Stacheldraht. Angetretene nackte Häftlinge. Ein Häftling wird ausgepeitscht. Der Galgen, der Erschießungsplatz. Ein Schloß bei Hartheim. (Fotos) 12. Angefertigte Werke von Häftlingen. Eine geschnitzte Eidechse, Kästchen, beschriebene Zettel. Zusammengebrochene Häftlinge. 13. Ein Krankenrevier (F). Kranke Häftlinge im Krankensaal. Foto eines SS-Arztes. Eine Kranken-schwester der SS. Ein Operationssaal. Ein Hinrichtungsblock. Medikamente. Menschen an denen medizinische Versuche vorgenommen wurden. Papiere verschiedener Häftlinge, das Buch mit Namen. 14. Das Zimmer eines Kapos. Die Villa eines Kommandanten. Fotos vom Familienleben eines Kommandanten. 15. Das Bordell eines KZs. Ein Gefängnis im KZ, die Luftschächte. (F) III. 16. Himmler inspiziert verschiedene Lager (Fotos). Entwurf, Modell und Bau eines Krematoriums. 17. Fahrender Güterzug. In einem geöffneten Waggon liegen Leichen. Ankunft der Häftlinge im KZ. Fotos die wenige Augenblicke vor einer Vergasung gemacht wurden. Nackte Frauen und Männer. Büchsen mit Zyklon B-Gas. 18. Der Vergasungsblock. Der Duschraum. Die von Fingernägeln sterbender Häftlinge zerkratzte Wand. (F) 19. Leichenberge. Verkohlte Leichen. Scheiterhaufen mit toten Häftlingen, bevor er in Brand gesteckt wurde. 20. Die Verbrennungsöfen (F) 21. Berge von Brillen, Kämmen, Rasierpinseln, Schüsseln, Schuhen und Frauenhaar. Textilien aus Frauenhaar. Knochen. Ein Bottich mit Köpfen toter Häftlinge. Seife, gewonnen aus Körpern toter Häftlinge. Abgezogene tätowierte Menschenhaut. 22. Luftaufnahmen verschiedener Lager. Leichenberge. Eine amerikanische Raupe schiebt die Leichenberge in eine riesige Grube. Frauen und Männer der SS-Bewachung werden abgeführt. Sie müßen die Toten begraben. Häftlinge nach ihrer Befreiung am Stacheldraht des Lagers. 23. Kapos und SS-Bewachung vor Gericht. Leichenberge. 24. Ehemalige KZ-Lager in ihrem heutigen Zustand, zerfallene Baracken. (Fotos, Filmreste und legale und illegale Dokumente deutscher und ausländischer Archive geben einen erschütternden Bericht über Mauthausen, Auschwitz, Maidanek oder Neuengamme) - Nacht und Nebel (Frankreich/1955/556) (BRD-Fassung) Der Film zeigt die Situation, wie die Besatzungsmächte bei Kriegsende die KZ vorfanden. Aufnahmen von den nicht mehr benutzten KZ, mit ihren Umzäunungen, ihren Baracken, ihren Einrichtungen, den Bade- und Brausestuben, in denen die Häftlinge vergast wurden, dem Krematorium, den Schlafsälen mit den Holzpritschen, auf denen sich die Häftlinge drängten. Eingeblendet sind Fotos und einzelne Filmszenen aus der Zeit, da die KZ im Betrieb waren. Man erlebt Abtransport von Juden in verschiedenen Ländern, Zusammenstellungen von Arbeitstransporten, Abtransport in Viehwagen durch SS. Appell der Häftlinge im Lager, einmal bekleidet dann nackt. Foto eines Capo, Arbeit bei Hitze und Kälte. Die Leichen der verhungerten oder erschlagenen Häftlinge, die sich zu Bergen türmen, die zum Skelett abgemagerten Häftlinge, die sich kaum noch aufrecht erhalten können, auf ihren Pritschen, am Zaun, beim Essen (Film). Die Abortanlage in einem KZ. Der Invalidenblock, das Revier, ein OP-Saal, ein Galgen, ein Häftling wird geschlagen. Eingangs wird der Bau von KZ gezeigt, die Aussiedlung von Juden mit dem Zionsstern. die fassungslosen Gesichter der Juden, wenn die Züge abrollen. 1932: Himmler und Stab, Anordnung, Krematorien einzurichten. Transporte von Toten, nackte Männer und Frauen kurz vor der Hinrichtung. Verbrennungen, die Öfen in einem Krematorium, der Berg von Toten, deren Schädel gesondert gelegt sind, ein Berg von Frauenhaaren, aus denen Decken gemacht werden. Verwertung der Knochen zu Dünger. 1945 die Befreier finden Leichen und Massengräber, das KZ-Personal wird abgeführt. Die Überlebenden schauen ungläubig zu. Die KZ Ruinen heute, die verfallenen Bauten. Der Film mahnt, diese Schrecken nicht zu vergessen und nicht zu glauben, dass solche fürchterlichen Dinge nur einmal und nur bei einem Volk geschehen könnten. (855 m) - Nationale Gedenkstätte Buchenwald (DDR/1956)
Filmbericht über die Nationale Gedenkstätte Buchenwald, die auf dem Gelände des ehemaligen faschistischen Konzentrationslagers geschaffen wurde. - Der Augenzeuge 2/1956 bitte kontaktierenSie progress.film ... Klement Jefremowitsch Woroschilow besucht das ehemalige KZ in Buchenwald Kranzniederlegung an der Gedenkstätte für Ernst Thälmann - Der Augenzeuge 6/1956 bitte kontaktierenSie progress.film ... Rückblick: Einblendung von Fotos aus dem ehemaligen KZ Sachsenhausen, Zahlenspiegel über die Opfer des Naziterros. Filmmaterial aus dem Film: Todeslager Sachsenhausen wird eingeblendet; Originalfilmaufnahmen vom Verhör des Henkers Paul Sakowski (O.T). Bundespräsident Heuß am Rednerpult, er spricht zu entlassenen Kriegsgefangenen, u.a. sollen darunter auch drei verurteilte Kriegsverbrecher aus dem Sachsenhausenprozeß sein. (Baumkötter, Höhn und Sorge) - Der Augenzeuge 11/1956 bitte kontaktierenSie progress.film ...Berlin: Aufnahmen aus einem völlig überfüllten Saal, hier findet eine Kundgebung gegen die Adenauerpolitk statt. Rabbiner Riesenburger (im Bild) spricht zu den Verbrechen gegen das jüdische Volk (Org.Ton) - Der Augenzeuge 38/1956 bitte kontaktierenSie progress.film ... Esterwegen im Emsland-Moor. Wo vor 20 Jahren die ersten Konzentrationslager geschaffen wurden, ist auch heute noch Stacheldraht. Nationalpreisträger Wolfgang Langhoff spricht Worte des Gedenkens. - Fox Tönenden Wochenschau 88/39/1956 ...Burns bei der Ankunft mit einem Flugzeug im israelischen Hauptquartier, im Gespräch mit Moshe Dayan, dem Chef des israelischen Generalstabs u.a. über die Zurücknahme der israelischen Truppen aus dem eroberten Gebiet - Mahnung für alle Zeiten (DDR/1958) Während in der DDR die ehemaligen Konzentrationslager zu Gedenkstätten wurden, sind in Westdeutschland Lager wie Dachau, Neuengamme usw. verwahrlost, dienen teilweise kommerziellen Zwecken, werden in einigen Fällen sogar vom Strafvollzug benutzt. Der Film nennt diese Tatsachen symptomatisch für die Verhältnisse in West- deutschland. ...Konzentrationslager Buchenwald: Kränze vor Gedenktafel für Ernst Thälmann. Stacheldrahtzäune.Buchenwald-Denkmal. Buchenwald heute als Mahn- und Gedenk- Stätte. Mehrere Pfeiler, jeweils ein Land symbolisierend (z.B. Deutschland, Frankreich u.a.), mit Opferschalen und Kränzen. Einige Pfeiler mit in Stein gehauenen Bildern. ...Gedenktafel für die Opfer der Kristallnacht am 9.November 1938 in Kiel. ...Kohlezeichnung: Mensch im Stacheldrahtzaun. Straßenschilder: Dachau-Ost, Alte Römerstraße zur KZ-Gedenkstätte (in 3 Sprachen). Dachau 1959: enge Straße mit Gaststätte und Lebensmittelgeschäft in der ehemaligen Totenhalle. Mehrere Baracken und ein Wachturm in der Mitte. Die Baracken werden heute als Wohnraum Genutzt. Kohlezeichnung: Mann mit erhobener Faust ...Wegweiser Neuengamme: heute äußerlich verwahrlost, aber bereits Außenstelle der Hamburger Gefängnisbehörde und in naher Zukunft wieder Zuchthaus. Stachel- drahtzaun vor hohem Gras.Reste vom ehemaligen Schlagbaum. ... Blatt mit Überschrift: KZ-Ärztin weiter in ihrer Praxis.Ärzte, die Massenmörder waren, dürfen sich Doktor nennen, praktizieren und ein schönes Haus bewohnen (R.1) ...Steinfigur - danach alles aktuelle Filmaufnahmen: Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus in Bergen-Belsen: Hoher Turm auf Plateau, am Rand entlang Kränze. Menschenmenge steht davor bzw. drumherum. Blumen werden vor einem Gedenk- stein für 800 Tote gelegt. Mehrere solcher Gedenksteine werden gezeigt ...2 Kohlezeichnungen: Männerkopf und ein Mensch hinterm Stacheldraht. Totale: Blick auf die Gedenkstätte mit Buchenwalddenkmal. Prof. Fritz Cremer beim Modellieren einer Plastik ...Buchenwald-Denkmal; Menschenmenge rund ums Denkmal versammelt. Feierliche Einweihung der Gedenkstätte Buchenwald; es spricht Otto Grotewohl. Fahnen mit verschiedenen Zeichen. Mehrere Menschen, vorn ein Mann in Sträflingskleidung. Politiker stehen auf einem Balkon. Gedenkpfeiler für Rominia mit Opferschale und
Kränzen. Denkmal und Turm mit Glocke. Luftaufnahme von der Veranstaltung. Mehrere ausländische Redner. Balkon, von dem der Schauspieler Wolfgang Langhoff das Gelöbnis spricht. Glockenturm, von dem viele Tauben aufsteigen. - Poet-Painter-President (BRD/1958) ... Bundespräsident Heuss im ehemaligen Konzentrationslager Belsen bei Kranzniederlegung. - Ein Tagebuch für Anne Frank (1958) Der Film zeigt Bilder von der Deportation holländischer Juden, vom Judensammellager Westerbork und entlarvt die Zusammenarbeit der deutschen Industrie mit der SS und ihren Todeslagern. - Wieder aufgerollt: Der Nürnberger Prozess (BRD/1958) ... Judenverfolgung im 3. Reich, KZ-Aufnahmen nach Einmarsch der Alliierten (s. Nacht und Nebel). Eisenhower in Bergen-Belsen (R.4) - Ufa-Wochenschau 111/1958 ...Juden, Katholiken und Protestanten haben ein gemeinsames Gotteshaus. Altar- raum dreht sich je nach Gottesdienst. - Gerettete Heimat (BRD/1960) ... Am Ehrenmal des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau wird ein Kranz der Sudetendeutschen Landsmannschaft niedergelegt. - Mein Kampf (Schweden/BRD/1960) …u.a. wird über die Zeit der Macht der Nationalsozialisten in Deutschland berichtet und welche Folgen die Politik mit dem Boykott der jüdischen Geschäfte, der Rassenpolitik und der Einschränkung der Meinungsfreiheit (bspw. Bücherverbren nung) für die Menschen hatte. Aber auch wie der Alltag der Menschen verändert wurde durch Organisation, wie der HJ (Hitlerjugend), dem BDM (Bund deutscher Mädel). Auch die Ausmaße der nationalsozialistischen Rassenpolitik mit den Ghettobildundungen, den Konzetrationslagern und Gaskammern, den Deporta- tionen, die Kennzeichnung der Juden mit dem Judenstern werden detailiert erläutert. Aber natürlich ist auch die Kriegsniederlage im Zweiten Weltkrieg und die Verarbeitung der Verbrechen des Dritten Reiches in den Nürnberger Prozessen ist Thema dieser Dokumentation. - Mord in Lwow (DDR/1960) Dokumentarischer Nachweis der Verbrechen Oberländers, der zur Zeit der Entste- hung des Films im Adenauer-Staat Minister war. Oberländer ist nachweislich für den Mord an zahlreichen Juden und Geistesschaffenden im damaligen Lemberg (heute Lwow) verantwortlich. Augenzeugen der Massaker treten persönlich auf. - Der 9. November 1938 (Reichskristallnacht) - Ein deutsches Menetekel- (BRD/1960) In wesentlichen Zügen werden die Verhältnisse geschildert, die in Deutschland zur Verfolgung und zum Tod nahezu aller Bürger jüdischen Glaubens geführt haben. Zentraler Punkt der Dokumentation ist der 9.November 1938, der als "Reichskristall- nacht" in die Geschichte einging. Da von den Vorgängen der Nacht vom 9. Zum 10. November 1938, in der auf Geheiß von Goebbels die SA in ganz Deutschland die Synagogen niederbrannte, die jüdischen Geschäfte demoliert und ausgeplündert wurden, keine Filmaufnahmen vorhanden sind, musste sich der Film bei der Darstellung dieser Vorgänge auf Fotos und Dokumente beschränken. Zur Verstärkung des Eindrucks wurde dieser Teil mit liturgischen jüdischen Gesängen unterlegt. - Der Augenzeuge B 2/1960 bitte kontaktierenSie progress.film ...Synagogenschändung in Köln - Der Augenzeuge B 14/1960 bitte kontaktierenSie progress.film ...Milde Urteile für die Synagogenschänder Strunk und Schönen in Köln - Deutschlandspiegel 65/1960 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Am Denkmal des ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen wird durch Bundeskanzler Adenauer ein Kranz niedergelegt. Anwesend ist u.a. Nahum Goldmann, der Präsident des jüdischen Weltbundes.
- Fox Tönende Wochenschau 43/43/1960 ... Empörung über die Kölner Synagogenschändung - Ufa-Wochenschau 183/1960 ...Bonn: Carlo Schmid spricht zur Judenhetze (O-Ton). Unter seine Sprache sind Bilder von Hakenkreuzen und die Demonstration der Berliner mit Fackeln zum Mahnmal der "Opfer des Nazi-Regimes" gelegt. - Aktion J (1961) Die Fernsehdokumentation verfolgt den Lebensweg des Antisemiten und Staatsse- kretärs im Bundeskanzleramt Dr. Hans Globke. - Weimar liegt bei Buchenwald (DDR/1961) Der Film hat die Aufgabe, den Besuchern des ehemaligen Konzentrationslagers auf dem Ettersberg einen kurzen zusammenhängenden Überblick der Geschichte dieses Lagers zu vermitteln. - Eichmann und das dritte Reich (Schweiz/1961) Einleitung: Es wird hebräische Schrift (Thoraschrein?) eingeblendet und Zitate Hitlers gesprochen, die den Kampf über die Gebote der Bibel stellen. ...Jerusalem 1961: Prozess gegen Eichmann. Gefängnis, Tor 3. Eichmann vor Gericht (Bilder ohne Ton, Aussage Eichmanns vom Band). ...Archivbilder SA in Berlin am Brandenburger Tor. Reichsführerschule Bernau: Dort wurde Eichmann ausgebildet. Eichmanns Personalbogen bei der SS und Lebenslauf. Eichmann wird "Referent für Judenfragen". Goebbels-Rede (Ausschnitt). Bilder des "Judenboykotts" vom April 33. ...Quellen über Juden in Deutschland (Mittelalter bis Neuzeit); NS-Propaganda ("Der Giftpilz"). ... Der Generalstaatsanwalt des Landes Hessen Dr. Fritz Bauer spricht zum Eichmann-Prozess - Deutschland sei das Land Goethes und Beethovens, aber auch das Land Hitlers und Eichmanns. Es sei noch nicht zu spät für Prozesse gegen NS- Täter. Pflicht zum Widerstand. Wahre Stärke sei nicht gleich Macht und Brutalität, sondern Toleranz. ...Bilder aus NS-Propagandafilmen. Die Jugend soll von Anfang an für den National- sozialismus gewonnen werden. Bücherverbrennung. Albert Einstein spricht aus dem Exil (englischer Originalton). Im Unterricht wird die NS-Ideologie vermittelt. Johannes von Leers. Reichsparteitag 15.09.1935, Nürnberg: Judengesetze. Konferenz mit Eichmann im RSHA 1942: Mischlinge 1. Grades haben die Wahl zwischen Deporta- tion und Sterilisation. ...ZT: Opfer der Vergangenheit (Filmtitel) + Vorspann des Films; NS-Propagandafilm über Eugenik. "Das jüdische Volk stellt einen besonders hohen Prozentsatz an Geisteskranken. Auch für Sie müssen gesunde deutsche Volksgenossen arbeiten." (O-Ton) ...Eichmann vor Gericht: "Judenfrage" sei Ablenkung von anderen Problemen gewesen. ...Hitler beim "Anschluss" Österreichs im offenen Wagen; hält eine Rede. Zentrale für jüdische Auswanderung unter Eichmann in Wien. "Reichskristallnacht" (Aufnahmen brennender Synagogen.). 30.1.39: Hitler spricht öffentlich über die "Ausrottung der Juden". Beispiel: Schicksal einer jüdischen Familie (David Isaak Cohen) ...Bilder vom Einmarsch in die Tschechoslowakei. Goebbels spricht. Eichmann richtet auch in Prag eine "Zentralstelle für jüdische Auswanderung" ein. ...Beginn des 2. Weltkriegs. Hitler spricht: "Die Erde ist ein Wanderpokal". Bilder des Krieges. Einmarsch in Polen; Franck wird Generalgouverneur. Schilder "nur für Deutsche" werden gezeigt. ...Himmler wird "Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums". Er plant Umsiedlungen. Eichmann wird für die "Aussiedlung der nichtdeutschen Minoritäten" mit verantwortlich. Juden werden zur Zwangsarbeit verpflichtet. ...Überfall auf die Sowjetunion. Befehl zur Hinrichtung der Parteifunktionäre, der auf die russischen Juden ausgedehnt wird. ...Wannsee-Konferenz. Auswanderung von Juden ist nun verboten. Zusammenarbeit der Instanzen. Details zu einzelnen Ländern. ...Übergriffe gegen Juden auf der Straße (Bildmaterial). Erschießungen durch Einsatz-
kommandos (Bilder). ...Himmler im Vernichtungslager Minsk. ...Heydrich wird von tschechischen Patrioten getötet und von den Nazis in der "Aktion Reinhard" gerächt. Massaker in Lidice. ...Bilder aus Theresienstadt. "Tagesbefehle" zeigen Eichmanns Entscheidungen. ...Beispiele, wie Eichmann sogar diejenigen Juden, die auswandern könnten, depor- tieren lässt. ...Ghettos in Osteuropa (Bilder). Aufnahmen betender Juden. Propagandaufnahmen der Nazis vom Ghetto. Judenrat. Gegenüberstellung "armer" und "reicher" Juden. ...Berliner Illustrierte: "Juden unter sich". ...Hunger und Armut im Ghetto. Leichen. Deportationen aus dem Ghetto. ...Eichmann ordnet öffentliche Hinrichtungen von Juden im Ghetto an. ...Aufstände im Ghetto, z.B. in Warschau. ...Judentransporte in den Osten. Eichmann sorgt für den Fahrplan der Züge. Depor- tationslisten, Aufnahmen der Wartenden. Zugehöriger Schriftverkehr. Zug fährt ab. ...15.07.1942: Ein Zug aus Frankreich nach Auschwitz fällt aus, was Eichmann "blamabel" findet. Kindertransport von Drancy nach Osten. Aufnahmen wartender Juden. Aufnahmen eines KZs (Auschwitz?). Pässe von Juden. Kinder zeigen ihre Häftlingsnummern. ...Zwangsarbeit in der Buna-Fabrik; Gewinn der SS an dieser Zwangsarbeit. ...Fotos von Häftlingen. Todesursachen laut Eichmann (z.B. "Herzmuskelschwäche"). Ablauf der Vergasung. Zahngold. Verwertung der anderen Besitztümer, z.B. zugun- sten des Winterhilfswerks. ...Eichmann vor Gericht; seine Aussage wird vom Band eingespielt. Er spricht über einen "Gaswagen". ...Details zum Umgang mit den serbischen Juden. ...Ungarn: Horthy versucht, die Deportation der ungarischen Juden zu verhindern. Schweden und die Schweiz ermöglichen die Auswanderung, aber Eichmann hat den Plan, dagegen vorzugehen. Eichmann setzt die Deportationen noch fort, nachdem Himmler deren Ende befohlen hatte. ..Entnazifizierung 1945: Schriften werden zertrampelt und verbrannt; eine Hitlerbüste verliert ihren Kopf. ...NS-Täter versuchen zu fliehen. Eichmann wird bekannt, da gefasste Täter gegen ihn aussagen. Prozesse gegen NS-Täter. Dokumente über Eichmann werden gesammelt. Siedlung Überlebender in Israel. ...Itzhak Zuckermann spricht über den Kampf im Warschauer Ghetto (hebräischer Originalton, danach deutsche Zusammenfassung). ...Frau Zuckermann spricht über die Rolle der jüdischen Frau während des 2. WK. ...Modell von Treblinka von einem Überlebenden, der über seine Erfahrungen dort spricht und dies am Modell zeigt. ...Eichmann vor Gericht - für ihn ist Treblinka nur ein Lager von vielen. Aufnahmen von Leichen. ...Eichmann vor Gericht. Zu seinen Ausführungen werden Bilder eines Lagers (Auschwitz?) sowie andere Archivbilder gezeigt. Eichmann rechtfertigt sich: Er sei weder ein Verräter, sondern ein Mörder gewesen. Er ist sich unsicher, ob er sich der "Beihilfe zur Tötung" bezichtigen soll. ...Appell zur Verteidigung der Menschenrechte und zur fortgesetzten Erinnerung. - Der 85. Geburtstag des Bundeskanzlers (BRD/1961) ...Am Nachmittag empfängt Dr. Adenauer die Mitglieder des Zentralrates der Juden in Deutschland, Prof. Dr. Levin, Generalsekretär Dr.van Dam, Herrn Dreyfuss und den Landesrabbiner Dr. Blech. Sie überreichen ihm ein Bild des alttestamentarischen Propheten Jesajas. - Erinnert Euch (DDR/1961) Eine Filmdokumentation über die faschistischen Grausamkeiten in deutschen und europäischen Konzentrationslagern. Der Film wurde aus Archivmaterialien der US-Streitkräfte zusammengestellt, welche Aufnahmen unmittelbar nach der Befreiung der einzelnen KZ-Lager machten. Anhand dieser Bilddokumente untersucht der Film die heutige Politik der USA im Allgemeinen und die von Kennedy im Besonderen. Dabei kommt er zu Feststellungen, da Parallelen nicht zu übersehen seien und die USA in ihrer Rolle als Weltgendarm entlarvt werde.
Der Film zeigt Aufnahmen aus den Lagern Breendonck (Belgien), Leipzig, Penig, Meppen, Ohrdruff, Münster, Nordhausen und Belsen. - Simon (BRD/1961) Menschen verlassen Gebäude; Fokus auf einen Mann mit Hut und Mantel, der ebenfalls das Gebäude verlässt. Simon geht über einen Platz; er setzt sich vor seinen Trödelladen. Jugendliche sehen sich in dem Laden Schallplatten an. Simon steht auf, schiebt die Jugendlichen grob zur Seite, zerbricht die Platte und schneidet sich dabei an der Hand. Man sieht an der rechten Hand, neben dem Daumen, eine eintätowierte Nummer. ...Simon geht in ein Antiquariat und kauft ein Buch. Zu Hause sieht man ihn betend mit Tallit (Gebetsschal) und diesem Gebetbuch. Simon legt den Tallit wieder ab und faltet ihn zusammen. Man sieht nun, dass er eine Kippa trägt. ...Simon spielt Geige. An der Wand hinter ihm hängen Fotografien von Personen unterschiedlichen Alters. Simon ist allein in der Wohnung. Auf einem Sims sieht man eine Menorah. Simon sitzt neben dem Herd und kocht, spielt Geige. ...Simon sitzt in Ruinen, hat seine Geige dabei. ...Simon geht abends über die dunklen Straße. Pferde laufen an ihm vorbei. Er sieht ihnen hinterher. Pferde in ihren Ställen. Simon geht draußen an einem Pferdemarkt vorbei. Auf dem Fell der Pferde sieht man einrasierte Nummern. Käufer nehmen die Pferde mit. ...Wieder zu Hause: Simon durchsucht seine Jackentaschen, sammelt Geld aus zahlreichen Verstecken in der Wohnung. Er zählt das Geld, lächelt dabei. Simon läuft zum Pferdemarkt. Er kauft einen traurig wirkenden, schmutzigen Schimmel, führt ihn durch die Straßen, über Plätze. Er mietet einen Stall, putzt das Pferd ungeschickt mit einer Bürste, nimmt es in einer Reithalle an die Longe. Man kann erkennen, dass er keine Erfahrung im Umgang mit Pferden hat. Er spielt dem Pferd dann auf der Geige vor. ...Simon transportiert einen Stuhl auf einem Fahrrad. Er kauft und verkauft zahlreiche Gegenstände. In seiner Wohnung stellt er auf einer Tafel eine Bilanz auf. Rechts steht ein Pferd, "Cheval", für 1000,-. Links drei Gegenstände. ...Simon bei einer Auktion, er sieht ein Gemälde. ...Simon trägt einen Sack Getreide und schüttet es Pferden, die auf der Weide stehen, in den Futtertrog. Gleichzeitig bietet er ihnen Heu an. Er streichelt die Pferde und freut sich, sie auf der Weide zu sehen. Simon geht zu weiteren Pferden auf die Weide. Er führt eines von ihnen die Weide entlang; die anderen Pferde folgen nach. - Fox Tönende Wochenschau 60/44/1961 ...Gedenkfeier am 16. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen- Belsen: Kranzniederlegung am Mahnmal des Lagers durch Vertreter des Landes Niedersachsen und des Zentralrats der Juden ...Prozeß gegen Adolf Eichmann in Jerusalem: Eichmann hinter kugelsicherem Glas im Gerichtssaal. Eröffnung der Verhandlung durch den Vorsitzenden und Verlesen der Anklagepunkte (kein 0-TON). Einwände des Verteidigers Dr.Robert Servatius (0-TON): "Sie betreffen die Besorgnis der Befangenheit der Richter und die Un- zuständigkeit... ." "Die Zeugen sollen bekunden können, daß die Entführung des Angeklagten Adolf Eichmann aus Argentinien im amtlichen Auftrag der Regierung Des Staates Israel erfolgte. Die Aussagen sind erheblich im Hinblick auf den Einwand der Unzuständigkeit des Gerichts. Diesen Einwand erhebe ich hiermit." Erwiderung des Generalstaatsanwalts Housner gegen die Einwände der Verteidigung - Fox Tönende Wochenschau 70/44/1961 ...Prozess gegen Adolf Eichmann. Robert Servatius bei der Aussage als Zeuge in eigener Sache vor dem Bezirksgericht in Jerusalem: (0-TON): "Ich schwöre nicht auf die Bibel, ich schwöre bei Gott". Auf Befragen durch seinen Verteidiger Servatius antwortet Eichmann (0-TON): "...Auswanderung ist der jüdische Sektor zu verstehen gewesen undunter Räumung das Aufgabengebiet des damaligen Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, zu dem Himmler bestellt wurde, nämlich die Räumung der damals zum Reich neu gekommenen deutschen Ostgebiete von, wie es Himmler und Hitler befohlen hat, von der Räumung der Juden und Polen aus diesen Gebieten und zwar lediglich in fahrplanmäßiger Hinsicht, das heißt transporttechnischer Hinsicht." - Jahre der Entscheidung (USA/1962)
Dokumentarfilm aus dem Jahr 1962 zur Geschichte des Staates Israel ...Rückkehr der Überreste von Theodor Herzl (1860-1904) nach Israel / Frankreich 1895: Theodor Herzl schreibt als Reaktion auf die Dreyfus-Affaire (öffentliche Degra- dierung eines zu Unrecht angeklagten jüdischen Offiziers) das Buch "Der Judenstaat" (K-Ton zitiert: "Das jüdische Problem kann nur durch die Gründung eines jüdischen Staates gelöst werden") / Basel 1897: Gründung der zionistischen Weltorganisation auf dem 1. Weltzionistenkongreß mit dem Ziel der "Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina" (K-Ton) / 1898: 2. Weltzionistenkongreß: Schaffung einer Bank (Aktie mit Aufschrift: "Jewish Colonial Trust, Jüdische Colonial- bank, Capital: 2.000.000) zur Finanzierung der Besiedlung des "verarmten und verö- deten" Palästina; erste Besiedlungsaktionen / ...1901: 5. Zionisten-Kongreß: Schaffung eines jüdischen Nationalfonds zum Kauf von Boden in Palästina, "Boden, der allen Juden gehören sollte" (K-Ton); 1904: Tod Theodor Herzl / ...1904: 2. Einwanderungswelle: Besiedlung, Organisation von ersten "Wachgarden" (K-Ton); 1909: Grundsteinlegung für Tel-Aviv / ...1917: England spricht sich in der Balfour-Erklärung für eine jüdische National-Heim- stätte in Palästina aus (Text: "His Majesty´s Government views with favour the esta- blishment in Palestine of a national home for the Jewish people") / ...1918: Völkerbund überträgt Mandat über Palästina an England; 3. Einwanderungs- welle ab 1920 / ...ab 1933: Europäische Juden flüchten vor den Nationalsozialisten, Kinderhilfsaktionen, Gründung von Kinderdörfern in Palästina / Organisation der Selbstschutzorganisation Hagana(h), Kämpfe mit Arabern, Schutzmauer- und Wachturm-Siedlungen / ...Englisches Weißbuch, "Das die jüdische Einwanderung beschränkte und den Land- ankauf auf ein Minimum reduzierte" / ...1939: Invasion Polens; Juden kämpfen auf alliierter Seite (Schild: "Headquarter Jewish Brigade") / ...Nach dem Zweiten Weltkrieg: England "hielt die Tore Palästinas noch immer ge- schlossen" (K-Ton) gegen jüdischen Protest (demonstrierende Menschen in KZ-Kleidung, Schild: "Je viens d´Auschwitz, seul survivant sur 1000"); illegale Einwanderung vieler Flüchtlinge nach Palästina (Schiffe mit Aufschrift "Hagana-Ship Jewish State", Haganah-Ship Exodus 1947"); Deportation der illegalen Einwanderer durch Briten nach Zypern / ...1947: UNO beschließt Teilung Palästinas; Ben Gurion ruft 1948 den Staat Israel aus (O-Ton Ben Gurion; hebräisch); heftige Kämpfe in Jerusalem / Einwanderungs- wellen halten an, neue Probleme: Arbeitslosigkeit, Wohnungsmangel, sanitäre Versorgung (K-Ton: "Das Problem war nicht mehr die Einwanderung, das Problem war die Eingliederung") / K-Ton: "Der Traum Theodor Herzls hatte sich verwirklicht. Der Traum von freien Menschen, die ihr eigenes Schicksal bestimmen […] alle, die noch kommen werden […] sie sind eine ausgewählte Generation […] Dieses Jahr, wie alle kommenden sind Jahre der Entscheidung" [Bildinhalt] Der Film ist durchgehend realisiert durch "Abfilmung" von Zeichnungen und Photos: Israel: Sarg Theodor Herzls auf Flugplatz, feierliche Ausstellung des Sarges / Portraits folgender Persönlichkeiten: Theodor Herzl (mehrfach); David Ben-Gurion (im Jahr 1904); Chaijim Weizmann; Arthur Ruppin / Zeitgenössische Presse-Zeichnungen zur Dreyfus-Affaire / Basel 1897: 1. Weltzionistenkongreß (Zeichnung) / Palästina Anfang des 20. Jahrhunderts: Unbestellte Landschaft, Juden an Klagemauer in Jerusalem, arabische Hirten, jüdische Siedler / Wien: Trauerzug bei Begräbnis Herzls / Einwanderungswellen: Gruppenbilder von jüdischen Siedlern, bei Ackerbestellung, bei Straßenbau / 1909: Grundsteinlegung von Tel-Aviv: Arbeiter posieren mit Schubkarre / Aufstellung von Wachen: Juden, teils in arabischer Kleidung, mit Gewehren, teils zu Pferd / 1918: Einmarsch englischer Armee in Jerusalem / 1936: Arturo Toscanini mit Orchester bei Konzert / Gruppen von Kindern, teils bei Landbestellung / Die Hagana(h): Jüdische Siedler bei Schießübungen und Gymnastik / Mit Stacheldraht, Mauer und Wachturm gesicherte Siedlungen / Demonstrierende KZ-Häftlinge / Flüchtlingsschiffe (mehrfach) Neuankömmling wird von britischen Soldaten abgeführt / 1947: UNO-Konferenz, arabische Vertreter (groß) / Jerusalem: zerstörte Gebäude, Straßenbarrikaden, brennende Häuser / Pressekonferenz: Ben Gurion vor Mikrophon (groß) / Kampfbilder: Soldaten an Geschütz, Straßenkampf / Kampfbilder: Soldaten an Geschützen, Straßenkampf / Schiffe mit Neuankömmlingen verschiedener Nationen (mehrfach), Begrüssungsszenen / Zeltstadt, innen und außen, Traktoren, Planierarbeiten, Siedlungen //
Quelle: Erschließungsprotokoll Bundesarchiv Koblenz - Das Leben von Adolf Hitler (Originalfassung) (BRD/1962) und - Das Leben von Adolf Hitler (DDR-Fassung/1962) (mit vorgeschnittenem Kommentar von Karl Gass) ...SA-Sprechchor auf einem Lastwagen: "Deutsche wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!" (R.1) ...Judenverfolgung. Schild: "Achtung Juden", "Deutsche wehrt Euch". Sprechchor der SA. Zeitschrift "Der Stürmer". Judenstern wird von einem SA-Mann an ein Schaufenster gemalt. Nürnberger Gesetze. Geschlossener Laden mit der Aufschrift: "Ist in Dachau". Emigrierte Juden verlassen in USA das Schiff. Albert Einstein. Kristallnacht 1938. Montage: Brennende Synagogen. (R.4) ...Aufnahmen aus den Konzentrationslagern. (R.4) ...Stacheldrahtverhau von Konzentrationslagern. (R.5) ...Warschauer Ghetto. Ausschnitte aus dem Ghetto-Film. In Holland werden Juden in Eisenbahnwaggons verladen (aufgenommen von einem SS-Mann). Ankunft auf dem Bahnhof, Entladung und Aussortierung der Juden (Foto). Gaskammer in einem KZ. Juden im KZ (Fotos). Verbrennungsöfen verschiedener KZ's. Hinrichtungsstätte. Medizinische Versuche an Häftlingen (Fotos).KZ Auschwitz (Flugaufnahme) Fabriken in der Nähe der KZ's. Abfallprodukte ermordeter Menschen: Schuhe, Brillen, Knochen, Frauenhaar. (R.9) ...Zerstörung des Dorfes Lidice, als Vergeltung für die Ermordung Heydrichs. die Ruinen des Dorfes. Danach durchstöbert die SS noch jeden Winkel. (R.9) ...Konzentrationslager werden befreit. Auschwitz, Bergen-Belsen, Ravensbrück, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Maidaneck. Treblinka. Überall ausgemergelte Gestalten und Krüppel. Lehmwand, in die dem Tod geweihte Häftlinge ihre Finger einkrallten. Leichenberge von Häftlingen. Leichen werden abtransportiert. (R.10) - Le Temps du Ghetto (Frankreich/1961) - Requiem für 500.000 (Polen/1963) Ein Film zum 20.Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto und dem Gedächtnis der von den deutschen Faschisten ermordeten polnischen Juden. - Transport aus dem Paradies (Transport z raje) (Spielfilm/CSSR/1963) Film über das Ghetto Theresienstadt und seinen Judenältesten „Marmulstaub“, basiert auf Arnost Lustigs autobiographischem Buch „Nacht und Hoffnung“. - Fox Tönende Wochenschau 63/46/1963 ...Gedenkfeier für die Opfer des Warschauer Ghettos. Rückblick: zerstörte Häuser im Ghetto, Menschen gehen über eine Brücke. Reges Treiben in den Straßen. Juden besteigen Eisenbahnwaggons. - Fox Tönende Wochenschau 69/46/1963 ..Jerusalem: Demonstrationen gegen den Besuch des ehemaligen Bundesverteidi- gungsministers Franz Joseph Strauß. Transparente, u.a. "Strauß means war!", "We remember Dachau", Strauß beim Verlassen der Gangway - Indem wir dienen (1964) (Judaica) "Ausstellungsstücke der 'Monumenta Judaica' werden in ihrem lebendigen Zusammenhang, d.h. in kultische und folkloristische Tradition des Judentums gestellt". (Festivalkatalog Mannheimer Filmwoche 1964) - Der kleine Gestapobeamte Schmidt (Polen/1964) Dem Film liegt ein Fotoalbum mit 380 Fotos zugrunde. 129, die auch Kriegsverbrechen gegen Juden in Polen zeigen, sind in den Film aufgenommen worden. ... Erste Wache in Feindesland (Schmidt) 2. Einrichten einer Dienststelle (Haus von aussen)
3. Aktion gegen 6000 Juden in Plonsk (Grosse Gruppe von Juden, davor Schmidt) 4. Judenaktion in Raciaz (Gruppe mit Juden und Schmidt; Juden beim Strassenreinigen) 5. Das jüdische Untermenschentum, das 6000 Volksdeutsche ermordete. Hart war die Sühne (Schmidt und Juden) 6. Kriegsgerichtssitzung (Gruppe mit einem Angeschuldigten) 7. Vor der Exekution (Gruppe von Häftlingen mit Schmidt und SS-Männern; Einzelfotos der Juden) 8. Kutno. Dienstgebäude (Haus mit Hakenkreuzfahne; Gruppe von SS-Männern mit entblöstem Oberkörper) 9. Unsere Köchin (entsprechend) 10. "Juden raus!" (Hausrat von Juden und die Familien auf der Strasse) 11. Evakuierung von Juden (entsprechend) 12. Im Ghetto Zychtin nach dem Abzug der Juden (Hausrat und Gerümpel auf öffentlichem Platz) 13. Schlachtfeste (SS mit Frauen bei fröhlichem Trunk) 14. Öffentliche Exekution in Kutno; Aufbauen der Galgen; Die Verurteilten Passfotos; Charnickim, Parkowski, Sand (drei Galgen auf öffentlichem Platz; die Verurteilten einzeln am Strang; die drei Galgen mit den Gehängten; die drei Toten in einer Kiste) 15. In Leslau (Gruppenbild mit Schmidt am Flussufer) 16. Öffentliche Exekution eines Schiebers (Schmidt und SS-Mann bei der Exekution und der Erhängte) 17. Samicki (Schmidt in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa, auf dem Tisch ein Totenschädel) 18. Er versuchte Deutsche niederzuschiessen (zweimal der Angeschuldigte, Passfotos) 19. Richtfest einer neuen Garage (Gruppenbilder vom Fest) 20. Staatspolizeistelle Hohensalza (Schmidt vor dem Haus) 21. Statistik in Sachen 1032/43g; Fahr km 1418 km; Festgenommen 37 (das Statistik Blatt) 22. Von unseren Fahrten (PKW auf der Strecke und im Ort) 23. Schema Aufbau der illegalen polnischen Nachrichtengruppe (Fotos der Angehörigen) 24. Im Lager Hoza (Schmidt und Häftlinge) 25. In Berlin, Gruppe Reich (Gruppenbild, festliches Zusammensein mit Frauen) 26. Meine Winterarbeit Januar-März 1942 (Fotos von Angeschuldigten darunter Nowicki, der Gründer der illegalen Organisation) 27. Sezierung des Nowicki (Die Leiche Nowickis, dreimal, mit geöffnetem Leib) 28. Sommer 1942, Festnahmeaktion in Sycawin (Häftlinge, Abtransport) 29. Czaplin wegen Sabotage zum Tode verurteilt (das Foto) Schlussbilder. Schmidt bei verschiedenen Anlässen am Arbeitstisch, an seinem PKW, und mit Freunden in Gruppe - Brundibár (BRD/1965) Der Film bringt neben Berichten des Librettisten und überlebender Augenzeugen aus Theresienstadt eine Wiederaufführung der Kinderoper in tschechischer Sprache aus dem Jahr 1965 in Prag.
- Europäische Tragödie (BRD/1965) Der Film beginnt mit der Darstellung des Elends der Flüchtlinge, die noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges aus Deutschland geflohen waren und denen kein Staat Asyl gewähren wollte. Der Krieg steigert die Fluchtbewegungen in den von den deutschen Armeen überrannten Ländern, Zwangsumsiedlungen, Verschleppung von Fremdarbeitern und Deportation der Juden in die Vernichtungslager. - Der Augenzeuge 52/1965 bitte kontaktierenSie progress.film ...Amtseinführung des neues Rabbiners der jüdischen Gemeinden Berlins und der DDR - Deutschlandspiegel 131/1965 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ...Ankunft des israelischen Botschafter für die Bundesrepublik Asher Ben Natan auf dem Flugplatz Köln-Wahn. Natan spricht (Org.Ton) - Lebende Ware (DDR/Spielfilm/1966) Am 19.3.1944 rückt die Wehrmacht in Ungarn ein und mit ihr SS-Einsatzkommando Eichmann. In Übereinstimmung mit der Regierung Ungarns sollen die 800.000 Juden in die Vernichtungslager deportiert werden. Der Vertreter der Juden ist der Judenarzt. Er unternimmt den Versuch, möglichst viele Juden ins neutrale Ausland zu bringen, auf kommerziellem Wege, eine zwiespältige Methode, aber durch die Not und den natürlichen Willen zum Überleben gerechtfertigt. Für Eichmann ist die Judenfrage eine Transportfrage im Dienste der Tötungsmaschinerie. Der hohe SS-Offizier Wolf dagegen nutzt skrupellos die Notlage der verfolgten Menschen aus. Erpressung und persönliche Bereicherung stehen bei ihm an erster Stelle, was ihm auch einen Konflikt mit Eichmann einträgt. Wolf wird Treuhänder des kriegswichtigen jüdischen Konzerns Weiß. Dafür läßt er den größten Teil der Familie nach Portugal ausreisen. Zum Schluß dann seine Flucht vor der anrückenden Roten Armee. - Memento (1966) Der Film wurde nach dem Buch „Das Licht verlöschte nicht“ gestaltet, das der im April 1965 verstorbene Rabbiner Dr. Martin Riesenburger über den Untergang der Jüdischen Gemeinde in Berlin schrieb. - Memorandum (Kanada/1966) Der in Kanada lebende Jude Bernhard Laufer besucht mit seinem Sohn die Bundes- republik Deutschland 1965 anläßlich eines Treffens (Gedenkveranstaltung) von Überlebenden des DP-Camp Bergen-Belsen. Zur gleichen Zeit findet ein Prozeß gegen Friedrich Wilhelm Boger (wegen an Häftlingen im KZ Auschwitz begangenen Mordes verurteilt zu lebenslänglichem Zuchthaus) und andere Kriegsverbrecher in Hamburg (?) statt. Im Kontrast zu den Bildern des Nachkriegsdeutschlands stehen Ghetto-Aufnahmen (überwiegend Kinder), Deportation von Männern, Frauen und Kindern. Dazu die "menschlichen Züge" von Goebbels, Hitler, Himmler und Göring. Aufnahmen nach der Befreiung Bergen-Belsens. (unvollständig: Anfang fehlt) - Der Augenzeuge 4/1966 bitte kontaktierenSie progress.film ...Proteste gegen Török als westdeutschen Vertreter in Israel - Der Augenzeuge 21/1966 bitte kontaktierenSie progress.film ... Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Stutthoff wird ein Mahn- mal für die Opfer des Faschismus errichtet. - Frauen in Ravensbrück (DDR/1967/68) Ein Film über die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück mit Rückblenden vom ehe- maligen KZ, mit Originalaussagen von ehemaligen Häftlingen (Frauen) aus diesem Lager, die diese Hölle überlebten. Es spricht die Präsidentin des Ravenbrück- Komitees aus Frankreich (ehemaliger Häftling). Kranzniederlegung am Mahnmal. - Der Augenzeuge 12/1968 bitte kontaktierenSie progress.film ...Vor 25 Jahren begann die Massendeportation jüdischer Bürger in die Gaskammern: Jüdischer Friedhof in Berlin- Weißensee, Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin
- Der Augenzeuge 31/1968 bitte kontaktierenSie progress.film ...Mahnmal im ehemaligen KZ Stutthof - Wenn man vierzehn ist (DDR/1969) Die Jugendweihe mit all ihren Vorbereitungen ist das Thema dieses Films, u.a. Kinder bei einem Besuch des ehemaligen KZs Sachsenhausen. (aus der „Golzow“-Reihe) - Deutschlandspiegel 187/1970 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Bundeskanzler Willy Brandt in der DDR, u.a. am Mahnmal des ehemaligen Konzen- trationslagers Buchenwald: Willy Brandt geht mit ernstem Gesicht auf Mahnmal zu. Kranzschleife mit Schrift "Willy Brandt. Brandt zwischen Blumen und Soldat. Denkmal und flatternde Fahnen. - Bilder aus einem fremden Land - Deutschland 1945 (BRD/1971) ... KZ Opfer, Aufgestapelte Leichen, KZ Opfer mit Victory-Zeichen. (R.1) ... KZ Flossenbürg: Stacheldrahtzäune, Gleisanlagen, Gitter, Mann öffnet Gittertüren. Männer öffnen Verbrennungsöfen, Leiche im Ofen liegend, Soldaten öffnen Massen- grab und zerren die Leichen mit Stricken aus der Erde. KZ Buchenwald: Häftlinge vor dem Eingang. Tor mit Aufschrift. Nackte Häftlinge. (R.2) - Sachsenhausen (DDR/1971) Aufnahmen aus dem ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen mit zahl- reichen Besuchern der Gedenkstätte heute. Der Kommentar referiert die Geschichte des KZ. ...Ehemalige Häftlinge berichten über die Widerstandsarbeit im Lager und die Arbeit des Lagerkomitees der Häftlinge: Bogdan Rozsa, Charles Desirat (Präsident des in- ternationalen Sachsenhausenkomitees), Fritz Eickemeier (1953-1964 Polizeipräsident von Berlin), Hans Rosenberg, Apotheker im Lager, Paul Dubias, französischer Berg- arbeiter, Stanislaw Tuski (Prof. für Mathematik), Lisa Walter, Oskar Hoffmann. Ärztin Elisabeta Schetowa berichtet über ihren Eindruck als Angehörige der Roten Armee bei der Befreiung des Lagers. Kurze Portrait-Aufnahmen der im Sachsen- Hausenprozeß (sowjetisches Militärgericht Berlin 1947) verurteilten Heinz Baumkötter, Lagerarzt, Kurt Eccarius, Leiter des Zellenbaus und Gustav Sorge, Rapportführer. Junge Pioniere pflegen die Gräber der Ermordeten. Vereidigung von Soldaten der Nationalen Volksarmee der DDR auf dem Gelände der Gedenkstätte Sachsenhausen. - Deutschlandspiegel 226/1973 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Bundeskanzler Willy Brandt in Israel: Lod-Airport. Brandt geht Flugzeugtreppe hinunter. Golda Meir begrüßt Willy Brandt herzlich. Militärkapelle spielt die deutsche Nationalhymne. Brandt bei Kranzniederlegung an der Gedenkstätte für die Opfer der Judenverfolgung Yad Vashem. Brandt geht neben Golda Meir bei einem Festessen im israelischen Parlament. Brandt besucht Kibbuz am See Genezareth. Essen mit den Kibbuzbewohnern. Brandt neben Rabbiner bei Besuch von heiligen Stätten in Jerusalem. Das Weitzmann-Institut. Verleihung der Ehrendoktorwürde an Brandt. - Und jeder hatte einen Namen (DDR/1974) Aussagen ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar. - Im Namen des Führers (Belgien/1977) Kompilationsfilm, der zeigt, wie die Nazis nichtarische Kinder im besetzten Europa behandelt haben. - Berlin-Totale XIV. Stadtgeschichte, Denkmale und Denkmalspflege 2. Historische Straßen und Plätze d) Almstadtstraße (1978) Ein jetziger Bewohner der Almstadtstraße, Herr Miegel, erinnert sich u.a. an die Zeit, in der vorwiegend Juden in der Grenadierstraße, der heutigen Almstadtstraße, wohnten. Er erzählt von den Bräuchen und Gewohnheiten der Juden, wie sie ihre Feiertage begingen, wie sich das auf das Gaststättengewerbe auswirkte und sich im Straßen- bild widerspiegelte. Er erinnert sich auch an die koscheren Läden und Bethäuser. Frau Kramp, eine andere alte Bewohnerin der Straße, spricht über die Kristallnacht
in der Grenadierstraße. Die Schriftstellerin Mischket Liebermann, aus jüdischer Familie stammend, erinnert sich an das Elternhaus in der Grenadierstraße, an jüdische Festtage, z.B. das Laubhüttenfest. Sie liest einen Nachtrag zur 2. Auflage ihres Buches „Aus dem Ghetto der Welt“. - ...deswegen müssen wir immer wachsam sein (BRD/1978) Zusammenkunft von ehemaligen KZ-Häftlingen am Vorabend der Kundgebung: Dr. Werner Koch (ehemaliger Häftling Sachsenhausen) äußert sich zu Neuauflage faschistischen Gedankenguts. Fotos KZ Sachsenhausen, KZ Buchenwald. Joseph Meier, Österreicher, äußert sich zum selben Thema. ...Foto von Lidice, Foto von Schulklasse am 20. Mai 1942; Anna Rohlova, CSSR, Mitglied des Nationalrats von Lidice in Köln spricht über Bewältigung der Vergangen- heit; weist erschüttert auf ein eingeritztes Hakenkreuz am U-Bahneingang Dom-Hauptbahnhof. ... Naziplakate und Fotos von Treffen rechtradikaler Vereine, z.B. "Hilfsgemein- schaft auf Gegenseitigkeit" (HIAG) als Nachfolgeorganisation der Waffen-SS; Foto eines Fürsprechers der Hilfsgemeinschaft im Bundestag: Hans Wisselbach (phonetisch) ...Demonstrationszug auf dem Weg zur Kundgebung: Veteranen in Häftlingskleidung, Bundeswehrsoldaten, Bevölkerung, Vertreter aus vielen Ländern ... Dr. Maurice Goldstein, Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, spricht zu den Versammelten (O-Ton: u.a. Forderung der Verwirklichung des § 139 GG) ...Camille Semon, Frankreich, spricht über das SS-Massaker von Oradour, das sie überlebt hat. ...In einem Privatarchiv, welches Dokumente aus der NS-Zeit sammelt. Die Archivarin zeigt Fotos von Lidice und Aufklärungsblätter über die Verbrechen Hitlers ...Büro des VVN und Bund der Antifaschisten: Interview mit dem Geschäftsführer des Bundes Hans Jennes (phon.) über die Veranstaltung. Er weist u.a. auf verschiedene neue faschistische Dokumentationen hin. Lebens-Geschichte des Bergarbeiters Alfons S. Folge 8 (BRD/1978) ... Der alltägliche Faschismus (1933-1939), u.a. "Schachern" mit einem Juden und die Folgen - Deutschlandspiegel 281/1978 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Bundeskanzler Helmut Schmidt in Warschau: Denkmal für die Opfer des Faschismus des KZ Auschwitz. Stacheldraht. Helmut Schmidt und Herbert Wehner bei Kranz- niederlegung vor dem Ehrenmal. Roter Nelkenkranz. Die brennende Opferflamme. - Dawids Tagebuch (DDR/1980) Im Mittelpunkt steht das Schicksal eines 12jährigen polnisch-jüdischen Jungen, Dawid Rubinowicz, der mit seiner Familie in einem KZ umgebracht wurde. Ein Foto, auf dem Dawid mit seiner Schulklasse zu sehen ist, und sein Tagebuch sind die einzi- gen Zeugnisse, die von den in der kleinen Stadt Krajno ansässig gewesenen Juden übriggeblieben sind. Dawid hielt fest, was von 1939 bis 1942 vor sich ging. Wie Freunde und Verwandte verschwanden, sich verstecken mußten, geprügelt wurden. Wie der Hunger zunahm. Wie er und die anderen jüdischen Kinder nur noch heimlich hatten unterrichtet werden können. Mitten im Satz bricht das Tagebuch ab. Michael Lösche fand in der Landschaft Stimmungen, die die Worte Dawids emotional eindring- lich und unvergeßlich machen. Film und Fotodokumente bezeugen, was damals laut Gesetz vonstatten ging. Hinter den vielen Namenlosen, über die das Auge so leicht hinweghuscht, steht nun ein Schicksal, dem man nachtrauert. - Der gelbe Stern (1980) Die Judenverfolgung 1933 - 1945. ...Judenboykott am 01.04.1933 in Berlin mit SA-Sprechchören (Orig.-Ton); (43 m) aus „Fox Tönende Wochenschau“ (R.1) ...Albert Einstein spricht auf einem Kongreß zur Judenverfolgung (Orig.-Ton englisch); (11 m) (R.2) ...Joseph Goebbels spricht zu Kultur und Kunst auf der Tagung der Reichskulturkammer am 27.11.1936 (Orig.-Ton);(24 m) (R.2) aus „Deulig Tonwoche 257/1936“ ...Junge Juden beim landwirtschaftlichen Praktikum (17 m) (R.2)
...Jüdische Auswanderer stehen an der Reeling und verlassen das Schiff in Israel. (13 m) (R.2) ...Hermann Göring verkündet 1935 die Rassegesetze und führt u.a. aus: "Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten." (Orig.-Ton) (13 m) (R.3) ...Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich 1938; Juden flüchten. (16 m) (R.3) ...Fotos von Herschel Grünspan und Ernst vom Rath. (06 m) (R.3) ...Überführung Ernst vom Rath's nach Deutschland und Trauerfeier in Düsseldorf am 17.11.1938 (36 m) (R.3) aus „Tobis-Woche 48/1938“ ...Reichskristallnacht am 09.11.1938. SA-Leute werfen Scheiben ein. (gestellt); brennende Synagoge. (14 m) (R.3) ...Sprengung und Abriß der Dresdner Synagoge. (24 m). Beseitigung der Brandruine (R.3) ...Ankunft deutscher Juden auf dem Bahnhof Zevenaar (Holland). Paßkontrolle der Einwanderer; Einwanderungsformalitäten und Auszahlung eines Überbrückungsgeldes; (42 m) (R.3) ...Paris "Asile de nuit, asile de jour et crèche Israelites" in der Rue de Chevalier Einwanderungsformalitäten der Emigranten (23 m) (R.3) aus „The March of time“ ...Jüdische Hilfsstelle in London; Emigranten bei der Anmeldung; Arbeit im nationalen Koordinierungs-Komitée (26 m) (R.4) ...Ankunft jüdischer Kinder im Hafen von Horwich. Kontrolle der umgehängten Identifi- kationskarten; an Land besteigen die Kinder den bereitstehenden Autobus; Ankunft im Lager (34 m) (R.4) Aus „Paramount Journalen15/1938“ ...Passagierdampfer "St. Louis" mit jüdischen Flüchtlingen an Bord im Hafen von Havanna; ein Teil der Flüchtlinge geht in englischem Hafen von Bord. (24 m) (R.4) aus „Paramount Journalen13/1938“ ...Eröffnung der Ausstellung "Der ewige Jude" am 01.08.1938 in Wien mit Ansprache von Reichskommissar Artur Seyss-Inquart (38 m) (R.4) (R.4) ...Ausstellung "Der Jude und Frankreich" 1942 in Paris. (25 m) ...Gemütskranke im Hof einer Anstalt; Vergleich arische Jugend und Geisteskranke (34 m) (R.4) ...Rattenszene und Ghetto (21 m) (R.4) aus „Der ewige Jude“ ...Hitler spricht am 30.01.1939 im Reichstag zur Judenfrage (22 m) (R.4) ...Überfall auf Polen am 1.9.1939; antisemitischer Kommentar der Wochenschau (20 m) (R.5) ...Amateuraufnahmen eines Judenpogroms in einer polnischen Stadt. Juden werden durch eine Straße getrieben; Menschen liegen auf der Straße; eine Frau wird an ihren Haaren geschleift. (08 m) (R.5) ...Einmarsch deutscher Truppen in Riga. Juden klettern von einem LKW und heben unter SS-Bewachung eine Grube aus. (31 m) (R.5) aus „Deutsche Wochenschau 567/301941“ ..Soldaten holen in der Kleinstadt Jonowa Menschen aus ihren Häusern und verhaften sie. (08 m) (R.5) ...Amateuraufnahmen einer Massenhinrichtung. Die Opfer werden im Winter zum Galgen geführt und zu zehnt gehenkt. (10 m) (R.5) ...Razzia deutscher Feldgendarmerie auf dem Wochenmarkt in Krakau; Juden werden von polnischen Hilfspolizisten notiert; Ausweiskontrollen, Zivilisten werden nach Waffen durchsucht und abgeführt. (32 m) (R.5) aus „Die Tätigkeit der Polizei im Generalgouvernement.“ ...Judenpogrom in Lemberg. Juden werden der deutschen Polizeidienststelle zugeführt (09 m) ...Verhaftete Menschen mit erhobenen Händen (04 m) (R.5) aus „Tobis-Woche 38/1939“ ...Judendeportation in Balti (17 m) (R.5) ...Umsiedlung der Juden ins Krakauer Ghetto (19 m) (R.5) ...Bilder aus dem Warschauer Ghetto. Straßenbahn, Straßenleben, Straßenhandel und -geschäfte; jüdischer Gottesdienst (67 m) (R.5) aus „Ghetto“ ...Amateuraufnahmen von der Einmauerung des Ghettos durch jüdische Maurer; Brücke über die Straße im Warschauer Ghetto; Straßentor im Ghetto; deutsche Bewohner. (27 m) ...Soldat kontrolliert am Ghettoeingang Passierscheine; überfüllte Wohnungen im Ghetto;
verwahrloste Kinder beim Essen. (26 m) (R.5) ...Bettelnde Kinder auf der Straße; zerlumpte Frau mit Kind auf dem Arm; deutscher Soldat kontrolliert Kinder auf Lebensmittelschmuggel; Ghettopolizei bringt Verhaftete in die Arrestanstalt; auf der Straße liegende Leichen werden eingesammelt; Beisetzung im Massengrab. (131 m) (R.6) Aus „Ghetto“ ...Amateuraufnahmen. Jüdinnen und Juden werden von schlagender Ghettopolizei aus einem Gebäude getrieben. Auf der Straße werden Juden zur Deportation zusammen- getrieben; Sammelplatz. (28 m) (R.6) ...Fotos von der Niederschlagung des Ghettoaufstandes aus dem Stroop-Bericht (38 m) ...Kameraschwenk über das Ghettogelände, nachdem es dem Erdboden gleichgemacht wurde. (08 m) (R.6) ...Ankunft privilegierter Juden in New York, Sidney und Israel; Kontrolle der Einwande- rungsbehörde. (32 m) (R.6) ... Aufnahmen der Wannsee-Villa (außen und innen) (Neuaufnahmen) (59 m) (R.7) ...Leichenüberreste in einem Verbrennungsofen. (05 m) (R.7) ...Juden in Berlin 1941 mit dem Davidstern auf ihrer Kleidung. (07 m) (R.7) ...Versorgung der Stuttgarter Juden in der Gaststätte zum Kriegsberg. Sammellager der Juden in Stuttgart vor ihrem Abtransport (84 m) (R.7) ...Leerer Eisenbahn-Waggon; Fahrtaufnahmen aus der mit Stacheldraht versehenen Öffnung (45 m) (R.8) ...Bilder aus dem Konzentrationslager Theresienstadt: Juden arbeiten in der Schmiede, Näherei, Schusterwerkstadt; Juden strömen nach Arbeitsschluß aus den Baracken; Aufnahmen aus den Wohnbaracken; Fußballspiel auf dem Kasernenhof; (104 m) (R.8) Aus „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ ...Reichsführer SS Heinrich Himmler besichtigt ein Gefangenenlager der Wehrmacht in Minsk. (02 m) (R.8) ...Himmler besichtigt in Begleitung von Wehrmachtsoffizieren und Adjudant Karl Wolff das Lager. (19 m) (R.8) aus „Judenexekution in Libau“ ...Ein Soldat holt eine Frau aus ihrem Holzhaus und trennt sie von ihrem Kind. (07 m) (R.8) ...Fotos von Judenexekutionen (16 m) (R.8) ...Himmler und Wolff besichtigen angetretene SS-Offiziere. (06 m) (R.8) ...Deportation holländischer Juden aus dem Sammellager Westerborg (115 m) (R.8) ...Fotos von Auschwitz. Ankunft von Transportzügen, Selektionen. (29 m) (R.8) ...Fotos aus dem Konzentrationslager Auschwitz nach der Befreiung und amerikanische Luftaufnahmen von 1944 (26 m) (R.8) ...Flug über Auschwitz-Birkenau; Kameraschwenk über das Lager; Frauen in einer Baracke; Häftlinge erhalten Suppe; essende Häftlinge; Häftlinge lecken Kübel aus. (57 m) (R.8) ...Fotos vom Lagerleben und Arbeitseinsatz (40 m) (R.8) ...Gaskammern in Auschwitz (23 m); Verbrennungsöfen (10 m) (R.8) ...Leichen verstorbener Häftlinge in verschiedenen Lagern; Leichenberge. (44 m) (R.8) ...Trauerfeier für die Opfer von Maidanek im Herbst 1944 in Lublin (17 m) (R.8) ...Maidanek: Überlebende Häftlinge nach der Befreiung. (17 m) (R.8) ...Zug der Zwillinge in Auschwitz (24 m) (R.8) - Palästina - Chronik eines Volkes (PLO(1983/84) Politisch-analytischer Archivfilm, der Entwicklung und Etappen des Palästina-Problems behandelt. ...Historische Aufnahmen von Jerusalem, die Klagemauer. Die heilige Stadt, Straßen, Gassen, Moscheen. Fotoserie vom Leben in der Stadt Jerusalem.Handwerk, Familie, Sitten und Bräuche. (R.1) ...Literatur zum Judenstaat. Autor Theodor Herzl. Fotoserie Geschichte. (R.2) ...Weiter historische Abläufe, Tumult auf den Straßen, friedlicher Alltag, Ausübungen des Glaubens - Mauer und Moschee. Handwerker, orthodoxe Juden, die Thora, Handel, Küche, Tänze, Aufbauarbeiten, Einzäunungen, Versammlungen.... Führungspersönlichkeiten, Polizei- und Truppen gegen die Bevölkerung. Terror und Tote. Aufbau in der Landwirtschaft, Schulen, Baumpflanzung, Aufbau Hochhäuser. Junge Männer und Frauen bewaffnet im Einsatz in den Bergen, Aussagen von Per- sönlichkeiten, Ausbildung an der Waffe. (R.3) ...Truppenbewegung in der Stadt, Barrikaden, Kontrollen durch die Engländer, Terrorakte an der Bahnstrecke, militärische Aktionen. (R.4)
...Ankunft neuer Besatzer in der Wüste in neuen Behausungen, Zelte. Judenpogrome in Berlin, Terror gegen jüdische Bürger, Vertriebene noch mit per- sönlichem Gepäck, von Soldaten der deutschen Wehrmacht bewacht. In langem Zug die Vertriebenen. Befreiung im KZ und Arbeitslager im Camp in Palästina, wieder hinter Stacheldraht, die KZ-Nummer auf dem Unterarm. Befreiungsszenen im Camp. Ankunft. Das Schiff „Theodor Herzl“. Die Heimkehrer an der Reeling. Libanon-Unruheherd. (R.5) ...Ablauf des Krieges. Sieges-Parade. Abzug der englischen Einheiten. Wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit Terror und Toten. Chaim Weizmann, World Zionist Organization. Ben Gurion, Parlament und Veranstaltungen. Dokumente zu Vereinbahrungen: Ägypten – Israel, Israel – Libanon, Israel – Transjordanien, Israel – Syrien. Riesiges Zeltlager. Das Zeltlager in der Wüste. Das Drama Suez-Kanal. Verhandlung mit Abd El Nasser (Ägypten). Kriegsvorgänge. Zivilbevölkerung, Flüchtlingslager. (R.6) - Die Mitläufer (BRD/1984) Zehn Episoden zeigen Verhaltensweisen von Menschen während der Zeit des Natio- nalsozialismus auf und geben dem Zuschauer die Möglichkeit, eigene Verhaltens- weisen zu hinterfragen. U.a. ..."Der Zinnsoldat": Ein am Boykott jüdischer Geschäfte beteiligter SA-Mann belehrt seine Familie, daß man im Dienst nicht als Mensch handele, sondern seine Pflicht erfülle. ..."Mit der Zeit gehen": Eine Putzfrau wird nach der Reichskristallnacht aufgefordert, nicht mehr Juden den Dreck nachzuräumen. ..."Der Eisenbahner": Ein Lokführer verdirbt die Weihnachtsstimmung, als er seiner Frau erzählt, daß er KZ-Transporte fährt. - Das Jahr 1945 (DDR/1985) ...Befreiung des KZ’s Buchenwald. Die Weimarer Bevölkerung muß das KZ besich- tigen. Der Schwur von Buchenwald am 19.4.45 (R.4) Was zuletzt bleibt - Geschichte eines gewöhnlichen KZ (DDR/1985) - Im Zeichen des Feuers Elie Wiesel (Schweiz/1986) Der Film ist ein Porträt des amerikanisch-jüdischen Schriftstellers, Hochschullehrers und Nobelpreisträgers Elie Wiesel, der den Holocaust überlebt hat und zum Sprecher der Opfer geworden ist. Elie Wiesel hatte lange geschwiegen, aus welchen Gründen auch immer. 1954 hatte den damaligen Zeitungskorrespondenten ein Gespräch mit Francois Mauriac herausgefordert, das Schweigen zu durchbrechen mit einem Leidartikel in sechsundzwanzig Bänden. - Stein schleift Schere (DDR/1986) Zunächst begab sich der Regisseur Peter Voigt an den Ort, an dem er fünf Jahre als Reichsdeutscher in Polen seine Kindheit verbrachte. Hier schloß er Freundschaften, lernte, spielte. Hier hatte der Vater zwei polnische Arbeiter gemeldet, weil sie sich trotz Verbots in ihrer Muttersprache unterhielten. Hier war er einem Juden begegnet, für ihn und seine Kameraden der Inbegriff des Bösen. Zwischen die einzelnen Episoden sind immer wieder Verse eines Kinderreims gesetzt, die davon handeln, wie eins das andere nach sich zieht: "Stein schleift Schere/Schere schneidet Papier". Sie fügten das Ganze zu einem unsentimentalen Gedicht über Ausgeliefertsein, Hingabe, Glaube, Liebe und der späten, zu späten Erkenntnis, in das Böse selbst verstrickt gewesen zu sein. - Erinnern heißt leben (1988) Leben der Juden in Berlin im Wandel der Jahrhunderte anhand der Geschichte des jüdischen Friedhofs in Berlin-Weißensee. - Die Lüge und der Tod (1988) Unter der Verwendung des Filmmaterials über die Deportation der Juden in Stuttgart 1941 wird das Schicksal der Juden aufgezeigt.
- Der Mann an der Rampe (DDR/1988) Heynowski und Scheumann suchten und fanden die Schuldigen in der anderen Re- publik. Der Mann, der den Zugverkehr in Auschwitz organisiert hatte, lebte später unbehelligt unter all den "Normalen" in der BRD. Heute, so hört und sieht man in Episoden, werden die Erinnerungen daran in Läden feilgeboten. Hakenkreuze und Judensterne, Tressen eines SS-Sturmbannführers. Originale oder Kopien, um der großen Nachfrage gerecht werden zu können. Vom "Wirtschaftlichkeitsprinzip beim Einsatz von Giftgas" spricht ein Beamter, zuständig für die Bundeswehr. Der Kom- Mentar läßt keinen Zweifel daran, daß die Verbreitung der Auschwitzlüge hier – und nur hier - auf fruchtbaren Boden fällt. ...Stillgelegtes Bahngleis; Wachtturm ...Detailaufnahmen des elektrischen Zauns von Auschwitz ...Leere Baracken; historische Fotos und Aufnahmen von Häftlingen, Blumen in leerer Baracke, Schild "Arbeit macht frei". Kommentator erklärt und verurteilt, was in Auschwitz passiert ist. Schuhe und andere Besitztümer. ...Der Ausdruck "Auschwitzlüge" wird erklärt, während Bilder ankommender Häftlinge gezeigt werden. Man sieht auch, wie die Türen eines Zuges von der SS geschlossen werden. Selektion der Ankommenden wird gezeigt (Männer, Frauen) und erklärt (arbeitsfähig, nicht arbeitsfähig). ...Einblendung: Bedeutung und Grenzen des Wirtschaftslichkeitsprinzips für das Verwal- tungshandeln. Autor: Dr. Rainer Reinhardt; Wehrbereichsverwaltung München. ..Abgeschnittene Haare werden gezeigt und Dr. Reinhardt wird zitiert: Die Tötung durch Gas war ein "Sieg des Wirtschaftlichkeitsprinzips". Die Aussage Dr. Reinhardts wird kritisiert und das Originalzitat eingeblendet. Quelle: Unterrichtsblätter für die Bundes- wehrverwaltung - Zeitschrift für Ausbildung, Fortbildung und Verwaltungspraxis. ...Prothesen werden gezeigt. ...Heft "Militaria-Shop, Militaria Liste", Soltau. Umfangreiche Preisliste für NS-Devotio- nalien (Waffen-SS-Gürtel, Waffen-SS-Koppelschloss, Pistolentasche, etc.). Es wird erklärt, wie Tressen, Sterne, Kragenspiegel etc. verwendet wurden. Erkennungsmarke KZ Dachau für jüdische Insassen wird in Großaufnahme gezeigt. ..."Die komplette Ausstattung eines SS-Offiziers jeden beliebigen Dienstgrads ist in der Bundesrepublik anstandslos zu haben", z.B. ein Hauptsturmführer für 2.921,- DM. ...Diejenigen, die an der Rampe selektierten, hatten zusätzlich ein Ärmelband "Auschwitz", das man in der BRD ebenfalls käuflich erwerben kann. - Das Singen im Dom zu Magdeburg (1988) ...Synagogalkonzert im Dom zu Magdeburg mit dem Magdeburger Domchor und dem Oberkantor Estrongo Nachama. - Herr Schmidt von der Gestapo (DDR/1989) Der Hauptverantwortliche für die Verwirklichung der „Endlösung der Judenfrage“ in Dresden und Umgebung, Henry Schmidt, wird nach 40 Jahren an den Ort seiner Verbrechen gebracht. Im Prozeß vor einem DDR-Gericht werden Hintergründe und Mechanismen des gesellschaftlichen Systems des Nationalsozialismus aufgedeckt. - Knabenjahre (DDR/1989) Peter Voigt befragt Männer seiner Generation - einen Pfarrer, einen Hauptabteilungs- leiter, einen Psychologen und einen Bühnenbildner – nach ihrer Erziehung im "Dritten Reich". Wie hatten sie erlebt, woran erinnern sie sich heute? Wie in einer Talk-Show sitzen sich Regisseur und der jeweils Befragte in einem Spiegelraum gegenüber. Wichtige Begriffe werden nach jedem Gespräch in einem Schriftbild wiederholt: "Deutscher Wald / Wir sind anders / Fremdarbeiter / Latentes Wissen / Todes- kommando / Hochrot Silbergrau Arisch / Ledergeruch / Vermutlich ein Jude / Angst / Elfenreigen". Die Musik (aus Carl Orffs "Carmina Burana") bewirkt eine sich steigende Unruhe darüber, was verdrängt und verschwiegen wurde, was ie Seele belastet und bis heute Angst macht. - Spuren (1989) Der Film verfolgt Spuren jüdischer Kultur auf deutschem Boden. (Er entstand mit Unterstützung des Studios für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste der DDR, dem Theaterarchiv der Akademie der Künste Berlin-West,
der Schaubühne am Lehniner Paltz, der Blibliothek der jüdischen Gemeinde Berlin. Martin Brandt spricht Texte aus Lessing „Nathan der Weise“, Shakespeares „Macbeth“. Filmszenen aus den Film „Das Urteil von Nürnberg“.) "Die Schwierigkeit war nicht das Töten, sondern die Leichen loszuwerden." Die Begegnung mit dem Schauspieler Martin Brandt, letzter Überlebender des Jüdischen Theaters in Berlin, der 1941 in die USA emigriert war und in Hollywood Nazis spielen mußte, und die Tatsache, daß die bevorstehende Sprengung der Überreste der Reichs- kanzlei dokumentiert werden sollte, führte zu diesem Film. Brandt starb noch vor der Premiere. (Quelle: Schwarzweiß und Farbe DEFA-Dokumentarfilme 1946-92) - Vergeßt unsere Tränen nicht (DDR/1989) Zur Geschichte des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück - Deutschlandspiegel 423/1989 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Kohl in Polen, u.a. Kranzniederlegung von Kohl an Gedenkstätte für KZ Auschwitz. - Ner Tamid - Ewiges Licht (D/1990) Die Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin, Mitte des letzten Jahrhunderts Im maurischen Stil des Historismus erbaut, wurde um Symbol der im 19. Jahrhundert erworbenen staatsbürgerlichen Gleichberechtigung der Juden umd zum Zentrum jüdischen Lebens. In der Pogromnacht 1938 wurde sie geplündert und demoliert. Der Hauptteil mußte – schwer beschädigt durch Bomben – nach 1945 abgetragen werden. Der Film berichtet vom beginnenden Wiederaufbau an gleicher Stelle, als Stätte der Begegnung, ein Centrum Judaicum, und der Zuversicht der Menschen für einen neuen Anfang. - Wofür starb Dirk Boonstra (1990) Dirk Boonstra war Polizist in der niederländischen Stadt Greifskerk. Er widersetzte sich dem Befehl der deutschen Besatzungstruppen, die Juden seines Ortes auszuliefern. Gemeinsam mit 11 anderen Polizisten kam er deswegen in ein Internierungslager und dann in das KZ Herzogenbusch. Im Mai 1944 starb er 51jährig im KZ Dachau. - Deutschlandspiegel 462/1993 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Die Deutschen und der 30. 1. 1933; u.a. im Rückblick SA-Mann steht vor jüdis- chem Geschäft Wehrt Euch Kauft nicht bei Juden. An Schaufenster Judenstern. Menschen auf Lastkraftwagen vor Abtransport.... Frauen Konzentra- tionslager. KZ-Häftlinge hinter Stacheldraht. - Beruf Neonazi (BRD/1993) Autofahrt in einer nächtlichen Stadt. Es läuft Autoradio in englischer Sprache. Veran- staltung im Souterrain, es sind ca. 30-40 Zuschauer anwesend, die dicht gedrängt sitzen. Ein Farbiger mit Hitlerbärtchen sieht sich Unterlagen an. Er erklärt, dass er ein "Arier" aus Indien sei und dass sein Vater im 2. Weltkrieg gekämpft habe. Viele der jungen Männer auf der Veranstaltung tragen Kleidung mit faschistischen Auf- nähern. Der Redner grüßt am Ende seiner Rede mit Hitlergruß; die Menge erwidert den Gruß und ruft "White Power". Nahaufnahmen der Besucher. ...Ein mit Unterlagen überfülltes Büro mit drei Bildschirmen. Ernst Zündel packt ein Paket aus. Es enthält ein Buch mit einem Foto, auf dem er ein Kreuz trägt. Dieses Kreuz wird im Büro aufbewahrt. Es ist das Kreuz, das er "für Deutschland" getragen hat, weil er verurteilt wurde. Er zeigt das "Schulungszentrum", in dem Veranstaltungen stattfinden. Er erklärt die Fahne der Bewegung (eine rote Fahne mit weißem Kreis und einem schwarzen Z für Zündel) und zeigt einige Schilder von Demonstrationen. ...Zündel, Grafiker von Beruf, ist nach Kanada ausgewandert, damit er nicht zur Bundeswehr muss. Im Büro steht ein Globus, damit er mit Gleichgesinnten die Welt- herrschaft planen kann. Außerdem steht ein Hitlerbild im Büro und ein Bild, das ein Entkommen aus der Gefangenschaft symbolisiert. Akten über diverse KZs und über die Frage "What ist a Jew?". Gefängniskleidung mit der Aufschrift "Political Prisoner", die Zündel selbst als "KZ-Kutte" bezeichnet. Auf dieser Kleidung sind Schilder mit seiner Telefonnummer. Zündel erklärt, die "Zionisten mit ihrer mächtigen Holocaust- Lobby" für seine eigenen Zwecke zu nutzen. ...Irving soll ausgewiesen werden; man sieht ihn beim Betreten des Gerichtsgebäudes. Jemand, der eine Jacke mit der Aufschrift "C.Y.S." trägt, nimmt eine Reichskriegsflagge
mit Hakenkreuz aus dem Kofferraum eines Autos. Jemand verteilt Flugblätter, in denen auf serbische Opfer des 2. Weltkriegs aufmerksam gemacht wird. Eine Frau spricht über die Opfer in ihrer eigenen Familie. Bela Ewald Althans, ein Neonazi, meint: "Das ist meine Zukunft hier. Kameras vor meiner Nase und Juden im Nacken." ...Zündel öffnet Briefe, in denen Geldspenden sind: 50 DM, ein Scheck über $50,-, etc. Althans, ein Deutscher, arbeitet für Zündel. Er ist für einige Monate in Kanada und bespricht mit Zündel das weitere Vorgehen in Deutschland. Broschüren werden gedruckt. Zündel spricht über die Audio- und Videokassetten, die er teilweise kostenlos in alle Welt verschickt. Im Fernsehstudio Zündels läuft "Der Ewige Jude" und ein Propagandafilm, der ins Spanische gedolmetscht ist. Raubkopien von Videos als Möglichkeit der Werbung. ...Zündel möchte die unterschiedlichen Neonazi-Gruppen in Deutschland vereinigen. Er sieht Althans (der seine absolute Loyalität erklärt) als zukünftigen Anführer der Welt, der "das deutsche Schicksal wenden" kann. Althans vergleicht sich mit Himmler und Heydrich. Er wird gezeigt, wie er durch die Straßen einer kanadischen Stadt geht. ...Ein Flugzeug startet. Dann plant er eine nationalsozialistische Stadtführung (Feldherrn- halle etc.) sowie die Unterbringung der "Kameraden" aus dem Ausland in München. Ein spanischer Neonazi erklärt in sehr gutem Deutsch seine Aufgabe. Ein anderer Neonazi erklärt auf Englisch "the greatness of Hitler". Vier Neonazis in Anzügen bei ihrer Besichti- gungstour durch München. Das "neue Braune Haus" in der Herzog-Heinrich-Straße wird gezeigt. Althans ist verärgert über konkurrierende nationale Gruppierungen. Mit seinem "Jugendbildungswerk", derzeit 50 Personen, will er sich an die Spitze setzen. "Mir geht es um geistige Gleichschaltung." Althans erklärt, dass seine Gruppe sich an der histori- schen Entwicklung der NSDAP erklärt. ...Ein Mitarbeiter sitzt an einem PC, schätzungsweise ein 386er oder 486er. Befragt nach seinen Zielen, erklärt Althans, dass er sich ein zweites wirtschaftliches Standbein schaffen will. ...Einladung zur Weihnachtsfeier. "Es gibt nichts nationalsozialistischeres als Weihnachten". Das habe auch nichts mit Jesus zu tun. ...Autofahrt, Althans als Beifahrer blättert im Spiegel. ...Die Mutter von Althans spricht über ihre Gefühle. Sie trennt die familiäre Beziehung von der Tätigkeit ihres Sohnes. Der Vater von Althans befürchtet, dass die "Grenze zwischen Ideologie und Gewalt" überschritten wird. Seine Mutter erinnert sich an dessen Kindheit: Auffallen um jeden Preis. "Es fing schon früher an, im Waldorfkindergarten schon." Althans diskutiert mit sienen Eltern über Politik. Er spricht von "Leuten, die in Rostock randalieren", die er als leicht beeinflussbar ansieht. Seiner Meinung nach suchen diese einen "Führer". Vater: "Die Gefahr liegt darin, dass das alles 50 Jahre zurückliegt bald". (Das Gespräch fand also Anfang der 1990er Jahre statt.) ...Althans: "Ich trage heute einen Judenstern in der Form eines Hakenkreuzes. Ich bin heute der, der für die Unfähigkeit anderer büßen muss als Sündenbock." ...Fahrt nach Polen. Althans spricht über eine Vertreibung von Deutschen aus Polen 1945, die er als Unrecht bezeichnet. Fahrt durch eine kleine Ortschaft in Polen. Althans spricht mit Deutschen, die in Polen leben und sich beklagen, dass das Material Zündels vom Zoll abgefangen wurde. Fahrt nach Auschwitz. Althans kauft ein Buch und zählt das Wechselgeld. "In Auschwitz betrogen werden, das wäre ja dann der Hit. Da hätte ich was zu lachen auf der Rückfahrt." Er erklärt Auschwitz als "riesengroße Verarschung", während im Stammlager herumläuft. Dann besichtigt er die Gaskammer, wo er mit einem Besucher auf Englisch streitet und seine Theorien in zwei Sprachen verbreitet. Andere Besucher fordern ihn auf, zu gehen. Draußen diskutiert er mit dem gleichen Besucher weiter. Dieser fordert ihn auf, die Sonnenbrille abzunehmen. Das tut er zwar, sieht sich dann aber überheblich um, gibt respektlose Sprüche von sich und geht in der übrigen Gedenkstätte herum, wo er ein "Schwimmbad" findet. ...Eine Neonazi-Veranstaltung. Althans zeigt seine Fotos von Auschwitz und erzählt vom "Schwimmbad" für die Häftlinge. ...Bahnhof, Taxifahrt durch München. Die Fahrt zur Geschäftsstelle kostet 25 DM, Althans zahlt 45 DM. Althans liest seinen Mitarbeiterinnen eine Postkarte vor, in der jemand Hitler lobt. Eine der Mitarbeiterinnen (eine Heimatvertriebene) erklärt, das Hitler nur das Beste für sein Volk gewollt habe und dass ihm der Krieg aufgezwungen worden sei. Der Krieg sei nur verloren worden, weil es "Millionen von Verrätern" in Deutschland gegeben habe. Ihre Mutter habe von Hitler sogar einmal im Theater einen Handkuss bekommen. In der Wohnung der alten Frau hängen Familienfotos und Fotos von Nazis. ...Ein Treffen von Neonazis. Eine "Judenzeitung" wird gezeigt; es wird kritisiert: "Laufend
geht's um Gaskammern." Gespräche über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien, in dem einige Neonazis als Freiwillige gekämpft haben. Ein französischer Freiwilliger spricht über seine Beteiligung am Jugoslawienkrieg (französischer Originalton ohne UT). Ein Kind reinigt und lädt ein Gewehr. Althans hält eine Rede über den Krieg in Kroatien. ...Althans spricht über Geldspenden an seine Organisation. Die höchste Spende, die er je bekommen hat, waren DM 25.000,- "Überall, wo die Jugend um Hilfe ruft, da gehe ich dann hin und sammle sie ein. Und dann mach ich anständige Nationalsozialisten aus ihnen, wie sich das gehört." Althans hält eine Rede über Nationalsozialismus. Er kritisiert die aktuelle Gesellschaft und stellt einen Kontrast zu den Neonazis her: "Ihr seid die Besten in Deutschland". Er rechnet damit, dass seine Bewegung die Gesellschaft in Zukunft do- minieren wird. - Begegnung in Israel (D/1995) Schüler und Studenten aus Leer, Ostfriesland, besuchen noch lebende Leeraner Juden, bzw. Nachkommen Getöteter in Israel. Im Sinne eines Zitats von Ministerpräsi- dent Rau "Deutsche und Israelis sind darauf an-gewiesen, dass wir täglich neue Brücken bauen, damit gegenseitiges Vertrauen und neue Hoffnung entstehen können", schildert der Film diesen Besuch an verschiedenen Orten in Israel und jüdisch-deutschen Gedan- kenaustausch in langen Gesprächen. - Zehn Brüder sind wir gewesen (BRD/1995) Der Weg der Juden in die Vernichtungslager des NS-Staates - Reisen ins Leben Weiterleben nach einer Kindheit in Auschwitz (BRD/1996) Ein Kameramann der US-Army erinnert sich an seine Aufnahmen bei der Befreiung der Lager und in den Displaced Person Camps. Er spricht über die Archivbilder, seine Gedanken und Gefühle von damals und heute. Eine Viertelmillion Überlebender des Holocausts wartete im Nachkriegsdeutschland, wieder in Lagern, Displaced Person Camps, dass ein anderes Land sie aufnahm. Der Weg nach Palästina, das heutige Israel, war versperrt. Zehntausende versuchten es illegal. Es dauerte ein Jahrzehnt, bis alle eine neue Heimat fanden. Von ihrer Reise ins Leben berichten Gerhard Durlacher aus den Niederlanden, Yehuda Bacon aus Israel und Ruth Klüger aus den USA. Sie setzen uns in Kenntnis, wie die Gesellschaften, in denen sie heute leben, sie weiter ausgrenzten. Wohin sie auch kamen, Politik und Menschen gingen über ihre Erfahrungen und ihr Wissen hinweg. Wegbegleiter bleiben die Erinnerungen. ..Historische Farbaufnahmen: Markierung und Tätowierung Gefangener. Häftlinge in Großaufnahme. Die U.S. Army zwingt Bürger aus Weimar, sich im ehemaligen KZ medizinische Präparate etc. anzusehen. ...Historische Farbaufnahmen: Stacheldraht, Häftlinge (tragen Häftlingskleidung und Zivilkleidung gemischt). Kranke werden in einen Krankenwagen geladen. Lange Reihen von Gräbern mit Kreuzen oder Davidssternen. ...Schwarzweiß: KZ Dachau, Häftlinge werden über ihre Zukunftspläne gefragt. Ein Häftling spricht über die vielen KZs und über seine unsichere Zukunft (englischer Originalton). Ein geschmückter Zug fährt von Buchenwald nach Paris. Ehemalige Häftlinge fahren in ein DP-Lager. ...Historische Farbaufnahmen: Leichen. Schwarzweiß: Menschen in einem DP-Camp stehen in einer langen Schlange. Schlafsaal mit einfachen Doppelstockbetten. Frauen beim Kartoffelschälen. ...Yehuda Bacon, geboren 1929 in Ostrava, lebt heute in Jerusalem. Er war 13 als er nach Theresienstadt kam, 14 als er nach Auschwitz kam,16 als er nach Jerusalem ging. Die Aufnahmen Yehuda Bacons wechseln sich mit Aufnahmen einer Autofahrt durch eine Wüste in Israel ab. Menschen mit Werkzeug gehen durch ein Tor mit der hebräischen Aufschrift "Baruchim haBaim". Kibbutz in den Alpen, organisiert von der Flüchtlingsorganisation UNRA. Die Flüchtlinge lernen Englisch und Hebräisch. Illegale Einwanderung nach Israel. Erschöpft wirkende Menschen überqueren die verschneiten Alpen auf dem Weg nach Italien. Ein Schiff mit illegalen Einwanderern nach Israel wird geentert. Internierungslager in Zypern. Bacon erzählt vom Unabhängigkeitskrieg und von seinem Studium. ...Zeichnungen über das KZ. Kinder im KZ bedeuteten wohl auch für die Wächter eine positive Assoziation. Die SS-Männer kamen gerne im Kinderblock vorbei, aber wie die
anderen Insassen des Familienlagers wurden auch die Kinder nach 6 Monaten ver- gast. Kinder sprechen über den Tod; verabschieden sich von der Gruppe, die vor ihnen dort ist. Kontakt zum Sonderkommando. So erfährt Bacon, dass sein Onkel umkam. Das Sonderkommando erlaubt den Kindern, sich in den Gaskammern auf- zuwärmen. Todesmarsch: Der Zeitzeuge beobachtet durch das Fenster normales Familienleben. Als Zeuge beim Auschwitz-Prozess in Frankfurt a. M. 1964. ..Seargeant Mayflower erinnert sich an Ohrdruf. Historische Farbaufnahmen ame- rikanischer Soldaten. Mayflower spricht über seine Tätigkeit als Kriegsreporter. ...Französische Kriegsgefangene zu Fuß auf dem Heimweg. Sie überqueren eine zerstörte Eisenbahnschiene. Deutsche Flüchtlinge (zu Fuß, mit Pferdewagen, im Zug, auf Lastwagen). ...Forderungen der Bevölkerung und Entscheidung der Lokalregierung, den jüdischen DPs keinen Wohnraum zuzuweisen. Kielce-Pogrom (Polen). Juden wandern aus. Jüdische DP-Lager in Deutschland, z.B. Landsberg. Aufnahme jüdischer Flüchtlinge durch die USA. Menschen gehen an Bord eines Schiffes. Ankunft in New York, stürmische Begrüßung durch dort Wartende. ...Ruth Klüger, geboren 1931 in Wien, lebt heute in Irvine, Kalifornien. Sie war 11, als sie nach Theresienstadt kam,12 als sie nach Auschwitz kam, 16 als sie nach New York ging. Ruth Klüger spricht über ihre Vergangenheit: Kindheit in Wien, Zeit in Auschwitz, Groß-Rosen, Flucht, Anschluss an einen Flüchtlingstreck nach Straubing. Enge in einer Scheune gegen Kriegsende löst die Entscheidung zur Flucht aus. Ruth Klüger beobachtet nach ihrer Flucht einen Todesmarsch. Verhältnis zur nichtjüdischen Umwelt. Angst vor Verrätern, Vorsicht, KZ-Nummer wird nicht gezeigt. Kontakt mit den Amerikanern. Man glaubt ihnen zunächst nicht, dass sie im KZ waren. Wichtigkeit der eigenen Wohnung. Warten auf die Emigration. Einerseits Verbundenheit mit der deutschen Sprache und Kultur, andererseits Ablehnung des Umgangs mit der Ver- gangenheit (Reaktionen auf die Nürnberger Prozesse). Ihre Gedichte über die Vergangenheit werden abgelehnt. Depressionen. Finanzielle Schwierigkeiten. Leben in den USA. Damals lehnte man Gespräche über den Holocaust ab. Reaktionen der Umwelt: Mitleid oder Feindseligkeit. Forderung nach Entfernung der KZ-Nummer. ...Kasernen von Ohrdruf auf dem Gelände des ehemaligen KZs. Sergeant Mayflower erinnert sich. Englischer Originalton, dazu historische Aufnahmen von der Befreiung des Lagers: Soldaten, Leichen, Foltergeräte, Bewohner der Stadt kommen in einem Lastwagen an und müssen sich das Lager ansehen ...Fortsetzung Interview Ruth Klüger, die über die gezeigten Bilder spricht. - Dachau (BRD/1998) Dokumentation über die Stadt Dachau. Verein Jugendgedenkstätte setzt sich mit der Geschichte auseinander - Umgang mit der Geschichte des KZ - Berlin Babylon – Jüdisches Museum (1999, Fertig aber leer) Deutschlandspiegel 537/1999 bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ... Bericht über die europäische Begegnungsstätte für Jugendliche in Kreisau (Krzyowa) in Polen, die gleichzeitig Gedenkstätte des "Kreisauer Kreises" ist und einen Besuch des ehemaligen Konzentrationslagers in Groß-Rosen. Auf dem Gelände des ehema- ligen Konzentrationslagers Groß-Rosen: Eingangstor, Lagerzäune mit Stacheldraht, Block-Gedenksteine, Baracke. - Deutschlandspiegel 537 /1999) bitte recherchieren Sie online in der Filmothek ...Bericht über die europäische Begegnungsstätte für Jugendliche in Kreisau (Krzyowa) in Polen, die gleichzeitig Gedenkstätte des "Kreisauer Kreises" ist. Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Groß-Rosen: Eingangstor, Lagerzäune mit Stacheldraht, Block-Gedenksteine, Baracke. - Dieses Jahr in Czernowitz (BRD/2003) Die im letzten Jahrhundert aus der Bukowina geflüchteten Juden haben Exil in vielen Teilen der Welt gefunden. Mit einigen dieser Emigranten und ihren Kindern kehrt der Film dorthin zurück. Der Cellist Eduard Weissmann aus Berlin, aus Wien kommen die Schwestern Evelyne Mayer und Katja Rainer, aus New York der Schauspieler Harvey Keitel und der Schriftsteller Norman Manea. Die Fahrt zu den mythischen
Orten ihrer Herkunft führt sie nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Gegenwart, zu heutigen Czernowitzern, der ukrainischen Studentin Tanja und dem beinahe 90-jährigen Deutschen Johann Schlamp. - Zeitabschnitte des Werner Bob [sic!!] (BDR/2005) Werner Bab wurde am 2. Oktober 1924 in Oberhausen geboren und lebte ab 1929 in Berlin. Durch die Folgewirkung der Nürnberger Rassengesetze von 1935 und weiteren einschränkenden Gesetzen war für ihn als deutscher Jude ein Besuch der öffentlichen Schulen nicht mehr möglich, so dass er gezwungen war - über einen Zwischenaufenthalt in Scheidemühl- ein Internat für jüdische Kinder in Stettin zu besuchen. Durch die Verhaftung sämtlicher Lehrer und anschließender Schließung der Schule nach der "Reichskristallnacht" im November 1938 kehrte Werner Bab nach Berlin zurück. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch im Jahr 1942 - um der drohenden Deportation zu entgehen - und einer Verhaftung durch die Gestapo an der Schweizer Grenze, folgte in den folgenden Monaten die Überstellung in das Konzentrationslager Auschwitz. Nur die wenigsten jüdischen Bürger konnten die Auswirkungen der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft, die von Zwangsarbeit, Verlust der familiären Bindung, Deportation und letztendlich Vernichtung geprägt waren, überleben. Auschwitz war, wenn überhaupt, nur im Einzelfall zu überleben. Obwohl schon für die "Sonderbehandlung", die Vernichtung durch Gas, selektiert, überlebte Werner Bab. Dieser Film gewährt Einblicke in die Lebensumstände jüdischer Bürger ab dem Beginn des 2. Weltkrieges und das Alltagsleben in den Konzentrationslagern, insbesondere im Stammlager Auschwitz, Mauthausen und Ebensee. - Leben ohne Hass (2008) Der Film schildert den außergewöhnlichen Lebensweg des Regisseurs Imo Moszkowicz. Er gehört zu den erfolgreichsten Theater- und Filmregisseuren Deutschland, war einer der "Männer der ersten Stunde" des Deutschen Fernsehens. Dass er ein Überlebender des Holocaust ist, wissen damals die wenigsten. 1925 als Sohn einer armen jüdischen Familie in Ahlen/Westfalen geboren, hat er als einziger seiner Familie Verfolgungen, Vertreibung und Vernichtung überlebt. Er gehört zu den wenigen, die das KZ Auschwitz und den berüchtigten "Todesmarsch" überstanden. Trotz schrecklichster Degradierun- gen im Terrorstaat der Nazis blieb Imo Moszkowicz in Deutschland. In den 50er Jahren lernte er das Regiehandwerk bei Gustaf Gründgens und Fritz Kortner. Ohne Jahreszahl - Dialogproben: Die jüdische Frau (AvT) - Fernsehaufzeichnung "Blick ins Land - Das Gedenkbuch der jüdischen Opfer in Deutschland von 1933-1945" - Judenverfolgung im 3. Reich - Der Prozeß Düsseldorfer KZ-Prozeß (Majdanek), 1975-1981 - Reisen ins Leben Weiterleben nach einer Kindheit in Auschwitz Ruth Kluger Spielfilme - Der Golem (1914) - Die Jüdin von Toledo (1919) Der König hält Einzug, aber für Juden ist der Schloßgarten verboten. Die schöne Rahel geht dennoch hin, will vom König gesehen werden. Vater und Schwester folgen in Angst und Schrecken. Sie werden verhaftet. Der König schenkt ihnen die Freiheit. Sie dürfen im Gartenhaus verweilen, bis sich der Zorn des Volkes gelegt hat. Der König besucht Rahel und ist verliebt. Der alte Jude und seine Töchter bleiben bei
Hofe, er macht Geschäfte und der König amüsiert sich mit Rahel, sie sind glücklich. Das Volk ist aufgebracht. Der Mord an Rahel wird geplant. Der alte Jude versteckt voll Habgier sein Gold im Keller. Der König kommt zu spät, Rahel ist tot. Als er still von ihr Abschied nimmt, wird ihm der "böse Zauber bewußt", er kehrt zu Frau und Kind zurück. Der alte Jude kehrt nicht eher vom Ort des Schreckens zurück, ehe er sein verstecktes Gold geholt hat. - Der Golem, wie er in die Welt kam (1920) Im 16. Jahrhundert: Rabbi Loew, geistlicher Führer der jüdischen Gemeinschaft in Prag, ein Magier und Meister der schwarzen Kunst, haucht einer Lehmstatue Leben ein. Der Koloss rettet dem Kaiser das Leben, worauf dieser ein Dekret widerruft, das die Vertreibung der Juden aus Prag verordnet. Als sich der Golem infolge einer ver- hängnisvollen Konstellation der Gestirne gegen seinen Schöpfer auflehnt, bricht ein kleines Mädchen seine Lebenskraft. - Die Gezeichneten (1921) Ein junger Rechtsanwalt, Sohn einer jüdischen Familie, wird dem Glauben seiner Väter untreu und büßt seine Schuld bei einem Pogrom mit dem Tode. Seine Schwester, welche durch die Schurkerei eines Christen aus ihrer Bahn geworfen worden, ist ihrem Volke treu geblieben und wird von dem Geliebten gerettet. Der Kampf der beiden Rassen bildet den Hintergrund der Geschehnisse. (Paimanns Filmlisten) ...Kleinstadt am Dnepr um die Jahrhundertwende. Hanna aus dem Judenviertel wird auf Grund von Verleumdungen von der Schule verwiesen. Nach Ausschlagen einer den jüdischen Traditionen entsprechend vermittelten Ehe, geht sie nach Petersburg. Ihr dort lebender Bruder konvertierte aus Karrieregründen. Sie hat Kontakt mit der politischen Opposition. Politische und persönliche Verwicklungen enden in einem Pogrom. - Jeremias (1922) Eine historische Rekonstruktion, behandelt die Belagerung Jerusalems durch Nebu- kadnezar, den Friedensschluß des Königs der Juden und dessen Bruch mit darauf- folgender Einnahme und der Zerstörung der Stadt durch die Perser. - Das alte Gesetz, 1923 (Een Jude) (Tschechische Zwischentitel) - Der Kaufmann von Venedig (1923) Der Jude Shylock wird von den Venezianern auf der einen Seite verhöhnt und gehetzt, während er auf der anderen Seite für gut genug befunden wird, Geld zu verleihen. Durch den jungen Bassiano, der in die reiche Porzia verliebt ist, wird der Kaufmann Antonio in eine Intrige verwickelt und ist genötigt von Shylock Geld zu leihen. Am Ende wird Shylock, der sein verliehenes Geld zurückfordert, vor Gericht gestellt. - Jüdisches Glück (SU/1925) - Idl mit’n Fidl (Judel Grana Skrzpkach) (Spielfilm/Polen/1933) - The Wandering Jew (1933) - Jud Süss (1940) Jud Süß ist ein deutscher Spielfilm von Veit Harlan aus dem Jahr 1940. Das von den Nationalsozialisten in Auftrag gegebene und als antisemitischer Propagandafilm konzipierte Werk ist scheinbar an die historische Figur des Joseph Süß Oppenheimer (1698-1738) angelehnt; die Erzählung entspricht jedoch nicht den überlieferten Quellen, die im Landesarchiv Baden-Württemberg verwaltet werden. Mittels der gezielt negativen Darstellung Oppenheimers sollte der Film das Judentum allge- mein diskreditieren und den zeitgenössischen Zuschauer auf weitergehende Verfolgungen der Juden vorbereiten. Protagonist des Films ist Joseph Süß Oppenheimer, ein jüdischer Finanzbeamter, der wohl im Februar 1698 in Heidelberg geboren und am 4. Februar 1738 in Stuttgart hingerichtet wurde. Süß Oppenheimer wurde 1733 Geheimer Finanzrat unter Herzog
Karl Alexander von Württemberg. ...Oppenheimer, der im Film deutlich mephistophelische Züge trägt, erlangt durch Zuwendungen die Gunst des Herzogs und überredet diesen zu immer weiterer Untreue gegenüber seinem Volk zu Gunsten seines eigenen luxuriösen Hofstaates. Zur Rückzahlung der angehäuften Schulden erhält Oppenheimer zunächst das Recht, Straßenzoll zu erheben. Diesen führt er ohne Zustimmung der Stände ein. Die Oppo- sition gegen den Herzog konzentriert sich deshalb auf Joseph Süß Oppenheimer, dem Verfassungsbruch und persönliche Bereicherung im Amt vorgeworfen werden. Oppenheimer treibt den Herzog zum Widerstand gegen die Stände an. Er rät ihm zur gewaltsamen Niederschlagung der drohenden Revolution. Oppenheimer ver- sucht immer wieder, sich der als "arisch" bezeichneten Dorothea zu bemächtigen. Während ihr Mann, der zu den Gegnern des Herzogs gehört, im Auftrag von Oppenheimer gefoltert wird, vergewaltigt Oppenheimer Dorothea. Sie begeht daraufhin Suizid. Ihr Ehemann birgt ihren Leichnam aus dem Fluss. Es kommt zum Aufstand. Nach dem plötzlichen Tod des Herzogs wird Oppenheimer verhaftet. Er wird wegen des Geschlechtsverkehrs mit einer Christin zum Tode verurteilt. Am Schluss des Films wird der um sein Leben bettelnde Oppenheimer gehängt. - Die Rothschilds (1940) - Wien 1910 (1942) - Das siebte Kreuz (1944) - Morituri (D-West/1948) Die Flucht einer Gruppe von KZ-Häftlingen wird mit den Schicksalen jüdischer und polnischer Familien verknüpft, die der Gestapo entkommen konnten und in einem Waldversteck das Herannahen der sowjetischen Truppen erwarten. - Sterne (DDR/1959) Bulgarien 1943. In einer von deutschen Faschisten besetzten Provinzstadt werden griechische Juden gefangen gehalten, die in ein Konzentrationslager überführt werden sollen. Hier begegnet dem Unteroffizier Walter die junge Jüdin Ruth, die ihn um Hilfe für eine gebärende Frau bittet. Zwischen ihnen wächst eine Liebe, die arm an Freuden und reich an menschlichem Leid ist. Walter will das Mädchen retten und kommt da- durch in Kontakt mit bulgarischen Partisanen, die ihn für sich gewinnen wollen. Doch Walter lehnt ab. Erst als er Ruth für immer verliert - die Juden werden in ein deutsches Konzentrationslager abtransportiert - ist er bereit, die Partisanen gegen den Faschismus zu unterstützen. - Leute mit Flügeln (DDR/1960) Bartuscheck, Bordmechaniker in den "Sperberwerken", ist Kommunist. Nach 1933 arbeitet er zuerst illegal, geht dann nach Spanien und kämpft als Kommissar in den Internationalen Brigaden. Seine Frau wird in ein KZ verschleppt, sein Sohn wächst bei sozialdemokratischen Freunden auf. In Spanien trifft Bartuscheck auf seinen ehemaligen Chef, Dr. Dehringer. Der hilft den Faschisten und glaubt, unpolitisch zu sein. 1944 kehrt Bartuscheck, als Franzose getarnt, in die "Sperberwerke" zurück. Er kommt zusammen mit einer Gruppe französischer Fremdarbeiter ins KZ. 1945 Trifft er seinen Sohn wieder. Henne kann seinen Traum, Flugingenieur zu werden, verwirklichen. Es gibt aber viele ideologische Differenzen zwischen Vater und Sohn. Als die erste Maschine des Werkes endlich aufsteigt, gebaut ohne die Hilfe von Leuten wie Dehringer, begreift der Sohn, wofür sein Vater gekämpft hat. Aufnahmeort u.a. Konzentrationslager Buchenwald - Professor Mamlock (DDR/1961) Tragischer Held ist der Chirurg und Chefarzt einer Klinik, Hans Mamlock. Ein national- liberaler deutscher Großbürger, der sich nicht vorstellen kann, von den Faschisten in die Enge getrieben zu werden. Doch er ist Jude und als Hitler an die Macht kommt, rücken seine Kollegen von ihm ab. Seine Tochter wird gedemütigt, er selbst aus der Klinik gejagt. Sein einziger Ausweg ist der Selbstmord. - Das zweite Gleis (DDR/1961/62) Der von allen geschätzte Bahnbeamte Richard Brock überrascht Diebe bei einem Güterwageneinbruch. In einem der Täter erkennt er den Rangierer Runge, der Mit-
wisser einer Schuld ist, die Brock während des Krieges auf sich geladen hat. Als er einem KZ-Häftling zur Flucht verhelfen sollte, liess er sich von Runge einschüchtern und lieferte durch sein feiges Verhalten die eigene Frau der Gestapo in die Hände. Sie kommt ums Leben. Auch jetzt kann er sich nicht entschliessen zu sprechen. So kann Runge ihn weiter erpressen. Er schickt den jungen Schlosser Frank Reissner, den er zum Diebstahl verleitete, als Mittelsmann zu Brock. Frank hat vorher erfahren, dass Brock unter falschem Namen lebt. Mit dessen Tochter Vera, der der Vater auch nicht die Wahrheit gesagt hat, stellt er Nachforschungen an. Sie erfahren dabei Brocks Vergangenheit und stellen fest, dass Runge ein Mörder ist. Frank trennt sich von ihm und wird kurz darauf ermordet. Nun muss Brock sprechen... - Angst (DDR/1982) Ein Junge freundet sich mit einem jüdischen Mädchen an. Mittels eines Telefons sind sie von Wohnung zu Wohnung verbunden. Damit erhält der Junge auch ein Zeichen, als SA-Schläger die Familie des Mädchens überfallen. Es gelingt ihm, das gefährdete Mädchen aus der Wohnung zu holen und nachts mit dem Fahrrad zu einer Deckadresse zu bringen. Als er ihr am nächsten Morgen eine Puppe, die er in der verwüsteten Wohnung gefunden hat, geben will, wird bei dieser Adresse ihre Anwesenheit geleugnet. - Rechtsfindung (DDR/SU/1985) Das Geschäft des jüdischen Juweliers Arndt wurde ausgeraubt. Die Täter: SA-Leute. Ein Kriminalfall. Kein gewöhnlicher, geshalb ist die Rechtsfindung sehr kompliziert, denn keiner der Interessenten im Hintergrund darf genannt werden, auch nicht die Akteure der Sturmabteilung. Der Jude Arndt selber? Er wird aus finanziellen Gründen von einigen Herren noch dringend gebraucht. Der Amtsrichter hat Angst ums Dasein und die Position. Er ist hilflos. (Marionetten/Real) Wenn Ärzte töten (BRD/2009) Im Dokumentarfilm "Wenn Ärzte töten" beschreibt der Psychiater Robert Jay Lifton, wie aus "normalen" Menschen, in diesem Fall Ärzten, Mörder werden können. Ange- regt durch Dokumente des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, begann der amerika- nische Wissenschaftler seine Forschung über die Verstrickung der Medizin in den Holocaust und andere politischen Gewaltakte. Lifton beschränkt sich dabei nicht nur auf die Betrachtung der historischen Hintergründe, sondern wirft auch die Frage nach Ethik und Moral in der modernen Medizin auf. In ausführlichen Interviews wird so versucht, Erklärungen für das Unfassbare zu finden.
Nicht in BMO - Unter unbekannten Kannibalen (1923/24) n.b./Ni/U Ein Film von Frank Hurleys zwei Expeditionen nach Papua Neu Guinea 1923/24. "With the headhunters of Unknown Papua" - Für den Auslandseinsatz wurde wieder der ursprüngliche Titel "Pearls and Savages/Perlen und Wilde" gewählt. (1925) OL: 1893 m ...ZT: Zu unserem unbeschreiblichen Erstaunen stellten wir fest, daß dieser neue Stamm einen bemerkenswerten hebräischen Einschlag hatte. Nahaufnahme von einem männlichen Eingeborenen. ...ZT: Achten sie auf die semitischen Züge und die königliche Würde des Häuptlings. Aufnahme des Häuptlings und seines Sohnes (R.4) - The Nazi Plan (nur Szene Judenboykott und Bücherverbrennung (1933) M 1258 ... Goebbels spricht auf Massenkundgebung zum Judenboykott im Berliner (kassiert!) Lustgarten (O-Ton): „Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen! Heute morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunden fortgesetzt. Er vollzieht Sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imoponierenden Mannes- Zucht und Disziplin. ...“. ... Judenboykott am 1.4.1933. Lastwagen mit SA-Männern, die Hakenkreuzfahnen schwenken und Hitlergruß zeigen, fährt langsam durch Straße; Hakenkreuz auf Kühlerhaube. Boykottschilder am Auto. Schaufensterbeschriftung, Boykottplakat, Judenstern an Schaufenster. SA-Angehöriger malt Judenstern auf Schaufenster. Fußgänger passieren. Laienhaft gemaltes Plakat mit Totenkopf. Eingangstür eines Cafés mit Totenkopfplakat. Zivilisten stehen vor Café. Drei Menschen stehen vor Schaufenster mit großem Davidstern; SA-Boykottwachen und Zivilisten vor Schuhgeschäft. Schild . SA- Männer beim Kleben von Boykott-Plakaten; SA-Wachposten vor Drogerieladen, zeigt Hitler-Gruß. Zwei Boykottposten mit Boykottschild vor Haus. Menschenmenge auf Geschäftsstraße. Boykottschild an Schuhgeschäft; SA-Boykottposten; SA auf Lastwagen. ...Goebbel (im hellen Mantel) spricht bei der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin (1.5.1933): „Meine Kommilitonen! Deutsche Männer und Frauen! Das Zeitalter des überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende und der Durchbruch der deutschen Revolution hat auf dem deutschen Weg wieder die Gasse freigemacht. ...“ - Darré spricht über faschistische Landwirtschaftspolitik (AvT)(ca. 1935) → ist das Darré spricht über Stadt und Land (1932)? - Das Judenviertel in Krakau (1936) n.b. - Brand der Synagoge von Bühl am 10. November 1938 (AvT) n.b./VHS/U ... Brennende Synagoge, Flammen im Innern, aus den Fenstern schlagend. Aus dem Dach dringende Rauchschwaden. Feuerwehrleute und Zuschauer auf dem Platz vor der Synagoge (diese nicht im Bild). Ein Feuerwehrmann mit Hakenkreuzaufnäher am Ärmel. Ausgebrannte Synagoge, qualmendes Dach, Flammen in den Fensterhöhlen; schwelendes Dach der Synagoge. (archivinterne Ansichtskassette) - Aktualita (1938/44) n.b./U - Ein Tag – Bericht aus einem deutschen Konzentrationslager 1939 n.b. - Fox Tönende Wochenschau 13/37/1939 n.b. ... Polenfeldzug: Deutsche Soldaten rücken in ein brennendes Dorf ein. Polnische Zivilisten, die sich angeblich am Bromberger Blutsonntag beteiligt haben, stehen mit erhobenen Armen an einer Häuserwand, bewacht von deutschen Soldaten. Einzelne Zivilisten werden mit erhobenen Armen abgeführt. Kommentar: "Polnische Juden, die sich in vielen Fällen der Aufhetzung und Anstiftung zum Mord an Deut- schen schuldig gemacht haben." Eine Gruppe von Zivilisten (alles Männer) werden abgeführt. Juden in Großaufnahme. Kommentar: "Heute sitzen die Brüder und Söhne dieser Ostjuden in England und Frankreich und hetzen zum Vernichtungs-
krieg gegen das deutsche Volk." Polnische Zivilisten kommen in ein Internierungslager. - Fox Tönende Wochenschau 13/42/1939 n.b. ...Warschau: Zerstörungen. Umgestürzte Straßenbahnwagen. Kommentarton "Bei den Aufräumungsarbeiten müssen auch die Juden mit anpacken. Es wird ihnen keine Gelegenheit gegeben, aus der Not der Anderen durch Gaunerei und Geschäfte- macherei noch Nutzen zu ziehen." - The March of Time Vo. 5/1939 ... Emigranten aus Deutschland in Belgien und den Niederlanden. Judenverfolgung in Deutschland , z.T. nachgestellt. - Krieg 1939/40 n.b./Si/U ... (In Farbe:) Westerplatte, Graudenz und Rheden mit Kriegszerstörungen und Aufräu- mungsarbeiten. Straßenleben mit jüdischen Bürgern, die mit gelbem Fleck gekenn- zeichnet sind. (Mat. von Höffkes) - Exhumierung und Pogrom (1940) n.b./VHS Bilder vom Ostfeldzug: Dorf und Städtebilder aus der Etappe, insbesondere eine große Hafenstadt im Süden. ...In Reihen und Haufen liegende zahlreiche Frauen- und Männerleichen in dörflicher Umgebung, umherstehende und betrachtende Zivilisten und deutsche Soldaten; ein mit einem langen Knüppel prügelnder Mann und sein am Boden liegendes Opfer; ein blutig geprügelter am Boden sitzender Mann; flüchtende Zivilisten, u.a. eine mit Fußtritten traktierte Familie (Mann, Frau, junges Mädchen). Die Ereignisse werden in Jugoslawien, an der Adria lokalisiert, möglicherweise im Zusammenhang mit der Ermordung von mehreren tausend Einwohnern der Stadt Kragujevac durch die Besatzer am 21. Oktober 1941. - Ghetto Litzmannstadt (1941) n.b./Si/U Verlegung einer Luftwaffeneinheit von Mainz nach Litzmannstadt; Verladung der Fahrzeuge auf die Bahn; Verabschiedeung von den Angehörigen auf dem Bahnsteig; Eisenbahnfahrt nach Litzmannstadt. ...Schilder: "Ghetto Wehrm.-Angeh. Ist das Betreten verboten. Fleckfieber", Der Aelteste der Juden in Litzmann-stadt. Federn- u. Daunen Arbeits-Ressort" und "Wohngebiet der Juden. Betreten verboten" (mit Wachposten); Leben im Ghetto: jüdische Kinder auf der Straße; Gruppen von Juden mit Stern auf dem Rücken marschieren gegenläufig durch das Ghetto; Häuserfassaden im Ghetto. (44 m) Quelle: Sichtung HG. Voigt (Mat. von Höffkes) - Judenrat Theresienstadt (40er Jahre) - Brundibar n.b. - Chronik über die Befreiung des Lagers in Auschwitz (1945) n.b. (Deutsche Fassung des Filmes "Oswiecim" ("Auschwitz") Filmdokumente der deutschen Verbrechen in Auschwitz ...Befreite Häftlinge, viele von ihnen mit Gepäck, einige mit Schlitten, gehen neben einem Stacheldrahtzaun durch den Schnee. Sie tragen eine Mischung aus Häftlings- kleidung und Zivilkleidung. Häftlinge hinter Stacheldraht sehen in die Kamera. Namen von KZs werden genannt: Groß-Rosen, Buchenwald, Belsen, Dachau, Majdanek, Treblinka. Verschneite Baracken in Auschwitz. ...Chemische Fabrik in Oswiecim wird gezeigt. Zwangsarbeit von Häftlingen. Baracken in Auschwitz-Birkenau von oben. Lageplan Auschwitz. Plan für Krematorium I und II. Seitenansicht "Entwurf für das Krematorium". ...Lufnahmen der Holzbaracken von Auschwitz-Birkenau von einem erhöhten Stand- punkt aus. Weiterer Lageplan.Baracke von innen, mit Frauen darin.Tor "Arbeit macht frei". ...Doppelter Stacheldrahtzaun. Schild "6000 Volt Raum, Vorsicht, Lebensgefahr". Hochspannungsanlage für den Zaun. Weitere Bilder von Frauen in Baracke; Schilderung der Lebensumstände in Auschwitz. Namen einiger Frauen werden genannt. Privatfotos
von Opfern. Befreite Gefangene, mit Decken, hinter Stacheldraht. ...Leichenberge. Viele ehemalige Häftlinge gehen auf die Kamera zu. Es waren auch Familienangehörige der jugoslawischen Regierung in Auschwitz; im Bild u.a. zwei Frauen, die einen Brief lesen. Häftlinge gehen neben dem Stacheldrahtzaun entlang und plaudern mit zwei russischen Soldaten. Kranke Häftlinge auf Tragen bzw. an Krücken. Häftlinge werden mit Pferdewagen weggebracht. ...Russische Soldaten führen Kinder zwischen den beiden Stacheldraht-Absperrungen entlang. Hintergrundinformation zu medizinischen Versuchen von Dr. Mengele und Dr. Karl Schmidt, v.a. an Zwillingen. Einige der Kinder zeigen ihre Nummern. Luftaufnahme der Kinder zwischen den Stacheldrahtzäunen. ...Reste eines Feuers, darin ein Kopf unbestimmter Herkunft. Krematoriumsöfen. Tür mit Guckloch; Dosen mit Zyklon B; Gasmaske mit Aufschrift: "Einsatz für Zyklon - J". Kleine Holzschachtel mit div. Behältern für Chemikalien. Leichen. ..."Eine Sonderkommission untersucht die Verbrechen von Auschwitz." Männer an einem Konferenztisch. Massengrab mit verhungerten Häftlingen. Die sowjetische Kommission sieht sich das Massengrab an, dann die Baracken des Stammlagers sowie den Galgen. (Block 11, "Todesblock"). Ehemalige Häftlinge, noch in Häftlingskleidung, erklären die Funktionsweisie des Galgens. Sie werden vorgestellt und zeigen dabei ihre Nummern. Es sind Prof. André [Dimousin], Prof. Berthold Epstein (Prag), Prof. Fischer, sowie ein weiterer Professor. Die Professoren kommen aus unterschiedlichen europäischen Ländern. ...Frauenhaar, teilweise bereits in Säcke verpackt. Die Sowjets schneiden einen der Säcke auf und untersuchen den Inhalt. Künstliche Gebisse; Zahnarztzangen, Brillen, Kleidung, Babykleidung. Schuhe, Zahnbürsten, Rasierpinsel, Koffer mit Etiketten in diversen Sprachen. Massengrab; Zivilbevölkerung (die Frauen halten sich Tücher vor die Nase). ...Christliche Prozession; viele Russen im Publikum. Eine große Zahl an einfachen Holz- särgen wird nebeneinandere aufgestellt. Die Särge stehen um ein Massengrab herum. Dann sind die Särge im Grab; das Grab wird zugeschaufelt. ...Untersuchung kranker Ex-Häftlinge. Erfrorene Füße werden gezeigt. Kinderfotos aus Auschwitz (Fotoalbum). Schwer unerernährtes Kind. Ein Mädchen mit schweren Erfrie- rungen, das nicht gerettet werden konnte. Opfer von Sterilisationsversuchen (3 Männer). Andere Opfer medizinischer Versuche. Überlebender eines Kopfschusses mit neurolo- gischen Schäden. ...Fotos von SS-Männern in Uniform, von denen zwei namentlich vorgestellt werden: Obersturmführer Sell und der Lagerkommandant Baer. - Dokumentaraufnahmen über das ehemalige KZ Auschwitz (SU/Polen/1945) n.b. Dokumentaraufnahmen übe das Vernichtungslager Auschwitz, zusammengestellt aus sowjetischem und polnischem Archivmaterial. ...Lageplan/Karte Raum Warschau-Krakau Oswiecim. Außenlagerpositionen von Oswiecim/Auschwitz. Lageplan Auschwitz I ...Aufnahmen Lagertor "Arbeit macht frei" Stammlager I : Elektrische Anlage; Hochspan- nungszäune; Schwenk über die Häuser des Stammlagers ... Strafblock; Hausfront; Eingangstür, Inneres des Hauses; Arbeitszimmer eines SS- Offiziers,Formular Meldung Strafverfügung vom 9. Juni 1944. SS-Helm; Prügelbock, Strafmeldung für Frankel,David im Bild. Kamera führt in die Stehzellen-"Abteilung" Blick in eine Zelle ...Lageplan Kriegsgefangenenlager Auschwitz OS. Flugaufnahme über das Lager Auschwitz- Birkenau. Fotoaufnahme: Einfahrt Reichsbahn in's Haupttor. ...Schwenk über's Lager; Nahaufnahme einer Baracke; ehemal.Viehstallanlage; Inneres des Gebäudes, Bettgestelle ...Krematoriumsskizze; Grundriß Untergeschoß; Foto 2 SS-Offiziere lesen einen Lageplan/ Bauplan o.ä., ev. Aufbau einer Krematoriumsanlage; Häftlinge beim Ausschachten einer Krematoriumsanlage; Inneres des Baus; Ofenanlage; Blick in den Verbrennungsraum. Rolle 1 = 283 m ...Lageplan Werk Auschwitz; IG Farben Aktiengesellschaft, Zivilist und SS-Offizier Fotos; Gruppen im Werksgelände. ...Flug über die Werksanlagen (nach Befreiung) ...Inneres von Baracken; Bettgestelle; Drahtzäune mit Stromzuführer. Foto von Szenen am Bahnhof/Güterzug/Deportierte in Aufstellung. Männergruppen/Frauengruppen: Jüdische Deportierte, LkW's, Koffer im Hintergrund; ...Aufnahme von geplündertem Güterzug, der für den Transport nach Deutschland vorgesehen war; Foto: Berge von Gepäckstücken, Dt. Offiziere im Bild.
...Büchse "Zyklon B", Nahaufnahme vom Etikett; Berge leerer Büchsen "Zyklon B". Fahrauftrag zur Abholung fünf Tonnen "Desinfektionsmittel" 5. Januar 1943 nach Auschwitz. ...Fotos von Frauen mit Kindern, Sammellager von Deportierten. Fotoaufnahmen von Frauen, die nackt und im Gehen begriffen sind. Foto: Erschießungen. Fotoalbum, Blättern in demselben. ...Gesprengtes Krematorium; Mauerreste; Treppe zum Keller; Kameraschwenk zu den Baracken. Fotos von Verbrennungen im Freien; Reste von Scheiterhaufen (Menschenköpfe und Füße). Rolle 2 = 255 m ...Haus; Kofferladungen gestapelt davor; Baracke mit herausquellender Kleidung , Kameraschwenk von oben auf die Kleidermassen, Schuhberg aufgehäuft an der Barackeninnenwand. Ortho- pädische Gehhilfen, Brillen en masse, Bürsten. Kammer mit Haarbergen. ...Häftlingszahnstation, Formulare über freigegebenes Gold etc. (17.05.42) nach "Einäscherung der freigegebenen Leiche". Gebisse, Zahnzangen usw. Werkzeuge ...Kinder- und Babywäsche, Klappern, Nuckel ...ein geöffnetes Massengrab, exhumierte Leichen z.B. Fötus mit Nabelschnur u. Gebärmutter. ...Erfrorene, im Schnee liegend, befreite Häftlinge , am Zaun stehend, Blick in die Kamera. ...medizinische Untersuchungskommission, Patient auf einer Liege sitzend, Arzt untersucht seinen Körper. ...Fotoalbum mit Kinderfotos, Kinder auf dem Krankenbett, Kinder werden der Untersuchungs- kommision vorgestellt. Erfrierungen etc. Kinder zeigen ihre Arme mit den Nummern in die Kamera. Ein 42 Jahre alter "Greis" erzählt. Ehemalige Häftlinge während der Aktion 'Verlage- rung in's Stammlager. Krankenstation' nach der Befreiung Jan.45. Leichen vor den Baracken. Rolle 3 = 262 m - Der 1.Mai im befreiten KZ Buchenwald (1945) n.b. (gefilmt durch den Sergeant in der1.Amerikanischen Armee, Samson B.Knoll) ...Aufmarsch der ehemaligen Häftlinge zum ehemaligen Appellplatz.Häftlingsbaracken. Gruppierungen mit Transparenten.Transparent mit Zeichnung im Bild und eines mit poln. und hebräischer Aufschrift..Schwenk entlang der Gruppierung, Lagerzaun im Hintergrund. Sichtbare Schneereste. Sanitätswagen fahren an den aufmarschierenden ehem. Häftlingen vorbei. Eine große Gruppe Menschen aus der Tschechoslowakei (Fahnenträger) mit Textiltransparenten geht auf den Appellplatz zu. Eine Musikkapelle spielt auf. Formieren auf dem Appellplatz zu einzelnen Blöcken. An den angetratenen , Gruppierungen der ehemaligen Häftlinge geht ein kleiner Zug von Kindern ? oder Jugendlichen ? vorbei (28,4 m) - Hamburg und KZ Buchenwald nach Kriegsende 1945 (Actualités françaises) (hat in MAVIS den Titel: Hamburg und KZ Leipzig-Thekla nach Kriegsende 1945) Flugzeugaufnahmen vom zerstörten Hamburg. Die Hafenanlagen mit ihren Gerüsten, zertrümmerte Dockanlagen. Die völlig zerstörten Lagerhäuser und Wohnviertel durch die alliierten Bomben. ...Bilder von einem Bahngleis bei Buchenwald mit Güterwagen, welche mit den Toten des KZ-Lagers Buchenwald beladen sind. Die abgebrannten Baracken des Lagers mit verkohlten Leichen. Die Drahtverhaue um das Lager, welche unter Strom standen, mit darin befindlichen Leichen. Alliierte Soldaten besichtigen mit ehemaligen Häftlingen die Trümmer des Lagers und lassen sich die Einrichtung erklären. [Bildinhalt]: Hamburg: Zerstörter Hamburger Hafen, Werft mit Dockanlagen, Kränen, Tanks. Frachtschiff im Hafen (Luftaufnahme, versch. kurze Einstellungen). Kriegsschäden im Hafenviertel (Lufaufnahme, zwei Einst.). Teil der zerbombten Innenstadt (Luftaufnahme). Wohngebiet mit erhaltenen Außenfassaden der ausgebrannten Häuser. Leipzig-Thekla: Güterwaggons auf Verladerampe in Dachau (Halbtotale). Blick durch offene Tür eines Viehwagens auf Leichen. KZ-Kleidung (z.T. einzeln, z.T. nah) (versch. kurze Einst.). Schwenk über den Innenraum eines offenen Viehwagens mit zusammengekrümmten Leichen, viele in KZ-Anzügen (halbnah). Schwenk von Waggon auf neben Gleisen liegende Leichen (versch. kurze Einst.). Fundament einer verbrannten KZ-Baracke in Leipzig-Thekla. Überlebender (K-Ton) demonstriert u.a. alliierten Soldaten Fluchtweg. Er klettert in Erdloch, duckt sich in Tunnelgang, zeigt in Fluchtrichtung (versch. kurze Einst.). Zwei Tote in KZ-Kleidung in engem Schacht sitzend (halbnah). Verkohlte Leichen an Stacheldrahtzaun (z.T. nah) (versch. kurze Einst.). Überlebender demonstriert alliierten Soldaten Fluchtweg: Er klettert über auf Stacheldrahtrolle liegendes Holzbrett und versucht, über Zaun zu
steigen. Verkohlte Leiche, im Stacheldrahtgestrüpp verfangen (halbnah). Verkohlte Leichen liegen an Stacheldrahtzaun (versch. kurze Einst.). - Kinodokumenty o swerstwach nemezko-faschistkich sacwatschikow (UdSSR/1945) n.b. Kurzinhalt: Leichen von Zivilisten und Kriegsgefangenen beiderlei Geschlechts, unter- schiedlichen Alters und unterschiedlicher Nationalität, die von nazideutschen Truppen während des Zweiten Weltkrieges erschossen oder zu Tode gefoltert worden sind in den Städten Rostow, Kaluga, Kertsch, Barwenkowo, Naltschik, Prochladnaja, in dem Dorf Sossino, in Pjatigorsk, Rossosch, Charkow, Rshew, Makejewka, Taganrog, Ossipenko, Kiew, Riga, Kremenez, Tallin. Eine Folterkammer der Gestapo, ein Galgen in der Stadt Kaluga. Aussage von Augenzeugen. Todeslager (Konzentrationlager) in der UdSSR und anderen Staaten. Die Lager Maidanek, Auschwitz, Oberwald und in den Städten Lublin, Danzig, Posen, Sonnenburg." Quelle: Annotation übersetzt aus d. Datenbank d. Russ. Staatsarchivs f. Film- u. Foto- dokumente (Krasnogorsk) (Gogolin 04.12.2004) Langinhalt: ...Bei Riga (18 km entfernt): KZ, offenes Massengrab, Besichtigung; Lager Stavrospila (?). ...Lagertor, Schilder "O.T. Betriebe Klooga"; "Halt! Es wird ohne Anruf geschossen!" (dasselbe lettisch und russisch); KZ seit September 1944; evakuiert am 19.09.1944; Scheiterhaufen mit Erschossenen, tlw. unverbrannt; Überlebender das Stapeln der Scheiterhaufen demonstrierend. ..Majdanek: KZ aus der Vogelschau; Exhumierung durch deutsche Kriegsgefangene; Leichen sowjetischer Kriegsgefangener; Totenschädel unter deutschem (!) Stahlhelm. Gaskammer; Zyklon B-Büchsen; Verbrennungsanlage; Verbrennungsöfen; Knochen- und Aschehaufen, Kohlfelder. Berg von Schuhen in e. Lagerhalle; gestapelte Kleidung (aus Majdanek, in der Wopan[?]-Str. in Lublin); Berge von Spielzeug, von Brillen, Ausweisen und Pässen. Befreite Häftlinge hinter Stacheldrahtzaun. ...Auschwitz: KZ aus der Vogelschau; Plan des Lagers, der Verbrennungsanlage; befreite Häftlinge in Barackeauf Pritschen; hinter Stacheldrahtzaun; Baracke, Tote; Häftlinge verlassendas Lager; befreite Kinder verlassen das Lager; Zyklon B-Büchsen; Gift- Injektionsampullen; Galgen, Funktionsweise von Überlebendem demonstriert; Grube voller Verhungerter; Frühgeburten (provozierte), auf dem Sektionstisch; Kleiderlager (vollgestopfte Baracke), Haufen von Schuhen, Bürsten, Zahnprothesen, Rasierpinseln, Brillen. - Das zerstörte Dresden nach dem Kriege (1950) n.b. ...Eine wiedererrrichtete Synagoge der jüdischen Gemeinde in Dresden mit Gedenktafel. - Elbsandstein-Gebirge (DDR/1952) n.b. ...Die Burg Hohenstein benutzte der Faschismus ab 1923 als KZ. Heute noch erzählen die Mauern von den tapferen Widerstandskämpfern. Eine große Gedenk- tafel für die Opfer des Faschismus (R.1) - Trautmann - Konvolut: 1952 Hausbau Niederham-Urlaubsszenen und Torfwerk Rott n.b./U ... Gruppe am Königssee; Gruppe der Familie geht an einer Hauswand/Ruine entlang. (Berchtesgaden). Groß im Bild ein eingekratzter Davidstern am zerstörten Gebäude am Obersalzberg - Kranzniederlegung für die Opfer des Faschismus im ehemaligen KZ Neuen Game (BRD/1950er Jahre) (ungeschnitten/Reste) n.b./Ni/U - Der Augenzeuge 20/1956 ... Weimar:Baustelle am Ettersberg für die Nationale Gedenkstätte der Opfer aus dem ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald.Teil derfertigen Mauer mit Gedenk- stelen für die einzelnen Länder - Dem Ende entgegen (BRD/1962) n.b./fa ...kurz skizziert, u.a. Judenverschleppung und Ausbeutung der besetzten Ostgebiete - Glauben und Leiden (BRD/1963) n.b. Der Film dokumentiert die Geschichte der Juden von Abraham bis in die Gegenwart. Mit einer Fülle von Material aus der Kunst- und Religionsgeschichte schildert er
1 1/2 Jahrtausende jüdischer Kultur, Glaubenshaltung und Glaubensverfolgung. Ein besonderes Gewicht wird dabei auf die Geschichte des Judentums in Europa sowie auf den Leidensweg der deutschen Juden gelegt, von der Aussonderung, Diskriminierung bis zur physischen Vernichtung. Die Leistungen deutscher Juden in Wissenschaft, Forschung und auf kulturellem Gebiet werden gewürdigt und das Ende der uralten Tradition des deutschen Judentums durch den Antisemitismus, dessen Ursprünge ebenfalls erläutert werden, beklagt. Der Film endet mit Worten Martin Bubers, die zu gottverbundener Humanität aufrufen. - So schön war es in Terezin (1964) n.b. Hier wurden historische Aufnahmen aus dem Proapagandafilm „Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ aus dem Jahre 1944 verwendet. Professor Karel Ancerl, heute Chefdirigent des tschechischen philharmonischen Orchesters, in den historischen Aufnahmen als Dirigent bei einem Konzert in Theresienstadt, schildert das wahre Leben zur damaligen Zeit, das im krassen Widerspruch zu den Aufnahmen stand. - Oswiecim (Polen/60er Jahre) n.b. Polnischer Amateurfilm über das KZ Auschwitz. ...Ankunft eines Transportes, die Rampe. Häftlinge entsteigen dem Waggon.Fotos von einer Selektion auf der Rampe. LKW steht bereit. Wartende Menschengruppe. ...Einblendung eines Dokumentes: R.F.SS-Sicherheitsdienst-Nachrichtenübermittlung vom 19.Juli 1942 Reichssicherheitshauptamt an Obersturmbannführer Eichmann/Berlin und an den KL-Kommandant Oranienburg und KL-Kommandant Auschwitz Betrifft: Judentransport aus Frankreich (R.1) ...unscharfes Foto: Häftlingsgruppe auf einer Rampe. Foto von Ausstellungsvitrinen. Plastik eines Zyklus "Häftlingsdasein"(?).Aufnahmen von aufgestapelten Büchsen 'Zyklon B'. Fahrauftrag für den ehemaligen Kraftfahrer zum Transport von 'Desinfektionsmittel'. Plastik mit Szenen aus dem Lagerleben der Häftlinge z.B. nachgebildetes Krematorium.Verschiedene Fotos und Dokumente aus dem Museum. Stoffe aus Haaren gewebt. Krematorium im Original.Foto von nackten Frauen. Foto: Beräumung von Leichen, Hintergrund die Schornsteine des tätigen Krematoriums. Kleiderhallen, Kofferberge, Gehhilfen, Bürstenberge, Pinselberge. Fotoalben werden nacheinander aufgeklappt. Babywäsche (R.2) ...Verschiedene Dokumente. Fotos:Waggon, Menschenmenge, Sammeltransport. Foto vom Stammlager Auschwitz: Hochspannungszaun, Lagertor "Arbeit macht frei“. Foto von der Ankunft der Häftlinge. SS-Männer entnehmen Wertsachen. Häftlingskleidung, Ausstellungstafeln zur Kennzeichnung der Gruppierungen (Häftlingsstatus). Liste der Nummerierungen der Häftlinge. Paßfotos von ehemaligen Häftlingen. Fotos von Gesichtern. Lagerzaun, Stromanlage. In einem Ausstellungsraum nachgestellte Eßge- schirrgruppe mit Brotlaib, Wurst und Butter als Ration eines Häftlings.Fotos von den Arbeiten im Steinbruch. Häftlingsgruppe betritt das Lager. Kranke werden abgeschleppt von den Kameraden. (R.3) ...der elektrische Lagerzaun, die Außenzaunanlage. Szenen vom Häftlingstransport. Baracken- inneres, Bettgestelle. Bunkergebäude im Stammlager Auschwitz. Arbeitszimmer des Lagerkommandanten. Strafverfügungsformular. Prügelbock. Foto von einer Prügelszene. Galgenanlage (kurz) (R.4) ...Gang durch den Strafbunker. Stehzelle. Häftling stehend vor einer Kommission. Große Zellen mit Gittertüren. SS-Bewacher. Kapo führt Häftlinge ab.Erschießungswand. Foto von einer Erschießungsszene. SS-Offizier danebenstehend. Außenzaunanlage, Wachturm. Grabgebinde und Trauersschleifen (R.5) - Der Jud von Eisenstadt (BRD/1969) n.b. Moritz Gabriel, einer der letzten Überlebenden des Ghettos von Eisenstadt, berichtet von seinem Schicksal. - KZ Dachau (BRD/1969) n.b./fa - Exodus 1970 – Juden im Ostblock n.b. - KZ Dachau (1970) n.b. - Charlotte Salomon (BRD/1972) n.b./fa
Notizen und Zeichnungen spiegeln die wechselvolle Geschichte des kurzen Lebens der Charlotte Salomon und lassen den Zeitgeist zwischen 1933 und 1943 und die Schrecken des Krieges und der Naziherrschaft nachempfinden. Charlotte Salomon kam 1943 im KZ Ausschwitz um. - Interviews mit ehemaligen Mitgliedern des Lagerkomitees des KZ Buchenwald (DDR/1974) n.b./fa - Unser Besuch in der DDR (DDR/1974) n.b. ... Die italienische Delegation besucht die DDR, u.a. :Weimar und das KZ Buchenwald - Berlin-Totale XIV. Stadtgeschichte, Denkmale und Denkmalspflege 2. Historische Straßen und Plätze d) Große Hamburger Str. (1978) ...Blick in die Hamburger Straße, Straßensituation. Das Gelände des ehemaligen ältesten jüdischen Friedhofs. Grabstein des Moses Mendelssohn mit hebräischer und deutscher Inschrift. Alte Grabtafeln in die Friedhofsmauer eingelassen, davor Reste von Grabtafeln dicht zusammengedrängt. An den Friedhof angrenzendes Wohnhaus, in dem sich die Wohnung von Herrn Friedrich Richter befindet. In der Wohnung von Herrn Richter, der schon über 50 Jahre hier wohnt. U.a. erinnert er sich an einen Vorfall, den er während des Faschismus von seinem Fenster mit Blick auf den Friedhof beobachtet hat. Hier befand sich ein Durchgangslager, von dem aus der weitere Transport ins KZ ging. Die Gefangenen mußten auf dem Friedhof Kar- toffeln einlagern. Als einer der Männer sich den Jackenkragen enger um den Hals legte, stürzte ein SS-Aufseher auf ihn zu und erschlug ihn mit einem Brett. Herr Richter erzählt aus seinem Leben, von seiner früheren Tätigkeit als - Erscheinungsform Mensch: Adolf Eichmann (1978/79) n.b./fa Die im Film auftretenden Personen werden nicht namentlich vorgestellt. Titel: Dieser Film ist kein Bericht über die Konzentrations- oder Vernichtungslager. Es ist der Versuch einer Annäherung an die verkörperte "Banalität des Bösen", an Adolf Eichmann. Auf der Anklagebank in Jerusalem saß ein Mensch aus Fleisch und Blut. Über ihn berichten Männer, die vor und während des Prozesses mit ihm zu tun hatten: Ärzte, Richter, Staatsanwälte, Polizeioffiziere. Über das, was Eich- mann mit Menschen gemacht hat, sprechen Überlebende aus Auschwitz. Was Eichmann zu sagen hatte, hören wir von ihm selbst. ...Eichmann erinnert sich mit eigenen Worten an seine Kindheit. ...Simon Wiesenthal spricht über die Suche nach Eichmann und über das Problem, ein aktuelles Foto von ihm zu beschaffen. Dies gelang dann mit Hilfe einer ehema- ligen Frauenbekanntschaft Eichmanns. ...Isser Harel (Mossad-Chef) spricht über die Suche nach Eichmann und über das Problem, mit dem Gefangenen unter einem Dach zu leben und ihn zu versorgen. Gespräche der Agenten mit Eichmann, der sie davon überzeugen wollte, dass er ein Freund der Juden sei. ...Ein Mann mit Bart und Brille (Avner W. Less) spricht über die Zeitungsmeldungen von Eichmanns Festnahme. Er wurde beauftragt, Eichmann zu verhören und stellt sein Team namentlich vor. ...Verhör Eichmanns: 275 Stunden Dauer, über 3.650 Seiten Protokoll. ...Der Arzt Eichmanns spricht. ...Details zum Ablauf der Verhöre. Eichmann stand vor den Beamten stramm. ...Tonaufnahmen und Foto Eichmanns. ...Eichmann erzählt seinen Lebenslauf, beginnend mit der Kindheit. ...Avner W. Less erzählt ebenfalls seinen Lebenslauf im selben Alter. ...Forsetzung Eichmanns Lebenslauf: Schulzeit. ...Fortsetzung Lebenslauf von Avner W. Less. ...Eichmann: Gruppenbildung in der Schule. ...Avner W. Less: Drohungen gegen Juden. Flucht nach Frankreich (keine Arbeits- erlaubnis). 1935 lernt Less seine Frau kennen. 1938 Auswanderung nach Israel. ...Eichmann (nun mit anderem Foto): Erste Kontakte zur NSDAP. Kaltenbrunner fordert Eichmann zum Beitritt auf. ...Avner W. Less spricht nun über Eichmann: ...1934 war dieser unter Sitz für die Freimaurer zuständig. Dann spezialisierte er sich auf die "Judenfrage".
...Eichmann spricht darüber, wie er vom "Führerbefehl" zur physischen Vernichtung der Juden erfuhr und diesen zwar erstaunt, aber kritiklos hinnahm. ...Ein jüdischer Zeitzeuge erzählt aus Warschau. Man erinnerte sich aus dem 1. Welt- krieg an die Deutschen als anständige Menschen. ...Avner W. Less hatte sich Eichmann ganz anders vorgestellt. ...Der Arzt: Eichmann war eigentlich kein "arischer Typ", sondern sah eher aus wie ein Jude aus Polen oder Russland. Aber er hatte "eiskalte Augen, wie aus Stahl". ...Foto: Eichmann wird untersucht. ...Personalbogen der SS über Eichmann. ...Isser Harel erzählt über das Problem mit dem Flugbenzin: Man war sich nicht sicher, ob es für Hin- und Rückflug nach Argentinien reichen würde. Eichmann kooperierte in allen Dingen bedingungslos, in der Hoffnung, so sein Leben zu retten. (R.1) ...Der diensthabende Offizier für Eichmann erzählt über ihn. Eichmann malte an Wie- hnachten ein Bild mit einem Haus, einem Tisch, eine Art Weihnachtsszene. Dann fing er an zu weinen, und das war das einzige Mal, dass er geweint hat. ...Eichmann gab selbst eine sehr ausführliche Erklärung ab. Er wollte ein Buch schrei- ben, die nächste Generation warnen, nicht seine Fehler zu machen, und sich am Ende selber hängen. ...Der Psychologe, der Eichmann untersuchte, spricht über dessen Lebensgeschichte. Eichmann sprach "frei und entspannt" über das Dritte Reich. Der Psychologe stellte eine starke Abkapselung Eichmanns von seiner Umwelt fest, die beinahe autistische Züge annahm. Auf die Frage des Psychologen, ob Eichmann wegen irgendetwas Gewissensbisse habe, antwortete dieser, dass er zwei Mal die Schule geschwänzt habe. ...Avner W. Less erzählt Eichmann davon, dass seine gesamte Familie in den Lagern umgekommen ist. Eichmann habe darauf mit ehrlichem Bedauern geantwortet: "Das ist ja furchtbar!" ...O-Ton Eichmann: "Ich habe nie einen Juden getötet. ..." ...Eichmann hat sich an der "Evakuierung" beteiligt und wird dafür büßen, war aber nicht selbst für die "handgreifliche" Evakuierung zuständig, sondern nur für die Logistik. ...1941 sprach Rademacher mit Eichmann über die Frage der "Evakuierung" von 12.000 Juden. Eichmann schlug Erschießen vor. ...O-Ton Eichmann über seine Besuche in Auschwitz. ...Über seine Tätigkeit: "Das ist eine Schlacht, die folgende Generationen nicht zu schlagen haben." ..Zwei Zionisten (ein Mann und eine Frau) sprechen über ihre Erinnerungen.Die Zeit- zeugin spricht über die Zustände im Ghetto. Der Zeitzeuge berichtet von einer Er- schießung. Die Zeitzeugin über die Deportation nach Auschwitz. Dort war eine andere Welt. Ihre Arbeit war "Häuser zerstören", also Abriss von Häusern ohne Schutzvor- kehrungen für die Arbeiter. ...Eichmann berichtet von einer Reise nach Minsk und Bialystok, wo er eine Erschie- ßung von Juden untersuchen sollte. Als er ankam, war die Erschießung schon fast beendet, worüber er "heilfroh" war. Während Eichmann spricht, werden Aufnahmen einer solchen Erschießung in einer Sandgrube gezeigt. ...Eichmann berichtet von einer anderen Reise. Er kritisierte, dass die Täter "zu Sadisten erzogen" werden. ...Eichmann berichtet von anderen Erschießungen. ...Avner W. Less: Eichmann wollte mit der Beschreibung dieser Szenen erreichen, dass man ihm auch dann glaubte, wenn er log. Das gelang ihm aber nicht. ...Wiesenthal zitiert Eichmann: "100 Tote sind eine Katastrophe, eine Million Tote eine Statistik." (R.2) ...Beim Eichmann-Prozess konnten Juden zum ersten Mal Gericht halten, und nicht einfach nur fliehen oder jemanden bestechen, wie früher. ...Ein Jugendlicher erinnert sich, dass er damals im Radio vom Eichmann-Prozess hörte. (Es gab zu der Zeit in Israel noch kein Fernsehen.) Foto vom Prozess. ...Ein Mann mutmaßt, warum Eichmann zur Gestapo ging. Am Anfang sei es wohl Opportunismus gewesen, am Ende Fanatismus. Für Eichmann habe es nur noch den Massenmord gegeben. "Ich weiß, der Krieg ist verloren, aber ich werde meinen Krieg noch gewinnen." ...Eichmann sorgte dafür, dass seine Todeszüge Priorität hatten, auch wenn der Krieg sich dadurch verzögerte. Er hinterging sogar Hitlers Befehle. ...Ein Zeitzeuge erzählt von der Ankunft in Auschwitz, der Selektion durch Dr. Mengele, wodurch er seine Familie verliert, der Tätowierung, etc.
...Eine Zeitzeugin: Hunger, Durst, Schläge, Erfrierungen, Krankheiten, Läuse. Arbeit trotz Typhus. Krankenrevier: Dr. Mengele führt eine Selektion durch. Es wird Fieber gemessen; er schreibt ihre Nummer auf. Sie denkt, dass es ihren Tod bedeutet - aber am nächsten Tag stellt sie fest, dass diejenigen, deren Nummern nicht notiert wurden, nicht mehr da sind. Bei Selektionen gab es immer diese Ungewissheit, welche Seite die richtige war. Schläge, vor allem wenn jemand versuchte, seine Würde zu bewahren. ...Eichmann spricht über Treblinka oder ein anderes Lager (genau weiß er es nicht mehr). "Aber das können Sie sicherlich feststellen."Auf der rechten Straßenseite war eine normale Unterkunft. Ein Hauptmann der Ordnungspolizei begrüßte ihn. Es gab dort zwei oder drei kleine Holzhäuschen. Eichmann bat um eine Erklärung. Das Haus konnte luftdicht ver- schlossen werden; die Abgase eines russischen U-Boot-Motors wurden ins Haus geleitet. Eichmann erklärt, dass er so etwas nicht gut vertragen kann, dass er auch kein Blut sehen kann und kein Arzt hätte werden können. ...Der Zionist erzählt von einem Bekannten aus dem Sonderkommando und von Wider- standsplänen. Die Zionistin erzählt, wie die Arbeiterinnen der Munitionsfabrik trotz stren- ger Sicherheitskontrollen jeden Tag etwas Pulver hinausschmuggelten. ...Zionist: Auschwitz war für die SS wie Urlaub. Dort mussten sie nicht an der Front kämpfen. ...Zionistin: Der Pulverschmuggel wird entdeckt. ...Zionist: Bunkerblock in Auschwitz. Der Kapo war Jude und hat mit den SS-Leuten immer Jiddisch gesprochen. ...Zionistin: Widerständler werden gefoltert, nennen aber keine weiteren Namen. ...ehrere Überlebende in einer Gesprächsrunde. Einer erklärt, dass er nicht über das Erlebte spricht. Mann mit Anzug und Krawatte: Völlige Trennung von Tätigkeit und Privatleben der Kommandanten. ...Andere Überlebende berichtet von einer Massenerschießung (Jiddisch, gedolmetscht). Der Bericht wurde teilweise direkt aufgenommen, teilweise berichtet die Überlebende vor Gericht davon und Eichmann sieht sie dabei unverwandt an. Die Schwester und das Kind der Überlebenden wurden erschossen, sie selbst fiel verletzt in die Grube und befreite sich dann als Einzige. .Der Staatsanwalt (Gideon Hausner?): Das Schicksal dieser Frau ist symbolisch für das Schicksal Israels. ...Ungarische Juden wurden gezwungen, vor der Vergasung Postkarten aus "Waldsee" zu schreiben. Ein Zeuge aus Israel hat noch heute so eine Karte. Dieser Zeuge, ein Ingenieur, kam auch nach Auschwitz; verlor dort seine Familie. Seine Tochter hatte einen roten Mantel, wie die Tochter des Staatsanwaltes. ...Der Mann mit Anzug und Krawatte ist entsetzt über die Vielzahl der offiziellen Berichte über Massenexekutionen zur NS-Zeit. Man findet auch andere Quellen, z.B. Briefe an das Finanzamt über Steuerschulden der Juden. ...Eichmann sollte eine Statistik büer die "Lösung der Judenfrage" erstellen, die alle Ortschaften enthielt. Seine Schätzung: Noch ca. 4,5-5 Mio. Juden, dann sind die "Judenprobleme in Europa abgeschlossen". ...Ein Mann spricht über den vor Gericht gezeigten Dokumentarfilm über die KZs (45 min). Dieser Film wurde vorab Eichmann und dessen Verteidiger vorgeführt. Eichmann zeigte keine Regung, hat aber nachher den Wächter gerufen und aufgeregt mit diesem gespro- chen. Er wollte vor Gericht einen grauen Anzug tragen, keinen blauen Anzug. ...Szenen dieses Films werden gezeigt. Man sieht fast verhungerte, teilweise nackte Menschen. ...Wiesenthal über ein Treffen mit dem Sohn Eichmanns. Diesem hat er das Leben gerettet, denn die nächste Generation trägt für ihn keine Schuld an dem, was passiert ist. (R.3) - Endlösung – Judenverfolgung in Deutschland (1979) n.b./fa Oder - Endlösung – Judenverfolgung 1933-1945 in Deutschland n.b./fa) Der Film entstand als dokumentarische Ergänzung zu der amerikanischen Fernseh- serie "Holocaust". Im Hauptteil der Dokumentation werden die Schwerpunkte der Holocaust-Serie durch filmische und wissenschaftliche Zeugnisse und vor allem durch Augenzeugenberichte von Überlebenden aus Deutschland, Österreich, Polen und Israel belegt. Die Abschnitte untergliedern sich: 1933 - 1938 Ausschaltung der uden aus dem öffentlichen Leben; 1938 - 1941 Wirtschaftliche Vernichtung und Berufsverbot; 1941 - 1945 Deportation, Ghettos und Konzentrationslager - Die Endlösung der Judenfrage. Zu Wort kommen unter anderem Klaus Scheurenberg, Pater Rufeisen, Israel Gutmann, Marcel Reich-Ranicky, Anna Palarczyk, Richard Glaser und Hermann
Langbein, der auch das Schlußwort spricht. - Ich schau mir Deine Fotos an (Polen/1979) Zu alten Familienfotos erklingen zeitgenössische Tanzstücke, Charleston- und Tangomusik der 1920er und 1930er Jahre. Die Fotos sind nach Themengruppen geordnet, wie z.B. "Meine Freundin", "Unsere Hochzeit", "Meine Kollegen" und "Unser Urlaub". Auf den Bildern sieht man Menschen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen und verschiedenen Alters. Ihre Gesichter sind ernst, heiter, glücklich oder auch angestrengt, dem Anlass der Aufnahme entsprechend. Auf einigen der Fotos stehen Jahreszahlen. Mit dem Jahr 1939 und der politischen Veränderung beendet eine schrille Disharmonie die fröhlich-nostalgische Musik. In einem grö- ßeren Bildausschnitt ist zu sehen, dass die Fotos in viele große Alben fein säuber- lich eingeklebt wurden. Durch die Beschriftung des Etiketts erfährt der Zuschauer, dass es sich um Privatfotos handelt, die Häftlingen bei ihrer Ankunft in Auschwitz- Birkenau abgenommen wurden. Mit einem Rolltitel, der vor dem Hintergrund des ehemaligen Konzentrationslagers abläuft, verdeutlicht der Kurzfilm das Grauen dieser Zeit. - Die Welt vor dem Holocaust. Aus dem Leben der Juden in Osteuropa vor dem zweiten Weltkrieg (1980) n.b./fa - Adelaarsnest (Niederlande/1981) n.b./fa ... Interview Herr Schulze-Kossens über KZ-Lager, Gefangennahme, Eichmann (R.15) - Mein Großvater: KZ-Aufseher Konrad Keller (BRD/1982) n.b./fa Der Fernsehfilm "Holocaust" war für den jungen Journalisten Kurt Kister aus Dachau der entscheidende Anstoß, sich um die Geschichte seiner Familie zu kümmern. Mit detektivischer Genauigkeit ging Kister den Spuren seines Großvaters nach, sammelte Zeugen und Zeugnisse, die ihm Aufschluß geben konnten über die Person des Großvaters, aber auch über den Ort, zu dem dieser täglich "zur Arbeit" ging - das Konzentrationslager Dachau. Die "Reise in die Vergangenheit" wurde für Kurt Kister zu einer Reise in das eigene Gewissen. Immer wieder stellt er sich die Frage: "Wie hätte ich mich verhalten, wenn ich damals gelebt hätte?" Eine Frage aber beschäftigt ihn besonders: "Was war das für ein Mensch - mein Großvater?" Glaubwürdige Zeugen schilderten ihn als aufopferungsfähigen, vorbildlichen Familienvater, der zu Hause keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Und doch war er dabei, war SS-Mann, war Lagerbewacher der ersten Stunde. Welche seelischen Verkrüppelungen muß ein Mensch erfahren, um so gespalten leben zu können?ie konnte man so handeln, so einer werden? Und "was geht uns das heute noch an"? Nicht zuletzt soll der Film auch diese Frage beantworten. - KZ-Aufseher Konrad Keller (Todesfuge) (Medienpaket, Video, Dias) n.b. - KZ-Aufseher Konrad Keller (Schnittreste) n.b./fa - Jüdischer Gedenkstein (1983) (Dokumentation Nr. 593) n.b./fa - O Buchenwald (DDR/1983/84) n.b./fa Gegenüberstellung der Kulturstadt Weimar und der im Konzentrationslager verübten Verbrechen. - Ein verlorenes Berlin (BRD/1943/84) n.b./fa Von Farnen und Efeu überwuchert, fast vergessen, liegt in Berlin-Weißensee der größte jüdische Friedhof Westeuropas. Von den Nazionalsozialisten unzerstört, vom Krieg kaum beschädigt, formen seine über 115 000 Gräber heute eine Land- schaft, in der sich auf einzigartige Weise Geschichte lesen läßt - die Geschichte der Juden in Berlin seit 1880. Kommentiert und geleitet werden die Bilder des Films von einer Montage aus Interviews . - Die Befreiung von Auschwitz (BRD/1986) n.b./tw.fa (Chronos-Film) Die Dokumentation enthält sämtliche Filmaufnahmen, die sowjetische Kameramänner nach der Befreiung von Auschwitz zwischem dem 27. Januar dem 28. Februar 1945
gedreht haben. Um die Authentizität der Dokumente zu wahren, werden selbst grausamste Bilder ohne Kürzungen gezeigt und auf Geräusch- und Musiksynchronisation verzichtet. ...Karte mit Standort von sieben KZs. Lage von Auschwitz wird gezeigt. Nebenlager. Dose mit den Filmen von der Befreiung; Kameramann Alexander Woronzow. ...Woronzow spricht über seine Aufgabe als Kameramann im Krieg. Panzer im Schnee; Soldaten in der Stadt. 17./18.01.1945: Die SS evakuiert Auschwitz. 27.01.1945: Die Sowjets erreichen Auschwitz. Die Soldaten haben den Auftrag, die Befreiung des Lagers zu filmen. ...Luftaufnahmen der Baracken von Auschwitz-Birkenau. Amerikanische Luftaufnahmen des Lagers. Hintergrundinformation über Auschwitz: Arrestblock; Exekutionen dort. Stammlager Auschwitz, Lager Birkenau, Industriegebiet mit Nebenlager Monowitz. Industrie in Auschwitz, z.B. Buna-Werke (I.G. Farben). Fabrikanlage, Bilder des Lagers. ...Woronzow spricht über seine Erlebnisse. Nahaufnahmen von Häftlingen; Leiche im Schnee. Die Zwangsarbeiter verlassen Auschwitz. ...Eine sowjetische Sonderkommission besichtigt das Lager. Gesprengte Gaskammer. Baupläne des Lagers. Details der Vergasung werden erklärt. Restliches Zyklon B. Medizinische Präparate für Versuche. Elektrische Anlage. Woronzow spricht. Die Sowjets in einer leeren Baracke. Baracken mit Überlebenden, die für den Film noch einmal dorthin zurückkehrten. Details zu den hygienischen Verhältnissen in den Baracken. Leichen im Freien. Abtransport von Kranken auf Bahren. Jüdische Beerdigung eines einzelnen Opfers. ...Frauen stehen im Schlamm und lesen einen Brief an die jugoslawische Regierung. Appell zur Rettung der restlichen Gefangenen in Deutschland und zur Aufklärung der Verbrechen. ...Woronzow spricht über die Probleme im Umgang mit den sehr geschwächten Gefangenen. Nahaufnahme eines Häftlings. ...Anfang Februar Evakuierung des Stammlagers und des Lagers Birkenau. Abtransport der Schwerkranken. Information über weiteres Schicksal der befreiten Häftlinge (R.1) ...Häftlinge gehen im Freien herum; verlassen das Lager mit Pferdewagen. Schilderung eines Augenzeugen darüber, wie sich die Häftlinge nur langsam bewegen, um Kraft zu sparen. Langzeitfolgen der Zeit in Auschwitz. ...Woronzow beschreibt die Ansammlung von Gegenständen im Lager. "Kanada" wird erklärt. Koffer werden gezeigt. ...Abgebrannte Baracken von Auschwitz-Birkenau. Warenlager im Stammlager Auschwitz. Details zu den gefundenen Waren. Details zu den Transporten der Waren nach Deutschland. Arbeit des "Aufräumungskommandos". Weitere Verwertung der Waren. Aktion Reinhardt (Ostpolen): Gegenstände im Wert von 180 Mio. Reichsmark. Gebetsschals. Offener Zug, halb voll Waren, die ins Reich transportiert werden sollten. Ballen mit Menschenhaar. Insgesamt wurden 7.000 kg Haar gefunden. Frauen beim ersten Appell im Lager, noch in Zivilkleidung. ...Reste von Scheiterhaufen mit Köpfen darin. Fotos der SS-Männer, Familienfotos der Opfer. Von der SS heimlich aufgenommene Fotos von der Ankunft eines Zuges in Auschwitz. Beschreibung dieser Ankunft. Ablauf einer Selektion. Foto von zwei Menschenkolonnen mit einem SS-Mann dazwischen. Details über die Arbeit. Details über die Vergasung. Fotos von Wartenden. ...Wieder geöffnetes Massengrab. Sektion einer Babyleiche. Details zu Sektionen anderer Häftlingsleichen. Aufräumen des gesprengten Krematoriums V durch Männer aus der Umgebung. Information zum Aufstand des Sonderkommandos im Krematorium IV. Es wurden Aufzeichnungen des Sonderkommandos gefunden. Unterbringung ehemaliger Häftlinge im Stammlager Auschwitz I zur Genesung. Lager Auschwitz I und Birkenau sind heute eine Gedenkstätte. Baracken in Monowitz (abgerissen). ...Eine sowjetische Kommission besichtigt das Lager. Häftlingsärzte berichten über ihre Tätigkeiten: Henry [di Moussaint] (Pathologe) zeigt seine Nummer; Berthold Epstein, Professor für Pädiatrie in Prag.Prof. Geza Mansfeld, Dr. Bruno Sigismund Fischer, Neurologe aus Prag. (R.2) ...Die Professoren (in Häftlingskleidung) führen die Kommission durch den Strafblock und zeigen ihr den Galgen. Bei Flucht eines Häftlings wurden zehn andere aus dieser Baracke zum Tod durch Verhungern verurteilt. Einer von ihnen war Pater Kolbe. Der Eingang zu einem Keller wird gezeigt. ...Woronzow berichtet von der Reaktion der Häftlinge. Kinder zeigen ihre Nummern. Ein fast verhungertes Baby wird untersucht. Tätowierstempel. Ein anderes Kind wird unter- sucht. Details zu Menschenversuchen. Überlebende werden untersucht. Ein Arzt beschreibt die Symptome des Verhungerns. Erfrierungen an den Füßen, verursacht durch stunden- langes Stehen beim Strafappell barfuß im Schnee. Ein Überlebender mit einem Kopfschuss wird untersucht. Details zu Strafen in Auschwitz, z.B. Stehzelle, Dunkelzelle, Prügelstrafe.
Kastrationsversuche von Prof. Clauberg. Betroffene werden untersucht. Prügelstrafe; ein Betroffener wird untersucht. Protokolle der sowjetischen Ärzte als Beweismaterial beim Nürnberger Prozess. Feierliches Begräbnis ehemaliger Häftlinge im Februar. Die Zwillinge verlassen das Lager. Dr. Mengele und Dr. Schmidt machten mit ihnen Versuche. Weiteres Schicksal der Kinder. Psychische Spätfolgen der Zeit im Lager. ...Weiteres Schicksal der erwachsenen Häftlinge. Information der Öffentlichkeit über Auschwitz am 7.5.45. Gestellter, nie veröffetnlichter Film der Befreiung des Lagers: Jubelnde Häftlinge, die sich alle hinter dem Eingangstor drängen und warten, dass die Sowjets ihnen das Tor öffnen. (R.3) MÖGLICHERWEISE Auschwitz Zwei Dokumentationen - Zeitabschnitte des Werner Bab / Die Befreiung von Auschwitz (in BMO recherchierbarer Titel) - Ephraim Oranienburger Strasse Berlin (BRD/1986) n.b./fa Ein junger Mann sucht, angeregt durch den Wiederaufbau des Ephraim-Palais in Berlin, nach Spuren des Mannes, der dem bedeutendsten Bürger-Palais Berlins seinen Namen gab. Dabei findet er das Grab eines Nachkommen des Münzpächters Ephraim. Er war Wundarzt in der Oranienburger Straße, dem Zentrum jüdischen Lebens in Berlin. Aber weder von dem Wundarzt noch von den vielen tausend Berlinern jüdischen Glaubens gibt es noch Spuren. Zwar sind die Namen einiger weniger Juden aus Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft noch bekannt, die anderen etwa 170000 Juden, die hier lebten, sind ausgelöscht, als habe es sie nie gegeben. Zwischen 1933 und ihrer Verschleppung in die Vernichtungslager wurde eine Mauer des Schweigens um sie errichtet, wurden sie von denen vergessen, mit denen sie als Nachbarn, Freunde oder Kollegen zusammen- lebten. - KZ Neuengamme (1987) (Dokumentation Nr. 1002) n.b./fa/U - Rosa Weiss (BRD/1987) n.b./Fa Trickfilm mit den Bildern aus dem gleichnamigen Buch von Roberto Innocenti. Die etwa 10jährige Rosa erlebt in einer deutschen Stadt den Ausbruch des 2. Welt- kriegs. Anfangs unterscheidet sie sich nicht besonders von den anderen Kindern; als sie aber Zeugin der Verhaftung eines jüdischen Jungen wird und nahe der Stadt ein KZ entdeckt, beschließt sie zu handeln. Heimlich bringt sie den Kindern im Lager Lebensmittel. Beim Herannahen des Kriegs wird das Lager verlegt. Rosa selbst wird in den letzten Kriegstagen noch getötet. - Der Versuch einer Berührung (BRD/1987) n.b./fa In einer Kneipe trifft sich ein älterer Mann, mit einer Gruppe Jugendlicher zu einem zwanglosen Gespräch. Er hat einen Faible für Swing-Musik.Dafür wurde er von den Nationalsozialisten in ein Konzentrationslager für Kinder und Jugendliche gebracht. Bevor er detailiert über seine Erfahrungen berichtet, werden von der Filmautorin die Jugendlichen vorgestellt. Sie berichten über ihre Herkunft und äußern ihre Meinung über das Gesellschaftssystem der Bundesrepublik. Gemeinsam haben sie ein mangelndes Interesse am Nationalsozialismus. Trotzdem folgen sie seinen Ausführungen. Er erläutert die Verhörpraxis der Nazis und kettet später einen Jugendlichen am Hand- und Fußgelenk an, um zu demonstrieren, daß Flucht- versuche unmöglich waren. Auf dem Gelände des Reichssicherheitshauptamtes versucht er das Eingesperrtsein in den Nazi-Kerkern zu veranschaulichen. Zu Hause kochen die Jugendlichen ein typisches KZ-Essen. Es folgt eine gemein- same Fahrt zum Jugend- und Kinder-KZ Moringen. Passanten reagieren auf Befragen der Jugendlichen gereizt. Das Setzen eines Gedenksteins "Von Jugend- lichen für Jugendliche vor 42 Jahren" beschließt den Aufenthalt in Moringen. Das Zusammensein mit ihm hat den Jugendlichen Stoff zum Nachdenken gegeben und ihre Einstellung zur Politik verändert. - Jeder konnte es sehen (DDR/1988) n.b. Film über die antisemitischen Ausschreitungen von 1933 bis zur "Reichskristallnacht" im Jahre 1938. Im Vorspann wird an die Ermordung des deutschen Gesandschaftsrates von Rath am 7.11.1938 in der deutschen Botschaft in Paris durch Albert Grünspan erinnert. Briefe und Zeitdokumente dokumentieren, daß der 17jährige jüdische Jugendliche
mit der Tat ein Fanal gegen die Judenverfolgung setzen wollte. Der Film blendet zurück zum ersten Judenboykott 1933 und den darauf folgenden Pogromen. kizzenhaft werden die Stationen der Judenverfolgung umrissen, von den Nürnber- ger Gesetzen bis zur Eskalation des antisemitischen Terrors 1938, als die Syna- gogen brannten und sich die Volkswut auf Befehle entlud. "Mit dem Zusehen und Schweigen begann die Schuld...". Zum Schluß wird die letzte Friedensweihnacht 1938 gezeigt, der Christkindlmarkt in München - "freundlich, fröhlich, friedlich geht das Jahr 1938 zu Ende", so, als ob nichts geschehen wäre. - Präsident jüdischer Weltkongreß (1988) (Dokumentation Nr. 1085) n.b./fa - Alle Juden raus! (Schweiz/Leiser-Prod.) n.b./fa - Alle Juden raus! – Judenverfolgung in einer deutschen Kleinstadt 1933-1945 (BRD/ 1988/90) n.b./U/VHS - Leer - bis wann? Teil 1 (BRD/1989) n.b./fa/U - Mahnung für alle Zeiten (DDR/1989) n.b./fa Die Persönlichkeit des Antifaschisten Robert Siewert und seine Erfahrungen, die er zur Zeit der faschistischen Diktatur von 1933-1945 machen mußte. ...Kamerafahrt zum Denkmal und Turm des ehemaligen Konzentrationslagers Sach- senhausen. Mauer mit Stacheldraht. Plastik: 3 Männer, davor Blumen.Blumen auch vor dem Gedenkstein mit Aufschrift: �ERSCHIESSUNGSGRABEN� AN DIESER STELLE WURDEN PATRIOTEN AUS ALLEN EUROPÄISCHEN LÄNDERN ER- MORDET. Gedenktafel für den TODESMARSCH DER HÄFTLINGE im APRIL 1945 - ...An verschiedenen Orten der DDR Gedenksteine mit Tafeln als Erinnerung und Mahnung an die Opfer der Hitlerdiktatur von 1933-1945; einige Tafeln werden gezeigt, unter anderen eine Tafel mit Judenstern und mehrere Namen darunter. - ...Straßenschilder mit Namen einiger Opfer wie zum Beispiel Dietrich-Bonhoeffer- Str. und Robert-Siewert-Str. Robert Siewert erzählt aus seinem Leben - dazu werden folgende Archivfotos gezeigt, u.a. Stacheldrahtzäune von Buchenwald. Menschen- menge im Konzentrationslager Buchenwald . Baracken von außen und innen, zwei an Bäumen aufgehängte Häftlinge; ein anderer Häftling liegt vor SS-Mann auf dem Waldboden,zwei liegende, abgemagerte Häftlinge,Leichenberge, Raum mit tuhl und verschiedenen Foltergeräten, aufgehende Eisentür, Zeichnung: Häftlinge am Tisch sitzend ...Weimar: Häftlinge im Konzentrationslager (Archivfoto) - viele Menschen auf Appellplatz mit Fahnen und ...Buchenwald: Erst als Modell, dann als fertige Gedenkstätte. Kamerafahrt zum Denkmal (Details), Gedenkstein mit Kranz, davor lodert eine Flamme aus rundem Stein. Delegation von DDR Politikern ...Sachsenhausen: Brennende Flamme in Opferschale. Menschenmenge vor Denkmal. ...Schweigemarsch: Schulklasse geht Waldweg entlang,dazwischen werden immer wieder Zeichnungen aus dem Konzentrationslager eingeblendet. Weg endet am Grab von 6 unbekannten Antifaschisten, sie wurden hier im Wald ermordet. ...Kinderzeichnungen zum Thema: Konzentrationslager:die Zeichnungen hängen alle an einer Wand, in der Mitte ein Bild von R. Siewert. Kinder gehen den Weg des ehemaligen KZ-Buchenwald entlang: das schmiedeeiserne Tor mit dem Schriftzug: JEDEM DAS SEINE. Während die Schüler durch das Gelände der Gedenkstätte gehen, werden mehrere verschiedene Zeichnungen, die das Leben und Sterben im KZ darstellen, eingeblendet. Kinder legen Blumen auf einen Gedenkstein nieder. Der Direktor der Mahn- und Gedenkstätte (früher selbst Häftling hier) erzählt den Kindern von seiner Vergangenheit und von seiner heutigen Arbeit in der Gedenkstätte. Kohlezeichnungen aus Buchenwald und Dokumente werden besichtigt: Verbrennungsraum mit Öfen und Bilder von Skeletten, offene Ofentüren. Bilder und Skulpturen, Kunst, die vermitteln soll, was damals geschah - ...Prof. Herbert Sandberg: Er sitzt am Tisch und zeichnet, erzählt, dazu werden seine Bilder gezeigt - Die Nacht als die Synagogen brannten (1989) n.b.
Film über die sogenannte „Kristallnacht“ vom 9./10. November 1938 - Spurensuche (BRD/1989) n.b./fa Die Juden in Frankfurt am Main Die Geschichte der Stadt Frankfurt ist mit der Geschichte der jüdischen Bewohner eng verknüpft. Ihre Gemeinde im Stadtkern galt seit jeher als Muttergemeinde Israels - der Ort, an dem die jüdische Kultur und Religion intensiver gelebt wurde als anderswo. Bis zu ihrer Vernichtung war sie die zweitgrößte jüdische Gemeinde Deutschlands. Dieser Film geht den Spuren jüdischer Vergangenheit nach. Die zeitgeschichtlichen Fakten und Dokumente geben Einblick in das jüdische Leben von den ersten jahrhundertealten Zeugnissen bis zum Beginn der nationalsoziali- stischen Ära. Gezeigt werden Elemente der jüdischen Kultur und Religion, die Entwicklung der jüdischen Gemeinde, ihr Kampf um Anerkennung und die Diskriminierungen und Feindschaften, denen sie immer wieder ausgesetzt war. Rabbiner Ahron Daum spricht über die besondere Stellung der Frankfurter Rabbiner in der jüdischen Welt. Am Beispiel dieser Stadt hinterfragt der Film auch das Zusammenleben von Christen mit einer jüdischen Minderheit. - Deutsch ist meine Muttersprache – Verfolgte Juden erinnern sich n.b./fa - Jacob van Ruisdael – Der Judenfriedhof bei Ouderkerk (1990) n.b. - Verschwundene Lieblinge (BRD/1990) n.b./fa/U/VHS In diesem Film wird an die "verschwundenen Lieblinge" aus Film und Theater erinnert, die die Zeit des Nationalsozialismus nicht überlebt haben und heute nahezu vergessen sind. Es werden die Geschichten von Otto Wallburg, Hans Otto, Fritz Grünbaum, Robert Dorsay und Joachim Gottschalk erzählt. ... Otto Wallburg. Mit bürgerlichem Namen hieß er Wasserzug und er beginnt 1926 zu filmen. Bis 1933 wirkte er in 74 Spielfilmen mit. 1933 wird ihm sein Jahresvertrag bei der Ufa gekündigt. Nachdem Wallburg an seine Kriegsverletzung und das Eiserne Kreuz aus dem 1. Weltkrieg erinnert, erhielt er eine Sondergenehmigung für einen Auftritt bei den Scala-Festspielen. Danach flieht er nach Wien, wo er auch kein Engagement erhält und über Paris nach Holland. Dort tritt er im damaligen Juden- viertel auf, bevor er und seine große Liebe Ilse Rein, deportiert werden. Otto Wallburg stirb am 30.10.1944 in Auschwitz. ... Hans Otto, 1900 in Calau geboren. Er beginnt 1930 ein Engagement im preu- ßischen Staatstheater, dessen Intendanz 1933 vollständig mit Nazis besetzt wird. Daraufhin wird der praktizierende Kommunist Hans Otto entlassen und geht in den Untergrund. Er lehnt Angebote aus Wien, Prag und Zürich ab. 1933 wird er denunziert und nach tagelanger Folter durch die SA aus dem Fenster geworfen. ...Bruno Keisky und Fritz Kleinmann erinnern sich an ihre Begegnung mit Fritz Grünbaum. Der österreichische Schauspieler und Kabarettist starb im KZ Buchenwald. ... Robert Stampa, der sich Dorsay nannte, begann seine Filmkarriere 1936. Im November des Jahres 1943 wurde sein Name aus dem Vorspann von 17 Filmen entfernt. Später Verurteilung zum Tode wegen fortsetzender reichsfeindlicher Tätigkeit und schwerer Zersetzung der deutschen Wehrkraft. ...Der letzte Teil des Filmes befasst sich mit dem Schauspieler Joachim Gottschalk, der sich mit seiner Familie aufgrund des NS-Terrors am 6. November 1941 das Leben nahm. - Der KZ-Kommandant - Die ungewöhnliche Geschichte des Erwin Dold (BRD/1991) n.b./tw.fa - Warum wir hier sind – Juden im heutigen Deutschland (BRD/1991) n.b./fa/U/Beta - Die zweiten Tausend Jahre (1992) n.b./tw.fa Bilder von der unzerstörten Stadt vor dem Krieg, Bilder vom tausendjährigem Nord- hausen. Diese Bilder, dazu Dokumente, Fotos und Erinnerungen von Zeitzeugen erzählen die lokalen Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945. Eine deutsche Stadt während der Nazi-Zeit, eine Stadt, die sich in den 'zweiten Tausend Jahren' verändern wird ... durch Ausgrenzungen jüdischer Mitbürger,
durch brutale Übergriffe und schließlich durch die organisierte Vertreibung der jüdischen Gemeinde aus der Stadt. Später sind es das Konzentrationslager im Stadtgebiet, die schweren Bombardierungen kurz vor Kriegsende und die Ereignisse während der Besetzung der Stadt. Etappen, die Nordhausen verändert haben. - Alles war möglich...Das KZ Dora und die V-Waffenfabrik (1992) n.b./fa - Perlasca (BRD/1992) n.b./fa Dokumentarfilm über den italienischen Staatsbürger Giorgio Perlasca, der sich gegen Ende des Zweiten Weltkriegs gegenüber den ungarischen Behörden als offizieller Nachfolger des bereits geflüchteten spanischen Botschafters in Budapest ausgab und dank einer großangelegten Finte rund 70.000 Juden vor der Auslieferung an die Nazis retten konnte. (Lexikon des Internationalen Films) - Der Auschwitz-Mythos (Teil 1) (Kanada/1993) n.b./fa/U/VHS Ein Deutscher und eine Jude untersuchen Auschwitz! Ernst Zündel und David Cole Zündel und Cole stehen vor dem Eingangstor von Auschwitz mit der Aufschrift "Arbeit macht frei" und stellen den Film vor (englisch). Zündel stellt sich vor (deutsch mit Akzent). Er lebt in Kanada, wurde wegen seiner "Aufklärungsarbeit zum Thema Holocaust" von einer "jüdischen Vereinigung" angeklagt. Details zu den Prozessen und zur Meinungsfreiheit in Kanada. Durch die Medienberichte über die Prozesse kam Zündel in Kontakt mit Cole, einem jüdischen Revisionisten. Cole ist amerikanischer Jude mit deutscher Abstammung. Er hat Zündel eine Zusammenarbeit angeboten. Bilder von Cole in Auschwitz. Zündel unterstützt Cole in organisatorischen Dingen und vereinbart ein Treffen in Auschwitz. (Das deutsche Konsulat in Toronto stellt ihm einen vorläufigen Reisepass aus.) Zündel hält dann erst einmal in London und Brüssel Vorträge und ruft dann Cole an. Cole hat in Auschwitz ein Interview mit dem Leiter der Gedenkstätte, Dr. Francisek Piper aufgezeichnet (kurzes Bild von Piper). Zündel fährt sofort nach Deutschland, gibt seinen Mietwagen ab und lässt sich von einem "Kameraden" weiter nach Krakau fahren, wo er Cole trifft. Dieser wohnt, zusammen mit vielen anderen Juden, im Holiday Inn. Zündel befürchtet, Cole nicht zu erkennen, findet ihn aber doch. Er beschreibt ihn als "typisch jüdisch aussehenden jungen Mann". Cole begrüßt Zündel herzlich, umarmt ihn, und berichtet von dem Gespräch mit Piper. Zündel beschreibt das Gespräch als "Durchbruch", denn viele jüdische Jugendliche sind "aufgehetzt" von Eltern und Lehrern. Aufnahmen von Jugendlichen, teils mit Kippa, teilst mit Schildern, die man nicht lesen kann, auf denen aber Davidssterne zu sehen sind. Zündel möchte sich von Cole durch Auschwitz führen lassen, um so den "jüdischen Blickwinkel" kennenzulernen. Zündel beschreibt das kühle Herbstwetter am 16.09. Autofahrt nach Auschwitz. Besucher betreten das Stammlager. Cole im Bild, hinter ihm das Tor "Arbeit macht frei". Wachtturm; Kontrollstelle "wo die ankommenden Häftlinge sicher dann ihre Papiere abgeben mussten, wo sie kontrolliert wurden". Cole steht mit Mikrofon unter der Aufschrift; Zündel reicht ihm demonstrativ die Hand und hofft auf den "Durchbruch". Zündel und Cole, "der junge Jude" beobachten, wie polnische Soldaten sich die Gedenkstätte ansehen. (Zündel betont sehr häufig, dass Cole Jude ist.) Zündel befürchtet außerdem, dass die polnischen Soldaten auf ihren Besuch in der Gedenkstätte mit "Hass gegen Deutschland" reagieren würden. Wieder zurück im Büro: Zündel gibt eine ernste Erklärung ab, dass er durch "Erläuterungen, was wirklich in Auschwitz geschah" versuchen werde, "diesen Hass abzubauen". Zündel steht vor einer Europakarte und erklärt den Reiseweg. Auschwitz: Küchenkomplex. Schwarzweißfoto an der Küchenwand zeigt ein Orchester. "Anscheinend wurde dieses Orchester dazu benützt, um den Auschwitz-Insassen beim Mittagessen musikalische Begleitung zu geben." Ziegelgebäude im Stammlager, "also nicht so windzugige Teerpappe-Bauten wie man im Fernsehen immer sieht", sondern massive Gebäude. [Die Baracken, von denen Zündel spricht, standen in Auschwitz-Birkenau, nicht im Stammlager.] Schwimmbad im Gras. "Dieses Schwimmbad ist ein ganz besonders wichtiges Beweismittel." Im Bild Ditlieb Felderer, schwedischer Revisionist. Das Schwimmbad wurde vor Gericht im Prozess gegen die Revisionisten nicht als Beweismittel zugelassen. Zündel, mit Helm, spricht mit Reportern. Das "Schwimmbad" erscheint auch auf den Luftaufnahmen der Amerikaner. Zündel bezeichnet das als "Sensation", da das Schwimmbad innerhalb des Zaunes, also im Lager liegt. Seine Schlussfolgerung:
Das Schwimmbad war weder für die Wachen noch für die SS, sondern für die Häftlinge. Weitere Details zum Schwimmbad. Zündel geht mit Cole zum Schwimmbad und besichtigt die Rückseite der Todeswand. Cole erklärt, dass die Wand schon seit Jahren ein Teil des Gebäudekomplexes gewesen sein musste. Zündel wundert sich, dass er "nicht ein einziges Ausschussloch" findet. Zündel hat eine ähnliche Wand nachbauen und beschießen lassen, um die Ergebnisse vor Gericht as Beweismaterial zu verwenden. Der Richter lehnt das ab. Aufnahmen des Experiments (Schüsse auf die Wand). Es entsteht ein Loch in der Wand. Die "Todeswand" nun von vorne, mit zahlreichen Besuchern, die Blumen niederlegen. Man sieht deutlich, dass es eine weitere Wand vor der Klinkerwand gibt. Zündel und Cole ärgern sich, dass die "anständigen, in die Irre geführten Menschen" dort Blumen niederlegen. Detailinformationen über den Kugelfang. Keine Einschusslöcher in der Wand. Links und rechts der Wand: Gynäkologische Abteilung bzw. Gefängnis. Auch das ist für Zündel eine Begründung, dass dort keine 20.000 Erschießungen haben statt finden können, denn die Gefangenen hätten davon ja etwas "wahrnehmen" müssen. Zündel erklärt, dass Cole bezweifelt habe, dass man 20.000 Erschießungen unbemerkt hatte durchführen können. Zündel findet ein "wuchtiges Gebäude" und direkt davor eine Mauer und nagelneuen Stacheldraht "der in der Sonne nur so glitzert". Foto einer Theateraufführung. Zündel behauptet, dass die Häftlinge solche Theateraufführungen hätten besuchen können und beschreibt das Theater. Zündels wiederkehrende Frage: Warum gibt es in einem Todeslager ein Schwimmbad/ ein Orchester/ ein Theater? Weg zur Gaskammer. Es wird das von Gras überwachsene Dach eines unterirdischen Gebäudes gezeigt; daneben ein massives Gebäude. (Es handelt sich nicht um die gesprengten Gaskammern in Birkenau.) Zündel bezeichnet die "angebliche Gaskammer" als ehemaliges Munitionslager der österreichisch-ungarischen Armee, das nachher als Leichenhalle genutzt worden sei. Zündel und Cole betreten das Gebäude und untersuchen die Tür; Cole findet einen Hebel, der "von innen und von außen betätigt werden konnte". Durch das Guckloch in der Tür konnte man nur eine Schrappnellwand sehen. Man konnte also die Insassen nicht beobachten. Im Raum findet Zündel Markierungen auf dem Zementboden, aus denen er schließt, dass der Raum früher durch Mauern unterteilt war. Außerdem findet er Abflussrohre von Toiletten, Wasserrohre, etc. Es gibt an den Wänden keine blau gefärbten Überreste. Zündel und Cole gehen in der Gaskammer umher und sehen sich alles genau an. Oben in der Decke sind Öffnungen. Zündel und Cole werden immer wieder von Besuchergruppen "unterbrochen", die "durchgeschleust" wurden. Weitere Details zu Türen und Fenstern des Raumes, den Zündel als "Gaskammer" bezeichnet. Kein luftdichter Abschluss zwischen Krematorium und Gaskammer. Zündel und Cole untersuchen Öffnungen auf dem Dach der "Gaskammer". Zündel bemängelt das Fehlen von Abzugsschornsteinen. Bild Abzugsschornstein eines Gefängnsisses in den USA. Gebäude der SS-Verwaltung direkt neben der Gaskammer (im Stammlager Auschwitz), daher Gesundheitsgefahren für diese SS-Leute. Galgen, zu dem alle Besucher "hingeschleust" werden. Archivaufnahmen: Hinrichtung an einem baugleichen Galgen. Fahrt auf der Straße vom Stammlager nach Auschwitz-Birkenau. Eingangstor des Lagers Birkenau. "Und wiederum übernahm mein junger jüdischer Wahrheitsforscher die Führung für mich." Aussicht aus dem Beobachtungsturm. Eingang einer der Steinbaracken wird gefilmt. Zündel zeigt sich "überrascht über die Qualität der inneren Ausrüstung, der Ausstattung". Wandsprüche und Wandgemälde (z.B. ein Segelschiff) in der Baracke. Toiletten innerhalb der Gebäude; die gelben Waschrinnen in einer der Steinbaracken werden gezeigt. (Es wird keine der Holzbaracken in Nahaufnahme gezeigt.) "Gedenkstätte" mit Blumen. Details zu den Platten der Gedenkstätte. Auf diesen Platten steht, dass diese Gedenkstätte für 4 Millionen Opfer des Faschismus errichtet worden sei. Foto von Papst Johannes Paul II an der Gedenkstätte. (kurze Bildstörung bei 0:56 min) Die mehrsprachigen Inschriften der Platten wurden nun herausgemeißelt. Revisionistische Schriften werden gezeigt, z.B. "Der erste Leuchter-Report". Zündel begründet seine revisionistische Tätigkeit mit der Bedrohung seiner Freiheit. Weitere Revisionisten werden im Bild gezeigt; Details zu Zündels Tätigkeit genannt. Cole geht mit einer Touristenführerin durch Auschwitz und stellt ihr Fragen, wobei er sein Mikrofon sichtbar trägt. Er trägt eine schwarze Kippa. Cole fragt die Touristenführerin, ob die Gaskammer im Originalzustand oder rekonstruiert sei. Er fragt nach den Zwischenwänden, deren Spuren er gefunden hat. Die Touristenführerin kann seine Fragen nicht beantworten. Dr. Piper über Umbaumaßnahmen in Auschwitz (englisch mit deutschen Untertiteln). Während Cole mit der Touristenführerin in Auschwitz herumgeht, erklärt Zündel, dass diese das wiedergebe, was sie in der Schulung gelernt habe, dass Piper aber besser Bescheid wisse. Zündel kritisiert, dass Piper zwar "dem Juden Cole gegenüber" viele Änderungen einräumt, dass die offizielle Positon aber sei,
dass es keine Änderungen gegeben habe. Während Zündel dieses Statement abgibt, sieht man Cole, wie er mit Mikrofon und Kippa in der Gaskammer etwas erklärt, und dort offenbar noch immer mit den niedergerissenen Wänden beschäftigt ist. Dr. Piper wollte nicht für Irving als Zeuge vor Gericht in München aussagen. Details zum Prozess gegen Irving. Bauplan von Topf und Söhne für eine "Einäscherungsanlage" in Auschwitz. Zündel erklärt den Plan. Juli 1943: Stilllegung des "alten Krematoriums" und Umbau in eine Luftschutzanlage für die SS mit einem Operationsraum. Zündel erklärt den Bauplan erneut mit den neuen Funktionen der Räume. Er betont die "Splitterwand", die vesetzen Türen und die starken Mauern - alles Hinweise auf einen Luftschutzbunker. Erneuter Umbau der Anlage wird anhand eines weiteren Plans erklärt. Details der Gaskammer werden kritisiert, z.B. Türen gehen nach innen auf. Maßstabsgerechtes Modell mit abnehmbaren Dach auf der Grundlage der alten Pläne. Dr. Robert Faurisson (ebenfalls Holocaustleugner) erklärt Zündel das Modell und zeigt, dass beide Türen nach innen aufgehen. Faurisson spricht sehr langsam Englisch. Entnahme einer Gesteinsprobe. "The Leuchter Report" wird im Bild gezeigt. Abschließende Worte von Zündel. - Der Auschwitz-Mythos (Teil 2) (Kanada/1993) n.b./fa/U/VHS Zwei Gruppen von Menschen stehen einander feindlich gegenüber; einige der Anwesenden greifen Mitglieder der gegnerischen Gruppe an. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und trennt die beiden Parteien. Eine Menge skandiert "Nazis raus". Nahaufnahme einer Gruppe Rechtsextremer, einige von ihnen Skinheads. Die gegnerische Gruppe skandiert weiter "Nazis raus", die Nazis antworten mit "Kohl soll verrecken." Sie zeigen ein zerrissenes Plakat und entrollen ein Transparent: "1. Mai, Tag der deutschen Arbeit". Die Gegendemonstranten werden durch eine Kette von Polizisten zurückgehalten; die Neonazis durch das Polizeifahrzeug. Großaufnahme beider Gruppen. Die Gegendemonstranten skandieren "Hoch die internationale Solidaritat", die Neonazis antworten mit "Hoch die nationale Solidarität". Die Polizei kesselt einige der Gegendemonstranten ein und drängt die gesamte Gruppe zurück. So vergrößert sich der Abstand zwischen beiden Gruppen. Die Kamera befindet sich zwischen beiden Gruppen. (8 min) Ein junger Mann gibt eine Erklärung ab, dass die Demonstration anlässlich des 1. Mai unter die Meinungsfreiheit falle, und das die gegnerische Gruppe diese friedlichen Demonstranten habe angreifen wollen. (Englischer OT). Die Neonazis zeigen eine schwarz-weiß-rote Flagge vor. Außerdem haben sie Flaggen mit weißem Kreis und schwarzem Z auf rotem Grund dabei. Einige tragen Baseballschläger bei sich. Die Nazis ziehen durch die Straßen; die Kamera geht voraus und filmt sie dabei von vorne. Die Gegner werden gefilmt, wie sie den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite entlanggehen und skandieren: "Wir wollen keine Nazischweine". Die Polizei drängt einzelne der Gegendemonstranten zurück, die versuchen, sich der Demonstration in den Weg zu stellen. Die Gegendemonstranten skandieren: "Raus aus München." Die Neonazi-Demonstration biegt um eine Straßenecke, daneben eine Rehe von Polizisten und direkt daneben einige der Gegendemonstranten. Die Gegendemonstranten werden gefilmt und sind erkennbar. Die Polizei riegelt eine Querstraße mit einer Kette von Beamten ab und macht so der Nazi-Demonstration den Weg frei. Die Neonazis singen die erste Strophe der Nationalhymne ("Deutschlandlied"). Die Gegendemonstranten pfeifen auf Trillerpfeifen. Man sieht Bela Ewald Althans unter den NS-Demonstranten. Einige der Gegendemonstranten, u.a. drei junge Frauen, diskutieren mit der Polizei. Die Polizisten reagieren darauf gelassen. Die Neonazi-Demonstration zieht zum Königsplatz (Blick auf Propyläen). Die Gegendemonstration nimmt direkt neben dem Gebäude Aufstellung und skandierrt durchgehend weiter "Hoch die internationale Solidarität", "Wir wollen keine Nazischweine" oder "Nazis raus". Die Neonazis gehen über den Rasen. Viele von ihnen tragen Fackeln. Die Neonazis bilden einen Kreis. Althans hält gegenüber des Gebäudes eine Ansprache mit einem Megafon. Die Teilnehmerzahl wird geschätzt: "weniger als 100 Kameradinnen und Kameraden". Thema der Ansprache: Der 1. Mai als "Tag der nationalen Arbeit"; Feiertag seit 1933. Arbeitslosigkeit und Not in der Weimarer Republik. Kritik an Gewerkschaften, die "von kommunistischen Gruppen
unterwandert" sind. Festnahme des Sprechers und dadurch Verhinderung einer Demonstration in Straubing. Während der Rede Nahaufnahmen der Neonazi-Demonstranten. Die Rede wird nicht komplett gezeigt. Aufnahme der Gegendemonstranten. Dank an den Veranstalter. Kritik an den Gegendemonstranten. Aufzählung von Parallelveranstaltungen. "Wir danken unseren Gegnern, dass sie den dreckigen Teil der Arbeit gemacht haben, und das wir hier in anständiger Form unsere Demonstration durchführen mussten". Weitere Hintergrundinformation zum 1933 eingeführten "Tag der deutschen Arbeit". Außerdem spricht der Redner von Exilanten aus der "SBZ" und davon, dass auch in der BRD bald Leute ihre Koffer werden packen und "nach Israel oder nach Amerika" auswandern müssen. "Dieser Tag ist nicht mehr weit." Dank an die Teilnehmer. Der Veranstaltungsleiter gibt Informationen zur Auflösung der Veranstaltung. Die Fackeln müssen gelöscht werden, dann geht man zu Fuß wieder den Weg zurück, den man gekommen ist. Die Teilnehmer singen gemeinstam das Deutschlandlied (1. Strophe, obwohl der Veranstaltungsleiter die 3. Strophe angekündigt hatte). Althans singt mit Megaphon ein anderes nationalistisches Lied. Dann werden die Fackeln gelöscht. Pfeifkonzert der Gegendemonstranten. Die Gegendemonstranten zeigen ihre Flagge: "1. Mai - Kampftag der Arbeiterklasse". Es wird inzwischen dunkel. Demonstranten, Polizeiwagen und andere Autos auf der Straße. Die Demonstranten sind auf dem Heimweg. Titel: Achtung! Dieses Video dient der sach- und fachgerechten wissenschaftlichen Arbeit. Er [sic] wurde unter der besonderen Beruecksichtigung der deutschen Holocaust-Schutzgesetze hergestellt und dienst nicht der Leugnung oder Verherrlichung historischer Ereignisse. Missbrauch sowie Vervielfältigung jeglicher Art, sind verboten. (35 min) Titel: Samisdat praesentiert: Der zweite Leuchter-Report Ein Buch wird eingeblendet: "Der zweite Leuchter-Report - Dachau, Mauthausen, Hartheim". "Prof. Robert Faurisson", "Ingenieur Fred Leuchter" und "Historiker Mark Weber" im Gespräch. Ernst Zündel Buch: "Did six million really die". Details zur Verurteilung Zündels 11/1983 und zum Prozess 1985. Eine Gaskammer in einem Gefängnis in Missouri, die bis heute in Gebrauch ist, wird gezeigt. Bill Amontrout (der Direktor des Gefängnisses), Fred Leuchter (US-Ingenieur für Gaskammern), Prof. Robert Faurisson (Lehrer an der Universität New York und "führender Revisionist") werden einzeln eingeblendet und gezeigt, wie sie sich zusammen Baupläne und Fotos ansehen. Ortsschild Oswiecim; Eingangstor von Auschwitz-Birkenau; startendes Flugzeug; "Leuchter-Report"; Leuchter beim Verlassen des Gerichtsgebäudes in Toronto 04/1988. Leuchter "untersucht" nun die Gaskammern von Dachau, Mauthausen und Hartheim. Daraus entstand der "Zweite Leuchter-Report". Amerikanischer Dokumentarfilm über das KZ Dachau: Luftaufnahme (Baracken); Eingangstor; Häftlinge, teils noch in Häftlingskleidung; Kleidung getöteter Häftlinge. Besichtigung der KZ-Gedenkstätte Dachau. Fred Leuchter untersucht eine Metallkonstruktion, klopft dagegen, leuchtet mit einer Taschenlampe. Dann wird die Tür zu einem Herren-WC geöffnet und wieder geschlossen. Eine Luke im Boden wird herausgehoben. Die Schlussfolgerung der Besucher: Es handelt sich um Räume zum Aufhängen und Entlausen von Bekleidung. Die Kleidung wurde zuerst mit Zyklon B behandelt, dann mit Luft durchblasen. Die amerikanische Dokumentation zeigt ein "Brausebad" mit Attrappen von Duschköpfen. Fred Leuchter untersucht diese Gaskammer genau und findet eine Rille in der Tür, die für eine Dichtung vorgesehen sein könnte, vermisst jedoch die Gegenrille am Türrahmen. Er überprüft den
Schließmechanismus der Tür und stellt dabei fest, dass eines der Scharniere verbogen ist. Außerdem untersucht er mehrere Vertiefungen in der Wand, die teilweise vergittert sind. Er nimmt den Kanaldeckel vom Abfluss und zieht einen Metallzylinder aus dem Abfluss. Er erklärt die Funktionsweise eines Abflusses. Außerdem entdeckt er mehrere Luftschächte. Er untersucht die Vertiefungen in der Wand, die Lampen enthalten, welche seiner Aussage aus nach 1945 eingebaut worden sind. An der Decke sind Duschköpfe, die direkt aus dem Mauerwerk kommen. Ein Duschkopf fehlt; statt dessen ist dort ein Loch. Der Revisionist untersucht alles ganz genau und kommentiert das Gesehene (englisch, gedolmetscht, in beiden Sprachen schwer zu verstehen). Er kommt zu dem Schluss, dass einige der Öffnungen in der Wand nachträglich eingebaut und mit Gittern versehen wurden. Dann untersucht er die Tür und den Boden. Amerikanische Dokumentation: Ingenieursraum. Dachau 1989: Ingenieursraum. Rohre führen unter der Decke entlang. Leuchter und Mark Weber sehen lange durch ein Fenster und betrachten innen etwas. Rohre, die "Gas-Rohre", werden gezeigt. Weber kommentiert die Untersuchung der Gaskammer in Dachau (deutscher Originalton). Leuchters Fazit: Es handelt sich nicht um eine Gaskammer. (Leuchter begründet diese Behauptung.) Weber dolmetscht Leuchters Aussagen schlecht ins Deutsche. Leuchter kritisiert auch, dass die Gaskammern in unmittelbarer Nähe des Krematoriums waren. Das hält er für unglaubwürdig "because the gas is highly explosive". [Anmerkung: Zyklon B ist erst beim 50fachen der für den Menschen tödlichen Dosis explosiv.] Leuchter begründet seine Schlussfolgerung mit weiteren Details. So habe die Gaskammer keine Entlüftungsanlage. Seine Schlussfolgerung: Die Gaskammer in Dachau ist eine Desinfektionskammer, denn die Türen sind nicht besonders stark. (1:10 m) Fahrt nach Mauthausen (Österreich). Aufnahmen der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Eingangstür zur Gaskammer. Leuchter und Weber untersuchen die Gaskammer von innen. Sie messen die Höhe und Breite. Faurisson ist nun auch dabei. An der Wand ist ein Schild "Gaskammer". Leuchter klopft eine große Ecke der Fliesen heraus und nimmt sie mit! "Wie bereits in Auschwitz und in Auschwitz-Birkenau, gelingt es Fred Leuchter auch in Mauthausen, wieder Gesteinsproben von Wänden und von dem Boden der sogenannten Gaskammer zu entnehmen." Leuchter kratzt außerdem Farbe und Putz von der Wand. Aus einer anderen Wand schlägt er mit Hammer und Meißel eine Gesteinsprobe. Eine Besuchergruppe betritt das Lager, währdend der Kommentator einen amerikansichen Dokumentarfilm kritisiert. Fahrt zum Schloss Hartheim. Faurisson ist nun auch dabei. Die Revisionisten sprechen über die in Mauthausen widerrechtlich entnommenen Gesteinsproben und machen dabei einen sehr zufriedenen Eindruck. Faurisson kommentiert die in der Gedenkstätte gegebene Erklärung über die Gaskammer in Mauthausen. Die Revisionisten diskutieren darüber, wie das Gas in die Gaskammer eingebracht wurde. "Skeptische" Besucher werden gezeigt. (Eine junge Frau steht zögernd am Eingang der Gaskammer und geht dann wieder.) Hintergrundinformation über Schloss Hartheim. Die Revisionisten messen einen Raum in Schloss Hartheim aus. Schlussfolgerung: Fred Leuchter kommt in allen besuchten Gedenkstätten (Auschwitz; Auschwitz-Birkenau, Dachau, Mauthausen, Hartheim) zu dem Schluss, dass die Gaskammern nicht zur Massenvernichtung genutzt worden sind. Die KZ-Gedenkstätten sind "Attrappen", und die richtigen Gebäude, die es irgendwo noch gibt, müssen untersucht werden, daher gehört der Leuchter-Report "in die Hand eines jeden Menschen". Aufforderung, den Leuchter-Report zu bestellen. Es gibt zwei Ausgaben, außerdem eine Ausgabe für "wissenschaftliche Arbeit", die etwas teurer ist. In englischer Sprache sind zwei weitere Ausgaben erschienen. Die Bestelladresse (ein Postfach in Kanada) wid eingeblendet.
(1:30 min) Bonusmaterial (Tonqualität sehr schlecht): Die Deutsche Wochenschau vom 3.8.1944 Feierliche Beisetzung eines Todesopfers des Stauffenberg-Attentats im Tannenberg-Denkmal. Göring legt einen Kranz nieder. Hitler besucht die Verletzten im Lazarett. Mitarbeiter Hitlers werden gezeigt. O.E. Remer: "Der 20. Juni 1944" (Beschriftung der Videokassette). Ein Zeitzeuge des Attentats auf Hitler wird befragt. Er spricht zunächst von seiner Kindheit und Jugend: Mitgliedschaft im Jungsturm, Erziehung zum "Preußentum". Geländeübungen. Wunsch, Offizier zu werden. Werdegang beim Militär. Begeisterung der Jugend. Überzeugung vom Nationalsozialismus, die "bis zum heutigen Tag" anhält. Gefühle bei der Machtübernahme der Nazis. Parteimitglied war der Zeitzeuge nicht, da "kein Soldat" in der Partei war. Kritik an Versailles. Einen Krieg hat der Zeitzeuge nicht erwartet, und schließlich hat ja auch Hitler immer versprochen, dass es keienn Krieg geben würde. Mobilmachung der Polen; Angriff auf Deutschland. Details zum Krieg gegen Polen. Frankreich-Feldzug (kurz); Balkan-Feldzug. Überraschender Umsturz in Belgrad. Angriff auf Griechenland. Überraschender Befehl zum Rückzug auf deutsches Gebiet. Beginn des Kriegs gegen Russland. Versetzung an die Ostfront. Details über Kämpfe in Russland. Major Remer spricht über seine Orden. Eindruck Major Remers vom "Führer": Hitler war ein sehr kritischer Mensch, den man ernst nehmen musste. Blondi kam zu Remer und ließ sich streicheln. Major Remer erinnert sich, dass Hitler für die Probleme der Soldaten Verständnis hatte. Er beklagt sich, dass nicht alle Soldaten ihren Aufgaben gewachsen waren. Von Widerstand innerhalb der Armee hat Major Remer gar nichts mitbekommen. Das Attentat auf Hitler hat das deutsche Offizierskorps durchweg abgelehnt. Major Remer kritisiert, dass der Attentäter nicht vresucht hat, Hitler zu erschießen, sondern eine Bombe hingestellt und "sich verdrückt" hat. Nur eine "ganz kleine Minderheit" hat das Attentat geplant; niemand sonst wusste davon oder hätte es auch nur in Erwägung gezogen. (Major Remer wird zunehmend ärgerlich.) Major Remer wurde am 20. Juli nicht vom Attentat informiert, sondern bekam die Information, dass Hitler tödlich verunglückt sei und bekam die Anweisung, das Regierungsviertel in Berlin abzuriegeln. Major Remer bekommt das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, und ein Kollege von ihm fährt zu Goebbels, um mehr in Erfahrung zu bringen. Der Genreal stellt fest, dass der Häuserkomplex um den Anhalter Bahnhof völlig abgesperrt wird. Er beklagt sich bei seinen Vorgesetzten über die unklaren Befehle, denn offenbar ist es das RSHA, das abgesperrt werden soll. (2:30) Goebbels fordert Major Remer auf, innerhalb 20 min zu kommen. Sein Vorgesetzter verbietet es ihm und fordert ihn auf, Goebbels zu verhaften. Der Vorgesetzte macht den Befehl dann aber auf Nachfrage rückgängig und Major Remer fährt zu Goebbels. Dieser fragt ihn, was er von der Lage weiß. Major Remer zeigt Goebbels, dass das Regierungsviertel umstellt ist. Goebbels teilt ihm mit, dass Hitler noch lebt, und stellt eine telefonische Verbindung her. Hitler bevollmächtigt Remer, in Berlin für Ordnung zu sorgen. Er war also zu dieser Zeit der wichtigste Mann in Berlin. "In keinem Fall hat es Widerspruch gegeben. Alle haben sich mir unterstellt." Remer sagt, dass er Stauffenberg sofort "wie einen räudigen Hund" ohne Gerichtsurteil erschossen hätte, wenn er gewusst hätte, was dieser plant. Motiv für die Handlungsweise Stauffenbergs laut Remer: "Ehrgeiz" sowie die Tatsache, dass dieser nach dem Krieg pensioniert gewesen wäre. Remer ruft beim Rundfunkintendanten an und sorgt dafür, dass nichts über das Attentat auf Hitler bereichtet wird. Haase hielt Remer für unschuldig an der Verschwörung. In der Wohnung von Goebbels. Haase möchte gern etwas essen, und bekommt zwar ein Glas Wein, aber Goebbels beklagt sich hinterher bei Remer darüber, wie jemand in einer solchen Lage auch nur an Essen denken kann. Remer berichtet weitere Details über die interne Organisation der Regierung in dieser Ausnahmesituation. Er betont dabei auch immer wieder, dass er den Oberbefehl über Berlin hatte. ... Remer liest noch eine Stelle aus seinem Buch vor, in dem er über das Attentat des 20. Juli und die Folgen spricht. Archivaufnahmen von Oberst Remer (schwarzweiß).
- Die Rettung der Berliner Juden (aus der Rosenstraße) (1993) n.b./fa - Die Kunst des Erinnerns-Simon Wiesenthal (1994/95) n.b./fa/VHS ... Die Kunst des Erinnerns: Filmische Hommage an Simon Wiesenthal (Johanna Heer, Werner Schmiedel) ...Mannheim: Prozess gegen Fred Leuchter wegen Volksverhetzung.Taxifahrer gibt Leuchter recht. Fahrgast (Frau mit dunklen Haaren und braunen Augen) widerspricht. Hebräisches Lied mit Untertiteln. Titel: Die Kunst des Erinnerns ..Los Angeles: Eröffnung Museum of Tolerance. Leitsatz Simon Wiesenthals: "Wer die Verbrechen und Völkermorde der Vergangenheit leugnet, legt den Weg frei für die Morde der Zukunft". Simon Wiesenthal wird auf einer förmlichen Veranstaltung geehrt. Hinter grundinformation zu Verfolgung von NS-Verbrechen. ...Simon Wiesenthal spricht in Paris über seine Arbeit. Aufnahmen aus dem "Museum of Tolerance". ...Wiesenthal spricht über eine Erschießung in Lemberg. Der Täter macht pünktlich um 18:00 h Feierabend und so überlebt Wiesenthal. Ein Bekannter rettet ihn dann. ...Wiesenthal war als Häftling in mehreren KZs. ...Wiesenthal spricht darüber, dass er ein Junger Mann war, als Hitler an die Macht kam und die Ereignisse ihn unvorbereitet trafen. ...Die Nazis versuchten, Spuren zu vernichten: Ausgraben und Verbrennen der Toten aus den Massengräbern. Wiesenthal musste sich daran beteiligen. ...In Schweden sind NS-Verbrechen bereits verjährt, da sie mehr als 25 Jahre zurück liegen. ...Todesmarsch nach Mauthausen, wo Wiesenthal schwer krank wurde. Schilderung der Zustände in Mauthausen, Foto. ...Wiesenthal zur jetzigen Fremdenfeindlichkeit: man könne diese mit den 1920er Jahren vergleichen. ...Befreiung von Mauthausen mit Colonel Richard R. Seibel (englischer Originalton mit Untertiteln). Fotos von der Befreiung, Aufnahmen des Colonel. ...[New York:] Simon Wiesenthal Center ...Mark Weitzman spricht über die Bedeutung Simon Wiesenthals für sein eigenes Leben. ...Mauthausen. Kontrast zwischen der Landschaft und dem Lager. Mai 1945: Simon Wiesenthal möchte das KZ verlassen, wird aber von einem Mithäftling verprügelt. Er meldet den Vorfall Oberst Seibel und beobachtet dabei, dass SS-Männer festge- nommen werden. ...Wiesenthal gibt Informationen an die Amerikaner weiter, er möchte mit ihnen zusammenarbeiten. Wiesenthals Frau überlebte ebenfalls den Holocaust. ...Wiesental ist in Busczacz, Galizien, geboren. In dieser Stadt bildete die jüdische Bevölkerung die Mehrheit. Straßenaufnahmen von Busczacz. ...Simon Wiesenthals Familiengeschichte. Ein Rabbiner spricht auf dem Friedhof (OT Hebräisch, deutsche Untertitel). ...Lemberg. Bis 1941 waren ein Drittel der Bevölkerung Juden. Wiesenthal studierte dort Architektur. Wiesenthals damaliges Wohnhaus wird gezeigt, Nachbarn werden befragt. ...Bereits im Mai 1945 versucht Wiesenthal, NS-Täter dingfest zu machen. Er listet KZs und Täter auf und schreibt der US-Verwaltung einen Brief. Er darf dann für die Amerikaner arbeiten, aber nicht alle von ihnen verstehen sein Anliegen. Daher gründet er ein Dokumentationszentrum. ...Wiesenthal spricht in Göteborg über die Zerstörung von Dokumenten. ...Wiesenthal möchte Zeugen finden. Noch leben die Überlebenden ja in Internie- rungslagern. ...Dossier der Zeugen, Dossier der Verbrecher, Dossier der Orte. So können Täter festgenommen werden. ...Privatleben Wiesenthals. Seine Tochter arbeitet als Psychologin in Israel. ...Buch Wiesenthals über den Großmufti von Jerusalem, der Verbindungen zu den Nazis hatte. ...Bereits im Sommer 1945 deckte Wiesenthals die Identität Eichmanns auf. Er findet in einem Elektrogeschäft in Linz den Vater Eichmanns. Die Spur führt ins Salzkammer- gut, nach Alt-Aussee. Eichmanns Frau will Eichmann für tot erklären lassen. Eichmann kann entkommen und flieht mit Hilfe von "Odessa" nach Syrien und später nach Südamerika. Wiesenthal kennt einen Briefmarkensammler, der ihm Briefe aus Argentinien zeigt und über den er dort Eichmanns Spur findet. Eichmann arbeitet
als "Ricardo Clement" für ein Wasserwerk. Wiesenthal informiert die Behörden. Sechs Jahre später wird Eichmann vom israelischen Geheimdienst verhaftet. Bilder vom Eichmann-Prozess in Israel. ...Ludwigsburg: Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NS-Verbrechen. Ein Staatsanwalt spricht über die Zusammenarbeit mit Wiesenthal. ...In Österreich gab es so eine zentrale Stelle nicht, was Wiesenthal kritisierte. ...Wiesenthal möchte ein Institut zur Erforschung des Antisemitismus gründen, scheitert aber an der Finanzierung. ...Ein Professor für vergleichende Religionswissenschaften in Jerusalem erklärt die Gefahr von Antisemitismus auch für Nichtjuden. Es ist diese Tendenz, das "Andere" zu hassen. Analogie: Israel ist für die Menschheit wie das Herz für den Körper. Wenn es also den Juden gut geht, geht es auch den anderen gut. ...Ehrendoktorate für Simon Wiesenthal. ...Ein Deutscher an einer amerikansichen Universität spricht über die Bedeutung Simon Wiesenthals (englischer Originalton). ..Auseinandersetzung mit Kreisky. Man wirft Wiesenthal Privatjustiz vor. ..Wien: Filmpremiere "Schindlers Liste" ...Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden (Buch wird eingeblendet). ...Steven Spielberg spricht über zeitgenössischen Rassismus. Raul Hilberg spricht darüber, wie seine Famlie aus der Wohnung vertrieben wurde. ...Wiesenthal zur "Wiedergutmachung": Jeder überlebende Jude muss etwas bekommen. ...Zeitung "Ausweg" wird vorgestellt. ...Wiesenthal spricht über seine Kindheit. Ein "Wunderrabbi" hat ihn gesegnet. Er erzählt die Geschichten seiner Grossmutter nach. ...Rabbiner spricht über die Bedeutung der Torah. ...Göteborg: Wiesenthal spricht sich dafür aus, Neonazi-Demonstrationen zu verbieten. ...Wiesenthal auf der Buchmesse in Schweden. Er spricht über sein Verhältnis zu Büchern und über die Bedeutung von Büchern für Juden generell. Jesaja als erster "Widerstandskämpfer" - seine Schriften haben überlebt. ...Amsterdam. Tagebuch der Anne Frank. Es wird im Original geblättert. Aufnahmen aus dem Anne-Frank-Haus. ...1958: Wiesenthal beginnt, denjenigen zu suchen, der Anne Frank verhaftet hat. Details zur Suche. Schließlich findet man Silberbauer, den Polizisten, der in der Abteilung 4B4 tätig war. Personalbogen Silberbauers. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Der Fall Silberbauer war kein Einzelfall. Nur wenige Naziverbrecher wurden verurteilt. Wiesenthal spricht darüber im Fernsehen. ...KZ-Überlebende in den USA zeigen ihre tätowierten Nummern. ...Ein Mitarbeiter des Simon-Wiesenthal-Centers spricht über den Sinn einer weiteren Jagd nach Nazi-Tätern. ...Wiesenthal fragt, ob jemand das Recht hat, stellvertretend für einen anderen zu verzeihen. ...Wiesenthal spricht über seine Mutter und den Hunger im Ghetto. Er bedauert, keinen zu Ort haben, an dem er um seine Mutter trauern kann. ...Wien: Gemeinschaft "BiH" Drustvo verleiht Wiesenthal eine Urkunde. ...Wiesenthal auf einem Empfang. ...Flughafen Syracuse, USA. ...Wiesenthal spricht über seine Aufgabe und darüber, warum er nicht als Architekt tätig ist. Der Grund: 1947 baten ihn Rabbiner um Hilfe. - bricht ab bei 1:40 - - Auschwitz – Fünf Tage im November (BRD/1995) n.b./VHS/U ...Ein Zug fährt an einer Schranke vorbei. Die Schranke öffnet sich. Die Autos fahren los. Ortsschild "Oswiecim"; Schild "Muzeum Auschwitz". ... ZT: Freitag 25. November : Bahnhof von Oswiecim. Fluss. Kirche mit rotem Dreieck. Parkplatz der Gedenkstätte mit Bussen. Kleine Läden in der Nähe der KZ-Gedenkstätte. Bücher über Auschwitz neben Coca Cola. Postkarten. Tor "Arbeit macht frei"; Schul- klasse. Baustellenschilder. Geschichte der Gedenkstätte. Ausstellungsstücke: Fotos von Kindern. Pläne von Auschwitz und Birkenau. Modell der Vergasungen. Leere Dosen Zyklon B; Kleidung; Schuhe, Haare, etc. Forderung von Rabbinern nach Beerdigung der Haare. Schüler aus Israel in der Gedenkstätte (mit Flaggen über den Schultern) ...Samstag 26. November: Die israelischen Schüler haben eine Jahrzeitkerze zurück- gelassen. "Beweise des Verbrechens": Schuhe, etc. Schwierigkeiten bei der Konservierung der Koffer, die durch die darüber liegenden Koffer beschädigt werden. Appellplatz im Stammlager. Fotos von politischen Häftlingen. Bauarbeiten in der Gedenkstätte. Häftlings-
waschraum mit Wandgemälde (zwei Männer auf Pferden). Todeszelle von Pater Maximilian Kolbe. Mauer, vor der die Erschießungen stattfanden ("Todeswand"). Problematik christ- licher Symbole in Auschwitz. Gebäude mit Aufschrift "Martyrology of Jews". Gedenkstein von Chaim Herzog (israelischer Präsident). Kleine, noch erhaltene Gaskammer mit "Grunwald-Orden". Verbrennungsöfen in der noch erhaltenen Gaskammer, mit Blumen, Steinen, Fähnchen und Schleifen geschmückt. Krematorium als Anziehungspunkt für Neonazis. ...Sonntag 27. November: "Alte Judenrampe" außerhalb des Stammlagers. (Überwachsene Bahngleise.) Das Gleis nach Birkenau ist bis heute erhalten. Lager von außen (Wachttürme, Zaun, daneben eine Straße.) Eingangstor von Auschwitz-Birkenau. Nonnen besuchen das Lager. Steinbaracke. Die Bevölkerung hat nach dem Krieg Baracken abgerissen. Restau- rierung von Baracken seit den 1950er Jahren. Baracke von innen. Graffitti von Besuchern an der Barackenwand. "Entwesungsblock". Schild "Renovation Works". Renovierung von Baracken mit neuen Fundamenten und neuen Brettern. "Aktionismus" Baracke von innen. Verrosteter Stacheldraht wird regelmäßig ausgetauscht. ...Montag 28. November: Gleise von oben, dazu der Ton einer deutschsprachigen Führung. Die Rampe, auf der die Häftlinge ankamen. Schülergruppe. Baracken, von oben gefilmt. Ton von Führungen in anderen Sprachen. Gleis, Detailaufnahme der Weiche, Wachtturm. Gesprengte Gaskammern. Probleme mit der Konservierung. Soll man die Gaskammern wieder aufbauen? (Man hat nun die Konstruktionspläne.) Kerzen und Blumen in den Ruinen der Gaskammern. Mehrsprachiges Schild: "Beim Betreten der Ruinen droht Gefahr". Birkenwald neben dem Lager, dahinter "Kanada". Gabeln und Löffel liegen auf dem Boden, durch Maschendraht gesichert. Die "Sauna". Renovierungsarbeiten. Original-Aufschriften "Haarschneideraum", "Untersuchungsraum", "Brausen". ...Dienstag 29. November: Mahnmal von 1967 als "Gedenkstätte für die Opfer des Faschis- mus". Wettbewerb um das Mahnmal. Veränderungen der Inschrift des Mahnmals. Gedenk- tafel der heiliggesprochenen "Edyta Stein". Kreuze und Davidssterne auf einem Feld neben dieser Gedenktafel. Schüler auf dem Feld. Trümmer des Krematoriums 4 mit Gedenktafel zur Erinnerung des bewaffneten Häftlingsaufstands vom 7.10.1944. Schwarze Steine werden aufgestellt, die zum 50. Jahrestag der Befreiung beschriftet werden sollen. Der Aschenteich. "Mexiko", jenseits eines Zaunes. Das Lager geht nahtlos in Wohnsiedlungen über. Fahrt durch Oswiecim. - Das Erbe der Bilder (D/1995) n.b./fa Das Portrait von Svend Noldan ist die Vorstellung einer widersprüchlichen Person, die in sich auch einen Teil der deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts widerspiegelt. Drei Lebensabschnitte des Malers und Filmemachers Svend Noldan. Den zweiten Schwerpunkt bildet die Zeit des Faschismus und die Arbeit Noldans für die Ufa, wo er unter anderem an dem nationalsozialistischen Hetzfilm Der ewige Jude beteiligt war. Gezeigt wird ein Ausschnitt aus dem Film und aus Noldans Arbeiten für die Propaganda- Abteilung. - Gedenken in Auschwitz 50 Jahrestag der Befreiung des KZ-Lagers (1995) n.b./fa/U - Die Schweiz und die Juden 1920-1945 3sat 1996 n.b. - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interview Hildeburg Späth) (1996) n.b./fa/U/VHS ... Interview mit Hildeburg Späth, ehemals Frauenhäftling im KZ Lichtenburg, in Leipzig am 11.09.1996. - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interviews Lina Haag und H. Eichner) (1996/97) n.b./fa/U/VHS Interviews mit Lina Haag in München im Oktober 1996 und mit H. Eichner in Stuttgart am 03.10.1996. - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interview Schuhmann) (1996) n.b./fa/U/VHS Interview mit Frau Schumann am 04. und 05.09.1996. - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interviews - Starke und Finger) (1996/97) n.b./fa/U/VHS
Interviews mit den Herren Starke und Finger am 20. und 21.08.1996. - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interviews - Rohmaterial) (1996/97) n.b./fa/U/VHS - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interviews September 1996 – Januar 1997) (1996/97) n.b./fa/U/VHS Videoaufgezeichnete Interviews zum Diplomprojekt " Räumliches Erinnern " (September 1996 - Januar 1997). - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Interviews - Familie Schladitz) (1996/97) n.b./fa/U/VHS Interview mit Jens Schladitz am 12.12.1996 und mit seiner Tante Irmgard am 03.01.1997. - Räumliches Erinnern. Schloß und Konzentrationslager Lichtenburg – Prettin (Aus- stellung) (1997) n.b./fa/U/VHS Ausstellung - eröffnet am 29.10.97, bis 09.11.97 - im Schloß Lichtenburg in Prettin an der Elbe, das NS-Konzentrationslager, Hauptzeugamt der Waffen-SS und sowjetisches Internierungslager war. - Memoria (Italien/1997) n.b. Das Filmteam begleitet 30 italienische Juden, Überlebende des Holocaust, an die Stätten ihres Leidens - das Gefängnis von Mailand, das Durchgangslager Fossoli, das Vernichtungslager Auschwitz - und lässt durch sie als Zeitzeugen die Erinnerung an eine zumeist verdrängte Vergangenheit lebendig werden. Obwohl die Kamera auf respektvoller Distanz bleibt, werden das Leid und die Trauer der Betroffenen erfahrbar, wird deutlich,dass Vergessen ein weiteres Verbrechen an den Überlebenden wäre. Der Film, entstanden für das Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), verzichtet auf historische Aufnahmen, vermittelt diese jedoch durch die Eindringlichkeit der Aussagen dem inneren Auge des Betrachters. - Deckname Dr. Friedrich (1999) n.b./tw. Bei Max Weber studierte er, mit Carl Zuckmayer war er befreundet. Den SPD-Reichs- tagsabgeordneten Carlo Mierendorff trieb es von der Literatur in die Politik, und gegen Ende der Weimarer Republik zählte er zu den profiliertesten Gegnern der nationalen Erhebung. Er entschied sich 1933 trotz drohender Verfolgung im Land zu bleiben. Viereinhalb Jahre KZ konnten ihn nicht mürbe machen, 1938 tauchte er unter. Er setzte sein Leben fortan für ein Deutschland in Freiheit ein. Seine Losung "Fort mit Hitler" brachte er in den Kreisauer Kreis ein und verfasste einen Aufruf zur "Sozialistischen Aktion" für die Zeit nach Hitler. Unterwegs als "Dr. Friedrich", kam er 1943 in einer Leipziger Bombennacht um. - Überlebenskampf unterm Hakenkreuz (BRD/1999) n.b./tw.fa 'Der Film schildert den ungewöhnlichen Werdegang des Dirigenten Konrad Latte, der als Jude während des Nationalsozialismus illegal in Berlin lebte und trotz stän- diger Gefahr erkannt, verhaftet und deportiert zu werden, seinen Wunsch Musiker zu werden hartnäckig verfolgte, in der Öffentlichkeit auftrat als Organist in verschie- denen Kirchen Berlins, als Statist in der Staatsoper und als Kapellmeister einer Wehrmachtstournee. Er überlebte dank eigener Geschicklichkeit, großem Mut und dank der über 30 Helfer, die ihn unterstützten und nicht verrieten. Nach schwerem Neubeginn nach dem Krieg gründete er das Berliner Barockorchester und führte es bis zu seinem Rücktritt zu großen Erfolgen.' - Mit Bubi heim ins Reich (BRD/1999) n.b./fa "Er war der Größte", sagen sie noch heute über ihn. Etliche von denen, die alt genug wurden oder sich ausreichend informiert glauben, beschreiben Ludolf von Alvensleben, genannt 'Bubi', als stattlich-schlanken Zwei-Meter-Hünen mit dem Schick des gebore- nen Uniformträgers: ein sympathischer 'Draufgänger', gewandter Windhund, 'verwandt- schaftlich' humorvoll, 'gerissen', gleichwohl bewegt von den 'adeligen Tugenden' des uralten Geschlechts, dem er entstammt. Wie kaltblütig er tatsächlich war, hat die Geschichtswissenschaft längst zweifelsfrei ermittelt: Als enger Gefolgsmann Heinrich Himmlers setzte der Massenmörder mit dem freundlichen Spitznaman die Vernichtung
Zigtausender von Polen und Russen ins Werk. Dennoch erfuhr ein Nachkomme 'Bubis' aus der Enkel-Generation vom braunen Fleck auf der strahlend weißen Weste seiner Altadeligkeit: Hubertus von Alvensleben begann zu recherchieren. Weil er kein Polnisch spricht, suchte er per Annonce nach einem Lehrer und fand ihn im Regisseur Stanislaw Mucha. Der, 1970 in Polen geboren, ließ sich darauf ein, um zu erfahren, warum ein Deutscher seines Alters am Ende des 20. Jahrhunderts ausgerechnet jene verzwickte Fremdsprache lernen wollte. Als der Unterricht fruchtlos blieb, stellte sich Mucha als Dolmetscher auf gemeinsamen Reisen zur Verfügung, sein Entgelt: die filmische Doku- mentation der Spurensuche in Deutschland, Polen, Lateinamerika. Dem 'Familientag' – einer Art Sippenparlament - wollte Hubertus das Filmergebnis vorführen. Doch niemand mochte es sehen. 'Bubi', der strahlende Hüne, der beinah ein Held war: Er wurde zum Identitätsproblem einer Familie, die durch Jahrhunderte hindurch gewohnt war, sich als ehrenhafte Krieger und rechtschaffene Gutsbesitzer zu definieren... - Gerhard Schröder – Bundeskanzler (2000) n.b./fa ... Kranzniederlegung im Stollen der KZ-Gedenkstätte "Mittelbau Dora'". - Zwischen Hoffen und Bangen (BRD/2003) n.b./U Dieser Film zeigt private Aufnahmen einer Familie aus den Jahren 1937 bis 1939. Die Bilder wurden von Siegfried Gumprich gemacht, einem Getreidehändler, der mit seiner Frau Louise und den Kindern Brigitte und Walter in Münster in Westfalen wohnte. Sie zeigen Szenen aus dem Leben einer jüdischen Familie in Deutschland zur Zeit der Naziherrschaft: Eltern und Kinder scheinbar unbeschwert beim Spiel im Garten, beim Tennissport, auf einer Urlaubsreise mit dem Auto an den Rhein, beim Sonntagsspaziergang in der Altstadt, beim Badeurlaub in den Niederlanden. Doch der Schein trügt. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen hatten die Gumprichs bereits mehrere Jahre Nazidiktatur erdulden müssen. Wie die übrigen Mitglieder der jüdi- schen Gemeinde Münsters waren sie nach und nach im alltäglichen Leben von den anderen Münsteranern fast völlig isoliert und durch Zwangsverkäufe und Berufsver- bote finanziell immer mehr ausgeplündert worden. Während diese Entwicklung für Millionen europäischer Juden in der Ermordung endete, entkamen die Gumprichs in letzter Minute dem Holocaust. Drei Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gelang ihnen die Ausreise nach Großbritannien. Auf diese Weise wurden auch Siegfried Gumprichs Familienaufnahmen vor der Vernichtung bewahrt. Im Besitz von Sohn Walter überdauerte das in seiner Überlieferung wohl einmalige Amateur- Archivmaterial viele Jahrzehnte in fernen Kanada. Auf Initiative der Historikerinnen Gisela Möllenhoff und Rita Schlautmann-Overmeyer gelangte es vor einigen Jahren zurück nach Deutschland. Seien Wiederentdeckung kommt einer kleinen filmischen Sensation gleich. Neben den Gumprichs zeigen die Bilder auch den letzten Rabbiner Münsters, Dr. Julius Voos, der gemeinsam mit seiner Frau Stephanie im Januar 1939 nach Münster kam und sich mit der Familie Gumprich anfreundete. - Winterkinder (2003/05) n.b./fa/U Spurensuche in der eigenen Familie. Ein Filmemacher der Enkelgeneration versucht, das Schweigen zu brechen und die Eltern über die NS-Vergangenheit des verstorbe- nen Großvaters zu befragen. ... Gang der Familie zum nahegelegenen KZ Groß-Rosen. - Stolperstein (BRD/2007) n.b./fa/U Der Dokumentarfilm begleitet den Kölner Künstler Gunter Demnig bei der Realisie- rung eines überaus ambitionieren Projekts: Sein Ziel ist es, für jeden der über sechs Millionen von den Nazis aus rassistischen und politischen Gründen getöteten Menschen kleine Gedenksteine vor ihren ehemaligen Wohnhäusern zu verlegen. Während das Projekt von politischer Seite, aber auch von Seiten des Zentralrats der Juden, auf starken Widerstand stößt, sind die positiven Reaktionen von privater Seite (darunter zahlreiche Angehörige Ermordeter) immens. Während Politiker wie der Münchner Oberbürgermeister Ude die Verlegung der Steine trotz der ausdrücklichen Wünsche von Opferfamilien verbieten, sehen zahllose Menschen in den "Stolpersteinen" eine Möglichkeit, der Geschichte zu begegnen. - Menachem & Fred (2008) n.b./fa/U
Der Film erzählt die Geschichte der Brüder Menachem Mayer und Fred Raymes, die als Juden deutscher Herkunft den Holocaust in einem französischen Waisenhaus überlebten, deren Wege sich jedoch nach Kriegsende trennten. Während Menachem nach Israel ging, wo er ein zutiefst religiöse Leben als orthodoxer Jude führt, emigriert Fred in die USA, wurde Amerikaner und verleugnete zeitlebens seine jüdisch-deut- schen Wurzeln. Nach Jahrzehnten, in denen die beiden auch die Existenz des Anderen leugneten, trafen sie schließlich wieder zusammen. Der Film begleitet die beiden bei ihrer Spurensuche, die sie von ihrem Heimatdorf Hoffenheim (bei Heidelberg) über Südfrankreich bis in das KZ Auschwitz führt, wo ihre Eltern ermordet wurden. Den Abschluss bildet ein großes Treffen beider Familien im einstigen Elternhaus der Brüder, das auf Einladung der Geschwister Hopp stattfindet- den Kindern jenes SA- Mannes, der Mayers 1938 aus ihrem Haus vertrieb. - Andula – Besuch in einem anderen Leben (BRD/2009) n.b./fa Dokumentarfilm über das Schicksal der tschechischen Volksschauspielerin Anna Letenska, die während der Nazi-Herrschaft ermordet wurde. Im Jahr 1942 stand Letenska, Spitzname "Andula", für die kriegswichtige Komödie "Ich komme gleich" vor der Kamera. Trotz ihrer Popularität kann sie nicht sicher sein, was nach Abschluss der Dreharbeiten mit ihr geschehen wird, denn ihr Ehemann wird der indirekten Beteiligung an einem Attentat auf Reinhard Heydrich beschuldigt. Tatsächlich wird s ie kurz darauf verhaftet und im KZ Mauthausen ermordet. Der Film "Andula - Besuch in einem anderen Leben" folgt den Spuren dieses Verbrechens und befragt zahlreiche Zeitzeugen wie den Regisseur Otakar Vávra und die Schauspielkollegen Zita Kabátová und Ivan M. Havel. Ohne Jahreszahl - Der älteste der Juden n.b. - Apropos – Video 070 – eine jüdische Hochzeit n.b./fa - Auf den Spuren Europas, Folge 2 – Ein europäisches Volk: Die Juden n.b./fa - Auschwitz – Wie renoviert man eine KZ-Gedenkstätte n.b./fa/U - Austreiben jüdischer Kinder aus einem Raum n.b. - Bar Mitzvah – Einsegnung eines jüdischen Jungen bei Eintritt in die religiöse Reife n.b. - Begegnung mit Juden n.b./fa - Begegnungen – Jüdische Identität heute n.b./fa - Die Bibel und ihre Zeit: Die Reiche Israel und Juda n.b./fa - Bürokratie – Juden – Killesberg (P.v.Zahn) n.b. - Deutsche Schüler pflegen jüdischen Friedhof n.b. - Doku über Juden in Israel n.b./U/fa - Echoes – Germany and Holocaust n.b./fa - Endlösung: 1933-1938 zur Ausschaltung der Juden aus dem öffentlichen Leben (BRD) n.b./fa - Foto’s vom KZ Buchenwald n.b./Ni/U - Das Frauen-KZ am Supermarkt (20B – 1072, 1073) n.b./fa/U - Das Frauen-KZ am Supermarkt (Nr. 244) n.b./fa/U - Die Gedanken sind frei - Die Auschwitz-Lüge und ihre Folgen (nach 1986) n.b./U/BEDI ... Flagge mit Hakenkreuz, Deutschlandlied (getragene klassische Version). Foto von Christophersen als alter Mann. ...Gesprochener Kommentar: Justitia schiele mal links, mal rechts, und ohnehin solle sie keine Augenbinde tragen. ... Dem Vaterland hat man sein Leben lang gedient, und beendet dennoch sein Leben im "Kerker". ...Schrift von Christophersen, "Die Auschwitz-Lüge" wird eingeblendet. ...Aufnahmen von Christophersen vor seinem Haus. ...Sprecher: Christophersen habe mutig seine Meinung gesagt und sei deshalb politisch verfolgt, von einem Staatsschutz, der der Stasi gleiche. (Im Hintergrund werden Bilder des Rheins gezeigt und klassische Musik gespielt.) "Wer kann schon darüber beleidigt sein, wenn sich nun herausstellen sollte, dass es gar keine Gaskammern zur Massenvernichtung von Juden gegeben hat?"(O-Ton) ..Zeitschriften "Kritik - Die Stimme des Volkes" werden eingeblendet".
...Urteil des Bundesgerichtshofes. Positive Bechreibung seiner Gesichtszüge und seines Charakters. "Sieht so ein gefährlicher Nazis aus?"(O-Ton) ...Herbst 1986: Christophersen bezieht sein Haus in Dänemark, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Finanziert wird er durch Spenden Gleichgesinnter. ...Blick auf die Regierungsgebäude der Regierung Dönitz. Vergleich Dönitz und Christophersen. ...Hakenkreuzfahne; Gemälde von Hitler; ...Statement Christophersen: Er nennt seinen Namen und sein Geburtsdatum (27.1.1918) - Christophersen wurde durch seine Bücher bekannt, wurde verfolgt und ging ins "Exil". Nach einem Jahr Gefängnis lebt er in Dänemark, wo er seine politische Meinung "ungestraft vertreten" darf. Er vergleicht die Strafen für Majestätsbeleidigung während der Kaiserzeit, Beleidigung des "Führers" im 3. Reich und "verächtlich machen" der Bundesrepublik heute. Er kommt zu dem Schluss, dass heute die Strafen am strengsten sind. ...Christophersen spricht über seine Zeit als Angehöriger der Wehrmacht in Auschwitz, wo er Naturkautschuk züchtete. In seinen Erinnerungen gab es keine Greueltaten; er vergleicht sich mit dem Kind im Märchen "Des Kaisers neue Kleider". Christophersen. lobt den dänischen Staat. Er hofft, durch sein Buch die Geschichte revidieren zu können. Christophersen erzählt von seiner Verwundung, durch die er nicht mehr "kriegsverwendungsfähig" war und so nach Auschwitz versetzt wurde. ...Er baute erst in der Ukraine Pflanzenkautschuk an, dann für das Kaiser-Wilhelm-Institut (heute: Max-Planck-Institut). Die zur Kautschukgewinung verwendeten Kok-Sagis-Pflanzen wurden erforscht und besser gezüchtet. Die Häftlinge wurden gut behandelt, gut verpflegt und arbeiteten mit großem Interesse. Es gab Fliegerangriffe. Industrie: Buna-Werke. ..."...ich habe gesagt, dass nach der jüdischen Kriegserklärung im März 1933, die Reichsregierung das Recht gehabt hätte, alle Angehörigen, alle jüdischen Volkangehörigen, zu internieren."(O-Ton) ...Die Häftlinge wurden laut Christophersen reichlich verpflegt und erhielten Pakete; es gab auch eine Kantine. Die Häftlinge konnten auch alle ihren Gottesdienst abhalten. Er habe in Birkenau bloße Nutzfeuer finden können, nichts aber, was auf eine Verbrennung von Menschen hingewiesen hätte. Es wurden auch einige Verstorbene exhumiert und verbrannt, um das Grundwasser zu schützen. ...Er spricht über den Angriff auf Dresden und behauptet, dass die Fotos der Leichen aus Auschwitz nach dem Angriff auf Dresden aufgenommen wurden ...Mengele habe im "Führerheim" von Auschwitz einen Vortrag gehalten über Ernährungsversuche an Frauen. Seine Ergebnisse: Die Kriegsernährung war viel gesünder als Fleischnahrung. ...Auf die Frage, was in Auschwitz gearbeitet wurde: Es gab eine Schneiderei, die Buna-Werke, Betriebe, die Flugzeuge zerlegten. Die Insassen arbeiteten teils im Lager, teils wurden sie "ausgeführt". Foto von Häftlingen aus Birkenau auf den Kog-Sagis-Feldern. ...Chr. wurde Ende 44/ Anfang 45 nach Schlesien versetzt, um dort Kok-Sagis-Anbaugebiete zu finden. m Februar 1945 wurde er nach Dresden versetzt und erlebtedort den Bombenangriff. Christophersen spricht ausführlich und sehr emotional über diesen Bombenangriff. "In Dresden sind viel mehr Menschen gestorben als überhaupt in Auschwitz." O-Ton. Er nimmt die Brille ab und wischt sich über die Augen. ...Die Frau Christophersens spricht über ihre Rolle als Hausfrau, über Kinder und Enkelkinder, über ihre Mithilfe bei der Verlagsarbeit, etc. ...Ernst Zündel (?) bedankt sich bei Christophersen und spricht über ein kanadisches Gesetz gegen "das Verteilen von falschen Nachrichten". Die "spitzfindigen Talmudjuden" stützten sich bei ihrer Klage auf dieses alte Gesetz. Er vergleicht die Berichte über Auschwitz, an die er "früher geglaubt" hat, mit dem Weihnachtsmann. "Man glaubt auch die Märchen der Juden nicht mehr." ...Zündel und Christophersen spechen darüber, wie sie gegen die Anklagen vorgehen können. Zündel erklärt, dass eidesstattliche Erklärungen vor Gericht ein Problem sind, weil man keine Rückfragen stellen kann. ..Klassisches Konzert: "Die Gedanken sind frei". Im Vordergrund eine schwarz-rot-goldene Flagge. Chr. wieder in seinem Büro; er singt das Lied nun selbst. ...Adresse des Nordwind-Verlags wird eingeblendet. - Gedenkfeierlichkeiten zu Ehren der Opfer des Faschismus im ehemaligen KZ Dachau n.b./Ni/U - Der gelbe Strom (Holocaust in der Malerei) n.b./fa - Die Geschichte der Frankfurter Juden n.b./fa - Glashaus-Sendung: 100 Tage Holocaust n.b./fa - Heimat der Heimatlosen – Juden in Wien n.b./fa - Die helle Frau und der Jude n.b./fa
- Hessen-Report: Anfrangstip: Jüdisches Museum, Veranstaltungskalender n.b./fa - Hitler und die Juden / Das Hitlerbild / Off Limits n.b./fa - Holocaust n.b./fa - Holocaust aus jüdischer Sicht n.b./fa - Holocaust Zeuge Karski n.b./fa - im Schatten des Holocaust – Kinder der Opfer – Kinder der Täter n.b./fa - Israel Film Judenvernichtung n.b. - Israelische Rückwanderer in der UdSSR (von SDK) n.b./U - Jerusalem – Hauptstadt der Juden n.b. - Juda/Judas n.b./fa - Judas n.b. - Juden (P.v.Zahn) n.b. - Juden in Belgien (Antwerpen) n.b. - Juden in der Schweiz Teil 1 n.b. - Juden in der Schweiz Teil 2 n.b. - Judenbuche (Spielfilm) n.b./fa - Judenverfolgung und Judenvernichtung n.b./fa - Jüdische Gedenkfeier Offenburg (Mbd) n.b. - Jüdische Geschichte – Herr Stein n.b./fa - Jüdische Geschichte – in Frankfurt n.b./fa - Jüdische Geschichte – Interviews im Frankfurter Hof n.b./fa - Jüdische Identität n.b./fa - Die jüdische Margerite (Schweiz/Leiser) n.b./fa - Jüdische Portraits n.b./fa - Jüdische Straßen (Schweiz/Leiser) n.b./fa - Jüdischer Friedhof Offenburg (Mbd) n.b. - Jüdischer Friedhof Weissensee (Dokumentation Nr. 1257) n.b./fa - Jüdischer Gedenktag (Ausschnitte) n.b. - Jüdischer Kongreß II n.b. - Jüdischer Kulturabend, Berlin 1935 n.b./fa - Jüdisches Glück (?) (F 1992, Pierre Oscar Levy: Premier Convoi n.b./fa - Konzentrationslager Dachau 1933-45 n.b./VHS/U - KZ Auschwitz/Birkenau (von SDK) n.b./fa/U - KZ Dachau n.b./fa - KZ-Film (AvT) n.b./U - Das KZ Moringen 1940-44 männliche Gefangene n.b./VHS/U - KZ-Schergen n.b. - KZ-Schergen (Sorge-Schubert-Prozeß) n.b. - Lemberg-Pogrom (II+I) / Die Juden von Dombrosova / Erschießung Jugoslawien / KZ Posen n.b./VHS/U - Montagabend im Dritten: Rekationen auf Holocaust n.b./fa - Musik der neuen Welt – Musik der Juden (P.v.Zahn) n.b. - Orthodoxe Juden in Israel n.b. - Der Prozeß Warschau-Düsseldorf-KZ Prozeß, Tagesthemen, Tagesschau n.b./fa/U - Rosch Haschama – Gedanken zum jüdischen Neujahrsfest n.b./fa - Das Schächten der Juden. Der Film einer Kulturschande, zusammengestellt vom Deutschen Fichte Bund e.V. Hamburg n.b. - Sholem Aleichem – Die Geschichte der Juden in der Sowjetunion (Chronos-Film) n.b./teilw.fa - Simchat Thora – Gedanken zum Tag der jüdischen Gesetzesfreude n.b./fa - Spuren jüdischen Lebens in Westfalen n.b./fa/U/VHS - Spurensuche Teil 1: Die Juden in Frankfurt am Main n.b./fa - Sukhot. Gedanken zum jüdischen Laubhüttenfest n.b./fa
- Tischa Be’AW – Gedanken zum jüdischen Trauertag n.b./fa - Unsere Geduld ist am Ende: Holocaust-Opfer klagen gegen deutsche Banken n.b./fa - Der vergessene Retter / Die Befreiung von KZ Mauthausen durch den Schweizer Louis Häfliger (Schweiz/E.Leiser) n.b./fa/VHS/U - Der Weg nach Auschwitz - Interview Frau Rothschild (Schweiz) n.b./BetaSP ... Kassette 1: Eine gepflegte ältere Dame sitzt in einer Privatwohnung und wird über ihre Erfahrungen in Auschwitz befragt. Die Fragen und Antworten sind hier sinngemäß und teilweise verkürzt erfasst. Fr. Rothschild: Soll ich Sie ansehen oder in die Kamera? Interviewer: Wie begann Ihr Weg nach Auschwitz? Fr. Rothschild: In unserer Heimat, in Preßburg, begannen schon 1939 die Nürnberger Gesetze zu wirken. Juden durften nicht mehr studieren. Ich wurde von der Schule ausgeschlossen. Meine Eltern schickten mich und meine Schwester ins Ausland, um uns zu retten. Wir wurden an der Grenze verhaftet und kamen schließlich nach Auschwitz. Auschwitz bedeutet für mich das Krematorium mit der blutroten Flamme. Ich sehe es alles vor mir. Eriinnerungen werden wach. Ich habe Auschwitz verlassen, aber die Erinnerungen leben bis heute. Die Juden wurden aus verschiedenen Ländern in Viehwaggons gesammelt. Erschöpft kamen die Juden an. An der Rampe selektierten abwechselnd zwei Ärzte, Dr. Mengele und Dr. Kühn. Die Selektion ging sehr schnell. Eine Kapelle spielte Lieder aus dem Land, aus denen die jeweiligen Juden kamen. Kinder, Alte und Kranke kamen ins Krematorium. Sie wurden in einen Duschraum geführt, aber anstatt Wasser kam Zyklon B. Das Sonderkommando (SK) musste dann die Leichen verbrennen. Vorher entfernten Zahnärzte (Häftlinge) die Goldzähne, die gesammelt und nach Deutschland in die Reichsbank versandt wurden. Mitglieder des Sonderkommandos erkannten unter den Toten oft ihre Angehörigen. Die Asche wurde gesammelt und es wurde daraus Seife gemacht. Das war die "Lagerseife", mit der sich die Häftlinge gewaschen haben. Ich frage mich, warum ich heute, nach 50 Jahren, davon erzähle. Ich war vor Kurzem im Krankenhaus für eine längere ... nein, halt, so kann ich das nicht sagen. [Im Hintergrund diskutieren mehrere Personen.] Fr. Rothschild: Die Aufgabe der Zahnärzte war es, die Zähne und die goldenen Brüchen herauszuziehen. Aus der Asche machte man Seife, mit der wir uns gewaschen haben. Wir wuschen uns mit dem Blut unserer eigenen Familie. Warum spreche ich jetzt, nach so langer Zeit darüber? Ich habe lange nicht darüber gesprochen, um die Erinnerungen nicht wach zu halten. Die Wunden sind teilweise verheilt, aber nur oberflächlich. Im Inneren schmerzt es wie am ersten Tag. Ich spreche haute aus zwei Gründen darüber: Im Krankenhaus hat mich eine Schwester auf die Tätowierung auf meinem Arm angesprochen, die sie für meine Telefonnummer hielt. Hat das Schulsystem derart versagt, dass eine Schwester nichts vom Tod von 6 ½ Millionen gewusst hat? Da wurde mir klar, dass man etwas tun muss. Ich nahm mir vor, über Auschwitz zu sprechen. Stop. Interviewer: Entschuldigung, ich höre ... Fr. Rothschild: Das war der erste Grund, warum ich mein Schweigen gebrochen habe. Und dann gibt es noch einen anderen Grund. Ich habe gemerkt, dass sich die Reihen derer, die Auschwitz überlebt haben, leider lichten. Ich habe Angst, dass Auschwitz eines Tages in der Schublade eines Archivs landen wird und niemand mehr Gewissheit haben wird, was dort passiert ist. Diese beiden Gründe haben mich bewogen, mein Schweigen zu brechen und über Auschwitz zu sprechen, so schwer es mir auch fällt. Ich fühle mich nach Auschwitz zurückversetzt. Als ich in Birkenau gearbeitet habe, verhängte die SS eines Abends eine Blocksperre. Ich war jung, deshalb habe ich mein Leben leichtfertig riskiert. Ich schlich mich zur Lagerstraße. Auf beiden Seiten der Straße waren Hochspannungszäune. Auf der Straße standen Frauen und Mädchen, barfuß und spärlich bekleidet, die man im "Krätzeblock" von Auschwitz gesammelt hat. Dorthin kamen diejenigen, die der SS missfallen haben. Wenn der Block voll war, hat man die Frauen vergast. Die Frauen wussten, was mit ihnen passeren würde, aber niemand schrie. Die Frauen beteten. Sie wurden mit Lastautos abgeholt.
Immer wieder hört man, dass die Juden feige waren. Aber sie waren nicht feige, sie hatten sehr viel Würde. Man wird immer wieder gefragt, warum sich die Juden nicht gewehrt haben. Aber wir waren halb verhungert, und die SS bestens ausgestattet. Ich werde Ihnen ein Beispiel dafür geben, dass die Juden nicht feige waren. Das Sonderkommando wurde alle drei Monate ausgetauscht, damit es niemandem etwas erzählen konnte. Und kurz vor Ende von Auschwitz bestand das Sonderkommando aus griechischen Juden. Sie wussten, was man mit ihnen vor hatte. Aus Litzmannstadt/Lodz waren Juden mit Munition gekommen. Das Sonderkommando zündete das Krematorium an. Nach nicht einmal zehn Minuten kam Verstärkung der SS und erschoss diese Griechen. Das ist die Antwort auf die Frage, ‚wart ihr feige?'. Nein, außergewöhnlich tapfer und würdig. Interviewer: Ich stelle jetzt eine Frage. Was haben Sie in Auschwitz gearbeitet? Fr. Rothschild: In Auschwitz habe ich für das Krematorium gearbeitet. Das hieß auch [Scheschinka] auf Polnisch, das heißt "der Hügel". Wir haben die Sachen der Vergasten sortiert. Sie haben ihre Wertsachen, ihr Gebetbuch, ihre Bilder in ihrer Kleidung versteckt. Wir haben die Kleidung sortiert und gebündelt. Ich habe in einer Baracke gearbeitet, in der wir die Handtaschen der Vergasten sortiert haben. Eines Abends hatte ich wahnsinnige Angst. Meine Kolleginnen holten den Vorarbeiter. Der Vorarbeiter gab mir einen Stoß, zeigte mir die Flamme und sagte, das seien seine Frau und seine beiden Kinder. Dann ging er wieder. Ich tat etwas Ungewöhnliches, das man sonst in Auschwitz nicht tat. Ich begann zu beten. Man hatte in Auschwitz eigentlich keine Angst. Man hatte vorher Angst davor, dort hinzukommen, aber danach nicht mehr. Deshalb war das ungewöhnlich. An einem anderen Tag sah ich eine schwarze Tasche mit einem Elfenbeinring. Das war die Tasche meiner Mutter. Stop. [Bildschnitt, Gemurmel] Fr. Rothschild: Plötzlich kam wieder eine neue Kiste mit einem Haufen Taschen von Menschen, die man gerade vergast hatte. Obenauf lag eine schwarze Tasche mit einem gelben Elfenbeinring, und ich erkannte die Tasche, die mein Vater meiner Mutter zum Geburtstag geschenkt hatte. Ich teilte das meinen beiden Mitgefangenen mit. Die beiden sagten auf polnisch, ‚die Frau ist verrückt'. Ich habe die Tasche geöffnet und verschiedene Karten gefunden, die meine Mutter an Gefängnisse geschickt hatte, von denen sie glaubte, dass ich dort sei. Die Karten kamen unbekannt zurück. Auf einer Karte, an ein ungarisches Gefängnis, stand: ‚Mein liebes Kind, du sollst niemals straucheln, immer auf Gott vertrauen. Niemals straucheln.' Dieses Motto ist mir geblieben für mein ganzes Leben. Damals ist etwas in mir zerbrochen. Interviewer: Pause. Fr. Rothschild: Wenn ich heute zurückblicke ... Interviewer: Moment. Entschuldigung. Fr. Rothschild: Wenn ich heute zurückblicke, war es der Glaube, der mir damals die Kraft gegeben hat, durchzuhalten und weiterzuleben. Wenn ich gefragt werde, ob ich keine Zweifel hatte, weil Gott einer gläubigen Jüdin nicht geholfen hat, dann ist meine Antwort: ‚Wenn man glaubt, dann fragt man nicht, und wenn man fragt, dann glaubt man nicht." Ich bin Gott dankbar. Er rettete mein Leben und gibt mir heute Halt, ist mir Stütze. Weibl. Stimme: Was zerbrochen. Können Sie mir sagen, was das ... Fr. Rothschild: Nein, das kann ich nicht. Weibl. Stimme: ... wie sich das, [lauter werdend] wie sich das in ihrem Leben nachher ausgewirkt hat? Fr. Rothschild: Nein, das kann ich nicht. Ich möchte dazu nichts sagen. Weibl. Stimme: Aha. Fr. Rothschild: Vielen Dank. Weibl. Stimme: Gut, dann kommt jetzt die ... Fr. Rothschild: Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Sie enschuldigen mich. [Schnitt] Fr. Rothschild: Was war meine letzte - gute Frage ich möchte jetzt auf das eingehen. Weibl. Stimme: Ich sag's noch mal. Kann man ... Fr. Rothschild: Nein, nein. Was habe ich als letztes gesagt? Weibl. Stimme: Sie haben gesagt, ‚der Glaube rettet mich.' Interviewer: Ja. Sie haben gesagt, ‚wer fragt, glaubt nicht, wer glaubt, fragt nicht', und dann haben Sie gesagt, dass der Glaube Sie erhalten hat.
Fr. Rothschild: Ja. Ich möchte auch noch hinzufügen, dass ich an das Gute in den Menschen glaube. Jeder Mensch hat in sich etwas Gutes, und es liegt in seiner Hand, dass das Gute Oberhand gewinnt. Darum habe ich es auch verziehen, aber nicht vergessen! Und das ‚nicht vergessen' erinnert mich gerade an jemanden, der mit diesen Worten gestorben ist. Das war Mala. Man konnte das Lager nicht passieren, außer die SS und eine Lagerläuferin. Sie hieß Mala und war aus Belgien. Sie war jung und schön, war beliebt und sprach mehrere Sprachen. Mala hatte als Einzige die Möglichkeit, von einem Lager ins andere zu gehen. Mala sah, dass die SS das beste Essen hatten. Die Häftlinge mussten bei dem Gelage aufspielen. Mala sah auch, wie man Experimente an Häftlingen machte. Sie sah den Hunger, sie sah die Krankheit und die Not der Häftlinge. Sie beschloss, etwas zu tun; die Menschen draußen zu warnen. Sie beschaffte sich eine SS-Uniform und floh. Man merkte es abends beim Zählappell. Zwei Tage später fand man Mala. Sie lag im Dickicht und hatte sich das Bein gebrochen. Das ganze Lager wurde versammelt. Ein Scharführer brachte Mala auf einem Karren. Mala ist aufgestanden, hat dem Scharführer zwei Ohrfeigen gegeben und hat uns allen gesagt, dass wir nie vergessen dürfen, was passiert ist. Mala kam dann ins Krematorium. Und in der heutigen Zeit ... schon Schluss? Interviewer: Einen besseren Schluss gibt es nicht. [Video bricht ab] Kassette 2: Frau Rothschild in der gleichen Kleidung und am gleichen Platz wie auf Kassette 1. Interviewer: Einen kleinen Augenblick. Moment. Ok. Fr. Rothschild: Nach dem Tod, nach der Ermordung meiner Mutter konnte ich nicht mehr in Auschwitz bleiben und ich war froh, dass man mich auf Transport geschickt hat. Ich war in verschiedenen Konzentrationslagern in kleineren Städten. Im Winter gingen wir ohne Schuhe über ein Gebirge. Und dann, vielleicht war es Ende April - wir wussten ja nicht, welcher Monat es war - kamen wir bei Hamburg in ein Lager, das hieß "Elbgau". Es war gegen Kriegsende, wir bekamen noch weniger zu essen, und ich hatte Durchfall und Fieber. Beim Zählappell holte mich die SS nach vorne. Ich musste die Schuhe ausziehen. Das war mein Todesurteil. Ohne Schuhe konnte man nicht mehr marschieren. Ich lag fiebernd in einer Ecke. Da kam ein Häftling. Ich habe sie nie vorher gesehen, und ich habe sie nachher nie wieder gesehen. Sie brachte mir meine Schuhe zurück. Sie hat mir das Leben gerettet. Nach Elbgau kamen wir auf Transport, d.h. wir wurden in Viehwaggons gepfercht. Die Amerikaner und die Russen kamen näher, aber wir sollten nichts erzählen. Es gab keine Munition mehr, um uns in die Luft zu sprengen oder zu erschießen. Also wollte man uns aushungern. Wir bekamen nichts zu essen. Einmal am Tag wurde der Viehwaggon geöffnet, damit wir austreten konnten. Wir haben das Gras abgeleckt und geschluckt, weil wir so hungrig waren. Am schlimmsten war es in der Nacht. In allen Sprachen rief man nach Brot und tauschte Kochrezepte aus. Je größer der Hunger, desto mehr Kochrezepte und desto mehr Rufe nach Brot. Wir warteten, dass wir austreten konnten, da sahen wir plötzlich, wie sich die SS mit den Hunden entfernte. Wir hatten Angst, aber es passierte nichts. Nach einiger Zeit kamen Menschen mit Uniformen mit einem Roten Kreuz. Sie riefen uns zu: ‚Ihr seid befreit'. Wir konnten es nicht glauben. Wir riefen nach Brot. Sie kamen nach einiger Zeit mit großen Kannen mit Rahm, Zucker und Porridge. Wir haben den Porridge nicht angerührt, aber literweise Rahm und Zucker getrunken. Viele starben in dieser Nacht. In der Baracke roch es schrecklich. Ich ging nach draußen. Dort sah ich, wie jemand die Fahne abnahm. Ich fragte ihn, ‚What are you doing?' Er antwortete mir, dass ein Mensch gestorben sei. Viele Menschen seien gestorben. Und wenn ein Mensch stirbt, trauert man. Da wurde mir bewusst, dass ich wieder ein Mensch bin und dass man um mich trauert. Da kam mir richtig zum Bewusstsein, dass meine Familie ermordet worden war und ich allein war. Damals, und auf der Fähre nach Schweden, fand ich meine ersten Tränen. Das ist meine Geschichte. Das ist mein Leben. Ich bin dankbar, dass ich leben darf. Interviewer: Danke. Weibl. Stimme: Und ich spreche mit ihnen jetzt, und Sie schauen in die Kamera glaube ich. Und ich wollte Ihnen erzählen. ... Tyskland. Interviewer: Sprechen Sie ruhig auf Deutsch. Fr. Rothschild: Darf ich nur etwas sagen? Soll ich mich nicht auf die Seite drehen? Interviewer: Nein! Fr. Rothschild: Herr Professor ... Weibl. Stimme: Also, ich bin in Deutschland geboren. Fr. Rothschild: Das merkt man. Berlin. Weibl. Stimme: Nee, nee. In Schlesien, an der Oder, in einer kleinen Stadt, die heute zu Polen gehört. Damals Nieder-, oder Ober-, oder Mittelschlesien. Es hieß Glogau. Eine Kleinstadt. Und 39 noch, im
April, ist es meiner Familie gelungen, herauszukommen, und wir waren auf dem Weg nach Brasilien und sollten in Schweden ein Schiff nehmen. Dort sollten wir erst einmal ein Visum erhalten. Es kam nie. Statt dessen kam der Krieg, und wir mussten in Schweden bleiben. So bin ich Schwedin geworden. Ich bin viel lieber mit einem schwedischen Pass in Schweden aufgewachsen, als nach Brasilien. Das ist also meine Geschichte. [Stille.] Dieser Ort in Schweden - also erst waren wir in Stockholm, und nach drei Jahren hat mein Vater dann eine Arbeitsgenehmigung bekommen und wir kamen nach Südschweden, nach Smaland. Das ist eine karge Landschaft. Wir wohnten an der Ostküste, sehr schön gelegen. Dort habe ich meine Jugend bis zum Abitur verbracht. Das Dorf hatte etwa 3000 Einwohner, und die Stadt, wo ich zur Schule ging, hatte 10000. Ich bin also auf dem Land aufgewachsen. Mein Mann ist ein Großstadtmensch. Ich könnte aber gut auf dem Land wohnen. Männl. Stimme: Damals studierte ich in London. Ich habe 1943 in Malmö alle dänischen Juden, die sich retten konnten, bei ihrer Ankunft erlebt. Interviewer: Bitte schauen Sie in die Kamera. Männl. Stimme: Im Prinzip hätten wir uns da auch begegnen können. Wir haben gemeinsame Freunde in Kopenhagen. Die dänischen Juden, die in Malmö waren, haben dann später Jüdinnen geheiratet, und wir waren immer bei ihren Hochzeiten. Jetzt sind das alles ältere Herrschaften geworden, mit grauen Haaren oder gar keinen Haaren. In Malmö gab es eine kleine Gemeinde, und in Kopenhagen eine große Gemeinde. Wir haben von den Dänen viel gelernt. ... Hast du genug Einstellungen? 2: Eine würde ich gerne noch. Zwanzig Sekunden hätte ich gerne noch. Männl. Stimme: Ja, gut. Weibl. Stimme: Erzähl, warum die Malmöer Juden ... Männl. Stimme: Die Malmöer haben ihre Rabbonim sehr schlecht behandelt. (Spricht über die Rabbiner von Malmö.) Die Gruppe spricht über verschiedene Rabbiner. Der Interviewer versucht, eine bestimmte Einstellung bzw. ein Bild von Frau Rothschild zu bekommen. 2: Meine Frau macht ein gutes Bild von Ihnen, und wir machen auch gute Bilder von Ihnen. Wir sind Profis. [Lange dauernde Stille] Ein Foto wird gemacht. [Video bricht ab.] - Der Weg nach Auschwitz - Sachsenhausen/Oranienburg (Schweiz) n.b./fa/U/VHS ... Kassette 1: Baracken, von denen jede eine andere Aufschrift trägt: Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Wehrhaftigkeit, Opfersinn, etc. Die Bilder wiederholen sich mehrmals. Ein Mann mit Kippa spielt Gitarre und singt auf Jiddisch ein trauriges Lied. Das Lied wiederholt sich. Schnitt. ..Der Sänger in Sachenshausen, wo er über die Entstehung des Liedes "Der jiddischer Toitengesang - tsen Brider senen mir gewen" spricht. [Tsen Brider / Zehn Brüder von Martin Rosenberg] Er sieht es als seine Aufgabe an, dieses Lied vorzutragen. Wiederholter Kameraschwenk über das Lager und zurück zum Sänger. ..Die gleichen Aufnahmen werden mehrmals wiederholt: Kameraschwenk über das Lager zum Sänger, der über das Lied und seine Geschichte spricht. ...Aufnahmen der Gedenkstätte Sachsenhausen. Auch hier werden die gleichen Aufnahmen mehrmals gezeigt. ...Der Sänger vor dem "Leichenkeller" in der Gedenkstätte. Er erzählt, dass er am 25.09.1992 die Gedenkstätte Sachsenhausen besucht hatte. Er trug eine Kippa, weil Sachsenhausen eine Gedenkstätte ist. Zwei ältere Männer lachten ihn aus und behaupteten, dass es gar keine Vergasungen gegeben habe und alles eine Lüge der Alliierten sei. Wenige Stunden später wurde der Brandanschlag auf die jüdische Baracke verübt, die dabei völlig ausbrannte. (Auch diese Aussage wird mehrmals gezeigt.) ...Portraitfoto eines Mannes und andere Fotos werden eingeblendet. Text "Jüdischer Todessang" wird als Ganzes und noch einmal sehr langsam Stück für Stück eingeblendet. ...Häftlingskleidung und Holzschuhe werden gezeigt. (Bricht ab bei 0:36 min.) Kassette 2: ...Namen auf Gedenktafeln werden gezeigt. Unterschiedliche Kameraeinstellungen. Schild "Juden im KZ Sachsenhausen" der Ausstellung in der Gedenkstätte.
Eisernes Tor mit Schrift "Arbeit macht frei". Zwei Besucher betreten die Gedenkstätte. (Bricht ab. ) - Vision und Wirklichkeit – Judenbuche (P.v.Zahn) n.b. - Warum, liebe Mutter, warum? Kinderzeichnungen aus Theresienstadt n.b./U - Wie Juden leben n.b./fa Spielfilme - Jud Süss (Jew Suss) (Großbritannien/1934) n.b. - Fürchte Dich nicht, Jakob! (Spielfilm/BRD/1980) n.b./fa Die gleichnishaft angelegte Leidensgeschichte eines jungen Juden, der sich mit seiner hochschwangeren Frau auf der Flucht vor Pogromen in Rußland in eine vermeintlich sichere Region zurückzieht, aber auch dort seine Angst vor Verfolgung nicht los wird. In der Osternacht, während seine Frau in den Wehen liegt, bestraft er seinen dämoni- schen Erzfeid im Dorf mit der Härte der Verzweiflung. Der seit 1974 in der Bundesrepublik lebende Rumäne Gabrea inszenierte die bedrückende, mit vielen düsteren Symbolen und religiösen Querverweisen versehene Geschichte sehr holzschnittartig – in einem Szenengebilde voller Ahnungen und verborgener Schrecken. Kein rundum gelungener, aber doch betroffen machender Film über Rassismus und religiöse Intoleranz. - Georg Benjamin 1895 – 1942, Nachdenken über ein Leben (D/1990) n.b./fa Film über Leben und Wirken des jüdischen Arztes Georg Benjamin. - Hades (BRD/1994) n.b./fa Der Unterweltgott Hades betreibt irgendwo vor den Toren Münchens ein Bestattungs- unternehmen. Er hat selbst hat Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Die jüdische Mutter kam mit seiner kleinen Schwester im Ghetto um. Und in der Stunde des eigenen Todes, erschlagen von einem Neonazi, erinnert er sich an seine Kindheit im Ghetto. Er ist der kleine Junge, den die SS-Soldaten tanzen ließen und dabei filmten. - Zwei Tage von vielen (BRD) n.b. Christa Landmann, Leiterin des Hilfswerk beim bischöflichen Ordinat in Berlin, versucht den von der Gestapo bedrängten und verhafteten Juden zu helfen. An dem Schicksal einzelner Menschen wird gezeigt, wie sie u.a. einen kleinen Jungen, der Halbjude ist und in einem Sammellager von seiner Mutter getrennt wird, auf Anord- nung der Lagerleitung anderweitig unterbringt, die Verschickung eines Juden, der von seiner Frau getrennt lebt, zu verhindern weiß oder einer jungen Frau, die zum Arbeitseinsatz verpflichtet wird, eine leichtere Arbeit als Näherin zu vermitteln weiß. Bei ihren Aktionen gerät sie immer mehr in Konflikt mit den staatlichen Vorschriften. Nachdem sie zunächst einmal vom Rasse- und Siedlungshauptamt verwarnt wird, wird ihr einige Monate später durch einen jüdischen Mittelsmann mitgeteilt, dass ihre Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Frau Landmann will nicht fliehen und hofft, dass alles gut ausgeht. Der Ausgang des Filmes wird offengehalten. - Gespräch im Gebirg (BRD/1999) n.b./fa Ein Filmessay über die Erzählung 'Gespräch im Gebirg' des Lyrikers Paul Celan aus dem Jahre 1959 - und gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit dem problematischen Verhältnis von Bild und Wort. (hat Spielfilmcharakter) Im Juli 1959 reiste der jüdische Lyriker Paul Celan von Paris aus mit Frau und Kind nach Sils-Maria in die Ferien. Er wollte im Engadin den Philosophen Theodor W. Adorno treffen, der mit seinem Satz '...nach Auschwitz Gedichte zu schreiben, ist barbarisch...' eine bis heute aktuelle Kontroverse ausgelöst hatte. Aber Adorno rschien nicht. Das Treffen fand nicht statt. Celan kehrte vorzeitig nach Paris zurück und schrieb die bedrückend schöne Erzählung 'Gespräch im Gebirg', in der sich zwei Juden im nächtlichen Gebirg begegnen. - Babij Jar (Spielfilm/2001) n.b./U Bis zum Herbst 1941 haben jüdische und russische Familien in Kiew friedlich als Nach-
barn nebeneinander gelebt. Als die Rote Armee von den vorrückenden deutschen Truppen aus der Stadt getrieben wird, treffen mit den deutschen Soldaten auch die Nachrichten von der Ermordung und Vertreibung jüdischer Menschen ein. Die Deut- schen planen den Völkermord kühl als militärische Operation. Die Angst macht selbst alte Freunde zu Feinden und Verrätern. Im Mittelpunkt des durchgehend schwarz- weiß gedrehten Dramas stehen die - durch eine Liebesgeschichte verknüpften – Schicksale einer jüdischen und einer ukrainischen Familie. Die an der Produktion beteiligten Historiker haben das Massaker anhand von Einsatzbefehlen und den Protokollen der Nürnberger Prozesse rekonstruiert. - Die Rollbahn (BRD/2002) n.b./fa Im Herbst 1944 begannen die Bauarbeiten an der ersten Rollbahn des Frankfurter Flughafens, die vornehmlich von jüdischen Arbeitssklavinnen geleistet wurden. 19 überlebende Frauen werden 2000 auf ihrer Erinnerungsreise begleitet. - Rosenstraße (BRD/2003) n.b./fa Nach dem Tod ihres Mannes besinnt sich die New Yorkerin Ruth Weinstein plötzlich auf jüdisch-orthodoxe Rituale und wendet sich zudem gegen die Heirat ihrer Tochter Hannah mit derem südamerikanischen Verlobten. Verstört reist Hannah nach Berlin, um dort nach der Vergangenheit ihrer Mutter zu forschen. Ihr Weg in Ruths Geburts- land, von deren Kindheit vor der Emigration in die USA Hannah so gut wie nichts weiß, führt sie zu der 90-jährigen Berlinerin Lena Fischer. Diese erzählt ihr, wie sie sich 1943 der kleinen Ruth annahm in der Rosenstraße, wo Gestapo und SS sogenannte "Mischlinge" und Juden aus "Mischehen" inhaftiert hatten. Lena Fischers Geschichte erzählt somit nicht nur von ihr selbst und der kleinen Ruth, sondern auch vom Widerstand aufrechter Frauen im Februar und März 1943, die als Demonstrantinnen in der Rosenstraße auf die Freilassung ihrer inhaftierten Angehörigen drängten. - Der neunte Tag (BRD/Luixemburg/2003/04) n.b./fa/U Dem Luxemburger Abbé Kremer widerfährt das Unglaubliche, als er völlig unerwartet für kurze Zeit aus dem KZ entlassen wird. Jeden Tag muss er sich nun bei dem Luxemburger Gestapo-Chef Gebhardt melden. Im Verlauf dieser Treffen kommt es zwischen dem beinharten Nazi-Karrieristen und dem integren Geistlichen zu einem intellektuellen Rede- und Gedankenduell, in dessen Verlauf die Unterschiede aber auch die Ähnlichkeiten ihrer Charaktere offenbar werden. - Alles auf Zucker (BRD/2004) n.b./Fa/U Es läuft nicht gut für den Ex-DDR-Sportreporter Jaecki Zucker: Finanziell steht der schlitzohrige Zocker vor dem Ruin und seine resolute Ehefrau droht damit, ihn zu verlassen. In dieser Situation kommt das Erbe von Jaeckis Mutter gerade recht. Die Sache hat nur einen Haken: Um das Erbe zu erhalten, muss Jaecki sich mit seinem Bruder Samuel, einem orthodoxen Juden, versöhnen. Nur hat Jaecki mit der Religion seiner Vorväter bislang nicht allzu viel am Hut gehabt ... - Der letzte Zug (Spielfilm/BRD/Tschech. Republik/2005) n.b./fa/U Zum Gedenken an die Deportation der Juden aus Berlin versammelt sich im Jahr 2005 eine Gruppe Menschen am Berliner S-Bahnhof Wannsee. Unter ihnen Nina und Ruth, die 1943 ab Grunewald nach Ausschwitz transportiert werden sollten und sich nun zurück erinnern: Die SS treibt jüdische Mitbürger auf den Bahnsteigen zu- sammen, zu denen u.a. Doktor Friedlich, seine Frau Erika und ihr Säugling sowie das junge Liebespaar Albert und Ruth gehören. Auch das Künstler-Ehepaar Jakob und Gabrielle Noschik befindet sich in den Waggons des Zuges, der als letzter den Bahnhof verlässt. Keinem von ihnen war es gelungen sich in seinem Versteck vor der Deportation zu retten. Auch dem Boxer Henry und seiner Frau Lea gelang es rotz Beziehungen nicht das Land rechtzeitig zu verlassen. Es beginnt die sechs- tägige Fahrt, auf denen viele Opfer der Enge, Hitze, des Durstes oder des Hungers werden. Einige der Gefangenen versuchen mit letzter Kraft zu fliehen. Nina und Ruth gelingt es und sie entgehen dem sicheren Tod. Heute sind sie die einzigen, die von der Fahrt im letzten Zug erzählen können.
Fehler in alter Liste: - Die Stadt ohne Juden (Niederlande/1924/Spielfilm) n.b./vir. → Österreich Aktualita Böhmen Cechy 1983/1942 → 1938 - Der Augenzeuge 20/1956 1957? oder Nr. 2/1956? Fehler in BMO: - Zeitabschnitte des Werner Bab (BDR/2005) → in BMO Bob! NICHT IM BUNDESARCHIV Bitte kontaktieren Sie für die Nutzung von BLICK IN DIE WELT Cinecentrum Hamburg. Das Bundesarchiv hält keinerlei Materialien mehr vor. - Blick in die Welt 37/1946 ... Wallfahrt ehemaliger KZ-Häftlinge bzw. Zwangarbeiter nach Lourdes, die dort eine Heiligensprechung ersuchen. - Blick in die Welt 24/1947 ... jüdische Ostern - Blick in die Welt 51/1949 ..Besuch von Bundespräsident Heuß in Hessen. Wiesbaden: Feier der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. - Blick in die Welt 20/1957 ...Wir erinnern uns: Archivaufnahmen von Häftlingen und Luftbildaufnahmen des Konzentrationslagers Buchenwald. Männer mit einer tätowierten Häftlingsnummer.































































































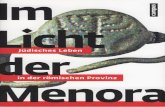




![["Jewish Regional Organization in the Rhineland - the Kehillot Shum around 1300."] "Jüdische Regionalorganisation am Mittelrhein. Die Kehillot Schum um 1300."](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63356a48a1ced1126c0ac8ca/jewish-regional-organization-in-the-rhineland-the-kehillot-shum-around-1300.jpg)














