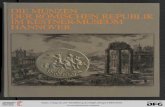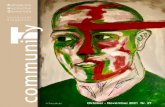1995 Jüdische Gemeinde in dem römischen Pannonien
Transcript of 1995 Jüdische Gemeinde in dem römischen Pannonien
SPECIMINA NOVADISSERTATIONUM EX INSTITUTO
HISTORICO UNIVERSITATIS Q UINQ UEECCLESIENSIS
DE IANO PANNONIO NOMINATAE
Apecsi
Janus Pannonius Tudomdnyegyetem Törtenelmi T
EVKÖNYVEXI, 1995
Redactio: Janus Pannonius TudomänyegyetemBölcseszettudomänyi Kar Törtenettudomänyi Tanszekcsoport H - 7624 Pecs Rökus u. 2-4.Tel.: 72/315 932
Terminus inmittendarum in redactionem dissertationum: Kalendis Novembribus
Specimina nova in commerciali usu inveniri non possunt sed per commutationem:
Janus Pannonius Tudomänyegyetem Ökortörteneti es Regeszeti Tanszek I-I - 7624 Pecs Rökus u. 2-4.
BORNUSxaiigifiiahi K/r. IkiMjtiiut li ii
SPECIMINA NOVA DISSERTATIONUM EX INSTITUTIS HISTORICIS UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS
DE IANO PANNONIO NOMINATAE
TOMUS XI PARS PRIMA
A PECSI JANUS PANNONIUS TUDOMÄNYEGYETEM TÖRTENETTUDOMÄNYI TANSZEKEINEK EVKÖNYVE
PECS 1995
SPECIMINA NOVA UNIVERSITATIS QUINQUEECCLESIENSIS XI 1995
ISTVÄN TÖTH:
JÜDISCHE GEMEINDE IN DEM RÖMISCHEN PANNONIEN
G. Alföldy sexagenario
Die aus Pannonien bekannt gewordenen jüdischen Denkmäler religiösen Charakters wurden bisher mehrmals zusammengestellt und ausgewertet. Neben den corpus-artigen Sammlungen1 von S. Krausz am Anfang dieses Jh. und S. Scheiber neuerlich erklärten die Arbeiten2 von G. Radan und H. Solin die historischen und religiösen Verhältnisse der jüdischen Bevölkerung Pannoniens beruhigenderweise. Aus dem äußerst vielfältigen Denkmalmaterial lernten wir bisher zwei solchen Inschriften kennen, die organisierte Religionsgemeinden der hier lebenden jüdischen Bevölkerung erwähnen. Sie sind wie folgt:
1. In tercisa (Dunaüjväros)3
Deo Aeterno pro sal(ute) d(omini) n(ostri) Sev(eri) Alexandri P(ii) F(elicis) Aug(usti) et Iul(iae) Mamaeae Aug(ustae) mat(ris) Aug(usti) vot(um) red(dit) l(ibens) Cosmius pr(aepositus) stat(ionis) Spondill. a(rchi)syna(gogus) Iud(a)eor(um).
Demgemäß wurde die Inschrift für die Ehre des Kaisers Alexander Severus und seiner Mutter, der Kaiserin Iulia Mamaea von dem Zollbeamter Cosmius, Leiter der Zollstation Spondill... gestellt. Er war gleichzeitig Vorstand, archisynagogus, der örtlichen jüdischen Gemeinde4. Die Inschrift, und folglich das Bestehen der organisierten jüdischen Gemeinde in Intercisa, läßt sich aufgrund der beiden erwähnten Kaisemamen eindeutig auf die Jahre zwischen 222 und 235 datieren. (Abb. 1.)
1 S. K rausz: Röm ai em lekek pannoniai zsidökröl (Römische Denkmäler über die pannonischen Juden). In: Izr. M agyar Irod. Tärs. fivkönyve 1902, 243-304, S. Scheiber: The Jewish Inscriptions from Hungary. Budapest - Leiden 1983 (in den Folgenden: JIH).
2 G. Radan: Comm ents on the History of Jews in Pannonia. ActaArchHung 25, 1973, 265-278, H. Solin: Zu pannonischen Juden. Ebenda 41, 1989, 233-23.
3 CIL III 3327 * 10301; J.B. Frey: Corpus Inscriptionum Iudaicorum. Roma 1936 I, 677; G. Erdelyi - F. Fülep in: Intercisa I (ArchHung 33) Budapest 1954, No. 329; Scheiber, JIH No. 4; Radan o.e. (Anm. 2) 268; RIU 1051 (J. Fitz).
4 Die frühere abweichende Lesung des W ortes archisynagogus siehe RIU 1051. - Die hiesige Lesung wurde angenommen von T. Rajak - D. Noy: Archisynagogoi: Office, T itle and Social Status in the G reco-Jewish Synagoge. JRS 83, 1993, 75-94; No. 27.
179
D E O A ET ER\j0>p RoTAiD"Ns S EVAFXA/L)RiTTA/g;T!0REÖ-LC°5WWi-PRsta-s p o D i l l a -STw ag
Abb. 1 - Die Synagoga - Inschrift aus Intercisa
2. M ursa (Osijek, Eszek)5
Aus der stark beschädigten Inschrift zitieren wir hier bloß die für das Thema wichtigen Teilen. Demgemäß wurde sie für die Ehre des Kaisers Septimius Severus und seiner Söhne von einer unbekannten Person, der [...projseucham [Iudaeor(um) vetujstate [collapsam a so]lo [extruxit oder restituit], also das vom Alter zusammengebrochene jüdische Bethaus {proseucha) auf eigene Kosten renovieren ließ. Die Datierung ist auch diesmal einwandfrei: die zweite Hälfte der Regierung des Septimius Severus zwischen 198 und 211.
Zu diesen beiden Inschriften läßt sich nun eine dritte anschließen, von der wir hier nachweisen möchten, daß es ebenfalls um das Bestehen einer jüdischen Glaubensgemeinde handelt.
Das monumentale Werk der römischen Inschriften, die im ausgehenden 19. Jh. von Th. Mommsen und seinen Mitarbeitern herausgegeben wurde, das Corpus Inscriptionum Latinarum, macht ein Inschriftbruchstück aus Brigetio (Öszöny) bekannt (Abb. 2.), das am Ende des vorigen Jh. in der Sammlung der Reformierten Hochschule von Päpa6 noch
5 D. Pelrovic, O sjecki Zbom ik 7, 1960, 28; 1962-1963, 61 ff.; Radan o.e. (Anm. 2) 266, Anm. 13; Scheiber JIH No. 8.
‘ I. Borsos: A pdpai ev. Ref. Föiskola Rcgisegtaränak es Törtenet-philologiai M uzeum anak katalögusa. (Sonderdruck aus der firtesitö.) Papa 1899, 37; CIL UI 10998; L. Barköczi; Brigetio. D issPann 11:22. 1951, No. 250; RIU 400 (L. Barkoczi).
180
10998 Ö-Szöny r e p .; nunc Päpa in collegio reformatorum.
5
Descripsi.
Abb. 2. - Die Inschrift von Brigetio im Corpus
auffindig war, seit seiner letzten Erwähnung in 1899 aber wurde es verschollen. In seiner letzten Erwähnung wurde die Inschrift von I. Borsos folgendermäßig beschrieben:"... Votivtafel, deren eine Hälfte bedauerlicherweise abgebrochen ist. Größe 50 cm, Breite 39 cm, Dicke etwa 5 cm. Die Buchstaben sind groß und schön". Aus den Größenangaben folgt, daß die ursprüngliche Breite der Tafel etwa 80-85 cm sein konnte. Angesichts der Bemerkung von Borsos über die "großen und schönen", also sicherlich regelmäßig und proportionell geformten Buchstaben, kann man sich eine gleichmäßige und symmetrische Textverteilung vorstellen. Der erhalten gebliebene Text ist wie folgt:
DEOAETER[.„]GAM PR[...]A[...]CLAVDIA P[...]OVE PECVN[...]FECIT EX V[...]
Aufgrund der erhalten gebliebenen Wortreste kann als gesichert angenommen werden, daß die Inschrift eine D onation-, am wahrscheinlichsten eine Bauinschrift war, die die Großzügigkeit einer bestimmten Claudia P... auf die Ehre des Deus M[agnus] Aeter[nus] - Großen Ewigen Gottes - verewigte. Unter dem übrigens allgemein zu verstehenden
O V E • PE C V lJiia tuet
F E C IT • EX • j 'o fo
181
Gottesname - neben anderen Möglichkeiten7 - kann am liebsten Jahve verstanden werden8.Die Ergänzung des Inschriftbruchstückes läßt sich aufgmnd der 6. und 7. Zeilen
versuchen. Diese beiden Zeilen lassen nämlich für möglich eine einwandfreie Ergänzung in der Form von ... pecun[ia] / sua fecit ex v[oto]. Die Ergänzung dieser Zeilen ermessen gleichzeitig die Anzahl der Buchstaben in den weiteren Zeilen. So können wir die Buchstabenzahl von 13 der 6. Zeile für die anderen Zeilen als maßgebend betrachten. Davon konnten Zeilen 4 und 1 abweichen, die eine wegen ihrer symmetrisch eingemeißelten wenigen, die andere wegen ihrer wohl größeren Buchstaben.
Nach diesen Überlegungen muß man solche Ergänzungen finden, die drei Kriterein entsprechen:- sie stehen im Einklang mit dem Charakter der Inschrift;- in den einzelnen Zeilen stehen maximum 13 Buchstaben;- sie beziehen sich auf die Ehre des Ewigen Gottes der Juden.
Aufgrund der Verwirklichung dieser Premissen lassen sich die folgenden Ergänzungen vorgeschlagen werden.
Zeile 1 - zwischen die Worte M[agno] in dieser Zeile und Aeter[no] in der 2. Zeile läßt sich kein anderes Wort einlegen (sogar auch et nicht). So muß man annehmen, daß die hiesigen Buchstaben - entsprechend der allgemeinen epigraphischen Praxis - größerer waren als die weiteren Buchstaben. Die erste Zeile wurde also durch die 8 Buchstaben der beiden Worte ausgefüllt.
Zeile 2 - In der zweiten Hälfte der Zeile muß ein solcher Wortteil gestanden haben, der den durch die Inschrift angedeuteten Bau benannte, und der die erste Hälfte des in der 3. Zeile lesbaren, im Accusativ stehenden Wortrestes ...gam bildete. Dieser und der oben benannten Bedingungen entspricht gleichzeitig die Ergänzung [synago]/gam.
Zeile 3 - Eine der im ersten Blick für sehr wahrscheinlich scheinenden Formeln pr[o salute...] oder pr[o se e t ...] machen nicht nur religiöse Überlegungen für kaum möglich, sondern auch das schwierige Einsetzen dieser Formeln in den ganzen Text der Inschrift. So kann hier wohl mit einem unmittelbar auf die synagoga sich beziehenden Ausdruck oder Attribut gerechnet werden. Von den in Betracht kommenden Möglichkeiten scheint am liebsten der Ausdruck pr[oseucham] (Acc.) richtig zu sein, denn dieses griechische Wort als Synonym, ergänzender Ausdruck der Synagoga von den kaiserzeitlichen jüdischen Gemeinden verwendet wurde9. Wir kennen sogar ihr pannonisches Vorkommen (s. weiter oben). Darüber hinaus entspricht das Vorkommen dieses verhältnißmäßig seltenen
7 F. Cumont: Les religions orientales dans le paganisme Romain. Paris 1929, 120; S. Sanie, in: H ommäges a M. J. V ermaseren III. Leiden 1978, 1092.
* S. Scheiber, The Jewisch Q uarterly Review (N.S.) 45, 1954, 45; Z. Kädär: D ie kleinasiatisch-syrischen Kulte zur Römerzcit in Ungarn. Leiden 1961, 25.
9 Die Angaben von H. Comfort im Artikel von D. Pinterovic, Osjecki Sbom ik 9-10, 1962-1963, 72 ff. S. weiterhin die Feststellungen von G. Radan und S. Schreiber in ihren in der Anmerkung 5 zitierten W erken. - A llgemein über proseucha s. S. Kraus, Synagogale A lterthümer. Berlin-W ien 1922, 18 ff.
182
griechischen Ausdruckes in dem lateinischen Text unserer Inschrift dem auch in anderen Fällen beobachteten polyglotten Sprachgebrauch der donauländischen, näher bestimmt
_A E" T EG A H ' FA/CHAM
AVS OLD ^ R IA D IL IO
Q V E 7 PECVI F E C IT* EX.vVOTO
Abb. 3 - Die Ergänzung der Inschrift von Brigetio
pannonischen jüdischen Gemeinden vollständig10.Angenommen die Richtigkeit dieses Ergänzungsvorschlags läuten die 2. und 3.
Zeilen wie folgt: ,..[synago]/gam pr[oseucham]. Den Accusativ der beiden Worte beurteilt das W ort/erif in Zeile 7.
Zeile 4 - Die Ergänzung der in der Nähe der Achse beginnenden kurzen Zeile kann kaum anders ergänzt werden als a [solo], also der gewöhnliche Hinweis auf die Selbstfinanzierung der Bautätigkeit.
Zeile 5 - Der die erste Hälfte der Zeile ausfüllende Familienname braucht kein Kommentar, die Ergänzung der darauffolgende P[...] als cognomen scheint aber aussichtslos zu sein. Ein
Radan, o.e. (Anm. 2) 272 f. - D er gem ischte griechisch-römische Sprachgebrauch läßt sich in den meisten pannonischen Inschriften jüdischen Charakters beobachten, cf. Scheiber, JIH, passim.
183
einziger, epigraphisch begründeter Vorschlag kann dann angenommen werden, falls die drei Buchstaben am Anfang der Zeile 6 als QVE zu lesen sind, denn so muß das mit P beginnende cognomen angesichts der Zeilenlänge mit 13 Buchstaben äußerst kurz gewesen sein, weil in diesem Fall noch ein weiteres, sich dem -que anschließendes Wort in der Zeile 5 Platz nahm. So kann etwa eine Ergänzung wie Claudia P[ia?filio]/que vorgestellt werden. Eine andere, mit weniger Wahrscheinlichkeit annehmbare Lösung könnte sein, wenn die drei Buchstaben am Anfang der Zeile 6 OVE wären. In diesem Fall könnte es in der Form von P[...]ove in den Zeilen 5-6 um einen kaum interpretierbaren, vielleicht hebräischen Frauennamen handeln. Wir geben den Vorteil der ersten Möglichkeit.
Die Ergänzung der Zeilen 6-7 ist problemlos: ... pecun[ia sua] / fecit ex v[oto]. Eine Beurteilung ist aber erforderlich hier zum Ausdruck ex v[oto], da diese, im Grunde genommen der römischen religio gehörende Formel (votum) von der jüdischen Religion sowohl förmlich als auch inhaltlich vollständig fremd war. Obwohl diese Feststellung scheint vollständig richtig zu sein, laß uns auf die zitierte Inschrift von Intercisa hinweisen, die von einem archisynagogus (Vorstand der gläubigen Gemeinde) gestellt wurde, und in der eine der hiesigen inhaltlich vollständig entsprechende Formel, votum reddit libens, steht". Die hier erscheinenden Formeln scheinen neben der Mehrsprachigkeit der pannonischen Juden auf ihre Elastizität in religiösem Hinsicht zu hinweisen.
Aufgrund der obigen Überlegungen kann die Inschrift wie folgt rekonstruiert werden: M [agno]/Aeter[no synago]/gampr[oseucham]/ a [solo]/ Claudia P[ia?filio]/que pecun[ia sua]/ fe c i t ex v[oto] (Abb. 3.). - Das heißt: Dem ewigen und großen Gott! Diese Versammlungshalle, den Platz des Gebetes, haben Claudia Pia(?) und ihr Sohn aus eigenen Kosten, infolge ihres Gelübdes bauen lassen. - In der kaiserzeitlichen jüdischen religiösen Praxis galt keineswegs für einen Sonderfall, daß Frauen, entweder alleine oder in der Gesellschaft ihres Mannes oder anderer Familienmitglieder als Stifter oder sogar als Bauherrin von Synagogen auftauchen12. Die neue Inschrift liefert also eine neuere Angabe zu dieser religiösen Praxis.
Während die Datierung der Inschriften von Mursa und Intercisa - aufgrund der erwähnten Kaiser - gesichert ist, verfügen wir für die Datierung der in Päpa einst aufbewahrten Inschrift über keinerlei solche unmittelbare Angaben. So muß man die zeitliche Bestimmung der jüdischen Gemeinde von Brigetio auf einem anderen Weg versuchen.
Es ist aus Brigetio (und aus Carnuntum) eine, in den westlichen Provinzen äußerst selten vorkommende orientalische Münze bekannt geworden. Sie wurde von Simon Bar Kochba während des letzten großen jüdischen Aufstandes zwischen 132-135 in Jerusalem geprägt13. Ihr Vorkommen in Pannonien läßt sich nur so erklären, daß Vexillationen der
11 Die Erfüllung eines votum wurde in den W erken der lateinischen Autore und der Inschriften mit den W örtern solvere, dissolvere, persolvere, exsolvere, reddere, referre, sequi, fungere und ähnliche zum Ausdruck gebracht.
12 Rajak - Noy, o.e. (Anm. 4) No. 18 (M ann und Frau), No. 20 und 29 (mehrere Familienmitglieder), und so weiter.
13 L. Barköczi, NumKözl 56-57, 1957-1958, 19; Scheiber JIH 63. - Zum C am untum er Exemplar s. E. Swoboda: Carnuntum, seine Geschichte und seine Denkm äler. G raz-Köln 19644, 201.
184
CARNUNTUM
Visegräd J
ULCISIA CASTRABRIGETIOSOLVA c
AQUINCUM
SAVARIA
in t e r c i s a
Dombövär
SOPIANAE o
Siklös
M URSA O*
SYNAGOGA
Abb. 4 - Jüdische Denkmäler in Pannonien
185
pannonischen Trappen - unter anderem die der in Brigetio stationierten legio I adiutrix - in der blutigen Niederwerfung des Aufstandes von Bar Kochba und in der Zerstörung Jerusalems14 teilgenommen haben, und mit den heimgekehrten Trappen als Kriegsgefangene, Sklaven auch einige solche Personen kamen, für die diese Münze ein auf das Heimatland erinnerndes Andenken sein konnte.
Es ist sicher, daß dies der früheste Termin war, als mit der Schar der heimkehrenden Soldaten auch Juden nach Brigetio gelangen konnten. Dann kann in erster Linie mit den Sklaven, mit dem etwaigen Auftauchen von Kriegsgefangene (wenn ja, nur mit wenigen) gerechnet werden, aber keinesfalls mit solchen, die eine offiziell zugesagte religiöse Gemeinde zustande bringen haben könnten. In den darauffolgenden Jahrzehnten, während der in der Mitte des Jahrhundertes aufgebrochenen und 15 Jahre lang dauernden blutigen Markomannisch-Quadischen Kriege ist das Erscheinen von Einsiedlern aus weit entfernten Gebieten in die aufgerührte Provinz im Grande genommen ebenfalls ausgeschlossen. Nach dem Abschluß des Krieges, nach 180 n. Chr., wurde aber die teils entvölkerte Provinz mit aus den fernen Provinzen stammenden Einsiedlern, darunter mit vielen Orientalen, ergänzt15. Orientalen tauchten in überraschend großer Anzahl eben in Brigetio, wo ein Großteil der städtischen Führerschicht im ausgehenden 2. und am Beginn des 3. Jh. aus den Reihen der syrischen Kaufleute stammte.
Nun ist es wohl kein Fehlschlag anzunehmen, daß gerade diese Zeitspanne sein konnte, als die durch die nachkriegerische Renovation gesteuerte Konjunktur auch die aus ihrer Heimat nach fremden Ländern getriebenen Juden hierher gelockt hat, die - damals schon die zweite oder dritte Generation nach dem Aufstand des Bar Kochba - sich den neuen Lebensbedingungen in vieler Hinsicht anpaßten, und gleichzeitig als Vollbürger das Recht erhielten, selbständige Organisationen zu gründen. Die Kaiser der Severischen Dynastie haben die Orientalen bekanntlich gefördert, Alexander Severus hat mit den Juden besonders sympatisiert. Wir glauben also, daß die synagoga von Brigetio - ähnlich den Gemeinden von Mursa und Intercisa - auf diese Ära zu setzen ist, also in die Periode zwischen 193 und 235.
14 S. dazu A. Möcsy: Pannonia. PW -RE Suppl. 9, 1962, 627.
15 L. Barköczi, A ctaArchH ung 16, 1964, 292 ff.
CONTINENTUR
BARKÖCZI Läszlo: Eaglehead-Omamented Sword-Hilts and Scrinia................................. 3
BORHY Läszlo: Überlegungen zur Bedeutung der Aussage
"aeternitas mea" des Constantius II. bei A m m ian ...................................................23
FEKETE Maria: Etliches über die hallstattzeitlichen Hortfunde
Transdanubiens..................................................................................................................37
GESZTELYI Tamäs: Religiosität der Aristokratie................................................................... 49
HAINZMANN, Manfred: Fragen der Militär- und Zivilverwaltung
(Ufer-) Norikums............................................................................................................. 59
HEGYI Dolores: Die Gründung der isthmistsche Spiele......................................................... 71
KERTESZ Istvän: Bemerkungen zur Inschrift Ogis Nr. 338................................................. 79
KISS Magdolna: Anmerkungen zu dem in "Getica" gezeichneten Bild
von Alarich........................................................................................................................ 81
KOVÄCS Peter: The Porta Praetoria and the Northwestern Angle
Tower of M atrica..............................................................................................................91
LENGVÄRI Istvän: Grain Storage Pits From Lussonium Roman Fort...........................113
LÖRINCZ Barnabäs: Ein neuer Ritter aus Pannonien..............................................................127
MÖSER Ibolya: Die Juden in I. Jh. n. Chr. im römischen Reich.................................... 131
NAGY Mihäly: A Double Building Inscription From Pannonhalma.................................. 147
PISO, Ioan: Zum Munizipalleben von Apulum und Sarmizegetusa................................... 155
SZIRMAI Krisztina: Adlocutio in Aquincum...........................................................................165
TAKÄCS Sarolta: The Travels of Two Men and an Obelisk...............................................175
TÖTH Istvän: Jüdische Gemeinde in dem römischen Pannonien.......................................179
VADAY Andrea: Roman Barrel-Wooded W ells..................................................................... 187
VILMOS Läszlo: Dispute-Settlement in Homer.......................................................................199
VISY Zsolt: Bemerkungen zur Frage der Länge des Militärdienstes
auf Grund der M ilitärdiplome..................................................................................... 223
WEBER, Ekkehard: Ein Beschriftetes Lotgewicht aus Carnuntum.................................... 231
FONT Martha: Einige Repräsentanten des Kleinadels im polnisch
ungarischen Grenzgebiet im 13. Jh. und die Zukunft Ihrer Familien................ 237
KOSZTOLNYIK J. Zoltän: Early Hungarian Towns, and Town Life,
in the Record of Western Chronicles.........................................................................251
RAJMAN, Jerzy-URBAN, Waclaw: Die Ungarn bei Krakau im frühen
M itte la lter.......................................................................................................................................261
SZ. GALÄNTAI Erzsebet: Filippo Tamburini: Santi e peccatori.......................................269