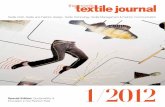Application of composite textile at Fakhruddin Textile Mills ...
Textile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
Transcript of Textile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
22�Textile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
i� Erhaltung und damit die Lesbarkeit von Textilien richten sich nach den Bedingungen in der archäolo-gischen Lagerung. So sind römische Textilfunde in
den Rheinprovinzen Germania inferior und superior – im Gegen-satz etwa zu Ägypten, wo sie oft noch vollständig und in ihrer ursprünglichen Farbigkeit zu Tage treten – zumeist bis an die Wahrnehmungsgrenze fragmentiert und verbräunt. Ihr Informa-tionsgehalt lässt sich meist nur mit großem technischen Auf-wand erschließen.1
Seit 2002 bemühen sich die Reiss-Engelhorn-Museen (rem)2 um eine Untersuchung von gut 130 Fragmenten aus Mainz, die dort in den 1980er Jahren gefunden wurden.3 Dieses Konvo-lut aus der Zeit um ca. 5 v. Chr. bildet den Ausgangspunkt der Forschungen zu Textilien des römischen Heers in Germanien, die mit der Bewilligung des EU-Projekts DressID fünf Jahre später auch die notwendige 3 nanzielle Unterstützung erhielten. So wurde es möglich, auch die Altfunde, die seit der Mitte des 19. Jhs. in Mainz entdeckt und seither auf zahlreiche europäische Sammlungen verteilt wurden, in die Analysen mit einzubezie-hen. Im Verlauf wurden so beinahe 350 Objekte in Mannheim untersucht. Etwa 100 weitere ließen sich in Inventaren, Archiven und älterer Literatur recherchieren, so dass insgesamt von etwa 450, vielleicht sogar 500 Überresten ausgegangen werden kann.4 Die Mainzer Funde bilden damit den wohl bedeutendsten Kom-plex römischer Textilien in Mitteleuropa, für dessen Vergleich
und Einordnung die Arbeiten von John Peter Wild5 und Lise Bender Jørgensen6 eine solide Basis bieten. Diese konnte durch Untersuchungen der rem gemeinsam mit dem Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA) noch erweitert werden.7 Sämt-liche Daten werden nachfolgend zusammen mit den schriftli-chen und bildlichen Zeugnissen ausgewertet.
Zur allgemeinen Lage
Einen grundsätzlichen Eindruck über die Qualität von Textilien im römischen Heer vermittelt ihr schriftlich dokumentierter Be-scha9 ungsaufwand: O; ziell erhielten Angehörige des Militärs zwar seit dem Ende der republikanischen Zeit Unterstützung aus ö9 entlicher Hand bei der Bereitstellung ihrer Ausrüstung,8 dennoch musste jeder Soldat einen gewissen Anteil aus eigener Tasche bestreiten, wie Tacitus in seinen Annalen (I, 17) berich-tet: Dort klagt ein Soldat über den harten und wenig pro3 tablen Dienst, in dem zehn Asse [16 Asse = 1 denarius] am Tag nicht nur für Kleidung, Bewa9 nung und Anteile für ein Zelt reichen sollen, sondern auch noch zum Freikauf von der Grausamkeit der Zen-turionen und vom Dienst überhaupt.9 Daher fehlt es nicht an er-haltenen Bittbriefen an Verwandte. So ersucht etwa der Marine-soldat Terentianus seinen Vater Tiberianus10 eindringlich um die Zusendung eines Mantels, einer gegürteten Tunika und Hosen.11
Textile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
s����� ���s��
D
1 ��� ��� ��������� � ��� �������� ������ ! �� � "� ���#$��� �������� ��� ���� %��� �$��� &'� �������� (�) *+�� � ���� (+) + s gut (c) erzeugten Töne wurden
aufgezeichnet und sind hier als Graphiken wiedergegeben. Bei dem jeweils oben aufgetragenen Sonagramm handelt es sich um ein Schallspektrogramm, in
dem die Stärke der vorhandenen Frequenzkomponenten in rechtwinkligen Koordinaten (x: Zeit-, y: Frequenzachse) dargestellt sind. Das untere Oszillogramm
gibt zudem Auskunft über die zeitliche Entwicklung des Tons.
1a 1b 1c
D,- ./013 4-5 678/9,:4; <<= <>9?@9A@ A>BC@
2FG Der nordwestliche Raum – Die Rheinprovinzen und Britannien
uHIJK LMHIKMNNOJKIJH Bedingungen drapierten Gewebe bildlich dokumentiert (Abb. 3), dann mit einem Prüfgerät ihr Fall be-stimmt (Abb. 4).21 Die Tunika des Gustavsburger Soldaten zeigt insbesondere im unteren Bereich eine kleinteilige, * ache Fälte-lung mit bogenförmigem Verlauf. In guter Übereinstimmung mit den experimentell ermittelten Daten sowie der schriftlichen Überlieferung setzt dies eine gewisse Feinheit und Dichte voraus, die sich am ehesten mit der untersuchten Wolle feiner bis mitt-lerer Qualität deckt. Der Sto0 der paenula wirkt schwerer, ohne
Aus diesen Missständen resultierender Unzufriedenheit in der Armee begegnete Kaiser Diokletian mit einem Höchstprei-sedikt im Jahre 301 n. Chr.12 Das staatliche Eingreifen sicherte den Wert des Solds und so die Interessen der überall im Reich stationierten Legionäre und Auxiliare.13 Für Militärtuniken ers-ter, zweiter und dritter Qualität wurden dort z. B. Preise zwischen maximal 1.000 und 1.500 denarii festgelegt (XXVI, 28–30).
Die Bescha0 enheit von Textilien erschließt sich aus den Schriftquellen jedoch nicht oder nur sehr eingeschränkt. Eine Ausnahme ist die bei Plinius beschriebene Leinenprüfung:14 Gu-tes Leinen soll, zwischen die Zähne genommen und angespielt, einen scharfen, klaren Ton ergeben. Dieses erziele dann auch den doppelten Preis. Ein hier durchgeführtes Experiment bestätigt diese Beobachtung: Schlechte, kurzfasrige Fadenqualität ergibt nur ein dumpfes Geräusch, während der mit steigender Güte immer klarer werdende Ton sich wie bei einer angespielten Saite verlängert (Abb. 1).15
Über Qualitätsstandards informiert auch eine an Weber aus Philadelphia (Arsinoites, Ägypten) gerichtete Anweisung aus dem Jahr 138 n. Chr. für Lieferungen an die römische Armee (BGU VII 1564): Die georderten Tuniken, Decken und »syri-schen« Mäntel sollen bestimmte Warengewichte aufweisen so-wie aus »guter, weicher und reinweißer Wolle ohne Verfärbun-gen« gefertigt werden, »gut und fest gewebt mit guten clavi« sein und dabei »dem Standard entsprechen, ohne Fehler aufzuwei-sen«, also »ihr Geld wert sein«.16
Das Beispiel Rheinprovinzen
Parstellungen römischer Militärangehöriger aus den germa-nischen Provinzen vermitteln einen Eindruck, wie die in den schriftlichen Quellen beschriebenen Textilien ausgesehen haben könnten.17 So trägt ein Soldat auf einem Grabstein aus Gus-tavsburg (Abb. 2) eine bis zur Mitte der Oberschenkel hochge-schürzte Tunika, die in der Taille von zwei diagonal überkreuzten Gürteln mit pteryges vorne gehalten wird.18 Die paenula, einen ponchoartigen Mantel, hat er über der rechten Schulter hochge-nommen. Vermutlich handelt es sich bei dem um den Hals dar-gestellten Wulst um eine zum Mantel gehörende Kapuze über einem verdeckten Halstuch, eventuell auch nur um ein besonders sto0 reiches Halstuch (focale).
Aus der unterschiedlichen Erscheinung der Kleidungsbe-standteile wird ersichtlich, dass verschiedene textile Qualitäten dargestellt wurden. Einer vertiefenden Betrachtung diente eine Versuchsreihe mit den vier gängigsten römerzeitlichen Materia-lien (Leinen, Baumwolle, Wolle und Seide) in jeweils drei Qua-litäten (grob, mittel, fein).20 Zunächst wurde der Faltenwurf der
2 Q����� � ��� Q'������ ��� R����&�+��S (1. Hälfte 1. Jh. n. Chr)
TUV WXYZ[ \V] ^_`XaUb\c def dgafeahe hgjke
2FlTextile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
wmnde sich demnach eine Variante aus der Gruppe der leinwand-
bindigen Wollgewebe anbieten: Hier wird ein geschlossenes Wa-
renbild durch unterschiedlich eingestellte Fadendichten in Ket-
te und Schuss erreicht, was einen rippigen Eindruck erzeugt.22
Diese Gewebe weisen zum Teil auch farbige Bänder auf, die sich
als clavi, den bei Tuniken üblicherweise eingearbeiteten Verzie-
eigentliche Falten und fällt in ruhigen, weichen Wellen. Dies
entspräche am ehesten einem Wollgewebe mittlerer bis grober
Qualität.
Tatsächlich gibt es im Fundmaterial der verschiedenen Mili-
tärstandorte in den Rheinprovinzen Textilien, auf die diese Be-
schreibung zutre$ en könnte. Für eine Verwendung als Tuniken
3 ��� ��� !'o������� '� ���
Faltenwurfs von Baumwolle (a),
Leinen (b), Seide (c) und Schafs-
wolle (d) in feiner Qualität, die
Variationen in Falten verlauf,
-tiefe und -volumen verdeutlicht
3a 3b 3c 3d
4 p� �� %��� �$� &'� ���q'��� (�)r
Leinen (b), Seide (c) und Schafswolle
(d) im Vergleich im Fallprüfgerät.
Im Bild ist Leinen (b) das steifste
Material, sowohl im Hinblick auf den
Fallkoeffi zienten (D) als auch der
geringen Faltenanzahl (n). Seide (c)
fällt sehr tief und hat demnach den
kleinsten Wert für D, dagegen wirft
Wolle (d) die meisten Falten und
erreicht so den Maximalwert für n.
4a 4b
4c 4d
tvx yz{|} ~x� ���z�v�~� ��� �������� �����
2F2 Der nordwestliche Raum – Die Rheinprovinzen und Britannien
�n den Hinterlassenschaften des römischen Heers in den Rheinprovinzen " nden sich jedoch nicht nur Gewandreste, son-dern auch Textilien aus dem technischen Bereich. Ihrem prakti-schen Zweck entspricht die überwiegend gröbere Machart. Da auch textile Schutzausrüstungen zu den technischen Textilien gerechnet werden, sind die Übergänge zur regulären Kleidung & ießend und entsprechend erstreckt sich das qualitative Spek-trum in die Breite.
Für eine technische Verwendung kommen zunächst unverar-beitete textile Rohsto( e in Betracht. Sie eigneten sich etwa für Füllungen, so beim Kalfatern von Booten, wie der Fund eines Faserstrangs aus unaufgeschlossenem Leinen unter einer Schi( s-planke aus dem römischen Hafen von Köln belegt.33
Wichtige Vertreter technischer Textilien sind Schnüre und Seile aller Art, von Lampendochten34 bis hin zu Spannseilen für Katapulte.35 In Brunnensedimenten haben sich häu" g Reste von Ziehseilen aus Basten erhalten, also streifenweise abgeschälter und dann miteinander verdrehter Baumrinde. Der Einsatz der feuchtebeständigen Baste für »nasse« Verwendungen ist in Zen-traleuropa seit der Mittelsteinzeit tradiert.36 Der wohl geläu" gste Rohsto( ist Lindenbast, für die römische Zeit wurden vor allem Eichenbaste bestimmt,37 deren praktische Eignung allerdings von der experimentellen Archäologie angezweifelt wird.38 Die im Rahmen von DressID untersuchten Seile vom Kastell Saal-burg 39 sind mit einem Durchmesser von etwa 1–2 cm auch für schwerere Lasten gut geeignet (Abb. 7). Für eine erhöhte Festig-keit bestehen sie häu" g aus mehrfach miteinander verwundenen Baststrängen. Wie auch die Beispiele aus dem nahen Zugman-tel40 zeigen, wurden sie dabei fast ausnahmslos erst in s-Richtung verdreht und dann gegenläu" g verzwirnt. Hier lassen sich wohl unterschiedliche Herstellungstechniken fassen: Vermutlich wur-den die Seile, wie es ein Schuhmacher auf einem Sarkophagrelief aus Ostia zeigt,41 mit der Spindel auf dem Oberschenkel erstellt, was bei Rechtshändern eine s-Drehung ergibt. Demgegenüber entsteht beim Arbeiten mit der Fallspindel, so wie bei Schnüren aus Spinnfasern üblich, eine z-Drehung.42
Auch Bänder eignen sich für diverse technische Verwendun-gen. So fanden sich in Mainz gröbere Bandfragmente aus Tier-haaren, hergestellt in der Technik des Zwirnspaltens (Abb. 8).43 Vergleichsstücke gibt es vor allem im östlichen Mittelmeerraum. Die dort besser konservierten Beispiele werden als Teile von Tierschirrungen interpretiert.44 Angesichts der zahlreichen Reit- und Packtiere in den römischen Militärlagern kann dies wohl auch für die Mainzer Stücke gelten.45
Mancherorts haben sich gewebte Bänder aus Tierhaaren erhal-ten, deren mittlere Qualität bei einer üblichen Warenbreite zwi-schen 4,5 und 6,5 cm eine vielfältige Nutzung erlaubt (Abb. 9).46 In zivilen Siedlungen sind sie bislang nicht nachzuweisen, so dass
rungen, deuten lassen (Abb. 5).23 Als Manteltücher würden sich die verschiedenen Gleichgratköper, auch mit gebrochenem Grat, eignen (Abb. 6).24 Durch die Verwendung voluminöser, o( en ge-drehter Fäden in Kette und Schuss sind diese Gewebe leicht und wärmend zugleich.25
Wo die mehrheitlich qualitätvollen Textilien von den Stütz-punkten des römischen Heers in den Rheinprovinzen gefertigt wurden, liegt bislang noch im Dunkeln.26 Der Großteil bestand allerdings aus z-gedrehten Garnen in Kette und Schuss, für die-sen Zeitraum ein Hinweis auf eine lokale Herkunft.27 Auch die oftmals vorhandenen Diamantkarovarianten passen in dieses Bild, da sie auf eine vorrömische, eisenzeitliche Tradition Nord-westeuropas verweisen.28 Demnach wurde die durch in Rauten angeordnete Bindungspunkte in alle Richtungen & exible Ware auch von römischen Soldaten geschätzt.29 Es ist daher nahelie-gend, dass sich das Militär wohl vor allem über einheimische Handwerker, Händler und Spediteure ausstatten ließ. Vermutlich war der Handel später auch über quasi Textilfabriken, den soge-nannten gynacea, organisiert, die an strategisch günstigen Orten gegründet wurden.30
Verschiedentlich wurden in beiden Fadensystemen s-gedreh-te Garne verarbeitet, was auf eine Provenienz der Gewebe aus dem östlichen Mittelmeergebiet hindeutet.31 Dies kann als Be-leg für den Verkauf von Waren aus dem Fernhandel auf lokalen Märkten betrachtet werden. Eventuell lässt er sich auch auf die weit gestreute Herkunft der hier stationierten Soldaten zurück-führen.32
5 Q������ ���� !���������S � ��� ��� o� � ��S� ��� ����������S��
prozesses. Die clavi werden beim Weben als farbige Schüsse angelegt.
Die graue Kontur zeigt die mögliche Position eines Gewebefragments
aus Mainz (Landes museum, Mainz)
��� ����� ��� �������� ¡¢¡ ¡£�¤¢�¥¢ ¥£¦§¢
2FFTextile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
6 p*� � �� ¨��q�����S ��� ©��������� S�� S����r� ������ %��� �$� � ��� R�� ��S���o����� ��� ©� �ª («� &��+�� �ª)
7 Q� ������ &'� ��� Q���+��Sr ��
Homburg. Die s-gedrehten Fäden
bestehen aus Rindenstreifen junger
Eichenzweige (Quercus L.)
8 ���#��S���� � �q ������������ o ��� ©� �ª («� &��+�� �ª)� ¨������ �� ������� �� � �� � �� �� ��� ���� � ���
Gurts zur Schirrung von Tieren.
¬® ¯°±²³ ´®µ ¶·¸°¹º´» ¼½½ ¼¾¹¿½¹À½ À¾Á½
2FÃ Der nordwestliche Raum – Die Rheinprovinzen und Britannien
ÄÅÆÇÈÉÇÊ Ëfascia / fasciola) angelegten Binden zu verstehen.47 Da
sie auf Bildwerken des Untersuchungsgebiets nicht zu erkennen
sind, wurden sie vermutlich eher unter der Tunika getragen.48
Textilien dienten daneben auch als Verpackung. So fanden
sich etwa auf Beutestücken aus dem Hort Neupotz textile Reste,
die darauf schließen lassen, dass geraubte Metallgegenstände für
den Abtransport in einfache, wohl vor Ort requirierte Sto' e ein-
hier o' enbar ein direkter Zusammenhang mit dem Militär be-
steht. Angesichts der Häu* gkeit von Webfehlern waren sie wohl
eine Massenware. Sämtliche Bänder weisen eine höhere Kett- als
Schussdichte auf, so dass sie sich besonders für Wickelungen eig-
nen, bei denen die Zugbelastung in Kettrichtung angelegt wird.
Möglicherweise sind diese Bänder im Zusammenhang mit den
von Soldaten zum Schutz der Waden (tibiale) oder der Ober-
9 Ì��q��� S�q�+��� $���� ���©� �ª («� &��+�� �ª ��� "�����������r©� �ª)� Q � ª� S�� ����� � �� $��� ���Í�++�� �� ��� � �� oettbetont gearbeitet.
Möglicherweise handelt es sich um Reste von Beinbinden.
ÎÏÐ ÑÒÓÔÕ ÖÐ× ØÙÚÒÛÏÜÖÝ Þßà ÞáÛâßÛãß ãáäàß
2FåTextile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
æalette textiler Qualitäten erscheint dabei relativ breit, im Ver-gleich der Lager untereinander jedoch auch zu einem gewissen Grad standardisiert. Bestimmte Produkte, wie die vermutlichen Beinbinden, " nden sich in vergleichbarer Qualität an verschie-denen Orten, sind aber in ihrem Vorkommen auf den militäri-schen Kontext beschränkt. Es kann daher angenommen werden, dass bei der Herstellung von Textilien für die in den germa-nischen Provinzen stationierte Armee (und wohl auch darüber hinaus)54 gewisse qualitative Grundsätze galten. Von einer Uni-formierung nach heutigen Maßstäben zu sprechen, ginge aber sicher zu weit.
Dabei wusste sich das römische Heer mit einer mehrheit-lich hochwertigen textilen Ausstattung zu versorgen. So belegen etwa Gewebe aus dem östlichen Mittelmeerraum, dass die La-ger auch Kristallisationspunkte für Produkte aus dem gesamten römischen Imperium darstellten. Die aufwändige Ausgestaltung militärischer Ausrüstungsgegenstände über das Funktionale hin-aus, wie etwa bei den Maskenhelmen vom Niederrhein zu beob-achten, unterstreicht zudem die Bedeutung von Textilien bei der Darstellung von Reichtum und Stand ihres Trägers.
geschlagen wurden.49 Auch Münzen zeigen oft Au+ agerungen von Textilien, die von ihrer ehemaligen Aufbewahrung rühren. Ein Beispiel vom Schlachtfeld in Kalkriese war sogar vollständig mit einem Leinwandgewebe mittlerer Qualität bedeckt.50
Von dort stammen auch Metallbeschläge, bei denen unter und um Befestigungsnieten Spuren zum Teil mehrlagiger Ge-webe mittlerer Qualität sichtbar wurden.51 Vermutlich dienten diese textilen Kaschierungen dem Schutz bzw. der Polsterung der mit ihnen überzogenen Ausrüstungsbestandteile.52 Bei den in Nijmegen und Xanten auf der Kalottenaußenseite von Masken-helmen feststellbaren Überzügen mit Flechtbändern aus Pfer-dehaaren steht dagegen ihre Schmuckwirkung im Vordergrund (Abb. 10).53
Auswertung
çie Untersuchung der textilen Hinterlassenschaften des römi-schen Heeres in den Rheinprovinzen belegt zunächst die Allge-genwart von Textilien im militärischen Alltag. Die feststellbare
10 è� S ���� ��� ��o'����� ����©��o�������
aus Nijmegen (a, b, d) und Xanten (c, e). Die auf-
wändig gearbeiteten Applikationen aus Pferde-
haaren auf der Außenseite der Kalotten haben
sich nur als kleinteiliges Muster in der Korrosion
erhalten (a–c). Die Rekonstruk tionen (d, e) ver-
deutlichen die ehemals prächtige Ausstattung der
Helme.
10a 10b
10d
10c
10e
éêë ìíîïð ñëò óôõíöê÷ñø ùúû ùüöýúöþú þüÿ2ú
2F� Der nordwestliche Raum – Die Rheinprovinzen und Britannien
w����� auf (vgl. Anm. 4). Ein etwas gröberer Gleichgratköper wird auch auf einem Ziegel aus Neuss erkennbar (Banck-Burgess / Pause 2008, 26, 27). Dieser wird von den Bearbeitern als Abdruck einer Tunika oder Hose ge-deutet, möglicherweise handelt es sich hier jedoch auch um einen Mantel.
25 Daneben lassen sich weitere textile Qualitäten für halbrunde Mäntel an-hand ihrer charakteristischen Form oder angewebter Kapuzen identi2 zie-ren (Fluck 2006, 28, Abb. 8; Granger-Taylor 2007, 2008; Cardon / Cuvigny 2011). Rechteckige Mäntel zeigen zudem häu2 g eine gammaförmige Eck-verzierung (Wild 1992; Mannering 1999). Im Zuge von DressID konnte auch unter den textilen Resten vom Vesuvausbruch in Pompeji 79 n. Chr. ein Mantelrest mit einem Gamma entdeckt werden (Inv. Nr. 18078 B).
26 Für den Fall des Nachweises lokal nicht vorhandener Rohsto5 e stehen künf-tig insbesondere bezüglich des Mainzer Fundmaterials weitere Erkenntnisse zu erwarten (vgl. Anm. 4).
27 Die Theorie feststehender Spinnereitraditionen wird in der Textilarchäo-logie vor allem von L. Bender Jørgensen vertreten (vgl. Bender Jørgensen 1992). In der Ethnologie wird das Phänomen dagegen kontrovers diskutiert (z. B. Minar 2000).
28 Wild 2009, 61. Für Beispiele aus Köln siehe Bender Jørgensen 1992, 231, 232, Kat. Nr. 36b; Schleiermacher 1982, 213, Taf. 16, 2. Für Mainz vgl. Wild 1970, 116, Tab. B 75–78, 165, Abb. 38– 40; Streiter 1988, 102, 103, 108, Tab. V.
29 So 2 nden sich feinere Varianten dieser Bindung, ebenfalls mit z-gedrehten Garnen in beiden Richtungen, bis nach Palmyra/SYR (Schmidt-Colinet et al. 2000, 23, Kat. Nrn. 187, 420) oder Didymoi/ET (Granger-Taylor 2008, 15).
30 Wild 2009, 61. – J.P. Wild verweist in diesem Zusammenhang auf die Ige-ler Säule, die an die im Tuchhandel zu Wohlstand gekommene Familie der Secundinier erinnert. Auch etwa für den Mainzer nauta Blussus wird eine Beteiligung an der Heeresversorgung angenommen (Jacobsen 1995, 141. Für eine Interpretation der dort dargestellten Kleidung siehe Kat. Mainz 2009, 41–43, Abb. 51; Rothe 2009, 61, 62, 154, Kat. Nr. M12, Taf. XXV).
31 Vgl. Anm. 28. – Hierfür gibt es etwa Beispiele aus Mainz (Cohausen 1879, 35, Nr. 1, Patrone 5; Wild 1970, 107, Tab. B 23). Aus der Severinstraße in Köln hat sich ein bisher unpubliziertes Gewebefragment in feiner Panama-bindung erhalten (Römisch-Germanisches Museum, Köln, Inv. Nr. 74.7551).
32 Etwa für die Herkunft der Soldaten aus Mainz im 1./2. Jh. n. Chr. vgl. Kat. Mainz 2009, 23, 24, 34 –39, Abb. 49. – G. Ziethen entwirft auf dieser Ba-sis ein eindrucksvolles Bild der mit Orientalen bevölkerten Stadt (Ziethen 1990).
33 Unpublizierter Untersuchungsbericht zu DressID 2009/10. – Nachweise von Kalfatermaterial aus römischer Zeit, wie auch beim Nydam-Schi5 , sind ansonsten selten. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit verbessert sich die Fundlage deutlich (Möller-Wiering 2004).
34 Mitschke et al., 2012.35 Baatz 2009, 258–262.36 Siehe z. B. Kernchen / Gramsch 1989, 23–27.37 Körber-Grohne / Feldtkeller 1998, 138. Dies gilt ebenso für die im Folgen-
den aufgeführten Seile von der Saalburg, für die J. P. Wild Hanf als Rohsto5 angibt (Wild 1970, 17). Auch hier hat U. Körber-Grohne ausschließlich Ei-chenbaste identi2 ziert, lediglich für SO 22 vermutet sie die Verwendung von Weidenbast (unpublizierter Bericht von U. Körber-Grohne vom 15.12.1980 im Archiv der Saalburg).
38 Reichert 2005, 205.39 Inv. Nrn. SO 21–45.40 Inv. Nrn. Z.V. 36/183 und Z.V. 615.41 http://arachne.uni-koeln.de/item/objekt/17572 [26.07.2011]. – Die Abbil-
dung wird dort sogar als Darstellung eines Schuhmachers und eines Seilers interpretiert, wahrscheinlich handelt es sich jedoch beide Male um Tätigkei-ten, die mit dem Schusterhandwerk in Verbindung zu bringen sind.
42 Dem entsprechen etwa die aus Spinnfasern und auf Basis einer z-Drehung hergestellten Schnurreste aus Mainz, Eppichmauergasse (Kat. Mainz 2009, 11, Abb. 17), vom Schlachtfeld in Kalkriese (Mitschke 2009, 7, 8, Tab. 1, Abb. 1) oder vom Flottenlager in Köln-Altenburg (Sieben / Mitschke 2004, 1006).
Anmerkungen
Zur Durchführung derartiger Analysen vgl. Beitrag zu den Methoden der Textilarchäologie in diesem Band.
2 An dieser Stelle sei auf den Verdienst von A. Böhme-Schönberger, Mainz, hingewiesen, die sich lange für die Erforschung dieser Funde eingesetzt und letztlich in der Verfasserin eine dankbare Bearbeiterin gefunden hat. A. Wieczorek, Mannheim, sei für seine spontane und freundliche Unterstüt-zung bei der ersten Idee zu diesem Forschungsprojekt gedankt.
3 Böhme-Schönberger / Mitschke 2005. 4 Die Untersuchungen dauern derzeit noch an und sollen im Rahmen der
Dissertation der Verfasserin an der Universität Tübingen vorgelegt werden (Mitschke, in Vorbereitung).
5 Wild 1970. – J. P. Wild fand sich zudem für eine mehrtägige gemeinsame Diskussion vor Ort an den Stücken sowie zur Durchsicht dieses Beitrags bereit. Für die vielen wertvollen Gespräche sei ihm herzlich gedankt.
6 Bender Jørgensen 1992. 7 Von Nord nach Süd dem Limes folgend wurden in den germanischen
Provinzen Textilien von nachstehenden Fundorten untersucht: Nijmegen und Xanten (Mitschke 2010; Mitschke / Leih / Becker / Meijers / Paetz gen. Schieck 2012), Rommerskirchen, Köln (Sieben / Mitschke 2004), Bonn, Zugmantel und Bad Homburg, außerdem Jülich, Jüchen, Frankfurt (Mar-tins / Mitschke 2011), Heidelberg (Mitschke / Paetz gen. Schieck 2009), Neupotz (Mitschke 2006) und Rottweil sowie aus den freien germanischen Gebieten die textilen Funde aus Kalkriese (Mitschke 2009). Den verschie-denen kooperierenden Museen, Denkmalämtern und Universitäten sei für die fruchtbare Zusammenarbeit gedankt, ebenso A. Paetz gen. Schieck, Mannheim, für die vielfache Unterstützung vor Ort.
8 Sumner 2009, 101. 9 Nach Bishop / Coulston 2006, 262.10 HGV Papyrus Michigan 8 467.11 Nach michigan.apis.2445 unter http://papyri.info/ddbdp/c.ep.lat;141
[13.08.2011].12 Lau5 er 1971.13 Brandt 2004, 49.14 Plinius, Naturalis historiae 19,2.15 Hörexperiment rem, September 2010, durchgeführt gemeinsam mit M. Feu-
ersenger, Mannheim.16 Nach Lewis 1983, 175 und Wild 2003, 39.17 Die Erkennbarkeit textiler Qualitäten steht dabei in engem Zusammenhang
mit der Materialgattung, dem Grad der Erhaltung und der häu2 g aus beiden Faktoren resultierenden Genauigkeit der Abbildung, die nicht zuletzt auch durch den künstlerischen Wert der Ausführung beein9 usst wird. Mit nach-lassender Detailtreue nimmt die Möglichkeit zur Beurteilung von Qualitäts-unterschieden ab. Daher gelingt der Vergleich zumeist nur innerhalb einer Darstellung, nicht in der Gegenüberstellung verschiedener Abbildungen.
18 Zu diesem und Militärgürteln im Allgemeinen vgl. Hoss 2010, 114, 116, 121, Abb. 5.
19 Boppert 1992, 95.20 Qualitätsexperiment rem, April 2009, durchgeführt mit A. Paetz gen.
Schieck, Mannheim, und in Kooperation mit A. Stau5 er, Köln. Aus prak-tischen Gründen wurden für die Tests industriell gefertigte Gewebe ver-wendet. Insofern ist gegenüber handgearbeiteten, historischen Geweben von einer gewissen Abweichung im entstehenden Faltenwurf auszugehen.
21 Für die Fallprüfung nach DIN EN ISO 9073-9 verwendet wurde ein Cusick Drape Tester, Model 165, Fa. James H. Heal, Halifax/ GB. Für die Durch-führung der Untersuchung geht unser Dank an A. Sicken, Köln.
22 Beispiele hierfür 2 nden sich sowohl in Köln (z. B. Schleiermacher 1982, 213, Taf. 15, 1, Kat. Nr. 3; Bender Jørgensen 1992, 231, Kat. Nr. 36b) als auch in Mainz (z. B. Wild 1970, 105, Tab. B 4 –7.)
23 Vgl. Wild / Bender Jørgensen 1988, 78, 79, Abb. 3; Bender Jørgensen 2011.24 Als ein Beispiel etwa aus Köln vgl. Schleiermacher 1982, 213, Taf. 15, 4.
Für Mainz siehe Wild 1970, 115, Tab. B 71 – der dort als Kriegsverlust ausgewiesene Fund tauchte im Rahmen der Untersuchungen der Verfasserin
D�� ��� �� ��������� ��� �������� �����
2F�Textile Qualitäten im römischen Heer der Rheinprovinzen
�� Olson 2003, 209.48 Möglicherweise ließen sich so bei kühler Witterung die nackten Beine wär-
men (Sander 1963, 156).49 Mitschke 2006.50 Mitschke 2009, Tab. 1, Abb. 4, 5.51 Mitschke 2009, Tab. 1, Abb. 2, 3.52 So konnten auch an dem Nackenschutz eines Helms aus Haltern Reste ei-
nes Halbpanamagewebes entdeckt werden (Bender Jørgensen 1992, 231, Kat. Nr. 35). Spuren eines o6 enen, leinwandbindigen Gewebes fanden sich auf der Innenseite der Helmkalotte eines Helms aus Nijmegen (Mitschke 2007, 86).
53 Mitschke 2010, 106, 107.54 Belege für die Beinbinden gibt es z. B. auch aus dem Kastell Vindolanda in
Britannien (Wild 2004, 303).
43 Zur Erläuterung der Technik siehe Seiler-Baldinger 1991, 52–54.44 z. B. aus Masada/IL (Fund Nr. 1205-748/2) oder aus Karanis/ET (Batcheller
2001, 45, Abb. 5.6.f ). In Südasien hat sich die Technik für diesen Zweck bis in die Neuzeit etwa für Kamelgurte erhalten (Collingwood 1998). – Diesen freundlichen Hinweis verdanke ich H. Granger-Taylor, London/GB.
45 Allein etwa für die 14 Militärlager im Taunus- und Wetteraukreis wird für das Jahr 165 n. Chr. von mehr als 3.000 Pferden und Maultieren ausgegan-gen (Kreuz 1999, 91).
46 Zahlreiche Beispiele hierfür gibt es aus Mainz (z. B. Wild 1970, 105–107, Tab. B 8–17), aber auch etwa von der Saalburg (vgl. Wild 1970, 108, Tab. B 30. O6 ensichtlich hat J. P. Wild hier allerdings die seitlichen Wen-destellen übersehen, demnach sind die Angaben zu Kett- und Schussrich-tung vertauscht).
��! "#$%& '!( )*+#,�-'. /01 /3,40,50 53670