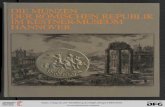Wie Jean Mabillon dem römischen Index entging. Reliquienkult und christliche Archäologie um 1700
Toponyme auf römischen Inschriften aus Bayern
-
Upload
uni-wuerzburg -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Toponyme auf römischen Inschriften aus Bayern
Blätter für oberdeutsche Namenforschung Für den Verband für Orts- und Flurnamenforschung in Bayern e. V.
herausgegeben von Wolf-Armin Frhr. v. Reitzenstein
45. Jahrgang
Inhalt
Dr. Robert Schuh (1947-2008)
2008
von Wolf-Armin Frhr. v. REITZENSTEIN ......................................... 5
Die Tagung "Namenforschung im Archiv" von Wolf-Armin Frhr. v. REITZENSTEIN ......................................... 7
Toponyme aufrömischen Inschriften aus Bayern von Karlheinz DIETZ........................................................................... 10
Möglichkeiten und Grenzen flir die Namenforschung im Bayerischen Hauptstaatsarchiv von Elisabeth WEINBERG ER............................................................. 23
Digitalisierte Archivbestände und Archivalien in Bayern von Joachim KEMPER ........................................................................ 31
Edition versus Originalhandschrift: Ihre Relevanz für die historische Lautgeschichte von Isolde HAUSNER ......................................................................... 42
Latinisiertes und reines Althochdeutsch im Urkundenmaterial der frühmittelalterlichen St. Galler Überlieferung von Stefan SONDEREGGER............................................................... 53
Die Urbare als namenkundliche Quelle von Peter AN REITER.......................................................................... 63
Quellen für die mundartlichen Formen von Ortsnamen von Anthony ROWLEY ....................................................................... 91
Toponyme auf römischen Inschriften aus Bayern
von Karlheinz DIETZ
Die Zahl der Toponyme auf römischen Inschriften aus Bayern ist überraschend gering. 1 Durch die thematische Vorgabe auszuschließen sind die Stammesnamen, die sich etwas zahlreicher finden und in jüngster Zeit zusammenfassend behandelt wurden.2 Die anfängliche Vielfalt wurde hier zunehmend durch das bislang mehr als vierzigmal belegte Ethnikon Raetus3
verdrängt. Unberücksichtigt lasse ich den erschlossenen Namen *Seiopa, der seit
Alfred von Domaszewskis Behauptung, es handle sich "mit einiger Wahrscheinlichkeit" um den alten Namen von Miltenberg am Main,4 nicht selten als "alteinheimischer Name" betrachtet wird5 und dem ,alt-celtischen Sprachschatz' einverleibt wurde.6 Tatsächlich ist er abgeleitet aus der Bezeichnung des n(umerns) [expl(orationis?) Sei]opens(is), der um 200 offenbar die Besatzung des Kastells Miltenberg-Ost stellte. 7 Zwar ist die Benennung dieser Truppe nach ihrem Gründungsort8 oder einem Vicus des
Ich verweise hier ein- fiir allemal auf die Zusammenstellungen bei VOLLMER, IBR S. 208-226; RElNECKE: Namen l; REINECKE: Namen li; REIN ECKE: Namen III; RASCH: Namen (einem. E. fragwürdige Neuausgabe). BUZAS/JUNGINGER: Bavaria Latina verzeichnet auch die forschungsgeschichtlichen Irrwege. Generell noch VON REITZENSTEIN 1970; VON REITZENSTEIN: Lexikon, 44-48; 122-123; 166-167; 252; 263; 298-299;313-318; 348; 354; VON REITZENSTEIN: Altbayem.
2 DIETZ: Bevölkerung, bes. 14-15. 3 DIETZ: Bevölkerung, 18-19; der dort verzeichnete civis secundus Retus, der in der 2. Hälfte
des 4. Jh.s praepositus militum Fotensium war (ClL VI 32969), könnte zu Foetibus gehören, aber das ist keineswegs sicher.
4 Ein ausftihrliches Referat bei KEUNE: Seiopa. 5 Schon HÜBNER: Herrschaft, 92. 6 HOLDER: Sprachschatz, II 1459; vgl. REINECKE: Bauten, 80; ROWELL: Numerus,
2538-2539. 7 CIL XIII 6605; ergänzt aus CIL XI 31 04; vgl. CIL Xlll 2,1, S. 281; XIII 4, S. 1 02; XIII 6,
S. 21. Zur Truppe neuerdings AUSTIN/RANKOV: Exploratio, 175; 192; 198; 203 und zu Miltenberg zuletzt BAA TZ/HERRMANN: Hessen, 439-440; W AMSER: Miltenbergl Bürgstadt; W AMSER: Miltenbergl Altstadt.
8 BAATZ: Hesselbach, 68.
10
1 1
!
Binnenlandes nicht auszuschließen,9 es ist aber genauso gut möglich, dass es sich um einen Zunamen von Brittones handelte. 10
Als außerbayerisch zu übergehen sind auch Brigantium!Bregenz, 11 und Tasgaetium!Eschenz, 12 flir welche epigraphische Belege existieren. Auszuschließen ist aber auch Reginum/Regensburg, das nur durch eine stadtrömische Inschrift belegt zu sein scheint. 13 Viel unsicherer als lange geglaubt ist nämlich die Auflösung der Buchstaben KR in der Wendung territor ( ... ) contr( ... ) et KR zu k(anabarum) R(eginensium). 14 Sollte sie richtig sein, hätten wir eine Bestätigung flir die in den Itinerarien bezeugte Form Regino, die bekanntlich mit dem Flurnamen Reganus!Regen verbunden wird. 15 In Pans Aeni/Pfaffenhofen am Inn 16 ist zwar eine zum illyrischen Zollbezirk gehörende statio Enensis bezeugt, indessen stammt der Stein aus Poetovio!Ptuj in Oberpannonien. 17 Auf einer Sarkophaginschrift aus einer Nekropole der einstigen dalmatinischen Stadt Salonae erscheint ein Veteran ex Castris Batavum. 18 Darin wollte man einen Bezug auf Batava/ Passau-Altstadt sehen, 19 doch dürfte dies schwerlich richtig sein, vielmehr könnte ein Lager der equites singulares Augusti gemeint sein, da diese kurz auch Batavi genannt wurden.20
Auf dem norischen Innufer von Passau befand sich der besonders aus den Itinerarien und der Vita Severini bekannte Ort Boiodurum/PassauInnstadt;21 er war auf dem verlorenen Meilenstein von Engelhartszelf2
9 FABRICIUS: Limesproblem, 299; vgl. EZOV: Numeri, 167. I 0 STAPPERS: Milices. 229-230; TERNES: Germania Superior, 831. Entsprechendes gilt auch
ftir die Brittones Triputien(ses) in Amorbach (CIL XIII 6514; 6606) und die Brittones Nemaning(enses) in Obernburg (CIL XIII6629); dazu VON REITZENSTEJN: Lexikon, 36-37; 286-287. Zu Nemaningensium hat Herr von Reitzenstein, wie er mir freundlicherweise mitteilt, inzwischen seine Meinung geändert und diese in einem noch ungedruckten Aufsatz über Namenarten dargelegt.
II Zu den Inschriften zu Bregenz HEGER: Steindenkmäler; WEBER: Weihinschrift; vgl. TRUSCHNEGG: Vorarlberg.
12 Zu den Inschriften aus Eschenz LIEB: Inschriften. 13 DIETZ: Herkunftsangaben. 14 CIL 1111437010
= AE 1986,534 = 1987,792; DIETZ/FISCHER: Römer, 142-144. 15 Zu den antiken Namen Regensburgs außerdem DIETZ/FISCHER: Grenze, 15-16. 16 Vgl. GARBSCH: Mithräum. 17 CIL 111 151847
= AIJ 302. 18 AE 1914,73 = ILJ 1112102. 19 So aber schon STEIN: Beamte, 168 Anm. 72; A. und J. SASEL im Kommentar zu ILJ;
vgl. AIGN: Cohors, 112. Zur Frage der Truppenbesatzung DIETZ: Alteglofsheim, 253-254. Anm. 96; WOLFF: Heer, 170.
20 Batavum wäre dann als Gen. Pl. zu verstehen. Die Zeugnisse der equites singulares Augusti bei SPEIDEL: Denkmäler; vgl. SPEIDEL: Riding.
21 ADAM: Reisewege, 49; 53-54.
II
in Österreich genannt. Zweifellos lag in dieser ,Bojerstadt' auch die statio Boiodurensis publici portorii Illyrici, von der wir zwar einen vilicus und einen Contrascriptor am Ort bezeugt haben.Z3 Der Name der Zollstation findet sich allerdings nur auf einer Inschrift in Trojane/Atrans in Nori-
24 cum. Sonderfälle sind schließlich Bedaium25 und Gontia, da beide epigraphisch
nur als Götternamen bezeugt sind. Im Unterschied zur mehrfach literarisch überlieferten Form des Toponyms Guntia zeigt der Göttername Gontia26
den o-Laut, der sich auch in der unsicheren Überlieferung des spätantiken Flussübergangs findet. 27 Die Weihung an Gontia stiftete ein Zenturio der unter Nero gegründeten legio I Jtalica, die bis in die Spätzeit in Novae (bei Svistow a. d. Donau) in Moesien kampierte. Der Anlass des Aufenthalts des Zenturios in Günzburg und der Weihung ist unbekannt. Ein Gott Bedaius findet sich auf mindestens sechs Weihinschriften aus Chieming und von benachbarten Fundorten, und zwar auch im Kontext staatlicher und städtischer Hoheitsakte (auf sog. Benefiziarierinschriften bzw. Weihungen von Salzburger Lokalmagistraten). Man hat damit den Namen des Chiernsees verbunden. Peter Scherrer hat dargelegt, dass der Stammesgott der Alounae (bei Ptolemaios Alaunoi) geehrt wurde.28
Nach so langer Umkreisung des Themas nun endlich zu den sicheren Belegen. Mit Abstand die meisten Toponyme finden sich auf sog. Meilensteinen, mithin auf einer Fundgruppe, die 2005 im CIL XVII neu ediert29
und unlängst von Michael Rathmann ausführlich kommentiert wurde.30
Als Straßenausgangspunkte, sog. capita viarum, finden sich? Augusta/Augsburg 27 Belege (7 ergänzt), 17 in Bayern Cambodunum!Kempten 1 Beleg Phoebiana!Faimingen 3 Belege Legio/Regensburg 6 Belege (zwei ergänzt)
22 CILXV114,I, 105. 23 CIL III 5691 add. S. 1846 ~ IBR 441 ~ AE I999 ad 1193. Vgl. AE 1977,594; mit den
Bemerkungen WOLFF: Führer, 7 m. Taf. 2; vgl. GARBSCH: Mann. 98 Abb. 75. 24 CIL lll5121 add. S. 2198 ~ RINMS 105. 25 SCHERRER: Regnum, 42-43 Verbreitungskarte 13. 26 AE 1930,74~WAGNER:Inschriften,229Nr.51 Taf.I6;BERKTOLD:Gontia,29Nr.l. 27 TIEFENBACH: Günzburg; CZYSZ: Gontia, 81-83. 28 SCHERRER: Regnum, 37-39. 29 KOLB,/W ALSERIWINKLER: CIL XVII 4, I. 30 RA THMANN: Untersuchungen. 31 Vorläufiger Index zu CIL XVII 17,4,1 im Internet: http://cil.bbaw.de/dateien/indices_
xvii.html (am 22.09.2008).
12
Juvavum!Salzburg 13 Belege, 3 in Bayern Boiodurum/Passau-Innstadt 1 Beleg, 0 in Bayern. Von letzterem war bereits die Rede.
A bzw. ab Augusta zählten Meilensäulen bis hinab nach Vipitenum/ Sterzing,32 entlang von vier Straßen:
a) über den Brenner und Seefelder Sattel nach Augsburg, b) von Kempten nach Pons Aeni, c) von Augsburg über Burghöfe donauabwärts und d) nördlich der Donau im Limesgebiet nach Eining.33
Die Annahme, dass an der Verbindung zwischen Bregenz und Innsbruck auf einigen Meilensäulen a B(rigantio) gezählt worden sei, konnte durch einen Neufund aus Mittenwald sicher falsifiziert werden; vielmehr ist auf den entsprechenden Steinen das folgende A VG für Aug(usta) durch Haplographie irrtümlich ausgefallen.34 Tatsächlich verzeichnen die Meilensteine für Augsburg alle nur diese drei Buchstaben A VG. Die bekannten 58 Zeugnisse für die antiken und frühmittelalterlichen Namen Augsburgs wurden vor mehr als 20 Jahren zusammengestellt und ausführlich kommentiert.35 Wie es scheint, kam seither ein einziges aus Rom hin-
36 zu. Danach haben wir aus 49 verschiedenen Quellen 54 Testimonien für
den Namen Augsburgs bis ins 6. Jahrhundert. Das Verteilungsverhältnis der Belege für Augusta Vindelicum: Aelia Augusta: Augusta (mit den jeweiligen Spielarten) entspricht etwa 2:3:5, wobei Augusta seine starke Repräsentanz vorwiegend einer Quellengattung, eben den Meilensteinen, verdankt. Sofern man die Milliarien der gleichen Serie zusammenfassen und als je ein Testimonium in Rechnung stellen würde, verschöbe sich die angegebene Relation zu 2:3:2,5. Im Mittelalter verändert sich diese dann sehr zugunsten von Augusta und seinen Derivaten Augustana und besonders Augustensis, die von nur wenigen Ausnahmen abgesehen das Bild bestimmen. Die Form Augusta Vindelicum ist auf einer bayerischen Inschrift nicht belegt.
32 CIL XVII 4, I, 7-8. 33 a) CIL XVII 4,1, 25. 38. 39. 40. 41. 46; b) CIL XVII 4,1, 50. 51, c) CIL XVII 4,1, 53.
54. 55; d) CIL XVII4, I, 63. 65. 66. 67. 69. 70 34 DJETZ/PIETSCH: Meilensteine, 52-53. 35 DIETZ: Augsburg; ZAHRNT: Augsburg. 36 DIETZ: Weihaltar, 100-102.
13
Lateinisch ist natürlich auch Legio, das als Ortsname sechsmal (davon zweimal sicher ergänzt) auf Meilensteinen erhalten ist.37 Ihr einstiger Standort wird gleich durch zwei Entfernungsangaben angezeigt: ab Aug(usta) und a Leg(ione), also "von Augsburg" und "von der Legion". Das für die römische Administration allein bedeutsame Lager der 3. Italischen wurde um 200 also nur Legio bezeichnet; ähnlich verfuhr man anderwärts, z. B. in Nordwestspanien, wo noch heute der Standort der 7. Legion in Le6n weiterlebt, aber auch Caer/eon in Britannien und Leggun in Palaestina waren ehemalige Legionsstandorte.
Ein weiterer Straßenknotenpunkt war Phoebiana, sofern der Nominativ zu Phoebianis so gelautet haben sollte. Er ist inzwischen auf drei Meilensäulen aus Gundelfingen und Sontheim belegt. 38 In der Schreibweise (Febiana) ist der Ort als Sitz der equites stablesiani iuniores seit langem aus der Notitia dignitatum geläufig.39 Damit kann nur der antike Vorläufer von Faimingen gemeint sein. Ob so auch schon, wie man jüngst gemeint hat,40
das im späteren Tempelbereich bald nach 90 gegründete und rund nach einem halben Jahrhundert aufgelassene Kastell oder erst das Apollo-Heiligtum so hieß, ist nicht zu entscheiden. Immerhin wäre die Bezeichnung Phoebiana41 ein passender Name für ein Apollo-Heiligtum gewesen. Daher ist keineswegs auszuschließen, dass dieser Name noch nicht mit dem Kastell verbunden war. Nicht weniger wahrscheinlich dürfte sein, dass das Kastell nach einem noch nicht gefundenen, kleineren Heiligtum benannt wurde und nach dessen Aufgabe zum zumindest Anfang des 3. Jh.s überregional bekannten Kultort expandierte.
Von nicht sicherer Etymologie ist Juvavum,42 das sich auf insgesamt 12Meilensteinen findet, die a Juv(avo) zählen; zwei davon stammen aus Bayern, und zwar von der aus Wien zum Inn führenden Straße.43 Daneben sind auf bayerischem Boden auch noch drei Inschriften von Ratsherrn und Magistraten aus dem alten Salzburg bezeugt, von decuriones luvavensium bzw. II viri civ(itatis) Juv(avensis). 44
Seiner Bildung nach eindeutig keltisch ist der Name Cambodunum, der in ausgeschriebener Form nur einmal auf einem Grabstein aus Aquin-
37 Sog. via secundum Danuvium: CIL XVII 4,1,55; via limitanea: CIL XVII 4,1,65 (er-gänzt). 66. 67. 69 (ergänzt). 70.
38 CILXVII4,1,60.61.62. 39 Not. Dign. Occ. 35,4. 15. 40 KOLB: Phoebiana; vgl. RATHMANN: Untersuchungen, 137. 41 Zur Bildung RASCH: Namen, 80; 128. 42 Zum römischen Salzburg KOV ACSOVICS: luvavum. 43 CIL XVII 4, I, 96; sicher ergänzt ist CIL XVII 4,1, 97. 44 WEDENIG: Quellen, 171-174 I 11-12; 14.
14
cum/Obuda45, innerbayerisch in gekürzter Weise als caput viae bei Isny
erscheint.46 Als "befestigter Ort an der Flusskrümmung"47 gehörte das alte Kempten zu jener stattlichen Zahl gallischer Städte, die aus keltischen Elementen gebildete Namen tragen, in denen der eine Bestandteil ( -dunum, -durum) auf die Existenz von Verteidigungswällen hindeutet, die aber während der Kaiserzeit solche Befestigungen mit Sicherheit nicht hatten. Zur Erklärung dieser Anomalie wurde vorgeschlagen, solche Namen könnten jeweils auf ein römisches Lager zurückgehen, das früh zur Kontrolle des Umlandes angelegt, von den römischen Stammespräfekten als Unterbringung benutzt und mit einer einheimischen Benennung belegt wurde. Aus den Märkten solcher "Basislager" konnten sich beträchtliche Siedlungen bilden, zumal, wenn die Lager aufgegeben wurden und die Einheimischen den früher militärisch ausgerichteten Platz der weiteren zivilen Nutzung zuführten.48 Da zudem viele unserer scheinbar keltischen Toponyme, wie Cambodunum, Abodiacum, Sorviodurum oder auch Radaspona auf keinerlei latenezeitlichen Vorgängersiedlungen beruhen, ist nicht auszuschließen, dass sich hinter der "keltischen Ortsnamenssitte" ein besonderer Zug römischer Integrationspolitik verbirgt, nämlich ihren Neugründungen bewusst Namen der alten Landessprache zu geben.49
Damit komme ich zu einer noch nicht lokalisierten norischen Zollstation, die durch zwei leider verlorene Inschriften bezeugte statio Esc ( ... ). Sie wird heutetrotz gelegentlicher Zweifel bei Ischl a. d. Alz (Gde. Seeon) im Chierngau gesucht. 50 Auf beiden Inschriften war diese Station mit den drei Buchstaben ESC abgekürzt, deren Auflösung- vermutlich zu Esc(onensis) - allen potentiellen Lesern der Inschriften unschwer möglich gewesen sein muß. In diesem Zusammenhang wird bedeutsam, dass die Tabula Peutingeriana 20Meilen (29,6 km) von Cambodunum und 18Meilen (26,6 km) von Epfach entfernt einen Ort Escone eingetragen hat. Diese Lokalität, die zwischen Marktoberdorf und dem Auerberg gelegen haben muss (die verschiedenen Lokalisierungsvorschläge tun hier nichts zur Sache), führen wohl zu einem Nominativ Esco. 51 Dieser ist in der nächsten Umgebung
45 CIL II1 15162. 46 CILXVII4,1,33. 47 WEBER: Anfange, 14-15 m. Anm. 6; vgl. RIVET/SMITH: Place-Names, 292-293. 48 DRINKWATER: Gaul, 131. 49 Vgl. RIVET: Names. 50 CIL III 5620 = AE 1995,1216; IBR 20 A. Zur Lokalisierung SCHERRER: Lage;
zustimmend ALFÖLDY: Gliederung, 52-53. Frühere Zweifel bei REINECKE: Station; vgl. KNUSSERT: Esco.
51 Zu Esco RASCH: Namen, 50; 186; 188 (zu Estiones).
15
_,
von Estiones natürlich auffällig. Konrad Miller hat daraus schon 1916 postuliert, der bei Strabon nur einmal überlieferte Name der Estiones, müsse * Eskones gelautet haben, was Artur Adam 197 6 noch durch den Hinweis untermauem wollte, dass der Wortstamm *Eskon- ziemlich sicher auch dem Namen der Stadt Schongau (alt Scongowa) zugrunde liege. 52
Offenbar geht auf den Namen der Schotter, eines linken Nebenflusses der Donau, der vicus Scutt(arensium) auf einer Weihinschrift zu Ehren von Mars und Victoria aus Nassenfels, Ldkr. Eichstätt zurück. Dort war bei einem frühen, wohl schon Anfang des 2. Jahrhunderts aufgegebenen Kastell ein Vicus zu einem der bedeutendsten Orte des transdanubischen Limesgebietes Raetiens aufgestiegen, mit einem reichen zivilen Leben und eigenen Quasi-Magistraten. Der uns interessierende Name ist trotz der teilweise stark verwitterten und im Zentrum von Zeile 2 stärker zerstörten Steinoberfläche eindeutig erhalten. 53 Die Lesung SCVTT ist nicht zu bezweifeln: Nach SC ist ein kleines V deutlich erhalten; vom folgenden T findet sich nur ein Rest der linken Serife des oberen Querbalkens; vom zweiten T ist der Rest einer unteren Senkrechten Haste sichtbar; ein kleines A, das Vollmer danach für möglich gehalten hat, war schwerlich je vorhanden. M. E. datiert der Stein aus dem Jahr 181 n. Chr.: "Dem Mars und der Victoria haben (dieses Monument) die Einwohner des Vicus an der Schutter (gesetzt) unter der Leitung des Gaius lulius Impetratus und des Titus Flavius Gemellinus als der Imperator Commodus zum 3. Mal Konsul war (= 181 n. Chr.)." DieSchutterist urkundlich schon vor der ersten Jahrtausendwende als Scutara belegt. 54
Nur ein Jahr nach dieser Inschrift gesetzt wurde offenbar die Bauinschrift des Kastells Ellingen, die uns dessen Namen mit kastel(lum) Sablpe(um) bezeugt.55 Obwohl grundsätzlich die Lesung sabloentum nicht auszuschließen ist, was dann soviel wie "Kastell mit Holz-Erde-Mauer" bezeichnen würde, wird man trotz der onomastischen Möglichkeit von Ganuenta56
und verwandten Bildungen lieber eine der zahlreichen etum-Bildungen annehmen, wie sie etwa in Prokops Kastellverzeichnissen nachweisbar sind
52 ADAM: Reisewege, 33-36. 53 CIL Ill5898 add. S. 1050. Dazujetzt DIETZ: Nassenfels, 34-36. 54 KEUNE: Scutara, 912-913 mit der älteren Literatur; siehe ferner BACH: Namenkunde
190; SCHMID: Namenschichten, 103-104; KRAHE: Flußnamen-Schichten, 192-195; weitere Literatur bei BUZAS/JUNG1NGER: Bavaria Latina, 216.
55 AE 1983.730. 56 BOGAERS/GYSSELING: Nehalennia. GYSSELING hat ebd. 89-92 die Dreifachligatur
zu -ENT- gelesen; es bedürfte der sprachlichen Überprüfung, ob nicht auch ein Ganunetum einen guten Sinn ergäbe.
16
1
(etwa Nwyno = Nucetum, TtAA.nw = Tilietum, OuA.,_mwv = Ulmeturn etc. ). Mittelalterlich sind sogar Bildungen wie Sablonetum bekannt, man denke nur an das heutige Sabbioneta. 57 Die Bezeichnung "am Sand" findet sich noch heute für die Gegend um Weißenburg. 58
Aus Weißenburg stammt schließlich der letzte und gewiss unsicherste Fall. Er steht auf einer 21,6 cm hohen Bronzestatuette, die 1979 im Kontext des Weißenburger Schatzfundes "Am Römerbad" ans Licht kam. Der nackte, auf dem rechten Bein stehende Merkur mit silberüberzogenem Flügelhut, Flügelschuhen und einen silbernen Halsring trägt über der linken Schulter den Mantel, in der Rechten den Geldbeutel und vor ihm liegt der Widder. Die Statuette ist angeblich eine gallische Arbeit. Der Gott steht auf einem achteckigen, mit Palmzweig und Kranz verzierten Sockel, der an seiner Frontseite die kurze Inschrift träge9 Mercuri I proptium. Nach Bogaers liegt entweder eine Vulgärform von prop<r>ium oder ein Schreibfehler für prop<i>tium vor. Hingegen schlug Vennemann vor,60
Mercuri proitium (sc. signum) zu verstehen und das zweite Wort nicht als Nom. sing., sondern als Gen. Pl. aufzufassen. In Analogie zu rheinischen Matroneninschriften will er Proitium oder Proptium als "Genitiv Pluralis einer Stammesbezeichnung oder Einwohnerbezeichnung *Pro pt-es beziehungsweise *Proit-es" auffassen; dies lässt ihn sprachwissenschaftlich einen Siedlungsnamen *Proium oder *Proicum, als "Kelto-Romanisierung eines älteren *Pro-a''. Da etwa 10 km nordöstlich von Weißenburg Pfraunfeld (Eindeutschung: Pfrau-n+feld) liegt, wäre der "Mercurius Proitium ( ... ) der Schutzgott der Bewohner der römerzeitlichen Vorgängersiedlung des jetzigen Pfraunfeld gewesen". Persönlich halte ich diese Deutung flir irrig. An der Lesung der Inschrift ist nicht zu zweifeln. Anders als auf einer Topfinschrift aus Regensburg,61 ist hier Mercuri sicher kein Vokativ, sondern ein Genetiv. Er findet sich eingeritzt auch auf einem heute im Leidener Museum aufbewahrten Keramikgefäß aus Vechten.62 Da dort Mercuri isoliert steht, wird das Gefäß mit seiner Opferung Eigentum des Gottes geworden sein. 63 Mercuri proprium wäre also nur eine Verstärkung des Genetivus possessivus. Eine kursive Vorlage von proprium dürfte an den beiden Stellen vor und nach dem 0 ziemlich ähnliche Haken in der Form
57 DIETZ: Sablonetum, 509-513. 58 DIETZ: Sablonetum, 513-514. 59 AE 1993,1232 nach KELLNER/ZAHLHAAS: Tempelschatz, 41-44 Nr. 7. 60 VENNEMANN GEN. NIERFELD: Matronae, 295-300 (mit Bemerkungen von J.E.
BOGAERS ebd. 295-296 Anm. 90). 61 AE 1995,1184; siehe MARTIN-KILCHER: Krug, 146-147. 62 CIL XIII I 0008, I. 63 Ähnlich zu ergänzen sind mehrere Inschriften aus Baalbek HAJJAR: Triade, 581.
17
eines schrägen Gamma (f) aufgewiesen haben. Angesichts dieser Überlegung erscheint die Fehlinterpretation des zweiten R zu T seitens der einritzenden Person durchaus denkbar.
Literatur
ADAM, A.: Reisewege= ADAM, A.: Römische Reisewege und Stationsnamen im südöstlichen Deutschland. Beiträge zur Namenforschung NF II, 1976, 1-59.
AE = L' Annee Epigraphique. Paris 1888 ff. AIJ = Hoffiller, V./B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslawien. I: Noricum und Pannonia su
perior. Zagreh 1938. AIGN, A.: Cohors = AIGN, A.: ,Castra Batava' und die Cohors nona Batavorum. Ostbairi
sche Grenzmarken 17, 1975, 102-157. ALFÖLDY, G.: Gliederung= ALFÖLDY, G.: Die regionale Gliederung Galliens in der römi
schen Provinz Noricum. In: Raumordnung im Römischen Reich. Zur regionalen Gliederung in den gallischen Provinzen, in Rätien, Noricum und Pannonien, hrsg. von G. GOTTLIEB. München 1989, 37-55.
AUS TIN, N.J.E./N.B. RANKOV: Exploratio = AUSTIN, N.J.E./N.B. RANKOV: Exploratio. Military and Political Intelligence in the Roman World ftom the Second Punic War to the Sattle of Adrianople. London 1995.
BAATZ, D.: Hesselbach = BAATZ, D.: Kastell Hesselbach und andere Forschungen am 0-denwaldlimes. Berlin 1973.
BAATZ, D./F.-R. HERRMANN: Hessen= BAATZ, D./F.-R. HERRMANN (Hrsg.): Die Römer in Hessen. Stuttgart 1982.
BACH, A.: Namenkunde = BACH, A.: Deutsche Namenkunde. li: Die deutschen Ortsnamen. Heidelberg 1954.
BERKTOLD, P.: Gontia = BERKTOLD, P.: Gontia: Fluss, Gottheit, Stadt. In: Gontia. Studien zum römischen Günzburg, hrsg. von J. SCHMID. München 2000, 29-33.
BOGAERS, J.E./M. GYSSELING: Nehalennia = BOGAERS, J.E./M. GYSSELING: Nehalennia, Gimio en Ganuenta. Oudheidkundige Medede/ingen uit het Rijksmuseum van Oudheiden te Leiden, 1971, 86-92.
BUZAS, L./F. JUNGINGER: Bavaria Latina = BUZAS, L./F. JUNGINGER: Bavaria Latina. Lexikon der lateinischen geographischen Namen in Bayern. Wiesbaden 1971.
CIL =Corpus lnscriptionum Latinarum. Berlin 1863ff. CZYSZ, W.: Gontia = CZYSZ, W.: Gontia. Günzburg in der Römerzeit Archäologische
Entdeckungen an der bayerisch-schwäbischen Donau. Friedberg 2002. DIETZ, K.: Nassenfels = DIETZ, K.: Bemerkungen zu Inschriften aus Nassenfels, Ldkr. Eich
stätt, Oberbayem. Bayerische Vorgeschichtsblätter 71 (Gedenkschrift ftir JOCHEN GARBSCH), 2006, 33-40.
DIETZ, K.: Sablonetum = DIETZ, K.: Kastellum Sablonetum und der Ausbau des rätischen Limes unter Kaiser Commodus. Chiron 13, 1983,497-536.
DIETZ, K.: Alteglofsheim = DIETZ, K.: Ein neues Militärdiplom aus Alteglofsheim, Lkr. Regensburg. Urkunden aus der Frühzeit des Kaisers Antoninus Pius. Beiträge zur Archäologie in der Oberpfalz 3, 1999, 225-256.
DIETZ, K.: Augsburg = DIETZ, K.: Die römischen und frühmittelalterlichen Namen Augsburgs. In: Forschungen zur Provinzialrömischen Archäologie in Bayerisch Schwaben, hrsg. von J. BELLOT, W. CZYSZ u. G. KRAHE. Augsburg 1985, 79-115.
18
'
DIE TZ, K.: Weihaltar =DIE TZ, K.: Weihaltar für Jupiter und Juno aus der Regierung Elagabals. In: Die Ausgrabungen im ehemaligen Kreuzgang des Niedermünsters in Regensburg, hrsg. von E. WINTERGERST. Regensburg 2004 [2005], 93-102.
DIETZ, K.: Herkunftsangaben = DIETZ, K.: Zu den Herkunftsangaben auf einem stadtrömischen Laterculus. In: Rom, Germanien und das Reich. Festschrift zu Ehren von Rainer Wiegels anlässtich seines 65. Geburtstages, hrsg. von W. SPICKERMANN. St. Katharinen 2005, 329-339.
DIETZ, K.: Bevölkerung= DIETZ, K.: Zur vorrömischen Bevölkerung nach den Schriftquellen. In: Spätlatenezeit und frühe römische Kaiserzeit zwischen Alpenrand und Donau. Akten des Kolloquiums in Ingolstadt am II. und 12. Oktober 2001, hrsg. von C.-M. HÜSSEN, W. IRLINGER u. W. ZANIER. Bonn 2004, 1-23.
DIETZ, K./T. FISCHER: Grenze= DIETZ, K./T. FISCHER: An der Grenze des Imperiums: Regensburg zur Römerzeit. In: Geschichte der Stadt Regensburg, hrsg. von PETER SCHMID. I, Regensburg 2000, 12-48.
DIE TZ, K./T. FISCHER: Römer = DIE TZ, K./T. FISCHER: Die Römer in Regensburg. Regensburg 1996.
DIETZ, K./M. PIETSCH: Meilensteine = DIETZ, K./M. PIETSCH: Zwei neue römische Meilensteine aus Mittenwald. Mohr- Löwe- Raute. Beiträge zur Geschichte des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 6, 1998, 41-57.
DRINKWATER, J.F.: Gaul= DRINKWATER, J.F.: Roman Gaul. The Three Provinces, 58 BC-AD 260. London etc. 1984.
EZOV, A.: Numeri = EZOV, A.: The Numeri exploratorum Units in the German provinces andRaetia.Klio79, 1997,161-177.
FABRICIUS, E.: Limesproblem = FABRICIUS, E.: Ein Limesproblem. In: Festschrift der Albrecht-Ludwigs Universität zum 25. Regierungsjubiläum ... des Grassherzogs Friedrich von Baden. Freiburg i. Br. 1902,277-302.
GARBSCH, J.: Mann = GARBSCH, J.: Mann und Roß und Wagen. Transport und Verkehr im antiken Bayern. München 1986.
GARBSCH, J.: Mithräum = GARBSCH, J.: Das Mithräum von Pons Aeni. Bayerische Vorgeschichtsblätter 50, 1985, 335-462.
HAJJAR, Y.: Triade= HAJJAR, Y.: La Triade d'Heliopolis-Baalbek. Leiden 1977. HEGER, N.: Steindenkmäler = HEGER, N.: Römische Steindenkmäler aus Brigantium. In:
Das römische Brigantium, hrsg. von E. VONBANK. Bregenz 1985, 13-16. HOLDER, A.: Sprachschatz = HOLDER, A.: Alt-celtischer Sprachschatz. Leipzig 1896-
1913. HÜBNER, E.: Herrschaft= HÜBNER, E.: Römische Herrschaft in Westeuropa, Berlin 1890. IBR = VOLLMER, F.: Inscriptiones Baivariae Romanae. München 1915. ILJ = SASEL, A./J. SASEL: Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia ... repertae et editae
sunt. Ljubljana 1963-1986. KELLNER, H.-J./G. ZAHLHAAS: Tempelschatz = KELLNER, H.-J./G. ZAHLHAAS: Der
römische Tempelschatz von Weißenburg i. Bay. Mainz 1993. KEUNE, J.B.: Scutara = KEUNE, J.B.: Scutara. In: Realency/opädie der classischen Alter
tumswissenschaft II AI, 1921,912-913. KEUNE, J.B.: Seiopa = KEUNE, J.B.: Seiopa. In: Realency/opädie der classischen Alter
tumswissenschaft II A I, 1921, 1114-1118. KNUSSERT, E.: Esco = KNUSSERT, E.: Ist das römische Esco Altdorfbei Marktoberdorf?
Unser Allgäu 10 (2), 1957,6-7. KOLB, A.: Phoebiana = KOLB, A.: Phoebiana- ein Vorschlag zur Namengebung von Kastel
len. Tyche 18, 2003, 31-32.
19
KOLB, A./G. WALSERIG. WINKLER: CIL XVII 4,1 = KOLB, A./G. WALSERIG. WINKLER (Hrsg.): Corpus Inscriptionum Latinarum voluminis decimi septimi pars quarta: Miliaria Illyrici, Fasciculus prior, Miliaria provinciarum Raetiae Norici Dalmatiae. Berlin 2003.
KOVACSOVICS, W.K.: luvavum = KOVACSOVICS, W.K.: luvavum. In: The Autonomaus Towns of Noricum and Pannonia -Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien -Noricum, hrsg. von M. SASEL KOS u. P. SCHERRER. Ljublana 2002, 165-201.
KRAHE, H.: Flußnamen-Schichten = KRAHE, H.: Vorgermanische und frühgermanische Flußnamen-Schichten. In: Namenforschung. Festschrift fiir Adolf Bach zum 75. Geburtstag am 31. Januar 1965, hrsg. von R. SCHÜTZEICHEL Heidelberg 1965, 192-198.
LIEB, H.: Inschriften = LIEB, H.: Die römischen Inschriften von Stein am Rhein und Eschenz. In: Frühgeschichte der Region Stein am Rhein. Archäologische Forschungen am Ausfluss des Untersees, hrsg. von M. HÖNEISEN. Basel 1993, 158-165.
MARTIN-KILCHER, S.: Krug = MARTIN-KILCHER, S.: Der Krug des Nicomedes aus Aventicum. In: Arculiana. Recueil d'hommages offert a Hans Bögli, hrsg. von F.E. KOENIG u. S. REBETEZ. Avenches 1996, 139-150.
RASCH, G.: Namen= RASCH, G.: Antike geographische Namen nördlich der Alpen. Berlin 2005.
RATHMANN, M.: Untersuchungen = RATHMANN, M.: Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium Romanum. Mainz 2003.
REINECKE, P.: Station= REINECKE, P.: Die angebliche Station ESC .... bei Ischl a. Alz, Korrespondenz-Blatt der Deutschen Gesellschaft fiir Anthropologie. Ethnologie und Urgeschichte 50, 1919, 16-17.
REINECKE, P.: Namen III = REINECKE, P.: Die örtliche Bestimmung der antiken geographischen Namen fur das rechtsrheinische Bayern. Bayerischer Vorgeschichtsfreund 6, 1926, 17-44.
REINECKE, P.: Namen I = REINECKE, P.: Die örtliche Bestimmung der antiken geographischen Namen ftlr das rechtsrheinische Bayern. Bayerischer Vorgeschichtsfreund 4, 1924, 17-48.
REINECKE, P.: Namen II = REINECKE, P.: Die örtliche Bestimmung der antiken geographischen Namen ftlr das rechtsrheinische Bayern. Bayerischer Vorgeschichtsfreund 5, 1925, 17-48.
REINECKE, P.: Bauten = REINECKE, P.: Römische Bauten in Kumpfmühl-Regensburg. Germania 1, 1917,78-83.
VON REITZENSTEIN, W.-A.: Römische Ortsnamengebung =VON REITZENSTEIN, W.-A.: Untersuchungen zur römischen Ortsnamengebung. Diss. München 1970.
VON REITZENSTEIN, W.A.: Lexikon = VON REITZENSTEIN, W.A.: Lexikon bayerischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. München 1991.
VON REITZENSTEIN, W.A.: Altbayern = VON REITZENSTEIN, W.A.: Lexikon bayerischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz. München 2006.
RINMS = SASEL KOS, M.: The Roman Inscriptions in the National Museum of Slovenia. Ljubljana 1997.
RIVET, A.L.F.: Names = RIVET, A.L.F.: Celtic names and Roman places. Britannia 11, 1980, 1-19.
RIVET, A.L.F./C. SMITH: Place-Names = RIVET, A.L.F./C. SMITH: The Place-Names of Roman Britan. Princeton 1979.
ROWELL, H.T.: Numerus= ROWELL, H.T.: Numerus, Realencylopädie der classischen Altertumswissenschaft XVII 2, 1937, 1327-1341:2537-2544.
20
SCHERRER, P.: Regnum = SCHERRER, P.: Vom regnum Noricum zur römischen Provinz: Grundlagen und Mechanismen der Urbanisierung. In: The Autonomaus Towns ofNoricum and Pannonia - Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien - Noricum, hrsg. von M. sM;EL KOS u. P. SCHERRER. Ljublana 2002, 12-70.
SCHERRER, P.: Lage = SCHERRER, P.: Zur Lage der statio Esc(ensis?) in Noricum. In: Lebendige Altertumswissenschaft. Festgabe zur Vollendung des 70. Lebensjahres von Hermann Vetters. Wien 1985,255-257.
SCHMID, A.: Namenschichten = SCHMID, A.: Die ältesten Namenschichten im Stromgebiet des Neckar. Beiträge zur Namenforschung 13, 1962, 53-69; 97-125; 209-227.
SPEIDEL, M.P.: Denkmäler = SPEIDEL, M.P.: Die Denkmäler der Kaiserreiter. Equites Singulares Augusti. Köln, Bonn 1994.
SPEIDEL, M.P.: Riding = SPEIDEL, M.P.: Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guard. London I 994.
STAPPERS, A.: Milices = STAPPERS, A.: Les milices Iocales de !'Empire romain. Musee Beige 7, 1903, 198-246; 301-334.
STEIN, E.: Beamte = STEIN, E.: Die kaiserlichen Beamten und Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat. Mit Benützung von E. Ritterlings Nachlaß. Wien 1932.
TERNES, C.-M.: Germania Superior= TERNES, C.-M.: Die Provincia Germania Superior im Bilde der jüngeren Forschung. In: Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. !I 5 1975, 721-1260.
TlEFENBACH, H.: Günzburg =TIEFEN BACH, H.: Günzburg. Namenkundliches. Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 13, 1999, !54.
TRUSCHNEGG, B.: Vorarlberg = TRUSCHNEGG, 8.: Vorarlberg und die Römer. Geschichtsbewußtsein und Landesgeschichte im Wechselspiel (1800-1945). Graz 2001.
VENNEMANN GEN. NIERFELD, T.: Matronae = VENNEMANN GEN. NIERFELD, T.: Die ubischen Matronae Albiahenae und der kelto-römische Mercurius Cimiacinus. Mit einem
Anhang über den Weissenburger Mercurius Pro[i]tium. Beiträge zur Namenforschung 28, 1993, 27 I -300.
WAGNER, F.: Inschriften = WAGNER, F.: Neue Inschriften aus Raetien (Nachträge zu Fr. Vollmer, Inscriptiones Baivariae Romanae). Bericht der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 37-38, 1956-57, 215-264.
WAMSER, L.: Miltenberg/Altstadt = WAMSER, L.: Miltenberg/Altstadt- Eine Ruine wird zur Stadt. Das Kastell "Altstadt" in Römerzeit und Mittelalter. In: Welterbe Limes. Roms Grenze am Main, hrsg. von B. STEIDL. Obernburg am Main 2008, 236-251.
WAMS ER, L.: Miltenberg!Bürgstadt = W AMSER, L.: Miltenberg!Bürgstadt- Schrumpfen fiir das Überleben. Das Rückzugsfort im NumeruskastelL In: Welterbe Limes. Roms Grenze am Main, hrsg. von B. STEIDL. Obernburg am Main 2008, 204-209.
WEBER, E.: Weihinschrift = WEBER, E.: Die Weihinschrift des Aurelius Augustus aus Bregenz. In: Archäologie in Gebirgen. Elmar Vonbank zum 70. Geburtstag, hrsg. von H. SWOZILEK u. G. GRABHER. Bregenz 1992, 203-206.
WEBER, G.: Anfänge= WEBER, G.: Die Anfänge des römischen Cambodunum-Kempten. In: Geschichte der Stadt Kempten, hrsg. von V. DOTTERWEICH, K. Filser, P. FRIED, G. GOTTLIEB, W. HABERL u. G. WEBER. Kempten 1989, 14-21.
WEDENIG, R.: Quellen= WEDENIG, R.: Epigraphische Quellen zur städtischen Administration in Noricum. Klagenfurt 1997.
WOLFF, H.: Führer= WOLFF, H.: Führer durch das Lapidarium im Römermuseum Kastell Boiotro. München 1987.
21