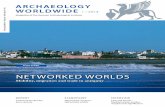C. Höpken, Ludi circenses auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen...
-
Upload
saarland-de -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of C. Höpken, Ludi circenses auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen...
Herausgegeben vom
Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz
in Verbindung mit dem
Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie
Sonderdruck aus
ArchäologischesKorrespondenzblatt
Jahrgang 41 · 2011 · Heft 1
Diese pdf-Datei ist nur zum persönlichen Verteilen bestimmt. Sie darf bis Mai 2013 nicht auf einer Homepage im Internet eingestellt werden.
This PDF is for dissemination on a personal basis only. It may not be published on the world wide web until May 2013.
Ce fichier pdf est seulement pour la distribution personnelle. Jusqu’à mai 2013 il ne doit pas être mis en ligne sur l’internet.
Paläolithikum, Mesolithikum: Michael Baales · Nicholas J. Conard
Neolithikum: Johannes Müller · Sabine Schade-Lindig
Bronzezeit: Christoph Huth · Stefan Wirth
Hallstattzeit: Markus Egg · Dirk Krauße
Latènezeit: Rupert Gebhard · Hans Nortmann · Martin Schönfelder
Römische Kaiserzeit im Barbaricum: Claus v. Carnap-Bornheim · Haio Zimmermann
Provinzialrömische Archäologie: Peter Henrich · Gabriele Seitz
Frühmittelalter: Brigitte Haas-Gebhard · Dieter Quast
Wikingerzeit, Hochmittelalter: Hauke Jöns · Bernd Päffgen
Archäologie und Naturwissenschaften: Felix Bittmann · Joachim Burger · Thomas Stöllner
Die Redaktoren begutachten als Fachredaktion die Beiträge (peer review).
Das Archäologische Korrespondenzblatt wird im Arts & Humanities Citation Index®
sowie im Current Contents®/Arts & Humanities von Thomson Reuters aufgeführt.
Übersetzungen der Zusammenfassungen (soweit gekennzeichnet): Loup Bernard (L. B.)
und Manuela Struck (M. S.).
Beiträge werden erbeten an die Mitglieder der Redaktion oder an das
Römisch-Germanische Zentral museum, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, [email protected]
Die mit Abbildungen (Strichzeichnungen und Schwarzweißfotos), einer kurzen Zusammenfassung und der
genauen Anschrift der Autoren versehenen Manuskripte dürfen im Druck 20 Seiten nicht überschreiten. Die
Redaktion bittet um eine allgemeinverständ liche Zitierweise (naturwissenschaftlich oder in Endnoten) und
empfiehlt dazu die Richtlinien für Veröffentlichungen der Römisch-Germanischen Kommis sion in Frankfurt
am Main und die dort vorgeschlagenen Zeitschriftenabkürzungen (veröffentlicht in: Berichte der Römisch-
Germanischen Kommission 71, 1990 sowie 73, 1992). Zur Orientierung kann Heft 1, 2009, S. 147ff. dienen.
ISSN 0342 – 734X
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
© 2011 Verlag des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsRedaktion und Satz: Manfred Albert, Hans Jung, Martin Schönfelder; Gwendolen Pare (Nackenheim), Tanja Göbel (Dieburg)Herstellung: gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH, Mainz
Das für diese Publikation verwendete Papier ist alterungsbeständig im Sinne der ISO 9706.
REDAKTOREN
CONSTANZE HÖPKEN
LUDI CIRCENSIS AUF DEM SPIELBRETT:
ZU SPIELSTEINEN UND SPIELBRETTERN
EINES RÖMISCHEN ZIRKUSSPIELS
Brettspiele sind seit Jahrtausenden Bestandteil des menschlichen Lebens: Im Glücksspiel oder im Strategie-spiel traten sich Gegner gegenüber und maßen Glück oder taktischen Verstand 1. Im archäologischen Fund -repertoire sind antike Spielbretter selten nachgewiesen 2. Zahlreich hingegen sind Brettspielsteine und Wür -fel überliefert. Von den Spielsteinen tragen einige eingeritzte Namen und manchmal auch eine Darstellungeines Pferdes oder Wagenlenkers. In der Forschung wurde vermutet, dass sie zu einem Zirkusspiel gehören 3
– wie dieses aber gespielt wurde, blieb unklar.Im Allgemeinen bestehen Spielsteine meist aus Bein oder Glas 4, manchmal auch aus Metall 5, und messenzwischen 15 und 25mm im Durchmesser. Da meistens zwei Parteien gegeneinander spielten, mussten Spiel -steinsätze unterscheidbar sein, gegebenenfalls sollte sich – je nach Spiel – auch eine unterschiedliche Wertig-keit erkennen lassen. Zur Unterscheidung dienten verschiedene Ausführungen und Verzierungen: bei Jetonsaus Bein beispielsweise gedrechselte Rillen oder Punktbohrungen, bei gläsernen Exemplaren ver schiedeneFarben und zusätzlich manchmal eingelegte farbige Glastupfen, bei metallenen offenbar bunte Email -einlagen 6. Selten finden sich auch kreuzförmige Markierungen, Zahlen und zudem eben auch Auf schriftenoder Darstellungen von Figuren oder Palmzweigen 7. Gefunden werden meist einzelne bereits in der Antikeverlorene Spielsteine, selten mehrere zusammen. Vollständige Sätze hingegen sind selten und allenfalls ausGrä bern überliefert 8; wenige Römer haben ihre Spielausrüstung in das Jenseits mitbekom men 9. Mit oft über 40mm Durchmesser etwas größer fallen mutmaßliche Spielsteine oder Rondelle aus, die ausumgearbeiteten Keramikscherben hergestellt wurden 10 und manchmal in größerer Zahl in Siedlungsabfallgefunden werden 11. Auch auf diesen sind manchmal Namenseinritzungen zu erkennen 12. Eine eigene Gruppe innerhalb der Spielsteine bilden solche mit Namen und/oder Pferde- und Wagenlenker -darstellungen aufgrund der Materialwahl, ihrer Größe und der Aufschriften bzw. Dekorationen beispiels-weise aus Trier, Köln und Colchester (Abb. 1-2; 3, 1-4) 13. Oft bestehen sie aus Stein – Kalkstein oder Mar -mor –, seltener auch Keramik oder Bein. Charakteristisch ist eine Größe zwischen 50 und 100 mm; sie sindje nach Material zwischen 5 und 15mm dick. Die Beschriftung wurde meist individuell angebracht. Diesweist darauf hin, dass es sich oft von vornherein um Einzelstücke gehandelt hat 14. Manche sind sehrqualitätvoll gearbeitet, einige Beschriftungen haben eher einen flüchtigen Charakter. Die Aufschriften nennen offenbar Pferdenamen – recht eindeutig ist dies bei Pegasus (Abb. 1, 2) 15 – undmanchmal auch solche von Wagenlenkern 16. Daher war schon lange vermutet worden, dass mit ihnen einZirkusspiel gespielt wurde 17; der Spielverlauf blieb aber unbekannt. Größe und Robustizität dieser Spielsteine, durch die sie sich deutlich von üblichen Spielsteinen unter-scheiden, ließen Paul Steiner an ein »Schibbelspiel« denken, bei dem die Spielsteine gerollt oder geschobenbzw. geworfen wurden 18. Entsprechende Abnutzungsspuren sind allerdings nicht ausdrücklich vermerktund mit bloßem Auge zumindest an einem Exemplar in Köln 19 nicht erkennbar. Die Benutzungsweisedieser großen Jetons lässt sich also nicht an Größe, Aufschrift oder Gebrauchsspuren ablesen. Da es sich,wenn auch um großformatige, aber dennoch zweckdienliche Brettspielsteine zu handeln scheint, war eineÜberprüfung von Spielbrettern auf geeignete Exemplare geboten.
65ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Blickt man nach Nordafrika, finden sich dort inBodenplatten eingeritzte Zirkusgrundrisse (Abb. 3,5-8) 20. Sie sind an der Form, aber auch an den car -ceres, den Startboxen, und oftmals an einer Zielliniezu er kennen 21. In Dougga ist ein solches Graffitozweifach belegt: auf einer Treppenstufe im Hofeines noch anonymen Tempels (Abb. 3, 5) 22 und inder Porticus des Concordia-, Frugifer- und LiberPater-Tempels (Abb. 3, 6) 23. Außerdem finden sichdiese Grundrisse in Henchir-el-Faouar in der Forums -porticus (Abb. 3, 7) 24 und in Leptis Magna auf demStraßenpflaster (Abb. 3, 8) 25 – also jeweils anPlätzen, die für eingeritzte Spielfelder typisch sind 26.Mit einer Länge von 100 bis 130cm und einer Breitevon 40 bis 50cm boten sie ausreichend Raum, mitgroßen Spielsteinen zu spielen, beispielsweise sol -chen mit Pferdenamen (vgl. Abb. 3).
66 Höpken · Ludi circensis auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen Zirkusspiels
Abb. 1 Spielsteine mit Pferdenamen: 1 Trier (Marmor[?], Dm. 97mm; Rheinisches Landesmuseum Trier Inv.-Nr. 21209; Steiner 1939,44 Taf. 22 Nr. 55). – 2 Köln-Pesch (Sandstein, Dm. 58mm; verschollen; Fremersdorf 1937, 49 Abb. 8,1). – 3 Köln (Marmor, Dm. 56mm;Römisch-Germanisches Museum, Köln Inv.-Nr. 55,236; Bös 1955/56b, 317 Abb. 1). – 4 Colchester (Keramik, Dm. 51mm; ColchesterMuseum Katalog 1, 1863, 32 Nr. 608; Collingwood / Wright 1991, 102 Nr. 2439.21*). – M. = 1:2.
1
3 4
2
Entsprechend könnten auch die zu den Spielsteinen aus Köln, Trier und Colchester gehörenden Spielbretterausgesehen haben, die vielleicht mit einer Scherbe auf eine Steinplatte oder mit einem Stock in den Sandgeritzt gewesen sein mögen 27. Zu rekonstruieren ist damit ein Zirkusspiel, das mit einem Jeton pro Spieler und vielleicht einem Würfelgespielt wurde – das Würfelglück entschied über die Chance, als erster das Ziel zu erreichen 28. Vermutlich
Abb. 2 Spielstein mit dem Pferdenamen MIRANDVS aus Köln. –(Photo Rheinisches Bildarchiv). – M. = 1:1.
67ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
1 2 3 4
Abb. 3 1-4 Spielsteine mit Pferdenamen aus den Nordwestprovinzen (vgl. Abb. 1). – Spielbrett-Graffiti aus Tunesien: 5-6 Dougga. –7 Henchir-el-Faouar. – Libyen: 8 Leptis Magna. – (nach Langner 2001, Taf. 150-151 Nr. 2327-2330). – M. = 1:10.
5
6
7
8
war das Spiel mit mindestes zwei, wegen der Breite der Bahnen und entsprechend der überlieferten vierFarben der factiones (Rennställe bzw. -clubs) in Rom und Konstantinopel 29 aber wohl in der Regel mit vierSpielern zu spielen. Statt eines eigens dafür gekennzeichneten Spielsteins konnte auch einfach eine Münze als Rennpferd aufdem Spielbrett dienen – im Idealfall eine mit der Darstellung einer Quadriga 30. Aber auch kleine rundplas-tische Pferdedarstellungen könnten als Spielfiguren in Frage kommen 31. Das Spiel ist offenbar meist mit dem direkten Vorbild – der Rennbahn – verbunden, denn es fällt auf, dassdie Zeugnisse für ein solches Spiel vor allem aus Städten stammen, in denen auch ein Zirkus belegt oderzumindest anzunehmen ist: In den nordafrikanischen Städten Dougga und Leptis Magna 32 und im Westenin Rom, Köln, Mainz, Trier und Colchester 33. Die Rennbahn war aber nicht nur Vorbild für dieses Spiel: AusKon stantinopel stammt eine marmorne Murmelbahn, bezeichnenderweise in der Nähe des Zirkus ge -funden, die ebenfalls Wagenrennen thematisiert 34. Über einen an der Vorderseite abgeschrägten Mar mor -block verläuft in Serpentinen ein Murmelbahnkanal, in dem die Murmeln herabrollen. Am Sockel und anden Seiten sind Wagenrennen mit Quadrigen abgebildet, die einen Bezug zum Zirkus herstellen. In beiden Spielen, dem Murmelspiel und den in den Boden eingeritzten Spielfeldern, wurden Pferde- bzw.Wagenrennen aus dem Zirkus in die Alltagswelt der Kinder übertragen. Graffiti 35 und Namensnennungenauf Kontorniaten 36, Mosaiken 37 und Messergriffen 38, die eine eifrige Verehrung von Rennpferden undWagen lenkern anzeigen 39, bestätigen die zentrale Bedeutung der ludi circensis in der römischen Lebens-welt. Auch einige Namen auf unseren Spielsteinen beziehen sich offenbar auf damals existierende Pferdeoder Wagenlenker: Ein Stein aus Trier nennt den Wagenlenker Superstes, der auch auf einem TriererMosaik namentlich abgebildet ist 40. Für Köln ist mutmaßlich zweifach der Name Mirandus auf Jetons be -legt 41. Liegt hiermit also möglicherweise ein Nachweis vor, dass es in Köln ein berühmtes Pferd namensMirandus gegeben hat? Die isolierten Hinweise auf ein römisches Zirkusspiel einerseits mit Rennpferd- und Wagenlenker-Spiel-steinen in den westlichen Provinzen und andererseits mit Zirkusgrundrissen in Nordafrika ergeben erst inder Zusammenschau ein vollständiges Bild: Insbesondere in Städten, in denen tatsächlich auch eine Renn-bahn existiert hat, wurde ein Zirkusspiel gespielt, mit Spielsteinen, für die offenbar real existierende Renn-pferde und Wagenlenker Pate standen.
68 Höpken · Ludi circensis auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen Zirkusspiels
Anmerkungen
1) Durch Anregungen und Diskussionen haben mich Manuel P.Fiedler, Renate und Eberhard Thomas sowie Beate Schneiderund Katja Oehmen unterstützt. Ihnen gilt mein herzlicherDank. – Für eine Neuaufnahme des Kölner Spielsteins imRömisch-Germanischen Museum der Stadt Köln sorgten Frie-derike Naumann-Steckner und Agnès Adam. – Allgemein zuSpielen in der Antike vgl. Huizinga 1938; Murray 1957; Fittà1997.
2) Im Römischen Reich sind auf Tempelstufen, Theatersitzbän-ken oder Bodenplatten öffentlicher Plätze eingeritzte Spiel-bretter überliefert. Sie befanden sich an den Stellen, wo mansich verabredete oder traf, wartete und sich die Zeit vertrieb.Antike Spielbretter aus organischem Material sind vor allem inGermanien nachgewiesen (vgl. Krüger 1982). Auch Spiel-steine finden sich oft an Orten, an denen man die Freizeit ver-brachte beispielsweise in Bädern, Tavernen oder im Amphi-theater (vgl. z.B. Collingwood / Wright 1991, 111. 117. 120Nr. 2440.15, 2440.51, 2440.68; Holliger / Holliger 1983, 14Abb. 7-8; Steiner 1939, 42-45 Nr. 2, 28, 37, 52, 55, 56, 61,67, 72, 75, 77).
3) Bös 1955/56a, 178. – Goethert 2007, 349.
4) Holliger / Holliger 1983, 5-6.
5) Ammann 2003, 106 Nr. 10: Sechs »Zierknöpfe«. Da die Stücke über keinerlei Befestigungsmöglichkeit verfügen,könn te es sich m.E. um Brettspielsteine handeln.
6) »Zierknöpfe« aus Bronze mit Resten gelber und türkisblauerEmaileinlage (Ammann 2003, 106).
7) Vgl. z.B. Steiner 1939, Taf. 21; Mickler 1997, Taf. 20; Faust2007; Merten 2007; Schwinden 2007.
8) Einen besonderen Glückfall für die Archäologie stellt einGrabfund in Colchester dar: erhalten waren hier, auf einemvergangenen und nur durch die Scharniere nachgewiesenenHolzspielbrett aufgestellte Spielsteine: Crummy 2007; Schäd-ler 2007.
9) Vgl. z.B. Hensen 2009, Taf. 223, 65/111.7-22. Taf. 232,65/130.7-15. Taf. 254, 66/4.6-15. – Crummy 2007. – Kraus2005, 389. – Müller 1999, 29 Grab 289. – Stauch 1993, 44
Abb. 58. – Collingwood / Wright 1991, 105. – Krug 1987,466 Abb. 3. – Riedel 1980, 146 Grab 17/3. – von Schnurbein1977, 142 Taf. 17 Grab 98; 194 Taf. 106 Grab 794. – Dölger1911.
10) Steiner 1939, 40; Chardron-Picault 2004, 329-340; Kiernan2009, 154f. – Außer als Brettspielstein könnten sie auch alsZählsteine oder Gefäßverschlüsse gedient haben.
11) Steiner 1939, 40. Auch im vicus von Bonn (OV 89/40, Befund88) wurden in einer Grube 20 Exemplare gefunden. Auffälligwar, dass sie mit überdurchschnittlich vielen Fragmenten vonImportamphoren vergesellschaftet waren: Abfall einer Ta ver -ne?
12) Beispielsweise Collingwood / Wright 1991, 102f.
13) Bös 1955/56a/b; Steiner 1939, 39-41; Collingwood / Wright1991, 96 Nr. 2438.1; 100 Nr. 2439.9; 102f. Nr. 2439.21 u.2439.25. – Fast alle britischen Exemplare wurden in Colches-ter gefunden. Beachtenswert ist auch ein Jeton von dort miteiner Elefantendarstellung (Collingwood / Wright 1991, 97Nr. 2438.7).
14) Bisher ist nur ein Satz dieser Spielsteine bekannt geworden. Eshandelt sich um sechs beinerne Spielsteine von etwa 50mmDurchmesser, gefunden in einem Kindergrab in Rom (Klum-bach 1952, 7-8). Dargestellt sind auf der einen Seite jeweilsein Pferd, dessen Name genannt wird (erhalten sind dieNamen Amicus, Dexiforus [?], Uranius, Pyrobolus und Tyran-nus), auf der anderen ist jeweils ein stehender oder knienderWagenlenker abgebildet. Vermutlich ebenfalls von Spielstein-sätzen stammen zwei Exemplare mit Zirkusdarstellungen aufder einen und einer Zahl auf der anderen Seite (Landes 1990a,95-97). Letztere werden allerdings auch als Eintrittmarken dis-kutiert (Mlasowsky 1991, 5).
15) Bös 1955/56a, 181 Abb. 2, 2.
16) Steiner 1939, 40 Taf. 22, 43. Hierin sind sie den Kontorniatenähnlich.
17) Bös 1955/56a, 178.
18) Steiner 1939, 40. – Bös 1955/56a, 178.
19) Römisch-Germanisches Museum, Köln Inv.-Nr. 55,236 (Mi -ran dus). – Vgl. Bös 1955/56b, 317 Abb. 1, 3 und 2.
20) Langner 2001, Taf. 150 Nr. 2327; 151 Nr. 2328-2330.
21) Durch einen Palmzweig ist die Ziellinie im Zirkusgraffito vonHenchir el-Faouar eindeutig als solche gekennzeichnet (vgl.Langer 2001, Taf. 150 Nr. 2327).
22) L. 130cm. Gebäude Dar-el-Acheb, Dar Lacheb bzw. Bar-el-Acheb vgl. Langner 2001, Taf. 151 Nr. 2328. – Zum Tempelvgl. Khanoussi 2002, 49. 12f. Nr. 31.
23) L. ca. 100cm. Langner 2001, Taf. 151 Nr. 2329. – Zum Tem-pel siehe Khanoussi 2002, 12-13 Nr. 22 und 40.
24) L. 100cm. Langner 2001, Taf. 150 Nr. 2327. – Humphrey1986, 331.
25) L. 50cm. Langner 2001, Taf. 151 Nr. 2330.
26) Vgl. Anm. 2 sowie Langner 2001, 72. – Auf ihre Funktion alsSpielbrett weist u.a. auch hin, dass sie stets am Boden undnicht an Wänden angebracht waren.
27) Der intensiven Überbauung der Städte und insbesondere beiKöln auch einer Steinarmut geschuldet, sind kaum Architek-turreste in situ überliefert, an denen sich Spielbretter befun-den haben könnten. Möglicherweise haben die recht großenSpielbretter auch aus vergänglichem Material, Stoff oderLeder, bestanden; sie konnten einfach mitgenommen und amSpielort ausgebreitet werden (vgl. textile Pachisi-Spielfelderder Neuzeit aus Indien bei Finkel 2007).
28) Allerdings wären für das durch einen Zufallsgenerator ge -regelte Vorrücken Gliederungslinien auf dem Spielbrett vonVorteil, die in keinem Fall nachgewiesen sind.
29) Goethert 2007, 347.
30) Thomas 2001, 506-508. – Desnier 1990, 81-90.
31) Klumbach 1952, 6 Abb. 7, 2 und 7 Abb. 10; Lange 1994,291-293; Rouvier-Jeanlin 1972, 325-337 Nr. 972-1020. – AlsSpielstein wurde aber wohl schon immer jeder greifbare mehroder weniger geeignete Gegenstand benutzt. Aus der Neuzeitist beispielsweise überliefert, dass in der Sahara Kameldung-Kugeln als Spielfiguren verwandt wurden (Murray 1957, 69).
32) Zu Zirkusanlagen allgemein siehe Humphrey 1986. – Nord-afrika war in der Antike zudem insbesondere für seine Pferde-zucht bekannt.
33) Wenn auch kein Zirkus in Köln nachgewiesen ist, so ist dochdavon auszugehen, dass in der Hauptstadt der Provinz Nieder-germanien – eine Stadt von überregionaler Bedeutung undZentrum des Umlandes – eine Rennbahn existiert hat (zurmöglichen Lage in der Stadt vgl. Thomas 1984). – Gleiches giltfür Mainz, der Hauptstadt Obergermaniens und Legions-standort (vgl. Hyland 1990, 209).
34) Effenberger 2010. – Auch der Kölner Mirandus-Spielstein (Bös1955/56b, 317) wurde nicht weit vom möglichen Zirkus -standort unter St. Maria im Kapitol gefunden (Binsfeld 1962/63, 135).
35) Langner 2001, 65 mit Anm. 403, Taf. 93 Nr. 1396 (bezeich-nenderweise aus einem Paedagogium in Rom) und Taf. 95 Nr.1431.
36) Alföldi 1943, 118-121.
37) Thomas 2001, 508-513. – Hoffmann / Hupe / Goethert 1999,142f. Taf. 71-73. – Dunbabin 1982. – Poinssot 1958, Taf. 3a.
38) Landes 1990b, 305-308, Nr. 67-72.
39) Goethert 2007, 345; Langner 2001, 65. – Zur Rezeption derWagenlenker in römischer Zeit vgl. Thomas 2001.
40) Zum Spielstein siehe Bös 1955/56a, 179 Abb. 2, 2; 182. –Zum Mosaik siehe Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 142f.Taf. 71-73, vgl. Horsmann 1998, 292f.
41) Bös 1955/56a, 180f.; 1955/56b, 317. – Der Name kommtwohl auch auf einem Trierer Spielstein vor (Steiner 1939, 43Taf. 21, 31).
69ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Literatur
Alföldi 1943: A. Alföldi, Die Kontorniaten. Ein verkanntes Propagan-damittel der stadtrömischen heidnischen Aristokratie in ihremKampf gegen das christliche Kaisertum (Budapest, Leipzig 1943).
Ammann 2003: S. Ammann, Fünf Gräber und eine Villa. Befundeund Funde der Römerzeit in Reinach (BL). Ber. Arch. u. Kantons-mus. Baselland 46 (Liestal 2003).
Binsfeld 1962/63: W. Binsfeld, Funde aus dem römischen Kanäl-chen. Kölner Jahrb. Vor- u. Frühgesch. 6, 1962/63, 135.
Bös 1955/56a: M. Bös, Spielsteine als Rennpferde. Bonner Jahrb.55/56, 1955/56, 178-183.
1955/56b: M. Bös, Nochmals »Spielsteine als Rennpferde«.Bonner Jahrb. 55/56, 1955/56, 317.
Chardron-Picault 2004: P. Chardron-Picault, Les rondelles en terrecuite mises au jour dans le quartier artisanal du »lycée militaire«à Augustodurum (Autun, Saône-et-Loire). SFECAG. Actes ducongrès de Vallauris 2004, 329-340.
Collingwood / Wright 1991: R. G. Collingwood / R. P. Wright, TheRo man inscriptions of Britain Vol II, Fasc. 3. Instrumentum Do -mesticum (Oxford 1991).
Crummy 2007: Ph. Crummy, The gaming board in CF47: theremains as found, possible reconstructions, and post depositio-nal movements. In: Ph. Crummy / St. Benfield / N. Crummy / V.Rigby / D. Shimmin, Stanway: An élite burial site at Camolodu-num. Britannia Monogr. Ser. 24 (London 2007) 352-359.
Demandt / Engemann 2007: A. Demandt / J. Engemann (Hrsg.),Konstantin der Grosse: Imperator Caesar Flavius Constantinus(Mainz 2007).
Desnier 1990: J.-L. Desnier, Les représentations du cirque sur lesmonnaies et les médailles. In: Ch. Landes (Hrsg.), Rome – By -zance. Le cirque et les courses de chars (Lattes 1990) 81-90.
Dölger 1911: F. J. Dölger, Spielmarken in Fischform aus einemRömergrab bei St. Matthias in Trier. Röm.-Germ. Korrbl. 4,1911, 26-29.
Dunbabin 1982: K. M. Dunbabin, The victorious charioteer onmosaics and related monuments. American Journal Arch. 86,1982, 65-89.
Effenberger 2010: A. Effenberger, Kugelspiel. In: Byzanz: Prachtund Alltag. Ausstellung, Kunst- und Ausstellungshalle der Bun -desrepublik Deutschland, Bonn, 26. Februar bis 13. Juni 2010(München 2010) 207-208.
Faust 2007: S. Faust, Spielstein mit Quadriga. In: Demandt / En ge -mann 2007, Katalogeintrag I.17.60.
Finkel 2007: I. Finkel, Pachisi. In: U. Schädler (Hrsg.), Spiele derMenschheit. 5000 Jahre Kulturgeschichte der Gesellschafts-spiele (Darmstadt 2007) 83-92.
Fittà 1997: M. Fittà, Spiele und Spielzeug in der Antike (Stuttgart1997).
Fremersdorf 1937: F. Fremersdorf, Inschriften auf römischem Klein -gerät aus Köln. Ber. RGK 27, 1937, 32-50.
Goethert 2007: K. Goethert, Circus und Wagenrennen. In: De -mandt / Engemann 2007, 344-349.
Hensen 2009: A. Hensen, Das römische Brand- und Körpergräber-feld von Heidelberg. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 108 (Stuttgart 2009).
Hoffmann / Hupe / Goethert 1999: P. Hoffmann / J. Hupe / K.Goe thert, Katalog der römischen Mosaike aus Trier und demUmland. Trierer Grab. u. Forsch. 16 (Trier 1999).
Holliger / Holliger 1983: Ch. Holliger / C. Holliger, Römische Spiel-steine und Brettspiele. Jahresber. Ges. Pro Vindonisssa 1983, 5-24.
Horsmann 1998: G. Horsmann, Die Wagenlenker der römischenKaiserzeit. Forsch. Ant. Sklaverei 29 (Stuttgart 1998).
Huizinga 1938: J. Huizinga, Homo Ludens (Haarlem 1938).
Humphrey 1986: J. H. Humphrey, Roman Circuses. Arenas forchariot racing (Berkeley/Los Angeles 1986).
Hyland 1990: A. Hyland, Equus: the horse in the Roman World(London 1990).
Khanoussi 2002: M. Khanoussi, Dougga (Tunis 2002).
Kiernan 2009: Ph. Kiernan, Miniature votive offerings on the Ro -man North-West. MenTor. Stud. Metallarb. u. Toreutik Ant. 4(Mainz, Ruhpolding 2009).
Klumbach 1952: H. Klumbach, Pferde mit Brandmarken. Fest-schrift des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainzzur Feier seines hundertjährigen Bestehens 1952, Band 3 (Mainz1952) 2-12.
Kraus 2005: K. Kraus, Ein römisches Gräberfeld bei Moers-Schwaf-heim am Niederrhein. In: H.-G. Horn / H. Hellenkemper / G.Isen berg / J. Kunow (Hrsg.), Von Anfang an. Archäologie inNordrhein-Westfalen (Mainz 2005) 387-389.
Krug 1987: A. Krug, Nero’s Augenglas. Realia zu einer Anekdote.In: Archéologie et médicine. VIIèmes rencontres internationalesd’Archéologie et d’Histoire d’Antibes (Juan-les-Pins 1987).
Krüger 1982: Th. Krüger, Das Brett- und Würfelspiel der Spät -latène zeit und römischen Kaiserzeit im freien Germanien. NeueAusgr. u. Forsch. Niedersachsen 15 (Hannover 1982) 135-324.
Landes 1990a: Ch. Landes, Pion de jeu (Nr. 52-53). In: Le CirqueRomain [Ausstellungskat. Toulouse] (Toulouse 1990) 95-97.
1990b: Ch. Landes, Manches de couteau à lame pliante Nr. 67-72. In: Chr. Landes (Hrsg.), Rome – Byzance. Le cirque et lescourses de chars (Lattes 1990) 305-308.
Lange 1994: H. Lange, Die Koroplastik der Colonia Claudia AraAgrippinensium. Untersuchungen zu Typologie, Technik, Werk-stattfunden, Betrieben, Signaturen und Produktionszeit. KölnerJahrb. 27, 1994, 117-309.
Langner 2001: M. Langner, Antike Graffitizeichnungen: Motive,Gestaltung und Bedeutung. Palilia 11 (Wiesbaden 2001).
Merten 2007: H. Merten, Spielstein mit Darstellung eines Wagen-lenkers. In: Demandt / Engemann 2007, Katalogeintrag I.17.59.
Mikler 1997: H. Mikler, Die römischen Funde aus Bein im Landes-museum Mainz. Monogr. Instrumentum 1 (Montagnac 1997).
Mlasowsky 1991: A. Mlasowsky, Die antiken Tesseren im Kestner-Museum Hannover (Hannover 1991).
Müller 1999: M. Müller, Faimingen-Phoebiana II. Die römischenGrabfunde. Limesforsch. 26 (Mainz 1999).
Murray 1957: H. J. R. Murrray, A history of boardgames othersthan chess (Oxford 1957).
Poinssot 1958: C. Poinssot, Les ruines des Dougga (Tunis 1958).
Riedel 1980: M. Riedel, Die Grabung 1974 im römischen Gräber-feld an der Luxemburger Strasse in Köln. Kölner Jahrb. Vor- u.Frühgesch. 17, 1980, 92-133.
Rouvier-Jeanlin 1972: M. Rouvier-Jeanlin, Les figurines Gallo-Ro -maines en terre cuite au Musée des Antiquités nationales. Gal-lia Suppl. 24 (Paris 1972).
Schädler 2007: U. Schädler, The doctor’s game – new light on thehistory of ancient board games. In: Ph. Crummy / St. Benfield /N. Crummy / V. Rigby / D. Shimmin, Stanway: An élite burial siteat Camolodunum. Britannia Monogr. Ser. 24 (London 2007)359-375.
von Schnurbein 1977: S. von Schnurbein, Das römische Gräberfeldvon Regensburg. Archäologische Forschungen in Regina Castra-
70 Höpken · Ludi circensis auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen Zirkusspiels
Regensburg 1. Materialh. Bayer. Vorgesch. A 31 (Kallmünz1977).
Schwinden 2007: L. Schwinden, Spielstein mit Wagenlenker (agi-tator). In: Demandt / Engemann 2007, Katalogeintrag I.17.58.
Stauch 1993: E. Stauch, Brettspiel von der Römischen Kaiserzeitzum Hochmittelalter. Ein nobler Zeitvertreib. In: Spielzeug in derGrube lag und schlief. Archäologische Funde aus Römerzeit undMittelalter. Museo 5 (Heilbronn 1993) 42-49.
Steiner 1939: P. Steiner, Römisches Brettspiel und Spielgerät ausTrier. Saalburg-Jahrb. 9, 1939, 34-45.
Thomas 1984: E. Thomas, Bemerkungen zum Circus des römi-schen Köln. Boreas 7, 1984, 157-171.
Thomas 2001: R. Thomas, Aurigae und agitatores. Zu einer Wa -genlenkerstatuette im Römisch-Germanischen Museum Köln.Kölner Jahrbuch 34, 2001, 489-522.
71ARCHÄOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 41 · 2011
Zusammenfassung / Abstract / Résumé
Ludi circensis auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen ZirkusspielsSpielsteine aus den Westprovinzen, die durch Namensaufschriften oder Abbildungen von Pferden oder Wagenlenkernals Rennpferde oder Quadrigen gekennzeichnet sind, gehörten zu einem Zirkusspiel, dessen Spielweise zunächst unbe-kannt war. Erst im Zusammenhang mit Spielbrettern aus Nordafrika, die einen Rennbahngrundriss zeigen, kann einZirkus spiel rekonstruiert werden. Auffallend ist, dass die Zeugnisse für dieses Spiel fast ausnahmslos aus Städten stam -men, in denen ein Zirkus nachgewiesen oder zumindest anzunehmen ist. Darüber hinaus lassen sich offenbar Namenauf den Spielsteinen mit damals berühmten Rennpferden und Wagenlenkern verbinden.
Ludi circensis on the play board: on counters and play boards of a Roman circus gameCounters from the western provinces characterised either by names or depictions of horses or charioteers as racinghorses or quadrigas, belonged to a circus game the rules of which at first was unknown. Only in association with playboards from North Africa showing the plan of a race course, a circus game can be reconstructed. It is striking that evidence for this game comes almost exclusively from towns for which the existence of a circus is established or atleast suggested. Furthermore, names on the counters can apparently be related to famous racing horses and chario-teers. M. S.
Les ludi circensis sur plateau: à propos des pions et des plateaux d’un jeu de cirque romain Des jetons provenant des provinces occidentales, qui se caractérisent par des noms ou des représentations de chevaux,de conducteurs de chevaux de course ou de quadriges, appartenaient à un jeu de cirque dont les règles sont encoreinconnues. En lien avec des plateaux de jeu d’Afrique du nord, qui reproduisent le plan d’une piste de course, on peutrestituer un jeu de cirque. De manière étonnante, les occurences de ce jeu proviennent presque exclusivement de villes où l’existence d’un cirque est attestée, ou tout du moins supposée. On peut donc visiblement mettre en relationles noms présents sur les jetons avec des chevaux de course et des conducteurs de char qui avaient à l’époque une cer-taine notoriété. L. B.
Schlüsselwörter / Keywords / Mots clés
Römische Kaiserzeit / Spielzeug / Zirkus / WagenrennenRoman Principate / games / circus / chariot racesEpoque impériale romaine / jeu / cirque / courses de char
Constanze HöpkenUniversität zu KölnArchäologisches InstitutAlbertus-Magnus-Platz50923 Kö[email protected]
ISSN 0342-734X
Roel C. G. M. Lauwerier, Jos Deeben, Burnt animal remains from Federmesser sites in the Netherlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Krzysztof Kwiatkowski, Mirosław Masojć, Wandering throughout the late Pleistocene landscape – evidence for hunting activities of Federmesser groups from south western Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rudolf Echt, Michael Marx, Vincent Megaw, Wolf-Rüdiger Thiele, Luc Van Impe, Leo Verhart, An Iron Age gold torc from Heerlen (prov. Limburg/NL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Alfred Pichler, Paul Gleirscher, Zum Goldreichtum der »norischen Taurisker« – Lagerstätten versus antike Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Constanze Höpken, Ludi circensis auf dem Spielbrett: zu Spielsteinen und Spielbrettern eines römischen Zirkusspiels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Karlheinz Schaldach, Eine seltene Form antiker Sonnenuhren: der Meridian von Chios . . . . . . . . . . . 73
Kostas A. Damianidis, Roman ship graffiti in the Tower of the Winds in Athens . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Wouter K. Vos, Jaap Morel, Tom Hazenberg, The Woerden 7: an oar-powered Roman barge built in the Netherlands – details on the excavation at the Nieuwe Marktin Woerden (Hoochwoert) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Hans J. Holm, Archäoklimatologie des Holozäns – ein durchgreifender Vergleich der »Wuchshomogenität« mit der Sonnenaktivität und anderen Klimaanzeigern (»Proxies«) . . 119
Hans-Jörg Nüsse, Römischer Schadenzauber bei den Germanen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Stefan Eichert, Mathias Mehofer, Robert Baier, Archäologische und archäometallurgischeUntersuchungen an einer karolingerzeitlichen Flügellanzenspitze aus dem Längsee in Kärnten/Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
INHALTSVERZEICHNIS
Das Archäologische Korrespondenzblatt versteht sich als eine aktuelle wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der vor-und frühgeschichtlichen sowie provinzialrömischen Archäologie und ihrer Nachbarwissenschaften in Europa. Neben deraktuellen Forschungsdiskussion finden Neufunde und kurze Analysen von überregionalem Interesse hier ihren Platz.Der Umfang der Artikel beträgt bis zu 20 Druckseiten; fremdsprachige Beiträge werden ebenfalls angenommen.Unabhängige Redaktoren begutachten die eingereichten Artikel.
Kontakt für Autoren: [email protected]
Abonnement beginnend mit dem laufenden Jahrgang; der Lieferumfang umfasst 4 Hefte pro Jahr; ältere Jahrgängeauf Anfrage; Kündigungen zum Ende eines Jahrganges.
Kontakt in Abonnement- und Bestellangelegenheiten: [email protected]
Preis je Jahrgang (4 Hefte) für Direktbezieher 20,– € (16,– € bis 2007 soweit vorhanden) + Versandkosten (z.Z. Inland5,50 €, Ausland 12,70 €)
HIERMIT ABONNIERE ICH DAS ARCHÄOLOGISCHE KORRESPONDENZBLATT
Name, Vorname ________________________________________________________________________________________
Straße, Nr. ________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort ________________________________________________________________________________________
Sollte sich meine Adresse ändern, erlaube ich der Deutschen Bundespost, meine neue Adresse mitzuteilen.
Datum ______________________ Unterschrift _____________________________________________________
Ich wünsche folgende Zahlungsweise (bitte ankreuzen):
� Bequem und bargeldlos durch Bankabbuchung (innerhalb von Deutschland)
Konto-Nr. ________________________________________ BLZ __________________________________________
Geldinstitut ________________________________________________________________________________________
Datum _________________________ Unterschrift __________________________________________________
� Durch sofortige Überweisung nach Erhalt der Rechnung (Deutschland und andere Länder)Ausland: Nettopreis net price prix net 20,– €Versandkosten postage frais d’expédition 12,70 €Bankgebühren bank charges frais bancaires 7,70 €
Bei Verwendung von Euro-Standardüberweisungen mit IBAN- und BIC-Nummer entfallen unsere Bankgebühren (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55), ebenso wenn Sie von Ihrem Postgirokonto überweisen oder durch internationale Postanweisung zahlen.Das Römisch-Germanische Zentralmuseum ist nicht umsatzsteuerpflichtig und berechnet daher keine Mehrwertsteuer.
If you use the European standard money transfer with IBAN- and BIC-numbers there are no bank charges from our part (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55). This is also the case if you transfer the money from a Post office current account or with an international Post office money order.The Römisch-Germanische Zentralmuseum does not pay Sales Tax and therefore does not charge VAT (Value Added Tax).
L’utilisation de virement SWIFT avec le numéro IBAN et SWIFT supprime nos frais bancaires (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; SWIFT: MVBM DE 55); ils peuvent aussi être déduits en cas de réglement postal sur notre CCP (compte courant postal) ou par mandat postal international.Le Römisch-Germanische Zentralmuseum n’est pas imposable à la taxe sur le chiffre d’affaires et ne facture aucune TVA (taxe à la valeur ajoutée).
Senden Sie diese Abo-Bestellung bitte per Fax an: 0049 (0) 61 31 / 91 24-199
oder per Post an:
Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte,Archäologisches Korrespondenzblatt, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Deutschland
Römisch-GermanischesZentralmuseum
Forschungsinstitut fürVor- und Frühgeschichte
R G Z M
BESTELLUNG DES ARCHÄOLOGISCHEN KORRESPONDENZBLATTS
3/0
8
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Monographien des RGZM, Band 91508 S., 151 Taf.
ISBN 978-3-88467-162-7110,– €
Kai Michael Töpfer
Signa MilitariaDie römischen Feldzeichen in der Republik und im Prinzipat
Die römische Armee verfügte über ein komplexes Signalwesen, das akusti-sche und optische Hilfsmittel – Blasinstrument und Feldzeichen – für eineschnelle Übermittlung von Befehlen nutzte. Die hierbei verwendeten Stan-darten, die signa militaria, waren aber keine reinen Gebrauchsgegen-stände, sie waren gleichzeitig bedeutende Sinnbilder der römischen Heeres-macht und wichtige Identifikationssymbole für die unter ihnen zusammen-gefassten Soldaten. Den Verlust eines solchen Feldzeichens empfandennicht nur die Soldaten, sondern alle Römer als immense Schande. In dem vorliegenden Band werden die Standarten des römischen Heeresauf Grundlage einer umfangreichen und reich bebilderten Materialsamm-lung, die neben zahlreichen antiken Darstellungen auch Inschriften undFragmente originaler Feldzeichen umfasst, intensiv untersucht. Im Zentrumstehen dabei Fragen nach ihrem Aussehen, ihrer Verwendung sowie ihremreligiösen Status. Darüber hinaus werden die Standartenwiedergaben inder römischen Kunst auf ihre Detailtreue und ihre semantische Bedeutunghin befragt. Auf diese Weise entsteht ein vielschichtiges Gesamtbild derrömischen Feldzeichen, die nicht nur in den Augen der Soldaten mehr alssimple Orientierungshilfen auf dem Schlachtfeld waren.
Monographien des RGZM, Band 88zugleich Vulkanpark-Forsch. Band 8
453 S., 234 Abb., 21 Tab., 2 Farbtaf., 6 Beil.
ISBN 978-3-88467-144-352,– €
Angelika Hunold
Die Befestigung auf dem Katzenbergbei Mayen und die spätrömischenHöhenbefestigungen in NordgallienAuf dem Katzenberg bei Mayen bestand von etwa 300 n.Chr. bis in dieMitte des 5. Jahrhunderts zum Schutz des Wirtschaftszentrums Mayen einemilitärische Befestigung, die zu den größten ihrer Art gehört. Ausgehend von den dort gewonnenen Ergebnissen werden 143 weitereHöhenbefestigungen in Nordgallien untersucht. An Verkehrswegen orien-tiert, vor allem an den Wasserstraßen, besitzen diese Anlagen keineswegsden Charakter versteckter Refugien. Vielmehr können auch sie als Militär-anlagen eingestuft werden, die in ein übergreifendes Verteidigungskonzepteingebunden waren. Sie sicherten den Fortbestand des zivilen und wirt-schaftlichen Lebens im ländlichen Raum. Somit bilden Höhenbefestigungeneines der Elemente einer tief gestaffelten militärischen Sicherung in derSpätantike.
160 S., ca. 200 meist farbige Abb.ISBN 978-3-88467-163-4 (RGZM)
24,90 €
NEUERSCHEINUNG
Angelika Hunold
Das Erbe des VulkansEine Reise in die Erd- und Technikgeschichte zwischen Eifel und Rhein
Die Landschaft der Osteifel rund um den Laacher See wurde durch einen erdgeschichtlich jungen Vulkanismus geformt.Schlackenkegel, Lavaströme und der gewaltige Laacher See-Vulkan hinterließen wertvolle Rohstoffe, die der Menschseit Jahrtausenden zu nutzen weiß. So entstand eine Landschaft, in der Naturphänomene und Zeugnisse alter Industrieeine überraschende Einheit bilden.Die besonderen Eigenschaften dieser Landschaft werden heute im Vulkanpark Osteifel an Besucher vermittelt. Dankder Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Mayen-Koblenz und dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainzverschmelzen in diesem Projekt Vulkanologie, Archäologie und Technikgeschichte ebenso miteinander wie Wissen-schaft und Tourismus. Zentrale Themen sind einerseits die Entstehung der Vulkanlandschaft, andererseits das Wirkendes Menschen in ihr von den Anfängen des Industriereviers bis in die Gegenwart. Dabei wird stets deutlich, wie dienatürlichen Grundlagen Wirtschaft und Gesellschaft der Region geprägt haben. Vulkanaufschlüsse, Steinbrüche undBergwerke, aber auch andere archäologische Stätten und Bauwerke aus verschiedensten Epochen sind die Sehenswür-digkeiten des Vulkanparks. Im Jahr 1998 konnten die ersten Landschaftsdenkmäler der Öffentlichkeit übergebenwerden, mittlerweile sind es rund 20.Der Band bietet eine eingehende Beschreibung sämtlicher Denkmäler des Vulkanparks. Exkurse informieren über dievulkanischen Ausbruchsmechanismen sowie über die Grundbegriffe der Steingewinnung.
Verlag Schnell & Steiner GmbHLeibnizstraße 13 · 93055 Regensburg · Tel.: 09 41/ 7 87 85-0 · Fax: 09 41/ 7 87 85-16E-Mail: [email protected] · Internet: www.schnell-und-steiner.de
in Zusammenarbeit mit dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum, Mainz
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 6131/ 91 24-0 · Fax: 0 6131/ 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de
NEUERSCHEINUNGEN
Hajanalka Herold
Zillingtal (Burgenland)Die Awarenzeitliche Siedlung und die Keramikfundedes Gräberfeldes
Die Bearbeitung der frühmittelalterlichen Siedlung (7.-8. Jahrhundertn.Chr.) sowie der Keramikfunde des zugehörigen Gräberfeldes konzentriertsich auf drei Schwerpunkte: awarenzeitliche Siedlungsbefunde und Sied-lungsstrukturen im Karpatenbecken, Keramikproduktion und Keramik -gebrauch in der Awarenzeit sowie awarenzeitliche Traditionen in Zillingtalbei der Beigabe von Keramikgefäßen ins Grab.Bei den Siedlungsbefunden interessiert vor allem die frühmittelalterlicheWiederverwendung der römischen Ruinen. Die Auswertung des Fund -materials konzentriert sich auf die Keramikfunde, mit denen zusammenauch die Keramikgefäße des awarenzeitlichen Gräberfeldes untersuchtwerden. Dazu dienen archäologische und archäometrische Analysen sowieMethoden der experimentellen Archäologie. Die gewonnene Chronologieder Grabgefäße und die anthropologischen Daten der Bestatteten bildendie Basis für die Analyse der awarenzeitlichen Traditionen bei der Beigabevon Keramikgefäßen in die Gräber.
Monographien des RGZM, Band 92268 S. mit 270 meist farbigen Abb.ISBN 978-3-88467-172-6 (RGZM)
ca. 76,– €
Ljudmilla Pekarska
Jewellery of Princely KievThe Kiev Hoards in the British Museum and TheMetropolitan Museum of Art and Related Material
In the capital of Kievan Rus’, princely Kiev, almost 70 medieval hoards havebeen discovered to date. The hoards contained gold and silver jewellery ofthe ruling dynasty, nobility and the Christian Church. They were unique toKiev and their quantity and magnificence of style cannot be matched by any-thing found either in any other former city of Rus’, or in Byzantium. Most ofthe objects never had been published outside the former Soviet Union.During the 17th-20th centuries, many medieval hoards were gradually un -earthed; some disappeared soon after they were found. This book providesa complete picture of the three largest medieval hoards discovered in Kiev:in 1906, 1842 and 1824, and traces the history and whereabouts of otherlost treasures. Other treasures took pride of place in some of the world’stop museums.This publication highlights the splendid heritage of medieval Kievan jew-ellery. It illustrates not only the high level of art and jewellery craftsmanshipin the capital, but also the extraordinary religious, political, cultural andsocial development of Kievan Rus’, the largest and most powerful EastSlavic state in medieval Europe.
Monographien des RGZM, Band 80,1-22 Bände, zus. 438 S., 120 Abb.,
240 Farbtaf., 4 Beil.ISBN 978-3-88467-133-7
272,– €
NeuerscheinungenMonographien des RGZM
H. HeroldZillingtal (Burgenland) – Die AwarenzeitlicheSiedlung und die Keramikfunde des GräberfeldesBand 80, 1-2; 2 Bde., zus. 438 S. mit 120 Abb., 240 Farbtaf., 4 Beil.ISBN 978-3-88467-133-7 272,– €
A. I. Ajbabin u. Ė. A. ChajredinovaDas Gräberfeld beim Dorf Lucistoe –Band 1 – Ausgrabungen der Jahre 1977, 1982-1984Band 83 (2009); 152 S. mit 213 z.T. farbigen Taf.ISBN 978-3-88467-141-2 110,– €
F. MangartzDie byzantinische Steinsäge von Ephesos –Baubefund, Rekonstruktion, ArchitekturteileBand 86 (2010); 122 S. mit 104 Abb., 23 Farbtaf.ISBN 978-3-88467-149-8 39,– €
H. KrollTiere im Byzantinischen Reich – Archäo -zoologische Forschungen im ÜberblickBand 87 (2011); 210 S. mit 105 Ill. und 16 Farbtaf.ISBN 978-3-88467-150-4 55,– €
A. HunoldDie Befestigung auf dem Katzenberg bei Mayenund die spätrömischen Höhenbefestigungen in NordgallienBand 88 (2011); zugleich Vulkanpark-Forsch. Band 8453 S. mit 234 Abb., 21 Tab., 2 Farbtaf. und 6 Beil.ISBN 978-3-88467-144-3 52,– €
K. M. TöpferSigna Militaria – Die römischen Feldzeichen in der Republik und im PrinzipatBand 91 (2011); 498 S. mit 1 Abb, 151 Taf.ISBN 978-3-88467-162-7 (RGZM) 110,– €
RGZM – Tagungen
D. Gronenborn u. J. Petrasch (Hrsg.)Die Neolithisierung Mitteleuropas – The Spread of Neolithic to Central EuropeBand 4 (2011); 665 S. davon 158 Abb.ISBN 978-3-88467-159-7 78,– €
J. Drauschke u. D. Keller (Hrsg.)Glas in Byzanz – Produktion, Verwendung,AnalysenBand 8 (2010); 270 S. mit 200 Abb.,15 Farbtaf.ISBN 978-3-88467-147-4 44,– €
B. Zorn u. A. Hilgner (Hrsg.)Glas along the Silk Road from 200 BC to AD 1000Band 9 (2010); 250 S. mit 206 meist farbigen Abb.,16 Tab.ISBN 978-3-88467-148-1 44,– €
Mosaiksteine. Forschungen am RGZM
M. Schönfelder (Hrsg.)Kelten! Kelten? Keltische Spuren in ItalienBand 7 (2010); 64 S. mit 70 meist farbigen Abb. ISBN 978-3-88467-152-8 18,– €
Sonderdruck
A. MeesDer Sternenhimmel vom Magdalenenberg. Das Fürstengrab bei Villingen-Schwenningen –ein Kalenderwerk der Hallstattzeit47 S. mit 23 meist farbigen Abb., 1 Beil.Sonderdruck aus Jahrbuch des RGZM 54, 2007 4,– €
Ältere Publikationen sind in der Regel ebenfalls noch lieferbar. Unser komplettes Publikations -
verzeichnis finden Sie im Internet auf unserer Homepage (www.rgzm.de) oder können es beim
Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Forschungsinstitut für Vor- und Früh -geschichte, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Tel.: 06131/ 9124-0, Fax: 06131/ 9124-199, E-Mail: [email protected], kostenlos anfordern. Seinen Autoren gewährt der Verlag des RGZM einen
Rabatt von in der Regel 25% auf den Ladenpreis.