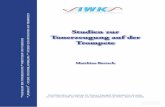Antonio Caldaras Kantatenschaffen zwischen römischen Conversazioni und dem Zeremoniell des Wiener...
-
Upload
uni-bayreuth -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Antonio Caldaras Kantatenschaffen zwischen römischen Conversazioni und dem Zeremoniell des Wiener...
117
Andrea Zedler (Graz)
ANTONIO CALDARAS KANTATENSCHAFFEN zwischen römischen Conversazioni und
dem Zeremoniell des Wiener Hofs1 Einen letzten Höhepunkt der Dienstzeit Antonio Caldaras als „Maestro di Cappella“2 im Hause des Principe Francesco Maria Ruspoli (1672–1731) stellte der Besuch des bayerischen Kurprinzen Karl Albrecht 1716 dar. Der nachmalige Kaiser Karl VII. befand sich gerade auf seiner Kavalierstour3 durch Italien, und ihm zu Ehren wurde am 26. April 1716 im Ruspolischen Palast ein „nobil trattenimento“4 abgehalten. Aus der Sicht des Romreisen-den und seiner Begleiter stach der Palast Ruspolis in der Via del Corso als „un des plus beaux qu’il y aye presentement a Rome“5 unter den Palazzi her-aus, und Karl Albrecht wurde abends
1 Die Autorin dankt Theophil Antonicek für wertvolle fachliche Hinweise sowie dem Öster-
reichischen Historischen Institut in Rom, insbesondere Richard Bösel und Ulrike Outschar, für die Ermöglichung des Forschungsaufenthaltes in den römischen Archiven.
2 Caldaras Titel – „Maestro di Cappella“ – erscheint 1710 offiziell in Verträgen des Hauses Ruspoli mit Musikern, vgl. Ursula Kirkendale, Antonio Caldara. Life and Venetian-Roman Oratorios. 2. durchgesehene und übersetzte Aufl. Florenz 2007, S. 56.
3 Kurprinz Karl Albrecht (1697–1745) befand sich vom 3. bis 29. April 1716 und vom 15. Mai bis 12. Juni 1716 in Rom. Die Tagebücher, die im Umfeld des Kurprinzen entstanden sind, enthalten u. a. detaillierte Angaben zur Papstaudienz, zu Besuchen beim römischen Adel und Klerus sowie zu den Sehenswürdigkeiten Roms, vgl. München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv [= BayHStA], Geheimes Hausarchiv [= GHA], Korrespondenzakt Nr. 718, siehe auch Abschrift in: München, Bayerische Staatsbibliothek [= BSB], Cgm 5016; München, Bayerisches Nationalmuseum [= BNM], Bibl. 2368; München, BSB, Cgm 6067. Die zuletzt genannte Handschrift entspricht dem jüngst wieder aufgefundenen Dia-riumsexemplar des Stiftsarchivs in Göttweig (Göttweig, Stiftsbibliothek, Handschrift 945 rot, 853 schwarz): teilweise abgedruckt bei: Wolfgang J. Bekh, Ein Wittelsbacher in Italien. Das unbekannte Tagebuch Kaiser Karls VII. München 1971; vgl. auch: Karl T. Heigel, Neu auf-gefundene Tagebücher Kaiser Karls VII., in: ders. (Hg.): Historische Vorträge und Studien 3. Mün-chen 1887, S. 105–127.
4 „Il sudetto Sig. Principe Elettorale, la sera [domenica] si portò nel Palazzo del Sig. Principe Ruspoli nobilmente addobato, da quale fù dato un nobil trattenimento, con una cantata delle sue Virtuose […].“ Gazzetta di Napoli (5. Mai 1716) Nr. 19, abgedruckt bei: Thomas E. Griffin, Musical References in the Gazzetta di Napoli 1681–1725. Berkeley 1993, S. 80, Ein-trag 355.
5 München, BNM, Bibl. 2368. Ruspoli hatte den Palazzo ein Jahr zuvor neu ausgestalten lassen, vgl. Geneviève Michel – Olivier Michel, La décoration du Palais Ruspoli en 1715 et la
118
„[...] aldorten von der Princessin, seiner [Ruspolis] gemahlin in dem ersten Vorzimmer empfangen, in die gallerie geführt, und in selbiger mit einer Zweystimmigen Cantata unterhalten [...]. Nach anhörung der Music wurd H: Graf v. Traußnitz6 durch die übrige häufig illuminierte Zimmer zu ei-nem Spiel geführt, und mit solchem die Gesellschaft beschlossen.“7
redécouverte de Monsù Francesco Borgognone, in: Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes 89/1 (1977) S. 265–340.
6 Kurprinz Karl Albrecht reiste incognito als Graf von Traußnitz durch Italien, vgl. Claus P. Hartmann, Karl Albrecht – Karl VII. Glücklicher Fürst. Unglücklicher Kaiser. Regensburg 1985, S. 30. Vgl. auch ders., Kurfürst Karl Albrecht und Italien. Seine Bildungsreise und Kavalierstour 1715–1716, in: Alois Schmid (Hg.), Von Bayern nach Italien. Transalpiner Transfer in der Frühen Neuzeit. München 2010, S. 259–276.
7 München, BayHStA, GHA, Korrespondenzakt Nr. 718, Eintrag vom 26. April 1716. Kirkendale zieht auf Basis einer Kopistenrechnung von Francesco Lanciani zwei Kantaten in Betracht, die anlässlich des Besuches von Karl Albrecht bei Ruspoli aufgeführt worden sein könnten: Chiuso è già Borea nevoso und Amor senza amore, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 103 f., 478 (Eintrag 231). Vgl. auch Thomas E. Griffin, The late baroque serenata in Rome and Naples. A documentary study with emphasis on Alessandro Scarlatti. Los Angeles: Diss. 1983, S. 675 und Michael Talbot – Colin Timms, Music and the Poetry of Antonio Ottoboni (1646–1720), in: Nino Pirrotta – Agostino Ziino (Hg.), Händel e gli Scarlatti a Roma. Atti del convegno internazionale di studi. Roma, 12–14 giugno 1985. Florenz 1987, S. 367–437, hier: S. 402. Für die erstgenannte Kantate wurde der Text von Antonio Ottoboni verfasst, vgl. Venedig, Museo Correr, Correr 467, 557–565. Der Komponist ist unbekannt, und bis dato konnte noch kein stichhaltiger Beleg für den Aufführungsort erbracht werden. Das Widmungs-exemplar der Kantate liegt unter der Signatur Mus. ms. 225 in der Staatsbibliothek Mün-chen und sieht eine große Besetzung von zwei Sopran-, einer Altstimme, drei 4-stimmigen Chören, Violinen, Viola, Flöten, Oboen, weiteren, nicht näher definierten Blasinstrumen-ten und Basso continuo vor. Diese Besetzung steht indes im Widerspruch zur Angabe „zweystimmig“ im Reisediarium Karl Albrechts. Zudem lassen sich weder in den Abrech-nungsbüchern der Casa Ruspoli Eintragungen zu dieser speziellen Kantatenkopie von Lanciani ausfindig machen, noch liegen detaillierte Abrechnungen von Musikern, die für eine Aufführung extra hätten engagiert werden müssen, vor. Die Chöre weisen nämlich ei-ne Besetzung auf, die nicht vom Hausensemble Ruspolis hätte realisiert werden können, vgl. Vatikan, Archivio Segreto Vaticano [= ASV], Tomo I, B 61, Fasc. 21, Fondo Ruspoli Marescotti, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1716. Auszüge aus den Haus-haltsbüchern der Jahre 1708–1716 sind abgedruckt bei: U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 478 (Eintrag 230). Auch die Kantate Amor senza amore ist für drei Solostimmen angelegt, so dass die Anzahl der Stimmen ebenso im Widerspruch zu der Angabe im Diarium steht und eine nähere Zuordnung einstweilen nicht ermöglicht. Eventuell wurde jene nicht wei-ter spezifizierte Kantate a 2 con VV [Violini] aufgeführt, die auf derselben Kopistenrech-nung wie Amor senza Amore aufgelistet ist, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 478 (Eintrag 231). Pipernos Datierung der Darbietung der Kantate Amor senza amore auf den 28. April und seine Zuordnung zum Besuch Karl Albrechts bei Ruspoli lässt sich auf Basis der Ta-gebücher nicht bestätigen, da der Kurprinz an diesem Tag nicht bei Ruspoli anzutreffen war, vgl. Franco Piperno, Su le sponde del Tebro. Eventi, Mecenati e istituzioni musicali a Roma ne-gli anni di Locatelli, in: Alberto Dunning (Hg.), Intorno a Locatelli. Lucca 1995, S. 793–877,
119
Es war das übliche Kartenspiel8, mit dem dieser Abend beschlossen wurde, der sich in die lange Reihe der sonntäglichen, vom römischen Adel und Kle-rus gerne besuchten Conversazioni bei Ruspoli einordnete. An Veranstaltun-gen dieser Art hing von März 1709 bis Mitte Mai 1716 Caldaras reichhaltige Kantatenproduktion.9 Überblickt man das musikalische Schaffen des venezi-anischen Komponisten, das sich auf Basis der Kopistenrechnungen, die an das Haus Ruspoli gestellt wurden, rekonstruieren lässt, so zeigt sich klar, dass neben neun Oratorien, vier Opern sowie vier Intermezzi, die über 200 Kan-taten mit unterschiedlicher Besetzung den Schwerpunkt seiner kompositori-schen Arbeit in Rom ausmachten.10 Als Caldara kurz nach Karl Albrechts Besuch bei Ruspoli gen Wien ab-reiste, trat er in die Dienste des Kaisers und somit in das soziokulturelle Um-feld des Wiener Hofes ein. Anstelle des von den römischen Conversazioni und kirchlichen Festen geprägten Kalenders waren es nun Zeremoniell und Pro-tokoll, welche sein Musikschaffen als Vizekapellmeister bestimmten. Infolge der kompositorischen Aufgabenverschiebung hin zu Sakral- und Theatral-musik standen Kantaten nicht mehr im Mittelpunkt seiner Arbeit. Gleich-wohl komponierte Caldara ab 1716 noch eine Reihe von Kantaten, deren genaue Untersuchung hinsichtlich musikalischer und thematischer Aspekte lohnt. Auf Basis einer Standortbestimmung jener Kantaten, die Caldara ei-nerseits für Ruspoli, andererseits für das kaiserliche Umfeld schuf, geht der vorliegende Beitrag der Frage nach, wie sich die Veränderung des soziokultu-rellen Kontextes auf seine diesbezüglichen Kompositionen auswirkte. Über
hier: S. 841. Im Gegensatz zu Kirkendale und Talbot – Timms ordnet Piperno die Kantate Chiuso è già Borea nevoso einer Darbietung im Palazzo Bolognetti am 25. Mai 1716 zu. Der Diariumseintrag von diesem Tag meldet: „Abendß ist für selbe [den Kurprinzen] von dem conte bologneti in seinem Pallast ein herrliches Fest mit prächtigen Confecturen in haufti-ger Gesellschaft […] und einer hierzu eigentlich componierten Cantata gehalten worden.“ Korrespondenzakt Nr. 718, München, BayHStA, GHA. Tatsächlich aber wurde die Canta-ta a tre [Il Genio della Baviera, La Gloria, La Fama] aufgeführt. Das gedruckte Libretto weist eine handschriftliche Datierung auf und bestätigt somit die Angaben im Tagebuch. Vgl. Vatikan, ASV, Fondo Bolognetti 260.
8 Ruspoli zahlte für „carte dà giocare nella Sera delli 26“ – Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo I, B 61, Fasc. 21 (April), Sp. 41, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1716.
9 Caldara wurde in den Rechnungsbüchern des Hauses Ruspoli seit Oktober 1708 geführt, aber erst seit 1. Juli 1709 mit regulärem Gehalt von 10 Scudi angestellt. Acht Monate nach seiner Anstellung wird dieses auf 20 Scudi verdoppelt, vgl. ibidem, Tomo II, A 46–1716 Tomo I, B 61, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1709.
10 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 105.
120
den phänomenologischen Zugriff hinaus werden erste Überlegungen zu den Gründen der Veränderungen im kompositorischen Schaffen vorgestellt.11
Kantatenkompositionen für Ruspoli im römischen Kontext Um die umfangreiche Kantatenproduktion für römische Adelige am Beginn des 18. Jahrhunderts zu verstehen12, ist es nötig, vorab die kulturelle Situati-on jener Jahre kurz zu skizzieren: Nachdem am 23. November 1700 Kardi-nal Giovanni Francesco Albani als Clemens XI. den Thron Petri bestiegen hatte, änderte sich die Haltung gegenüber dem von seinem Vorgänger festge-legten Opernverbot im Kirchenstaat nicht. Im Gegenteil: Für weitere neun Jahre waren Opernaufführungen verboten, sodass das musikalische Schaffen der in Rom ansässigen Komponisten maßgeblich beeinflusst wurde, bis das „Comedie-Fieber“ 1710 wieder voll ausbrach.13 Umso wichtiger war es für die Musikschaffenden, zum Ruhme ihrer Mäzene solche Musik zu schreiben, die in der gegebenen Situation en vogue und zugleich opportun erschien. Neben den römischen Kirchen waren vor allem die Häuser der Adeligen sowie die Akademien Orte der Musikpraxis, an denen die Musik im Allge-
11 Eine tiefgreifende Untersuchung, die das musikalische Material einbezieht, wird in Kürze
im Rahmen der Dissertation der Autorin vorgelegt werden. 12 Aus musikwissenschaftlicher Perspektive lag die Konzentration der Kantatenforschung bis
dato vor allem auf der Entwicklungsgeschichte der Gattung bzw. auf der Rekonstruktion einer chronologischen Ordnung der Werke ausgesuchter Komponisten. Einige dieser Ar-beiten griffen Kantaten ausgewählter Komponisten zur musik- oder textanalytischen Be-trachtung heraus. Eine übergreifende Darstellung bzw. weitgreifende Ausführungen, wel-che in Rom oder für Rom geschriebene Kantaten aus kulturhistorischer Perspektive dar-stellen und somit den Kontext beleuchten, in dem die Kantaten entstanden sind, sind noch immer ein Desiderat der Forschung. Wichtige diesbezügliche Forschungsergebnisse zu Händels römischen Kantaten legte jüngst Berthold Over vor. Vgl. Berthold Over, Zum so-zialen Kontext von Händels römischen Kantaten, in: Hans Joachim Marx – Michele Calella (Hg.), Händels Kirchenmusik und vokale Kammermusik (Das Händel-Handbuch 4). Laaber 2012, S. 325–343. Mit Blick auf die musikalischen Quellen zeigt Dubowy in seinem zu Scarlattis Kantaten erschienen Artikel drastisch Probleme der Kantatenforschung auf, die auch auf weitere Kantatenkomponisten zutreffen: Die Quantität der autograph bzw. in Abschriften erhaltenen Kantaten „can easily prove a deterrent to the modern scholar.“ Dubowy betont, dass vor allem hinsichtlich der detaillierten Quellenkritik noch Pionierarbeit geleistet werden müsse und „to connect his [Scarlatti’s] work with certain moments of his creative life and to look in particular at the changing poetics and aesthetics in the genre around 1700 as reflected in cantata poetry and music.“ Norbert Dubowy, ‚Al tavolino medesimo del Compositor della Musica‘. Notes on Text and Context in Alessandro Scarlatti’s cantate da camera, in: Michael Talbot (Hg.), Aspects of the Secular Cantata in Late Baroque Italy. Farnham 2009, S. 111–134, hier: S. 112.
13 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 61 f.
121
meinen und die weltliche Kantate im Rahmen der Conversazioni im Besonde-ren gefördert wurden. Eine der erfolgreichsten und heute noch bestehenden römischen Akade-mien, deren Mitglieder das Kantatengenre des 18. Jahrhunderts maßgeblich mitbestimmten, ist die 1690 gegründete Accademia dell’Arcadia. In ihren Grundsätzen hatten sich die Arkadier dem Diskurs über die italienische Dichtkunst und über neue wissenschaftliche Methoden verschrieben. Giovanni Mario Crescimbeni, Mitbegründer der Akademie und ihr langjähri-ger „Custode“, untermauerte den Erfolg der Arkadier in zahlreichen Werken und belegte dies auch mit Zahlen: In seinem 1712 erschienenen Werk Storia dell’Accademia degli Arcadi beschrieb er nicht allein die Genese der Akademie, er verwies zudem nachdrücklich auf die hohe Anzahl von 1300 „Pastori“, die im genannten Jahr als Mitglieder der Akademie verzeichnet waren.14 Die Arkadier, welche großen Einfluss auf das Kulturleben in Rom ausübten, blieben aber nicht auf die Stadt Rom beschränkt. Mit der Gründung von „Colonie“ verteilten sie sich über ganz Italien und nahmen auch künstleri-sche Schlüsselpositionen jenseits der Alpen15 ein. Minutiös listete Crescim-beni im genannten Werk diejenigen Mitglieder auf, die den römischen Arka-diern Orte für ihre Versammlungen zur Verfügung stellten und somit zu den Hauptgeldgebern der Akademie zählten. Ruspoli16, zeitgleich Widmungsträ-ger der genannten Storia, wurde darunter besonders hervorgehoben, da er nicht nur einer der maßgeblichen Förderer der Arkadier war, sondern ab 1712 auch den Bosco Parrasio 17 am Aventin mit einem eigens für die Ver-sammlungen erbauten Amphitheater zur Verfügung stellte.18 Den hohen
14 Vgl. Giovanni M. Crescimbeni, Storia dell’Accademia degli Arcadi istituita in Roma l’anno 1690.
Rom 1712, Reprint London 1805, S. 6. 15 Für den Wiener Hof wirkten als Textdichter für Caldaras Werke die Arkadier Apostolo
Zeno, Pietro Pariati, Francesco Claudio Pasquini und Pietro Metastasio. 16 Ruspoli wurde 1691 unter dem arkadischen Namen Olinto Arsenio in den Kreis der Arka-
dier aufgenommen. 17 Bosco Parrasio ist die arkadische Bezeichnung für den Versammlungsplatz der Mitglieder. 18 Die „poliza dell’affitto“, die Ruspoli mit den Brüdern Ginnasi abschloss, befindet sich in
den Haushaltsbüchern unter den Abrechnungen des Jahres 1712. Dort wurden Zweck und Zeitraum des Mietverhältnisses festgelegt: Ruspoli „prende d[ett].o luogo in locazione per fare cosa grata, con dare il commode de Recitamenti, all’Insigne Adunanza degl’Arcadi […]“ für neun Jahre „da cominciare il p[ri].mo maggio 1712“ – Vatikan, ASV, Fondo Rus-poli Marescotti, Tomo I, B 53, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1712. Vgl. auch G. Crescimbeni, siehe Anm. 14, S. 9 f. Zuvor hatten sich die Arkadier im Garten Ruspolis bei San Matteo in Merulana versammelt, vgl. Susan M. Dixon, Between the real and the ideal. The Accademia degli Arcadi and its garden in eighteenth-century Rome. Newark 2006, S. 61–63; vgl. auch: Saverio Franchi, Il principe Ruspoli. L’oratorio in Arcadia, in: ders. (Hg.), Percorsi dell’oratorio romano. Da „Historia Sacra“ a Melodramma Spirituale. Rom 2002, S. 245–316, hier: S. 265.
122
monetären Aufwand für die arkadische Akademie19 und das dauerhafte En-gagement als Musikmäzen konnte sich Ruspoli erst nach einem erfolgreich abgeschlossenen Gerichtsverfahren am 22. September 1705 leisten.20 Das Ruspolische Erbe war Ausgangspunkt für einen steilen politischen und sozia-len Aufstieg in der Ewigen Stadt: Navach vermutet wohl zu Recht, dass Ruspolis breit angelegte musikalische Initiativen „obviously part of a greater and more ambitious political pattern“21 gewesen seien und diese nicht zuletzt seine gesellschaftliche Stellung und seine politische Macht sicherten.22 Neben seinen Investitionen in die Kunst, trat er auch als Finanzier im Umkreis des Papstes auf – und dies mit Erfolg: Als sich Clemens XI. im Zuge des Spani-schen Erbfolgekrieges 1708 in Auseinandersetzung um die Herrschaft Comacchios mit Kaiser Joseph I. befand, kam es zum offenen Konflikt bei-der Parteien. Päpstliche Truppen, für die auch Ruspoli Soldaten bereitstellte, wurden zur Verteidigung der Stadt entsandt.23 Diese Unterstützung wurde
19 Neben Musik und den Versammlungsorten für die Arkadier finanzierte Ruspoli auch
Drucke arkadischer Poesie – beispielsweise wurde am 7. August 1711 der Drucker Antonio de Rossi bezahlt, „per haver stampato per suo conto una Raccolta di Poesie intitolata componimenti Poetici di diversi Pastori Arcadi dedicata all Eccmo Prpe di Cerveteri […].“ Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo I, A 51, Fasc. 99, August, Sp. 70, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1711.
20 Der Antritt des immensen Erbes, das ihm sein Onkel hinterlassen hatte, beinhaltete auch den Titel eines „Marchese“, vgl. Ursula Kirkendale, Händel bei Ruspoli. Neue Dokumente aus dem Archivio Segreto Vaticano, Dezember 1706 bis Dezember 1708, in: Händel-Jb. 50 (2004) S. 309–374, hier: S. 310. Vgl. auch: S. Franchi, siehe Anm. 18, S. 245–250.
21 Lisa Navach (Hg.), Francesco Gasparini: Cantatas with Violins, Part 1: Soprano Cantatas (Recent Researches in the music of the baroque era 162) Middleton 2010, S. IX.
22 Vgl. zu den Bestrebungen Ruspolis im Bereich der bildenden Künste: Maria C. Cola, Francesco Maria Ruspoli. Mecenate e collezionista (1672–1731), in: Franco Cazzola – Ranieri Va-rese (Hg.), Cultura nell’età delle Legazioni. Atti del Convegno Ferrara – marzo 2003 (Quaderni degli annali dell’Università di Ferrara. Sezione Storia 1) Florenz 2005, S. 507–535, hier: S. 507 f.: „Nella storia della famiglia e non solo sul piano della committenza e del mecena-tismo, Francesco Maria occupa un ruolo di particolare rilievo; si riconoscono nel giovane marchese infatti le intuizioni politiche e la decisa volontà di equiparare la propria casata al rango delle più antiche famiglie baronali romane e di portare a termine quel processo di as-similazione alla società romana ed ai suoi valori e di totale distacco dalle radici fiorentine che era stato perseguito dalla sua famiglia fin dalla metà del Cinquecento.“
23 Das Diario di Roma meldete am 8. Juli 1708: „Si è il marchese Ruspoli offerto a S. Beatitu-dine di fare a sue spese la leva d’un reggimento di cinquecento huomini con vestirli et ar-marli, domandando in grazia che il suo piccolo figliolo ne sia dichiarato colonnello: il chè stato accordato.“ Francesco Valesio, Diario di Roma, Libro settimo e libro ottavo [Bd. 4: 1708–1728] hg. von Gaetana Scano. Mailand 1978, S. 109. Vgl. auch: Ursula Kirkendale, The War of the Spanish Succession reflected in works of Antonio Caldara, in: AMl 36 (1964) S. 221–233, hier: S. 224; vgl. auch: Saverio Franchi, Possibile valenze storico-ideologiche dell’attività musicale romana durante il soggiorno die Händel (1706–1708), in: Sabine Ehrmann-Herfort – Matthias Schnettger (Hg.), Georg Friedrich Händel in Rom (Analecta Musicologica 44) Kassel etc. 2010, S. 109–122, hier: S. 117.
123
am 3. Februar 1709 von Seiten des Papstes mit dem Titel „Principe di Cerve-teri“ belohnt, so dass Ruspoli den „più grandi principi romani“24 gleichge-stellt wurde. Die Musik betreffend war Ruspolis Engagement eingebettet in ein breitge-fächertes – zum Teil konkurrierendes und zum Teil freundschaftlich25 ver-zahntes – Mäzenatensystem in Rom: Neben den schon erwähnten Ruspoli-schen Conversazioni, fanden in den Palazzi der Adelsfamilien wie der Colonna oder der Bolognetti musikalische Veranstaltungen statt, darunter allwöchent-lich abgehaltende Conversazioni im Hause Pamphilj (freitags) und Ottoboni (mittwochs), für die Kantaten komponiert wurden.26 Vor allem mit Kardinal Pietro Ottoboni, der regelmäßig in seinem Hause anzutreffen war, bestand eine besondere Verbindung.27 Ottoboni, der wie Uffenbach wohl überspitzt berichtet, „niehmahlen dergleichen [musikalische Vorführungen bei Ruspoli] versäumt“28, war nicht nur Akademiekollege bei den Arkadiern, sondern seit seiner Jugend mit Ruspoli auch auf dem Feld der Musik verbunden.29 Die musikalischen Ambitionen der beiden werden von den Protokollen und Schriften der arkadischen Akademie belegt: Immer wieder bedankte sich der Custode der Arkadier bei Crateo (Pietro Ottoboni)30 und Olinto (Francesco Maria Ruspoli) für spezielle Einladungen wie beispielsweise zu der von den beiden gemeinsam abgehaltenen Adunanza alla recita de drammi musicali und riet den Mitarkadiern, sich mit einem „Sonetto da stamparsi in forma nobile“
24 S. Franchi, siehe Anm. 18, S. 251. 25 U. a. wurden Musiker „verborgt“ wie beispielsweise Vittorio Chiccheri (Tenor), der „mu-
sico dell’ Em.° Cardinale Pamphilj“ war und neben Auftritten innerhalb von Oratorien und Commedie 1713 für eine Kantatendarbietung von Ruspoli bezahlt wurde, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 440. Diese Angabe erlaubt es, Pritchards Aussage „there are no Roman cantatas for tenor or bass“ zu revidieren. Brian W. Pritchard, Antonio Calda-ra. The Cantatas revisited, in: The musical Times 133 (1992) S. 510–513, hier: S. 510.
26 Vgl. Ursula Kirkendale, The Ruspoli Documents on Handel, in: JAMS 20 (1967) Nr. 2, S. 222–273, hier: S. 250.
27 Ottobonis Name taucht regelmäßig in den Abrechnungen für Kartenspiele bei Ruspolis Conversazioni auf, vgl. stellvertretend für weitere: „Agosto 1707, Nota delle Carti da Ombre per la Conversazione: 7. [Agosto] 2 mazzi Tremoglie [Joseph la Trémouille], 14. [Agosto] 1 mazzo Card[ina].le Ottoboni […]“, Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, A 44, Fasc. 88, August, Sp. 160, Filza delle Giustificationi del Libro Ma[st]ro di Roma dell’anno 1707.
28 Eberhard Preußner, Die musikalischen Reisen des Herrn von Uffenbach. Aus einem Reisetagebuch des Johann Friedrich A. von Uffenbach aus Frankfurt a. M. 1712–1716. Kassel etc. 1949, S. 78.
29 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 20, S. 350. 30 Ottoboni wurde 1695 unter dem arkadischen Namen „Crateo Ericinio“ bei den Arkadiern
aufgenommen, vgl. Anna Maria Giorgetti Vichi, Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon. Rom 1977, S. 66 f.
124
erkenntlich zu zeigen.31 Von Seiten der Arkadier wurden aber nicht nur So-nette geschrieben, diese lieferten auch musikdramatische Texte sowie solche für Kantaten, die bei Ruspoli aufgeführt wurden. Crescimbeni gibt auf Basis seiner Comentarii wertvolle Hinweise, wie die Kantate in den Augen der Akademie beurteilt wurde und welche Funktion sie einnehmen sollte:
„[…] Oltre alle feste, s’introdussero per la musica certe altre maniere di poesia, che comunemente oggimai si chiaman Cantate, le quali sono com-poste di versi e versetti rimati senza legge, con mescolamento d’arie, e ta-lora ad una voce, talora a più. Questa sorta di poesia è invenzione del se-colo decimosettimo […]“.32
Die Betonung auf „questa sorta di poesia“ zeigt klar, dass die Kantaten von den Arkadiern als literarische Gattung verstanden wurden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass als „compositor di cantate“ Dichternamen fallen und die von Crescimbeni genannten Komponisten wie Stradella oder Bononcini die Texte lediglich in Musik setzen müssten („messe in musi-ca“33). Auch gibt Crescimbeni in seinen Comentarii einen direkten Hinweis darauf, dass die Kantaten auf funktionaler Ebene eng an die Conversazione gebunden waren, denn sie wären „[…] il più bello e gentil divertimento che mai possa prendersi in qualunque onorata e nobile conversazione […]“.34 Die Textgrundlage der Kantaten stand vorrangig in der Tradition der bu-kolischen Poesie, welche von Theokrit und Vergil geprägt und von Sannaza-ro, Petrarca und Tasso weitergeführt worden war. „So ist ein bevorzugtes Thema für Eklogen und Kantaten der Arkadier das arkadische Hirtenleben, in dem Jugend, Liebe und Gesang dominieren.“35 Es sind „Human arche-types“, die in den Kantaten zum Zug kommen und diese
31 I-Ra, Atti Arcadia 2 1696–1712, Collegio al I. dopo il XX. di Posideone Cadente l’anno II.
dell’Olimpiade DCXII. Vgl. auch: S. Franchi, siehe Anm. 18, S. 264. Neben den größeren musikalischen Veranstaltungen für die Akademie finden sich in den Abrechnungsbüchern des Hauses Ruspoli immer wieder Einträge zu einzelnen Musikern, die „per l’arcadia“ spielten und von Ruspoli gesondert bezahlt wurden, vgl. die Abrechnung des Violinisten Carlo Alfonso Poli: Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo I, A 47, April, Sp. 43, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1709.
32 Giovanni M. Crescimbeni, Comentarii intorno all’istoria della poesia italiana. Bd. 2, London 1803 (reprint), S. 253 f.
33 Ibidem, S. 254. 34 Ibidem. 35 Sabine Ehrmann-Herfort, Mythos Arkadien. Die Accademia dell’Arcadia und ihr Einfluss auf
Händels Sujets in römischer Zeit, in: Händel-Jb. 54 (2008) S. 91–102, hier: S. 94.
125
„can be ascribed to two mirror relationships: a humble shepherd, with generous and sincere feelings, is repeatedly deceived and insulted by a mischievous and malicious nymph who eventually yields to him after a long (and cruel) courtship; and vice versa, an innocent shepherdess is abandoned by a cruel shepherd“.36
Überblickt man das Kantatenschaffen im Hause Ruspoli, so fällt ins Auge, dass viele der Kantatentexte diesem pastoralen Liebesdiskurs entspringen. Arkadische Gestalten wie Clori, Mirtillo sowie Tirsi treten – neben mytholo-gischen Figuren und antiken Gottheiten – in zahlreichen Kantaten Caldaras in den Vordergrund, um ihr Liebesleid vorzubringen. Genau diese Thematik wurde der Kantate später zum Vorwurf gemacht: So kommt Freitas zu dem Schluss, dass die Auseinandersetzung mit der Kantatendichtung des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts voller vorschneller Urteile gewesen sei.37 Prägend sei Ambros’ negative Einschätzung38 von 1878 gewesen, dessen Tenor sich noch in Roses Aussage – „again and again we are confronted with a cruel, heartless lady and her suffering, faithful lover“39 – spiegelt. Ak-tuelle Forschungsarbeiten, welche die Kantate in ihrer Funktion als adeligem Ausdrucksmedium untersuchen, versuchen erstmals ein großes Repertoire an Kantatentexten im aristokratischen Umfeld zu kontextualisieren und zu in-terpretieren und lassen neuartige Ergebnisse zur textlich-musikalischen Kommunikation erwarten.40
Charakter und Teilnehmer der Ruspolischen Conversazioni Die römischen Conversazioni, welche als „riunioni a carattere ricreativo“41 beschrieben werden können, hatten einen „prototipo del genere“42 zum
36 L. Navach, siehe Anm. 21, S. XI. 37 Vgl. Roger Freitas, Singing and playing: The Italian cantata and the rage for wit, in: ML 82 (2001)
S. 509–542, hier: S. 509. 38 Es seien „[…] herkömmliche Liebesjammer in Phrasen voll falschen tragischen Pathos’
oder in witzigen Concetti mit getreuer Wiederholung der in der italienischen Poesie seit Jahrhunderten stereotyp gewordenen Redensarten, ganz zierlich gereimt, ganz artig ausge-drückt, aber auch von unaussprechlicher Langweiligkeit.“ August W. Ambros, Geschichte der Musik. Bd. 4. Leipzig 1878, S. 189.
39 Gloria Rose, The Cantatas of Giacomo Carissimi, in: MQ 48 (1962) S. 206. 40 Vgl. das derzeit laufende Projekt Die Kantate als aristokratisches Ausdrucksmedium im Rom der
Händelzeit am Musikwissenschaftlichen Institut der Johannes Gutenberg-Universität Mainz: http://www.tag-der-forschung.uni-mainz.de/1076.php [Abrufdatum, 15.6.2011].
41 Franco Piperno, Francesco Gasparini „Virtuoso dell’eccellentissimo Sig. Principe Ruspoli“. Contributo alla biografia gaspariniana (1716–1718), in: Fabrizio Della Seta – Franco Piperno (Hg.),
126
Vorbild: es war die Conversazione der Königin Christina von Schweden. Ihre Conversazione wurde von einer ausgewählten, limitierten Anzahl an Personen besucht, welche
„nel campo delle scienze, delle arti, delle lettere recassero chiara fama o indubbia promessa di talento. […] Per questo carattere di selezione la conversazione di Cristina di Svezia segna un momento assai elevato nella cultura romana del Seicento.“43
Ruspolis regelmäßig sonntags stattfindenden Conversazioni unterschieden sich – wie noch zu zeigen sein wird – von dieser maßgeblich hinsichtlich der Anwesenden. Die Ausgaben in den Ruspolischen Haushaltsbüchern, welche die in der Regel verankerten Bestandteile einer Conversazione, also die Musik, die „Acque fatte“ (das sind Getränke für die Gäste der Conversazione) und das Kartenspiel verzeichnen, können über den gesamten Zeitraum von Caldaras Wirken bei Ruspoli nachvollzogen werden.44 Wie wichtig diese Aufzeich-nungen für die Datierung von musikalischen Darbietungen beziehungsweise für Musikalien sind, haben bereits Kirkendale für die Oratorien Caldaras und Piperno für Francesco Gasparinis musikalisches Wirken bei Ruspoli nachge-wiesen.45 Ab Oktober 1705 wurde von Ruspoli der Palazzo Bonelli an der Piazza de’ Santi Apostoli gemietet, der nach Umbauarbeiten nicht nur Platz für seinen großen Haushalt, dem circa achtzig Personen angehörten, sondern auch für zahlreiche Gäste bieten musste.46 Die Musik betreffend zählten zu dem Haushalt in der Zeit zwischen 1709 und 1716 einige Stammmusiker mit fixem Salär: Caldara als Kapellmeister, der neben der kompositorischen und aufführungspraktischen Arbeit auch Kopistenrechnungen überprüfen und Verträge mit Musikern abschließen musste. Daneben waren mit unterschied-licher Dauer als Sängerinnen Margarita Durastante, Caterina Petrolli, Orsola Sticotti, Anna Maria di Piedz und Agnesa Corsie angestellt. Als Instrumenta-listen ergänzten Carlo Alfonso Poli, Giuseppe Valentini, Pietro Castrucci sowie Silvestro Rotondi (Violine), Giuseppe Peroni (Violoncello), Bartolo-meo Cimapane (Kontrabass) und Stefano Giovanni Antonio Sicuro (Oboe)
Francesco Gasparini 1661–1727. Atti del primo convegno internazionale (Quaderni della Rivista italiana di musicologia 6) Florenz 1981, S. 191–214, hier: S. 201.
42 Lina Montalto, Un Mecenante in Roma barocca. Il Cardinale Benedetto Pamphilj (1653–1730). Florenz 1955, S. 149.
43 Ibidem, S. 148. 44 Vgl. Filza delle Giustificationi, siehe Anm. 9. 45 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2 und F. Piperno, siehe Anm. 41. 46 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 58.
127
über die Dienstzeit Caldaras verteilt den Bestand der Hausmusiker bei Rus-poli. Die Sängerinnen lösten sich hinsichtlich ihrer Anstellungen so ab, dass in der Regel zwei von ihnen aus dem Pool der fest Angestellten für die häus-lichen Darbietungen zur Verfügung standen.47 Daneben wurde eine Reihe von Musikern für spezielle Gelegenheiten gesondert herangezogen.48 Die Musik bei Ruspoli florierte, bis 1714 eine räumliche Veränderung an-stand. Dieser „Riposo“49 wurde durch den Umzug vom Palazzo Bonelli in den Palazzo am Corso verursacht. Am neuen Standort konnten von Piperno zwei Räumlichkeiten lokalisiert werden, in denen die Conversazioni stattfan-den: das Appartamento di cima und die Galleria. Eine Rechnung vom 24. De-zember 1717 belegt, dass vom Appartamento di cima u. a. sämtliche Stühle, das Cembalo und die Spieltische „per la conv[ersazion].e che si fece alla Galla-ria“50 getragen werden mussten. Einen Einblick in die Gallerie hat Uffenbach hinterlassen:
„[…] ein ungeheuer große und lang gallerie in dem es gleichwie in dem ganz hauß an unvergleichlichen gemälden und silber werk nicht fehlt, alles war aufs prächtigste illuminirt und zu beyden seiten der ganzen gallerie stühle vor die Zuhörer gesezet, oben aber der plaz für die musique frey gelassen, alwo eine große anzahl Virtuosen sich rangirten […]“.51
Wenn die Conversazioni „[…] assumevano un tono eccezionale dato il presti-gio degli ospiti che vi prendevano parte, esse con le relative esecuzioni musi-cali si svolgevano nella galleria […]“52. Dies bestätigt sich auch für die Conver-sazione, die für den eingangs erwähnten Kurprinzen Karl Albrecht abgehalten wurde. Neben den Reisetagebüchern, die im Umfeld des Wittelsbachers entstanden sind, enthalten weitere zeitgenössische Reisediarien Hinweise zu Kantaten, Teilnehmern und Umfeld der Conversazione bei Ruspoli. Extrahiert man die diesbezüglichen Informationen aus den Tagebüchern Uffenbachs, des Kurprinzen Karl Albrecht und des Prinzen Anton Ulrich von Sachsen-
47 Zu den genauen Anstellungsdaten vgl. ibidem, S. 437 f. 48 Eine Liste der gelegentlich bezahlten Musiker findet sich ibidem, S. 439–444. 49 Auf dem Motettendruck, den Caldara Ottoboni widmete, findet sich der Ausdruck „Ripo-
so“. Diese „Auszeit“ ermöglichte es Caldara, seine Motetten für den Druck vorzubereiten, vgl. Ursula Kirkendale, Antonio Caldara. Sein Leben und seine venezianisch-römischen Oratorien. Graz etc. 1966, S. 73.
50 „Lista pagata al appro [apresso] Facchini Li 24 Xm.re [Dezembre] 1717“, F. Piperno, siehe Anm. 41, S. 203.
51 E. Preußner, siehe Anm. 28, S. 77. 52 F. Piperno, siehe Anm. 41, S. 203.
128
Meiningen53 und korreliert sie mit den Abrechnungsbüchern, so ergibt sich folgendes Bild: Der Besuch der Conversazione war für Adelige möglich, ohne dass sie ein besonderes Zeremoniell einzuhalten hatten, weil Ruspoli „[…] jedem frembden ohne introduction erlaubt hinzukommen“.54 Dies erklärt auch, warum der „Mandatario“ Ascanio, der für offizielle Einladungsdienste herangezogen wurde, nur bei besonderen Gelegenheiten bezahlt wurde.55 Wie aus Anton Ulrichs Diarium hervorgeht, beschränkten sich die Teilneh-mer der Conversazioni nicht auf den römischen Adel und Klerus, sondern die Conversazioni waren auch Treffpunkt von reisenden und in Rom lebenden ausländischen Aristrokraten. Anton Ulrich, der laut seinen Aufzeichnungen mindestens sechs Mal an einer Conversazione im Palazzo Bonelli teilgenom-men hatte und dabei auf Georg Friedrich Händel traf, hielt bezüglich der Anwesenden fest, dass „[…] da Viel teütsche, und Englische und andere Cavallier […]“56 anwesend waren. Uffenbach fand für das Auditorium ähnli-che Worte: Bei dem „Sontagliche ordinaire concert [7. April 1715] […] [war] eine große anzahl standes persohnen, und frembde“57 zugegen. In der Be-richterstattung wurde immer Wert darauf gelegt, die anwesenden Kardinäle hervorzuheben. Zu diesen zählten, wie auch die Kartenspielabrechnungen in den Haushaltsbüchern mit großer Regelmäßigkeit bezeugen, die Kardinäle Pietro Ottoboni, Joseph la Trémouille und Francesco Del Giudice.58 Von diesen wurde dokumentiert, dass „sie in ihr Abeès Kleider daselbst, mit roth Callotiche und roth Strümp“59 erschienen. Eine bestimmte, zeremoniell fest-gelegte Sitzordnung der Teilnehmenden lässt sich nicht rekonstruieren, im Gegenteil: Von der Conversazione für Kurprinz Karl Albrecht wird berich-
53 Prinz Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen, der spätere Herzog von Sachsen-Meiningen,
brach 1705 zur Kavalierstour nach Italien auf und verzeichnete in seinem Tagebuch Hin-weise zu den musikalischen Darbietungen in Rom. Am 24. April 1707 besuchte Anton Ul-rich zum ersten Mal die Conversazione bei Ruspoli, vgl. Meiningen, Thüringisches Staatsar-chiv Meiningen, Geheimes Archiv [= ThStaMgn GA], Reisetagebuch Anton Ulrich 1705–1708, GA XV O 1. Vgl. auch: Rashid-S. Pegah, „anno 1707“. Neue Forschungsergebnisse zur Tä-tigkeit von G. F. Händel in Rom und Florenz, in: Mf 62 (2009) S. 2–13; Alfred Erck – Hannelo-re Schneider, Musiker und Monarchen in Meiningen 1680–1763. Meiningen 2006, S. 180–185.
54 E. Preußner, siehe Anm. 28, S. 77. Anton Ulrich vermerkt, dass er ohne „uns anzumel-de[n]“ der Conversazione beigewohnt habe. Meiningen, ThStaMgn GA XV O 1, 354r, in Auszügen abgedruckt bei: R. Pegah, siehe Anm. 53, S. 10.
55 Zu offiziellen Einladungen kam es selten, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 60. 56 Meiningen, ThStaMgn, GA XV O 1, 468r. In Auszügen abgedruckt bei: R. Pegah, siehe
Anm. 53, S. 11. 57 E. Preußner, siehe Anm. 28, S. 78. 58 Vgl. Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo II, A 46–8 Tomo I, B 61, Filze delle
Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1709–1716. 59 Meiningen, ThStaMgn, GA XV O 1, 354v. In Auszügen abgedruckt bei: R. Pegah, siehe
Anm. 53, S. 10.
129
tet, dass „zu anhörung der Music alles pesle mesle zu sitzen sich angestelt“60 hatte. Reverenz wurde den neuankommenden Kardinälen und Damen erwie-sen, „da jeder aufstund, nachmal aber auf seinen alten plaz sich wieder seze-te“61. Die Conversazioni waren von unterschiedlicher Dauer und konnten über mehrere Stunden hinweg durchaus bis nach Mitternacht anhalten.62 Zur Erfrischung der Gäste fehlten „herumgetragene rinfreschi, confecturen etc nicht“.63 Die bei Ruspoli zu Gehör gebrachte Musik war so glänzend, dass Uffen-bach sie als „die beste alhier“ 64 bezeichnete. Er wohnte ausschließlich größe-ren Aufführungen, nämlich Oratorien65, bei, die zeitweilig die „solita“ Conver-sazione mit Kantatendarbietung ersetzten. Auf Basis von Zahlungslisten für Musiker, die herangezogen werden mussten, um das Hausensemble zu er-gänzen, konnten die aufgeführten Oratorien von Kirkendale genauen Pro-ben- und Aufführungsdaten zugeordnet werden. Ungleich schwerer fällt die Zuordnung der Kantaten zu einer bestimmten Conversazione, da sie von Hausmusikern dargebracht wurden und daher keine detaillierten Aufzeich-nungen von Seiten des Mastro di Casa zu erbringen waren. Falls dennoch Musiker hinzugezogen wurden, fallen die Angaben sehr allgemein aus, wie an den Beispielen der Conversazioni „in occasione del ferragosto“66 1709 gezeigt werden kann: Die Abrechnung vom 31. Juli 1709 zählt die Sänger und In-strumentalisten auf, die für die „cantate“ und „prove“ bezahlt wurden: Checchino de Grandis (Sopran), der zusätzlich zu seiner Bezahlung ein Ge-schenk bekam „per haver cantato varie volte alle conversatione“, Pasqualino (Alt) für zwei Kantaten und eine Probe, D. Giulio (Bass) für eine Kantate und eine Probe sowie die Violinisten Carlo Guerra, Bartolomeo de Monti, Straccioncino und Alfonso für jeweils eine Kantate mit Probe. Hinzu kam noch D. Andrea Caldara (Kontrabass). Eine genaue Zuordnung der Kanta-ten zu einzelnen Conversazioni erlauben die Abrechnungsbücher nicht; gleichwohl sind auf Grundlage der Quellen Aussagen über die abgehaltenen Conversazioni und die dafür geschaffenen Kantaten möglich.
60 München, BayHStA, GHA, Korrespondenzakt Nr. 718, Eintrag vom 26. April 1716. 61 E. Preußner, siehe Anm. 28, S. 77. 62 Vgl. ibidem, S. 77; vgl. auch: Meiningen, ThStaMgn, GA XV O 1, 354v, 451v und 468r; in
Auszügen abgedruckt bei: R. Pegah, siehe Anm. 53, S. 10 f. 63 E. Preußner, siehe Anm. 28, S. 77. 64 Ibidem. 65 Uffenbach hörte die Oratorien Abisai, Jefte, La conversione di Clodoveo re di Francia und La
ribellione di Assalonne von Caldara, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 91. 66 Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo I, A 47, Juli, Sp. 62, Filza delle Giustificatio-
ni del Libro Mastro di Roma 1709, abgedruckt bei: U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 449 (Ein-trag 23).
130
Kantaten für die Conversazioni
Kirkendale geht davon aus, dass pro Jahr circa 52 Kantaten zur Verfügung stehen, für die Conversazioni aber nicht immer neue Kompositionen geliefert werden mussten; einige Kantaten würden wiederholt bzw. in einer transpo-nierten Version wiederaufgeführt.67 Setzt man diese Annahme in Beziehung mit den detaillierten Abrechnungen in den Haushaltsbüchern, ergibt sich ein klareres Bild: Auf Basis der Abrechnungen des Bottiglieros für Getränke, von Musikern, die hinzugezogen wurden und der Abrechnungen zu den Kartenspielen, welche die Datumsangaben der Conversazioni gesondert aus-weisen, konnten während der Dienstzeit Caldaras (März 1709 bis Mai 1716) 240 Conversazioni identifiziert werden, deren chronologische Aufteilung sich wie folgt darstellt:
(ab März) 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 (bis Mai) 1716
35 30 37 41 37 23 30 7
Die Conversazioni liefen das ganze Jahr hindurch, wurden aber durch Villeggi-ature (längere Aufenthalte Ruspolis außerhalb der Stadt) und Theatervorstel-lungen außerhalb des Ruspolischen Hauses unterbrochen. Die von Ruspoli besuchten Theatervorführungen – in der Regel Comedie – fanden in den Mo-naten Januar und Februar zur Karnevalszeit statt und können zum Teil eben-so auf der Grundlage von Abrechnungen des Bottiglieros nachgewiesen werden, beispielsweise bezahlte Ruspoli Giovanni Battista della Vetra für „Acque fresche“ am 15., 21., 22. und 31. Januar 1714 „per la comedia“.68 Angaben zu Conversazioni entfallen – anders als sonst üblich – in diesen Zeit-räumen, so dass davon auszugehen ist, dass keine stattfanden. Besonders augenfällig sind die Jahre 1714 und 1716: Das erste Halbjahr 1714 war – wie schon erwähnt – vom Umzug in den Palazzo am Corso ge-prägt. Dies zeigt sich auch an der gesunkenen Conversazioni-Anzahl: Ruspoli ließ keine Oratorien aufführen und es lassen sich lediglich drei Conversazioni (7. Januar, 8. und 15. April) ausmachen, bevor sie am 1. Juli wieder regelmä-ßig aufgenommen wurden. Der quantitative Tiefstand des Jahres 1716 sticht insofern heraus, als Caldara nach der Comedien- und Oratoriensaison nach
67 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 61. 68 Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo I, B 57, Fasc. 2 (Januar), Sp. 74, Filza delle
Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1714. Zu den musikalischen Darbietungen vgl. die Ausführungen von U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 89.
131
Wien abreiste und von seinem Nachfolger Francesco Gasparini erst im Juli Kantaten für Conversazioni nachweisbar sind.69 In dem knapp siebenjährigen Zeitraum (1709–1716) wurden dem Hause Ruspoli von den Musikkopisten Francesco und Tarquinio Lanciani 274 Kan-tatenkopien70, die auf Basis der derzeitigen Quellenlage Caldara zugeschrie-ben und datiert werden können, in Rechnung gestellt. Vergleicht man diese Zahl mit den datierbaren Conversazioni, so ist ersichtlich, dass das kopierte Kantatenrepertoire den Bedarf passend deckte. Von den 274 Kopien können auf Grundlage der in den Rechnungen enthaltenen Textinzipits71 193 unter-schiedliche Kantaten ausgemacht werden. Die Differenz zur Gesamtanzahl der Kopien erklärt sich daraus, dass einige Kantaten wie beispielsweise Rispo-san già mehrere Male (bis zu vier Mal) kopiert wurden. Von diesem reichhal-tigen Kantatenrepertoire konnte der Quellenstandort von 75 Kantaten iden-tifiziert werden:72 Der Großteil der Manuskripte für Ruspoli ist über den Musiksammler Fortunato Santini im 19. Jahrhundert an die Diözesanbiblio-thek Münster gekommen. Neben der Diözesanbibliothek sind es das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien und das Civico Museo bibliografico musica-le in Bologna, welche größere Bestände an Kantaten enthalten, die aber nicht zu den von Lanciani kopierten Beständen gezählt werden können, da sie autographes Material enthalten.73 Die personellen Voraussetzungen bei Ruspoli erlaubten es Caldara, nicht nur die zeitgenössisch sehr gebräuchliche Besetzung der Kantate mit einer Stimme und Basso Continuo zu wählen, sondern auch eine große Anzahl an Kantaten mit obligaten Instrumenten bzw. Duettkantaten für die sonntägli-chen Conversazioni zu komponieren. Die Werke mit obligaten Instrumenten sind als Kantaten „con stromenti“ mit Violinen gestaltet worden. Selten ergänzen Oboen das Klangspektrum. Unter den (in der Regel anonymen)
69 Dies belegt eine Abrechnung von Francesco Lanciani: „A di 5 Luglio 1716. Copie scritte
per la Prima Accademia sotto la direttione del Sig.re Fran:co Gasparini“, vgl. Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo 1, B 61, Juli, Sp. 17, Fasc. 32, Filza delle Giustificati-oni del Libro Mastro di Roma 1716, abgedruckt bei: F. Piperno, siehe Anm. 41, S. 191.
70 Bis heute steht ein kritisches Werkverzeichnis für Caldara aus, daher kann über die genaue Anzahl der Kantaten Caldaras lediglich spekuliert werden. Warren Kirkendale erstellte in der revidierten und übersetzten Fassung von Ursula Kirkendales Band zu Caldaras venezi-anisch-römischen Oratorien erstmals eine Aufstellung der Kantatenkopien für Ruspoli, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 105.
71 Vgl. Vatikan, ASV, Fondo Ruspoli Marescotti, Tomo II, A 46–1716 Tomo I, B 61, Filza delle Giustificationi del Libro Mastro di Roma 1709.
72 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 445–478. 73 Im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde befinden sich acht und im Civico Museo neun
autographe Kantaten, die von den Kopisten für Ruspoli während Caldaras Dienstzeit ko-piert wurden, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 445–478.
132
Textdichtern jener für Ruspoli vertonten Kantaten wirkten drei Arkadier: Texte von Antonio Ottoboni, Jacopo Buonaccorsi, Ignazio de Bonis und Paolo Rolli konnten bereits nachgewiesen werden.74
Kantaten für den Kaiserhof und dessen Umfeld Als Caldara im Juli 1716 in Wien eintraf, war die Stadt für den neu installier-ten Vizekapellmeister kein gänzliches Neuland mehr: Bereits 171275 hatte er sich längere Zeit in der Residenzstadt Kaiser Karls VI. befunden, um diesem in der Hoffnung auf den Kapellmeisterposten seine Dienste anzubieten. Caldaras Erwartungen hatten sich aber nur bedingt erfüllt: Nicht er, sondern Johann-Joseph Fux war Marc Antonio Ziani auf dem Posten des Hofkapell-meisters nachgefolgt. Vergleicht man aber das kompositorische Schaffen Fux’ und Caldaras, so war Caldara „the court composer par excellence, Fux the prudent administrator“.76 Dies zeigt sich beispielsweise anhand der dramati-schen Kompositionen, für die Caldara über fünfzig Werke komponierte, Fux im selben Zeitraum lediglich neun. Anstelle des von den römischen Conver-sazioni und kirchlichen Festen geprägten Kalenders waren es nun Zeremoni-ell und Protokoll, welche Caldaras Musikschaffen als neu bestallter Vizeka-pellmeister bestimmten. Infolge der kompositorischen Aufgabenverschie-bung hin zu Sakralmusik und Oper standen Kantaten nicht mehr im Mittel-punkt seines Schaffens. Ab 1716 komponierte Caldara trotz des veränderten Aufgabenprofils eine Reihe von Kantaten, deren Funktion innerhalb des Zeremoniells in der Folge nachgegangen wird.
Kantaten im Kontext des Zeremoniells am Wiener Hof Aufgabe der kaiserlichen Hofkapelle war es, Dienste für die Kirchen-, Thea-ter- und Kammermusik zu versehen. Rahmen des musikalischen Wirkens
74 Antonio Ottoboni lieferte die Texte für Invida di mia pace, Elpino innamorato, Apelle, Campas-
pe, Va mormorando, O de verd’anni miei, Spiegate pur spiegate und Arbitro di me stesso. Von Jacopo Buonaccorsi stammt die Textgrundlage zur Serenata Chi s’arma di virtù vince ogni affetto; von Paolo Rolli stammen Alme voi che provaste und Dunque Giasone ingrato, vgl. U. Kirkendale, sie-he Anm. 2, S. 445–478. Auch die Kantate Bireno il di s’appressa ist Rolli zuzuordnen, vgl. Paolo Rolli, Rime di Paolo Rolli. Verona 1728, S. 230–233.
75 Zum Ablauf des Aufenthaltes vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 82–84. 76 Ibidem, S. 109.
133
„[…] war ein Zeremoniell, dessen primäre Aufgabe die panegyrische Ver-herrlichung, wenn nicht sogar Divinisierung des Herrschers war, der – im Verständnis der Zeit – als gesalbter König bzw. Kaiser eine Stellung zwi-schen Gott und den Menschen innehatte. […] Das Hofcurriculum um-fasste einerseits einen Kalender jährlich wiederkehrender Anlässe (Ge-burts- und Namenstage, Gedenktage) bzw. von aus anderen Gründen feststehenden Feierlichkeiten und zeremoniellen Handlungen (wie z. B. den gesamten liturgischen Jahreskalender, aber auch die Toison-Feste), andererseits ‚spontane‘ (d. h. kurzfristig angesetzte) Anlässe wie Hochzei-ten, Besuche anderer Potentaten, (neue) militärische Ereignisse, Todesfälle etc.“77
Hofmusiker waren in eine strenge Hierarchie eingebettet, deren Normen das Verhalten am Hof reglementierten und den jeweiligen Verhaltenskodex in-nerhalb des Aufgabengebiets im öffentlich-zeremoniellen bzw. im nicht-öffentlichen Bereich vorgaben. Auf Repertoireebene fielen unter die zu komponierende und aufzufüh-rende „Theatralmusik“ große Faschingsopern, Dramme per musica bzw. Com-ponimenti da camera anlässlich von Geburts- und Namenstagen der kaiserlichen Familie. Der Anlass bestimmte den Aufwand, so wurden zu herausragenden Ereignissen wie z. B. Hochzeiten ressourcenintensive „Feste teatrali“ aufge-führt. Die kirchenmusikalischen Funktionen waren „die höchste und eigent-liche Bestimmung und Pflicht der Hofmusik“.78 Sie lassen sich auf Basis der Gottesdienstordnung und Kilian Reinhardts Rubriche Generali rekonstruieren, die bereits Riedel in seinem grundlegenden Band zur Kirchenmusik am Hofe Karls VI. ausgewertet hat und die Musik u. a. für Liturgie, Oratorien und Prozessionen umfassen.79 Vokale Kammermusik wie Kantaten konnte einerseits wie größere theat-ralische Werke die Feierlichkeiten zu Geburts- und Namenstagen umrah-men, wurde andererseits jedoch auch im nicht-öffentlichen Bereich herange-zogen. Für letzteren können zwei Orte der Kantatendarbietung ausgemacht
77 Elisabeth Th. Fritz, Musik und Hofmusikkapelle im Zeremoniell der Habsburger-Höfe des frühen 18.
Jahrhunderts, in: Thomas Hochradner – Susanne Janes (Hg.), Fux-Forschung. Standpunkte und Perspektiven. Tutzing 2008, S. 1–10, hier: S. 1–5.
78 Theophil Antonicek: 1711–1740: „Constantia et fortitudine“. Höhenflug von Kunst und Wissen-schaft unter Karl VI., in: Günter Brosche et al. (Hg.), Musica Imperialis. 500 Jahre Hofmusikka-pelle in Wien 1498–1998. Katalog der Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbiblio-thek, 11.5.–10.11.1998. Tutzing 1998, S. 91–98, hier: S. 95.
79 Vgl. Friedrich W. Riedel, Kirchenmusik am Hofe Karls VI. (1711–1740). Untersuchung zum Verhältnis von Zeremoniell und musikalischem Stil im Barockzeitalter (Studien zur Landes- und Sozialgeschichte der Musik 1) München etc. 1977, S. 18–31.
134
werden: Erstens konnten Mitglieder der Hofkapelle zur musikalischen Um-rahmung der Tafel herangezogen werden,
„wenn er [der Kaiser] allein oder mit seinen engsten Angehörigen speiste, wobei andere hochgestellte Persönlichkeiten wie der päpstliche Nuntius, der venezianische Botschafter oder vornehme auswärtige Gäste ihre ‚Aufwartung‘ machen konnten“.80
Zweitens spielte sich ein großer Teil der Kammermusik im Bereich der Reti-rada, in den Räumen der kaiserlichen Privatgemächer, ab. Genau dies stellt den Forschenden vor quellentechnische Schwierigkeiten, auf die bereits Antonicek im Allgemeinen81 und Bennett82 im Speziellen für die Kantaten vor Caldaras Wirken am Wiener Hof hingewiesen haben. Die Quellenproblematik ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass sich ledig-lich sporadische Aufzeichnungen zur Darbietung von Kantaten in den rele-vanten Protokollen (Zeremonialprotokolle), Kalendern (Hofkalender), Zei-tungsberichten (Wienerisches Diarium, Corriere ordinario) und Briefen finden.83 Ein weiterer Ort, an dem es Kantatendarbietungen gegeben hatte – die Acca-demia – lässt sich während der Regierungszeit Karls VI. nicht mehr nachwei-sen. Sie wurde von Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Bruder Kaiser Ferdi-nands III., 1656 ins Leben gerufen, erreichte ihren Höhepunkt unter der Kaiserinwitwe Eleonora und wurde bis in die Regierungszeit Josephs I. fort-geführt. Aber:
„Diese Akademien hatten nicht dieselbe Bedeutung für das künstlerische und wissenschaftliche Leben wie die in Italien; sie dienten eher der priva-ten Unterhaltung der kaiserlichen Familie und des Hofadels. Es gab im-
80 Friedrich W. Riedel, Musikpflege am kaiserlichen Hof in Wien von 1716 bis 1719, in: Günter
Gattermann (Hg.), Zelenka-Studien II (Deutsche Musik im Osten 12) Sankt Augustin 1997, S. 453–469, hier: S. 457.
81 „Am Kaiserhof spielte sich der Hauptanteil allerdings tatsächlich in der ‚Kammer‘ […] ab, was zur Folge hat, daß wir nur wenige Quellen darüber besitzen: selbst von den Werken dürfte nur ein Bruchteil erhalten sein. Gelegentliche Nachrichten, etwa in brieflichen Mit-teilungen der Herrscherfamilie, lassen jedoch mit Sicherheit vermuten, daß Musizieren im kleinen Rahmen und unter starker eigener Betätigung des Kaisers und seiner Umgebung besonders für Karl VI. eine große Rolle spielte.“ T. Antonicek, siehe Anm. 79, S. 98.
82 „Only fragmentary information about the occasions for which cantatas were commis-sioned during the period c. 1700–c. 1711 has come to light.“ Lawrence E. Bennett, The Ital-ian Cantata in Vienna. C. 1700–C. 1711. New York: Diss. 1980, S. 101.
83 Eine systematische Auswertung wird im Rahmen der Dissertation der Autorin vorgelegt werden.
135
mer nur wenige Sitzungen im Jahr, und ihr Leben läßt sich nur in eher zu-fälligen Spuren verfolgen.“84
Unter Joseph I. lassen sich beispielsweise Kantatenkompositionen für zwei Sitzungen der Accademia aus dem Jahr 1706 von Marc’ Antonio Ziani bele-gen.85 Unter Karl VI. wurde der Plan zur Begründung einer öffentlichen literarischen Akademie – so bezeugen es Briefe von Apostolo Zeno – zwar aufgegriffen, aber nie verwirklicht.86 Weitere wichtige Schlüsse zum Darbietungskontext von Kantaten lassen sich anhand der überlieferten Musikalien rekonstruieren. Dies soll in der Folge anhand von Teilen des Kantatenrepertoires, welches seit dem Dienst-eintritt Caldaras am Wiener Hof komponiert wurde, gezeigt werden.
Das Wiener Kantatenrepertoire und seine Quellen Herausragende Quellen zur Rekonstruktion des Kantatenrepertoires Calda-ras in der Zeit als Vizekapellmeister stellen unterschiedliche Inventarien und Verzeichnisse dar. Dies hat mehrere Gründe, zu deren wichtigen jener zählt, dass sich keine Aufzeichnungen von Caldaras Hand über seine Musikalien erhalten haben bzw. diese bis dato nicht aufgefunden wurden. Besonders bedauerlich in diesem Zusammenhang ist, dass ein Inventar seiner Besitztü-mer (Oberstmarschallamt, Abhandlungen, Nr. 4339) seit 1923 als verschollen gilt.87 Zudem besteht kein zeitgenössisches Inventar, welches die gesamten Bestände der Musikalien für den Kaiserhof Karls VI. verzeichnet. Kataloge jener Jahre wie der Catalogo delle compositioni musicali für Karl VI. stellen eine wichtige Quelle dar, benennen aber nur in seltenen Fällen die einzelnen Kan-taten mit genauem Titel.88 Verzeichnisse, die aus musikgeschichtlicher Per-
84 Herbert Seifert, Akademien am Wiener Kaiserhof der Barockzeit, in: Wolf Frobenius – Nicole
Schwindt-Gross – Thomas Sick (Hg.), Akademie und Musik. Erscheinungsweisen und Wirkungen des Akademiegedankens in Kultur- und Musikgeschichte, Festschrift für Werner Braun (Saarbrü-cker Studien zur Musikwissenschaft 7) Saarbrücken 1993, S. 215–222, hier: S. 221.
85 Vgl. L. Bennett, siehe Anm. 82, S. 101. 86 Vgl. H. Seifert, siehe Anm. 84, S. 221. 87 Vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 120. 88 Vgl. Catalogo delle Compositioni Musicali. Continente, Oratori Sacri, Componimenti da Camera,
Serenate, et Opere. Composte, e rappresentate sotto il Gloriosissimo Governo della S[acr]:a. Ces[are]:a e Real Catt[oli]:ca M[ae]:stà di Carlo VI. Imperadore de Romani sempre Augusto. dall A[nn]:o 1712. Con un’Appendice in fine d’alcune Compositioni rappresentate in Tempo, che regnarono gl’Aug[ustissi]:mi Imp[erato]:ri Leopoldo, e Giuseppe I:mi di sempre gloriosa Memoria: consistente di Sepolcri, Oratori Sacri, Componimenti da Camera et Opere. Compresovi le altre simili Composizioni Mu-sicali dedicate humilissimamente alla stessa Ces[are]:a e Real Cattolica Maestà di Carlo VI. Da diversi Autori, A-Wn Mus. Hs. 2.452, Inv. I Karl VI. 1.
136
spektive entstanden sind, wurden erst im Laufe des 19. Jahrhunderts erstellt. Sie erlauben einen Überblick über das zu diesem Zeitpunkt in Wiener Archi-ven bzw. Sammlungen liegende musikalische Material Caldaras, sind aber mit allen quellengeschichtlichen Problemen posteriori entstandener Verzeichnis-se behaftet. Um valide Aussagen über das Gesamtrepertoire von Caldaras Kantatenschaffen als Vizekapellmeister treffen zu können, ist es in einem ersten Schritt nötig, sich einen Überblick über die diesbezüglichen quantitati-ven Dimensionen zu verschaffen. Grundlage hierfür sind die bisher bekann-ten, aber noch nicht ausgewerteten Verzeichnisse.89 Eine erste hier vorzustellende Hypothese fußt auf dem Verzeichnis Simon von Molitors, das sich in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibli-othek befindet.90 Molitor fasste die Werke unter den Hauptbegriffen „Drama-tische Werke“ bzw. „Dramatische Musik“, „Kammer- und Festmusiken, Serenaden und Cantaten für mehrere Stimmen und Orchester“ zusammen und listet darunter 128 Kompositionen auf. Das Verzeichnis wurde auf Basis der Musikalien in der Hofbibliothek (heute Musiksammlung der Österreichi-schen Nationalbibliothek) bzw. im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde erstellt, wobei Molitor auch Angaben Allaccis91 berücksichtigte92 und sich mit Raphael Georg Kiesewetter93 austauschte. Alle 85 Werke, die Molitor als Autographe verzeichnet, wurden von ihm dem Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde zugeordnet. Eine erste Überprüfung ergab, dass sich einige die-ser autographen Werke nicht mehr am ursprünglichen Aufbewahrungsort befinden, wie beispielsweise die Kantate Vingannasce ò pensieri, welche über Aloys Fuchs in das Stiftsarchiv Göttweig kam.94 Molitor übernahm für sein Verzeichnis nicht allein den Titel des Werkes, sondern auch wichtige Anga-ben zur Besetzung, zu den Tonarten, und er fügte – sofern am musikalischen Material vermerkt – Daten zu Kompositions- bzw. Darbietungszweck, zum Entstehungsdatum sowie -ort und zu den Textdichtern hinzu. Entstehungs-zeitpunkt und -ort zeigen, dass einige Kantaten, welche zum Zeitpunkt der Entstehung von Molitors Verzeichnis in Wien lagen, noch aus Caldaras rö-
89 Dazu zählen insbesondere Verzeichnisse von Simon von Molitor und Aloys Fuchs. 90 Vgl. A-Wn, Mus.Hs. 19.239 XII, fol. 31v–36r. Die weitgreifende systematische Auswer-
tung aller bestehenden Verzeichnisse, welche die lexikalischen einschließt, wird alsbald im Rahmen der Dissertation vorgelegt werden.
91 Vgl. Lione Allacci, Drammaturgia di Lione Allacci. Venedig 1775. 92 Beispielsweise gibt Molitor bei Il Giubilo della Salza an: „Nach Allacci hier nicht vorhan-
den“, A-Wn, Mus.Hs. 19.239 XII, fol. 31v. 93 Vgl. A-Wn, Mus.Hs. 19.239 XII, fol. 54r. 94 Vgl. A-Gö, Mus.Ms. 4.029. Vgl. auch die Auflistung bei Richard Schaal, Aloys Fuchs als
Autographen-Vermittler. Zum Repertoire der von Fuchs vermittelten und begutachteten Manuskripte, in: Mozart-Jb. 1976/77 (1978), S. 225–264, hier: S. 235. Für wertvolle Hinweise zu dieser Kan-tate sei Friedrich W. Riedel gedankt.
137
mischer Zeit stammten (Molitor gibt an, dass 13 Kantaten in Rom und fünf in Albano95 entstanden sind und insgesamt 26 Kantaten Caldaras aus der Zeit bei Ruspoli stammen). Bemerkenswert ist, dass lediglich acht von diesen Kantaten für Ruspoli96 kopiert wurden. Es befinden sich in Molitors Katalog, wie aus seiner Kategorisierung her-vorgeht, neben Kantaten auch größere Kammer- und Festmusiken, die er – so kann angenommen werden – aufgrund ihres Umfangs (Länge und Beset-zung) von den Opernkompositionen abgrenzt. Es fallen darunter „Serena-de“, „Feste musicali“, „Feste di Camera“, „Componimenti da camera“, „Ser-vizi di camera“, „Pastorali“, die neben groß angelegten Werken der Bezeich-nung „Cantata di Camera à 3 voci“ oder „Cantata piacevola à 4 Soprani“ stehen. Die Titulierungen richten sich demnach weniger nach musikinhären-ten Kriterien, als vielmehr nach den äußeren Anlässen.97 Für jene Kantaten, die im direkten Zusammenhang mit der kaiserlichen Familie stehen, d. h. für besondere Anlässe wie Hochzeits- oder Faschingsfeiern verfasst wurden, lassen sich Aussagen zum Entstehungs- und Aufführungskontext treffen.98 So wurden im Falle einer musikalischen Beteiligung von Mitgliedern der kaiserlichen Familie die Namen der jeweiligen Sängerinnen extra auf den Partituren vermerkt. Beispielsweise wurden auf der „Cantata piacevole à 4 Soprani con diversi Stromenti“ Il Giuoco del quadriglio 99 neben Hofdamen die Erzherzoginnen Maria Theresia und Maria Anna benannt. Auch werden in seltenen Fällen Namen professioneller Sänger bzw. Sängerinnen vermerkt: Als Beispiel können hier Gaetano Orsini und Maria Anna Schulz genannt
95 Caldara hielt sich von Juli bis Oktober 1712 in Albano auf, vgl. U. Kirkendale, siehe
Anm. 2, S. 84–86. 96 Es handelt sich dabei um die Kantaten: L’Usignuolo, Filli convien che parto, Astri di quel bel viso,
Misero e sventurato, Filen ingrato (alle A-Wgm, VI 16.568), Dì crudel vuoi tu che mora (A-Wgm, VI 33907), La Zenobia, Amarilli vezzosa (alle A-Wgm, III 2.616), vgl. auch U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 446–479.
97 Abgrenzungen des Kantatenbegriffs werden in der Literatur immer wieder thematisiert und problematisiert: Bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhundert nimmt Scheibe eine ausführliche Diskussion über Art und Charakter der Kantate vor, vgl. Johann Adolph Scheibe: Critischer Musikus, 2. verbesserte Auflage. Hamburg 1745, S. 380–412, 485–492. Vgl. zur Definition und Charakterisierung der Kantate jüngeren Datums auch: Michael Talbot, The chamber cantatas of Antonio Vivaldi. Woodbridge 2006, S. 25–29.
98 Vgl. stellvertretend zur Musikausübung der kaiserlicher Familienmitglieder in Zusammen-hang mit Caldaras Werken: Roswitha V. Karpf, Die Beziehungen Maria Theresias zur Musik, in: Johann Trummer (Hg.), Musik am Hof Maria Theresias (Beiträge zur Aufführungspraxis 6) München etc. 1984, S. 93–107; Gabriele Schwab, Maria Theresia als Sängerin. Wien: gewi. Dipl.arb. 1994.
99 A-Wgm, VI 16.576 (A 404).
138
werden.100 Der Darbietungszweck wie etwa anlässlich des kaiserlichen Na-menstages wird mitunter auch auf Partituren vermerkt. Dieser wurde am 4. November 1720 mit Caldaras Apollo in Cielo 101 begangen. Unter Molitors Kategorie „Cantate à Voce sola“ fallen insgesamt 81 Wer-ke, wobei 36 davon besonders augenfällig sind. Sie haben die außergewöhnli-che Besetzung „à Basso solo“ und verteilen sich auf zwei Bände, wobei Mo-litor einem Band 24 Kantaten zuordnete, die im Zeitraum zwischen 29. Juni und 20. August 1730 in Casalmaggiore102 erstellt worden seien. Diese Kanta-ten wurden „für I[hr]e Maestät dem Kaiser Cal [sic!] VI komponiert“103 und am 12. Oktober 1730 ihm selbst überreicht.104 Der andere Band enthält zwölf bislang undatierte Kantaten105, deren innerer Zusammenhang auf textlicher Basis von Centanni analysiert wurde. Die Ergebnisse der Analyse beinhalten bemerkenswerte Feststellungen, die Rückschlüsse auf den Entste-hungskontext der Kantaten zulassen, da es sich um Kantatentexte handelt, welche nicht mehr dem „canone tradizionale“ zugeordnet werden können: „[…] sono lamenti sì, ma non di Didoni, di Dafni, di Cloe o di Titiri: ma di eroi, spesso maturi, maschioni molto virili […] colti in momenti particolari di deliquio o di disperazione.“106 Es sind Helden wie Herkules und Tamerlan, die ihre Lamenti vorbringen und deren inhaltlicher Monolog sich nur punk-tuell auf klassische Quellen zurückverfolgen lässt. Centanni zeigt, dass die zugrunde liegenden Kantatentexte die zeitgenössischen Vorlieben für das Orientalische reflektieren, Themen aufgreifen, die für Opern herangezogen
100 Beide sangen 1726 in der Pastorale à due voci Nigella e Tirsi, vgl. D-MEIr, ED 118q/2.
Diese Angabe ist auf einer Kantatenkopie für Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen ent-halten. Der Herzog ließ eine große Anzahl von Kantaten in Wien kopieren, die wichtige Quellen zum Kantatenschaffen Caldaras darstellen. Einige Vorlagen für die in Wien vor-wiegend zwischen 1726 und 1728 kopierten Kantaten sind verschollen und können nur mehr über die Kopie für den Herzog rekonstruiert werden. Vgl. auch: Lawrence Bennett, A little-known collection of early-eighteenth-century vocal music at Schloss Elisabethenburg, Meiningen, in: FAM 48 (2001) S. 250–302.
101 A-Wgm, III 1.6017 und A-Wn, Mus.Hs. 18.241. 102 Auf Basis von Molitors Datierung ist die Angabe über Caldaras Aufenthalt in Casalmaggio-
re bei Kirkendale zu revidieren, vgl. U. Kirkendale, siehe Anm. 2, S. 123. 103 A-Wn, Mus.Hs. 19.239 XII, fol. 35v; A-Wgm VI 16.567 (A 403). 104 Dieses Exemplar befindet sich in A-Wn, Mus.Hs. 17.580. 1–24 Mus. Nur mehr 18 der 24
Kantaten lagen in autographer Handschrift in A-Wgm, VI 16.567, vgl. zu den Quellenan-gaben der autographen Musikalien auch: Antonio Caldara, Kammermusik für Gesang. Kanta-ten, Madrigale, Kanons, hg. von Eusebius Mandyczewski (DTÖ 75) Wien 1932, S. 107. Jüngst wurde die Kantate Tirsi geloso für das Archiv zurückgekauft, sodass seit 2009 19 Kantaten vorhanden sind. Die Autorin dankt Otto Biba für die freundliche Auskunft.
105 A-Wn, Mus.Hs. 17.603. 1–12. 106 Monica Centanni, „…Delirante, disprezzato, deluso, acceso amante“. Variazioni su temi classici in
alcune cantate inedite di Antonio Caldara, in: Musica e Storia VII (1999) S. 403–446, hier: S. 403.
139
wurden und diesen näher standen als dem arkadischen Umfeld, das typischer Weise als inhaltliche Grundlage bei Kantaten rezipiert wurde.
Kantatenkompositionen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten Schon ein erster Blick auf die soziokulturellen Umstände der Kantatenpro-duktion Caldaras in Rom und Wien lassen die Bedeutung von deren Rah-menbedingungen erkennen: hier der Palazzo eines stadtrömischen Adeligen, dort der politische Mittelpunkt Europas; hier der unprätentiöse Zugang zur Conversazione, dort das Reglement des Zeremoniells; hier die institutionelle Verankerung der Akademien und ihr Einfluss auf das kulturelle Leben Roms, dort die panegyrische Verherrlichung des Kaisers. Doch der zentrale Punkt, der das Kantatenschaffen maßgeblich veränderte, lässt sich in der veränderten Funktion der Kantate ausmachen: Stand sie in Rom im Mittel-punkt von Caldaras Schaffen, mit dem Ziel der musikalischen Darbietung bei den Conversazioni zu dienen, so rückte sie in Wien zugunsten großer dramati-scher Werke in den Hintergrund. Gleichwohl behielt sie auf funktionaler Ebene zwei Ankerpunkte: einerseits wurde sie zur Umrahmung besonderer Feierlichkeiten herangezogen, andererseits hatte sie für die Musik in den privaten Räumlichkeiten der kaiserlichen Familie Bedeutung. Dass die musi-kalische Einbindung der kaiserlichen Familie auf Caldaras Schaffen direkten Einfluss nahm, kann an dem Beispiel der Cantata Pastorale Eroica à 5 Voci di Soprano 107 nachvollzogen werden, die unter Beteiligung der Erzherzoginnen Maria Theresia und Maria Anna dargeboten wurde. Für Caldara bedeutete dies, eine hierarchische Ordnung berücksichtigen zu müssen, die er in Rom nicht bedenken hatte müssen. In der genannten Situation aber gebührte der erstgeborenen Erzherzogin Maria Theresia die erste Arie. Stimmumfang und musikalische Fähigkeiten der kaiserlichen Familienmitglieder bestimmten somit die Struktur und die musikalischen Mittel dieser spezifischen Kategorie an Kantaten. Für Rom standen auf Ebene der Besetzungspraxis Sopran- und Altkanta-ten im kompositorischen Fokus. Diese Form der Kantate (Solokantate, bzw. Kantate mit Violinen) entsprach dem Geschmack und den Forderungen der römischen Mäzene, wie auch ein vergleichender Blick auf Scarlattis römische Kantaten beweist. Auch für das kaiserliche Umfeld entstanden Kantaten mit dieser Besetzung; sie standen aber gleichberechtigt neben zahlreichen Kanta-ten der eher unüblichen Besetzung mit der Bassstimme bzw. neben solchen,
107 A-Wn, Mus.Hs. 17.681. Vgl. R. V. Karpf, siehe Anm. 98, S. 95.
140
die klanglich u. a. durch den Einsatz von Solovioloncello108, Chalumeau, Fagott, Posaune109, Clarini und Pauken110 erweitert wurden. Auch bei der Produktionsweise lässt sich eine entscheidende Änderung feststellen: Zieht man die datierten Autographe aus der Zeit als Vizekapell-meister heran, so fällt auf, dass eine Vielzahl an Kantatenkompositionen in kurzer Zeit kumulierte.111 Ob dies mit anderweitigen Verpflichtungen zu-sammenhing und Caldara zeitliche Freiräume für eine intensive Kantaten-produktion nutzte, ist derzeit ebenso Gegenstand einer umfassenden Unter-suchung der Autorin wie die Veränderungsprozesse auf der Ebene von mu-sikalischer Struktur, vertonter Themen und Motive, textlicher Grundlagen und kompositorischer Aspekte.
108 Vgl. die Kantate Vicino a un rivoletto (ediert in DTÖ 75, siehe Anm. 104, S. 38-46, 107). 109 Die Kantate Come debba esser condotta una reciproca Simpatia wird mit Chalumeau, Fagott und
Posaune besetzt, vgl. D-MEIr, ED 118q/1. 110 Vgl. die Besetzungsangaben zur Kantate Tempo distruggitor, dov’è l’orgoglio bei S. Molitor: A-
Wn, Mus.Hs. 19.239 XII, fol. 32v. 111 Vgl. den Band mit 12 Kantaten für eine Stimme, der zwischen 30. Mai 1729 bis 10. Juni
1729 in Wien erstellt wurde oder jene 24 Kantaten für Bassstimme, die zwischen 29. Juni und 20. August 1730 in Casalmaggiore entstanden sind, vgl. A-Wn, Mus.Hs. 19.239 XII, fol. 33r–v, 35v.