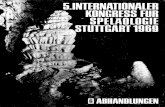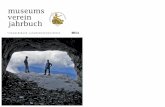Intersexuality and Transidentity - Bundeskanzleramt Österreich
Revolutionen und Reaktion: Der Wiener Kongress, Österreich und die Amerikafrage
Transcript of Revolutionen und Reaktion: Der Wiener Kongress, Österreich und die Amerikafrage
1
Revolutionen und Reaktion: Der Wiener Kongress, Österreich und die Amerikafrage Von Christian Cwik (Universität zu Köln / Universidad La Habana)
Einleitung
Nur weil Österreichs wirtschaftliche und politische Interessen auf dem amerikanischen Kontinent
und seinen Inseln im Zeitalter des Wiener Kongresses bislang kaum erforscht wurden, bedeutet
dies nicht, dass es keine gab. Im Gegenteil gab es so viele Verbindungen, dass in diesem Beitrag
gar nicht auf alle Beziehungen zwischen Österreich und den Amerikas zur Zeit des Wiener
Kongress eingegangen werden kann.1 Auch wenn die Politik der habsburgischen Regierung in
Wien hinsichtlich der Amerikas im Vergleich zu anderen westeuropäischen Mächten als gering
einzustufen ist, verfolgten die drei habsburgischen Kaiser Joseph II, Leopold I und Franz II
(1780-1806) und in Folge Franz als österreichischer Kaiser Franz I. (1804-1835) eigenständige
koloniale Konzepte.2 Diese waren einerseits durch den Sieg der amerikanischen Revolution 1783
notwendig geworden, die im Wettstreit mit Großbritannien die Gründung (elitärer)
demokratischer Republiken in Spanisch- und Portugiesisch Amerika förderte, sowie andererseits
durch die allgemeine Bedrohung der Französischen Revolution (1789-1814), die Freiheit und
Gleichheit proklamierte, die Sklaverei abschaffte und nach der Weltherrschaft griff, zu
verhindern. Österreich stellte sich von Beginn an sowohl gegen das britische Modell der
konstituionellen Monarchie, als auch gegen das US-amerikanische des demokratischen
Republikanismus und die Französische Revolution. Stattdessen forcierte die Regierung in Wien
die Wiederherstellung absolutistischer Macht in Spanien und Portugal und forderte die
Restauration der Grenzen vor 1789 in Europa und in Übersee. Trotz aller politischen
Bemühungen während des Wiener Kongresses, ist in den Schlussakten nur ein Bruchteil der
Verhandlungsbemühungen um die Widerherstellung der Kolonien reflektiert.
1 Erwähnung finden österreichische Kolonialinteressen während des Wiener Kongresses zuletzt
in Ansätzen bei Walter Sauer, Habsburg Colonial: Austria-Hungary’s Role in European
Overseas Expansion Reconsidered. In: Austrian Studies, Nr. 20 (2012) 5-23.
2 Ich möchte hier nicht auf die Frage eingehen, inwieweit die habsburgische Politik in Ost- und
Südosteuropa als Kolonialpolitik zu definieren ist und verweise auf die Debatten hierzu bei:
Andrea Komlosy, Innere Peripherien als Ersatz für Kolonien? Zentrenbildung und
Peripherisierung in der Habsburgermonarchie. In: Endre Harz [et al.] (Hg.), Zentren, Peripherien
und kollektive Identitäten in Österreich-Ungarn (Tübingen/Basel 2006) 55–78; sowie Moritz
Csaky, Johannes Feichtinger, Prutsch Ursula (Hg.), Habsburg postcolonial. Machtstrukturen und
kollektives Gedächtnis. (Gedächtnis-Erinnerung-Identität 2, Innsbruck/Wien/München/Bozen
2003).
2
Der vorliegende Beitrag basiert auf ersten Ergebnissen eines gemeinsam mit Michael Zeuske
durchgeführten Forschungsprojekts über den Wiener Kongress und seine globale Dimension an
der Universität zu Köln. Das Ziel des Beitrages ist es, sowohl die revolutionären Veränderungen
in den Amerikas als auch die Reaktion Europas auf die politischen Umbrüche in Übersee zu
beschreiben. Innerhalb dessen wird die Bedeutung der Nord- und Südamerikafrage für die europäische
Politik im Zeitalter des Wiener Kongresses analysiert, wobei sich dieser Artikel als Review Beitrag
versteht und in erster Linie auf einer Zusammenfassung der wissenschaftlichen Literatur aufgebaut ist. 3
Besprochen werden die Amerikanische Revolution und ihre Auswirkung auf die Haitianische
und die iberoamerikanischen Revolutionen sowie die Position Österreichs vor und während der
Französischen Revolution. In Folge wird an verschiedenen Beispielen analysiert, inwieweit der
Wiener Kongress formal auf die Bedrohung durch die Revolutionen reagiert hat.
Zur Ausgangssituation
Ohne Zweifel existiert sowohl hinsichtlich politisch-sozialer Veränderungen als auch technisch-
ökonomischer Umwälzungen eine universal-historische Dimension der Französischen
Revolution. Sie bestimmte im Wesentlichen das gesamte 19. Jahrhundert hindurch die großen
kulturellen und industriellen Revolutionsprozesse in Europa und Übersee. Durch sie begann sich
eine bürgerliche Gesellschaftsordnung zu etablieren, die sich in weiterer Folge als global
beherrschendes System behaupten konnte. Ihren maßgeblichen Impuls erhielt die Französische
Revolution jedoch durch die Amerikanische Revolution (1775-1789), in der sich die Peripherie
gegen das Mutterland erstmals militärisch und politisch durchsetzen konnte. Bereits 1939
beschrieb William Spence Robertson die Auswirkungen der Französischen Revolution auf die
Unabhängigkeitsbewegungen Lateinamerikas.4 Aber auch andere Ereignisse in den europäischen
Kolonien in den Amerikas, wie etwa der Ausbruch der Revolution „freier Menschen“ und
Sklaven in Haiti 1791, übten maßgeblichen Einfluss auf die Radikalisierung der Französischen
Revolution aus.
Die Erklärung der Menschenrechte in den 13 nordamerikanischen Kolonien und in Frankreich
1794 sowie die Abschaffung der Sklaverei in Frankreich und seinen Kolonien 1794 erschütterte
die Grundfeste okzidentalen Denkens in Europa. Dies erforderte in Europa eine intensivere
Auseinandersetzung mit anderen Erdteilen, was zur Folge hatte, dass eine einer Art
3 Noch ausständig ist Auswertung der vom Projekt bislang gesicherten offiziellen und inoffiziellen
Protokolle aus Beständen französischer und britischer Archive sowie der geretteten österreichischen
Geheimprotokolle, ein Großteil verbrannte während des Justizpalastbrandes 1927 vollständig. Ein Projekt
des Österreichischen Staatsarchivs versucht die Geheimprotokolle zu restaurieren (Interview mit GI
Wolfgang Maderthaner vom 13.1.2013).
4 William Spence Robertson, France and Latin American Independence. (Baltimore 1939).
3
„Verweltgeschichtlichung“ einsetzte. Neue technische und ökonomische Errungenschaften auf
beiden Seiten des Atlantiks ermöglichten neue Netzwerkstrukturen globalen Außmaßes, zumeist
auf der Basis von kapitalistischen Familienetrieben. So hatten räumliche - also lokale und
regionale Entscheidung in den Amerikas globale Auswirkungen auf die Politik und Wirtschaft.5
Der Wiener Kongress von 1814/15 versuchte, den epochalen Wandel vom merkantlitischen
Kolonialismus zum kapitalistischen Imperialismus (Sattelzeit)6 zu kanalisieren. Die Freiheit der
internationalen Flussschifffahrt, die Abschaffung des Sklavenhandels oder die Ächtung der
Sklaverei (Artikel 118) ebneten den europäischen Mächten diesen Weg in die Amerikas, aber
auch nach Afrika und Asien. Selbst das 1804 enstandene Kaisertum Österreich, das vor 1795
eine, wenn auch recht unbeschriebene, atlantische Macht war, beteiligte sich am Wettlauf um
Ressourcen in Süd-, Mittel- und Nordamerika.
Von der großen Mehrheit der Historiker wird der Wiener Kongress noch immer als Ereignis von
ausschließlich europäischer Reichweite dargestellt.7 Die Restauration und Neuordnung Europas
durch die europäische Pentarchie, die wegen der militärischen Niederlage Napoleons notwendig
wurde, und das damit verbundene endgültige Ende der Französischen Revolution (und ihren
Demokratiekonzepten) werden allgemein als zentrales Motiv für die Einberufung des Kongresses
herangezogen. Der Blick über den europäischen Tellerrand, vor allem die Berücksichtigung der
Tatsache, dass die großen europäischen Mächte (mit Ausnahme Preußens und Österreichs)
enormen Kolonialbesitz in Übersee besaßen, ihre Kriege global führten, fehlt in der
Historiographie über den Wiener Kongress und seine Nachfolgekongresse.
Eine Ausnahme stellen die wissenschaftlichen Arbeiten des deutschen Historikers Manfred
Kossok (1930-1993) von der Leipziger Schule für vergleichende Revolutionsforschung dar, der
über den Einfluss der iberoamerikanischen Revolutionen auf Europa und im speziellen auf den
5 Zur Wirkung der Globalgeschichte aus lokaler Perspektive siehe Andrea Komlosy, Globalgeschichte,
Methoden und Theorien. (Wien/Köln/Weimar 2011).
6 Reinhart Koselleck, Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft, In: Werner Conze (Hg.),
Theorie der Geschichtswissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts. (Stuttgart 1972) 10-28, hier
14f.
7 Ich möchte hier aufgrund der Fülle der Literatur zum Wiener Kongress nur auf einige ausgewählte
Werke verweisen: Wolfram Pyta (Hg.), Das europäische Mächtekonzert: Friedens- und Sicherheitspolitik
vom Wiener Kongress 1815 bis zum Krimkrieg 1853. (Köln 2009) sowie die vom Forschungsprojekt
„Wiener Kongress“ In: www.wiener-kongress.at publizierte Bibliographie zum Wiener Kongress online
unter <http://www.wiener-kongress.at/Bibliographie1.html> (29. September 2013). Carsten Holbraad,
The Concert of Europe: A Study in German and British International Theory 1815–1914. (London 1970);
Francis Roy Bridge, Roger J. Bullen, The Great Powers and the European States System 1815–1914.
(London/New York 1987); Eckart Conze, Wer von Europa spricht, hat unrecht. Aufstieg und Fall des
vertragsrechtlichen Multilateralismus im europäischen Staatensystem des 19. Jahrhunderts. In:
Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, Nr. 121 (2001) 214–241.
4
Wiener Kongress und die Heilige Allianz gearbeitet hat. Durch das Studium seiner Schriften8
wird rasch klar, dass der Wiener Kongress viel mehr war als ein nur rein „europäisches
Spektakel“. Der Kongress in Wien, die Gründung der Heiligen Allianz sowie die vier
Folgekongresse veränderten, so Kossok, nicht nur die Situation in Übersee nachhaltig, sondern
waren eine Reaktion auf die historischen Ereignisse in Übersee. Der Einfluss, den die Aufstände
und Revolutionen in Lateinamerika auf die Destabilisierung Spaniens, die europäische Krise und
schließlich Überwindung des Systems der Heiligen Allianz ausübten, ist „bislang nur wenig ins
historische Bewusstsein eingedrungen“.9
Die Wiederherstellung räumlicher Herrschaft nach den Vorstellungen der Pentarchie bedeutete
insbesondere die territoriale Restauration auf der Basis der Grenzen von 1789 bzw. 1793. Die
Forderung nach der Wiederherrstellung des Status Quo von 1789/93 inkludierte von Beginn an
auch die Restauration der Kolonien in Übersee und war somit keineswegs nur auf Europa
beschränkt. Der Wiener Kongress sollte hierfür die Grundlagen erarbeiten und die an die
„Revolutionen“ verlorengegangenen Kolonien wieder in den Schoß der konservativen Mächte
zurückführen. Um Kolonien zurückzuerobern und Revolutionen10
bereits im Keim ersticken zu
können, erarbeitete der Wiener Kongress neue politische und militärische Prinzipien. Die
Gründung gemeinsamer politischer Kollektive zur Bekämpfung von Revolutionen garantierte
den fünf europäischen Großmächten das Interventionsrecht auf der Bais des
Legitimationsprinzips, sobald sie den territorialen Status Quo – egal wo - gefährdet sahen. Um
8 Manfred Kossok, Im Schatten der Heiligen Allianz. Deutschland und Lateinamerika, 1815-1830. Zur
Politik der deutschen Staaten gegenüber der Unabhängigkeitsrevolution in Mittel- und Südamerikas
1810-1830. (Studien zur Kolonialgeschichte und Geschichte der nationalen und kolonialen
Befreiungsbewegung Berlin 1964); Ders., Legitimität gegen Revolution. Die Politik der Heiligen Allianz
gegenüber gegenüber der Unabhängigkeitsrevolution in Mittel- und Südamerikas 1810-1830. In:
Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR, Gesellschaftswissenschaften, Nr. 6/G
(1987a) Akademischer Verlag Berlin; Ders., Karl Marx und der spanische Revolutionszyklus des 19.
Jahrhunderts. In: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR,
Gesellschaftswissenschaften, Nr. 4/G (Leipzig 1987b).
9 Kossok, Im Schatten der Heiligen Allianz (1987a) 6; Alberto Filippi (Hg.): Bolívar y Europa en las
crónicas, el pensamiento político y la historiografía. Bd.1 (siglo XIX). (Caracas 1986) 209-213.
10 Damit waren Regierungen und Bewegungen gemeint, die nicht „organisch-gewachsen“, sondern auf
„nichtlegitimierten“ Weg entstanden waren. Valerian Aleksandrovi Zorin [et. al] (Hg.), Istorija
diplomatii, Bd. 1 (Moskau 1959) 494 f. hier Kossok, Legitimität gegen Revolution. Die Politik der
Heiligen Allianz gegenüber der Unabhänigkeitsrevolution in Mittel- und Südamerikas 1810-1830.
Kommentare und Quellen. In: Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften der DDR,
Gesellschaftswissenschaften, Nr. 6, G (Berlin 1987a) 6.
5
die Gefahr rechtzeitig zu erblicken, errichteten sie ein diplomatisches Netzwerk, das die
politische und ökonomische Stabilität überwachen und den Frieden sichern sollte.11
Auch für das neugeschaffene Österreich ging es im Wiener Kongress um Fragen territorialer
Restauration, schließlich war man von der Französischen Revolution 1794 um die
Österreichischen Niederlande „erleichert“ worden. Die Spanischen Niederlande fielen nach der
Niederlage im Spanischen Erbfolgekrieg durch die Verträge von Rastatt 1714, als Kompensation
für den „Verlust“ der spanischen Kolonien an die Habsburger. Österreich musste somit seine
kolonialen Forderungen in Spanisch-Amerika endgültig aufgeben.12
Auch wenn die österreichischen Kolonialprojekte zwischen Afrika und Asien scheiterten (siehe
Kaiserliche Ostender Kompanie), besaß Österreich bis zum Verlust seiner innereuropäischen
Kolonie in den Niederlanden mehrere ausbaufähige Atlantikhäfen. Da die Regierung in Wien
weiterhin an Kolonialprojekten in den Amerikas interessiert war, bemühten sich die Österreicher,
während des gesamten Wiener Kongresses unter der persönlichen Leitung des Fürsten Klemens
Wenzel von Metternich um die Rückgewinnung der Österreichischen Niederlande.13
Erst der
Verzicht auf die Niederlande sicherte den Österreichern die Präsidialmacht im neugegründeten
Deutschen Bund, den man hinsichtlich seiner nationalstaatlichen Interessen benötigte.
Revolutionen in den Amerikas
Vergleichen wir Karten von koloniale Territorien in den Amerikas aus den Jahren vor 1790 mit
Kartenwerken des Jahres 1814/15, so lassen sich große Verschiebungen hinsichtlich der
kolonialen Herrschaft in dieser Weltregion beobachten. Die um die Restauration bemühten
Verhandungsdelegationen am Wiener Kongress erwartete ein ziemlich großer Arbeitsaufwand,
war doch in den Amerikas im besagten Zeitraum kaum ein Stein auf dem anderen geblieben.
11 Henry Alfred Kissinger, Großmacht Diplomatie. Von der Staatskunst Castlereaghs und Metternichs.
(München 11980) 1f; Ders., A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace, 1812-
22. (Boston 21973).
12 Die besonders verdienstwürdige Arbeiten von Analola Borges und von David González Cruz
behandeln die Interessen des Hauses Habsburg, im Speziellen Karl von Österreichs an den
iberoamerikanischen zur Zeit des Spanischen Erbfolgekrieges (1701-1714).Die besonders
verdienstwürdige Arbeiten von Analola Borges und von David González Cruz. Analola Borges, La
Casa de Austria en Venezuela durante la Guerra de Sucesión Española (1702-1715) (Salzburg 1963);
Dies., Los aliados del archiduque Carlos en la América virreinal. In: Anuario de Estudios Americanos,
Sevilla, 37 (1970) 321-370. David González Cruz, Guerra de religión entre príncipes católicos. El
discurso del cambio dinástico en España y América (1700-1714). (Madrid 2002).
13 Metternichs Vater, Franz Georg Karl Graf von Metternich-Winneburg, war der letzte österreichische
bevollmächtigte Minister in den Österreichischen Niederlanden. Alan Sked, Metternich and Austria: An
Evaluation. (London 2008).
6
Als größtes Problem schätzten die europäischen Monarchen zweifellos die Konsoldierung der
Vereinigten Staaten von Nordamerika als „freies und demokratisches Gesellschaftsmodell“ ein.
Der Wiener Hof stand von Anfang an dem Projekt der Vereinigten Staaten ablehnend gegenüber,
auch wenn Frankreich als Österreichs engster Verbündeter bereits am 17. Dezember 1777 die
vereinigten Staaten von Nordamerika als unabhängiger Staat anerkannt hatte. Die Wiener
Regierung verbot Österreichischen Söldnern, die aktive Teilnahme am Krieg, blieferte jedoch die
US-Unabhängikeitsarmee geheim mit Waffen.14
Der erste nach Wien entsandte US-Diplomat
William Lee wurde 1778 weder von Erzherzogin Maria Theresia noch von Staatskanzler Kaunitz
empfangen. Trotzdem traf Lee während seines Aufenthalts in Wien mehrere hochrangige
Persönlichkeiten des politischen und wirtschaftlichen Lebens der Habsburgermonarchie.15
Lee
traf beispielsweise am 28. Mai 1778 den Grafen Francis Xavier Koller sowie die Prinzessin
Anna Khevenhüller. Maria Theresia hatte bereits 1777 die Angebote des Philadelphia-
Kongresses abgelehnt, die dem Erzherzogtum Österreich weitgehende Freihandelsrechte
eingeräumt hätten. Ebenso scheiterten im Jahr 1792 endgültig die Verhandlungen um die
Etablierung diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Staaten, die 1783 aufgenommen
worden waren.16
Großbritannien war es im Britisch-Amerikanischen Krieg von 1812-1814 weder gelungen einige
ihrer ehemaligen Kolonien zurückzuerobern, noch das „revolutionäre Gesellschaftsmodell“ zu
zerschlagen. Stattdessen verloren die Briten Teile West-Floridas an die USA, wodurch sie im
nordkaribischen Raum an Einfluss verloren. Die Verfassung von 1787 und die Bill of Rights von
1789-90 sicherten den Bürgern der USA im Rahmen einer freien und demokratischen
Gesellschaft auf der Basis von Werten der Aufklärung, bestimmte unveräußerliche Grundrechte
auf Life, Liberty, und der Pursuit of Happiness zu. Über atlantisch-interamerikanische Netzwerke
standen diese nordamerikanischen Kolonien seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit
britischen, niederländischen, dänischen und französischen Kolonien in regem Handelsaustausch,
ganz zu schweigen von den Handelsbeziehungen ins benachbarte französische und spanische
Louisiana. In das von 1763 bis 1800 von Spanien verwaltete Louisiana wanderten vor allem
14 Reinhold Wagnleitner, Das Problem Amerika als Artefakt der europäischen Expansion. In: Ders.,
Coca - Colonisation und Kalter Krieg. Die Kulturmission der USA in Österreich nach dem zweiten
Weltkrieg; V. Österreich und Amerika. <http://www.ejournal.at/Buecher/cocola/wga5.html> (29. März
2013)
15 Karl A. Roider, William Lee, our first Envoy in Vienna. In: The Virgina Magazine of history and
biography, Bd. 86, 2 (1978).163-68; Hanns Schlitter, Die Beziehungen Osterreichs zu den Vereinigten
Staaten von Amerika. (Innsbruck 1885) 7.
16, Hubert van Houtte, Documents on Commercial Conditions and Negotiations with Austria, 1783-1786.
In: American Historical Review, Bd. 16 (1911) 567-578.
7
Kanaren, Deutsche und frankokanadische Akadier ein. Die 37 Jahre bedeuteten die größte
Ausdehnung des Königreichs Spanien in den Amerikas.17
Städte wie Kingston auf Jamaika und Philadelphia in Pennsylvania sowie Boston in
Massachusetts und Bridgetown auf Barbados waren über Firmen und Familiennetzwerke
miteinander verbunden. Der Hafen von Pensacola in Westflorida wurde nach der Übernahme
durch die Briten 1763 in eine Drehscheibe für den atlantisch-karibischen Handel zwischen
Nordamerika und dem karibischen Raum ausgebaut, und als er 1783 wieder an die Spanier
verlorenging, behielt er als Schnittstelle seine Position.18
Um Republikanismus und Demokratie
in den europäischen Kolonien in den Amerikas zu verbreiten, griffen die amerikanischen
Revolutionäre zu teilweise abenteuerlichen Mitteln. Der französischstämmige Kapitän Louis
Michel Aury eroberte gemeinsam mit seinen indigenen Verbündeten aus den
Unabhängigkeitskriegen die Insel Ameila vor der Halbinsel Florida im Jahre 1817 und gründete
dort die Republik von Florida.19
1822 erklärte der ehemalige napoleonische General H. L. V.
Ducoudray Holstein, ein späterer Biograph Simón Bolívars, die Insel Puerto Rico zur Republik
Boricua (der Name stammt aus dem Arawak).20
Gedankengut gleich welcher Art erreichte die verschiedenen Hafenstädte, und es kam zur
Etablierung vorindustrieller autonomer Hafengesellschaften, einer Art Seeproletariat, das seine
relative Selbständigkeit auch mit Gewalt zu verteidigen im Stande war.21
Revolutionäre
Konzepte wurden zu ideellen Schmugglergut und verbreiteteten sich über die Hafenstädte ins
Landesinnere, zumeist über weitverzeigte Flusssysteme. Daran änderte sich auch kaum etwas
nach der Loslösung von Großbritannien.
Es war allen voran der Wunsch nach Freihandel, der die kreolischen Eliten in den spanischen
Kolonien der Amerikas Stellung gegen das Mutterland beziehen ließ. Seit 1797 forcierten die
USA ihre Handelsbeziehungen mit Havanna und dem mexikanischen Hafen von Veracruz.22
Kein geringerer als Alexander von Humboldt beschreibt die massive Präsenz von
17 Carl A. A Brasseaux, Refuge for All Ages: Immigration in Louisiana History. (Lafayette 1996);
Gilbert C. Din, The Spanish Presence in Louisiana, 1763-1803. (Lafayette 1996).
18, Ira Berlin, Many Thousands Gone: The First Two Centuries of Slavery in North America. (Cambridge
Mass. 1998) 306-307.
19 David Armitage, Declaraciones de Independencia, 1776-2011: De derecho natural al derecho
internacional, paper. Harvard, Seiten 15 online unter
http://scholar.harvard.edu/files/armitage/files/declaraciones.pdf (Zugriff: 31.3.2013)
20 Rufus Kay Wyllis, Filibusters of Amelia Island. In: Georgia Historical Quarterly, 12 (1928) 297-325.
21 Peter Linebaugh, Marcus Rediker, The many-headed hydra: sailors, slaves and commoners and the
hidden history of the revolutionary Atlantic. (Boston 2000); Marcus Rediker, Villains of all nations:
Atlantic prates in the golden age. (London 2004); Ders., Slave ship :a human history. (New York 2007).
22 Peggy K. Liss, Atlantic Empires. The network of Trade and Revolution, 1713-1826.
(Baltimore/London 1983) 173, 180.
8
amerikanischen Schiffen in den beiden Häfen.23
Humboldt selbst, der 1804 auch die USA
bereiste, wurde nach seiner Rückkehr nach Europa zu einem Übermittler amerikanischer
Ideologien zwischen Paris, London, Berlin und Wien. Sein Bruder Wilhelm von Humboldt
gehörte der preußischen Delegation beim Wiener Kongress an.
Inventarlisten einiger Privatbibliotheken in Veracruz und Cartagena widerspiegeln den Einfluss
US-amerikanischer Schriften zum Freihandel und Republikanismus. Der venezolanische
Intellektuelle Manuel Garcia de Sena publizierte 1811 in Philadelphia ein Handbuch der
Revolution La independencia de la Costa Firme, justificada por Tomás paine treinta años ha für
die spanischen Kolonien, das großen Einfluss auf die Unabhängigkeitsbewegungen ausübte.24
Durch den Erwerb Louisianas 1803 hatte US-Präsident Jefferson am 30. April 1803 den größten
Grundstücksverkauf in der Geschichte abgeschlossen. Der Kauf der französischen Kolonie
Louisiana (2.144.476km²), der sogenannte Louisiana Purchase, erregte höchste Aufmerksamkeit
in Europa. Die Rechtmäßigkeit des Geschäfts wurde von den europäischen Mächten in Zweifel
gezogen, änderte jedoch nichts an der Realität. Damit gelang es Jefferson das Staatsgebiet der
USA bis zum Golf von Mexiko auszudehnen, wodurch sich neue Handelswege in den Süden und
Südwesten öffneten. Die neutrale Haltung der USA in den Koalitionskriegen ermöglichte
Washington ab 1805 den Ausbau der Handelsbeziehungen zu den iberoamerikanischen
Kolonien. Durch ein Handelsembargo versuchte Jefferson zwischen 1806 und 1810 nicht nur
Großbritannien sondern auch Frankreich mit einer Handelsblockade vom amerikanischen Markt
auszuschließen und deren Einfluss auf die Unabhängigkeitsbewegungen in Iberoamerika
einzudämmen. Im Wettlauf mit Großbritannien, das um die Transformation der spanischen
Kolonien und Brasilien in eine von London unterstützte konstitutionelle Monarchien kämpfte,
setzten die USA auf ein breites Agentennetz, das unter dem Schlagwort „For us, the patria is
America“ republikanische Kräfte aus Spanisch- und Portugiesisch-Amerika unterstützte.25
Viele
der bekannten lateinamerikanischen Revolutionäre, wie etwa Miranda oder Bolivar, gingen z. B.
bei dem einflussreichen Kaufmann Stephan Girard aus Philadelphia ein und aus.26
Der Aufstand freier Farbiger und des weißen Lumpenproletariats erschütterte Frankreichs
ertragsreichste Kolonie Saint Domingue im Jahre 1790. Bis dahin exportierte die Perle des
23 Alexander von Humboldt, Personal Narratives of Travels to the Equinoctial Regions of the New
continent during the years 1799-1804, 7 Bde. (London 1822-29) hier Bd. 7, 221-248.
24 Tomás Paine, La independencia de la Costa Firme, justificada por Tomás Paine treinta años ha.
Manuel García de Sena (Hg. und Übersetzung) (Panamá 1949)
25 Alva Curtis Wilgus, Some activities of United State citizens in the South American wars of
Independence, 1808-1824. In: Louisiana Historical Quarterly, Nr. 14 (1931) 182-203.
26 Auch Simon Bolivars Bruder Juan Vicente Bolivar reiste nach Philadelphia und vereinbarte
Waffenlieferungen für die Aufständischen. Cristóbal Mendoza, Las primeras misiones diplomáticas de
Venezuela, 2 Bde. (Caracas 1962) 33-43.
9
französischen Kolonialreiches jährlich rund 75 Millinen Pfund Rohzucker, 51 Millionen
raffinierten Zucker, 43 Millionen Tonnen Kaffee sowie eine Million Pfund Indigo und zwei
Millionen Pfund Baumwolle. Frankreich, das sich selbst in einer revolutionären Umbruchphase
befand, sah plötzlich, was passieren konnte, wenn revolutionäre Idelogien erst einmal ihre
eigenen Kolonien erreicht hatten. Viele dieser Ideen kamen mit den tausenden französischen
Emigranten und Remigranten nach dem Ende des Unabhängigkeitskriegs in Britisch-
Nordamerika 1783 in die Kolonie. Als erfolgreiche französische Amerikakämpfer folgten sie den
Verlockungen des Reichtums in die vielversprechendste Kolonie ihres Königreichs.27
Doch die
meisten Veteranen scheiterten an den feudal-kolonialen Verhältnissen auf Saint Domingue und
so entstand ein weißes Lumpenproletariat auf der Insel. Gemeinsam mit den ebenfalls
diskriminierten Freien Farbigen nahmen sie ab 1791 den Kampf um Gleichberechtigung als
französische Bürger auf auf. In Paris hatte man in der Phase des Umbruchs ab 1789 die Kontrolle
über die Kolonien weitgehend an die weiße royalistische Pflanzerschaft verloren. Im Laufe des
Jahres 1792 gelang es den Aufständischen - eine Allianz aus Freien und Sklaven sowie Maroons
- rund ein Drittel der Kolonie gewaltsam unter ihre Kontrolle zu bringen. Den militärischen
Erfolg sicherten sich die Aufständischen mit Hilfe freigelassener Sklaven.28
Nach der Kriegserklärung Frankreichs an Großbritannien 1793 begannen die Briten mit ihrer
Unterstützung für die weiße Pflanzerschaft auf Saint Domingue, die sich unter den Schutz der
britischen Krone stellte. Eine Invasionsarmee kam der weißen Pflanzerschaft im Kampf gegen
die Aufständischen Armee zu Hilfe, die ihrerseits von der legitimistischen revolutionären
Kolonialregierung unterstützt wurde. Sie bestand aus Söldnern aus dem spanischen Teil der Insel
(Santo Domingo), darunter auch Sklaven, sowie aus Söldnern aus dem britischen Jamaika.
Zwischen 1793 und 1804 fielen zehntausende farbige Rebellen sowie rund 200.000 Sklaven (auf
beiden Seiten) und rund 100.000 Soldaten britischer, französischer und spanischer Verbände.29
Die Sklaverei wurde 1794 durch den Nationalkonvent in Frankreich und seinen Kolonien
abgeschafft und gleichzeitig die Gleichheit aller Bürger garantiert. Nach langjährigen
militärischen Auseinanderstzungen mit Großbritannien gelang es der Revolutionsarmee unter der
Führung von Toussaint Louverture, die Briten aus Saint Domingue zu vertreiben. Mit dem
Vertrag von Basel 1795, der das Ende des Kriegs zwischen Frankreich und Spanien bedeutete,
waren die Spanier gezwungen, sich aus Saint-Domingue zurückzuziehen.
27 Cyril Lionel Robert James, The Black Jacobins. Toussaint L'Ouverture and the San Domingo
Revolution. (London 1982).
28 Tausenden Kolonisten gelang die Flucht aus Haiti. Carl A. Brasseaux , Glenn R. Conrad (Hg.), The
road to Louisiana: The Saint Domingue Refugees, 1792-1809. (Lafayette 1992); Nathalie Dessens, The
Saint Domingue Refugees and the Preservation of Gallic Culture in Early American New Orleans. In :
French Colonial History, Nr. 8 (2007) 53-69.
29 David Patrick Geggus, Haitian Revolutionary Studies. Blacks in the Diaspora. (Bloomington 2002).
10
Als Napoleon 1799 an die Macht kam, forderte er für die Kolonien Spezialgesetze ein. Die
Macht des französischen Gouverneurs Toussaint Louverture sollte gebrochen werden. Das
Gesetz zur Wiedereinführung der Sklaverei, löste 1802 neue Unruhen aus, die in der
französischen Invasion der Jahre 1802-03 gipfelte. Napoleon erlitt dabei eine schwere
Niederlage.30
Saint-Domingue proklamierte am 1. Jänner 1804 als neuer Staat „Haiti“ seine
Unabhängigkeit von Frankreich und beendete endgültig die Sklaverei. Alle französischen
Rückeroberungversuche scheiterten.
Zwischen Reaktionen und Unterstützung
Aber auch in den spanischen, niederländischen Kolonien sowie in Portugiesisch-Brasilien kam es
aufgrund der Französischen Revolution zu massiven politischen und territorialen Veränderungen.
Die Koaltionskriege hinterließen ihre Spuren überall in den Amerikas. Im September 1798
besiegte die britische Flotte unter der Führung von Captain John Moss und Superintendent
Thomas Barrow die spanische Armee in der Schlacht von Saint George´s Cay und sicherte sich
endgültig große Teile der Nordwestküste der Bucht von Honduras (heute Belize).31
Auch an der
benachbarten Moskito Küste, die durch die Anglo-Spanish Convention 1786 dem Königreich
Spanien zugesprochen wurde, setzten sich die Briten durch, indem sie die Miskitos in ihrem
erfolgreichen Krieg gegen die Spanier im Jahre 1800 unterstützten.32
Ebenfalls auf Kosten der
Spanier ging die britische Eroberung der Insel Trinidad 1797 vor der Mündung des Orinokos.
Mit dem Ausbruch des Kriegs gegen Frankreich fielen der Reihe nach französische Kolonien in
die Hände Großbritanniens. 1794 eroberten die Briten die Insel Martinique. Trotz der Rückgabe
der Insel an Frankreich durch die Vereinbarung des Friedens von Amiens im Jahre 1802,
kontrollierten die Briten Martinique bis zum Wiener Kongress. Obwohl den Briten im selben
Jahr auch die Eroberung von Guadeloupe gelang, konnte die Insel nicht lange gehalten werden
und ging im Dezember 1794 wieder an Frankreich verloren.
Erfolgreich schlugen die Briten zwischen 1793 und 1797 nicht nur sämtliche durch die
französische Revolutionsregierung unterstützte Sklavenrebellionen auf den westindischen Inseln
nieder, wie auf Tobago, Grenada, Saint Luicia und Saint Vincent, sondern auch die Eroberung
der niederländisch-batavischen Kolonien in Südamerika, Demerara, Essequibo und Berbice
sowie 1800 die karibischen Inseln Curacao und Bonaire, 1803 die Insel Saba sowie ab 1807 auch
30 Christope Belaubre, Jordana Dym, John Savage (Hg.), Napoleon´s Atlantic. The impact of Napoleonic
Empire in the Atlantic World. (Leiden/Boston 2010).
31 Jeremy Black, British foreign policy in an age of revolutions, 1783-1793. (New York 1994) 32–33.
32 Frank Griffith Dawson, William Pitt's Settlement at Black River on the Mosquito Shore: A Challenge
to Spain in Central America, 1732-87. In: HAHR 63, 4 (1983) 677–706.
11
die benachbarte Insel Aruba. 1809 kam es zur Eroberung von Französisch Guyane durch
portugiesische Truppen, die mit Unterstützung der britische Marine von Para aus in der
französischen Kolonie einmarschierten und sie unter ihre Kontrolle brachten.
Die Serie an Niederlagen gegen Großbritannien und seine Verbündeten schwächte die Position
Spaniens in seinen amerikanischen Kolonien. Die Besetzung Spaniens durch Napoleonische
Truppen 1807 und das dadurch ausgelöste kolonialpolitische Chaos stärkten die republikanischen
Positionen in Übersee. Zwischen 1808 und 1811 kam es in allen Vizekönigreichen spanischer
Provenienz zu Unabhängigkeitsproklamationen.33
Um das ehemalige Wirtschaftsmonopol der
spanischen Krone kämpften Briten, Franzosen und US-Amerikaner. Da die von Großbritannien
gestützte Cortes von Cádiz, die seit 1810 als von Frankreich unabhängige Regierung im Namen
des exiliierten Königs Ferdinand VII. operierte, die iberoamerikanischen Vertreter nicht als
gleichberechtigte Partner anerkannte, verweigerten ab der Proklamation der Verfassung von
1812 einige Vertreter aus den Kolonien der Cortes die Gefolgschaft. Paraguay, das sich 1811
vom Vizekönigreich La Plata gelöst hatte, erklärte 1813 seine Unabhängigkeit. Mit der
neuerlichen Inthronisierung von Ferdinand VII. im März 1814 begann die Entmachtung der
Cortes. Im Mai 1814 setzte der Monarch die liberale Verfassung von 1812 außer Kraft und
errichtete eine absolutistische Diktatur. Längst war den Monarchen Europas klar geworden, dass
das portugiesische Brasilien auch unter der direkten Regentschaft des Braganzaprinzen João VI.
die ihm zugedachte Funktion eines Cordon sanitaire gegen die Rebellenrepubliken nicht
durchhalten werde können. Dies brachte Metternich Brasilien gegenüber zum Ausdruck, indem
er den portugieschen Herrscher, gleichsam mahnend und bittend, um ein rasches Ende des
Jakobinismus in Südamerika anflehte „Ne jacobinez pas“ 34
Gemeinsam mit dem französischen
Außenminister Chateaubriand warnte der österreichische Staatskanzler am Wiener Kongress vor
dem „Gespenst“ des südamerikanischen Republikanismus, das die alten europäischen
Monarchien beenden würde.35
Der Plan, die Revolutionen zu „monarchisieren“, sei so
Chateaubriand, die letzte Möglichkeit, die Lage unter Kontrolle zu bekommen.36
Diese
Einschätzung drückte auch der ehemalige spanische Außenminister und Botschafter in Wien
33 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias: Ensayos sobre las revoluciones hispánicas,
Bd. 36 (Ensayos, Ediciones Encuentros, Madrid 2009).
34 Ar uivo di lom tico da inde end ncia, Vol. IV, Austria-Estados da Allemanha. Rio de Janeiro 1922-
25, S.108 hier Kossok, Legitimität gegen Revolution (1987a) 7.
35 Jean Descola, Les messagers de l´independance. (Paris 1973) 157; William Spencer Robertson, France
and Latin American Independence. (New York 21967) hier Kossok, Legitimität gegen Revolution (1987a)
7.
36 Ebend.7.
12
Pedro Ceballos (oder Cevallos) Guerra in einer Note an Metternich aus, indem er an den
Staatskanzler schrieb: „Die Revolution Amerikas ist die Revolution Euro as“.37
Der Koalition gegen Na oleon war, außer der „Monarchisierung“ der ortugiesischen Kolonie
Brasilien, kein weiterer Erfolg vergönnt. Mit britischer Hilfe war König João VI. im Novmber
1807 nach Rio de Janeiro geflohen. Begleitet wurde er von ungefähr 15.000 portugiesischen
Untertanen (Militärs und Zivilisten).38
João war nicht nur der erste portugiesische König in
Brasilien, er war überhaupt der erste europäische Monarch auf amerikanischen Boden. Rio de
Janeiro wurde 1808 Hauptstadt des Königreich Portugals, dessen europäisches Mutterland
bereits im Dezember 1807 in die Hände Frankreichs gefallen war. Trotz der „Befreiung“
Portugals von den Franzosen durch britische Truppen unter der Führung Wellingtons im August
1808, blieb João in den Tropen und kehrte nicht in das von den Briten besetzte Portugal zurück.
Stattdessen nutzte London die Anwesenheit des Monarchen, um in Südamerika Krieg gegen
Napoleon zu führen, wie dies die erwähnte Eroberung von Französisch Guyane demonstriert.
Durch die großen Veränderungen rückte die sogenannte Südamerikafrage in den Fokus des
politischen und ökonomischen Interesses der Großmächte am Wiener Kongress. Viele sahen im
möglichen Zusammenbruch des Kolonialsystems die Existenz Europas bedroht. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass noch während der Wiener Kongress tagte, König Ferdinand bereits im
Februar 1815 seinen General Pablo Morillo y Morillo mit insgesamt 65 Schiffen in die
„abtrünnigen“ Kolonien entsandte. Im April begannen die spanischen Truppen mit der
Rückeroberung des Generalkapitanats von Venezuela. Nach dem Sieg in Venezuela wandte sich
Morillo nach Westen und eroberte das Vizekönigreich Neugranada. Gegen Ende des Jahres 1815
war die spanische Kolonialherrschaft im nördlichen Südamerika wieder hergestellt. Der im Mai
1815 ins Exil nach Jamaika geflüchtete Simón Bolívar suchte bei den Briten und danach beim
haitianischen Präsidenten Alexandre Petion um militärische Unterstützung für den
Befreiungskampf gegen Pablo Morillo an und erhielt Waffen, Munition und Söldner (British
Legions). Mit dieser Unterstützung sowie neuen Bündnisse mit Piraten, Warlords und Libertos
gelang Bolívar ab 1817 die Rückeroberung der von Morillo eroberten Gebiete.
Auch in Mexiko, wo nach den Aufständen der beiden Priesterrevolutionäre Hidalgo und Morelos
1814 die liberale Verfassung von Apatzingan ausgerufen wurde, eroberten königstreue Truppen
mit spanischer Unterstützung im Laufe des Jahres 1815 weite Teile von Neuspanien zurück. Die
revolutionären Kräfte in Mexiko waren zu schwach, um das Vizekönigreich Neuspanien zu
beseitigen und erst mit der Ausrufung der Revolution von 1820 in Spanien, dem sogenannten
37 HHstA. Wien: Staatenabteilung Spanien. Differend concernant les Colonies Espagnoles 1817 a 1818.
Fasz. 185. Cevallos an Metternich vom 20.2.1818, fol. 251. hier Kossok, Legitimität gegen Revolution
(1987a) 7.
38 Laurentino Gomes, 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso, e uma corte corrupta
enganaram Napoleao e mudaram a história de Portugal e do Brasil. (Rio de Janeiro 2007).
13
Trienio Liberal (liberales Triennium) oder Trienio Constitucional, konnten sich die liberalen
Kräfte unter Agustín Cosme Damián de Iturbide in Mexiko durchsetzen.39
Nach der erfolgreichen Verteidigung von Buenos Aires gegen britische Angriffe 1806 und 1807
durch argentinische Milizen, gewann die Aufständischen im Vizekönigreich La Plata die
Oberhand, die den weiteren Verbleib bei Spanien ablehnten. In der Mairevolution von 1810
übernahm eine Junta in Buenos Aires die Macht, setzte den spanischen Vizekönig ab und
erklärte die Vereinigten Staaten am Rio de la Plata als neues Staatskonstrukt. Paraguay erklärte
jedoch 1811 seine Unabhängikeit von diesem „Staatskonstrukt“ und wurde 1813 endgültig ein
eigener unabhängiger Staat.
Abgesehen von der Frage wie man die Revolutionen in den Amerikas beenden und vor allem ein
Übergreifen auf Europa verhindern könnte, stellte man sich in Wien auch die Frage, wie man die
russische Expansion in den Amerikas einschätzen solle. 1799 war die Russisch-Amerikanische
Kompagnie als Monopolgesellschaft gegründet worden. Unter der Leitung von Nikolai
Petrowitsch Resanow und Alexander Andrejewitsch Baranow versuchte sie die gesamte
Pazifikküste Nordamerikas in Besitz zu nehmen. 1805 erreichten die Russen den spanischen
Handelsstützpunkt Yerba Buena in der Bucht von San Francisco, scheiterten jedoch noch mit der
Errichtung einer Kolonie in Kalifornien. Dies gelang erst 1809 Iwan Alexandrowitsch Kuskow
mit der Errichtung der russischen Kolonie Port Rumyantsev (Bodega Bay), 85 km nordwestlich
von San Francisco. Drei Jahre später, 1812, gründete Kuskow Fort Rossija (Fort Ross), etwa 145
km nordwestlich von San Francisco.40
Damit standen sich Russen und Spanier (ab 1821
Mexikaner) in Nordamerika bis 1841 gegenüber.
Im Gegensatz zur österreichischen Regierung, die Spaniens und Frankreichs Reconquista
in den Amerikas politisch in absolutistischer Treue zu den Bourbonenherrschern unterstützte,
gab es österreichische Untertanen, die von Staatskanzler Metternich mehr direktes Engagement
in Spanisch-Amerika und in den unabhängigen Republiken verlangten. Der Wiener Historiker
Rudolf Agstner fand im Österreichischen Staatsarchiv Informationen über den 1766 in Triest
geborenen Kaufmann August Emanuel Pérez, der in den Wirren der Napoleonischen Kriege nach
Kuba geflohen war.41
Pérez schrieb Metternich ab 1816 mehrere Briefe, in denen er die
Regierung bat, österreichische Honorarkonsulaten in New York, New Orleans, Haiti und
Havanna zu errichten und Kommerzagenten aufzustellen. Darüberhinaus sollte sich die
39 Sergio Guerra Vilaboy, El dilema de la independencia. (Havanna 2007).
40 Leonid Shur, The Khlebnikov archive. Unpublished journal (1800–1837) and travel notes (1820, 1822,
and 1824) (Fairbanks 1990); Lyn Kalani, Rudy Lynn/ John Sperry (Hg.), Fort Ross (Jenner, CA 1998).
41 HHStA, Administrative Registratur (AR), Fach (F) 4, Karton (K) 253. Zitiert nach Rudolf Agstner,
Von Kaisern, Konsuln und Kaufleuten, Bd. 2. Die k. (u.) k. Konsulate in Arabien, Lateinamerika,
Lettland, London und Serbien. (Forschungen zur Geschichte des österreichischen Dienstes, Bd. 7,
(Hamburg 2012).
14
Aufnahme von Handelsbeziehungen mit Hati für Österreich als vorteilhaft erweisen. Noch
deutlicher wurde Pérez bei der Frage, ob Österreich als Kolonialmacht in den Amerikas aktiv
werden sollte. 1820 schrieb Pérez an Metternich folgende Zeilen: „Wenn heute Österreich eine
Colonie in West-Indien an sich bringt, allen Nationen freyen Handel erlaubt, nota bene mit
niederen Zöllen – so ist es unausbleiblich, dass der Zulauf neuer Pflanzer sehr groß seyn wird –
weil sie unbeschränkten Absatz ihrer Erzeugnisse erlangen. Der Handel würde sich von
Westindien größtentheils in die österreichische Colonie ziehen, und die österreichischen
Producte und Manufacturen werden Gelegenheit eines großen Absatzes erlangen, und
Österreich würde sich alle Colonialwaaren mit Umtausch gegen ihre Erzeugnisse, und nicht
meist mit Geld, wie bisher, verschaffen. Auf die Frage, welche eine convenable Colonie für
Österreich wäre ist meine Antwort Porto Rico“42
.
Konklusionen
Österreichs Interessen um die Rückgewinnung der ehemaligen innereuropäischen Kolonie
„Österreichische-Niederlande“ wurden während des Wiener Kongresses zu Gunsten der
Vormachtstellung im deutschen Bund aufgegeben, um nicht zu sagen, fungierte der
Restaurationsanspruch auf die „Österreichischen Niederlande“ nur als strategisches Druckmittel.
Durch den Verzicht auf die atlantischen Häfen verspielte Österreich endgültig, die Chance
direkten Einfluss auf die Geschehnisse in Westafrika und den Amerikas zu nehmen, eine
Möglichkeit die beispielsweise die Hansestädte Hamburg und Bremen nutzten. Die
Verweigerung, die USA in einem frühen Stadium anzuerkennen, verbaute Österreich Handels-
und Wettbewerbsvorteile mit der aufstrebenden unabhängigen Macht in Nordamerika. Durch die
treue Unterstützung Spaniens und auch Frankreichs in den Amerikas ließ Wien die Möglichkeit
aus, als Kolonialmacht in Übersee aufzutreten. Nur im Falle von Portugal und Brasilien
versuchte Österreich durch die Eheschließung zwischen Kronprinzessin Leopoldine und dem
Prinzen Pedro 1817 Einfluss auf die Kolonialpolitik in Brasilien und die Bekämpfung der
Rebellenrepubliken (mittels der Heiligen Allianz) zu nehmen. Doch die „Bändigung der
Revolutionen“ erwies sich, so Eric Hobsbawm, „spätestens ab 1820 als vollständige
Fehleistung“.43
42 Ibidem.
43 Eric Hobsbawm, The age of revolutions, Europe 1789-1848 (London 1962) 136 f.