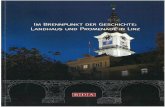Messung und Bewertung von Forschungsleistungen in Österreich
-
Upload
austrianinstituteoftechnology -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Messung und Bewertung von Forschungsleistungen in Österreich
Messung und Bewertung von Forschungsleistungen in Österreich
Externes Gutachten von Karl-Heinz Leitner
Version 08. Juni 2013
Austrian Institute of Technology
Donau-City-Strasse 1
1220 Wien
1
1. Einleitung
Das vorliegende Gutachten geht der Frage nach, wie österreichische Universitäten ihre
Forschungsleistungen erfassen, messen und bewerten.
Die Bewertung und Messung von Forschungsleistungen ist vor dem Hintergrund der
Rahmenbedingungen und Instrumente, die der Gesetzgeber mit dem UG 2002 gelegt hat und
das BMWF durch seine aktuelle Politik verfolgt, zu interpretieren. Gemäß UG gibt es folgende
Instrumente, die von besonderer Bedeutung für die Bewertung von Forschungsleistungen sind:
Leistungsvereinbarungen: Mit Hilfe der Leistungsvereinbarungen werden über eine Periode
von drei Jahren Globalbudgets für Universitäten allokiert, deren Höhe an Ziele und Leistungen
gekoppelt ist. 2012 erfolgten die Verhandlungen für die dritte Leistungsvereinbarungsperiode
2013-2015. Für die Forschung ist hier vor allem der Abschnitt B relevant, in dem die
Forschungsleistungen der Universitäten und deren Forschungsschwerpunkte dargestellt werden
und sodann Vorhaben und (möglichst überprüfbare) Ziele definiert werden. Im Abschnitt A
werden Angaben und Ziele zu Personalentwicklung und Qualitätsmanagement gemacht, die
ebenfalls direkt oder indirekt Auswirkungen auf die Art und Weise, wie Forschung bewertet
wird, haben können.
Die wichtigsten Ziele und Themen im Bereich Forschung im Rahmen der letzten
Verhandlungen von Seiten des BMWF waren, i) die Fortführung der Schwerpunkt- und
Profilbildung, ii) die Intensivierung der Kooperationen, iii) der Ausbau der
Internationalisierung, iv) der strategische Ausbau der Forschungsinfrastruktur sowie v) die
weitere (quantitative oder qualitative) Entwicklung der Drittmitteleinwerbung.
Die Bündelung und Ausrichtung der Forschungstätigkeiten auf Forschungsschwerpunkte ist ein
wichtiges und längerfristiges Ziel der Hochschul- und Forschungspolitik. Bereits im Rahmen
der Erstellung der ersten Entwicklungspläne und Leistungsvereinbarungen in den Jahren 2004
und 2005 begannen Universitäten mit der Formulierung von Forschungsschwerpunkten. Die
gesamtuniversitären „Forschungsschwerpunkte“ werden von den Universitäten explizit als
Forschungsschwerpunkte (Bsp. Universität Innsbruck), aber auch als Forschungscluster (Bsp.
Medizinische Universität Wien), Forschungsfelder (Medizinische Universität Graz), oder
Fields of Expertise (Technische Universität Graz) bezeichnet.
Bisherige Analysen und Stellungnahmen zur Umsetzung und Ausgestaltung von
Leistungsvereinbarungen zeigen dabei jedoch, dass Vorhaben und Ziele sehr unterschiedlich
operationalisiert sind und eine nachvollziehbare und objektive Bewertung der Zielerreichung
bzw. tatsächlichen Forschungsleistungen bei vielen Vorhaben und Zielen kaum möglich ist
oder wenig Aussagekraft enthält.1
Zielvereinbarungen: Diese stellen das universitätsinterne Instrument zur Verteilung des
Globalbudgets auf die einzelnen Organisationseinheiten einer Universität (Fakultäten,
Departments, Zentren, Kliniken, etc.) dar. Der Gesetzgeber hat dazu jedoch keine expliziten
Angaben gemacht und schreibt nur in §22 Abs 1, dass es Aufgabe des Rektorates ist, mit den
LeiterInnen der Organisationseinheiten Zielvereinbarungenen abzuschließen. Im Weiteren heißt
1 Vgl. dazu die Stellungnahme durch den Wissenschaftsrat und den Rechnungshof.
2
es sodann, dass die Zielvereinbarung die im Rahmen der Leistungsvereinbarung
gesamtuniversitär eingegangenen Verpflichtungen konkretisieren und ihre Umsetzung
sicherstellen.
Hochschulraumstrukturmittel (vormals Formelbudget): Im Rahmen einer Novelle des UG
wurde im Sommer 2012 das Instrument der Hochschulraum-Strukturmittel (HRSM) eingeführt.
Damit wurde die leistungsorientierte Finanzierung in Form des Formelbudgets durch einen
neuen Allokationsmechanismus abgelöst. Das Formelbudget wurde mit dem UG 2002
eingeführt und für die Finanzierung einer eigenen Budgetkomponente im Zeitraum von 2004-
2012 angewendet. Mit der Anzahl der prüfungsaktiven Studierenden, der Anzahl der
Studienabschlüsse und den Einnahmen aus F&E-Projekten wurden beim Formelbudget drei
Indikatoren verwendet, die in adaptierter Form nun auch beim Verteilungsmodell der
Hochschulraum-Strukturmittel zur Anwendung kommen.2 Neben dem Grundbudget, das
weiterhin auf Basis von Leistungsvereinbarungen definiert wird, werden für die LV-Periode
2013 und 2015 Hochschulraum-Strukturmittel verteilt.
Evaluierungen: Laut § 14 des UG sind österreichische Universitäten zur Durchführung von
Evaluierungen verpflichtet, wobei universitätsinterne Evaluierungen nach Maßgabe der
Satzung regelmäßig durchzuführen sind. Weitere Angaben gibt es von Seiten des UG nicht,
wohl gibt es in Österreich aber eine gängige und gelebte Praxis (inkl. Foren, Arbeitsgruppen,
etc.), die sich an den internationalen Standards orientiert.
Wissensbilanzen: Mit dem UG 2002 wurden österreichische Universitäten dazu verpflichtet,
Wissensbilanzen zu erstellen. Dabei sind mehr als 30 Indikatoren (die durch eine entsprechende
Verordnung genau definiert werden) jährlich auszuweisen, die über die Inputressourcen,
Prozesse und Outputs Auskunft geben. Für die Forschung im besonderen Maße relevant sind
die Kennzahlen zu den Drittmitteln und den Publikationen, liefern diese doch eine mögliche
Basis für die Leistungs- und Zielvereinbarungen. Die Wissensbilanz wird seit ihrer Einführung
kontrovers diskutiert und vielfach kritisiert, steht sie doch bereits von ihrer Begrifflichkeit für
eine quantitative Bewertung von Forschungsleistungen.
Qualitätsmanagement: Neben der Durchführung von regelmäßigen Evaluierungen sind die
Universitäten gemäß UG auch verpflichtet, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen.
Entsprechende Vorhaben werden seitdem auch im Rahmen der Leistungsvereinbarungen
definiert. Qualitätsmanagementsysterme an Universitäten nutzen unterschiedlichste quantitative
und qualitative Verfahren um die Qualität von Forschung und Lehre zu erhöhen.
Rankings und Benchmarking spielen in Österreich bislang eine untergeordnete Rolle. Zwischen
2009-2010 wurde im Rahmen einer Arbeitsgruppe das Thema Benchmarking diskutiert, jedoch
nicht weiter verfolgt. Das BMWF hat jüngst im Rahmen der Leistungsvereinbarung und von
Pilotprojekten das Thema Benchmarking und Rankings mit einigen Universitäten vereinzelt
thematisiert.
Die hier kurz skizzierten Instrumente legen das Korsett für die Bewertung und Steuerung von
Forschung an österreichischen öffentlichen Universitäten. Es kann davon ausgegangen werden,
dass diese Instrumente unterschiedlich ausgestaltet und angewendet werden, zumal der
2 Die Evaluierung der Formelbudget-Verordnung kam in diesem Zusammenhang zum Ergebnis, dass die
verwendete Formel zu komplex und damit auch intransparent sei.
3
Gesetzgeber (UG) den Universitäten einen Gestaltungsspielraum gewährt (Bsp. bei
Evaluierungen oder der internen Allokation der Budgets). Im Rahmen des vorliegenden
Gutachtens wird an Hand von ausgewählten Universitäten untersucht, was die gelebte Praxis an
österreichischen Universitäten ist.
Strategie- und Profilbildung ist ein wichtiges Ziel, deshalb ist auch von Interesse, in welchem
Ausmaß und wie Forschungsschwerpunkte mit Hilfe von unterschiedlichen Instrumenten und
Möglichkeiten bewertet werden.
Im Fokus dieses Gutachtens steht die Darstellung der Praxis an österreichischen Universitäten.
Die vielfach in der Literatur dokumentierten Vor- und Nachteile von qualitativen und
quantitativen Verfahren werden hier nicht näher diskutiert.3 Auf die Frage der Bewertung der
Geistes- und Sozialwissenschaften wird hier im Besonderen eingegangen.
Die Studie basiert auf der Analyse von Unterlagen der Universitäten (Leistungsvereinbarungen,
Zielvereinbarungen, Satzungen), auf Ergebnissen früherer Studien durch den Autor4 sowie
Interviews mit VertreterInnen der Universitäten, wobei hier vor allem mit MitarbeiterInnen aus
dem Rektorat, die für Zielvereinbarung, Forschungsdokumentation, Qualitätsmanagement und
Evaluierung zuständig sind, Interviews geführt wurden. Ausgewählt für eine vertiefende
Analyse wurden die Volluniversitäten Wien, Innsbruck, Graz und Salzburg (diese haben
jeweils auch geisteswissenschaftliche Fakultäten) sowie die TU Graz als Vertreter eine
technischen Universität sowie die Medizinische Universität Innsbruck als Repräsentant der
medizinischen Universitäten. Nicht näher eingegangen wurde auf die Kunstuniversitäten.
2. Messung und Bewertung der Forschungsleistung an österreichischen
Universitäten
Im Folgenden wird die Praxis der Bewertung von Forschungsleistungen an ausgewählten
österreichischen Universitäten untersucht. Vor dem Hintergrund der oben angeführten
Rahmenbedingungen wird dabei jeweils auf folgende Themen eingegangen:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Evaluierung
Wissensbilanz
Rankings
3 Für eine Diskussion siehe z.B: Wissenschaftsrat (2011): Empfehlungen zur Bewertung und Steuerung von
Forschungsleistung. Drs. 1656-11. Köln: WR; Bittner, S., Hornbostel, S. und Scholze, F. (Eds.) (2012):
Forschungsinformation in Deutschland: Anforderungen, Stand und Nutzen existierender
Forschungsinformationssysteme. Workshop Forschungsinformationssysteme 2011. iFQ-Working Paper No.10.
Berlin. 4 Vgl. Heller-Schuh, B., Leitner, K-H. (2012): Ergebnisse der Forschungsinfrastrukturerhebung an Universitäten
im Kontext der Leistungsvereinbarungen 2013-2015, Auftragsprojekt für das Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung, AIT-F&PD-Report, Vol. 61, August, Wien
4
2.1. Universität Wien
Die größte Universität Österreichs mit einer großen fachlichen Breite setzt universitätsintern
folgende Instrumente zur Messung und Bewertung von Forschungsleistungen ein:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
In der aktuellen Leistungsvereinbarung werden im Bereich Forschung unter anderem Vorhaben
und Ziele im Zusammenhang mit der Ausbildung von DoktorandInnen, der Akquisition von
EU-Forschungsprojekten sowie der Weiterführung und Stärkung der Forschungsplattformen
definiert. Die Universität Wien hat Forschungsschwerpunkte auf Ebene der Fakultäten definiert
und insgesamt 19 Forschungsplattformen etabliert, die fakultätsübergreifend bzw.
interdisziplinär ausgerichtet sind. Quantitative Ziele in Bezug auf den Forschungsoutput oder
die Entwicklung einzelner Fakultäten oder Disziplinen werden in der Leistungsvereinbarung
nicht definiert.
Zielvereinbarungen werden mit allen Fakultäten abgeschlossen. Für die Zielvereinbarungen
gibt es innerhalb der Universität Wien eine Vorlage (inkl. Fragen, die zu beantworten sind), die
ähnlich strukturiert ist wie die Leistungsvereinbarung und Ziele und Vorhaben im Bereich
Forschung, Lehre und Personal vorsieht. Bei allen Zielvereinbarungen wird standardmäßig ein
Set an Indikatoren verwendet, die zu einem Teil auf den Wissensbilanz-Kennzahlen beruhen
und zentral aufbereitet werden.
Zusätzlich werden noch einige spezifische und weiter differenzierte Kennzahlen ausgewiesen,
vor allem um die Qualität des Forschungsoutputs besser abzubilden. Unter anderem werden die
Publikationen im Hinblick auf die Mehrsprachigkeit ausgewertet, denn so ist es gerade in den
Geistes- und Kulturwissenschaften häufig wichtig, in einer spezifischen Sprache zu publizieren.
Darüber hinaus ist die Universitätsleitung bestrebt, die Qualität der Publikationen für die
unterschiedlichen Fachbereiche zu bewerten. Gemeinsam mit den Fakultäten wurde hier ein
Ranking wichtiger Publikationsmedien vorgenommen. Während dies in der Physik oder
Volkswirtschaft einfacher ist, stellt es in den Geisteswissenschaften größere Herausforderungen
dar. In der Vergangenheit hat man hier beispielsweise die ERIH (European Reference Index for
the Humanities)-Listen der ESF genutzt (wenngleich hier noch keine allgemein akzeptierte
Vorgehensweise gefunden wurde und diese derzeit bis auf weiteres nicht mehr genutzt
werden). Was Monographien betrifft, wird versucht weiter zu differenzieren, welche Qualität
die Verlage haben (Lektorat, Reviewprozess etc.). Open Access ist ebenfalls ein Thema in den
Zielvereinbarungen (auch der Anteil der Open Access Publikationen), mit dem versucht wird,
eine Qualitätssteigerung voranzutreiben. Bei den Vorträgen versucht die Universität Wien
ebenfalls differenziert die Qualität zu bestimmen, in dem beispielsweise der Anteil der Key
Notes und dgl. separat ausgewiesen wird. Bei Postern wird zwischen der Kategorie national
und international differenziert. Die Drittmittel werden ebenfalls differenziert ausgewiesen.
Insgesamt ist ein übergeordnetes Ziel, im Rahmen der Darstellung des Publikationsoutputs die
Anzahl der peer reviewed Publikationen zu erhöhen bzw. das Niveau zu halten
(Qualitätssteigerung). Daneben ist der Ausbau der Drittmittel für alle Fakultäten – nach
Maßgabe ihrer Möglichkeiten – ein wichtiges Ziel, auch hier werden Vorgaben für jede
Organisationseinheit definiert.
5
Neben Vorgaben, die sich direkt aus den Leistungsvereinbarungen ableiten lassen, sind Ziele
und Schwerpunkte, die sich aus dem Entwicklungsplan ergeben, wesentlicher Input für die
Gestaltung der Zielvereinbarungen, die an der Universität aktuell für zwei Jahre (in der
Vergangenheit für ein Jahr) definiert werden. Im Fokus stehen hier vor allem die Berufungen
bzw. Widmungen, die wesentlich die inhaltliche Ausrichtung zum Ausdruck bringen.
Evaluierungen
Evaluierungen werden alle 5 Jahre auf Ebene der Fakultäten durchgeführt. Hier wird, wie bei
allen anderen hier untersuchten Universitäten, zunächst ein Selbstevaluierungsreport von Seiten
der WissenschaftlerInnen verfasst, der sodann an die Peers geht. Auch für die Durchführung
von Evaluierungen gibt es einen standardisierten Vorlage samt Fragen sowie auch einen
standardisierten Kennzahlen-Anhang (Personal, Drittmittel, Publikationen). Dieser Leitfaden
wird in einem gewissen Umfang auch auf für Spezifika der einzelnen Fakultäten adaptiert
(Umfang, Kennzahlen). Bei den Fakultäten, bei denen die Daten in ausreichender Qualität zur
Verfügung stehen (vor allem Naturwissenschaften) fließen auch bibliometrische Analysen ein
(hier erfolgt eine Analyse im internationalen Vergleich, es wird jedoch keine Reihung auf Basis
von Hirsch-Indices oder dgl. durchgeführt). Bei den Geisteswissenschaften ist die Universität
Wien sehr stark eingeschränkt, was die Möglichkeiten und Aussagekraft von Indikatoren
betrifft. Die Frage nach der Nennung der zehn wichtigsten Publikationen soll die
WissenschaftlerInnen und Peers bei ihrer Bewertung unterstützen.
Die Erkenntnisse aus den Evaluierungen fließen nach Angaben des Qualitätsmanagers der
Universität Wien wiederum in die Zielvereinbarungen der Universität ein. Wenngleich hier
unterschiedliche Zyklen (Leistungsvereinbarungen: 4 Jahre, Zielvereinbarungen: 2 Jahre,
Evaluierungen: 5 Jahre) vorliegen, wird hierin kein grundsätzliches Problem gesehen, haben
doch Empfehlungen von Seiten der Gutachter häufig einen längerfristigen Horizont (Bsp.
Ausbau von Professuren).
Forschungsplattformen werden auf Antrag eingerichtet, wozu es alle 2 Jahre Ausschreibungen
gibt. Es gibt sodann eine erste Evaluierung des Antrags und bei Bewilligung nach drei Jahren
eine Zwischenevaluierung. Ist diese positiv, werden die Plattformen um drei Jahre verlängert
und weiter ko-finanziert. Im Weiteren werden sie als Forschungszentrum an einer Fakultät
verankert.
An der Universität Wien werden überdies auch im Rahmen von Neuberufungen und auf
Wunsch der Berufungskommission bibliometrische Analysen der BewerberInnen durchgeführt.
Wissensbilanz
Die Universität Wien nutzt Wissensbilanz-Kennzahlen im Rahmen von Evaluierungen und
Zielvereinbarungen. Wie oben angeführt werden zusätzlich noch weitere differenziertere
Indikatoren erhoben.
Rankings und Benchmarking
Derzeit spielen Rankings oder Benchmarking keine direkte Rolle für die Bewertung und
Steuerung der Forschung. Gegenwärtig wird jedoch an der Universität Wien diskutiert, sich am
U-Muli-Ranking der Europäischen Union zu beteiligen. Aus Sicht der Universität Wien ist es
6
dabei wichtig, dass Benchmarking und Rankings vor allem auf Ebene der Fachgebiete
durchgeführt werden.
Zusammenfassung
Einige Befunde können an dieser Stelle kurz zusammengefasst werden:
Die Methode der Bewertung von Forschungsleistung im Rahmen von Evaluierungen wird
von der Universität Wien als informed peer review bezeichnet.
Im Allgemeinen wird konstatiert, dass im Rahmen der Evaluierungen stärker auf die
Fachspezifika eingegangen wird bzw. werden kann, während die Zielvereinbarungen
weniger Spielraum bieten, Unterschiede zwischen den Disziplinen zu berücksichtigen
(trotz des oben angeführten Versuchs, Qualitäten bei den Outputs differenziert
darzustellen).
Was die Geisteswissenschaften betrifft, wird bekräftigt, dass die Leistungen hier schwerer
zu erfassen und zu messen sind, gleichzeitig wird aber auch hier versucht, etwa durch die
Definition der Publikationsorgane (Bsp. Monographien in angesehenen Fachverlagen
anstelle von Eigenverlagen) die Qualität zu messen und damit zu erhöhen (indirekte
Wirkung). Mit internationalen Rankings von Publikationsmedien wurde hier auch
experimentiert, jedoch konnte bislang noch kein Konsens erzielt werden.
2.2. Universität Innsbruck
Die Praxis der Bewertung und Messung von Forschungsleistungen zeigt sich an der
zweitgrößten Volluniversität Österreichs wie folgt:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Die aktuelle Leistungsvereinbarung zwischen der Universität Innsbruck und dem BMWF
versucht vergleichsweise viele Ziele zu einzelnen Outputs zu quantifizieren und deren
Zielerreichung nachvollziehbar messbar zu machen. Als eine der wenigen Universitäten (auch
die medizinischen können in diesem Zusammenhang angeführt werden) werden hier Ziele für
den Publikationsoutput und von Co-Publikationen explizit ausgewiesen.
Die Zielvereinbarung ist ähnlich aufgebaut wie die Leistungsvereinbarung und beschreibt Ziele
im Bereich Forschung, Lehre, Personal und Forschungsinfrastruktur. Insgesamt ist man
bestrebt, in den aktuellen Zielvereinbarungen weniger aber dafür sehr spezifische Ziele und
Vorhaben zu definieren.
Im Prozess der Verhandlung der Zielvereinbarung gibt es dabei sowohl von Seiten des
Rektorats gewisse Zielvorstellungen und Vorgaben als auch von Fakultätsseite. Dabei werden
sowohl qualitative als auch quantitative Vorgaben bzw. Ziele definiert. Dies reicht von einer
Steigerung der Web of Science Publikationen bis hin zu Vorhaben wie der Errichtung eines
„Hauses der Physik“. Dabei wird es als wichtig erachtet, auf die unterschiedlichen Disziplinen
einzugehen: so wird etwa bei der Verhandlung mit den Architekten der Schwerpunkt nicht auf
der Erhöhung der Web of Science Publikationen gelegt, da dies dort weder möglich noch
Kultur ist, im Gegensatz dazu kommt von den Physikern häufig selbst der Impuls, bestimmte
7
Publikationen in ausgewählten Top-Zeitschriften zu platzieren. Damit versucht man realistische
und der Wissenschaftskultur angemessene Ziele für jede einzelne Fakultät zu definieren.
Evaluierungen
In den letzten Jahren wurden alle Fakultäten der Universität Innsbruck evaluiert. Für die
Evaluierung der Forschung gibt es dazu eine spezifische Evaluierungsverordnung.5 Evaluierung
dient dabei gemäß der Satzung der „Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung der an der
Universität Innsbruck verfolgten Ziele und Kernaufgaben.“ Dabei wird unter §5, Abs. 1 zu den
Grundlagen und Maßstäben der Evaluierung angeführt: „Grundlagen der Evaluierung sind die
Forschungsleistungsdokumentation, die Kennzahlen für das universitäre Berichtswesen und
weitere geeignete Kennzahlen, der Selbstbericht und Gutachten interner sowie externer
Fachleute, einschließlich der Studierenden.“ In § 6, Abs.1 zu den Kriterien der Evaluierung
wird definiert: „Die Evaluierung der Leistungen in der Forschung hat festzustellen, ob die
Leistungen im Hinblick auf die in § 5 genannten Maßstäbe erreicht worden sind. Dabei sind
unter anderem die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:
1. wissenschaftliche Publikationen,
2. wissenschaftliche Vorträge,
3. wissenschaftliche Projekte,
4. Leistungen für die Scientific Community.“
Den Kern der Evaluierung bildet ein Selbstbericht, der eine Auflistung der Leistungen zu
enthalten hat, die auch in universitären Datenbanken abrufbar sind. Dieser Selbstbericht wird
sodann von mindestens zwei extern bestellten Gutachtern bewertet. Evaluierungen sind gemäß
Satzung alle fünf Jahre durchzuführen. Gegenstand der Evaluierung sind dabei sowohl die
Organisationseinheiten gemäß Organisationsplan wie auch Professoren, Dozenten und
wissenschaftliche Mitarbeiter.
Evaluierungen von Fakultäten und Personen starten immer mit einem Selbstbericht, bei dem
Kennzahlen eine fixer Bestandteil sind, welche von der Forschungsinformationsstelle geliefert
werden. Die quantitativen Kenngrößen stehen bei den Selbstberichten jedoch nicht im
Mittelpunkt sondern stellen nach Angaben des befragten Vertreters der Universität eine
Ergänzung dar, - in diesem Sinn kann hier von der Praxis eines informed peer review
gesprochen werden. Im Selbstbericht ist jede Fakultät gefordert, sich darzustellen. Die
Forschungsinformationsstelle liefert dazu ein Basis-Set von Kennzahlen, auf Wunsch werden
auch avanciertere Analysen wie H-Indices, Zitationsraten, und dgl. durchgeführt. Wenngleich
es einen Leitfaden gibt, steht die Gestaltung des Selbstreports den Fakultäten weitgehend offen.
Nach Angaben des befragten Vertreters der Universität Innsbruck unterscheiden sich die
Selbstberichte sehr stark und reflektieren die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen (z.B.
eher qualitativ bis hin zu quantitativ mit H-Indices für jedes Institut, oder Darstellung der Top-
Publikationen jedes Wissenschaftlers). Kenngrößen werden dabei auch als etwas gesehen, dass
den Gutachtern wichtige Rahmeninformationen liefern. Die Möglichkeiten der
Selbstdarstellung sind damit sehr groß, und es ist dann die Aufgabe der Gutachter, dies im
jeweiligen wissenschaftlichen Kontext zu bewerten.
5 Mitteilungsblatt 15 June 2011, Satzungsteil Evaluierung gemäß § 19 Abs 2 Z 3 Universitätsgesetz 2002.
8
Neben den Fakultäten werden an der Uni Innsbruck auch die Forschungsschwerpunkte,
Forschungsplattformen und Forschungszentren evaluiert. Die Kriterien für die Bewertung sind
laut Universität (nicht in der Satzung definiert):
1. Exzellenz (das wichtigste Kriterium, verwendet werden Publikationen, Vorträge,
Dissertationen, Habilitationen)
2. Internationalität (Fragen und Kriterien wie EU-Mittel, Konferenzen, Publikationen,
Forschungskooperationen, etc. hier werden auch Fragebögen verwendet)
3. Kohärenz (Fragen nach der Vernetzung der beteiligten Forscher innerhalb der Uni; es
werden Drittmittelprojekte von Habilitierten bewertet und in welchen Ausmaß
fächerübergreifend Projekte durchgeführt werden; Basis ist die Personaldatenbank der
Uni)
4. Drittmittel (=Summe der eingeworbenen Drittmittel)
Die Faktoren Exzellenz, Kohärenz und Drittmittel werden ausschließlich quantitativ bewertet,
Internationalität tlw. auch qualitativ.
Bei der Bewertung der Forschungsschwerpunkte (es gibt sowohl naturwissenschaftliche und
technische als auch sozial- und geisteswissenschaftliche) wird seit 2012 bewusst ein
einheitliches Raster verwendet. Universitätsintern war die Devise dabei: „Wir belohnen Web of
Science Publikationen“. Wie zu erwarten, gab es hier die Rückmeldung, dass dies in den
Geistes- und Sozialwissenschaften problematisch sei, da hier die Publikationsmedien kaum
vorhanden sind. Von Seiten des Forschungsmanagements wurde darauf reagiert, indem
möglichst viele unterschiedliche Publikationsformen berücksichtigt wurden, wobei
unterschiedliche Medien verschieden gewichtet werden. Es gibt Beiträge im Web of Science,
Beiträge in Sammelwerken (inkl. Kunstkatalogen), Bücher und sonstige wissenschaftliche
Beiträge.6 Diese werden mit den Faktoren 2, 1 und 0,5 gewichtet und machen insgesamt rund
25% des Faktors Exzellenz aus. In einer ähnlichen Weise wurden auch die Vorträge gewertet.
Auch hier wurden unterschiedliche Typen klassifiziert und gewichtet (Bsp. Key Note auf einer
internationalen Konferenz, Nationale Tagung, etc.). Sämtliche Daten werden aus der internen
Forschungsdokumentationsdatenbank gezogen.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass die Nutzung eines einheitlichen Bewertungssystems und
die starke Quantifizierung vor allem damit begründet wird, dass man nur dadurch eine
Gesamtsicht auf die sehr heterogenen Felder erhalten kann. Als Beispiel wird hier der
Forschungsschwerpunkt Alpiner Raum angeführt, bei dem Historiker, Biologen, Geologen,
Soziologen und dgl. kooperieren.
An der Uni Innsbruck wurde auch diskutiert, die Forschungsschwerpunkte ähnlich wie die
Evaluierung der Fakultäten auf Basis eines Peer-Reviews zu evaluieren. Auf Grund der starken
Heterogenität ihrer Ausrichtung hätte die Universität Innsbruck nach eigenen Angaben eine zu
große Anzahl von Peers pro Forschungsschwerpunkt bestellen müssen. Das wäre vom
Aufwand nicht machbar gewesen, weshalb man sich auf eine quantitative Methode geeinigt hat.
6 Diese Verteilung war ein Kompromissvorschlag, denn ursprünglich wollte das Rektorat eine höhere Bewertung
der Web of Science Beiträge. Es wurden jedoch im Vorfeld Modellrechnungen durchgeführt, die gezeigt haben,
dass die Naturwissenschaften stark gewonnen hätten, weshalb Zeitschriftenbeiträge und Buchbeiträge letztlich
gleich gewertet wurden.
9
Der Bewertungsraster wird aber durchaus unterschiedlich interpretiert bzw. es wird auf
unterschiedliche Parameter fokussiert. So spielt etwa die Drittmittelquote in den
Naturwissenschaften eine größere Rolle als in den Geisteswissenschaften oder der Architektur.
„Man hat zwar den gleichen Rahmen abgesteckt, aber man schaut sich jeden Schwerpunkt
etwas anders an“, so der interviewte Mitarbeiter der Universität. Es gab auch Versuche, auf
Ebene der Forschungsschwerpunkte die Top 5 Publikationen auszuwählen: darauf konnten sich
aber die WissenschaftlerInnen nicht einigen, weshalb diese Idee schnell wieder verworfen
wurde.
Wissensbilanz
Die Universität Innsbruck hat die Wissensbilanz und den Aufbau einer zentralen Datenbank zur
effizienten und effektiven Erhebung und Analyse der Kennzahlen mit großem Engagement
betrieben mit dem Ziel, nicht nur den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen sondern die
Kennzahlen für die interne Steuerung zu nutzen. Organisatorisch ist die Stabstelle für
„Forschungsinfrastruktur und Wissensbilanz“ für die Bewertung der Forschungsleistungen
verantwortlich. Die möglichst umfassende und vollständige Erfassung und Dokumentation der
Forschungsleistungen (vor allem Publikationen) ist dabei eine Kernaufgabe.
Rankings
Die Universitätsleitung analysiert auch die Position der Universität Innsbruck in Rankings
(auch im Vergleich mit anderen österreichischen Universitäten), wobei, wenn möglich, die
Position in einzelnen Fachbereichen berücksichtigt wird.
Eine echte Steuerungsfunktion wird Rankings jedoch nicht beigemessen, zum einen da höchst
unterschiedliche Kennzahlen in diversen Rankings verwendet werden, zum anderen da die
Kenngrößen schwer beeinflussbar sind, wenn man etwa an die Zahl der Studierenden und das
Betreuungsverhältnis denkt. Bei Entscheidungen zu Berufungen, Studienprogrammen und dgl.
wird folglich nicht auf das mögliche Abschneiden in Rankings Bedacht genommen.
Zusammenfassung
Die Universität Innsbruck hat derzeit ein stark von Naturwissenschaftlern dominiertes
Rektorenteam, was zu einem gewissen Ausmaß die aktuell vergleichsweise starke
Orientierung auf Kenngrößen und quantitative Bewertungsmethoden erklärt.
An der Universität Innsbruck wird die Messung und Bewertung von Forschungsleistungen
weitgehend nach Kriterien, wie sie durch Leistungsvereinbarung und Wissensbilanz und
damit vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Die wichtigsten Kriterien zur Beurteilung der
Forschungsleistungen innerhalb der Universität (Fakultäten und Institute) sind Drittmittel
und Publikationen, letztere wie oben angeführt noch weiter differenziert und gewichtet.
Die Notwendigkeit einer relativ starken Quantifizierung wird an der Universität auch damit
begründet, sich nach außen bzw. in der Leistungsvereinbarung gesamthaft als Organisation
darzustellen, wie auch ein Vertreter der Universität Innsbruck bekundet: „Wie sollte man
eine 16 Fakultäten umfassende Universität adäquat darstellen, wenn man nicht irgend
welche Kenngrößen verwendet? Man muss dann einfach darstellen, welche Drittmittel die
gesamte Uni einwirbt, wie viele Studierende sie hat und dgl.“
10
Insgesamt hat die Quantifizierung und Nutzung von Indikatoren in der Bewertung von
Forschungsleistungen nach Einschätzung der Universität Innsbruck in den letzten Jahren
zugenommen. Die Ausgestaltung der Zielvereinbarungen dokumentiert diese Entwicklung.
So gibt es in den aktuellen Zielvereinbarungen mit jeder Fakultät die Vorgabe, dass - im
Rahmen ihrer Möglichkeiten - eine Steigerung der Web of Science Publikationen
angestrebt werden sollte. Das wäre nach Angaben des befragten Vertreters der Universität
Innsbruck vor 10 Jahren noch nicht möglich gewesen. Wenngleich die Rolle von
Indikatoren zugenommen hat, wird besonders bei Evaluierungen darauf geachtet, dass
diese komplementär zu einer qualitativen Bewertung von Forschungsleistungen verwendet
werden, - ganz im Sinne eines informed peer review.
Die Universität Innsbruck hat mit der Wissensbilanz und einer zentral organisierten
Datenbank für Forschungsdokumentation, die den Qualitätsstandards entspricht, eine sehr
gute Datenbasis. Diese erklärt auch, warum die Universität Innsbruck die interne Praxis der
Steuerung und Bewertung von Forschung ein Stück quantitativer als an anderen
Universitäten betrachtet.
2.3. Universität Graz
Die Praxis der Bewertung und Messung von Forschungsleistungen an der Universität Graz
kann wie folgt beschrieben werden:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Gemeinsam mit den medizinischen Universitäten ist die Universität Graz diejenige Universität,
die Forschungsoutput in Form der Anzahl der Publikationen, differenziert nach
Wissenschaftsdisziplinen, in der Leistungsvereinbarung besonders stark quantifiziert. Darüber
hinaus führt die Uni Graz auch ein explizites Ziel an, was die Drittmitteleinnahmen betrifft.
Die Universität Graz formuliert umfangreiche Zielvereinbarungen mit den einzelnen
Fakultäten, die teilweise im Internet abrufbar sind und somit auch der Öffentlichkeit zugänglich
sind, was den Wunsch nach Transparenz widerspiegelt.
Im Rahmen der Verhandlungen zu den Zielvereinbarungen gibt es intensive und kontroverse
Diskussionen mit allen Fakultäten über die unterschiedlichen Zielsetzungen und die Bewertung
und Gewichtung der Forschungsleistungen. Die Frage, in welchen Publikationsorganen
(Qualität) wie viel publiziert wird (Quantität) steht bei allen Verhandlungen an der
Tagesordnung. Insgesamt versucht auch hier das Rektorat in Richtung hochwertigere Organe
zu gehen, bei Büchern etwa weg von Eigenverlagen hin in Richtung Fachverlage. Die Priorität
liegt aktuell im Anheben der Qualität, dies heißt, dass Ziele in Bezug auf die Quantität derzeit
zurückhaltend formuliert werden, was selbst eine Reduktion des Outputs bedeuten kann.
Der Anstieg der Drittmittel ist ebenfalls ein in jeder Zielvereinbarung ausverhandeltes Ziel.
Wie zu erwarten, sind die Möglichkeiten für die Geistes- und Sozialwissenschaften hier
eingeschränkt, was auch entsprechend Berücksichtigung findet. Erste Versuche, die
Transferleistungen der Geisteswissenschaften expliziter darzustellen und wenn möglich zu
messen, konnten bislang nicht realisiert werden.
11
Indikatoren spielen in der Zielvereinbarung insgesamt eine relativ große Rolle, um die
Zielerreichung letztlich auch besser messbar zu machen. Diese werden auf Ebene der einzelnen
Wissenschaftsdisziplinen und teilweise bis auf Institutsebene differenziert definiert.
Mittelfristig kann man sich vorstellen, Ziele bis auf Ebene der MitarbeiterInnen runter zu
brechen. Während also der Publikationsoutput bereits quantifiziert wird, werden an der
Universität Graz keine Vorgaben im Hinblick auf Zitationen oder Impactfaktoren durchgeführt.
Die Berücksichtigung der Fachkulturen – an der Uni Graz Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften sowie Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ist ein
permanentes Spannungsfeld. Bei der Definition der Zielwerte wird auf unterschiedliche
Besonderheiten der einzelnen Fakultäten und Fachdisziplinen weitgehend eingegangen,
wenngleich der Trend, dass auch in den Geisteswissenschaften verstärkt in Zeitschriften
publiziert wird ein starker ist; dieser wird von Seiten des Rektorats gefördert, von Seiten der
WissenschaftlerInnen unterschiedlich aufgenommen.
Ein interviewter Vertreter der Universität Graz spricht, was die Rolle der Indikatoren betrifft,
wörtlich vom informed decision making und einer zunehmenden Objektivierung der
Entscheidungen (vor allem auch in Richtung Budgets). Bei der Analyse von Kennzahlen bzw.
deren Nicht-Erreichung wird dabei auch immer untersucht, warum diese nicht erreicht worden,
etwa ob Ziele ambitioniert waren, Professoren einen Ruf erhielten, oder Studierendenzahlen
stark nach oben stiegen oder nach unten sanken. Eine direkte Koppelung zwischen
Kennzahlenwert und Budgetierung gibt es jedoch nicht, vor allem auch, da hier die Gefahr
besteht, dass WissenschaftlerInnen und Institute direkt in die Optimierung einzelner
Kennzahlen verfallen würden. Die Philosophie ist hier: ForscherInnen bzw. Institute erhalten
finanzielle Mittel, um Ziele zu erreichen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Mechanismus,
demzufolge ein bestimmter Anteil des Budgets am Ende der Periode einbehalten werden kann
(rund 2% des Budgets, Pönale). Dies kam in der Vergangenheit beispielsweise in einem Fall
zum Tragen, als nicht wie vereinbart Mitarbeitergespräche durchgeführt wurden.
Die Universität Graz hat jüngst auch die Hochschulraumstrukturmittel (HRSM) adaptiert. Wie
alle anderen Universitäten werden die Mittel aus dem HRSM (bzw. dem früheren
Formelbudget) intern auf die unterschiedlichen Organisationseinheiten, demselben
Berechnungsmodus folgend, berechnet. Allerdings möchte die Universität Graz intern nach wie
vor die Förderung von Frauen auch mit diesem Instrument vorantreiben (im älteren
Formelbudget gab es hier einen entsprechenden Indikator) und hat die Formel für interne
Zwecke angepasst.
Ergebnisse der Evaluierungen werden (wenn zeitlich nicht zu lange entfernt) für die
Zielvereinbarungen, Leistungsvereinbarungen und Entwicklungspläne genutzt, wenngleich
diese Prozesse nicht direkt synchronisiert sind, was zeitlich und organisatorisch letztlich schwer
zu organisieren ist. Teilweise wird auch mit Nachträgen zu Zielvereinbarungen gearbeitet, das
hießt, es werden bestimmte Punkte offen gelassen und erst nach dem Vorliegen der
Evaluierungsergebnisse Definitionen vorgenommen.
Evaluierungen
An der Universität Graz werden wie an allen anderen österreichischen öffentlichen
Universitäten (und dem UG) regelmäßig Evaluierungen durchgeführt. Eine eigene Satzung
12
wurde im Jahr 2004 erstellt, diese ist derzeit in Überarbeitung. Forschungseinheiten werden alle
fünf Jahre nach dem Peer Review Verfahren (mit mindestens zwei Gutachtern) evaluiert.
Im Rahmen der Evaluierung erstellen die Universitäten zunächst Selbstevaluationsberichte.
Dabei handelt es sich um eine vorwiegend narrative Darstellung und qualitative Bewertung der
Forschungseinheit, wobei auch Ziele und Strategien für die künftige Ausrichtung der
Forschungsaktivitäten dargestellt werden. Dieser Report wird sodann an die (möglichst
internationalen) Peers gesendet, wobei bei großen, heterogenen Einheiten bis zu sechs Peers
involviert sind. Nach einem Besuch vor Ort wird das Gutachten erstellt. Eine große Bedeutung
aus der Sicht des Universitätsmanagements nimmt dann der sogenannte
„Umsetzungsworkshop“ ein, der zwischen den Vertretern der Organisationseinheit und dem
Rektorat durchgeführt wird und bei dem Konsequenzen und Maßnahmen definiert werden.
Ergebnisse der Evaluierung fließen sodann auch in die Zielvereinbarungen und die
Entwicklungspläne ein. Insgesamt liegt bei den Evaluierung nach Angaben des
Universitätsmanagements der Fokus dabei vor allem auf der Analyse und Bewertung der
Zukunftsfähigkeit der Einheiten und Forschungsgruppen und weniger auf der ex-post
Bewertung.7 Neben den Fach-Peers engagiert die Universität Graz bei jeder Evaluierung auch
einen fachfremden Experten, der auf Aspekte wie Kommunikationsstrukturen, Arbeitsabläufe,
Nachwuchsausbildung und dgl. Bedacht nimmt. Insgesamt fungieren Evaluierungen aus Sicht
des Universitätsmanagements daher auch als wichtiges Instrument für die Entwicklung der
Fachbereiche.
Fixer Bestandteil der Evaluierung und des Selbstevaluierungsreports ist die Darstellung der
Forschungsleistungen nach einem standardisierten Schema, wobei hier in Summe (Forschung
und Lehre) 25 Indikatoren ausgewiesen werden müssen. Für die Forschung werden unter
anderem verwendet: Publikationen, Vorträge, Mitgliedschaften in Kommissionen, Drittmittel,
Transferleistungen. Dieses (einheitliche) Schema wird von Seiten des Rektorats vorgegeben,
wobei nur wenige geringfügige Anpassungen durchgeführt wurden, um Unterschiede zwischen
Disziplinen zu berücksichtigen. So werden etwa bei den Naturwissenschaften keine Bücher
ausgewiesen. Nach wie vor gibt es kontroverse Diskussionen innerhalb der Universität Graz
über die Notwendigkeit der einheitlichen Darstellung der Leistungen, dennoch hat das Rektorat
am Procedere festgehalten. Im Kontext dieser Debatten wurde als Alternative auch diskutiert,
die von den WissenschaftlerInnen selbst genannten fünf besten Publikationen zu evaluieren,
allerdings hat sich für diesen Vorschlag keine Mehrheit gefunden.
Die Indikatoren, die im Rahmen der Evaluierung standardmäßig ausgewiesen werden, werden
vom Qualitätsmanagement zentral aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Es werden hier
jedoch keine weiteren Analysen oder Vergleiche durchgeführt (Bsp. Zitationsanalyse). Aufgabe
der Peers ist es sodann, die Outputs vor dem Kontext der Wissenschaftsdisziplin und im
internationalen Vergleich zu bewerten. Die Indikatoren werden nach bisherigen Erfahrungen
höchst unterschiedlich von den Peers genutzt, wobei nicht zwangsläufig abgeleitet werden
kann, dass in den Naturwissenschaften Gutachter quantitativere Bewertungen bevorzugen als
beispielsweise in den Geisteswissenschaften. Während einige Gutachter die Kennzahlen sehr
genau analysiert haben, schenken ihnen andere Gutachter keinerlei Aufmerksamkeit.
7 Eine Besonderheit an der Uni Graz sind die Evaluierungseinheiten: evaluiert werden Wissenschaftszweige und
nicht die Institute oder Fakultäten.
13
Der Vertreter des Rektorats betont, dass es sich bei den Indikatoren um komplementäre
Informationen handelt, die jedoch bei den Evaluierungen nicht im Zentrum stehen. Auch hier
kann daher von der Praxis eines informed peer review gesprochen werden.
Die Forschungsschwerpunkte wurden an der Universität Graz bislang noch nicht evaluiert. Eine
erste Evaluierung ist für 2015 geplant. Die Universität ist sich bewusst, dass die
Schwerpunkbildung mehrere Jahre in Anspruch nimmt, bevor aussagekräftige
Forschungsleistungen bewertet werden können.
Des Weiteren werden in ausgewählten Bereichen Evaluierungen auf Personenebene
durchgeführt, etwa bei Qualifizierungsvereinbarungen, Entfristungen und dgl.
Rankings
Ähnlich wie die Universität Innsbruck argumentiert die Universität Graz, dass die Position in
Rankings beobachtet wird, aber dass man nicht direkt versucht die dabei verwendeten Kriterien
zu beeinflussen. Potential sieht man vor allem in fachspezifischen Rankings, die jedoch noch
zu wenig verbreitet sind.
Wissensbilanz
Einige Kennzahlen in der Wissensbilanz werden nach wie vor als zu wenig valide betrachtet, -
darunter auch die Anzahl der Publikationen -, vor allem auch was einen Vergleich zwischen
unterschiedlichen Universitäten betrifft. Dennoch werden auch intern Auswertungen
durchgeführt und etwa die Anzahl der Publikationen pro WissenschaftlerInnen auf Ebene der
Wissenschaftsdisziplinen verglichen, derartige Auswertungen ermöglichen eine
Positionsbestimmung.
Neben der Wissensbilanz wird auch InCites von Thomson Reuters genutzt, um
Forschungsgruppen international zu benchmarken.
Zusammenfassung
Nach Angaben des interviewten Universitätsqualitätsmanagers ist es in den letzten Jahren
zu einer zunehmenden Quantifizierung beim Methodenmix für die Bewertung von
Forschung gekommen. Diese Quantifizierung wird aber vor allem im Sinne eines
Monitorings und einer Positionierung verstanden bzw. genutzt. Indikatoren erlauben vor
allem auch die Überprüfung der Zielerreichung im Sinne eines Management by Objectives,
wenngleich bei der Analyse von Abweichungen die erste Frage die nach dem Warum der
Abweichung ist.
In der Objektivierung von Entscheidungen als Folge der stärkeren Nutzung von
Kennzahlen wird der größte Vorteil von Seiten des Universitätsmanagements gesehen.
Auch für die Frage, wo das größte Potential für zukünftige Schwerpunkte und Akzente in
der Forschung liegt (Steuerung), wird ein Nutzen gesehen.
Zukünftig will die Universität Graz auch gezielt Indikatoren für die Geistes- und
Sozialwissenschaften nutzen, wozu eine Arbeitsgruppe bis 2014 Vorschläge erarbeiten
soll. Dabei wird versucht, Forschungsleistungen multi-dimensional darzustellen und vor
allem auch den Wissenstransfer (inkl. möglicher Kenngrößen) abzubilden.
14
2.4. Universität Salzburg
Die Universität Salzburg deckt ein breites Spektrum von Wissenschaftsfächern ab, auch hier
kann vor allem ein Spannungsfeld zwischen den Naturwissenschaften einerseits und den
Geistes-, Rechts- und Sozialwissenschaften sowie der Kunst vermutet werden. Bei der
Messung und Bewertung von Forschungsleistungen wird wie folgt vorgegangen:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Die Leistungsvereinbarung der Universität Salzburg beschränkt sich im Bereich der Forschung
vor allem auf die Beschreibung von geplanten Vorhaben und dem Commitment, diese
umzusetzen. Die Ausweitung der EU Drittmittel um 2% pro Jahr stellt die einzige klassische
Outputvariable dar.
An der Universität Salzburg werden Zielvereinbarungen direkt mit den 31 Fachbereichen
geschlossen, welche damit direkt dem Rektorat unterstellt sind. Fachbereiche sind wiederum
Fakultäten zugeordnet, dem Dekan der Fakultät obliegt dabei die Koordination der Lehre.
Im Rahmen der Verhandlung zu den Zielvereinbarungen wird von Seiten des Rektorats ein
sogenannter Pflichtzielkatalog und Wahlzielkatalog vorgegeben. Bei der Forschung wird dabei
aktuell eingefordert, dass jeder Fachbereich eine Forschungsstrategie formulieren muss, die
Angaben zu Profilbildung, Veröffentlichungen, wissenschaftlichem Nachwuchs und Angaben
zur Erhöhung der Drittmittel enthalten muss. Es gibt jedoch für diese einzelnen Dimensionen
keine direkten quantifizierten Ziele oder monetäre Vorgaben. Vom Aufbau her sind die
Zielvereinbarungen ähnlich wie die Leistungsvereinbarungen gehalten und umfassen Ziele und
Vorgaben zu Forschung, Lehre, Personal und Internationalem.
Insgesamt lassen sich nach Angaben der Universitätsleitung keine systematischen Unterschiede
zwischen den einzelnen Zielvereinbarungen quer über die unterschiedlichen Fachbereiche und
Disziplinen identifizieren. Der einzige eindeutige Unterschied kann bei der Höhe der
angestrebten Drittmittel bzw. Bestrebungen, diesen Anteil zu erhöhen, ausgemacht werden.
Gleichwohl gab es in der Vergangenheit aber Bestrebungen, den Drittmittelanteil auch in den
Geisteswissenschaften zu erhöhen, bislang konnte zwischen Rektorat und Vertretern der
jeweiligen Fachbereiche dazu aber keine gemeinsame Position gefunden werden. Die
Zielvereinbarung fungierte dabei aus Sicht der Universitätsleitung als Instrument, um
bestimmte Fachbereiche, in denen Drittmittel bislang kaum akquiriert wurden, zu motivieren,
ebendiese zu erhöhen.
Evaluierungen
Der Rahmen für die Durchführung der Evaluierung wird auch an der Universität Salzburg
durch eine entsprechende Satzung definiert. Dazu wird intern auch ein Berichtsformular
vorgegeben, das grob Struktur und Inhalte des Selbstevaluierungsberichts beschreibt. In der
Satzung der Universität Salzburg wird etwa angeführt, dass Evaluierungen als Datenquellen
Selbstberichte über erbrachte Leistungen in Forschung, Einträge in die
Forschungsdokumentation, Kennzahlen des universitären Berichtswesens sowie
Stellungnahmen von Dritten enthalten können, womit das Methodenspektrum ein Stück weit
abgegrenzt wird. Explizit wird darin auch angeführt, dass die Ergebnisse von Evaluierungen,
insbesondere bei der Festlegung von Zielvereinbarungen, zu berücksichtigen sind (§53 der
Satzung der Universität Salzburg).
15
Gemäß Satzung und Organisationsplan der Universität Salzburg werden Zentren und die
fakultätsübergreifenden Forschungsschwerpunkte (beides sind auf begrenzte Zeit gebildete
Forschungsschwerpunkte, die mit dem UG etabliert wurden) alle 5 Jahre evaluiert. Fakultäten
und Fachbereiche (entsprechen Instituten) werden an der Universität Salzburg nur
anlassbezogen evaluiert.
Was die Nutzung von Indikatoren betrifft, ist man an der Universität Salzburg sehr
zurückhaltend und kritisch eingestellt. Zwar werden im Rahmen von Evaluierungen auch
Kennzahlen von Seiten der zu evaluierenden Einheiten ausgewiesen (im Bereich Forschung
Publikationen und Drittmittel), diese stellen aber laut Angaben des Universitätsmanagements
„Rahmeninformationen“ dar. Es gibt dabei keinerlei exakte Vorgaben oder impliziten Druck,
dass bestimmte Indikatoren ausgewiesen werden müssen. Im Allgemeinen gibt es nach
Einschätzung der interviewten Vertreterin des Rektorates keine systematischen Unterschiede
zwischen den Naturwissenschaften und den anderen Wissenschaften.
Die Biowissenschaften (diese stellen einen sehr erfolgreichen Forschungsschwerpunkt dar, bei
dem viele Fachbereiche involviert sind und interdisziplinär zusammenarbeiten) haben etwa
andere Publikationsorgane und Outputstrukturen als etwa die Kunst. Die jeweiligen
Koordinatoren der Forschungsschwerpunkte bzw. Zentren haben großen Freiraum und nutzen
diesen auch.
Des Weiteren werden von Seiten des Rektorats keine weiterführenden oder vergleichenden
Analysen - auch nicht im Rahmen der Formulierung der Zielvereinbarungen (siehe auch unten)
- durchgeführt.
Wissensbilanz
Die Wissensbilanz wird wie vom Gesetzgeber gefordert erstellt, ambitioniertere Vorhaben zur
IT-gestützten Erhebung und Verwaltung, zur bibliometrischen Analyse oder systematischen
Nutzung (wie etwa an der Universität Innsbruck oder Graz) von Kennzahlen für die Steuerung
oder Budgetierung wurden (bislang) nicht implementiert bzw. eingesetzt.
Zusammenfassung
Folgende Befunde lassen sich an dieser Stelle zusammenfassen:
Was die fachspezifische Bewertung von Forschungsleistungen betrifft, lassen sich weder
bei den Evaluierungen noch den Zielvereinbarungen systematische Unterschiede im
Hinblick auf die Nutzung von quantitativen versus qualitativen Bewertungsmethoden
festmachen. Einzige Ausnahme stellt die Bedeutung der Drittmittel dar, die in den
Naturwissenschaften eine größere Rolle spielen und dort auch explizit als Ziel ausgewiesen
werden. Insgesamt haben die unterschiedlichen Bereiche einen großen Freiraum bei der
Ausgestaltung der jeweiligen Dokumente, die mangelnde Objektivierung erfordert vom
Rektorat wohl ein großes Verhandlungsgeschick. Diese Praxis ist vermutlich auch stark
von den handelnden Personen (Rektoren), der historischen Entwicklung und der
spezifischen Universitätskultur getragen bzw. determiniert.
Indikatoren werden als komplementäre Methoden bzw. Rahmeninformation gesehen, die
jedoch nicht systematisch ausgewiesen werden. Dennoch ist auch an der Universität
Salzburg geplant, in den nächsten Jahren die Kennzahlendokumentation auszubauen und
16
mit Hilfe eines IT-gestützten Forschungsinformationssystems zu etablieren. Dies ist die
Voraussetzung für auch an der Universität Salzburg geplante stärkere Nutzung (trotz aller
Kritik und Einschränkungen) von Indikatoren für die Bewertung und Messung von
Forschungsleistungen.
2.5. Technische Universität Graz
Die Praxis der Bewertung und Messung von Forschungsleistungen kann wie folgt beschrieben
werden:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Die TU Graz folgt bei der Ausverhandlung der Zielvereinbarungen mit den einzelnen
Fakultäten stark den Vorgaben der Leistungsvereinbarung und versucht die dort definierten
Ziele und Vorhaben auf die einzelnen Fakultäten herunter zu brechen; man spricht hier auch
von einem „Kaskadenmodell“. Vorgaben für Publikationen oder Drittmittel werden im Rahmen
der aktuellen Leistungsvereinbarung 2013-2015 nicht vereinbart.
Die Zielvereinbarungen der TU Graz sind äußert knapp gehalten und umfassen nicht mehr als
zwei Seiten. Während anderen Universitäten im Rahmen der Zielvereinbarungen auch
Forschungsschwerpunkte und die Strategie darstellen, beschränkt sich die TU Graz in den
Zielvereinbarungen vornehmlich auf die messbaren Zielen und Vorgaben. Vorgaben, Ziele und
Indikatoren werden für die Bereiche Forschung, Lehre und Personal definiert. Auf Basis einer
Analyse der Werte aus der Vorperiode und der allgemeinen Rahmenbedingungen wird
versucht, realistische Zielwerte zu vereinbaren, wobei diese durchaus auch nach „unten“ gehen
können.
Für den Bereich Forschung kommen hier die klassischen Kennzahlen zu Publikationen (jede
Fakultät definiert dabei aber selbst die Qualitätskriterien), Drittmittel (differenziert nach
Antrags- und Auftragsforschung) und Dissertationen zur Anwendung. Die notwendigen Daten
werden dabei zentral von der Forschungsdokumentationsstelle aufbereitet und zur Verfügung
gestellt.
Die an anderen Universitäten in den Zielvereinbarungen durchgeführten Ausführungen zu
Strategien, Schwerpunkten, Stellenplan und dgl. erfolgen an der TU Graz vor allem parallel
bzw. als Teil des Entwicklungsplans. Zielvereinbarungen sind, wie beim Großteil der
österreichischen Universitäten, an der TU Graz nicht öffentlich zugänglich.
Dennoch kann nicht abgeleitet werden, dass hier eine direkte Verknüpfung zwischen
Indikatorenwert bzw. Zielerreichung und Budgetierung besteht. Auch hier zielt man eher auf
eine indirekte Wirkung ab und hofft durch Positionierung und einer diskursiven Diskussion der
Zielerreichung Lerneffekte und Anreize zu setzen. Darüber hinaus gibt es einen Budgettopf für
die Finanzierung strategischer Projekte.
An der TU Graz werden im Rahmen des Qualitätsmanagements auch sehr detaillierte Analysen
in Form von „Effizienzspinnen“ auf Fakultäts- und Institutsebene durchgeführt und
Input/Output-Relationen berechnet.
Um auf unterschiedliche Wissenschaftskulturen und Publikationspraktiken einzugehen, wurde
an der TU Graz der Weg eingeschlagen, dass jede Fakultät für sich selbst definiert, was die
17
jeweiligen wichtigen Top-Publikationsmedien sind, wobei hier keine Gewichtung
vorgenommen wird, d.h. die Top-Publikation in der Physik ist nicht mehr wert als die Top-
Publikation in der Architektur, auch wenn es sich in einem Fall um einen Katalog oder einen
gewonnen Architekturpreis handelt und im anderen Fall um eine Nature Publikation handelt.
Die Orientierung, die damit vor allem jüngeren KollegInnen kommuniziert wird, wird als
wichtig erachtet.
Was die Forschungsschwerpunkte der TU Graz betrifft, dort als Fields of Expertise bezeichnet,
werden bereits seit einigen Jahren Publikationsanalysen durchgeführt. Dies bedeutet, dass die
Publikationen der TU Graz den jeweiligen Fields of Expertise zugordnet werden müssen.
Evaluierung und Rankings
Die TU Graz führt unter der Koordination der AQA einen System Audit durch, bei dem
internationale peers involviert sind. Die TU Graz ist damit die erste österreichische Universität,
die erfolgreich durch ein Systemaudit zertifiziert wurde und führt dies auch in der aktuellen
Leistungsvereinbarung im Kapitel zu Qualitätssicherung an.
Für die Bewertung von Forschungsleistungen spielt auch die Teilnahme an Rankings eine
wichtige Rolle. Die TU beteiligt sich am CHE Ranking, wobei jährlich eine andere Fakultät
schwerpunktmäßig vergleichend analysiert wird. Die Position in Rankings („Rankingpräsenz“)
wird sogar im Rahmen der Leistungsvereinbarungen als eigenes Ziel formuliert.
Darüber hinaus nimmt die TU Graz in Abstimmung mit dem BMWF an einem großen
internationalen Rankingprojekt teil, um differenzierter die Position der TU Graz auf globaler
Ebene zu bestimmen. Ergebnisse der Rankings fließen derzeit noch nicht in die
Zielvereinbarungen ein, in Zukunft könnte sich das aber möglicherweise ändern.
Wissensbilanz
Die Wissensbilanz liefert wichtige Kennzahlen für die Zielvereinbarungen. Für das
Benchmarking mit anderen österreichischen Universitäten werden diese aber nicht
herangezogen, da die Definition hier als zu wenig präzise betrachtet wird und von
unterschiedlichen Universitäten verschieden interpretiert wird.
Zusammenfassung
Die Praxis der Bewertung der Forschungsleistungen kann an der TU Graz als durchaus
quantitativ orientiert betrachtet werden.
Die internen Zielvereinbarungen sind an der TU Graz quantitativer gehalten als die
Zielsetzungen in der aktuellen Leistungsvereinbarung.
Das Commitment von Seiten der Dekane und Institutsleiter, die in der Zielvereinbarung
quantifizierten Ziele zu erreichen und die damit verbundenen Anreizmechanismen
(indirekte Wirkung), wird von der interviewten Vertreterin der TU Graz als positiv
bewertet.
18
2.6. Medizinische Universität Innsbruck
Ausgewählte Aspekte der Praxis der Bewertung von Forschungsleistungen zeigen sich hier wie
folgt:
Leistungs- und Zielvereinbarungen
Die Leistungsvereinbarung (Teil Forschung) der MU Innsbruck ist im Vergleich zu vielen
anderen Leistungsvereinbarungen stark auf messbare Outputziele fokussiert. Sie gehört mit zu
den wenigen Universitäten, die nicht nur den Publikationsoutput als Ziel formulieren sondern
auch für die Impactfaktoren Zielwerte vorgeben. Diese werden differenziert auf Ebene der vier
Forschungsschwerpunkte festgelegt. Eine ähnliche Vorgehensweise ist ansonsten aktuell in
Österreich nur bei den beiden anderen medizinischen Universitäten in Wien und Graz zu
identifizieren.
Die Medizinische Universität Innsbruck hat zudem mit Einführung des UG und dem neuen
Finanzierungssystem eine Leistungsorientierte Mittelvergabe (LMO) eingeführt, die sich am
Modell, wie es einige Bundesländer in Deutschland praktizieren, orientiert hat. Ziel der LMO
ist es, besondere Leistungen in Lehre und Forschung nach quantitativen, objektiven und
transparenten Kriterien zu bonifizieren. Die LOM, deren Anteil am Gesamtbudget in den
letzten Jahren reduziert wurde, macht nur wenige Prozente des Gesamtbudgets aus und die
Berechnung der Formel wurde über die Jahre mehrmals revidiert.
Im Rahmen der internen Zielvereinbarungen werden diese Vorgaben und Ziele auf die
einzelnen Departments herunter gebrochen. Insgesamt ist aber die Anzahl der Professoren bzw.
des wissenschaftlichen Personals die wichtigste Kenngröße für die interne Verteilung des
Budgets. Darüber hinaus werden auch Zielvereinbarungen mit den Sprechern der
Forschungsschwerpunkte abgeschlossen.
Evaluierungen
An der MU Innsbruck werden sowohl Organisationseinheiten, Forschungsschwerpunkte als
auch Personen regelmäßig evaluiert. Der Satzungsteil Evaluation beschreibt dabei wichtige
Grundlagen. Die Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM) wird dabei auch als Instrument der
Evaluierung dargestellt. In der Vergangenheit wurde unter anderem der
Forschungsschwerpunkt Onkologie (unter Beteiligung des Wissenschaftsrates) evaluiert.
Evaluierungen starten wie bei anderen Universitäten auch mit der Erstellung eines
Selbstevaluationsberichts. Wie bei den Leistungs- und Zielvereinbarungen werden im Rahmen
von Evaluierungen Daten (Publikationsoutput, Impact, Zitationen, etc.) aus der Wissensbilanz
bzw. dem Leistungsmonitoring verwendet, die in der Regel von der Stabstelle Evaluation und
Qualitätsmanagement aufbereitet werden.
Darüber hinaus werden auch bei Berufungen standardmäßig bibliometrische Auswertungen
durchgeführt.
Wissensbilanz
Die im Rahmen der Wissensbilanz erhobenen Indikatoren werden als valide und gute
Datenbasis gesehen.
19
Die Erfahrungen mit der Entwicklung des Publikationsoutputs zeigen dabei, dass zwar in vielen
Bereichen eine relativ große Konstanz vorliegt, Schwankungen oder „Leistungseinbrüche“ aber
relativ schwer vorherzusehen sind und auch die Ursachen für den Rückgang letztlich schwer zu
identifizieren sind. Der direkte Steuerung und Beeinflussung der Zielerreichung ist dabei aber
letztlich eingeschränkt.
Zusammenfassung
Trotz dem gerade an der MU Innsbruck in der Vergangenheit stark forcierten Einsatz von
bibliometrischen Indikatoren (die dort in der internationalen Wissenschaftskultur inhärent
sind) ist man sich über die einseitige bzw. eingeschränkte Aussagekraft von Indikatoren
bewusst und versucht durch qualitative Darstellungen, die Leistungen, die hinter den
Zahlen stehen, sichtbar zu machen.
Die große Homogenität der Universität Innsbruck begünstigt zweifelsohne den Einsatz von
bibliometrischen Verfahren, dennoch gibt es auch an dieser Universität Bereiche, in denen
Indikatoren keine Aussagekraft besitzen.
3. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Im Mittelpunkt dieses Gutachtens steht die Analyse der gängigen Praxis der Bewertung und
Messung von Forschungsleistungen an den österreichischen Universitäten. Abschließend sollen
die Befunde synthetisiert werden:
Die Leistungsvereinbarung ist das zentrale Instrument für die Finanzierung der
österreichischen Universitäten durch die öffentliche Hand. Die jeweilige Ausprägung der
Leistungsvereinbarung und das Ausmaß der Quantifizierung spiegeln sich im Weiteren in
den universitätsintern definierten Zielvereinbarungen mit den unterschiedlichen
Organisationseinheiten wider. Eine Analyse der aktuellen im Jahr 2012 formulierten
Leistungsvereinbarungen8 zeigt im Gegensatz zur vorherigen
Leistungsvereinbarungsperiode, dass im Bereich Forschung bei einigen Universitäten
verstärkt Indikatoren genutzt wurden, um die Zielerreichung und den Erfolg der
Umsetzung von Vorhaben zu quantifizieren und messbar zu machen. Was die
ausverhandelten Zielwerte betrifft, hat man hier durchwegs konservative Zielwerte
angesetzt. Besonders ambitionierte und vermutlich unrealistische Ziele will man vor dem
Hintergrund eines schwierigeren Umfelds, was die Finanzierung und den steigenden
Wettbewerb betrifft, nicht vereinbaren. „Konstant halten“, „Stabilisierung“, oder
„moderater Anstieg“ sind typische Formulierungen in diesem Zusammenhang.
Bei den Zielvereinbarungen und Evaluierungen gehen die hier untersuchten Universitäten
nach einem relativ standardisierten und strukturierten Prozess vor, bei dem mit Hilfe von
Arbeitsbehelfen, Vorlagen, Fragekatalogen und Indikatoren Forschungsleistungen erfasst
und bewertet werden.
Insgesamt lässt sich bei der Bewertung und Messung von Forschungsleistungen in den
vergangenen Jahren eindeutig ein Trend zur Quantifizierung und Objektivierung 8 Insgesamt wurden im Leistungsbereich „Forschung“ 291 Vorhaben und 101 Ziele formuliert. Vgl. dazu auch den
jüngst publizierten Forschungs- und Technologiebericht 2013 der Bundesregierung.
20
konstatieren. Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den Universitäten und das Ausmaß
der Quantifizierung hängt auch stark von der jeweilig historisch gewachsenen
Universitätskultur, dem Beharrungsvermögen und den jeweiligen Rektoren ab.
Voraussetzung für den Einsatz von quantitativen Methoden der Bewertung von
Forschungsleistungen stellen die nach höchsten Qualitätsstandards erhobenen und
archivierten Indikatoren (Datenbanken bzw. Forschungsinformationssysteme) dar. Mit
Ausnahme der Universität Salzburg wird die Datenbasis und die Aussagekraft der
Kennzahlen (zu einem Gutteil auf Basis der Wissensbilanz) von den hier untersuchten
Universitäten als gut bezeichnet. Die Stabstellen bzw. Servicestellen an den Universitäten
bereiten in der Regel Informationen und Kennzahlen für die Erstellung von
Leistungsvereinbarungen, Zielvereinbarungen und Evaluierungen auf. Des Weiteren
werden vielfach – standardmäßig wie an der Medizinischen Universität Innsbruck für die
Leistungsorientierte Mittelvergabe oder wie an der Universität Graz auf Wunsch der
Fakultäten – avanciertere bibliometrische Analysen durchgeführt (Bsp. H-Index,
Zitationsanalysen).
Einigkeit besteht unter allen Universitäten, dass ein direkter Vergleich des
Publikationsoutputs zwischen den unterschiedlichen Disziplinen nicht möglich und auch
nicht sinnvoll ist. Selbst bei spezialisierten Universitäten (Technik und Medizin) ist ein
Vergleich innerhalb unterschiedlicher Fakultäten teilweise nur eingeschränkt möglich, so
kann etwa innerhalb der technischen Universitäten die Architektur erwähnt werden,
innerhalb der medizinischen Universitäten die Bewertung der Forschung in der
Orthopädie.
Universitäten stehen universitätsintern vor der Herausforderung, unterschiedliche
Forschungseinheiten und Forschungsschwerpunkte zu bewerten und Forschungsmittel
nach Kriterien der bisherigen Leistung und des zukünftigen Leistungspotentials zu
verteilen. Das Credo lautet bei allen Universitäten, die Fakultäten, Institute und Bereiche
so zu behandeln, wie es ihrer Wissenschaftskultur entspricht. Dabei wählen die
Universitäten unterschiedliche Strategien:
i. Mit dem Instrument der Selbstreports (bei Evaluationen) haben die
Forschungseinheiten (bottom-up) einen großen Spielraum, im Rahmen ihrer
Darstellung, Spezifika und Besonderheiten auszudrücken, die im Weiteren durch
die Peers gewertet und interpretiert werden.
ii. Die Selektion der fünf besten wissenschaftlichen Publikationen (Top-
Publikationen) stellt eine weitere Option dar, die es Einheiten ermöglicht, sich
(im Rahmen von Evaluierungen) darzustellen.
iii. Überdies wird von einigen hier untersuchten Universitäten die Strategie verfolgt,
auf die Disziplin abgestimmte Rankings für wissenschaftliche Publikationstypen
zu verwenden. Diese werden entweder von den Organisationseinheiten selbst
definiert bzw. gereiht oder die Universität nutzt Rankings und Indices von
internationalen Gremien (Bsp. ERIH-Index der ESF).
Vor allem die Bewertung von sehr heterogenen Forschungsfeldern, wie etwa den häufig
breit definierten Forschungsschwerpunkten, stellt große methodische Herausforderungen
21
dar. Das peer review-basierte Evaluationsverfahren muss in diesem Fall eine große Anzahl
von Peers involvieren, was in der Regel als zu aufwendig erachtet wird. Der Versuch, für
einen breiten und sehr heterogen definierten Forschungsschwerpunkt die fünf wichtigsten
Publikationen zu nennen, stellt ebenfalls eine nicht konsensual bewältigbare Aufgabe dar,
wie die Universität Innsbruck erfahren musste. In vielen Fällen wird daher bislang auf eine
Quantifizierung verzichtet (wie zu einem guten Teil auch bei den Leistungsvereinbarungen
für die Gesamtuniversität). Bei relativ homogenen Forschungsschwerpunkten (Bsp. TU
Graz oder Medizinische Universität Innsbruck) werden ausgewählte Publikationstypen
(zumeist Web of Science Publikationen) pro Forschungsschwerpunkt ausgewiesen. Einen
Weg, auch relativ breit ausgerichtete Forschungsfelder quantitativ zu bewerten, hat die
Universität Innsbruck bestritten, indem unterschiedliche Publikationsformen gewichtet
wurden und diese letztlich für den gesamten Forschungsschwerpunkt aggregiert dargestellt
wurden.
Evaluierungen werden meist als Teil bzw. Instrument des Qualitätsmanagements und
damit auch der strategischen Entwicklung gesehen, deren Ergebnisse dann in die
Zielvereinbarungen einfließen. Die hier untersuchten Universitäten organisieren auch
Workshops, um die Umsetzung dieser Ergebnisse zu institutionalisieren. In diesem
Kontext wird von der Universität Graz auch darauf hingewiesen, dass im Rahmen von
Evaluierungen vor allem die Einschätzung des Zukunftspotentials wichtig ist und
Evaluierungen gleichermaßen ex-post wie auch ex-ante Charakter aufweisen sollten.
Insgesamt wird bekräftigt, dass die Durchführung von Evaluationen ausreichend große
Zyklen erfordert. Die Praxis, alle fünf Jahre die Organisationseinheiten zu evaluieren, wird
als angemessen betrachtet. In der Regel erfolgt eine Synchronisation zwischen
Leistungsvereinbarung, Zielvereinbarung und Evaluation.
Auch für die Bewertung der Geisteswissenschaften wird von den hier untersuchten
Universitäten letztlich der Weg einer quantitativen Bewertung eingeschlagen. Neben der
Nutzung von intern erstellten oder externen Rankinglisten (Bsp. ERIH) wird etwa an der
Universität Graz die Kennzahl Reputation und Transferleistungen diskutiert (Bsp.
Tätigkeiten in Kommissionen, Funktionen in Zeitschriften, Gutachter für
Habilitationsverfahren, Einladungen zu Vorträgen und dgl.), die nach Einschätzung eines
Interviewten besser über die Fächer hinweg verglichen werden kann.
In diesem Zusammenhang kann gefolgert werden, dass ein Erfahrungsaustausch zwischen
den Universitäten unter Einbindung anderer Akteure des Wissenschaftssystems sinnvoll
wäre, um gemeinsame Grundlagen oder Leitlinien zu erarbeiten.9
Was die Nutzung von Outputindikatoren betrifft, wird dies bei den Evaluierungen als
komplementäre Informationsgrundlage für die Bewertung betrachtet und klassischerweise
als informed peer review bezeichnet. Bei den Zielvereinbarungen stellen diese Indikatoren
eine wichtige Orientierungsgröße dar und sollen Anreize schaffen, ein unmittelbarer Link
zur Finanzierung besteht aber in der Regel nicht.
9 Zu dieser Thematik hat etwa die historisch-philosophische Klasse der ÖAW im Mai 2012 eine Kommission zur
Bewertung geistes-, sozial- und kulturwissenschaftlicher Publikationsleistungen eingerichtet. Auch die Universität
Graz hat hier jüngst intern eine Arbeitsgruppe eingerichtet.
22
Rankings und Benchmarking spielen bislang eine noch untergeordnete Rolle und es wird
von keiner der hier untersuchten Universitäten versucht, Kriterien oder Kenngrößen direkt
zu optimieren. Sehr wohl gibt es aber erste konkrete interne Diskussionen, Pilotprojekte
und Ziele, dieses Instrument mittelfristig stärker zu nutzen. Hier wird von allen Befragten
betont, dass es wichtig sei, derartige Vergleiche und Analysen auf Ebene der Fachbereiche
zu bewerkstelligen.
Die Profil- und Schwerpunktbildung in der Forschung ist ein wichtiges
hochschulpolitisches Ziel in Österreich. Forschungsschwerpunkte werden im Rahmen der
Leistungsvereinbarungen dargestellt (Prozessbeschreibung, Begründung, beteiligte
Institute, etc.). Eine nachvollziehbare Bewertung der Entwicklung der Schwerpunkte wird
im Rahmen der Leistungsvereinbarung jedoch bislang nicht durchgeführt. Die an den
Universitäten etablierten gesamtuniversitären Forschungsschwerpunkte werden teilweise
von Universitäten selbst als noch zu jung betrachtet (bestehen seit rund fünf bis acht
Jahren), um sie schon sinnvoll evaluieren zu können. Gleichwohl haben einige
Universitäten haben jedoch schon Evaluierungen von Forschungsschwerpunkten
durchgeführt. Bei der Evaluierung der Forschungsschwerpunkte gibt es letztlich, wie
angeführt, noch keine etablierte Praxis bzw. keine Erfahrung.
In diesem Kontext wären zwei Maßnahmen zu diskutieren:
i. Die Konstitution von Arbeitsgruppen zum Erfahrungsaustausch bzw. die
Erstellung gemeinsamer Richtlinien im Zusammenhang mit der Bewertung von
Forschungsschwerpunkten wäre sinnvoll. In diesem Kontext kann auch auf den
Hochschulplan und die Hochschulkonferenz und den Koordinationsmaßnahmen
verwiesen werden.
ii. Ebenso wäre es mittelfristig notwendig, aus einer gesamtösterreichischen
Perspektive den Profil- und Schwerbildungsprozess zu analysieren und
Erfahrungen und Wirkungen zu untersuchen.
Auf Basis der hier untersuchten Universitäten zeigt sich ein gewisser Konnex zwischen
dem Ausmaß der Quantifizierung in der Leistungsvereinbarung auf der einen Seite und den
Zielvereinbarungen (bzw. Evaluationen) auf der anderen Seite. Kurzum, quantitativ
gefasstere Leistungsvereinbarungen implizieren vielfach auch quantitativ ausgestaltete
Zielvereinbarungen.
Die Universitäten reagieren stark auf die nationalen Anforderungen und Strategien (LV
durch BMWF)10
wie auch auf den internationalen Trend zur Bewertung und Messung von
Forschungsleistungen (Rankings, Wissenschaftskultur, Kriterien für erfolgreiche
Wissenschaftskarrieren, Bedeutung von Drittmitteln etc.), denen allesamt eine stärkere
Quantifizierung inhärent ist und denen sich Österreich (als kleines Land) nicht entziehen
kann.
10
So argumentiert eine Befragter etwa in diesem Zusammenhang: „Wenn das Ministerium vorgibt, die
Drittmittelquote muss steigen, dann kann man sich dem kaum entziehen und entsprechend werden diese Vorgaben
intern weiter gegeben.“