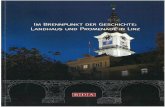Österreich im internationalen Wirtschaftssystem
Transcript of Österreich im internationalen Wirtschaftssystem
Beitrag zu
Ewald Nowotny und Georg Winckler (Hrsg)
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Österreichs
Manz-Verlag, Wien 1996
Österreich im internationalenWirtschaftssystem
Von
Rainer Bartel, Johannes Pointner und Friedrich Schneider
Arbeitspapier 9610
Juli 1996
Rainer Bartel, Friedrich Schneider
Institut für Volkswirtschaftslehre
Johannes Kepler Universität
A-4040 Linz
Tel. (0732) 2468 / 219, 211 (Fax 209)
E-mail: [email protected]
Johannes Pointner
Institut für Höhere Studien
Stumpergasse 56, A-1060 Wien
Tel. (0222) 59991 / 246
E-mail: [email protected]
Inhalt
1. Einbettung in internationale Zusammenhänge .....................................................................11.1. Die Entwicklung und außenwirtschaftliche Verflechtung Österreichs ...........................11.2. Internationale Tendenzen und österreichische Strategien .............................................3
2. Reale Außenwirtschaftstheorie und internationale Wettbewerbsaspekte..............................52.1. Klassische und Neue Handelstheorie ...........................................................................52.2. Internationale Faktormobilität ...................................................................................102.3. Handelsbarrieren und die politische Ökonomie der Handelspolitik .............................12
3. Multilaterale Wirtschaftsorganisationen............................................................................143.1. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT.................................................143.2. Der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank ........................................163.3. Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD ...............16
4. Die Europäische Union als supranationale Organisation ...................................................174.1. EWG, EG, EU und EWR..........................................................................................174.2. EU-Haushalt .............................................................................................................204.3. EU-Regional- und Strukturpolitik .............................................................................224.4. Die gemeinsame Agrarpolitik in der EU ....................................................................234.5. Die gemeinsame Handelspolitik in der EU .................................................................244.6. EUREKA - Technologische Zusammenarbeit in Europa ............................................244.7. Einheitliche Europäische Akte und die Europäische Währungsunion (EWU) .............25
4.7.1. Die Maastricht-Konvergenzkriterien für die EWU ..............................................254.7.2. Die Verwirklichung der EWU ............................................................................28
5. Tendenzen und Perspektiven Österreichs..........................................................................295.2. Ostöffung und Wirtschaftsbeziehungen Österreichs ...................................................34
5.2.1 Osthandel ............................................................................................................345.2.2 Direktinvestitionen ..............................................................................................365.2.3 Osterweiterung der EU........................................................................................37
5.3 Entwicklungstendenzen der Zahlungsbilanz ................................................................385.3.1 Kapitalverkehr.....................................................................................................385.3.2 Waren- und Dienstleistungsverkehr .....................................................................385.3.3 Spezialproblem Fremdenverkehrsentwicklung......................................................405.3.4 Soziale Liberalisierung und Leistungsbilanz .........................................................415.3.5 Hartwährungspolitik und Leistungsbilanz ............................................................425.3.6 Regionale Außenhandelsaspekte..........................................................................43
5.4. Generelle Überlegungen ............................................................................................445.4.1 Supranationale und nationale Wirtschaftspolitik...................................................445.4.2 Strukturwandel, Beschäftigung und Soziales........................................................455.4.3 Globalität der Umweltproblematik.......................................................................48
ANMERKUNGEN...............................................................................................................49LITERATURVERZEICHNIS ..............................................................................................50ARBEITSPAPIERE 1991-96 ...........................................Fehler! Textmarke nicht definiert.
1
Österreich im internationalenWirtschaftssystem
Rainer Bartel, Johannes Pointner, Friedrich Schneider
1. Einbettung in internationale Zusammenhänge
1.1. Die Entwicklung und außenwirtschaftliche Verflechtung Österreichs
Österreich gehört heute zu den wirtschaftlich wohlhabendsten Nationen der Erde. Aus dem
stark zerstörten Nachkriegsösterreich entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten eine
politisch und wirtschaftlich stabile Nation. Der Grundstein dafür wurde durch die Ereignisse
nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt. Nach 1945 war die wirtschaftliche Situation der meisten
europäischen Länder sehr schlecht, wodurch sich für Europa insgesamt eine politisch äußerst
instabile Lage ergab. Zusätzlich versuchten die beiden Großmächte USA und Sowjetunion,
ihren Einflußbereich in Europa so weit wie möglich auszudehnen. Um einer sowjetischen Ex-
pansion Richtung Westen entgegenzuwirken, boten die USA interessierten europäischen Staa-
ten ein Wirtschaftshilfeprogramm zur Überwindung der Kriegsschäden an. Dieses European
Recovery Program (ERP), das unter dem Namen Marshallplan in die Geschichte einging, er-
laubte es den Teilnehmerstaaten, ihre Wirtschaften auf ein tragfähiges, freiheitlichen Prinzipien
folgendes ökonomisches Fundament zu stellen.1 Die Wichtigkeit des Marshallplans und anderer
Wirtschaftshilfsprogramme ist heute unumstritten. "... nach übereinstimmender Meinung konn-
te in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Existenzgrundlage der österreichischen Wirtschaft
nur durch die Hilfe des Auslands sichergestellt werden..." (Abele 1989, S. 62).2 Speziell durch
die Marshallplanhilfe gelang es auch, den Handel zwischen den europäischen Staaten wieder in
Gang zu setzen, was in weiterer Folge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) führte. So startete auch
Österreich einen beachtlichen Aufholprozeß. Österreich hat heute ein BIP pro Kopf zu Kauf-
kraftparitäten, das in etwa dem Kanadas, Belgiens oder Dänemarks entspricht und jedenfalls
sowohl über dem Durchschnitt der Europäischen Union (EU) als auch über dem der OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) liegt (OECD 1993, 1995, WIFO
1996).
Ab den 60er Jahren war die Integration in die Weltwirtschaft einer der Hauptgründe für die
überdurchschnittliche wirtschaftliche Dynamik Österreichs. Durch die kontinuierliche Öffnung
2
Österreichs für den Außenhandel wurde die heimische Wirtschaft - verschärft durch die Hart-
währungspolitik - der internationalen Konkurrenz ausgesetzt, was zu einem raschen Produkti-
vitätsanstieg durch kostensenkenden technologischen Fortschritt und Veränderungen in der
Wirtschaftsstruktur führte. Der Anteil des österreichischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) am
gesamten BIP der OECD beträgt weniger als ein Prozent. Diese ökonomische Kleinheit impli-
ziert einen kleinen Binnenmarkt und somit ein geringes Nachfragepotential. Dies ist ein Grund
dafür, daß meist nur kleinere und mittlere Betriebe bestehen. Dabei ist es für diese Firmen zur
Ausnutzung von Skalenerträgen oft notwendig, ihre Güter auch auf den internationalen Märk-
ten abzusetzen. Das Bestehen auf dem Weltmarkt setzt wiederum einerseits einen hohen Spe-
zialisierungsgrad voraus, impliziert aber andererseits eine geringe Angebotsvielfalt (Breuss
1989). Das Ausmaß der Integration kann am besten anhand der Export- und Importquoten am
BIP betrachtet werden. Die Exportquote im weiteren Sinn, das sind die Exporte von Waren
und Dienstleistungen in Prozent des BIP, beträgt heute ca. 37 % (OECD Main Economic Indi-
cators 1996, S. 196). Damit gehört Österreich zu den Volkswirtschaften mit den höchsten au-
ßenwirtschaftlichen Verflechtungsgraden innerhalb der OECD.
Die Leistungsbilanz ist in die Waren-, die Dienstleistungs- und die Transferbilanz (diese bein-
haltet z. B. Wirtschaftshilfe, Beiträge zu internationalen Organisationen und Überweisungen
von Pensionen) unterteilt. Für Österreich ist die Unterscheidung zwischen Waren- und Dienst-
leistungsaußenhandel sehr bedeutend. Der Warenhandel ist von seinem Volumen her die wich-
tigste Komponente der Leistungsbilanz. Allerdings ergibt sich aus dem Warenverkehr ein chro-
nisches Defizit in der Größenordnung von rund 5 % des BIP. Das Warenbilanzdefizit kann
aber in der Regel durch einen ständigen Überschuß im Dienstleistungssektor ausgeglichen
werden. Ein Grund für die derzeitigen Leistungsbilanzprobleme ist eine ungünstige Entwick-
lung im Tourismusbereich, der einen Großteil des Überschusses in der Dienstleistungsbilanz
erwirtschaftet. Trotzdem dürfte Österreich einen relativen Wettbewerbsvorteil im Touris-
mussektor besitzen, was entsprechend der Faktorproportionentheorie einen relativen Wettbe-
werbsnachteil in den anderen Sektoren impliziert (vgl. Abschnitt 2).
Der Warenaußenhandel mit den Industriestaaten ist meist ein substitutiver. Das heißt, es wer-
den Industriewaren gegen Industriewaren getauscht. Der Außenhandel mit den Nicht-OECD-
Ländern (frühere Oststaaten, Entwicklungsländer) ist im allgemeinen ein komplementärer:
Österreich exportiert Industriewaren und importiert Rohstoffe und Energie. Dieses "kaskaden-
artige" Spezialisierungsmuster Österreichs ist durch seine "mittlere" technologische Position
bedingt und wird durch die Charakteristika des Warenhandels widergespiegelt (Breuss 1989).
Im Vergleich zur OECD exportiert Österreich allerdings viel weniger Hochtechnologiegüter,
dafür aber mehr ressourcen- und arbeitsintensive Produkte. Obwohl schon erhebliche Um-
strukturierungen stattgefunden haben, ist festzustellen, daß Österreichs Industriestruktur noch
3
immer zu "grundstofflastig" ist und die österreichische Wirtschaft über relativ wenig Know-
how im Hochtechnologiebereich verfügt. Die Produktivität der heimischen Gesamtwirtschaft
liegt nach einem stetigen Aufholprozeß heute im internationalen Vergleich knapp über dem
OECD-Schnitt und sogar über dem Niveau Deutschlands. Die Produktivität im exponierten
Sektor Österreichs ist eine der OECD-weit höchsten. Doch selbst nach weiteren Verbesserun-
gen der österreichischen Konkurrenzfähigkeit im Hochtechnologiebereich dürfte das Warenbi-
lanzdefizit mittelfristig weiter vorhanden sein.
Ein weiterer kritikischer Aspekt ist die geographische Verteilung des österreichischen Waren-
außenhandels. Diese wird durch die hohe Europakonzentration des österreichischen Außen-
handels und somit die nur spärliche Präsenz auf dem amerikanischen Markt und auf den über-
durchschnittlich dynamischen südostasiatischen Märkten charakterisiert. Sowohl für Warenex-
porte als auch -importe gilt, daß die Bundesrepublik Deutschland, gefolgt von Italien, Öster-
reichs wichtigster Handelspartner ist. Der Handel mit den osteuropäischen Ländern ist traditio-
nell relativ hoch. Für die Entwicklung der österreichischen Außenhandelsstruktur war und ist
die fortschreitende europäische Integration verantwortlich. Ein markantes Datum war das Jahr
1972, in dem Großbritannien, Irland und Dänemark Beitrittsabkommen zur Europäischen Ge-
meinschaft (EG) unterzeichneten und Österreich, Finnland, die Schweiz, Schweden, Portugal
und Island Freihandelsabkommen mit der EG abschlossen, deren Inhalt der Abbau von Zöllen
und nicht-tarifären Handelshemmnissen (z. B. Einfuhrkontingente und technische Standards) in
mehreren Stufen bis 1977 war. Österreichs Integration in die EU wird in den Abschnitten 4 und
5 gesondert behandelt.
1.2. Internationale Tendenzen und österreichische Strategien
Die kleine offene Volkswirtschaft Österreich wird samt ihrer Wirtschaftspolitik maßgeblich von
den Entwicklungen des Weltmarktes und den Institutionen internationaler Zusammenarbeit
bestimmt. Zu den wesentlichsten Charakteristika der wirtschaftlichen und politischen Rahmen-
bedingungen der vergangenen rund zweieinhalb Jahrzehnte zählen folgende:
• der Zusammenbruch des vom Internationalen Währungsfonds (IWF bzw. International
Monetary Fund IMF) getragenen "Bretton-Woods-Systems" stabiler (eingeschränkt flexi-
bler) Wechselkurse in den frühen 70er Jahren,
• das Ende des Kalten Krieges,
• die Tendenz zur generellen Liberalisierung der Welthandelsordnung im Rahmen des General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT seit 1955) bzw. der World Trade Organisation
(WTO seit 1994),3
4
• die Bildung von Handelsblöcken mit Abschottungstendenzen gegenüber Dritten (Asian Pa-
cific Economies APEC, North American Free Trade Area NAFTA, EWR bzw. EU-Binnen-
markt), zum Teil als Antwort auf die nicht-tarifären Handelshemmnisse der 80er Jahre und
als Folge der daraus entstandenen Anti-Dumping-Bestrebungen und Retorsionszölle,
• der rasche technische Fortschritt in den weltweiten Kommunikationsmöglichkeiten,
• die beschleunigte Globalisierung aber auch Regionalisierung (EU, NAFTA, Ostasien) der
Wirtschafts- bzw. Wettbewerbsbeziehungen,
• die tiefgreifende Veränderung der internationalen Arbeitsteilung zwischen Industrie-, Ent-
wicklungs- Schwellenländern (Newly Industrialized Countries NICs),
• die Dominanz großer multinationaler Konzernunternehmen im Welthandel und ihr Ausnüt-
zen der Vorteile nationaler Handelspolitiken durch Direktinvestitionen (internationale
Standortentscheidungen),
• 1989 der Übergang der ehemaligen RGW-Staaten zu Demokratien und offenen Marktwirt-
schaften (Ostöffnung) und der 1992 folgende Zusammenbruch des Rates für gegenseitige
Wirtschaftshilfe (RGW, auch Comecon oder Rubel-Zone genannt) sowie
• der Liberalisierungsimpuls der Uruguay-Runde des GATT bzw. der WTO auf die stark re-
gulierten Agrarmärkte und speziell auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU.
Österreichs Wirtschaftspolitik hat den Herausforderungen der neuen Ära permanenten Wandels
und Anpassungsbedarfs, die weit ins nächste Jahrhundert fortdauern wird, verschiedentlich
Rechnung getragen, nämlich
• seit den 80er Jahren durch eine inoffizielle, mittels fixem ÖS/DM-Wechselkurs erzielte Teil-
nahme am stabilen (eingeschränkt flexiblen) Wechselkurssystem des Europäischen Wäh-
rungssystems (EWS), dessen Wechselkursgefüge gegenüber Drittwährungen zwar nicht frei,
aber durch koordinierte Devisenmarktoperationen etwas gedämpft schwankt ("managed
blockfloating"),
• ab 1986/87 durch eine Neuausrichtung der wirtschaftspolitischen Gesamtkonzeption auf
eine betontere Umstrukturierung, Modernisierung und Internationalisierung der Wirtschaft
(Vranitzky 1986, 1987) mit dem Ziel, ein attraktiver Standort für Produktions- und Export-
aktivitäten zu sein (Strukturpolitik als aktive Arbeitsmarktpolitik) sowie
• 1994 durch den Beitritt zum EWR und 1995 zur EU mit dem Zweck, die Integrationsvor-
teile des Gemeinsamen Marktes (EU-Binnenmarktes) zu nützen.
Bevor Österreichs Position im Gefüge internationaler Wirtschaftsinstitutionen (Abschnitt 3)
und im Prozeß der Supranationalisierung der Wirtschaftspolitik durch die EU (Abschnitt 4)
dargestellt werden, wird zunächst in Abschnitt 2 noch auf die handelstheoretischen Grundlagen
eingegangen, um die Überlegungen über die Perspektiven Österreichs in der weltwirtschaftli-
chen Entwicklung (Abschnitt 5) zu fundieren.
5
2. Reale Außenwirtschaftstheorie und internationale Wettbewerbsaspekte
2.1. Klassische und Neue Handelstheorie
Das Prinzip der nationalen Arbeitsteilung ist allgemein anerkannt und seine Vorzüge sind un-
umstritten. Es ist offensichtlich ineffizient, wenn jeder Haushalt völlig autark in Subsistenzwirt-
schaft lebt. Zu einsichtig sind die durch Arbeitsteilung entstehenden Vorteile, wenn sich die
einzelnen Wirtschaftseinheiten auf die Bereitstellung jener Güter und Dienstleistungen speziali-
sieren, für welche sie die besten Voraussetzungen in Form von Ressourcenausstattung (Hu-
man-, Real- und Finanzkapital) mitbringen. Zwangsläufig bedingt diese Spezialisierung einen
Handel der arbeitsteilig erzeugten Produkte. Die Erklärung und Rechtfertigung internationalen
Handels kann analog dazu erfolgen. Auch hier ist es das Prinzip der Arbeitsteilung, das Wohl-
fahrtsgewinne ermöglicht. Der Unterschied zur nationalen Arbeitsteilung und zum nationalen
Handel besteht lediglich darin, daß bei internationalen Wirtschaftsbeziehungen Grenzen natio-
nalstaatlicher Einheiten zwischen den Handelspartnern liegen. Diese historisch bzw. politisch
bedingten Staatsgrenzen ändern aber nichts an der ökonomischen Vorteilhaftigkeit des Prinzips
der Arbeitsteilung und des Handels. Noch offensichtlicher wird im internationalen Kontext der
Einfluß international unterschiedlicher Faktorausstattungen. Wollte Island Weinanbau betrei-
ben und Österreich sich als Fischfangnation etablieren, würde dieses Unterfangen an klimati-
schen bzw. geographischen Gegebenheiten scheitern. Es sind aber nicht nur solche Faktoren,
die die Produktionsmöglichkeiten der in einem Land lebenden Menschen beschränken. Auch
spielen diesbezüglich Mentalität, Kultur, Tradition und wirtschaftshistorisch bedingte Gege-
benheiten eine wesentliche Rolle. Genauso wie der nationale erhöht auch der internationale
Handel das reale Einkommen der Handelspartner.
Aus dieser Betrachtung können bereits erste Schlußfolgerungen für den internationalen Handel
abgleitet werden (Krugman 1993):
• Internationaler Handel verändert die grundlegenden Fundamente eines Wirtschaftssystem
nicht. Vielmehr ist er als eine bestimmte Form der Güterproduktion zu betrachten, durch
die Exporte in Importe umgewandelt bzw. heimische Produktionsfaktoren in Form von
Exporten gegen ausländische Produktionsfaktoren in Form von Importen getauscht wer-
den.
• Der eigentliche Grund, internationalen Handel zu betreiben, liegt also in der heimischen
Nachfrage nach ausländischen Gütern (und umgekehrt). Internationaler Handel ist nicht mit
internationaler Konkurrenz zu verwechseln (Firmen, nicht Nationen, konkurrieren interna-
tional), sondern als gegenseitig profitabler Austausch von Gütern zu sehen.
6
Das unter den Annahmen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie abgeleitete Konzept relativer
Wettbewerbsvorteile besagt, daß auf Märkten mit vollständiger Konkurrenz bei international
ungleichen relativen Güterpreisen Handel stattfindet und für alle Beteiligten wohlfahrtsstei-
gernd ist (Krugman, Obstfeld 1991, Kenen 1994). Mit dem Handel nähern sich je nach Ausmaß
bestehender Handelsbarrieren und Transportkosten die nationalen Preise der international ge-
handelten Güter mehr oder weniger an deren Weltmarktpreise an. Mit den veränderten natio-
nalen Preisen verändert sich aber auch die optimale Güterproduktionsstruktur. So ergeben sich
neben den "gains from trade" auch "gains from specialization". Beide Effekte führen unter
den Annahmen des allgemeinen Gleichgewichtmodells zu Paretoverbesserungen, und zwar
unabhängig von den wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus der handelnden Länder. Liegt zwar
die wohlfahrtssteigernde Wirkung des Handels auf der Hand, so scheint diese Aussage in Be-
zug auf die Spezialisierungseffekte doch sehr von den Modellannahmen abhängig zu sein (etwa
perfekt kompetitive Märkte, statische Betrachtung).
Der endogen bestimmte reale Preisvektor definiert die Terms of Trade (ToT) der einzelnen
Länder, also das reale Austauschverhältnis zwischen den jeweiligen Import- und Exportgütern.
Je höher die ToT einer Nation, umso höher ist das erreichbare Nutzenniveau für diese Nation.
Somit ist jedes Land bestrebt möglichst hohe ToT zu erreichen. Da die ToT einer Nation das
Inverse der ToT der anderen Nation sind, besteht hierin ein fundamentaler Interessenkonflikt
zwischen den Nationen. Der Preisvektor und damit die ToT sind im Modell durch die existie-
rende Technologie und die jeweilige Güternachfrage determiniert. Es ist daher evident, daß die
Regierungen der einzelnen Länder versuchen, durch Beeinflussung der Nachfrage- bzw. Ange-
botsseite der eigenen Ökonomie auch die ToT für ihr Land positiv zu beeinflussen. Importzölle
zur Beeinflussung der Nachfrageseite bzw. zum Schutz eigener Wirtschaftssektoren vor der
ausländischen Konkurrenz oder Forschungs- und Entwicklungssubventionen zur Erweiterung
der eigenen Produktionsmöglichkeiten sind somit Fragen, die die optimale Handelspolitik be-
treffen.
Ein solches Modell führt zu einer eindeutigen Aussage über das Spezialisierngsmuster. Jede
Nation exportiert das Gut, für welches relative Wettbewerbsvorteile bestehen. Mögliche Grün-
de unterschiedlicher Produktionsmöglichkeiten werden in den klassischen Außenhandelstheori-
en von Ricardo und Heckscher/Ohlin analysiert. Während im Ricardianischen Modell nur ein
Produktionsfaktor, nämlich Arbeit betrachtet wird, ist das Heckscher/Ohlin-Modell ein 2-
Faktoren -Modell. Im Ricardianischen Modell brauchen die Länder für die Produktion der ein-
zelnen Güter einen unterschiedlich hohen Arbeitseinsatz, das heißt, daß einige Länder weniger
Arbeit brauchen, um ein Gut herzustellen, als andere und somit in der Produktion dieses Gutes
effizienter sind. Es ist offensichtlich, daß ein Gut dort produziert werden soll, wo am wenigsten
Arbeitskraft dafür verbraucht wird. Hat ein Land bei jedem Gut Produktivitätsvorteile (niedri-
7
gere Arbeitskoeffizienten), so produziert es jenes Gut, wo der Effizienzvorsprung am größten
ist. Daraus folgt, daß - auch wenn ein Land jedes Produkt effizienter erzeugen kann als sein
Handelspartner - es für beide Länder wohlfahrtssteigernd ist, wenn das effizientere Land das
Gut produziert, wo der Abstand am größten ist und sich das andere Land auf das Gut mit dem
geringsten Produktivitätsabstand spezialisiert. Ein höherer Lohn im produktiveren Land macht
aus dem für beide Güter bestehenden (absoluten) Wettbewerbsvorteil einen nur mehr relativen
für das Gut, bei dem der größere Produktivitätsvorsprung besteht. Lohnunterschiede spiegeln
also nicht einen unfairen Wettbewerbsvorteil wider, sondern sind durch Produktivitätsunter-
schiede begründet.
Im Heckscher/Ohlin-Modell sind es unterschiedliche Faktoreinsatzverhältnisse in der Güter-
produktion einerseits und verschiedene Faktorausstattungen der Länder andererseits, die den
Handel verursachen. Das Heckscher/Ohlin-Modell wird auch Faktorproportionenmodell ge-
nannt. Zur Vereinfachung der Analyse wird angenommen, daß die Faktoreinsatzkoeffizienten
fix und unveränderlich gegeben sind. Sind diese von Gut zu Gut verschieden und differieren
auch die Länder in ihren Faktorausstattungen, so folgen daraus unterschiedliche Produktions-
möglichkeiten mit den schon beschriebenen Konsequenzen. Jedes Land wird sich auf Produkti-
on und Export jenes Gutes spezialisieren, für welches es die besten Voraussetzungen hat. Ob-
wohl trotz Handel beide Güter in beiden Ländern hergestellt werden, erzeugt das relativ kapi-
talreiche Land vorwiegend kapitalintensive Güter, während das Land mit relativ zur Kapital-
ausstattung zahlreichen Arbeitskräften hauptsächlich arbeitsintensive Güter produziert.
Da das Heckscher/Ohlin-Modell zwei Produktionsfaktoren unterscheidet, eröffnet sich dadurch
die Möglichkeit, Verteilungswirkungen des Handels zu diskutieren, indem die Situationen der
Eigentümer der verschiedenen Faktoren, also z. B. der Kapitaleigner und der Besitzer des
Faktors Arbeit, verglichen werden können. Wir müssen dafür aber wissen, inwieweit der Gü-
terpreisausgleich die Faktorpreise beeinflußt. Die Antwort auf diese Frage liefert das Stol-
per/Samuelson-Theorem. Demgemäß erhöht in jedem Land die Handelsöffnung den Preis des
reichlich vorhandenen Faktors. Einerseits wissen wir, daß der Preis des Exportgutes durch
internationalen Handel steigt, andererseits ist das Exportgut jenes Gut, welches den reichlich
vorhandenen Faktor intensiver nützt als den weniger verfügbaren. Es erhöht sich also der Preis
jenes Faktors, der relativ mehr zur Erzeugung des Exportgutes verwendet wird. Im arbeitsrei-
chen Land steigt also der Lohnsatz, im kapitalreichen der Preis des Kapitals. Wenn - wie in
unserem Extremfall - beide Länder die gleiche Techgnologie mit konstanten Grenzkosten zur
Verfügung haben und jedes Land beide Güter produziert, keine Behinderungen wie Transport-
kosten oder Zölle bestehen und daher ein völliger Güterpreisausgleich erreicht wird, dann müs-
sen unabhängig von den jeweiligen Produktionsplänen auch die internationalen Faktorpreise
gleich sein. Dieser als Faktorausgleichstheorem bekannte Zusammenhang impliziert, daß die
8
Handelsöffnung die unterschiedlichen Faktorausstattungen vollständig kompensiert. Verallge-
meinert man das Modell durch die Möglichkeit der Faktorsubstitution, so wird das optimale
Faktoreinsatzverhältnis eine Funktion der Faktorpreise. Die Schlußfolgerungen bleiben im
Prinzip unverändert.
Eine wesentliche Annahme obiger Modelle ist, daß sowohl Arbeitnehmer als auch Kapitalgüter
zwischen den Industrien mobil sind, das heißt kostenlos und ohne Produktivitätsverlust von
einem Produktionssektor in den anderen transferiert werden können. Verwirft man die Mobili-
tät zumindest eines Faktors zwischen den Industrien, erhält man ein Modell mit spezifischen
Faktoren und es lassen sich noch weitreichendere Verteilungswirkungen als im Heck-
scher/Ohlin-Modell aufzeigen. Der Produktionsfaktor Arbeit sei zwischen den Industrien mobil
und alle anderen Faktor seien ausschließlich für die Produktion eines der Güter verwendbar.
Da im Gleichgewicht der Lohnsatz in jeder Industrie gleich hoch sein muß, wird die vorhande-
ne Arbeit so auf die Sektoren aufgeteilt, daß das Grenzprodukt der Arbeit in jedem Sektor das
gleiche ist. Aus der Allokation des Faktors Arbeit und den vorhandenen spezifischen Faktoren
ergeben sich dann bei gegebener Nachfrage die jeweilige Produktionsstruktur und die im all-
gemeinen international unterschiedlichen Gleichgewichtspreise. Wenn nun Handel wieder zum
Ausgleich der Güterpreise führt, verändert sich die Entlohnung der Produktionsfaktoren, so
wie im Haberler-Theorem beschrieben: Die Entlohnung eines spezifischen Faktors steigt,
wenn der Preis dieses Gutes durch den Handel steigt, und fällt anderenfalls. Der reale Lohnsatz
steigt bezogen auf das billiger gewordene Produkt und sinkt bezogen auf das im Preis gestie-
gene Gut. Jedenfalls liegen die unterschiedlichen Interessen der Eigentümer der verschiedenen
spezifischen Faktoren den Freihandel betreffend auf der Hand.
Ein weiterer Analysepunkt betrifft die Auswirkungen wirtschaftlichen Wachstums auf die
Wohlfahrt einer Nation. Auf der Grundlage der Handelstheorie wird folgendes Ergebnis erzielt.
Exportorientiertes Wachstum, das durch erweiterte Absatzmöglichkeiten und deren Skalenef-
fekte zustande kommt, verschlechtert die ToT des wachsenden Landes aufgrund des höheren
Angebots und gesunkenen Preises des Exportgutes. Hingegen verbessert Wachstum, das auf
Produktivitätssteigerung und Preissenkung im importsubstituierenden Sektor beruht, die eige-
nen ToT und erhöht damit die nationale Wohlfahrt. Exportorientiertes Wachstum erhöht die
eigene Wohlfahrt nur dann, wenn der direkte Wohlfahrtseffekt der erweiterten Produktions-
möglichkeiten die Verschlechterung bei den ToT überkompensiert. Wenn andere Länder inno-
vativ tätig sind, verliert ein sich nicht weiterentwickelndes Land durch Verschlechterung seiner
ToT sowohl relativen als auch absoluten Lebensstandard.
Die klassischen Modelle können die tatsächliche beobachtete Handelsstruktur - wenn über-
haupt - nur sehr unzureichend erklären. Warum sollten Länder mit ähnlichem Entwicklungsni-
9
veau und ähnlichen Ressourcenausstattungen miteinander handeln? Warum gibt es neben dem
interindustriellen Handel, also den Handel von Gütern verschiedener Produktionssektoren auch
intraindustriellen Handel mit Gütern aus demselben Sektor?
Die Neue Handelstheorie untersucht den internationalen Handel, indem sie entgegen den Mo-
dellen der klassischen Außenhandelstheorie vom Postulat des vollkommenen Wettbewerbs
abgeht und Skaleneffekte zuläßt. Die Ergebnisse der klassischen Theorie gelten strenggenom-
men nur dann, wenn die gehandelten Güter standardisiert sind und für jedes Gut genügend An-
bieter am Markt agieren, so daß keine Firma Marktmacht besitzt. Die Preise entsprechen dann
den Grenzkosten. Um Grenzkostenpreissetzung zu garantieren, müssen Skaleneffekte ausge-
schlossen werden. Existieren nämlich Skaleneffekte der Produktion, sinken mit zunehmender
Produktion die Durchschnittskosten. Das impliziert aber, daß die Grenzkosten niedriger als die
Durchschnittskosten sind und Grenzkostenpreissetzung daher zu kontinuierlichen Verlusten für
die Unternehmer führt. Bei hinreichender Wettbewerbsintensität werden die Unternehmer die
Preise gleich ihren Durchschnittskosten setzen. Wenn es in diesem Fall einen Produzenten gibt,
dessen Marktanteil höher ist als jener seiner Konkurrenten, kann er zu günstigeren Durch-
schnittskosten produzieren und seinen Kostenvorteil nützen, um seine Konkurrenten vom
Markt zu verdrängen. Infolge dessen bleibt dann dieser Produzent als Monopolist über und
kann genau jene Monopolmacht ausüben, die in den klassischen Modellen ausgeschlossen wur-
de. In der neuen Handelstheorie wird die Industrieökonomie auf internationale Fragestellungen
angewandt.
Nun stellt sich die Frage, wie internationaler Handel bei vorhandenen Skalenerträgen wohl-
fahrtssteigernd wirken kann. Einerseits ist es natürlich wünschenswert, daß die Skaleneffekte
so weit wie möglich ausgeschöpft werden, um eine möglichst billige Produktion zu erreichen.
Das impliziert aber Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben. Wenn in
jedem Land Monopolisten den Markt beherrschen, könnten die nationalen Skaleneffekte zwar
technisch ausgeschöpft werden. Der Monopolist verhindert jedoch die ökonomische Ausnüt-
zung dieses Produktionsvorteils für die Abnehmer durch das Setzen des Monopolpreises. Han-
delsöffnung erlaubt nun den Firmen, auch die Auslandsmärkte zu bedienen. Entsprechend der
Oligopoltheorie ist dann von einer Situation vollkommener Konkurrenz bis zur unveränderten
Monopolsituation bei Nichteintritt der Firmen in den ausländischen Markt bzw. bei kollusivem
Verhalten (gemeinsame Gewinnmaximierung der am Markt agierenden Firmen) jedes Ergebnis
möglich. Sobald die Firmen aber wegen der internationalen Konkurrenz vom Monopol abwei-
chen müssen, steigert das die internationale Gesamtwohlfahrt über zweierlei Effekte: erstens
über den niedrigeren Preis und zweitens über die dadurch ausgeweitete Produktion der Güter.
10
In dieser Situation spielen Produktdifferenzierung und technologische Entwicklung eine be-
deutende Rolle. Ist es den Firmen mittels differenzierter Produkte möglich, Marktnischen zu
besetzen, können sie Preiskämpfen eher ausweichen. Verbesserung im technologischen Know-
how führen zu Produktivitätsvorteilen, die in Preiskämpfen genutzt werden können, um Kon-
kurrenten aus dem Markt zu drängen. Die Chance, temporäre Monopolstellungen zu erlangen,
bildet einen notwendigen Anreiz für die Einführung technischen Fortschritts. Forschung und
Entwicklung ist im allgemeinen eine mit Skaleneffekten verbundene Aktivität, die vorwiegend
auf Oligopolmärkten beobachtet wird.
Mittels der neuen Handelstheorien ist eine weitere Erklärung für die Existenz internationalen
Handels gegeben. Nicht unterschiedliche Faktorausstattungen in den verschiedenen Ländern,
sondern das Ausnützen von Skalenerträgen und Markteintritte in ausländische Monopolmärkte
erklären den Handel, speziell - im Gegensatz zu den klassischen Modellen - den intraindustri-
ellen Handel. Die Handelsstruktur selbst kann durch den unvollständigen Wettbewerb nicht
erklärt werden. Sind aber Handelsstrukturen historisch gegeben, so können diese durch Skale-
nerträge gefestigt werden.
2.2. Internationale Faktormobilität
Die internationale Immobilität der Produktionsfaktoren ist eine entscheidende Annahme der
bisher diskutierten Modelle. Wachsende internationale Direktinvestitionen sowie Migration von
Arbeitskräften zwischen den Nationen machen diese Annahme in vielen Fällen unplausibel.
Wenn im Modell spezifischer Faktoren die gleichen Faktoren in den einzelnen Ländern unter-
schiedlich entlohnt werden, impliziert das obige Modell international unterschiedliche Grenz-
produktivitäten. Wenn die Faktoren zwar nicht zwischen den Wirtschaftssektoren, sehr wohl
aber international mobil sind, wechseln sie zu den Orten höherer Grenzproduktivität. Gibt es
beispielsweise Land und Kapital als spezifische Faktoren, dann wandert Kapital dorthin, wo
relativ zu den anderen Faktoren weniger Kapital vorhanden und teurer ist. Im Ursprungsland
wird Kapital daher knapper und sein Grenzprodukt und damit die Produktivität steigen in die-
sem Land. Wenn nun aber im Kapitalsektor bei gleichbleibendem Arbeitsangebot der Kapital-
bestand geringer wird, sinkt auch das Grenzprodukt des Faktors Arbeit. Solange Arbeit in den
Sektoren ungleich entlohnt wird, wandert ein Teil der vorher im Kapitalsektor beschäftigten
Arbeitnehmer in den Landsektor. Trotzdem kann aber der Ausgangslohn nicht mehr erreicht
werden. Im Kapitalempfängerland ist das Ergebnis genau spiegelbildlich. Dort sinkt die Grenz-
produktivität des vorher knapperen Faktors Kapital und über denselben Mechanismus steigt
der Lohnsatz. Die vor dem Kapitaltransfer verzerrte Faktorallokation hat die jeweils knappen
Faktoren bevorzugt. Obwohl die Entlohnung von Kapital im Empfängerland sowie von Arbeit
11
im Ursprungsland sinkt, wird durch die nun effizientere Allokation der Produktionsfaktoren ein
insgesamt höherer Output erzielt. Im Modell spezifischer Faktoren ist also Faktormobilität die
Konsequenz der internationalen Beziehungen. Der Handel behält aber eine wichtige Funktion,
wenn immobile Produktionsfaktoren (in unserem Beispiel ist es Land) ungleich verteilt sind.
Im Heckscher/Ohlin-Modell läßt das Faktorpreisausgleichstheorem keinen Spielraum für Fak-
tormobilität. Nur wenn Faktoren in unterschiedlichen Ländern verschieden hoch entlohnt wer-
den, macht Faktormobilität Sinn. Wenn Translokationskosten (z. B. Zölle oder Transportko-
sten) den internationalen Güterpreisausgleich verhindern, gilt auch das Faktorpreisausgleichs-
theorem nicht mehr. In dieser Situation ist Faktormobilität ein vollständiger Ersatz für interna-
tionalen Handel. Faktormobilität führt dann zu identischen Faktorausstattungsverhältnissen in
den einzelnen Ländern und weiterer Handel ist nicht mehr notwendig. Die Verteilungseffekte
sind dieselben wie im Modell spezifischer Faktoren.
Mit einem Modell, das Translokationskosten berücksichtigt, kann also Faktormigration zwi-
schen Ländern mit unterschiedlichen Faktorausstattungen erklärt werden. Faktormobilität stellt
dabei ein direktes Substitut für internationalen Handel dar. Im Falle von Kapital muß zwischen
zwei Formen des Transfers unterschieden werden. Einerseits kann Kapital über die internatio-
nalen Kapitalmärkte direkt in das Bestimmungsland gelangen. Das bedeutet, daß ein Land bzw.
die dort ansässigen Firmen auf den Kapitalmärkten Kredite aufnehmen und die Investition und
den Betrieb der neuen Anlagen in Eigenregie durchführen. Die andere Variante sind Direktin-
vestitionen multinationaler Firmen. Dabei errichtet ein Investor außerhalb des Landes, in dem
er seine Wirtschaftsaktivitäten hauptsächlich ausübt, eine Produktionsstätte und betreibt sie in
eigenem Namen.
Auslagerungen von Produktionsstätten in Billiglohnländer, wenn das politische Umfeld in die-
sem Land mehr oder weniger unproblematisch und das entsprechende Betriebs-Know-how im
Zielland nicht vorhanden ist, gehören mittlerweile zum alltäglichen Wirtschaftsgeschehen. Wa-
rum aber Firmen außerhalb ihres Ursprugslandes in Ländern mit ähnlichen Faktorbedingungen
Fabriken bauen ist nicht so leicht ersichtlich. Ein diesbezüglicher Erklärungsansatz ist die
Theorie multinationaler Firmen. Sie versucht die Vorteile der Internationalisierung einerseits
bei vertikaler Integration und andererseits für den Technologietransfer zu erklären: Beziehun-
gen zwischen Endprodukt- und Vorleistungsproduzenten können problematisch sein. Je nach
Art der gegenseitigen Abhängigkeit kann der Vorleister versuchen, vom Abnehmer Monopol-
renten abzuschöpfen, oder umgekehrt der Abnehmer danach trachten, seine Position als wich-
tiger, vielleicht einziger Nachfrager auszunützen. Wenn es aufgrund von Faktorbedingungen
notwendig ist, diverse Vorleistungen in verschiedenen Ländern zu produzieren, können solche
Probleme durch eine mittels Direktinvestitionen vertikal integrierte Firma, die spezifische Vor-
12
produkte an den dafür geeignetsten Orten selbst erzeugt, überwunden werden. Zusätzlich kann
Technologietransfer innerhalb eines multinationalen Konzerns besser möglich sein als zwischen
unabhängigen Firmen. Probleme tauchen etwa bei der Erstellung von Lizenzverträgen auf,
wenn es um die monetäre Bewertung der Technologie geht, oder bei der Wahrung geistiger
Eigentumsrechte über den Lizenzvertrag hinaus.
Ein wichtiger Aspekt ist aber auch die Möglichkeit zur Beeinflussung politischer Prozesse am
Auslandsmarkt. Wirtschaftspolitische Maßnahmen zum Nachteil der Firma können mit der
Drohung, die Niederlassung zu schließen und die dort Beschäftigten zu kündigen, eventuell
abgewendet werden. Bedient man einen Auslandsmarkt ausschließlich über Exporte, so fehlt
dieses Druckmittel. Die Möglichkeit zur Produktionsverschiebung zwischen Standorten in ver-
schiedenen Ländern spielt beispielsweise bei Lohnverhandlungen eine wesentliche Rolle.
2.3. Handelsbarrieren und die politische Ökonomie der Handelspolitik
Internationale Wirtschaftsbeziehungen steigern die Wohlfahrt, indem sie die allokative Effizi-
enz der Produktion erhöhen. Zu einem geschieht dies durch internationalen Handel, indem
überall das produziert wird, was mit gegebenen Faktoren am produktivsten erzeugt werden
kann. Zum anderen erfolgt die Wohlfahrtssteigerung über Faktormobilität, die zum Ausgleich
der Faktorpreise führt. Handelsbarrieren, ob Zölle, Subventionen für Importsubstitute, Im-
portregulierungen oder die Faktormobilität einschränkende Regulierungen, verhindern den
Ausgleich der internationalen Güter- und Faktorpreise. Wenn internationale Skaleneffekte exi-
stieren, kann Protektion deren Ausnützung behindern. Ein Zoll treibt - genauso wie eine Ex-
portsubvention - einen Keil zwischen Inlands- und Weltmarktpreis, so daß die Bedingungen für
einen pareto-optimalen Zustand nicht mehr erfüllt sind. Die einzelnen Instrumente unterschei-
den sich hauptsächlich darin, wen sie bevorzugen. Ein Zoll hebt den Importpreis über den
Welthandelspreis, weshalb der heimische Konsum dieses Gutes sinkt. Den Zollerlös erhält die
Regierung, der höhere Preis kommt den heimischen Produzenten zu gute. Eine Exportsubven-
tion hat prinzipiell dieselbe Wirkung, allerdings mit der Ausnahme, daß nicht die Regierung,
sondern der Exportsektor die Differenz zwischen Weltmarktpreis und heimischem Preis lu-
kriert. Eine Importbeschränkung legt die maximal importierbare Menge fest. Der ausländische
Produzent des Importgutes wird daher den Preis genau dementsprechend festlegen und von
den Kunden im Importland eine zusätzliche Rente abschöpfen.
Trotz der bisherigen Überlegungen gibt es zwei Situationen, in denen ein Zoll zwar nicht welt-
weit, doch aber national wohlfahrtssteigernd sein kann. Importiert ein Land einen großen Teil
der weltweiten Gesamtnachfrage nach einem Gut, kann ein Nachfragerückgang aus diesem
13
großen Importland den Preis des Gutes weltweit reduzieren. Ein Importzoll dieses Landes er-
zielt aufgrund seiner nachfragedämpfenden Wirkung genau diesen Effekt der internationalen
Preissenkung. Mit dem sinkenden Preis des Importgutes steigen gleichzeitig die Terms of Tra-
de (ToT). Solange die Wohlfahrt durch die erhöhten ToT mehr steigt, als sie aufgrund der bei
geringerer Nachfrage verminderten Konsumentenrente sinkt, ist der Zoll national wohlfahrts-
steigernd. Mit steigendem Zoll wird der negative Effekt immer größer, so daß ein "optimaler"
Zoll gefunden werden kann. Optimal bezieht sich in dem Fall natürlich ausschließlich auf die
betrachteten nationalen Effekte. Wenn der Zoll nämlich zusätzlich einen negativen Einfluß etwa
auf Technologie-spill-overs aus dem Ursprungsland des Importgutes hat oder durch fragmen-
tiertere Produktion die Ausnutzung von Skaleneffekten verhindert, erhöht der Zoll die natio-
nale Wohlfahrt nicht mehr. Zusätzlich kann der Versuch, Zölle wegen deren ToT-Effekten
einzuführen, zu Revancheaktionen der Handelspartner führen (Retorsionszölle). Ein anderes
Argument für das Einheben eines Zolles gilt bei unvollkommenen Märkten. Existieren bei der
Produktion eines Gutes positive externe Effekte (z. B. nationale Technologie-spill-overs), so
kann es wohlfahrtssteigernd sein, mittels eines Zolles den heimischen Marktpreis für das ent-
sprechende Gut zu erhöhen, was wiederum die heimische Produktion erweitern kann. Aber
auch hier ist der Zoll nicht unbedingt das beste Instrument, denn eine Subventionierung der
Produktion hätte den gleichen Effekt bezüglich der heimischen Produktionsausweitung. Im
Vergleich zur Situation mit einer Einhebung von Zöllen bleibt aber der heimische Konsum auf
dem gleichen Niveau, weshalb die Konsumentenrente nicht sinkt.
Somit scheint eine Beseitigung aller Handelsbarrieren die wünschenswerte Konsequenz zu sein.
Wir haben aber gesehen, daß Faktorpreisveränderungen, wie sie im Zuge der Handelsliberali-
sierung entstehen, auch Verteilungswirkungen haben. Produktionsfaktoren, die aufgrund der
Handelsbarrieren ineffizient verteilt waren, konnten dort, wo sie relativ knapp waren, über-
durchschnittliche Gewinne erzielen. Die Eigner dieser Faktoren haben natürlich ein fundamen-
tales Interesse daran, den Zustand der Protektion beizubehalten, und versuchen, den politi-
schen Prozeß dahingehend zu beeinflussen. Entscheidungen über die angewandte Handelspoli-
tik werden also eher durch den durch Partikularinteressen geprägten politischen Prozeß als
durch ökonomische Effizienzüberlegungen beeinflußt. Dieser Aspekt bietet eine Antwort auf
die Frage, warum internationale Handelsbarrieren trotz ihrer im Modell offensichtlichen Effizi-
enznachteile beobachtet werden. Solche Zusammenhänge analysiert die politische Ökonomie
der Handelspolitik.
Um der Verteilungskonflikte beim Abbau von Handelsschranken Herr zu werden, wurden tat-
sächlich in internationalen Verhandlungen einschneidende Liberalisierungen vereinbart. Multi-
laterale Verhandlungen betreffen nicht nur die Interessen der Firmen, die am heimischen Markt
gegen Importe konkurrieren, sondern auch jene der heimischen Exportwirtschaft. Damit ent-
14
stehen gruppenspezifische Interessen auch für einen Abbau von Handelsschranken. So ist für
die nationalen Regierungen ein Kompromiß leichter erreichbar. Die wesentlichsten Reduzie-
rungen von Handelsbarrieren wurden unter dem GATT (der heutigen WTO) vereinbart (vgl.
Abschnitt 3.1).
3. Multilaterale Wirtschaftsorganisationen
Der wirtschaftspolitische Handlungsspielraum einer kleinen offenen Volkswirtschaft wird nicht
nur durch die Bedingungen des Weltmarktes begrenzt, sondern kann sich durch Mitglied-
schaften in internationalen oder supranationalen Organisationen ergeben. Bei internationalen
Verträgen bleibt zumindest die formale Souveränität der einzelnen Staaten, die miteinander in
Vertragsbeziehungen treten, unberührt. Bei supranationalen Lösungen verzichten hingegen die
Einzelstaaten auf Teile ihrer Souveränität und geben sie an eine gemeinsame Organisation mit
eigener Souveränität ab. Beispiele für wirtschaftspolitisch wichtige internationale Verträge, an
denen Österreich teilnimmt, sind die Verträge über das GATT, den IWF, die Weltbank und die
OECD (vgl. Abschnitt 1.2.). Diese wichtigsten internationalen Organisationen multilateralen
Typs werden im folgenden kurz beschrieben.
3.1. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT
Das GATT bzw. seine Nachfolgeorganisation WTO trägt hauptsächlich Sorge, daß ein mög-
lichst freier Welthandel verwirklicht wird. Nach der Vorstellung der am GATT teilnehmenden
Länder ist eine multilaterale Welthandelsordnung, die den fairen Wettbewerb und offene
Märkte vertraglich fixiert, am besten geeignet, die gemeinsamen ökonomischen Handelsinter-
essen zu sichern. Österreich und die BRD traten dem GATT im Oktober 1951 bei, die Schweiz
folgte im August 1966. Im Rahmen des GATT gab es seit den 60er Jahren drei entscheidende
Verhandlungsrunden: Einmal die Kennedy-Runde von 1963-67, in der die Senkung der Zölle
bis zum Jahr 1972 um bis zu 35 % und ein Anti-Dumping-Kodex vereinbart wurden. Danach
schloß die Tokyo-Runde von 1973-79 an, in der wiederum die Senkung der Zölle bis zum Jahr
1987 um 32 bis 40 % ausgehandelt, daneben aber auch die Beseitigung einiger nicht-tarifärer
Handelshemmnisse erreicht wurde. Ab 1986 arbeitete die Uruguay-Runde, in der ein weiterer
Abbau von Zöllen und Handelshemmnissen sowie die Liberalisierung des Agrarhandels und
sämtlicher Dienstleistungen vorgesehen war. Die Uruguay-Runde konnte im Dezember 1993
mit einer Liberalisierung des Agrarbereiches abgeschlossen werden; hingegen konnten für eini-
15
ge Teile des Dienstleistungssektors (z. B. Filmproduktion) keine Einigung hinsichtlich einer
Liberalisierung erreicht werden.
Nach dem GATT-Statut besteht eine Freihandelszone, wenn die Handelsschranken zwischen
den Mitgliedern der Freihandelszone im wesentlichen beseitigt sind. Eine Zollunion dagegen ist
ein Zusammenschluß mehrerer Zollgebiete zu einem einzigen Zollgebiet mit gemeinsamen
Handelsbedingungen gegenüber Drittländern. Im Gegensatz zu einer Zollunion behalten die
Mitgliedsländer einer Freihandelszone also ihre Außenzollautonomie und somit ihre Unabhän-
gigkeit in der Handelspolitik gegenüber Drittstaaten. Soferne sich eine Freihandelszone nur auf
Güter beschränkt, die in den Mitgliedsstaaten der Freihandelszone erzeugt werden, sind im
Gegensatz zu einer Zollunion Ursprungszeugnisse erforderlich, um Mißbrauch vorzubeugen.
Durch die Aufhebung von Zöllen können heimische Produkte teurer werden als die vorher mit
Zoll belegten ausländischen Güter, weshalb heimische Produktion durch zusätzlichen Handel
ersetzt wird. Dieser Effekt wird als "trade creation" bezeichnet. Weiters wird durch den
Zollabbau auch der Handel mit Drittstaaten beeinflußt. Waren, die in Drittstaaten billiger er-
zeugt werden können als in den Teilnehmerländern einer Freihandelszone oder einer Zollunion,
können durch den Außenzoll der Partnerländer so verteuert werden, daß diese Güter
schließlich teurer sind, wenn sie aus Drittstaaten importiert werden, als wenn sie innerhalb der
zollbegünstigten Zone - weniger produktiv - hergestellt und gehandelt werden. Somit wird der
Handel mit solchen Waren von Drittländern auf die Partnerländer umgelenkt, was als "trade
diversion" bezeichnet wird. Während durch "trade creation" die wirtschaftliche Gesam-
teffizienz steigt, weil die Produktion dorthin verlagert wird, wo sie am billigsten ist, sinkt die
Gesamteffizienz durch "trade diversion" (vgl. Abschnitt 2).
Die wahrscheinlich wichtigste Bestimmung des GATT ist die Verpflichtung zur Meistbegünsti-
gung, die in einem Verbot der Diskriminierung bei der Anerkennung gleicher Marktzugangs-
möglichkeiten für alle Vertragsparteien des GATT besteht (Art. I GATT). Alle in irgendeiner
Form gewährten Vergünstigungen, Vorteile, Vorrechte und Befreiungen gegenüber einem
Handelspartner müssen gleichzeitig und bedingungslos allen anderen Vertragspartnern gewährt
werden. Da das GATT kein Freihandelsabkommen zwischen den Vertragsparteien ist, wird die
Existenz von Handelshemmnissen in der Praxis anerkannt, deren Hintanhaltung immerhin in
Art. 4 des GATT-Vertrags Regeln vorgesehen, die im Bereich von Dumping und Subventionen
ein angemessenes Gleichgewicht im Wettbewerb zwischen den Handelspartnern herstellen sol-
len (Schaps 1991, S. 554).
Das GATT sieht allerdings eine Reihe von Ausnahmen und Sonderregelungen vor, die seine
liberalen Grundprinzipien zum Teil erheblich relativieren (Schaps 1991):
16
• Schutzmaßnahmen gegen schnell wachsende Einfuhren, die eine Gefahr für die heimische
Erzeugung darstellen (Art. XIX GATT),
• Handelsbeschränkungen zur Sicherung der Zahlungsbilanz (Art. XII, XVIII GATT),
• Sonderregelungen bei nationalen Krisen oder zur Wahrung nationaler Kultur- und Sicher-
heitsinteressen (Art. XX, XXI GATT) sowie
• die Aussetzung der Meistbegünstigung bei der Schaffung von Freihandelszonen und Zoll-
unionen (Art. XXIV GATT).
3.2. Der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank
Der IWF wurde gemeinsam mit der Weltbank im Juli 1944 in Bretton Woods im Rahmen der
"United Nations Monetary and Financial Conference" gegründet. Der IWF hat seine Hauptauf-
gabe in der Unterstützung von Ländern, die ihre Zahlungsbilanzdefizite abbauen müssen. Er
stellt einerseits kurzfristige Stabilisierungskredite zur Überbrückung zeitweiliger Liquiditäts-
engpässe zur Verfügung und berät andererseits bei Auf- und Abwertungen zur Beseitigung
struktureller Ungleichgewichte. Da der IWF wirtschaftlicher Stabilität in Form von Geld- und
Währungsstabilität oberste Priorität einräumt, sind seine wirtschaftspolitischen Auflagen, die
mit einem IWF-Finanzierungsbeistand verbunden werden können, nicht unumstritten. Die re-
striktiven wirtschaftspolitischen Bedingungen des IWF verursachen nämlich häufig Rezessio-
nen in den Beistandsempfängerländern und führen mitunter auch zu politischen Unruhen.
Die grundsätzliche Zielsetzung der Weltbank, wie sie in ihrer Satzung verankert ist, ist das
wirtschaftliche Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung in ihren Mitgliedsländern anzu-
regen und zu beleben; sie soll damit den Lebensstandard in diesen Ländern heben und sich dort
besonders der Bekämpfung von Hunger und Armut widmen. Die Weltbank finanziert sich aus-
schließlich auf den internationalen Kapitalmärkten. Sie ist als internationale Organisation
Schuldner bester Bonität mit einem hohen Eigenkapitalanteil und bietet daher dem Kapitalanle-
ger eine extrem hohe Sicherheit, weshalb Veranlagungen bei der Weltbank auch bei relativ
niedrigem Zinssatz attraktiv sind. Diesen niedrigen Zinssatz gibt sie an ihre Kreditnehmer wei-
ter.
3.3. Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD
Die OECD trat im September 1961 die Nachfolge der Organisation für Europäische Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit (OEEC) an. Ziel dieser atlantisch-pazifischen Wirtschaftsgemein-
schaft ist es, die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Mitgliedsländer, insbesondere die Kon-
junktur- und Währungspolitik, aufeinander abzustimmen, das Wirtschaftswachstum und die so-
17
ziale Entwicklung zu fördern, den Welthandel auszuweiten und den Entwicklungsländern bei-
zustehen. Die ursprünglichen Aufgaben der im April 1948 gegründeten OEEC bestanden im
Wiederaufbau der kriegszerstörten Volkswirtschaften Westeuropas und in der Koordinierung
der nationalen Aufbaupläne. Darüber hinaus strebten die damals 18 westeuropäischen OEEC-
Länder eine weitgehende Liberalisierung des Handels und des Zahlungsverkehrs an. Nachdem
sich die OEEC als wirksames Instrument zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit
in Europa erwiesen hatte, wurde sie zur OECD erweitert, der neben den europäischen Staaten
auch Kanada, die USA, Japan, Australien (seit 1971) und Neuseeland (seit 1973) angehören.
4. Die Europäische Union als supranationale Organisation
Da Österreich (wie Finnland und Schweden) seit Beginn des Jahres 1995 Mitglied der EU ist
und schon vor seiner Mitgliedschaft am europäischen Integrationsprozeß beteiligt war, werden
im folgenden kurz die Geschichte der EWG, EG bzw. EU und die wichtigsten Teilorganisatio-
nen der EU dargestellt.
4.1. EWG, EG, EU und EWR
Im März 1957 wurden in Rom die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) unterzeichnet. Die
an dem Vertragswerk beteiligten sechs Länder (Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Nie-
derlande und Luxemburg) waren schon seit 1952 in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS), auch Montanunion genannt, zusammengeschlossen. Durch die Verträge
von Rom, die Anfang 1958 in Kraft traten, kam die europäische Vereinigung einen großen
Schritt voran. Mit Blick auf die allgemeinen Ziele eines verstärkten Wirtschaftswachstums,
besserer Lebensbedingungen und engerer zwischenstaatlicher Beziehungen sah der EWG-
Vertrag (EWGV) die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die allmähliche Angleichung
der Wirtschaftspolitik in der Sechsergemeinschaft vor. Intensivierter Handel durch niedrigere
Transaktionskosten und die bessere Ausnützung von Skalenerträgen in einem gemeinsamen
Markt sollten das Erreichen dieser Ziele ermöglichen. Neben dem Aufbau einer Zollunion
(1968) mit freiem Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft und gemeinsamen Zolltarifen im
Handel mit anderen Drittländern, beschloß man bereits 1972 eine gemeinsame Landwirt-
schaftspolitik und eine Liberalisierung des Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs.
Dies setzte voraus, daß die Mitgliedsstaaten auf Souveränitätsrechte zugunsten der Gemein-
schaft und ihrer Organe verzichteten. Die wirtschaftliche Dynamik der Gemeinschaft übte eine
18
starke Anziehungskraft auf andere Staaten aus; so schlossen sich Dänemark, Großbritannien
und Irland (1973), Griechenland (1981), Spanien und Portugal (1986) den Europäischen Ge-
meinschaften (EG) an, welche die Teilorganisationen EWG, EURATOM und EGKS umfaßten.
Auch der Beitritt der ostdeutschen Bundesländer zur BRD brachte 1990 eine stille Erweiterung
der EG mit sich.
Der Gründungsvertrag der EWG von 1957 setzte für die Verwirklichung des gemeinsamen
Marktes einn Zeitraum von zwölf Jahren an. Während es in dieser Frist gelang, die Zollschran-
ken zwischen den beteiligten Ländern abzubauen und einen gemeinsamen Außenzolltarif ein-
zuführen, ließ die Verwirklichung anderer Elemente eines Gemeinschaftsmarktes weiter auf
sich warten. Erst 1985 einigten sich die EG-Mitglieder auf das Ziel, bis Ende 1992 alle noch
bestehenden Schranken innerhalb der Gemeinschaft zu beseitigen, und damit einen echten Bin-
nenmarkt zu schaffen - einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren,
Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet und weder durch technische noch durch
rechtliche oder steuerliche Schranken eingeschränkt wird. Im Juni 1985 wurde von der EG-
Kommission auf Wunsch des Europäischen Rates (Begriff siehe unten) das Weißbuch zur
Vollendung des Europäischen Binnenmarktes (Gemeinsamen Marktes) vorgelegt, welches
das Programm und den Zeitplan für die Binnenmarktvollendung festlegte. Im Dezember 1985
beschloß der Europäische Rat die Schaffung des europäischen Binnenmarktes bis Ende 1992
und verabschiedete die Einheitliche Europäische Akte (EEA), die die erste große Revision des
EWG-Vertrages darstellt und auch die rechtliche Absicherung zur Verwirklichung des Bin-
nenmarktes beinhaltet, indem sie den Art. 8a EWGV mit einer Binnenmarktdefinition und der
zeitlichen Zielvorstellung "1992" einführte.
Durch das Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte mit Juli 1987 wurde die Kom-
petenz der Gemeinschaft auch in bis dahin ungeklärten Bereichen geregelt. Die zentrale Neue-
rung der EEA und ihre Bedeutung für den Binnenmarkt liegt jedoch in der geänderten Hand-
habung des Beschlußfassungsprozesses im Europäischen Rat gemäß Art. 100a EWGV. In
weiten Bereichen wurde das Einstimmigkeitserfordernis zugunsten von Mehrheitsentscheidun-
gen aufgegeben; Ausnahme ist z. B. der gesamte Steuerbereich (Streil, Weyringer 1991, S.
290ff). Neben der Harmonisierung von Rechtsvorschriften, technischen und statistischen Nor-
men wird in letzter Zeit die gegenseitige Anerkennung von einzelstaatlichen Normen prakti-
ziert. In der Praxis stellte sich nämlich die Harmonisierung als umständlich und langwierig her-
aus. Außerdem war die Harmonisierung aufgrund der Vielzahl der technischen und anderen
Vorschriften organisatorisch nicht mehr zu bewerkstelligen.
19
Die "vier Freiheiten" des 1993 formell vollendeten, aber in mancher Hinsicht noch nicht voll-
ständig realisierten EG-Binnenmarktes, der die Beseitigung aller Handels- und Mobilitäts-
hemmnisse vorsieht, umfassen die folgenden:
• Freiheit des Warenverkehrs: Die Binnenmarkt-Mitglieder dürfen weder Zölle, mengenmäßi-
ge Beschränkungen noch technische Handelshemmnisse im Warenhandel mit den Vertrags-
partnern erlassen. Ausnahmen bilden die Landwirtschaft und die Fischerei. Außerdem sind
die Grenzkontrollen weggefallen.
• Freiheit des Dienstleistungsverkehrs: Unternehmen und freiberuflich Tätige eines Landes
dürfen in jedem anderen Binnenmarkt-Land ihre Dienstleistungen erbringen. Von besonde-
rer Bedeutung sind dabei vor allem die Finanzdienstleistungen (Banken und Versicherun-
gen), der Straßen- und Lufttransport sowie die Telekommunikationsdienste.
• Freiheit des Kapitalverkehrs: Finanzanlagen, unternehmerische Direktinvestitionen und der
Erwerb von Immobilien durch private Haushalte unterliegen keinen Beschränkungen. Falls
der freie Kapitalverkehr zu Störungen auf dem Kapitalmarkt oder in der Zahlungsbilanz
führt, sind Schutzmaßnahmen allerdings möglich.
• Freiheit des Personenverkehrs: Sie umfaßt die Freizügigkeit für natürliche und juristische
Personen. Arbeitnehmer erhalten in allen Binnenmarkt-Staaten das Arbeits- und Niederlas-
sungsrecht sowie das Recht auf Familiennachzug. Eine notwendige Voraussetzung der frei-
en Berufstätigkeit bildet die gegenseitige Anerkennung von Diplomen.
Die 1991 ausverhandelten und am 1. November 1993 in Kraft getretenen Maastricht-Verträge
sehen eine Europäische Union (EU) vor, die zu einem Teil die drei bestehenden Gemein-
schaften (EWG, EURATOM, EGKS) umfaßt, wobei künftig die bisherige EWG nunmehr Eu-
ropäische Gemeinschaft (EG) heißt und zur Wirtschafts- und Währungsunion ausgestaltet
wird (die Abkürzung EG war schon vorher gebrächlich, nämlich für die Gesamtheit der Euro-
päischen Gemeinschaften). Darüber hinaus bekennt sich die EU zu einer gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik und zu einer Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres. Im
folgenden werden die Organe der Europäischen Union kurz dargestellt.
Im Europäischen Rat, der in den EWG-Gründungsverträgen nicht in dieser Form vorgesehen
war, tagen zweimal jährlich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer (heute EU-
Länder) und der Präsident der Europäischen Kommission, um über Grundsatzfragen der euro-
päischen Zusammenarbeit und internationalen Politik zu beraten und zu beschließen. Der Eu-
ropäische Rat ist das Lenkungs- und Impulsorgan innerhalb der EU. In diesem Gremium fallen
die wichtigsten politischen Entscheidungen.
Der Rat (Ministerrat) ist nach dem Europäischen Rat das oberste Entscheidungsgremium der
Europäischen Union. In ihm treten die Außenminister oder die jeweils zuständigen Fachmini-
20
ster als weisungsgebundene Vertreter der nationalen Regierungen zur Beratung und Be-
schlußfassung zusammen. Der Rat ist somit das gesetzgebende Organ der Gemeinschaft (zum
Europaparlament siehe unten). Weitere wichtige Aufgaben des Rates sind die Kontrolle der
Kommission, die Entlastung der Kommission in Haushaltsfragen (gemeinsam mit dem Europäi-
schen Gerichtshof), die Definition politischer Ziele und die Wahrung der Interessen der Einzel-
staaten im Ausgleich mit den Interessen der EG bzw. EU.
Die Kommission der Europäischen Union (Europäische Kommission) mit ihren 20 Kom-
missaren - einer davon aus Österreich - ist als unabhängiges, überstaatliches Organ den ge-
meinschaftlichen Interessen der Union (früher EG) verpflichtet. Sie ist einerseits für die
Durchführung der Ratsbeschlüsse und die Anwendung der EG-Vertragsbestimmungen verant-
wortlich und hat andererseits ein weitgehendes Initiativ- und Vorschlagsrecht, mit dem sie die
Entwicklung der Gemeinschaft vorantreiben kann. Vorschläge der Kommission dürfen vom
Rat nur einstimmig abgeändert werden.
Das Europäische Parlament, dessen 626 Mitglieder - davon sind 21 aus Österreich - in den
EU-Ländern direkt gewählt werden, ist im Vergleich zu den nationalen Parlamenten nur mit
begrenzten Rechten ausgestattet. Es wirkt innerhalb bestimmter Grenzen am Zustandekommen
des Gemeinschaftshaushaltes mit und verfügt im sogenannten Kooperationsverfahren, das für
die EU-Gesetzgebung zum Europäischen Binnenmarkt eingeführt wurde, über erweiterte Mit-
spracherechte. Neue Beitritts- und Assoziierungsabkommen sind von der Zustimmung des
Parlaments abhängig. Im übrigen ist das Europa-Parlament auf Kontroll- und Anhörungsrechte
beschränkt. Durch die Verträge von Maastricht über die Europäische Union wurde seine Stel-
lung aber deutlich aufgewertet. Es kann jetzt viele Bereiche der europäischen Politik mitge-
stalten und miteintscheiden (z. B. Zustimmungsrecht zur Einsetzung einer neuen Europäischen
Kommission, Mißtrauensantragsrecht gegen die Kommission).
Der Europäische Gerichtshof (Zusammensetzung 15 Richter und 8 Generalanwälte) hat als
supranationale Einrichtung dafür zu sorgen, daß das auf europäischer Ebene geschaffene Ge-
meinschaftsrecht gewahrt und richtig angewandt wird. Er entscheidet über die Auslegung der
EU-Rechtsnormen (z.B. bei Streitigkeiten zwischen EU-Organen und Mitgliedsstaaten) und
kann von allen angerufen werden, die unmittelbar von Rechtsakten der Union betroffen sind.
4.2. EU-Haushalt
Der Umfang des Gesamthaushaltsplanes der EG betrug für das Haushaltsjahr 1994 70 Mrd.
ECU (Europäische Rechnungseinheit European Currency Unit). Verglichen mit dem BIP aller
21
15 Mitgliedsstaaten zusammen entspricht dies 1,4 %, und gemessen an der Summe der 15 na-
tionalen Haushalte ist der EU-Haushalt mit ca. 2,8 % von eher bescheidenem Umfang. Die
Einnahmen ergeben sich aus Beiträgen der Mitgliedsstaaten, die sich aus verschiedenen Kom-
ponenten zusammensetzen:
• Einnahmen aus Zöllen und Agrarabschöpfungen,4
• festgesetzte Abgaben für Zucker und Traubenzucker, die in der EG hergestellt werden,
• ein bestimmter Anteil (1,4 %) der Mehrwertssteuereinnahmen der Mitgliedsstaaten,
• ein Beitrag entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsstaaten
("BSP-Eigenmittel").
Die Einnahmen- und Ausgabenstruktur des EU-Haushalts ist in Tabelle 1 dargestellt.
Tabelle 1: Anteile der verschiedenen Einnahmen und Ausgaben am Gesamthaushalt
der EU 1994
Einnahmenstruktur Ausgabenstruktur
Mehrwertsteuer- Agrarmärkte 57,5 %
Eigenmittel 55,0 % Regional- und Verkehrspolitik 11,0 %
BSP-Eigenmittel 23,0 % Sozialpolitik 8,3 %
Zölle 19,0 % Forschung, Energie, Umwelt 3,7 %
Agrarabschöpfungen 2,0 % Entwicklungspolitik 3,5 %
Zuckerabgabe 1,0 % Sonstiges 16,0 %
Summe 100,00 % Summe 100,00 %
Quelle: Weidenfeld, Wessels 1996.
Mit den Verträgen von Maastricht ergibt sich die Notwendigkeit, das Haushaltssystem der EU
zu reformieren, um die neuen Aufgaben entsprechend erfüllen zu können. Die Kosten der Wirt-
schafts- und Währungsunion (siehe unten), des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts,
der Entwicklung neuer Politiken sowie für die Unterstützung der Länder Osteuropas und der
Dritten Welt müssen aufgebracht werden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, wird das Haushalts-
budget bis 1997 auf mindestens 80 Mrd. ECU steigen (die neue Höchstgrenze ist 1,2 % des
EU-BIP statt der seit 1988 gültigen 1,1 %). Die zusätzlichen Mittel werden vorwiegend dazu
eingesetzt werden, im Vorfeld der Wirtschafts- und Währungsunion die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung der ärmeren Regionen der Gemeinschaft zu beschleunigen sowie die inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken.
22
4.3. EU-Regional- und Strukturpolitik
Die Länder und stärker noch die Regionen der EU unterscheiden sich bezüglich der ökonomi-
schen Situation (z. B. gemessen an Indikatoren wie der Arbeitslosenquote) sehr stark. Wie
Schoneweg (1991, S. 237) schreibt, wird "die Strukturpolitik, deren integrierter Bestandteil die
Regionalpolitik ist, damit zu einer der größten politischen Aufgaben der Gemeinschaft in der
Gegenwart". Im Jahr 1994 wurden hierfür nicht weniger als 29 % der Mittel des Gemein-
schaftshaushaltes (21,3 Mrd. ECU) aufgewendet. Damit wird die Strukturpolitik zum zweit-
größten Haushaltsposten nach der Gemeinsamen Agrarpolitik.
Die Strukturpolitik konzentriert sich auf fünf vorrangige Ziele:
(1) die Förderung der Entwicklung und strukturellen Anpassung der Regionen mit Entwick-
lungsrückstand durch Ankurbelung der produktiven Investitionen,
(2) die Umstellung der Regionen und Grenzregionen mit rückläufiger industrieller Entwick-
lung mit dem Ziel der Wiedereingliederung in den Prozeß der wirtschaftlichen Entwick-
lung,
(3) die Bekämpfung der Langzeit-, Jugend- und Altersarbeitslosigkeit,
(4) die Erleichterung der Anpassung der Arbeitskräfte an die industriellen Wandlungsprozes-
se,
(5a) Anpassung der Erzeugungs-, Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen in der Land-
und Forstwirtschaft sowie
(5b)die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums.
Zur Erreichung dieser fünf Ziele werden primär die drei Strukturfonds und die Europäische
Investitionsbank eingesetzt. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gibt
Zuschüsse, die zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte beitragen sollen,
durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) soll die Beschäftigung gefördert werden, und durch
den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) soll die
Anpassung der Agrarstrukturen im Sinne der Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik be-
schleunigt werden. Die Europäische Investitionsbank und die sonstigen Förderungsinstitu-
tionen (EGKS, EURATOM, das Neue Gemeinschaftsinstrument) nehmen Anleihen auf und
vergeben sie als Darlehen an Wirtschaftsakteure. Die Investitionsbank gibt ihre Darlehen an
Gebiete, die einen Entwicklungsrückstand aufweisen oder deren Industrien sich im Niedergang
befinden Die EGKS vergibt solche Darlehen speziell für Untenehmen der Kohle- und Stahlin-
dustrie. Diese Aktionen der Union ergänzen entsprechende Maßnahmen der Mitgliedstaaten
oder tragen zu deren Unterstützung bei. Sie erfolgen in partnerschaftlicher Abstimmung zwi-
schen Kommission, Mitgliedstaaten und regionalen Instanzen. Die Durchführung der gemein-
23
samen Politiken und die Errichtung des Binnenmarktes erfordern, das Ziel der Kohäsion zu
berücksichtigen und zu seiner Verwirklichung beizutragen.
4.4. Die gemeinsame Agrarpolitik in der EU
Steigende Agrarüberschüsse, wachsende Spannungen im Welthandel aufgrund der hohen Ex-
portsubventionen, die die EU bezahlt, um die Agrarüberschüsse auf dem Weltmarkt verkaufen
zu können, und anhaltende Unzufriedenheit der Bauern, deren Einkommen hinter denen ande-
rer Wirtschaftszweige zurückbleiben, kennzeichnen die Situation, der mit der Gemeinsamen
Agrarpolitik (GAP) entgegengewirkt werden soll (Ausgaben im Jahr 1994: 40,2 Mrd. ECU).
Seit der Konferenz von Stresa im Jahr 1958 beruht die Gemeinsame Agrarpolitik im wesentli-
chen auf drei Grundsätzen:
(1) Markteinheit bedeutet einen gemeinsamen Markt (also einen Binnenmarkt) für agrarische
Produkte, durch den Wettbewerbsverzerrungen aufgrund unterschiedlicher Marktordnun-
gen verhindert werden sollen.
(2) Gemeinschaftspräferenz ist das Prinzip, den Absatz der Ararprodukte auf dem Binnen-
markt zu bevorzugen. Agrarprodukte aus Drittländern dürfen nicht unter den Preisen ver-
kauft werden, die für die im EU-Gebiet erzeugten Waren gelten.
(3) Finanzielle Solidarität heißt, daß die Kosten der gemeinsamen Agrarpolitik aus einem ge-
meinsamen Fonds, dem Europäischen Ausgleichs- und Garantiefonds für die Landwirt-
schaft (EAGFL) getragen werden, unabhängig davon, welches Produkt oder welches Land
gefördert wird.
Durch das Senken der EG-Agrarpreise auf das Weltmarktniveau und den Abbau von Über-
schüssen sollen die landwirtschaftlichen Strukturen in der Gemeinschaft grundlegend verändert
werden. Ziel ist es, den Anteil der Agrarausgaben am Budget durch die Reform der Gemein-
samen Agrarpolitik zu reduzieren, und zwar möglichst ohne Einkommensverluste für die Bau-
ern, was aber wegen der Notwendigkeit des Produktionsabbaus Ausgleichszahlungen für die
Bauern notwendig macht. Im Juli 1992 einigten sich die EU-Agrarminister auf eine Reform,
aufgrund derer die Bauern subventioniert werden, wenn sie ihre Anbauflächen für Getreide,
Ölsaaten und Eiweißpflanzen stillegen oder ihre Tierbestände reduzieren. Die Reform der
Agrarpolitik soll neben dem Abbau von Überschüssen auch die Umweltverträglichkeit der
landwirtschaftlichen Produktion fördern.
24
4.5. Die gemeinsame Handelspolitik in der EU
Die gemeinsame Handelspolitik baut auf die Zollunion und den Binnenmarkt auf. Sie ist die
wichtigste außenpolitische Teilkompetenz der EU. Ein wesentliches Ziel der Gemeinsamen
Handelspolitik ist es, den Gemeinschaftsmarkt für Drittländer offenzuhalten, wobei versucht
wird, Lösungen für die verschiedenen Fragen des Marktzugangs im Sinne eines "Gleichge-
wichts der gegenseitigen Vorteile" auszuhandeln. Mit Ausnahme der zur Zeit noch weltweit
geschützten Bereiche Landwirtschaft, Textilien und Stahl ("sensible Waren") ist dieses Ziel
weitgehend erreicht werden. Im Zuge der faktischen Vollendung des Binnenmarktes sollen die
mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen der EU-Länder aus Drittstaaten aufgehoben bzw. bei
sensiblen Waren schrittweise abgebaut werden. Im Rahmen der GATT-Verhandlungen hat die
EU (mit Ausnahme ihres Widerstands gegen die internationale Agrarmarktliberalisierung) ver-
sucht, im Sinne der Prinzipien des Wirtschaftsliberalismus zur Stärkung des GATT beizutra-
gen. So hat sie gemeinsam mit den USA führend am Abbau der Zölle mitgearbeitet. In den
Fragen des Subventionsabbaus hat die EU eine mittlere Position zwischen der Forderung der
USA nach einem völligen Subventionsverbot und der Position der Entwicklungsländer, die
Subventionen als notwendiges Element der Wirtschaftsförderung ansehen, eingenommen. Zum
Schutz vor Importen zu Dumping-Preisen werden von der EU "Anti-Dumping-Zölle" ver-
hängt. Diese Zölle betreffen aber in Relation zu den Gesamtimporten nur ein unerheblich ge-
ringes Handelsvolumen und beeinflussen somit weder Struktur noch Umfang des Außenhan-
dels entscheidend. In bilateralen Verhandlungen versucht die EU einerseits, ihr Handelsbilanz-
problem mit Japan und die Differenzen mit den USA im Agrarbereich zu lösen, was aber bisher
noch nicht gelungen ist. Andererseits arbeitet sie am Ausbau präferenzieller Handelsbeziehun-
gen mit dem Motiv eines gesamteuropäischen politischen Assoziierungsprozesses (z. B. die
Europaverträge mit den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas: vgl. Abschnitt 5.3.).
4.6. EUREKA - Technologische Zusammenarbeit in Europa
Im wissenschaftlich-technischen Wettlauf mit den USA und Japan geraten die Europäer oft ins
Hintertreffen. Die Hauptursachen liegen in der nationalen und fachlichen Zersplitterung der
europäischen Forschungs- und Entwicklungsansätze. Um diesem unbefriedigenden Zustand
abzuhelfen und das vorhandene Potential in Zukunft besser zu nutzen, wurde Mitte 1985 in
Paris das Europäische Technologie- und Forschungsprogramm EUREKA ins Leben gerufen.
Ihm gehören 19 westeuropäische Länder, darunter alle EU- und EFTA-Mitglieder, sowie die
Kommission der EU an. Nach der 1985 in Hannover beschlossenen Grundsatzerklärung dient
EUREKA dem Ziel, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Unternehmen und For-
schungsinstitutionen auf dem Gebiet der Hochtechnologie zu fördern und dadurch die Produk-
25
tivität und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaften Europas zu steigern.
EUREKA ergänzt damit die schon zuvor existenten Ansätze gemeinsamer Forschung, wie sie
beispielsweise im Rahmen der EU oder der Europäischen Weltraumbehörder (European Space
Agency ESA). Während die traditionellen EU-Programme auf die langfristige Förderung
marktferner Grundlagenforschung und die Ausarbeitung gemeinsamer technischer Normen
abzielen, soll EUREKA vor allem die Entwicklung marktfähiger Produkte, Verfahren und
Dienstleistungen vorantreiben.
4.7. Einheitliche Europäische Akte und die Europäische Währungsunion (EWU)
Die im Jahr 1991 gefaßten Beschlüsse von Maastricht bedeuten die weitgehende Umsetzung
der 1985 beschlossenen "Einheitlichen Europäischen Akte". Der Europäische Rat hat sich dort
auf die Verträge über die Politische Union und über die Wirtschafts- und Währungsunion
(WWU) geeinigt, die nach den erforderlichen Ratifizierungen durch die EU-Mitgliedstaaten mit
1. November 1993 in Kraft getreten sind. Neben der Politischen Union soll zur weiteren Ver-
tiefung der wirtschaftlichen Integration in der EU nach dem Binnenmarkt auch eine einheitliche
Währung - der EURO - eingeführt werden.
Im Delors-Bericht der Europäischen Kommission wurde 1989 die Auffassung vertreten, daß
die Vorteile des Gemeinsamen Marktes erst bei fixen Wechselkursen zwischen den Mitglieds-
staaten voll ausgeschöpft werden können. Die Destabilisierung im Wechselkursgefüge des
EWS 1992/93 sollen nach Angaben der Europäischen Kommission Einbußen in Höhe von ei-
nem halben Prozent des gemeinschaftlichen BIP verursacht haben. Weiters wurde von Delors
argumentiert, daß völlige Wechselkursstabilität nur durch eine einheitliche europäische Geld-
politik erzielt werden können, zumal die vollkommene Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit
verstärkten spekulativen Kapitalbewegungen verbunden wäre. Obwohl eine einheitliche Wäh-
rung für eine geldpolitische Union nicht unbedingt erforderlich ist, werden für als Vorteile der
geplanten Gemeinschaftswährung EURO vor allem die leichtere Handhabung der gemein-
schaftlichen Geldpolitik und die Senkung der Transaktionskosten in den Wirtschaftsbeziehun-
gen zwischen den EWU-Teilnehmerländern ins Treffen geführt.
4.7.1. Die Maastricht-Konvergenzkriterien für die EWU
Anhand festgelegter Konvergenzkriterien wird die wirtschaftliche Konvergenz der EWU-
Teilnehmerstaaten gemäß Art. 109 überprüft. Eine Präzisierung dieser sehr allgemeinen Krite-
rien erfolgt in einem dem Vertrag beigefügten Protokoll. Diese lauten:
26
• Die Inflationsrate darf nicht mehr als 1,5 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der drei
Länder mit der niedrigsten Teuerungsrate liegen.
• Die Zinssätze dürfen in den zurückliegenden 12 Monaten nicht mehr als 2 Prozentpunkte
über dem Durchschnitt der drei Länder mit den niedrigsten Zinssätzen gelegen sein.
• Das laufende öffentliche Defizit (die Nettoneuverschuldung) aller Gebietskörperschaften
darf 3 % und die öffentliche Gesamtverschuldung aller Gebietskörperschaften 60 % des BIP
nicht überschreiten.
• Der Wechselkurs muß sich während zweier Jahre innerhalb der vom Europäischen Wäh-
rungssystem vorgesehenen Bandbreite (EWS-Band) entwickelt haben.
Bei der Betrachtung einzelner Länder hinsichtlich der Erfüllung dieser Konvergenzkriterien
werden große Probleme bezüglich der Verwirklichung der EWU für viele Mitgliedsländer of-
fensichtlich (vgl. Tabelle 2).
Tabelle 2: Erfüllung der Konvergenzkriterien der EU-Länder 1995
Erfüllung der
Konvergenzkriterien Inflations- Budget- Staats- Zins- Qualifiziert
im Jahr 1995 rate saldo schuld sätze Juni 1995
Belgien 1,5 -4,5 134,4 7,6 Nein
Deutschland 1,8 -3,6 58,8 6,6 Nein
Dänemark 2,0 -2,5 73,6 8,4 Nein
Finnland 1,2 -5,4 63,2 8,0 Nein
Frankreich 1,9 -5,0 51,5 7,5 Nein
Griechenland 9,2 -9,3 114,4 18,4 Nein
Großbritannien 3,0 -5,1 52,5 8,3 Nein
Irland 2,5 -2,7 85,9 8,3 Nein
Italien 5,6 -7,4 124,9 11,7 Nein
Luxemburg 1,9 0,4 6,3 6,2 Ja
Niederlande 1,6 -3,1 78,4 7,2 Nein
Österreich 2,4 -5,5 69,2 6,5 Nein
Portugal 4,2 -5,4 70,5 11,4 Nein
Schweden 2,8 -7,0 81,4 10,1 Nein
Spanien 4,9 -5,9 64,8 11,1 Nein
Kriterien: 2,9 -3,0 60,0 9,6 Ja
Quelle: OECD, laufende Berichte
27
Hierbei scheint nahezu ausgeschlossen, daß Griechenland, Italien und Belgien angesichts ihrer
Staatsschuldenquoten bis April 1997 die geforderten Bedingungen erreichen können. Für Grie-
chenland gilt dies auch bezüglich seiner Inflationsrate von über 9 %. Die Schwierigkeit läßt
sich am Beispiel Italiens leicht demonstrieren: Allein um die Staatsschuldenquote vom jetzigen
Niveau von 100 % im Jahr 1999 zurückzuführen, müßte Italien einen primären, das bedeutet,
einen um die Zinsenzahlung bereinigten Budgetüberschuß in Höhe von 4 % erzielen. Denn die
Staatsschuldenquote wird bei einem Realzins von rund 6 % (1995) um mehr erhöht als das
reale Wachstum des Sozialproduktes von rund 3 % sie zu senken vermag, so daß es eines pri-
mären Überschusses bedarf, um eine weitere Zunahme der Staatsschuldenquote zu vermeiden.
Soll Italien jedoch die budgetpolitische Konvergenzbedingung von maximal 60 % Staatsver-
schuldung gemessen am BIP bis Anfang 1999 erfüllen, müßte der primäre Überschuß 12 % des
Sozialprodukts betragen. Dies würde eine Erhöhung der Steuerquote um 15 Prozentpunkte
bzw. eine Erhöhung der Steuersätze um 45 % erfordern - sicherlich Maßnahmen, die politisch
nicht durchsetzbar sind und wirtschaftspolitisch wegen der deshalb entstehenden Rezession
keinen Sinn machen. Für Belgien und Griechenland gelten ähnliche Größenordnungen. Die
Steuerquote müßte in Belgien um 24 und in Griechenland um 22 Prozentpunkte erhöht wer-
den. Aber auch Portugal, die Niederlande und Deutschland haben einen beträchtlichen fiskal-
politischen Anpassungsbedarf.
Die Konvergenzkriterien können bis zur Entscheidung über die Teinehmerstaaten an der EWU
in der ersten Hälfte von 1998, die auf der Datenbasis von 1997 erfolgt, von mindestens drei
Mitgliedsländern mit Sicherheit, von zwei weiteren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt
werden. Doch schon im Zusatzprotokoll des 1993 ratifizierten Vertragswerks von Maastricht
wurden diese Kriterien in ihrer Striktheit abgemildert. Statt der Erfüllung der Drei-Prozent-Re-
gel für die Nettoneuverschuldungsquote genügt es auch, daß die Quote erheblich und laufend
sinkt oder nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und in beiden Fällen in
der Nähe des Referenzwertes liegt. Statt der Erfüllung der Sechzig-Prozent-Regel für die Ver-
schuldung ist es hinreichend, wenn die Quote rückläufig ist und sich rasch genug dem Refe-
renzwert nähert. Diese eher "schwammigen" Formulierungen lassen vermuten, daß von den
stark verschuldeten Ländern zwar einige Konsolidierungsbemühungen erwartet werden, daß
aber Höhe und Veränderung der Staatsverschuldung keine entscheidende Bedingung für den
EWU-Beitritt darstellen. Dagegen moniert die BRD als das EU-Mitgliedsland mit der stärksten
Präferenz für Währungsstabilität - die Bundesbank und der Bundesfinanzminister sind relativ
stark monetaristisch ausgerichtet - die strikte Einhaltung der Konvergenzkriterien, besonders
der fiskalischen. Wie die meisten anderen EU-Staaten muß auch Österreich große budgetpoliti-
sche Anstrengungen unternehmen und hat dies 1996 auch getan, um zumindest das Neuver-
schuldungskriterium erfüllen und Gründungsteilnehmer in der EWU werden zu können.
28
4.7.2. Die Verwirklichung der EWU
Die Realisierung der EWU ist in drei Stufen vorgesehen:
• Ziele der ersten Stufe waren die Vollendung des Binnenmarktes (ursprünglich geplanter
Beginn war Juli 1992), die Teilnahme aller Länder am Wechselkursmechanismus und eine
verstärkte Kooperation im wirtschaftlichen und monetären Bereich. Selbst die Ziele der er-
sten Stufe sind allerdings bis heute nicht zur Gänze erreicht worden. Einige Länder haben
aufgrund der Schwäche ihrer Währung bzw. als Folge einer eigenständigen Zinsenpolitik
(GB, Italien) den Europäischen Währungsverbund bereits wieder verlassen. Die jüngsten
Währungsturbulenzen 1992/93 führten zu einer Vergrößerung der erlaubten Schwankungs-
bandbreiten für die Wechselkurse (plus/minus 15 %).
• In der zweiten Stufe - Beginn war der 1. Jänner 1994 - werden die instutionellen und wirt-
schaftlichen Voraussetzungen für die dritte Stufe geschaffen. Mit diesem Datum wurde das
Europäische Währungsinstitut (EWI) in Frankfurt am Main errichtet, das die nationalen
Geldpolitiken koordinieren, das EWS überwachen und schließlich die private Verwendung
des EURO fördern soll. Bis spätestens Mitte 1998 soll das EWI durch das Europäische Sy-
stem der Zentralbanken (ESZB) ersetzt werden. Das ESZB soll aus der Europäischen Zen-
tralbank (EZB), die aus dem EWI hervorgehen und ebenfalls in Frankfurt ihren Sitz haben
wird, und den nationalen Zentralbanken bestehen, die allerdings bis zu diesem Datum unab-
hängig sein müssen. Im Jahr 1998 soll der Europäische Rat so früh wie möglich, spätestens
aber bis Jahresmitte auf der Basis der Budget- und Wirtschaftsdaten von 1997 mit qualifi-
zierter Mehrheit den Eintritt in die dritte Stufe beschließen, falls eine Mehrheit der Mitglie-
der die Konvergenzkritierien erfüllt, und entscheiden, welche EU-Länder (von Beginn an)
an der EWU teilnehmen. Großbritannien und Dänemark sind zum Eintritt in die dritte Stufe
nicht verpflichtet.
• Der Beginn der dritten Stufe ist für 1. Jänner 1999 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt wird
die Währungsunion vollzogen, indem die Finanzminister gemeinschaftlich die Wechselkurse
der Teilnehmerwährungen zum EURO unwiderruflich festlegen. Der EURO wird letztlich
die einzige Währung der EWU bilden, in der auch die Gemeinsame Geldpolitik erfolgt. Bis
2001 sollen alle Rechnungswesen von den nationalen Währungen auf den EURO umgestellt
werden. Spätestens mit Jahresbeginn 2002 soll mit der Ausgabe des EURO-Bargelds be-
gonnen werden. Dann sollen bei anfänglich paralleler Verwendung von nationalen Währun-
gen und EURO binnen Halbjahresfrist alle Transaktionen in EURO abgewickelt werden.
Obwohl die Einführung einer Währungsunion für EU-Europa unter Ökonomen umstritten ist,
sowohl was die Konzeption generell als auch das Tempo ihrer Realisierung betrifft, wird auf
EU-Ebene politisch an der planmäßiger Realisierung der EWU festgehalten und gegenwärtig
29
lediglich diskutiert, welche EU-Mitglieder von Anfang an teilnehmen dürfen. Die ökonmomi-
schen Auswirkungen der Europäischen Währungsunion werden in Kapitel VII diskutiert.
5. Tendenzen und Perspektiven Österreichs
Aufbauend auf die bisherigen Überlegungen stellt sich die Frage, wie die österreichischen Per-
spektiven unter den gegenwärtigen ökonomischen Entwicklungstendenzen, innerhalb der sich
abzeichnenden weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und auf dem Kurs in Richtung Grün-
dungsmitgliedschaft in der EWU aussehen mögen.
5.1. EU-Integration Österreichs
Das Gemeinschaftsrecht der EU als der einzigen supranationalen Organisation stellt ein
weltweites Unikum dar. Die EU-Mitgliedschaft bringt durch die Geltung des Primärrechts (Ge-
meinschaftsverträge), der Verordnungen, Entscheidungen und Richtlinien der Union für Öster-
reich die unmittelbarsten Veränderungen der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen der
Nachkriegszeit mit sich. Der Hauptimpuls, der von der Rechtsangleichung ausgeht, besteht
wohl in der Liberalisierung der österreichischen Wirtschaftsordnung, insbesondere im Bereich
monopolistischer Betriebe, bei Finanzdienstleistungen und im öffentlichen Beschaffungswesen.
Dadurch soll unmittelbar ein effizienterer Ressourceneinsatz in bislang geschützten Sektoren
und dadurch mittelbar (infolge der Alternativkostensenkung) auch ein Konkurrenzvorteil für
den exponierten Sektor bewirkt werden. Darüber hinaus soll der freie Zugang zum Gemein-
samen Markt die Transaktionskosten im EU-Binnenhandel reduzieren (Wegfall der Grenz-
kontrollen im Wirtschaftsverkehr), die Absatzchancen im Export steigern und damit die Aus-
nützung weiterer Skalenvorteile in der Produktion ermöglichen. Der dynamische Vorteil wirt-
schaftlicher Integration in Form einer langfristigen Steigerung des Handelsvolumens ("trade
creation"), Angebotsspezialisierung ("trade specialization") und Anhebung des Wachstumspfa-
des wird durch verschiedene empirische Untersuchungen gestützt, die vor dem theoretischen
Hintergrund der neuen Außenhandels- und Wachstumstheorie unternommen wurden (Kenen
1994, S. 272ff.). Vom Zusammenwirken der Intensivierung des Wettbewerbs durch Liberali-
sierung und der Nutzung weiterer Außenwirtschaftsmöglichkeiten und ihrer Produktivitätsstei-
gerungspotentiale erwartet man sich eine Erhöhung der österreichischen Wohlfahrt (höherer
Output, geringere Inflation). Weiters ist damit zu rechnen, daß aufgrund der EU-Mitgliedschaft
die ausländischen Direktinvestitionen in Österreich zunehmen, indem internationale Unter-
nehmen nicht nur die österreichischen Standortvorteile (insbesondere die Qualität des Hu-
mankapital und den sozialen Frieden) nützen, sondern auch die Vorteile eines Standortes in-
30
nerhalb der EU, um den Außenschutz (die "Mauern") der wirtschaftlichen "Festung" EU-
Europa zu überwinden.
Als EFTA-Mitglied (seit 1960), das formell seit 1972 und effektiv seit 1977 durch einen Asso-
ziierungsvertrag mit der EG bzw. EU verbunden ist, und selbst als EWR-Teilnehmer befand
sich Österreich nur in einer Freihandelszone. Zusätzlich war Österreich als Nicht-Mitglied der
EU in seinem Außenhandel durch EU-Handelsregulierungen wie die EU-Ursprungslands-
bestimmungen deutlich benachteiligt, insbesondere im Handel mit den Reformstaaten Mittel-
und Osteuropas. Als EU-Mitglied ist Österreich nun in einer Zollunion, in der auch die Au-
ßenzölle zu Drittstaaten vereinheitlicht sind. Dabei sind die nationalen Kompetenzen auf die
Gemeinsame Handelspolitik übergegangen. So mußte das Hochzolland Österreich seine Au-
ßenzölle etwa halbieren und konnte seine autonomen Verhandlungen mit der WTO nicht fort-
führen, sondern mußte EU-konform die Verpflichtung der Uruguay-Runde des damaligen
WTO übernehmen, in den nächsten fünf bis zehn Jahren die Zölle um 37 % zu reduzieren. Die-
ser vorübergehende Nachteil der verstärkten Öffnung dürfte jedoch durch die erwähnten Vor-
teile für Exporte in die Reformstaaten und in die EU sowie durch den Dämpfungseffekt auf die
Inflation überkompensiert werden.
Eine Simulation der makroökonomischen Effekte des EU-Beitritts auf die österreichische
Wirtschaft für die Periode 1995-2006 (Schneider 1996) ergibt positive Effekte auf das BIP,
das Masseneinkommen und die Beschäftigung. Bei der Simulation wurde davon ausgegangen,
daß zusätzliche ausländische Direktinvestitionen in EU-Österreich getätigt werden. Auch
wurde berücksichtigt, daß die Wohlstandsgewinne aus der EU-Mitgliedschaft durch Güter-
nachfrageabflüsse reduziert werden, die aufgrund von höheren indirekten Steuern als in der
BRD, insbesondere der Mehrwertsteuer (+ 5 Prozentpunkte im Normalfall), entstehen. Zusätz-
lich fand Beachtung, daß zuvor geschützte Sektoren (Telekommunikation, Gelbe Post, Nah-
rungs- und Genußmittelproduktion, Handel) nicht frühzeitig durch eine antizipative Struktur-
und Wettbewerbspolitik auf den erhöhten Konkurrenzdruck in der EU hinreichend vorbereitet
worden wären. Infolge dessen seien während der nun angebrochenen Anpassungsphase ent-
sprechende Marktanteilsverluste hinzunehmen. Von den positiven Integrationseffekten auf das
BIP und die Beschäftigung würden 50 bis 70 % des zusätzlichen BIP und 30 bis 55 % der in-
duzierten Beschäftigung verlorengehen.
Die Problematik der empirischen Erfassung der Integrationseffekte liegt - abgesehen vom
jeweils verwendeten Modell und dem Umstand, daß die Wirtschaftsentwicklung von mehr
Faktoren als bloß von der wirtschaftlichen Integration bestimmt wird (Weltkonjunktur, Ostöff-
nung, Globalisierung, WTO-Bestimmungen) - im jeweiligen Basisszenario. Diese Grundsimu-
lation der hypothetischen Wirtschaftsentwicklung ohne Integrationseffekte kann nie ein zuver-
31
lässiges Referenzbild abgeben. Daher liegen auch unterschiedliche Evaluationen der Integration
Österreichs in die europäische Wirtschaft vor.
Die Auswirkungen der Europäischen Integration auf Österreich, die Breuss (1996, S. 209
ff.) für die Jahre 1993-95 simuliert hat, sind in Tabelle 3 dargestellt. Erfaßt werden die Inte-
grationseffekte werden als die Abweichungen der Integrationssimulation - des "Integrations-
szenarios" - von der Grundsimulation, das heißt vom "Basisszenario", das sich ohne die EWR-
Realisierung von 1993 sowie ohne die EWR-Teilnahme und den EU-Beitritt Österreichs ergibt.
In den Integrationseffekten sind daher zum einen die passiven Mitnahmeeffekte enthalten, die
Österreich 1993 als EFTA-Mitglied außerhalb von EWR und EU durch das EWR-bedingte
Einkommenswachstums in Gesamteuropa und folglich durch die gesteigerte Exporte nach Eu-
ropa erzielte. Zum anderen sind die Integrationseffekte erfaßt, die sich aufgrund der EWR-
Teilnahme ab 1994 und der EU-Mitgliedschaft seit 1995 für Österreich ergeben haben. Kumu-
liert über die gesamte Untersuchungsperiode weisen die Ergebnisse günstige Effekte auf BIP,
Beschäftigung, Arbeitsproduktivität und Inflation auf. Allerdings sind darin die rezessiven
Effekte der europäischen Budgetkonsolidierung im Hinblick auf die EWU (wie bei Schneider
1996) nicht berücksichtgt. Diese Anpassungskosten für die Vorbereitung der EWU kommen
gegenwärtig zum Tragen, und zwar noch bevor die positiven Wirkungen des Binnenmarktes in
vollem Umfang lukriert werden konnten. Die Reaktion der Wirtschaft auf den integrationsbe-
dingt verschärften Wettbewerb und die Wahrnehmung der Chancen des Gemeinsamen Marktes
erfordern einen Zeitbedarf für alle Binnenmarktteilnehmer, insbesondere für die neuen Teil-
nehmer wie Österreich. Um diese Zeitspanne wird die EWU nach Meinung der Autoren offen-
bar zu früh eingeführt. Die zu erwartenden Auswirkungen der EWU werden in Kapitel VII
behandelt.
Tabelle 3: Effekte der EU-Integration auf Österreich 1993-95
Veränderungen (ohne Budgetkonsolidierungseffekte) gegenüber der Grundsimulation
(in Prozentpunkten bzw. Beschäftigten)
Variable 1993 1994 1995 1993-95
Beschäftigte + 10.600 - 6.800 + 5.800 + 9.400
BIP real + 1,0 + 0,3 + 0,8 + 2,1
Arbeitsproduktivität + 0,6 + 0,5 + 0,7 + 1,8
Inflation - 1,1 - 0,8 - 1,8 - 3,7
Quelle: Breuss 1996, S. 210.
32
In einem Vergleich seiner mit dem Makromodell des WIFO erzielten Ergebnisse der Europäi-
schen Integration mit der tatsächlichen Entwicklung gelangt Breuss (1996) zu folgender
Einschätzung: "Bei der Kommentierung der Integrationseffekte wird immer wieder übersehen,
daß der Einstieg in den Binnenmarkt mit seiner beabsichtigten Verschärfung des Wettbewerbs
auf allen Ebenen mit einem Rückgang der Beschäftigung erkauft werden mußte" (S. 208f.).
"Im Gegensatz zu den anderen Integrationsvarianten (bis zum EWR) war der EU-Beitritt sehr
teuer" (S. 211). "Kurzfristig überwogen in Österreich die Anpassungskosten in Form von In-
solvenzen, Arbeitslosigkeit und Budgetlasten. Mittel- bis langfristig sollten die Chancen des
großen und frei zugängigen Binnenmarktes besser genützt werden, um die prognostizierten
Wachstums- und Wohlfahrtseffekte, die man im allgemeinen aus einer Vertiefung der Integra-
tion erwartet, wahr werden zu lassen" (S. 222).
Immerhin entwickelte sich die österreichische Wirtschaft selbst unter den verschlechterten
Rahmenbedingungen (Konjunkturschwäche, Budgetkonsolidierung, Wettbewerbsverschärfung)
1993-95 relativ günstig im Vergleich zur "EU der 15", wie in Tabelle 4 gezeigt wird.
Tabelle 4: Wirtschaftsentwicklung in Österreich und in der "EU der 15" 1993-95
(Variable jeweils in Prozent)
BIP-Wachstumsrate real Arbeitslosenquote Inflationsrate
1993 1994 1995 1993 1994 1995 1993 1994 1995
Österreich 0,4 3,0 1,8 4,2 4,4 4,6 3,6 3,0 2,2
EU-15 - 0,6 2,8 2,5 10,9 11,4 11,0 3,6 3,0 3,1
Quelle: Breuss 1996, S. 211.
Nach Meldung der Außenhandelsstellen der Bundeswirtschaftskammer haben 1995 im Handel
mit der EU die Exporte um 11,0 % und die Importe nur um 8,7 % zugenommen. Von allen
positiven EU-Effekten konnte allerdings jener der Inflationssenkung im Vergleich zu den
damit verknüpften Erwartungen erst am wenigsten realisiert werden. "Mehr Wettbewerbsdruck
- sei es auch ausgelöst seitens der Konsumenten durch Direkteinkäufe - wird in den nächsten
Jahren noch notwendig sein, um die erwartete Preisdämpfung (und damit Wohlfahrtssteige-
rung) auch in Österreich erleben zu können" (Breuss 1996, S.218).
Trotz der im Vergleich zur EU günstigen Entwicklung Österreichs ist es - ganz im Sinn der
Umstrukturierung, erhöhten Produktivitätssteigerung und nachhaltig zu verbessernden Wett-
bewerbsposition - offensichtlich, daß nicht alle Unternehmen dem verschärften Konkurrenz-
33
druck gewachsen sind. Die Insolvenzen nahmen von 4.837 (mit 23.000 gefährdeten Arbeits-
plätzen) 1994 auf 6.144 (44.000 gefährdete Arbeitsplätze) im Jahr 1995 zu. An erster Stelle
der Insolvenzstatistik steht die Gastronomie, gefolgt vom Baugewerbe und der Nahrungs- und
Genußmittelwirtschaft. Gerade die Kleinbetriebe sind aufgrund ihrer Kapazitätsgrenzen zumin-
dest vorübergehend in der Ausnützung der Skalenvorteile benachteiligt, die der Gemeinsame
Markt bringen kann. Dieser Umstand legt sowohl eine betontere Spezialisierung in der Pro-
duktion und forciertere Ausdehnung der Kapazitäten in diesen Spezialbereichen als auch eine
verbesserte Kooperation der Unternehmen in ihren Angebotspolitiken auf dem Binnen- wie auf
dem Außenmarkt der EU nahe. Schon in der Vorbereitungsphase auf den Gemeinsamen Markt
war vor allem in der EG, aber auch in Österreich eine verstärkte Tendenz zu Fusionierungen
bemerkbar. Die auf höhere Losgrößen orientierte Industrie Österreichs konnte im ersten EU-
Jahr sogar wieder ein überproportional hohes Wachstum vorweisen (5,5 %). Negativ betroffen
waren allerdings die Leder-, Nahrungs- und Genußmittel- sowie die Textil- und Bekleidungs-
industrie, doch fielen die Beeinträchtigungen meist geringer aus als erwartet.
Am schärfsten wirkte sich der EU-Beitritt in der Landwirtschaft aus, weil die Gemeinsame
Agrarpolitik (GAP) die österreichische, durch relative hohe Preisstützungen gekennzeichnete
Landwirtschaftspolitik ersetzte und die österreichischen Agrarbetriebe eine geringere Produk-
tivität aufweisen. Die EU-bedingte Senkung der Inflationsrate ist bislang noch primär auf den
Lebensmittelbereich zurückzuführen. Doch konnten in der Landwirtschaft die Auswirkungen
des massiven Rückgangs der Erzeugerpreise (-23 %) auf die Erzeugereinkommen (-28 %)
durch erhöhte Subventionen (+150 %) im Rahmen des sogenannten Europaabkommens (teils
EU-finanziert) sogar überkompensiert werden. Darüber hinaus sind die Preise für landwirt-
schaftliche Betriebsmittel um 1 % gesunken (Breuss 1996). Da die agrarischen Subventionen
jedoch auf die Übergangsperiode 1995-98 beschränkt und degressiv gestaffelt sind, steht dem
österreichischen Agrarsektor die Umstrukturierung und Redimensionierung erst bevor. Da
die Problematik in anderen EU-Staaten ähnlich gelagert ist, wird das Agrarförderungssystem
der EU künftig noch verstärkt in Richtung der Abgeltung positiver Externalitäten (Land-
schaftspflege und -schutz) entwickelt werden müssen. Immerhin werden die hohen Ausgaben
für Preisstützungen im Rahmen der GAP bald drastisch zurückgehen und fiskalische Spielräu-
me für andere Förderungen - auch neue, umweltorientierte Förderungen im (landschafts-
pflegerischen) Agrarbereich - eröffnen.
Jedenfalls ist Österreich im ersten Jahr seiner EU-Mitgliedschaft vom viert- zum drittreichsten
Land der Union avanciert, wobei innerhalb der Union die realen BIP-Zuwächse pro Kopf am
stärksten bei den reichen EU-Ländern beobachtet wurden. Im Hinblick auf den vergleichswei-
sen Reichtum Österreichs sind und bleiben die österreichischen Gebietskörperschaften ganz
offensichtlich Nettozahler zum Gemeinschaftsbudget der EU. Dieser Umstand entspricht
34
nicht nur dem Leistungsfähigkeitsprinzip der Budgetbeitragsleistungen auf der supranatio-
nalen Ebene, sondern läßt sich - über die Motive internationaler Solidarität und Subsidiarität
hinaus - auch aus eigennützig nationaler Sicht durch eine volkswirtschaftliche Umwegrentabi-
lität im Wege eines erhöhten Wohlstands und einer gesteigerten (Export-)Nachfrage der ein-
kommensschwächeren Partner in der EU und schließlich durch ein rascheres Wachstum des
österreichischen BIP und Steueraufkommens rechtfertigen.
5.2. Ostöffung und Wirtschaftsbeziehungen Österreichs
5.2.1 Osthandel
Die historischen Handelsbeziehungen Österreichs zu den ostmittel- und osteuropäischen Län-
dern lebten mit dem Ende der Besatzungszeit wieder auf. Der Handel über den Eisernen Vor-
hang hinweg war stets durch klare Vorteile in Form österreichischer Leistungsbilanzüber-
schüsse gekennzeichnet. Der Rückgang dieses österreichischen Osthandels, der zwischen 1975
und dem Systemumbruch 1989 zu verzeichnen war, begründete sich mit den wachsenden Aus-
landsverschuldungsproblemen der ehemaligen RGW-Staaten. Ab 1989 konnte nicht nur das
österreichische Osthandelsvolumen von 9,6 % Exportanteil (6,9 % Importanteil) am BIP auf
eine Ostexportquote von 13,6 % (Ostimportquote von 8,5 %) im Jahr 1994 erhöht werden. In
diesem Jahr kumulierte auch der Leistungsbilanzüberschuß gegenüber den ost- und ostmittel-
europäischen Handelspartnern (16,5 Mrd. S.).
Neben der Erweiterung der österreichischen Exportchancen bewirkte die Liberalisierung in den
Reformstaaten natürlich auch eine Verschärfung der Konkurrenz zwischen den Ostimporten
und der ostimportsubstituierenden heimischen Wirtschaft. Die komparativen Vorteile der ar-
beitsintensiven und arbeitskostengünstigen Produktion in den Oststaaten machten sich in den
Erfolgsstrukturen der österreichischen Wirtschaft ebenso bemerkbar wie die trotz aller plan-
wirtschaftlicher "Hypotheken" relativ rasch erfolgende wirtschaftliche Anpassung und Ent-
wicklung der Reformstaaten. Dies ließ die Struktur des österreichischen Osthandels und der
somit heimischen Industrie nicht unverändert. Doch die Leistungsbilanz- und Beschäftigungs-
nachteile Österreichs infolge der arbeits-, energie- und rohstoffintensiven Ostimporte (vor al-
lem Zement, Stahl, Textil, Bekleidung und Landmaschinen) wurden durch entsprechende
Vorteile aufgrund sachkapital-, humankapital- und technologieintensiven Exporten deutlich
überkompensiert. Zudem wandelt sich der österreichische Osthandel allmählich von einem
komplementären Tausch von Industriegütern gegen Basisgüter zu einem substitutiven Handel
mit Industriegütern zwischen entwickelten Wirtschaften (Breuss, Schebeck 1996, S. 99f.). Die-
35
se Tendenz unterstreicht die rasch an Bedeutung gewinnende Rolle der Reformstaaten als
Konkurrenten auf dem Markt für Industriegüter und die Verschärfung der Wettbewerbslage für
etablierte Industriestaaten wie Österreich, deren langfristige Chance in einer antizipativen,
qualitätsorientierten Anpassungsstrategie liegt.
Österreichs Antwort auf den durch die Ostöffnung aufgezwungenen Strukturwandel bestand -
durchaus in Übereinstimmung mit der EU - in einer handelspolitischen Einschränkung des
Osthandels mit Hilfe von Quoten und Anti-Dumping-Regelungen bei "sensiblen" Waren (etwa
Landmaschinen). Das Bestreben nach einem Schutz vor der erstarkenden Exportwirtschaft der
Reformstaaten sollte offenbar der heimischen ostimportsubstituierenden Wirtschaft Zeit ein-
räumen, sich offensiv - durch Verbesserungen ihrer Wettbewerbsfähigkeit in qualitativer, tech-
nologisch-innovativer, jedenfalls nicht preisbezogener Hinsicht - anzupassen. Eine Importquo-
tenstrategie ist zwar in kürzerfristiger Sicht beschäftigungspolitisch verständlich, doch würde
sie für ihr wesentliches Wirksamwerden (wie bei Erziehungszöllen) eine längere Dauer des Au-
ßenschutzes erfordern und könnte dadurch die Anpassungsbereitschaft und -geschwindigkeit
der heimischen Importsubstitutionswirtschaft entscheidend beeinträchtigen. Dies ist immerhin
eine aus dem "austrokeynesianischen Jahrzehnt" gezogene Lehre, die schließlich auch zu der
erwähnten grundsätzlichen Neuorientierung der österreichischen Wirtschaftspolitik seit den
späteren 80er Jahren geführt hat. Eine solche Regulierung der Ostimporte Österreichs stößt
außerdem an die Grenzen der Gemeinsamen Handelspolitik der EU.5
Die offensive, liberale Langfriststrategie der EU, die auf Begünstigung des Osthandels - so
auch der Ostimporte - abstellt, bildet selbstverständlich auch für die Handelspolitik Österreichs
eine zwingende Rahmenbedingung. Aus dieser Sicht ist die partielle Osthandelseinschränkung
eine kurzfristige beschäftigungspolitische Maßnahme, die zwar im Einklang mit der EU er-
folgte. Doch stellt sich dabei generell die Frage nach der Fairness, zumal der Westen - insbe-
sondere Österreich - sehr erfolgreich mit Exporten in den institutionellen Freiraum des Syste-
mumbruchs vorgestoßen ist und aus einer Startposition des Exportüberschusses handelt, ohne
die mittelfristigen Nachteile der liberalisierenden Reformstaaten in Bezug auf das Volksein-
kommen entwicklungspolitisch zu minimieren. Außerdem liegt die Bedeutung der Ostöffnung
für Österreich langfristig in der Aufhebung der Exportrestriktion, die sich zuvor aus der
planwirtschaftsbedingten Devisenknappheit östlicher Handelspartner ergeben hatte. Dieser
Vorteil kann - abgesehen von der Eingebundenheit in die EU-Handelspolitik - am besten durch
eine günstige Export-, Einkommens- und Strukturentwicklung in den Reformstaaten genützt
werden und sollte eine maßgebliche Perspektive österreichischer Wirtschaftspolitik sein. Dies
erfordert nicht nur eine Politik der Liberalisierung, sondern auch eine konstruktive Hilfspolitik,
die dazu beiträgt, daß die zentralplanerischen Relikte nicht nur abgebaut, sondern durch jene
Institutionen ersetzt werden, die für ein möglichst reibungsloses Funktionieren einer Markt-
36
wirtschaft nötig sind, wie etwa unternehmerisches und wirtschaftspolitisches Know-how, Infra-
struktureinrichtungen, definierte Eigentumsrechte insbesondere auch hinsichtlich des Produkti-
onsfaktors Umwelt, faire Wettbewerbsregeln und dgl. (z. B. Sum 1995, S. 40f.).
5.2.2 Direktinvestitionen
Theoretisch wie empirisch uneindeutig ist die Antwort auf die Frage, ob ausländische Direktin-
vestitionen die Exporte des Investorlandes in das Zielland fördern oder substituieren. Mit dem
Übergang zur politischen und ökonomischen Liberalität setzte überhaupt erst eine nennens-
werte Direktinvestitionsaktivität des Westens in Ostmittel- und Osteuropa ein, hauptsächlich in
den Staaten mit niedrigen Wachstumsraten und zuweilen massiv verstärkt durch die Privatisie-
rungsschritte der Reformstaaten. Direktinvestitionen werden als ein effektiver Faktor des effi-
zienten Systemübergangs zur Marktwirtschaft angesehen. In den Reformstaaten weisen Un-
ternehmen mit direktem Auslandskapitaleinsatz häufig eine mitunter stark überdurchschnittli-
che Produktivität auf (offenbar aufgrund eines leistungsfähigeren Human- und Sachkapitals).
Allerdings fallen die Beiträge der Direktinvestitionen zum Wachstum und zur Finanzierung der
Zielstaaten bislang relativ schwach aus, wiewohl diesbezüglich wesentliche Impulseffekte erst
nach einigen weiteren Jahren zu erwarten sind.
Österreich war den anderen Industrieländern in den Dirketinvestitionen im Osten nur anfangs
voraus und ist mittlerweile darin erheblich zurückgefallen. Der österreichische Anteil machte
1990 41 % der Direktinvestitionen in den Reformstaaten aus. 1995 waren es nur mehr 5,6 %,
obwohl Österreichs Anteil gemessen an den westlichen Warenexporten in dieses Zielgebiet bei
einem Zehntel liegt. Besonders im Telekommunikationsbreich fehlen österreichische Direktin-
vestitionsbestrebungen. Österreichs Wirtschaft konzentriert sich mit ihren Direktinvestitionen
einseitig auf den EU-Raum und vernachlässigt dadurch langfristige Chancen auf die wirt-
schaftspolitisch intendierte Verstärkung der Internationalisierung. Österreichische Direktinve-
stitionen fallen in den Reformstaaten nur in jenen Bereichen außergewöhnlich hoch aus, wo
andere Investorländer die großen Risiken scheuen. Für Stankovsky (1996a) ist diese Entwick-
lung kein Ostspezifikum, sondern nur ein Phänomen der in Österreich allgemein rückläufigen
Internationalisierung. Zwischen 1992 und 1995 haben sich die gesamten österreichischen Di-
rektinvestitionen auf 10 Mrd. S. halbiert. Angesichts dessen werden an Stelle der Einschrän-
kungen von Subventionen, wie etwa durch den Umweltfonds, weitere förderungspolitische
Akzente zu einer verstärkten Internationalisierung der österreichischen Wirtschaft zu setzen
sein. Allerdings werden die Strukturverbesserungsprogramme der EU für Mittel- und Osteuro-
pa (PHARE, TACIS) laut Industriellenvereinigung erst in enttäuschendem Maß von der öster-
reichischen Wirtschaft genützt. Der von Österreich ausgeschöpfte Anteil am gesamten Ostför-
37
derungsvolumen der EU betrug 1995 nur 1 % und führte zu einer Informationsoffensive über
EU-Förderungsmöglichkeiten der Wirtschaftsbeziehungen zu den Reformstaaten.
Ein weiteres Handlungserfordernis ergibt sich für Österreich aus den zu beobachtenden nega-
tiven Nebeneffekten der Direktinvestitionen des Westens in Ostmittel- und Osteuropa. Die
kraft ihrer Schlüsselposition im Systemwandel mit großer Verhandlungs- und Marktmacht aus-
gestatteten westlichen Direktinvestoren schränken die Wettbewerbsintensität zum wohl-
fahrtsökonomischen Nachteil der Zielländer erheblich ein. Direktinvestitionen werden sich aber
nur in jenen Reformwirtschaften langfristig positiv auswirken, denen es gelingt, den Übergang
zu einer effizienten Marktwirtschaft unbeeinträchtigt durch Rent Seeking und Kollusion zu
vollziehen. Eine verdienstvolle Aufgabe Österreichs wäre es daher, die Aufnahme der östlichen
Beitrittskandidaten in die EU voranzutreiben, damit das Wettbewerbsrecht der Union den
Marktmachtmißbrauch einschränkt. Eine durch einen EU-Beitritt bewirkte Beschleunigung des
Prozesses, die Reformwirtschaften dem harten Wettbewerbsdruck auszusetzen, kann jedoch
den politischen und wirtschaftlichen Reformprozeß aufgrund hoher sozialer Anpassungskosten
gefährden und dadurch auch dem Westen langfristig große ökonomische Nachteile bringen.
Deshalb besteht eine weitere verdienstvolle (und auch eigennützige) Aufgabe Österreich darin,
durch faire bilaterale Wirtschaftsbeziehungen und solidarische Wirtschaftshilfe - auch gegen
den Widerstand von Steuerzahlern und betroffenen Wirtschaftsgruppen - eine wirtschaftlich
effiziente wie sozial befriedigende Systemanpassung zu fördern (Stankovsky 1996b).
5.2.3 Osterweiterung der EU
Im Juni 1993 fiel in Kopenhagen die Grundsatzentscheidung des Europäischen Rates zu Gun-
sten einer Osterweiterung der EU um assoziierte mittel- und osteuropäische Staaten und wurde
in der Folge auf mehreren Ratstagungen bekräftigt und weiter konkretisiert.6 Bei konstitutiven
Entscheidungen wie jener der österreichischen Mitgliedschaft in der EU stellt sich auch hin-
sichtlich einer EU-Osterweiterung für Österreich die Frage nach dem langfristigen Verhältnis
der dadurch bewirkten volkswirtschaftlicher Nutzen und Kosten. Dabei ist der fiskalische Ef-
fekt eines EU-Beitritts der relativ armen Reformstaaten Mittel- und Osteuropas, der die Netto-
zahlerposition Österreichs als drittreichstes Mitglied gegenüber dem supranationalen Gemein-
schaftsbudget der EU erhöht, den Wohlstandseffekten eines erweiterten Gemeinsamen
Marktes gegenüberzustellen. In dieser Hinsicht ist nach einer Simulation von Breuss und Sche-
beck (1996) eine für Österreich optimale Osterweiterung der EU im Beitritt der vier Nachbar-
staaten Tschechien, Slowakei, Ungarn und Slowenien zu sehen.
38
5.3 Entwicklungstendenzen der Zahlungsbilanz
Die Saldenstruktur der Zahlungsbilanz gibt ein - wenn auch vereinfachtes - Abbild der außen-
wirtschaftlichen Position eines Landes. Die Zahlungsbilanz Österreichs war in der Periode zwi-
schen den schweren Leistungsbilanzkrisen, die 1976-81 sowie seit 1993 zu beobachten sind,
durch einen moderaten kumulierten Überschuß in der Leistungsbilanz von 24 Mrd. S. (1992-
92) charakterisiert.
5.3.1 Kapitalverkehr
Die Kapitalverkehrsbilanz wies zumeist hohe Überschüsse auf, so daß die offiziellen Wäh-
rungsreserven seit Beginn der 70er Jahre und besonders in den 90er Jahre eine deutlich stei-
gende Tendenz zeigten. Die relativ hohen Nettokapitalimporte begründen sich hauptsächlich
durch eine starke Auslandsnachfrage nach langfristigen festverzinslichen Wertpapieren mit
wechselnden Schwerpunkten in Inlands- und Fremdwährungspapieren. Aus den Nettozahlun-
gen an Ausländer ergibt sich daher das Problem eines negativen Einflusses auf die Dienstlei-
stungsbilanz und das Volkseinkommen Österreichs. Mit der fortschreitenden Liberalisierung
des Kapitalverkehrs verbindet sich die Besorgnis, daß die nationalen Kapitalmärkte durch hohe
spekulative Transaktionen destabilisiert werden, die eher psychologisch als durch ökonomi-
schen Grunddaten ("fundamentals"), wie Inflations- und Zinsdifferentialen, beruhen und daher
unverhältnismäßig erratisch erfolgen. Schon seit Jahren stammen in Österreich rund 90 % der
internationalen Transaktionen nicht aus leistungsbilanzrelevanten Transaktionen, sondern aus
Vermögensdispositionen. Aus diesem Argument begründet sich die nicht unumstrittene Auf-
rechterhaltung der österreichischen Börsenumsatzsteuer, die in Form erhöhter Transaktionsko-
sten die Volatilität grenzüberschreitender Eigenkapitaltransaktionen herabsetzen soll. Generell
wird das Problem destabilisierender Finanztransaktionen auf internationaler Ebene thematisiert
und wird die Handelspolitk der WTO, die Wettbewerbspolitik der EU, die Währungspolitik der
EZB und somit auch die wirtschaftspolitische Position Österreichs im Rahmen dieser Institu-
tionen künftig verstärkt beeinflussen.
5.3.2 Waren- und Dienstleistungsverkehr
Das Charakteristikum der österreichischen Leistungsbilanz besteht in der chronisch defizitären
Warenbilanz (etwa 5 % des BIP), obwohl die Lohnstückkosten langsamer anwachsen und die
Arbeitsproduktivität stärker zunimmt und letztere seit 1992 sogar höher ist als im Haupthan-
delspartnerland Deutschland. Das Warenbilanzdefizit beruht allerdings nicht auf einem Mißer-
39
folg der Exportwirtschaft. Die Wachstumsraten der Exporte liegen - trotz der die Exportwirt-
schaft beeinträchtigenden Hartwährungspolitik - langfristig deutlich über jenen des BIP. Wie
ganz generell in entwickelten Industriestaaten, so ist jedoch auch in Österreich zu beobachten,
daß sich die Zuwachsraten von Exporten und Importen ziemlich parallel entwickeln (Hahn,
Walterskirchen 1992, S. 15). So verzeichnet Österreich aufgrund seiner historischen Aus-
gangssituation Warenbilanzdefizite gegenüber Europa, der EU, der OECD (insgesamt wie dem
europäischen Teil), Asien, Afrika, Amerika (speziell auch den USA) und insbesondere dem
Haupthandelspartner BRD. Seit Österreichs Teilnahme am EWR kam es immerhin zu einer
merklichen Zunahme der Warendirektimporte aus den Nachbarstaaten in der EU. Dennoch
deutet der Umstand, daß das Warenbilanzdefizit gegenüber der EU 1995 nicht weiter zunahm,
auf den sich eröffnenden Nettovorteil des Außenhandels im Gemeinsamen Markt hin. Die
Binnenmarktteilnahme könnte daher vielleicht auch längerfristig eine Verbesserung der öster-
reichischen Leistungsbilanz zur EU ermöglichen. Immerhin erzielt Österreich traditionell Über-
schüsse aus dem Warenverkehr mit den EFTA-Ländern, den Reformstaaten (mit Ausnahe
Rußlands) und Ozeanien sowie mit einzelnen Staaten, wie Norwegen, der Schweiz und Kana-
da.
Wenn das Warenaußenhandelsdefizits tendenziell verringert werden soll, wird es verstärkt die
Aufgabe der Technologie- und Bildungspolitik sein müssen, die Struktur des exponierten
Sektors deutlich in Richtung know-how-intensiver, innovativer Produkte zu verschieben - so-
wohl in der exportierenden als auch in der importsubstituierenden Wirtschaft. Dadurch können
sowohl das Nettoexportwachstum quantitativ gesteigert als auch die Terms of Trade verbessert
und die Unit Values der Exporte über jene der Importe angehoben werden. Eine Orientierung
auf Güter, mit denen Österreich als ein Schumpeter´schen "Firstcomer" auf neuen Märkten
Erfolge erzielt, würde auch zu einer Stabilisierung der Gesamtnachfrage in konjunktureller
Hinsicht beitragen und das Beschäftigungsproblem mildern.
Das technologisch-innovative Argument gilt ebenso für den Außenhandel mit industrienahen
(technologischen und wirtschaftlichen) Dienstleistungen. In Bezug auf die negative und sich
tendenziell eher verschlechternde Technologiebilanz (Patent- und Lizenzbilanz) kann immer-
hin darauf hingewiesen werden, in der die Spitzentechnologieexporte 1994 mit 13 % bedeu-
tend rascher wuchsen als die Gesamtexporte. Dennoch blieb im selben Jahr die Bilanz des
Technologieaußenhandels aufgrund der noch höheren Importe (15,5 %) defizitär (OeNB 1995,
Bayer 1996). Immerhin läßt sich vermuten, daß der hohe Technologieimport technologische
Spill-overs hervorruft, die der heimischen Forschung und Entwicklung aufgrund von Kumula-
tions- und Synergieeffekten Impulse verleihen, den Forschungs- und Entwicklungsrückstand
verringern helfen und die Technologiebilanz längerfristig aktivieren können.
40
Angesichts der wesentlich an Bedeutung gewinnenden wirtschaftsnahen Dienstleistungen und
dem Außenhandel mit nicht in Waren und Dienstleistungen aufteilbaren Gütern, der einen po-
sitiven, aber stagnierenden Saldo aufweist, wird im Interesse der internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit das industriepolitische Augenmerk auf die zukunftsträchtigen, innovativen
Cluster (zusammengehörigen Leistungspakete) der österreichischen Wirtschaft zu legen sein.
Aufgrund der klein- und mittelbetrieblichen Wirtschaftsstruktur erscheint es zukunftsweisend,
statt eng umrissener Angebote kleiner, hoch spezialisierter Einzelfirmen zusammenhängende
Exportangebote (Güterbündel, Clusters) durch Projektgemeinschaften mehrerer Firmen auf
den Weltmarkt zu bringen. Eine solche handelspolitische Strategie setzt auf Synergie- und
Skaleneffekte. Daher erfordert sie eine enge Kooperation heimischer Firmen mit dem Ziel einer
erfolgreichen Präsenz auf dem Weltmarkt. Als eine umfassende unternehmerische Handelspoli-
tik beinhaltet die Cluster-Politik Gemeinschaftsaktionen der Unternehmen in der Strategiepla-
nung, Forschung und Entwicklung, Angebotserstellung, Repräsentanz und Distribution. Die
Nutzung dieser Vorteile ist allerdings noch stark entwicklungsbedürftig. Die Zusammenarbeit
im Rahmen potentieller gemeinsamer Exportprojektbereiche würde den österreichischen Fir-
men - gegebenenfalls im Zusammenhang mit Direktinvestitionen - auf dem Weltmarkt die
Vorteile einer großen, breiter diversifizierten Unternehmung, die kompakte Leistungsbereiche
zur Gänze abdeckt, bieten, ohne daß dabei die Nachteilhaftigkeit von Großbetrieben (Ineffizi-
enz aufgrund komplexer, starrer, wenig marktanpassungsfähiger Betriebsorganisationen) in
Kauf genommen werden müßte. Die Realisierung des Cluster-Konzepts ist über das erste Sta-
dium, nämlich die Identifikation zukunftsweisender Cluster, noch kaum hinausgekommen
(Hutschenreiter 1994). Dieses Erfordernis wird in der Ausrichtung der Förderungspolitik deut-
lichen Niederschlag finden müssen: Clusterorientierte Industriepolitik CIP, (Weiss 1994, S.
112ff.). Erfolgversprechende Cluster sind in Österreich für die Bereiche Umwelttechnik, Medi-
zintechnik, Bio- und Gentechnologie, Metall, Freizeit, Bauen und Wohnen, Automobilzuliefe-
rung und sogar für Papier und Holz (obwohl zyklisch stark schwankend) sowie selbst für Textil
und Bekleidung festzustellen (Weiss 1994, S. 22ff.).
5.3.3 Spezialproblem Fremdenverkehrsentwicklung
Der Reiseverkehr bildet den Hauptfaktor für die ungewöhnlich starke Verschlechterung der
österreichischen Leistungsbilanz, die 1993 begann, doch bislang nicht an die durch die beiden
Ölpreisschocks bedingte Leistungsbilanzkrise mit Defiziten von 1,5 bis 4,5 % des BIP zwi-
schen 1976 und 1981 heranreicht. Die drastische Verschlechterung der - positiven - Fremden-
verkehrsbilanz, die das Defizit aus dem Warenverkehr immer weniger kompensiert, weist kon-
junkturelle und strukturelle sowie externe und heimische Ursachen auf. Gegenwärtig reduzie-
ren die europäische und japanische Rezession sowie die Budgetkonsolidierungspolitik in der
41
EU zur Erfüllung der fiskalischen Konvergenzkriterien von Maastricht im Hinblick auf die
EWU die verfügbaren Einkommen und die Zahlungsbereitschaft der Österreichbesucher merk-
lich. Bedingt durch die Abwertung der Lira bevorzugten darüber hinaus die Österreicher Italien
als Urlaubsland, wo die wechselkursbedingte Verbilligung trotz der mittlerweile deutlichen
Beschleunigung der italienischen Inflation immer noch vorhält. Längerfristig beeinträchtigen
die zunehmenden, relativ billigen und von den Österreichern immer stärker genützten Angebote
an Fernreisen die Leistungsbilanz. Nicht nur aufgrund der österreichischen Hartwährungspoli-
tik, sondern auch als Folge der Hochpreispolitik der heimischen Tourismuswirtschaft wird
Österreich als Urlaubsland weniger attraktiv. Offensichtlich kann die Schönheit der österreichi-
schen Landschaft allein die Konkurrenzfähigkeit zu anderen Tourismusländern immer weniger
sichern. Kritisiert wird das unzureichende Angebot an Erlebnisurlaub, die Inflexibilität im Ein-
gehen auf die Wünsche der Urlauber ("hamma net"-Mentalität) und die Regelung der Öff-
nungszeiten aus Gründen des Arbeitnehmerschutzes.
Das Preis/Leistungs-Verhältnis im Tourismus wird daher sowohl auf der Preisseite (z. B. bei
weit überhöhten Getränkepreisen) als auch auf der Leistungsseite (Vielfalt, Qualität, Ser-
vicecharakter) zu Gunsten der Gäste wesentlich verbessert werden müssen. Angesichts der
relativ hohen Einkommenselastizität im Tourismusbereich dürfte auf lange Sicht der Quali-
tätstourismus die besten Chancen bieten, aber eine Preissenkung im Durchschnittsqualitätsbe-
reich und eine Kapazitätsreduktion in der Privatzimmervermietung erzwingen. Gerade die Be-
herbergungsbetriebe der höchsten Kategorien mußten 1995 die geringsten Ertragseinbußen
(0,5 %) hinnehmen. Allerdings werden die tendenzielle Klimaerwärmung, die zunehmende
Umweltschädigung durch den Einsatz von Kunstschnee und die durch das Auftauen von Frost-
boden beschleunigt steigende Vermurungs- und Bergsturzgefahr vor allem den Wintertouris-
mus, der bislang vom Nachfrageeinbruch relativ wenig beeinträchtigt wurde, aber auch den
Sommeralpintourismus längerfristig zurückdrängen. Zur Bewahrung der komparativen Vortei-
le, die Österreichs Landschaft im internationalen Fremdenverkehr bietet, liegt ein wirtschafts-
politischer Schwerpunkt im Bereich der Umwelterhaltung nahe.
5.3.4 Soziale Liberalisierung und Leistungsbilanz
In jüngerer Zeit wird die Liberalisierung der Arbeitszeit- und Ladenöffnungszeitenregelungen
als wichtige Agenda der Wirtschaftspolitik Österreichs als kleine offene Volkswirtschaft disku-
tiert. Die Debatte über Arbeitszeitflexibilisierung ist noch wenig weit gediehen, zumal sich
viele Ökonomen nur relativ geringe Beiträge zur Erreichung des Beschäftigungsziels erwarten,
falls die Flexibilisierung nicht mit einer (differenzierten) Verkürzung der Arbeitszeit verbunden
wird, welche die Beschäftigung in Nicht-Krisenbereichen erhöht. Denn eine flexibilisierungsbe-
42
dingte Senkung der Arbeitskosten würde zwar den primär am Preiswettbewerb orientierten
Bereichen des exponierten Sektors Vorteile bringen. Doch kann damit erstens das Arbeitsko-
stenniveau der Schwellen- und Reformländer - selbst im Zusammenhang mit Lohn(neben)ko-
stensenkungen - nicht annähernd erreicht werden, und zweitens würde dadurch eine struktur-
erhaltende Wirkung in jenen Bereichen erzielt werden, die langfristig besser den ökonomisch
und sozial weniger weit entwickelten Staaten überlassen werden sollten. Deshalb ist von dieser
Strategievariante keine wesentliche strukturelle Verbesserung der Warenbilanz zu erwarten.
Relevant für die Leistungsbilanz ist die Frage der Ladenöffnungszeiten lediglich im Bereich
der Tourismusgebiete und der Direktimporte in grenznahen Regionen, wo man davon ausge-
hen kann, daß aufgrund des erweiterten Zeitrahmens die Güternachfrage nicht hauptsächlich
zeitlich verschoben, sondern auch insgesamt gesteigert wird. Dieser Umstand erfordert spezifi-
sche Lösungen statt einer generellen Öffnungszeitenregelung; diese wird selbst vom Handel
(mit Ausnahme der Großkaufhöfe) in weitaus überwiegendem Maß abgelehnt. Speziell für
Tourismusgebiete und grenznahe Einkaufszentren bestehen durch Verordnungen der Landes-
hauptleute ohnehin schon Ausnahmebestimmungen für die Rahmenöffnungs- und -
arbeitszeiten. Selbst die Erweiterung des Zeitrahmens für die Ladenöffnungszeiten in der BRD
ab November 1996 würde die in Österreich bestehenden Generalregelungen kaum übertreffen.
Noch dazu werden die seit Juli 1991 geltenden österreichischen Rahmenöffnungszeiten über
die Normalöffnungszeiten hinaus im allgemeinen kaum ausgenützt, weil die schwache Zusatz-
nachfrage die Personalkosten außerhalb der Normarbeitszeiten ökonomisch meist nicht recht-
fertigt. Allerdings gibt es in Deutschland eine kostengünstigere Regelung für Arbeitsleistungen
außerhalb der Normarbeitszeit. Eine Reduktion dieser Kosten in Österreich würde jedoch die
Mehrauslastung der bereits Beschäftigten zu Lasten der Einstellung zusätzlicher Beschäftigter
fördern.7
5.3.5 Hartwährungspolitik und Leistungsbilanz
Die Hartwährungspolitik Österreichs, die seit Anfang der 80er Jahre in Form einer Stabilisie-
rung des nominellen Wechselkurses des Schillings zur Deutschen Mark als einer starken Wäh-
rung verfolgt wird, soll dem direkten Inflationsimport aus relativ stark inflationierenden, ten-
denziell abwertenden Ländern (Weichwährungsländern) vorbeugen. Die österreichische Wech-
selkurspolitik dient somit nicht wie in den meisten anderen Staaten dem Leistungsbilanzaus-
gleich. Im Gegenteil, der Aufwertungseffekt des Schilling verbilligt nicht nur Importe, son-
dern erhöht andererseits die relativen Lohnstückkosten und verteuert die Exporte in Auslands-
währung. Insgesamt werden dadurch die Gewinne in der Exportwirtschaft komprimiert. Damit
wirkt die Hartwährungspolitik aber auch als "Rationalisierungspeitsche" und stellt solcherart
43
eine Form der Wettbewerbs- und Konsumentenschutzpolitik dar (falls keine Preisdifferenzie-
rung zwischen Binnen- und Weltmarkt erfolgt). Der Nachteil der Exportwirtschaft hält sich
dabei insgesamt in Grenzen, weil jeweils drei Viertel der Ex- und Importe in Schilling und DM
abgewickelt werden; der Dollaranteil beträgt dabei weniger als ein Achtel (1993). Deshalb und
aufgrund der relativ niedrigen Inflation fällt die reale effektive Aufwertung des Schilling gerin-
ger aus, als auf den ersten Blick vermutet zu vermuten ist. Dennoch wird immer wieder disku-
tiert, die österreichische Hartwährungspolitik zu lockern. Diese Frage ist jedoch angesichts der
bevorstehenden Währungsunion nur mehr bis Beginn des Jahres 1999 relevant, wenn die bilate-
ralen Paritäten der nationalen EWU-Teilnehmerwährungen zu der neu zu schaffenden Gemein-
schaftswährung EURO unveränderlich festgelegt werden.
5.3.6 Regionale Außenhandelsaspekte
In regionaler Hinsicht ist es von großer Bedeutung, nicht nur stärker auf den im Rahmen der
NAFTA aufstrebenden amerikanischen Absatzmarkt zu drängen, sondern vor allem die asiati-
schen Märkte zu erschließen, zumal diese auf absehbare Zeit die raschest wachsende Welt-
wirtschaftsregion darstellen dürften. Eine einseitige Konzentration auf den Europäischen Bin-
nenmarkt würde den Verzicht auf langfristige Chancen in Wachstumsmärkten außerhalb Euro-
pas bedeuten. Besonders in fernen Ländern mit fremdartigen Kulturen sind die ständige Prä-
senz vorort und die Vertrautheit mit der regionalen Wirtschaftsmentalität sowie der laufende,
direkte, vertrauenschaffende Kontakt (in China: "guanxi") zu den dortigen Handelspartnern
und Behörden (Sum 1995) entscheidend für die Überwindung der in den asiatischen "Tiger-
staaten" noch existenten protektionistischen Marktzutrittsbarrieren (Schnitzer 1995, S. 380ff.)
und für die Etablierung längerfristig erfolgversprechender Außenwirtschaftsbeziehungen. Dies
erfordert wiederum eine entsprechende Repräsentanz am Zielort, ein Distributionssystem im
Ausland und (ganz im Sinn des Cluster-Konzepts) ein den Nachfragerpräferenzen angepaßtes
komplettes Leistungsset im jeweiligen Angebotsbereich. Neben dem Netz der Außenhan-
delsdelegierten der Bundeswirtschaftskammer wird es daher von Vorteil sein, Direktinvesti-
tionen in den exporterfolgsträchtigen Zielstaaten zu forcieren, welche die Exportbemühungen
unterstützen sollen. In einem solchen Fall steht zu erwarten, daß der exportschaffende den ex-
portsubstituierenden Effekt der Direktinvestitionen im Zielland überwiegt. Diesbezüglich er-
scheint die österreichische Direktinvestitionsentwicklung bedenklich, die ebenso zurückgeht
wie die ausländische Direktinvestitionsaktivität in Österreich. Dieser Umstand legt einen ent-
sprechenden industriepolitischen Politikschwerpunkt nahe. Eine ergänzende Bedingung für den
Exporterfolg stellt die Öffnung für Importe insbesondere aus den Ländern dar, denen die öster-
reichischen Exporthoffnungen gelten.
44
5.4. Generelle Überlegungen
5.4.1 Supranationale und nationale Wirtschaftspolitik
Im Konzept der Wirtschafts- und Währungsunion findet autonome Geld- und Währungspolitik
auf nationaler Ebene keinen Platz mehr. Zusätzlich beschränken die fiskalischen Kriterien von
Maastricht die Verschuldungspolitik der öffentlichen Haushalte ziemlich strikt. Auch wird be-
reits eine weiterreichende Harmonisierung der Steuern und anderen Abgaben ernsthaft disku-
tiert. Der Wegfall des wechselkurs- und geldpolitischen sowie die Einschränkung des fiskalpo-
litischen Instrumentariums auf nationaler Ebene läßt vermuten, daß dadurch die regionalen und
sozialen Unterschiede innerhalb der EU transparenter und verschärft werden. Handelsliberali-
sierung (vor allem innerhalb von Integrationsgebieten, aber auch zu Drittländern außerhalb der
Integrationsblöcke) sowie die Förderung von technologischem Fortschritt, lebenslanger Bil-
dung und von Regionen (als Wirtschaftsstandorte) zeichnen sich daher als die ausschlaggeben-
den Tendenzen der Wirtschaftspolitik in einer international immer offeneren Wirtschaft ab.
Dabei ist zu beachten, daß auch das Förderungswesen in Österreich maßgeblich von der EU-
Gesetzgebung geprägt wird. Generell verlangt die Kompetenzverschiebung auf die supranatio-
nale Ebene der EU von der heimischen Wirtschaftspolitik primär sicherzustellen, daß die im
Gemeinschaftsrahmen vorgesehenen Förderungsmöglichkeiten optimal genützt werden können.
Dabei stellen die wirksame Information über Förderungsmöglichkeiten, die rasche, reibungslo-
se Administration der EU-Beihilfen und die Gewährleistung der nationalen Kofinanzierung der
gemeinschaftlichen Projektförderungen zentrale (außen-)wirtschaftspolitische Agenden dar.
Mit der Sozialpolitik verbleibt vorerst noch ein zentraler Politikbereich im Rahmen vorwie-
gend nationaler Gestaltung, obwohl auch er durch die fiskalischen Eckwerte der EWU und die
Steuerharmonisierungstendenzen mittelbar eingegrenzt ist. Der verbleibende Autonomieraum
im Sozialbereich wird zweifellos an Bedeutung gewinnen, wenn der forciert angestrebte, tief-
greifende Strukturwandel einer kleinen offenen Volkswirtschaft bei Anpassungsschwächeren
hohe persönliche Kosten verursacht, die selbst durch aktive Struktur- und Arbeitsmarktpolitik
nicht vermieden werden.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des tertiären Sektors und der weitreichenden interna-
tionalen Kommunikationsmöglichkeiten in der Dienstleistungswirtschaft werden sich die Au-
ßenhandelspolitiken auf nationaler, supranationaler (EU) und internationaler (WTO) Ebene
tendenziell auf das Gebiet der Struktur- und Wettbewerbspolitik verlagern. Insbesondere im
Bereich der Technologiepolitik wird das Erziehungszollargument von den entwickelten Staaten
für eine aktive Außenwirtschaftspolitik herangezogen, um der beabsichtigten Zurückdrängung
45
der Wirtschaftsförderungsfreiräume durch die Weiterentwicklung der WTO-Bestimmungen zu
begegnen und sich ein (außen-)wirtschaftspolitisches Instrument zu bewahren (Kenen 1994, S.
290ff.). Unbeschadet der Beurteilung der wohlfahrtspolitischen Effekte dieser Tendenz auf die
Weltwirtschaft wird Österreich verstärkt vorzukehren haben, die technologiepolitischen Mög-
lichkeiten im Rahmen der EU auszuschöpfen.
5.4.2 Strukturwandel, Beschäftigung und Soziales
Die besonders für eine kleine offene Volkswirtschaft entscheidende Grundsatzfrage nach der
Förderung oder Verzögerung des weltwirtschaftlichen Strukturwandels im eigenen Land muß
unzweifelhaft entschieden werden. Akzeptiert man im Interesse des langfristigen qualitativen
Wachstums, also einer nachhaltigen Wohlfahrtsentwicklung, den Strukturwandel als eine Auf-
gabe, die antizipativ verfolgt und aktivistisch unterstützt werden soll, so darf den partikularen
Interessen in den Schrumpfungsbereichen der Wirtschaft nicht nachgegeben und die Struktur-
politik in ihrer Wirkung nicht durch Kompromisse herabgesetzt werden.
Ebenso würde dies eine dezidierte Absage an die Forderungen nach einem Eintreten in die
internationale Lohnsenkungskonkurrenz mit den Schwellen-, Reform- und konservativ re-
gierten Industrieländern implizieren. Eine Enthaltung von der internationalen Lohndeflati-
onspolitik ist nicht zuletzt durch die moderne, produktivitätsorientierte Gewerkschaftstheorie
(z. B. Addison, Gerlach 1983, S. 217ff.), die Effizienzlohntheorie (z.B.Gordon 1993, S. 225ff.)
und die empirischen Befunde über die relative Bedeutung der einzelnen Faktoren von Stand-
ortentscheidungen zu rechtfertigen (Handler 1996). Sozialer Friede, Ausbildungsniveau und
öffentliche Infrastruktur stellen wesentliche Erfolgsfaktoren in der internationalen Standort-
konkurrenz dar. Auch die Mitgliedschaft im Europäischen Binnenmarkt stellt für ausländische
Direktinvestoren aus Nicht-EU-Ländern einen Standortvorteil Österreichs dar. So sind die
ausländischen Direktinvestitionen in Österreich selbst in der Zeit des integrationsbedingt ver-
schärften Wettbewerbs gestiegen: 1993 12,9 Mrd. S., 1994 16,6 Mrd. S. und 1995 17,6 Mrd.
S. Allerdings haben sich nach der Berücksichtigung der aus noch nicht untersuchtem Grund
scharf erhöhten Desinvestitionen von Ausländern in Österreich die ausländischen Direktinve-
stitionen netto von 1994 (15,0 Mrd. S.) auf 1995 (5,3 Mrd. S.) gedrittelt (Breuss 1996, S.
222f.).
Als Garant gegen einen ökonomisch unverkraftbaren gewerkschaftsseitigen Lohnexpansionis-
mus steht zweifelsohne die Österreichische Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft. In deren
Rahmen wirkt sich zum einen die 1979 explizit erfolgte Absage des ÖGB an eine expansive
Umverteilungspolitik der Primäreinkommen auf dem Arbeitsmarkt in Gestalt der Benya-Formel
46
(Abgeltung der laufenden, ziemlich stabilen Inflationsrate und der Produktivitätszuwachsrate in
den Löhnen) stabilisierend aus. Zum anderen bietet das österreichische Lohnbildungssystem
hinreichende Flexibilität für eine gesamtwirtschaftlich verantwortungsvolle Auslotung bran-
chen- und sogar betriebsspezifischer Lohnerhöhungsspielräume. Darüber hinaus ist zu beob-
achten, daß die Überzahlungen der Kollektivlöhne in Österreich ohnedies tendenziell abnehmen
und daß die Arbeitskosten in der Schweiz und BRD über den österreichischen liegen. Außer-
dem wird Österreich seit der zweiten Etappe der Steuerreform in den frühen 90er Jahren von
ausländischen Direktinvestoren im Hinblick auf die Unternehmensbesteuerung als Standort
besonders geschätzt. Eine beschäftigungspolitische Option und Alternative zur kompetitiven
internationalen Lohndeflation bietet eine gleichere steuerliche Behandlung der Produkti-
onsfaktoren Arbeit und Kapital, die Österreich als Land mit hoher Beschäftigungspriorität in
die Debatte der EU über eine Harmonisierung der Steuersysteme einbringen könnte.
Bei all diesen Überlegungen darf nicht übersehen werden, daß ständiger Strukturwandel auch
permanent hohe soziale Kosten vor allem in Form hartnäckiger struktureller und friktioneller
Arbeitslosigkeit bewirkt. Daher erfordert eine effektive strukturorientierte Außenwirtschafts-
politik in Bezug auf ihre volkswirtschaftliche - und daher auch soziale - Effizienz die soziale
Abfederung der weltwirtschaftlich diktierten Strukturanpassungen. Ein Sozialstaat wie Öster-
reich hat selbst unter erhöhtem Anpassungsdruck weiterhin darauf zu achten, daß die von Ar-
beitslosigkeit betroffenen Individuen nicht die gesellschaftlichen Kosten des Strukturwandels
tragen müssen, der dem Gros der Bevölkerung Wohlstandsgewinne einräumt. Um die struktu-
relle Arbeitslosigkeit und ihre sozialen Kosten tendenziell senken, ist komplementär zur Sozi-
alpolitik eine aktive Arbeitsmarktpolitik vorzusehen, die in umfassender Weise angelegt und
speziell in Gestalt der Bildungs- und (Infra-)Strukturpolitik langfristig und antizipativ ausge-
richtet ist.
Für die Bewältigung der Arbeitslosenproblematik jeweils in der kurzen Frist stellt sich selbst im
Rahmen der fiskalischen Konvergenzkriterien der EWU immerhin das Erfordernis eines hinrei-
chenden budgetären Handlungsspielraums zur Konjunkturstabilisierung. Nicht immer
wird man von der günstigen Voraussetzung ausgehen können, daß Nachfrageschocks durch
eine antizyklisch wirkende Anpassung der Sparquote der privaten Haushalte gedämpft werden.
Für Österreich wurde gezeigt, daß infolge von permanenten wie transitorischen Angebots- und
Nachfrageschocks die heimische Wirtschaft synchron mit jenen Ländern mitschwankt, die fak-
tisch maßgeblichen Einfluß auf die gemeinschaftliche Wirtschafts- und Währungspolitik aus-
üben (Helmenstein, Url 1995, S. 12f.). Diesbezüglich wird es auch ein spezifischer Vorteil sein,
wenn Österreich seine Mitentscheidungskompetenz in der Politik der EZB nützt, für eine anti-
zyklische Gemeinsame Geldpolitik einzutreten.
47
Österreich wird wie jeder andere EWU-Teilnehmerstaat mit einer Stimme in der EZB vertreten
sein. Dabei wird Österreich als ein Staat, dessen nationale Nachfragepolitik traditionell primär
beschäftigungs- statt einseitig geldwertorientiert ausgerichtet ist, auf Gemeinschaftsebene sei-
nen Einfluß geltend zu machen haben, damit die Zielpriorität in der Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion nicht überwiegend auf Geldwertstabilität gelegt wird. Doch dürfte dies
selbst in Allianz mit anderen Teilnehmerstaaten eine schwierige Aufgabe sein, zumal die wäh-
rungspolitische Stabilität ("Härte") des EURO davon abhängen wird, wie effektiv und zeitlich
konsistent (glaubwürdig) die internationalen Finanzanleger die geldwertstabilitätsorientierte
und daher eher restriktive Politik der EU einschätzen. Deshalb wird die BRD ihren faktisch
überproportionalen Einfluß geltend machen, um durch die Substitution der D-Mark durch den
EURO keine wesentlich weichere Währung in Kauf nehmen zu müssen. So wird die künftige
Europäische Zentralbank ausschließlich die Erhaltung der Währungsstabilität zur Aufgabe ha-
ben. Im Gegensatz dazu ist die Oesterreichische Nationalbank verpflichtet, in ihrer Politik auf
die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung Bedacht zu nehmen. Der realwirtschaftliche Effekt
eines weichen, das heißt niedrig bewerteten EURO wäre für bisherige Hartwährungsländer wie
Deutschland und Österreich insofern ungünstig, als die EURO-Sollzinssätze durch einen Auf-
schlag zur Abgeltung der von den internationalen Kreditoren erwarteten Abwertungs- und In-
flationseffekts erhöht würden und dadurch die Güternachfrage gedämpft würde. Österreich
besitzt bislang aufgrund seiner faktischen Währungsunion mit Deutschland (fixe ÖS/DM-
Kurse) den Vorteil niedriger Realzinssätze, die sich auf den guten Ruf der DM und die zum
Teil durch die Hartwährungspolitik bedingte niedrige Inflationsrate in Österreich gründet, ohne
daß dazu in der Regel - vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland - eine übersteigert
restriktive Politik zur Demonstration der währungsstabilitätspolitischen Entschlossenheit für
die Kapitalmärkte erforderlich gewesen wäre.
Strukturwandel tritt auch in Form und als Konsequenz geänderter wirtschaftspolitischer Rah-
menbedingungen auf. Unter dem Eindruck der europaweiten Rezession im Vorbereitungsstadi-
um auf die EWU wird diskutiert, die fiskalischen Konvergenzkriterien, die auch nach der
EWU-Einführung weiter gelten und nach dem Willen des deutschen Bundesfinanzministers
auch mit fiskalischen Sanktionen durchgesetzt werden, nicht durch absolut vorgegebene Pro-
zentsätze, sondern relativ - das heißt in Relation zum Gemeinschaftsdurchschnitt der aktuellen
Werte - zu formulieren oder eine auf die Arbeitslosenquote bezogene Nebenbedingung als Re-
striktion für die Budgetkonsolidierungspolitik einzuführen. Auch hinsichtlich dieser Fragestel-
lung wird Österreich seine Position in der EU mit besonderer beschäftigungspolitischer Ver-
antwortung zu vertreten haben.
Die Überlegungen zur gesellschaftlichen Solidarität im Schatten des weltwirtschaftlichen
Strukturwandels gelten nicht nur für die Vermeidung von Arbeitslosigkeit und die Absicherung
48
gegen die Folgen von Arbeitslosigkeit im nationalen und supranationalen Rahmen, sondern
auch für die Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen zu weniger weit entwickelten Drittstaaten.
Dabei sind derartige Solidaritätsüberlegungen nicht nur altruistisch zu begründen, sondern im
Lichte der Handelstheorie auch als effizienz- und wohlfahrtssteigernd zu sehen (vgl. Abschnitt
2). Sollen sich etwa die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas zu gut funktionierenden - so-
zialen - Marktwirtschaften entwickeln, um durch ihre Importfähigkeit wichtige Exportziellän-
der Österreichs zu bleiben und geeignete Mitgliedsländer in der EU zu werden, dürfen österrei-
chische Ostimporte und Direktinvestitionen (diese sind zum Teil Auslagerungen heimischer
Produktionen) nicht behindert werden, beschleunigen sie doch den letztlich unumgänglichen
Strukturwandel und bieten den Vorteil der Vermeidung späterer, durch strukturpolitische Ver-
zögerungen erhöhter volkswirtschaftlicher Kosten. Derartige "Investitionen in die Zukunft"
sollten aus kurzfristigen Bedenken nicht verhindert, wohl aber sozialpolitisch akkomodiert
werden. Auf diesem Weg dürften die gesellschaftlichen Kosten des weltwirtschaftlichen Fort-
schritts minimiert werden können.8
5.4.3 Globalität der Umweltproblematik
Auf internationaler Ebene werden die Umweltprobleme nicht nur tendenziell verschärft, son-
dern auch zunehmend globaler. Dies verlangt nicht nur, die ökonomischen Vorteile einer auf-
strebenden Umweltwirtschaft (Cluster "Umwelttechnik" in der österreichischen Wirtschaft) zu
nützen. Aufgrund der hohen Bedeutung internationaler "Schadstofftransporte" und der poten-
tiellen Bedrohung durch den Treibhauseffekt wird es immer mehr erforderlich, der Internatio-
nalität der Umweltproblematik auch in der Umweltpolitik Rechnung zu tragen. Um dieser Her-
ausforderung gerecht zu werden, sollte Österreich nicht nur auf der internationalen Ebene der
Umweltkonferenzen und auf der supranationalen Ebene der EU Initiativen setzen. Bekanntlich
scheitern jedoch effektive Gemeinschaftslösungen auf zwischen- und sogar überstaatlicher
Ebene am strategischen Verhalten der Verhandlungspartner, wenn diese (was meist der Fall ist)
ihre Nettonutzenposition unter der zu verhandelnden Lösung kennen. Aufgrund der diesbezüg-
lichen Koordinations-, Kontroll- und Sanktionsproblematik zwischen souveränen Staaten
kommt einer nationalen Vorreiterpolitik entscheidende Bedeutung zu. Wie theoretisch und
empirisch gezeigt werden kann, sind die Chancen auf die Erzielung ökonomischer Vorteile
durch das umweltpolitische Vorreiterverhalten und auf das Nachziehen der anderen Staaten aus
verschiedenen Gründen eher positiv als negativ zu beurteilen.9
Auf dieser Grundlage müßte sich - insbesondere angesichts der grenzüberschreitenden Exter-
nalitäten - selbst im internationalen Zusammenhang auch das ökonomische Prinzip stärker
durchsetzen können, nämlich bei der verstärkten Erhaltung des (weitgehend gemeinsamen)
49
Gutes Umweltqualität dort zu anzusetzen, wo das Verhältnis zwischen Grenznutzen und
Grenzkosten am größten ist. In Anbetracht der internationalen Externalitäten und der großen
Unterschiede zwischen den Pro-Kopf-Einkommen der Staaten (gerade auch innerhalb Gesamt-
europas) müßte sich schon allein aus ökonomisch-pragmatischen Gründen die Auffassung
durchsetzen, daß die Vermeidung von Umweltschäden im eigenen Land den Einsatz von heimi-
schen Ressourcen (Budgetmitteln) erfordert, selbst wenn sich die Schadensquelle im Ausland
befindet (z. B. das slowakische Kernkraftwerk in Mohovce). Dies erfordert auf nationaler Ebe-
ne eine entsprechende Überzeugungspolitik gegenüber dem Steuerzahler (Kirchgässner
1992). Auch in dieser Hinsicht könnte Österreich die für sich reklamierte Rolle des umweltpo-
litischen Vorreiters unter Beweis stellen.
Ungeachtet dieser neuen globalen Sicht der Umweltpolitik wird in somanchen entwickelten
Staaten über die Einführung von Umweltsteuern auf Importe aus Ländern mit einer relativ
umweltintensiven Produktionsweise diskutiert. Die strikte Betonung des Verursacherprin-
zips durch ökologische Importsteuern kann zwar vordergründig als zweitbeste Lösung ange-
sehen werden, doch kann diese Strategie hintergründig als Substitut für abgebaute tarifäre
Handelsrestriktionen eingesetzt werden und dadurch ökonomisch effizientere Lösungen ver-
hindern.
ANMERKUNGEN
1 An dieser Stelle ist anzumerken, daß der Marshallplan auch zur Teilung Europas beigetragen hat (Mähr1989): Einerseits gelang es in jedem Teilnehmerland, das Wirtschaftssystem wieder leistungsfähig zu ma-chen und das Entstehen totalitärer Regime abzuwehren. Andererseits versagten die Sowjets den in ihremEinflußgebiet befindlichen Staaten die Teilnahme am ERP.
2 Wir sollten uns heute bei der Diskussion der Probleme in den Transformations- und Entwicklungsländerndaran erinnern.
3 Allerdings beziehen sich die Bestimmungen des GATT bzw. der WTO hauptsächlich auf die Warenhan-delspolitik der Regierungen und betreffen noch kaum die so zahlreichen wie unterschiedlichen nationalenRegulierungen des Dienstleistungssektors und der öffentlichen Beschaffungsvorgänge sowie die wettbe-werbseinschränkenden Maßnahmen der Unternehmen. Letztere sind private, auf Marktmacht beruhendenicht-tarifäre Handelshemmnisse (Kenen 1994, S. 262ff., 293ff.). Daher wird Handelspolitik zunehmenddie Form von Industrie- und Wettbewerbspolitik annehmen.
4 Die Agrarabschöpfungen sind jene Gebühren, die auf Agrarprodukte aus Drittländern aufgeschlagen wer-den, um deren Preis auf das Niveau des Binnenmarktpreises anzuheben.
5 Nach Handels- und Kooperationsverträgen der EU mit den meisten der Reformstaaten gleich in den Jah-ren 1989 und 1990 schloß die EU mit ihnen 1992 Interimsverträge ab, die sogar einseitigen Zolltarifsen-kungen (EU-Importzölle) für Industriegüter zum Inhalt hatten (Breuss 1995). 1994/95 folgten Assoziie-rungsverträge, die sogenannten Europaverträge, wodurch im Osthandel der EU Freiheiten des Gemeinsa-men Marktes zum Tragen kamen, ohne daß damit jedoch eine wettbewerbspolitische Rechtsangleichungwie bei Mitgliederstaaten erfolgte. Die EU-Importquoten und die - asymmetrischen - Zölle für sensibleWaren, wie Stahl, Kohle, Textil und Bekleidung, sollen immerhin bereits 1996 und 1997 aufgehobenwerden (Breuss, Schebeck 1996, S. 98f.).
50
6 Der Dezember-Ratsgipfel 1994 in Essen bot den potentiellen Mitgliedern einen "strukturierten Dialog" an.Im Mai 1995 wurde ihnen ein Pflichtenheft über die Vorbereitung der für eine Vollmitgliedschaft erfor-derlichen Rechtsanpassung vorgestellt. Die assoziierten Staaten wurden bereits zur Teilnahme an der Dis-kussion auf dem Ratstreffen von Cannes im darauffolgenden Juni eingeladen. Die Madrider Dezemberta-gung des Rates befaßte sich 1995 mit den von der EU-Kommission abgeschätzten Auswirkungen einerOsterweiterung, insbesondere auf die Kosten der Gemeinschaftliche Agrarpolitik. Dabei betonte der Ratdie historische Chance und politische Notwendigkeit eines EU-Erweiterungsschrittes nach Osten. Europa-abkommen waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit zehn Staaten abgeschlossen. Frühestens nach Beendi-gung der EU-Regierungskonferenz von Florenz (1996-98) könnten die Beitrittsverhandlungen aufgenom-men werden (Breuss, Schebeck 1996, S. 97f.).
7 Die Forderung nach einer generellen Liberalisierung der Arbeits- und Ladenöffnungszeiten ist daher imHinblick auf andere Ziele zu relativieren, wie etwa die Lebensqualität der Handelsangestellten (StichwortZeitsouveränität) wie der Kleinstunternehmer (Stichwort Überlastung), die Einkommensumverteilungs-wirkungen zwischen großen und kleinen Handelsunternehmen, zwischen Unternehmen und Arbeitneh-merhaushalten, Wachstums- und Schrumpfungsbranchen sowie die rein temporale Umverteilung der be-stehenden Nachfrage innerhalb der Rahmenöffnungszeiten. Gerade bezüglich der Lebensqualität von Ar-beitgebern und Arbeitnehmern im kleingewerblichen (weniger dispositionsfähigen) Einzelhandel weistdie Theorie auf ein Koordinationsversagen des Marktes hin, indem aufgrund der Intransparenz der Kon-kurrenzsituation und der Unsicherheit über das Konkurrentenverhalten eine optimale Abgrenzung der in-dividuellen Öffnungszeiten nach Grenzkosten und Grenzerlösen beeinträchtigt wird (Gordon 1993, S.227f.).
8 In diesem Sinn stand auch der Weltwirtschaftsgipfel der sieben größten Industriestaaten (G-7) im Juni1996 unter dem Motto "Die Globalisierung meistern - zum Nutzen von allen". Mit dem Blick auf die po-litisch-ökonomische Realität fielen die Ergebnisse des Gipfels der G-7 erwartungsgemäß nur sehrschwach zu Gunsten der wirtschaftlich und sozial benachteiligten Staaten aus.
9 Zwar ist es auf kurze Sicht ist es ökonomisch rational, wenn die anderen Staaten ihre verschmutzendeProduktion als Reaktion auf die Vorreiterpolitik ausdehnen. Dennoch gibt es auf längere Sicht durchausErfolgsaussichten. Erstens kann ein umweltpolitischer Vorreiterstaat insofern mit dem Nachziehen derNachzügler rechnen, als er implizit droht, seine Maßnahmen wieder zurückzunehmen, wodurch dann alleStaaten wieder schlechtergestellt werden ("Tit-for-tat Strategy"). Zweitens ist die Vorbildfunktion desVorreiters ist nicht zu unterschätzen: Die Umweltbewegungen der Nachzüglerstaaten erhalten durch dasVorbild moralische Unterstützung und gewinnen an politischem Gewicht. Drittens ist der Vorzeigeeffektist nicht als gering zu erachten: Der Vorreiter zeigt, daß die umweltpolitische Maßnahme seine interna-tionale Wettbewerbsposition nicht wesentlich beeinträchtigt und daß die befürchtete wirtschaftliche "Kata-strophe" ausbleibt. Dies haben empirische Studien ergeben (z.B. Wicke 1991). Selbst wenn die relativeWettbewerbsposition beeinträchtigt würde, gibt es kein wohlfahrtspolitisches Erfordernis für eine interna-tionale Harmonisierung der Umweltpolitiken, da die Grenzkosten wie die Grenznutzen der Umweltpolitiknational sehr unterschiedlich sind. Einheitliche umweltpolitische Normen wären daher ökonomisch inef-fizient (Kirchgässner 1992).
LITERATURVERZEICHNIS
ABELE, H. "Anmerkungen zu einer Wirtschaftsgeschichte der Gegenwart: Österreich seit 1945". In Abele, H.,Nowotny, E., Schleicher, S., Winckler, G. (Hrsg.), Handbuch der Österreichischen Wirtschaftspolitik.Wien 1989, S. 57-74.
ADDISON, J.T., GERLACH K. "Gewerkschaften und Produktivität: Fehlallokation oder Produktivitätssteige-rung? Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 139, 1983, S. 215-228.
BAYER, K. "Standortindikatoren". In Handler H. (Hrsg.), Wirtschaftsstandort Österreich. Wettbewerbsstrate-gien für das 21. Jahrhundert. Wien 1996, S. 56-64.
BREUSS, F. "Außenwirtschaft". In Abele, H., Nowotny, E., Schleicher, S., Winckler, G. (Hrsg.), Handbuchder Österreichischen Wirtschaftspolitik. Wien 1989, S. 399-418.
BREUSS, F. "Cost and Benefits of EU´s Eastern European Enlargement". WIFO Working Paper 78, 1995.
51
BREUSS, F. "Erste Spuren des EU-Beitritts in Österreichs Wirtschaft. Ein Überblick". WirtschaftspolitischeBlätter 43, 1996, S. 207-224.
BREUSS, F., SCHEBECK, F. "Opening up of Eastern Europe and Eastward Enlargement of the EU". AustrianEconomic Quarterly 1, 1996, S. 97-107.
GORDON, R.J. Macroeconomics. 6. Aufl., New York 1993.HAHN, F., WALTERSKIRCHEN, E. "'Stylized Facts' der Konjunkturschwankunggen in Österreich, Deutsch-
land und den USA". WIFO Working Paper 58, 1992.HANDLER, H. (Hrsg.) Wirtschaftsstandort Österreich. Wettbewerbsstrategien für das 21. Jahrhundert. Wien
1996.HELMENSTEIN, C., URL, T. "Identifying Common Fluctuations in Europe". WIFO Working Paper 76, 1995.HUTSCHENREITER, G. "Cluster innovativer Aktivitäten in der österreichischen Industrie". WIFO-Studie.
Wien 1994.KENEN, P.B. The International Economy. 3. Aufl., New York 1994.KIRCHGÄSSNER, G. "Ansatzmöglichkeiten zur Lösung europäischer Umweltprobleme". Außenwirtschaft 47,
1992, S. 55-77.KRUGMAN, P.R. "What Do Undergrads Need To Know About Trade?". American Economic Review 83, Pa-
pers and Proceedings, 1993, S. 23-26.KRUGMAN, P.R., OBSTFELD, M. International Economics, Theory amd Policy. 2. Aufl., London 1991.MÄHR, W. Der Marshallplan in Österreich. Graz 1989.OECD. OECD Monthly Statistics of Foreign Trade, August 1993.OECD. OECD Economic Surveys. Austria. Paris 1993, 1995.OECD. OECD Main Economic Indicators, Paris, Mai 1996.OESTERREICHISCHE NATIONALBANK "Zahlungsbilanz im Jahr 1994". OeNB Berichte und Studien,
I/1995, S. 3-11.OESTERREICHISCHE NATIONALBANK "Zahlungsbilanz im Jahr 1995". OeNB Berichte und Studien,
I/1996, S. 15-21.SCHAPS, J. "Die EG und das GATT". In Röttinger, M., Weyringer, C. (Hrsg.), Handbuch der europäischen
Integration, Wien 1991.SCHNEIDER, F. "Die Auswirkungen des EU-Beitritts. Eine vorläufige, kritische Bilanz eines EU-
Befürworters". Wirtschaftspolitische Blätter 43, 1996, S. 264-270.SCHNITZER, Y. "Transformationsprozeß in China". WIFO-Monatsberichte 68, 1995, S. 376-383.SCHONEWEG, E. "Regionalpolitik". In Röttinger, M., Weyringer, C. (Hrsg.), Handbuch der europäischen
Integration, Wien 1991.STANKOVSKY, J. "Direktinvestitionen in Osteuropa: Österreich auf dem Rückzug?". WIFO-Monatsberichte
69, 1996a, S. 349-354.STANKOVSKY, J. "The Role of Foreign Direct Investment in Eastern Europe". Austrian Economic Quarterly
1, 1996b, S. 109-120.STREIL, S.J., WEYRINGER, C. "Der Binnenmarkt und die vier Freiheiten". In Röttinger, M., Weyringer, C.
(Hrsg.), Handbuch der europäischen Integration. Wien 1991, S. 229-249.SUM, N.-L. "Social Embeddedness and Geo-Governance in East Asian Economic Regions: Their Nature and
Dynamic in Three Contrasting Cases and Some Implications for Eastern Europe". Der öffentliche Sektor -Forschungsmemoranden, 1995, S. 21-46.
VRANITZKY, F. "Mit neuer Kraft für Österreich". Regierungserklärung 1986. Wien 1986.VRANITZKY, F. "Eine neue Partnerschaft für Österreich". Regierungserklärung 1987. pd-aktuell 21, 1987.WEISS, A. "Österreich als Standort international kompetitiver Cluster". IWI-Studien, Band XIII. Unter Mitar-
beit von C. Bellak, G. Kerschbaumer, W. Koller, W. Minarik, C. Patsch, T. Wildner. W. Clement, Pro-jektleitung. Industriewissenschaftliches Institut, Hrsg. Wien 1994.
WICKE, L. Umweltökonomie und Umweltpolitik. München 1991.WIEDENFELD, W., WENELS, W. (Hrsg.) Europa von A - Z. Bonn 1996.WIFO. Wifo-Monatsberichte 69, beiliegende Statistische Übersichten. 1996.