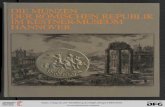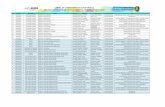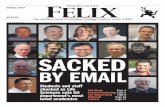Der Octavius des Minucius Felix - ein interreligiöser "Rechtsstreit" zur Beurteilung der...
-
Upload
thh-friedensau -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Der Octavius des Minucius Felix - ein interreligiöser "Rechtsstreit" zur Beurteilung der...
Der „Octavius“ des Minucius Felix:Ein interreligiöser „Rechtsstreit“ zur
Beurteilung der römischen undchristlichen Religion1
Minucius Felix hat Anfang des 3. Jahrhunderts2 mitdem „Octavius“ eine stilistisch wie inhaltlichbesonders unterhaltsame Variation christlicherApologetik geschaffen. Ich möchte in diesemArtikel einige Beobachtungen entwickeln, diezeigen sollen, was unter anderem an diesem kurzenBüchlein innovativ ist und damit zu einer erstenoder erneuten Lektüre einladen.3
1 Ich danke Jürgen Zangenberg, Renate Noack und WinfriedNoack für hilfreiche inhaltliche und formaleVerbesserungsvorschläge.
2 In der offenen Frage, ob Tertullian bei der Abfassungseines „Apologeticum“ (ca. 197 n. Chr.) den „Octavius“benutzt hat oder umgekehrt Minucius Felix auf das„Apologeticum“ zugreift, überzeugen mich die Argumentederjenigen Philologen, die letzteres vertreten. DasHauptargument ist, dass Minucius Felix bei derinhaltlichen Ausgestaltung seiner Schrift verschiedeneliterarische Quellen benutzte (u.a. Cicero „de naturadeorum“, Seneca, Vergil, Tacitus), diese aber umdeuteteoder für seine Zwecke rearrangierte. Bei Tertullian lässtsich dieses Verfahren nicht so deutlich beobachten. Daherist anzunehmen, dass Minucius mit Tertullians Text soumgegangen ist wie mit den nichtchristlichen Texten.
3 Der Text ist leicht zugänglich als Reclamausgabe: M.Minucius Felix: Octavius, Lateinisch/Deutsch, hrsg. undübersetzt von Bernhard Kytzler, Stuttgart: Reclam, 1993.Sie folgt der kritische Textausgabe, die Kytzler 1965 imKöselverlag (München) herausgegeben hat.
Vielen Lesern des Octavius fällt die Stimmungder urbanitas, der Höflichkeit und gebildetenAusdrucksweise, der Freundschaft und desgegenseitigen Respekts auf. Die Rahmenhandlung istvon Urlaubsstimmung, persönlicher Nähe undSensibilität geprägt. Drei Freunde, alleRechtsanwälte, die in Rom tätig sind, disputierenam Strand des alten Ostia, veranlasst durch einereligiöse Geste von Caecilius, einem derProtagonisten, über die wahre Verehrung derGötter/des Gottes und kommen schließlich zu demErgebnis, dass die Christen die wahreGottesverehrung (vera religio) praktizieren, währenddie römische Götterverehrung Aberglaube ist(superstitio).
I. Textform und Thema
Zunächst soll genauer bestimmt werden, welchesHauptthema den Text prägt und welche TextformMinucius Felix gewählt hat, um seineAussageintention umzusetzen.Ich beginne mit einem Gliederungsvorschlag des
Textes, der gleichzeitig eine knappe Inhaltsangabesein soll:
A: Hinführung und Rahmenhandlung1: Hinführung: Sehr persönlich und emotional gehalteneRückerinnerung des Autors Minucius Felix an den verstorbenenOctavius, der ihm Freund in allen Lebenslagen gewesen war.Erinnerung an ein besonderes Gespräch, von dem ab Kap. 2berichtet wird:2-4: Rahmenhandlung: Spaziergang der drei Freunde amGestade und Strand von Ostia und der Auslöser derDisputation: Caecilius ehrt eine Serapis-Statue, wasMissfallen bei Octavius hervorruft, was wiederum Caeciliuskränkt. Er fordert eine Disputation zwischen ihm undOctavius zur Klärung der angemessenen religiösenLebensweise.
B: Die Disputation, der gespielte Gerichtsprozess:5-13: Das Plädoyer des Caecilius: Er entfaltet seine Kritikbezüglich der Möglichkeit, genaueres über die Natur derGötter zu erfahren (5 und 13). Konsequenz daraus ist nichtder Atheismus, sondern die Treue zur traditionellen,altehrwürdigen und erfolgreichen Götterverehrung Roms (6-7). Dann folgen massive Angriffe auf Kultpraxis undGottesverehrung der Christen (8-12: u.a. Vorwurf der
Verschwörung, Tötung von Säuglingen bei nächtlichenVersammlungen), Infragestellung bestimmter Lehren derChristen, vor allem des Weltgerichtes und derAuferstehungshoffnung. 14-15: Kurzer Wortwechsel zwischen Caecilius und Minucius Felix, dervon den Freunden zum „Richter“ ernannt wurde, zurUnterscheidung zwischen rhetorischer Form undWahrheitsgehalt. 16-38: Plädoyer des Octavius, das Schritt für Schritt auf dieArgumente des Caecilius eingeht: Widerlegung derskeptischen Haltung des Caecilius (16-19); dieGötterverehrung der Römer wird als Aberglaube(superstitio) entlarvt und die Wirksamkeit vonGötterstatuen durch Dämonen erklärt (20-27). Widerlegungder Angriffe auf die Kultpraxis und Gottesverehrung derChristen als hahnebüchener Unsinn (von Dämonenverursacht) und Erweis des christlichen Glaubens als wahreGottesverehrung, als vera religio (28-38), die auchbezüglich des Weltgerichts und der Auferstehungphilosophisch bestehen kann.
C: Ergebnis und Schluss39-40: Caecilius nimmt den Richterspruch des Minuciusvorweg, er erklärt Octavius, aber auch sich selbst zumSieger, da er durch ihn vom Irrtum zur Wahrheit gefundenhabe. Alle freuen sich.
Die Bezeichnung des Textes als „Dialog“ isteinerseits zwar richtig und dennoch nicht präzisgenug. Ein Dialog, bei dem die Gesprächspartner ineinem ständigen Hin und Her ihre Argumente oderFragen austauschen, wie zum Beispiel in vielenplatonischen Dialogen, in Justins „Dialog mit demJuden Tryphon“ oder zumindest immer wieder inCiceros Schrift „de natura deorum“, die MinuciusFelix ausführlich für seine Schrift benutzt hat,4
4 Wobei auch Cicero seine Gesprächspartner z.T. sehrlange Argumentationen entwickeln lässt, fast das gesamteBuch 2 (von 4-168) enthält das ununterbrochene Plädoyerdes Stoikers Lucilus Balbus. Vgl. Hans von Geisau,„Minucius Felix“, in: Paulys Realencyclopädie der classischenAltertumswissenschaften (RE) Suppl. 11 (1968), Sp. 952-1002 und1365-78., dort Sp. 975f.: „M.F.’ Gesprächsmuster istoffenbar Cic. De natura deorum, in dem die epikureischeund die stoische Götterlehre durch Velleius bzw. Balbuszusammenhängend vorgetragen werden, so dass zu jeder These
liegt nicht vor. Die Gliederung zeigt, dass dieSchrift schwerpunktmäßig in Rede und Gegenredezweier Parteien unterteilt ist, getrennt durcheine kleine Auseinandersetzung zwischen Caeciliusund Minucius, des (Schieds-)Richters“ (arbiter 4,6oder iudex 5,1; 15,1), der zum Schluss seinenUrteilsspruch (sententia) fällen soll.5 Der Autorlässt die befreundeten Anwälte am Ufer des Meereseine philosophische Disputatio durchführen, die an dieForm des öffentlichen Gerichtsprozesses (genus iudicale)auf dem Forum angelehnt ist.6 Auf die vom Autorbewusst gewählte Mischform zwischenphilosophischer Diskussion und Rechtsprozessweisen auch die Begriffe hin, die verwendetwerden: quaestio (40,2), disputatio (1,5; 4,4-5),sententia (5,1; 40,1), iudex (5,1; 15,1).die Gegenthese zu finden ist…“
5 Ebd., Sp. 954: „Echtes Gespräch finden wir nur zuAnfang, in der Mitte und am Schluss, viel weniger als etwain Tacitus’ Dialogus de oratoribus mit seinem lebhaftenund eher zwanglosen Hin und Her. Der ‚Octavius’ besteht,abgesehen von einer die Situation darlegenden Einleitung,aus Rede und Gegenrede vor einem Schiedsrichter, dessenRolle M.F. selbst übernimmt.“ Zur Einsetzung einesSchiedsrichters vgl. Tacitus, Dialogus de oratoribus 4,2-5,2.
6 Ebd., Sp. 976: „Es sind also 2 große Monologe (actio8,3, 15,1 oder propositio 16,2 und responsio 16,2; sieentsprechen der probatio und refutatio im Betrieb derRhetorenschule), von knappen Dialogen umgeben und in einenerzählenden Rahmen hineingestellt.“ Vgl. auch Bernd ReinerVoss, Der Dialog in der frühchristlichen Literatur, München 1970, S.40: „Das Werk ist als Redestreit angelegt, bei dem dieGegner ihre Auffassungen in zusammenhängenden Darlegungenvortragen. Mit ihrer Folge von Klage und Gegenklage imBeisein eines Schiedsrichters ist die Auseinandersetzungeinem Streit vor Gericht angenähert.“ Voss kann auch davonsprechen, dass „die Ausführungen als Gerichtsredenangelegt sind“ (46) und auf den „Prozesscharakter derAuseinandersetzung“ (46) hinweisen.
Das Hauptthema lässt sich aus dreiTextabschnitten erschließen, die zusammenfassenden(1,5) oder abschließenden Charakter haben (13,5und 38,7):
1,5: Wenn ich nun in Gedanken die ganze Zeit unseresfreundschaftlichen Zusammenlebens an mir vorüberziehenlasse, dann fesselt meine Aufmerksamkeit vor allem jeneUnterredung, in der er in einer tief greifendenArgumentation den Caecilius, der damals noch im Wahn desAberglaubens befangen war, zur wahren Gottesverehrungbekehrte („…in illo praecipue sermone eius mentis meaeresedit intentio, quo Caecilium superstitiosis vanitatibusetiamnunc inhaerentem disputatione gravissima ad veramreligionem reformavit“).7
13,5: Und so ist auch meine Meinung, dass man unlösbareFragen als Fragen auf sich beruhen lassen soll und sichnicht kühn und keck auf die eine oder andere Ansichtfestlegen darf, da doch so viele große Männer bei bloßenMutmaßungen stehengeblieben sind; denn sonst macht sichentweder ein altweiberhafter Aberglaube breit oder aberdie Religiosität geht gänzlich zugrunde („…ne aut anilisinducatur superstitio aut omnis religio destruatur“).
38,7: Warum sollten wir undankbar sein, warum es unsselbst missgönnen, wenn das wahre Wissen über Gott indieser unserer Zeit zur Vollkommenheit gelangt ist?Genießen wir unser Glück, fällen wir über das Rechte einausgewogenes Urteil: der Irrglaube werde gebannt,Gottlosigkeit gesühnt, die wahre Gottesverehrung aberbleibe bewahrt („…cohibeatur superstitio, inpietas expietur,vera religio reservetur“).
Das Hauptthema ist demzufolge die wahreGottesverehrung (vera religio). Genau dieses Thema istin seiner inhaltlichen Ausführung umstritten undwird darum zum Problem, zur Frage. „Caecilius“8
7 Die Übersetzungen lehnen sich an die Reclamausgabe vonKytzler an.
8 Die Anführungsstriche bezeichnen die Figuren, dieMinucius Felix als Autor gestaltet hat. Ich verstehe sie –ungeachtet tatsächlicher Personen und Erlebnisse – alsrepräsentative, typisierte Vertreter ihrer Position, die in derGesamtkomposition der Dichtung bestimmte Funktionen zuerfüllen haben. Geisau (Anm.4) argumentiert dahingehend,
repräsentiert die Auffassung, dass die wahre religiodarin besteht, auf metaphysische Gewissheitenbezüglich der Götter aufgrund kritischer Einwände9
zu verzichten und deshalb vielmehr die altenüberlieferten römischen Kultgebräuche (religionestraditas) zu pflegen wie auch die Kulte, die dieRömer durch militärische Siege zu ihren eigenengemacht haben, d.h. die durch Tradition undÜbernahme entstandene Götterverehrung (disciplinammaiorum) zu achten.10 Die Macht der Götter zeigedass der Octavius ein historischer Dialog ist (dem also eintatsächlich geführtes Gespräch zugrunde liegt), und zwarin Auseinandersetzung mit Wolfgang Speyer, der gewichtigeArgumente für den Charakter als fiktiven Dialog ins Gesprächgebracht hat („Octavius, der Dialog des M.F.: Fiktion oderhistorische Wirklichkeit“, in: Jahrbuch für Antike undChristentum 7 (1964), S. 45-51 = ders., Frühes Christentum imantiken Strahlungsfeld, Tübingen 1989, S. 14-20).
9 Dies geschieht in Anlehnung an die platonischeAkademie, die unter Arkesilaos, Karneades und Philon vonLarissa einen gemäßigten Skeptizismus (Probabilismus)entwickelte, der auf die ursprüngliche sokratischeGrundhaltung zurückgreifen wollte: Der Mensch könne dasabsolute Wissen nicht erlangen. „Caecilius“ spielt dieRolle, die der Pontifex „Cotta“ in Ciceros de natura deorumzu vertreten hat. Zum von der pyrrhonischen Skepsisgeprägten Charakter des Skeptizismus von „Caecilius“ vgl.Hans Armin Gärtner, „Die Rolle und die Bewertung derskeptischen Methode im Dialog Octavius des MinuciusFelix“, in: Manfred Wacht (Hg.), Panchaia. Festschrift für KlausThraede, Münster 1995, S. 141-147: dort S. 145: „Ich meinenun, Minucius lässt seinen Caecilius sich zwar aufArkesilaos und Karneades berufen, rückt ihn aber, was dieTendenz seiner Argumentation angeht, deutlich in die Näheder pyrrhonischen Skepsis.“
10 Die Verbindung von philosophischem Skeptizismus miteiner kulturellen und politischen Treue zur vorgegebenenGötterverehrung repräsentiert eine Einstellung in derOberschicht, die noch Ende des 4. Jh. gängig war; vgl. die
sich in ihrer Fähigkeit, bei richtiger Verehrung(pietas, religio) – Erfüllung der Opfer, Reinheit derJungfrauen, Ritualpflege selbst in Notsituationen– Erfolg zu geben, gerade auch militärisch unddamit politisch. Weitere Aufgaben der Götterseien: die Zukunft zu offenbaren, Schutz inGefahren zu geben, Heilmittel bei Krankheiten,Hilfe den Elenden, Trost in der Trübsal undLinderung im Leiden zu sein (7,6.). „Octavius“, der wie „Minucius“ ehemals die
gleiche (römische) Lebensweise (genus vitae 5,1)vertrat, aber dann zur Lebensweise der Christenüberwechselte, verkörpert die gegenteiligePosition. Philosophische Argumentation führtgerade nicht zur Unsicherheit bezüglich des Wesensder Götter, sondern auf die Spur des einen Gottes,dessen ganze Wahrheit nun gerade den Christen undnicht den Römern bekannt ist und somit dieGrundlage für die wahre religio bildet. „Octavius“hat im Streitgespräch die Funktion, den römischenGötterglaube wie auch die römische Kultpraxis instark abwertender Weise als superstitio zu entlarven,im diametralen Gegensatz zur Position des„Caecilius“, der gerade die christlicheLebensweise als anilis superstitio (altweiberhafterAberglaube 13,5) aufzudecken versucht. Wir halten fest: In Frage steht, welche
Lebensform (vivendi genere) - traditionelle römischeoder die christliche Lebensform - religio ist, undzwar im Unterschied zum Aberglauben, zur superstitio.Minucius Felix lässt die Plädoyers der Freunde an
Bittschrift des Symmachus 3,8: „Da nämlich unser Verstandim Dunkeln tappt, wie könnten wir bessere Kenntnis von denGöttern besitzen als durch Erinnerung [an ihren Beistand]und sichtbare Erfolge? Und wenn eine lange Reihe vonJahren eine Religion bestätigen, dann sollten wir sovielen Jahrhunderten die Treue bewahren und unseren ElternFolge leisten, so , wie diese mit Erfolg ihren Altvorderenfolgten.“ (Übersetzung nach Adolf Ritter (Hg.), Kirchen- undTheologiegeschichte in Quellen, Band I. Alte Kirche, Neukirchen-Vluyn1985, S. 186.)
der Leitdifferenz religio/superstitio entlanglaufen.11
Diese ist binär konstruiert (Entweder-Oder), waseinen dritten Wert ausschließt. Die ebenfallsverwendeten binären Unterscheidungen Irrtum vs.Wahrheit (error/veritas) und Unwissenheit vs. Weisheit(inscientia/sapientiam) sind ihr zuzuordnen. Das Entweder-Oder dieser Differenzen spiegelt
sich in Rede und Gegenrede des gespieltenGerichtsprozesses.
II. Das Bezugsproblem
Ich möchte jetzt genauer nach dem Bezugsproblemfragen, das der Autor Minucius Felix mit dieser„Versuchsanordnung“ im Blick hat und auf einebestimmte Weise lösen möchte. Es ist daraufaufmerksam zu machen, dass im Prozess-Spiel derFreunde nicht nur philosophische Schulmeinungenauf dem Spiel stehen, sondern sinngebende Identitätenund Lebensformen.12 Das entspricht dem Idealphilosophischer Freundschaft. „Caecilius“ beginntdaher seine Argumentation in Blick auf zweiLebensformen:
11 Auf die Unterscheidung religio licita/illicita wird zwarangespielt, aber sie erhält die tragende Rolle wie inTertullians Apologeticum, das viel stärker an dem Problemder Prozesse gegen Christen orientiert ist. Die Plädoyershaben nicht nur mögliche kriminelle Delikte im Focus,sondern nehmen auch den philosophischen Wahrheitsgehaltder jeweiligen Lebensstile in den Blick. Das gibt derSchrift insgesamt eine andere Tendenz, als sie beiTertullian vorliegt. Dies spricht meines Erachtensebenfalls für eine Datierung nach Tertullian, in die ersteHälfte des 3. Jh. hinein, in der Christenverfolgungen vorallem in Nordafrika nachließen.
12 Pierre Hadot, Wege zur Weisheit oder: Was lehrt uns die antikePhilosophie?, Frankfurt am Main 1999, hat nachdrücklichdarauf aufmerksam gemacht, dass besonders in derKaiserzeit Philosophie als Lebensform begriffen wurde, diedie gesamte Lebensführung umfaßt (S. 125f.; 180-184). Andieses Konzept knüpfen die frühchristlichen Apologeten an.
„Lieber Marcus, du hast natürlich über die Frage, diewir jetzt genauer untersuchen wollen, eine festeMeinung; hast du doch beide Lebensformen (utroque vivendigenere) gründlich kennengelernt und dann die eineaufgegeben und die andere angenommen. Wenn du aber jetztdie Waagschalen hältst, musst du dich ganz auf denStandpunkt eines unparteiischen Richters (aequissimi iudicis)stellen. Keine der beiden Parteien darfst dubegünstigen. Sonst könnte der Verdacht entstehen, dassdein Richterspruch (sententia) mehr deiner eigenenÜberzeugung entspringt und weniger auf unserenArgumenten beruht.“ (5,1)
„Caecilius“ steht – wie sein Plädoyer zeigt -für eine römische Identität, deren besondererCharakter gerade darin besteht, dass traditionellereligio und politische Macht Roms in einemunauflösbaren Strukturzusammenhang gesehen werden,indem der politische Erfolg auf die strengeEinhaltung der Kultrituale zurückgeführt wird.13
Zu dieser Lebensform gehört auch die Teilnahme anVergnügungen, Schauspielen, Festzügen undöffentlichen Speisungen (12,5-6). Die Distanz derChristen zu diesen kulturellen Praktiken führt„Caecilius“ auf religiöse Angst zurück (12,5). Inexkludierender Weise charakterisiert „Caecilius“in einer sehr abwertenden Fremdbeschreibung denchristlichen Glauben und Kult sowohl alsphilosophisch unbrauchbar, weil angstgeprägt, wieauch politisch gefährlich. Dass Christen Römer imrechtlichen Sinne sein können, kommt nicht in denBlick; ihre Praxis ist aus seiner Sicht mitrömischer Lebensweise, mit dem „Römertum“, nichtvermittelbar, sie ist nicht Anschlussfähig. DieChristen stehen aus seiner Sicht außerhalb desweit gespannten Möglichkeitsspielraums derjenigenLebensform, die römischen Charakter hat. Mitdiesem harten Urteil konfrontiert er zweiChristen, mit denen er freundschaftlichen Umgangpflegt.
13 Dies ist ein klassischer Topos römischer Identität,vgl. Cicero, de natura deorum 2,8; 3,5; de haruspicum responso9,10.
„Octavius“ wiederum steht für die Identität alsChristianus,14 der zur Verteidigung seinerLebensführung als religio die römische Kultpraxisals superstitio angreift (Romana superstitio 24,10;superstitio Romanis 25,1), und dabei auch diepolitische Identität Roms einbeziehen muss. Diestut er tatsächlich in äußerst negativer Weise inKapitel 25: Der Anfang Roms sei auf Unrecht undauf Verbrechen gegründet. Eine positive Beziehungzur römischen Identität wird inhaltlich nichtanvisiert. Zwar bezieht sich „Octavius“ auf„unsere Vorfahren“ (maioribus enim nostris 20.3,maiores nostri 20,5), die hinsichtlich der Götterunvorsichtig und leichtgläubig gewesen seien.Gemeinsame Basis ist die Bildung: „Diese abwegigenAmmenmärchen lernen wir von unseren unerfahrenenEltern, und, was noch schwerer wiegt, wirerarbeiten sie uns selbst in unseren Studien undim Unterricht, hauptsächlich aus den Werken derDichter.“ (23,1) Er redet dann aber die offiziellerömische Lebensweise mit „ihr“ an: „Eure Götter“(22,5), „eure Völker“ (31,2), „eure Geschichten,eure Tragödien“ (31,3), „eure Ehrenstellen, eurePurpurstreifen“ (31,6). So entsteht der Eindruck,dass Christen Menschen sind, die sich weder mitdem römischen Staat noch mit dessen Religionidentifizieren.15 In Kapitel 28 spricht er von
14 Diese Selbstbezeichung taucht mehrmals im Plädoyer desOctavius auf, ohne jemals auf Jesus als den Christus Bezugzu nehmen, auf den der Name verweist: 18,11; 20,1; 27,7;28,2; 28,4f.; 35,5f.; 37,1; 37,3.
15 Die Identität als Christianoi, von griechischer undjüdischer Lebensform unterschieden, führt im Diognetbriefzu folgender Zuordnung: „Obwohl sie griechische undbarbarische Städte bewohnen, wie es einen jeden traf, unddie landesüblichen Sitten befolgen in Kleidung und Kostsowie im übrigen Lebensvollzug, legen sie doch eineerstaunliche und anerkanntermaßen eigenartigeBeschaffenheit ihrer Lebensführung an den Tag. Siebewohnen das eigene Vaterland, aber wie Beisassen. Sienehmen an allem teil wie Bürger, und alles ertragen sie
seiner vorchristlichen Zeit: „Wir waren ja in derselben Lage wie ihr und hatten dieselbenAnsichten, solange wir noch blind und taub waren“(et nos enim idem fuimus et eadem vobiscum quondam adhuccaeci et hebetes sentiebamus). Die Christen sind, weilsie der Wahrheit anhängen, verglichen mit denirrenden, abergläubischen Römern „viel besser“(multo vobis meliores 35,5). Er setzt auf diekomplexere Struktur monotheistischerWelterklärung, beansprucht für diese höherePlausibilität, gerade auch aus philosophischerPerspektive.16 Ja, die Christen sind nicht alsgefährlicher Geheimbund, sondern vielmehr alssittlich besonders ausgezeichnete philosophischeLebensform zu begreifen: „Und dass sich unsereZahl von Tag zu Tag vergrößert, das kann jaschließlich nicht ein Beweis für einen Irrweg(crimen erroris) sein, sondern zeugt für eine guteSache. Denn nur einer Lebensform (genere vivendi),die in ihrer Vorzüglichkeit andere in den Schattenstellt, bleiben ihre alten Anhänger treu undschließen sich neue an“ (31,7). „Caecilius“ bleibttrotz dieser offensiven Verteidigung für„Octavius“ Natalis mei (mein Natalis) und meus frater(mein Bruder), d.h. auf der Ebene der Freundschaftbleiben sie miteinander verbunden, trotz (noch)divergierender Lebensformen.
Aufgrund dieser Beobachtungen ist es genauermöglich, das Bezugsproblem zu bestimmen, dasMinucius Felix bearbeitet. Es ist die massiveAblehnung der christlichen Lebensform durch dierömische Mehrheitsgesellschaft. Die abweichende
wie Fremde. Jede Fremde ist ihr Vaterland und jedesVaterland eine Fremde…“(Schrift an Diognet 5,4-5)
16 Vgl. 20,1: „Die Meinungen fast sämtlicher Philosophenvon Rang habe ich dargelegt; alle haben den einen Gott,wenn auch unter vielerlei Namen, gelehrt. Ja, man könntemeinen, die Christen wären die Philosophen von heute –oder die Philosophen wären schon damals Christen gewesen(aut nunc Christianos philosophos esse aut philosophos fuisse iam tuncChristianos).“
Lebensform der Christen,17 ihre Devianz vomÜblichen, Vertrauten, wird nicht geachtet, sondernverachtet. Die Verachtung erzeugt Vorurteile undBehauptungen über ihre Lebensweise, die auschristlicher Sicht unwahr sind, ja in ihrerGroteskheit und Überzogenheit erneut einerErklärung bedürfen (Minucius Felix führt sie aufdas Wirken von Dämonen zurück). Die Ausgrenzungchristlicher Sinngehalte als superstitio wurde auchvon philosophisch gebildeten Rhetoren und Anwältenbetrieben, also von Angehörigen der Bildungselitedes Reiches, die wiederum im engen Kontakt zurOberschicht und zum Kaiserhaus standen, wie zumBeispiel Fronto, auf den sich Minucius Felixexplizit bezieht. 18
17 Ulrich Berner, „Religio und Superstitio. Betrachtungenzur römischen Religionsgeschichte“, in: Th. Sundermeier(Hg.): Den Fremden wahrnehmen. Bausteine für eine Xenologie,Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 1992, S. 45-64, dortS. 56-60, führt in diesem Zusammenhang den Begriff der„Daseinshaltung“ ein und konstatiert: „Die Ablehnung desChristentums im römischen Staat kann aus derUnvereinbarkeit verschiedener religiöser Daseinshaltungenerklärt werden…Aus der römischen Sicht erscheint dasChristentum als eine verkehrte Einstellung zurGesellschaft und zum diesseitigen Leben überhaupt.“ (59)Im Gegensatz zur Religionserfahrung von Stammes- undVolksreligionen als „primäre Religionen“, die wie dierömische dem vitalen Leben und der Lebenssteigerungdienen, neigen Hochreligionen als „sekundäre Religionen“(zu denen auch das neue Christentum gehört) eher zurAbwendung und zum Freiwerden vom diesseitigen Leben (soBerner in Anschluss an Theo Sundermeiers Differenzierungzwischen „primärer“ und „sekundärer“ Religion). Dieseweltdistanzierte Lebensform führte zur Ablehnung, nichtdie Fremdartigkeit an sich, wie zum Beispiel dieIntegration der dionysischen Religion mit ihrerlebenssteigernden Daseinshaltung in die römische Kulturzeige (58f.).
Ein semantisches Instrument zur Exklusionchristlicher Kommunikation wurde dieUnterscheidung religio/superstitio.19 Es ist allerdingszu beachten, dass der semantische Gehalt beiderBegriffe variieren kann und nur dann einenGegensatz bildet, wenn sie im Bedeutungskontextunmissverständlich als Gegensatz eingeführtwerden. Minucius Felix kann an einigen Stellensuperstitio ohne negative Konnotation verwenden undmeint dann nur den besonderen Eifer derGottesverehrung20. Synonym zu religio steht superstitio
18 M. Cornelius Fronto, römischer Rhetor und Anwalt, deraus dem afrikanischen Numidien stammte (Cirta). Er waru.a. Erzieher des Kaisers Marc Aurel und im Jahr 143Konsul. Bekannt sind Briefe, die er an die Kaiser MarcAurel, Lucius Verus und Antonius Pius schrieb. Alssuperstitio beurteilten u.a. auch Tacitus (Annalen 15.44.3-5),Sueton (Nero 16,2) und Plinius der Jüngere (Briefe10.96.8) das Christentum.
19 Auf diese Leitunterscheidung bin ich durch diespannende Darstellung Religions of Rome. Vol 1. A History (Cambridge1998) von Mary Beard, John North und Simon Price gestßen,die darauf aufmerksam machen, dass „römische Religion”Grenzen der Toleranz gegenüber Fremdkulten kannte undangemessene wie unangemessene Formen der Gottesverehrung(„proper and improper religious activity“) unterschied: „Apair of Roman terms, religio and superstitio, provides astarting point: two key terms with which the Romansdebated the nature of correct religious behaviour… ( S.215); vgl. auch Berner (Anm. 17); ders., „Moderner undantiker Religionsbegriff“, in: Kurt Erlemann und Karl LeoNoethlichs (Hg.), Neues Testament und Antike Kultur Band 1,Neukirchen-Vluyn 2004, S. 13-22; Dale Martin, InventingSuperstition from the Hippocratics to the Christians, Cambridge (MA)2004.
20 So in 6,2: Die Gallier bewundern die Kühnheit derGottesverehrung der Römer („et per Gallorum aciesmirantium superstitionis audaciam pergunt telis inermes,sed cultu religionis armati“), oder in 10,3: Der
nicht nur in 6,2, sondern auch in 5,7, wo beideBegriffe aus philosophischer aufgeklärterPerspektive (Skeptizismus, Epikureismus) einenegative Konnotation bekommen, weil sie Ausdruckvon Angst und Furcht seien: „Woher dann diereligiöse Scheu, woher die Angst, die Aberglaubeist (unde haec religio, unde formido, quae superstitio est)?“Der christliche Kult wird auch als libidum religio,als Ritual der Lüste bezeichnet (9,3) oder alsverdrehte, schlechte Gottesverehrung (prava religio21
10,1) abgewertet. Ebenso aber gilt, dass religio undsuperstitio als binäre Unterscheidung eingesetztwerden können und dann entsteht das Phänomen, dassreligio nur an superstitio erkannt werden kann, alsoden Gegenwert braucht, um sich selbst als religiobeobachten zu können.Die Unterscheidung hat eine doppelte
Stoßrichtung, eine seelsorgerlich-philosophische22 undeine politisch-gesellschaftliche. Als seelsorgerlichverwendete Unterscheidung gebraucht,differenzierte der philosophische Diskursirrtümliche von wahren Formen der Gottesverehrung.Irrtümlich ist eine Gottesverehrung dann, wenn sieAngst und Furcht in der Seele erzeugt.23 Als
christliche Gott ist so unbedeutend, dass er nicht einmalder Romana superstitio, dem religiöse Übereifer der Römer, zuOhren gekommen ist.
21 Vgl. Plinius, Briefe (epist.) 9.33.9: Als religio pravawird das falsch und schlecht eingesetzte Ritual einesLegaten bezeichnet, das das Gegenteil vom Bezwecktenbewirkt.
22 „Seelsorge“ meint hier die antike Sorge für einenheilsamen Umgang mit den Affekten und Leidenschaften,meint Seelsorge als Lebenskunst, wie sie vor allem von derStoa, aber in der Kaiserzeit auch von anderenphilosophischen Schulen entwickelt wurde; vgl. Hadot (Anm.12).
23 Diese Wertung ist kennzeichnend für den Epikureismus(vgl. Cicero, de nat. deor. 1,45.55f.117f.); vgl. auchPlutarchs Traktat über den Aberglauben, der ganz auf einerseelsorgerlichen, heilenden Linie liegt. Für ihn ist
politisch-gesellschaftliche Unterscheidung dientesie in Rom der Identitätssicherung als Volk undStaat und der Bestimmung von Anschlussfähigkeit:religio bedeutete für die römische Oberschicht – aussystemtheoretischer Sicht reformuliert - einsystemstabilisierender, systemerhaltender Kontaktmit numinosen Mächten. Religio – vor allem dieStaatsfeste, der öffentliche Kult und diePraktiken der Auguren (Vogelschauer) undHaruspizen (Eingeweideschauer) - , absorbierteroutiniert und bewährt Unsicherheit inmehrdeutigen Lagen (vor Kriegen, bei Katastrophenu.a.). Als superstitio hingegen beobachtete manreligiöse Praktiken, denen man unterstellte,Unruhe zu stiften und chaotisierend zu wirken. Dasklassische Beispiel war für die Römer der Kybele-Kult (Bacchanalienskandal). Die Res Publica sahsich durch sie in ihrem Bestehen bedroht. Jemassiver diese Bedrohung eingeschätzt wurde, destostärker mussten die rechtlichen Maßnahmen sein,die zu ergreifen waren. Das galt vor allem dann,wenn größere Gruppen sich zu bestimmten Kultentrafen und möglicherweise eine Verschwörung gegenden Staat hätten anzetteln können. Aus der Sichtvon religio erscheint superstitio in jedem Fall alsnichtadäquate Ersatzleistung, die denErrungenschaften von religio – nämlich die ResPublica zu erhalten – nicht genügt. superstitio dientnicht dem Ganzen, sie ist vielmehr partikular,egoistisch und asozial angelegt, sie baut nichtauf, sondern zerstört. Anerkannte und erprobtereligio hingegen fungiert am Gemeinwohl orientiertsystemerhaltend. superstitio ist das Christentum fürden gebildeten Römer also nicht nur aufgrundübertriebener Gottesfurcht, sondern auch aufgrund
Aberglaube (deisidaimonia) mehr als ein kognitiver Irrtum,er ist ein falscher Affekt (pathos), also eine mitpsychisch belastenden Emotionen verbundene Meinung. DieFolgen sind Verstörung, Verzagtheit und unruhiger Schlaf,die dann wiederum mit sinnlosen magischen Praktikenbekämpft werden. Wahre Gottesverehrung (eusebeia) hingegenist von Freude im Umgang mit den Göttern geprägt.
von Kulthandlungen, die die gesellschaftlicheOrdnung zu untergraben scheinen.24
Ich halte fest: Das Bezugsproblem, das MinuciusFelix - wie andere Apologeten auch - bearbeitet,ist die aus christlicher Sicht prekäre Exklusionchristlicher Kommunikation und Kultpraxis, u.a.mit der Zuschreibung als prava religio, als superstitio,die die römische Ordnung angeblich gefährdet undgleichzeitig angstgeprägte Züge haben soll.
III. Die besondere Lösung des Bezugsproblems durchMinucius Felix
Wie löst der Autor dieses Problem? Ich denke, dasser eine besondere Kommunikationsstrategie gewählthat, die sich von den Strategien andererApologeten unterscheidet. Zunächst einmal das rhetorische „Setting“: Formal
stellt er die Figuren des Prozess-Spiels in dieWelt der römischen Bildungsschicht hinein, die alsAnwälte Kontakt zur Oberschicht haben und derenSprache sprechen; er inkludiert christlicheKommunikation in die Oberschicht virtuell durchseinen Text hinein. Somit wird jede asymmetrischeKommunikation mit der Führungsschicht vermieden,wie sie für die apologetischen Mahn- undBittschriften (Athenagoras, Justin) odergerichtliche Verteidigungsschriften (TertulliansApologeticum) typisch waren. Die Frage nach demCharakter christlicher Lebensform wird von
24 Diese Verbindung ist charakteristisch für dieOberschicht der Kaiserzeit, vgl. Martin (Anm. 19), S. 135:„It is therefore clear that when Pliny the Younger,Tacitus, and Seutonius, as examined in Chapter 1 above,worried about the superstitio of Christianity they werereflecting not just the philosophical criticism ofsuperstition, which tended to see it as shameful andridiculous but not necessarily of great importancepolitically. Rather, these Roman writers also wereintroducing into the picture the particularly Roman fearof superstitio as politically subversive and sociallydangerous, as a threat to Rome itself.”
Personen ausgetragen, die als Anwälte selbst Teilder römischen Öffentlichkeit sind, also von ihrerberuflichen Rolle her formal und organisatorischin die Leitkultur inkludiert sind. Verstärkt wirddieser Eindruck durch die scheinbarselbstverständliche Bezugnahme auf anspruchsvollesemantische Traditionen (Cicero, Seneca, Vergil,Tacitus, Platon u.a.), die typischesBildungswissen der Oberschicht repräsentieren undvor allem auch philosophisch Anschlussfähigsind.25 Der Konflikt über die wahre Gottesverehrung wird
zudem von drei Freunden ausgetragen, die in dertextinternen Kommunikation auf soziale Symmetrie,also auf gleichrangigen Status achten.
„Wir setzten uns, wie er vorgeschlagen hatte, nieder,und zwar so, dass die beiden sich zu meinen Seitensetzten und mich in die Mitte nahmen. Natürlich nichtaus Ehrerbietung oder aus Rücksicht aus Rang oderWürden; die Freundschaft nimmt ja stets nur Gleiche aufoder aber stellt die Freunde einander gleich. Vielmehrsollte ich wie ein Schiedsrichter den beiden als NachbarGehör schenken können und in der Mitte die beidenKontrahenten trennen.“ (4,6)
„Caecilus“ ist ein Freund des „Minucius“, obwohlsie (noch) nicht den gleichen Glauben haben. DieFreundschaftssemantik, die besonders in deneinführenden Kapiteln und zum Schluss verwendet
25 Vgl. von Geisau (Anm. 4), Sp. 999: „Durch Cicero brachM.F. dem Christentum die Bahn zur gleichberechtigtenAuseinandersetzung mit der überlieferten Weltweisheit,indem er es vor dem Forum einer skeptischen Generation,die für blendende Wortkunst empfänglich war, wirksamverteidigte.“ Barbara Aland, „Christentum, Bildung undrömische Oberschicht. Zum Octavius des M.F.“, in: Platonismusund Christentum, Festschrift für Heinrich Dörrie (JACE X) Münster1983, S. 11-30 (dort S. 18, Anm. 45), weist darauf hin,dass die von Minucius zitierten Autoren Schulautorenwaren, deren Kenntnis bei der Oberschicht (zu der sie mitVittinghoff auch den ordo decurionum zählt) vorauszusetzenist.
wird, gibt den höflichen und gebildeten Grundtonan, der trotz heftiger, z.T. unter die Gürtellinietreffenden,26 Plädoyers bestimmend ist. In diesemKontext erweisen sich die Protagonisten, und damitder Autor selbst, als unterhaltender Meister derrömischen Sprache, Rhetorik und Tradition, diespätestens seit Cicero auch die Integrationgriechischer Philosophie umfasste. Nichts könnterömischer sein als die Form, die der ChristMinucius Felix seinem Text gibt. Die Form des Streitgesprächs mit einem Richter
als Beobachter gibt ihm weiter die Möglichkeit derBeobachtung zweiter Ordnung (d.h. beobachtenkönnen, wie andere beobachten): Der Autorkonstruiert eine Perspektive, aus der heraus erjeweils beobachten kann und dies auch darzustellenweiß, wie einerseits römische religio sich selbstbeschreibt und zu welcher Art vonFremdbeschreibung des Christentums sie fähig ist(nämlich als superstitio), und wie andererseitsChristen ihre Lebensform beschreiben, als verareligio, und welche Deutung der römischenGötterverehrung von Christen gegeben wird (nämlichals superstitio). Minucius Felix beobachteteinerseits, wie die dominante Kultur –repräsentiert durch „Caecilius“ – ihre eigeneReligiosität wie auch die Religiosität derChristen beobachtet. Er vermag damit zweierleiüber die Figur des „Caecilius“ zu leisten: einenegative Fremdbeschreibung der christlichenLebensweise wie auch eine positive Selbstbeschreibungeiner von Christen als Aberglaube abgelehntenLebensweise. Es ist schon bemerkenswert, wie im
26 Aggressive, den Gegner abwertende Diskussionsbeiträgesind nicht ungewöhnlich,; vgl. nur die Angriffe, die dieProtagonisten des Gesprächs im ciceronischen Dialog denatura deorum gegeneinander führen (zum Beispiel 1.42f.),und zwar im Rahmen eines privaten, freundschaftlichenAustauschs (1,61). Eine wichtige Rolle spielt hier wohlauch der Unterhaltungsaspekt für Zuhörer und Leser(Spannungsaspekt: wer gewinnt, wer führt die härterenSchläge?).
Gerichtsduell zwei Parteien ihre eigene Sichtpräsentieren können: Der Christ Minucius Felixlässt „Caecilius“ kein christliches Zerrbild derrömischen Religion präsentieren, sondern einestarke, zunächst überzeugende Version, dievermutlich nicht untypisch für die aufgeklärterömische Oberschicht Anfang des 3. Jahrhundertswar.27 Ein Christ lässt also eine nichtchristlichereligiöse Haltung sich selbst so beschreiben, wiesie sich selbst hätte beschreiben können!28
27 Aland (Anm. 25), S. 22: „Schon der äußere Aufbau desWerkes macht das Konzept des Verfassers im Unterschied zumgesamten apologetischen Schrifttum der Alten Kirchedeutlich: Als erster und einziger der Autoren lässtMinucius einen Heiden zu Wort kommen und ihn sein ‚genusvivendi’ (5,1) vertreten…Die Rede des Heiden muss inerster Linie lebenswahr sein ,d.h. die angesprocheneLeserschicht muss sich darin wiederfinden können, selbstwenn sie mit dem einen oder anderen Argument im einzelnennicht übereinstimmt. Gewiß sind nicht alle GebildetenSkeptiker gewesen, wie der hier auftretende Caecilius. Daaber seine Argumente durch die Übereinstimmung mit CicerosCotta aus nat. deor. gewissermaßen legitimiert waren,konnte ein Andersdenkender die Argumente aus seinerSchicht stammend akzeptieren.“ Barbara Aland versucht inihrem lesenswerten Artikel zu zeigen, wie stark der Textan die Denk- und Rezeptionsmuster der römischenBildungsschicht angepaßt ist.
28 Aland (Anm. 25), S. 21, spricht von der erstaunlichen„Elastizität des Autors, die ihn seine Werbeschrift undApologie ganz und gar vom Denk- und Empfindungsvermögenseiner Leser her aufbauen ließ, und zwar so konsequent,wie es schwerlich in irgendeiner andern frühchristlichenSchrift zu beobachten ist.“ Für Aland ist die anvisierteLesergruppe die römische Oberschicht. Ich würdepräzisieren: Die „impliziten“ Leser sind Angehörige derOberschicht ob sie Christen sind oder nicht! Der Witz beiM.F. ist ja gerade der, dass bei ihm Christen selbst ganzselbstverständlich, ohne es direkt zu thematisieren, zu
Allerdings zwingt er „Caecilius“, die römischereligio als einen Fall möglicher Religionsausübung zupräsentieren. Die römische Religion wird aus derPerspektive des gerichtlichen Plädoyers zu einerphilosophischen Lebensform, die man wählen oderablehnen kann! Sie wird zu einer Möglichkeit,neben die andere Möglichkeiten treten dürfen.29
Die Form der Beobachtung zweiter Ordnung führtsomit zu der Fähigkeit, einen „interreligiösen“Dialog zu kreieren.30 Der Vertreter dergesellschaftlich selbstverständlichen Formen vonreligio ist durch die Disputationsform schon in derDefensive, da die Disputation den bisher nichthinterfragten Status seiner religio außer Kraftsetzt. Er wird gewissermaßen dazu gezwungen, seineLebenspraxis als „Konfession“ zu verteidigen.Schon dadurch hat der christliche Glaube gewonnen,er wird diskussionswürdig, etabliert sich alsreligiöse Alternative im philosophischen Gewand,die nicht einfach totgeschwiegen werden kann.31
Inhaltlich nun tritt der christlicheDisputationsgegner als klarer Sieger hervor, undzwar, das ist die nächste Pointe,32 mitdieser Schicht dazugehören.
29 Interessant ist, wie „Caecilius“ zu Beginn seinesPlädoyers (5,1) die römische Lebensweise als eineMöglichkeit anführt. Etwa 150 Jahre später, Im 4. Jh. n.Chr. müssen „Heiden“ angesichts des christlich dominiertenReiches so argumentieren!
30 Vittorio Hösle, Der philosophische Dialog. Eine Poetik undHermeneutik, München 2006, S. 101, hat keine Scheu, denOctavius als „interreligiösen Dialog“ zu bezeichnen.
31 Vgl. Voss, (Anm. 6), S. 326: „Während Justin, in derWirklichkeit wie in seinem Dialog, in selbstverständlichemKontakt mit Nichtchristen steht und argumentiert,unternimmt Minucius es, die Christen als diskussionsfähigzu erweisen. Diese Aufgabe hat er erfüllt, durch dieAnlage des Werkes und mehr vielleicht noch durch seinenstilistischen Rang.“
32 Auf die Aland (Anm. 25) hinweist und das auchausführlich begründet (S. 23-30).
philosophischen und rechtlichen Argumenten, diedem Bildungspublikum bekannt sind und plausibel,Anschlussfähig erscheinen können (gewonnen vorallem aus Cicero, Seneca und Platon). ChristlicherGlaube ist damit vernünftiger und moralischer alsdie römische religio, die sich aufgrund der ausrömischer Bildungstradition gewonnenen Nachweiseals irrational, sogar als kriminell und somit alssuperstitio erweisen lässt. Der Christianus belehrt denFreund der alten Religion. In Bezug auf dasinhaltliche Ergebnis gewinnt der Dialog eineasymmetrische Form, da „Caecilius“ dieÜberlegenheit der Argumentation von „Octavius“anerkennt, ja sich dieser neuen Lebensform sogaranschließen möchte.33
Welches Publikum visiert Minucius Felix an? DieSchrift mit ihrer besonderen Erzählform hebtzunächst einmal das Statusbewusstsein vonChristen. Hier ist ihr Glaube Thema derjenigenSchicht, durch die sie in der Regel bisher dochbekämpft wurde. Für christliche Leser (von ihnenkennen wir zumindest Cyprian, Laktanz34 undHieronymus) ist sie somit eine Ermutigung zu einerchristlich geprägten selektiven Aneignung derrömischen Leitkultur bei Absage an dentraditionellen Götterglauben (und damit verbundenauch an die politische Statushierarchie desReiches). Gleichzeitig ermöglichte sie es Lesernaus der römischen Bildungs- und Führungsschicht,zum einen aufmerksam auf die philosophischeSubstanz des christlichen Glaubens zu werden undzum anderen auf unterhaltsame Weise politisch-rechtliche Ängste vor der Lebensform deschristlichen Glaubens zu verlieren. Wie vielegebildete Nichtchristen tatsächlich diese Schriftgelesen haben, wissen wir nicht. Einer von ihnen
33 Vgl. dazu Hösle (Anm. 30).34 „Von denen (der Gebildeten), die mir bekannt sind,
hatte Minucius Felix als Rechtsanwalt (causidicos) keinengeringen Rang (non ignobilis). Sein „Octavius“ betiteltesBuch zeigt, welch fähiger Verteidiger der Wahrheit erhätte sein können, wenn er sich ganz dieser Aufgabegewidmet hätte.“ (inst. 5,1,22 Übersetzung v. Kytzler)
zumindest war der Redner und Rechtsanwalt Cyprianvon Karthago, der wohl Ostern 246 Christ wurde undden Text kannte, möglicherweise schon bevor erChrist wurde. 35
Minucius Felix lässt freilich offen, welcheKonsequenzen seine apologetische Strategie für diepolitisch-gesellschaftliche Dimension deschristlichen Glaubens hat. Andere Apologeten habendem römischen Staat Angebote gemacht in dieRichtung, dass das Gemeinwesen mit Hilfe derchristlichen vera religio, d.h. mit der Macht deswahren christlichen Gottes, besser fährt (zumBeispiel Origenes in Wider Celsos 8,69-73).Konstantin der Große hat diesen Schritt danntatsächlich gewagt. Die konstantinische Wende warbezüglich der Unterscheidung religio/superstitio einekopernikanische Wende für das Reich. DasChristentum hatte damit eine unerwarteteAnerkennung gewonnen, aber die Distanz zurStatushierarchie Roms („eure Ehrenstellen, eurePurpurstreifen“) verloren, die für Minucius Felixnoch konstitutives Element christlicher Existenzwar, das er aber mit seiner Interventionparadoxerweise unterlief.
35 Vgl. Michael M. Sage, Cyprian (Patristic MonographSeries No. 1), Philadelphia: Patristic Foundation, 1975,S. 51: „The Octavius of Minucius Felix …forms theintellectual background for the milieu that led Cyprian toadopt Christianity as an alternative to what seemed adisintegrating and shattered pagan world view.”