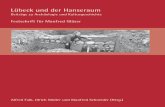S. Berke, Requies aeterna. Der Grabbau 12/1988 und die relative Chronologie innerhalb der römischen...
Transcript of S. Berke, Requies aeterna. Der Grabbau 12/1988 und die relative Chronologie innerhalb der römischen...
27
Mackensen M. Mackensen, Das romische Graberfeld auf der Keckwiese in Kempten. Carnbodunurnforschung 4 = Materialhefte zur Bayeri schen Vorgeschichte Reihe A 34 (1978). NeujahrsgruB. Jahresbericht Westfalisches Museum fur Archaolo gie. Amt fur Bodendenkmalpflege, Munster, und Altertumskom rnission fiir Westfalen.
NJG
Die ubergeordnete Grabungsleitung lag in allen Jahren bei J.S. Kuhlborn, dem ich an dieser Stelle ganz besonders fur die Publikationserlaubnis des Graberfeldes danken mochte. Die ort liche Grabungsleitung durfte der Verf. in den Jahren 19821984 und dann wieder 19871988 iibemehrnen. In den Jahren 19851986 lag sie bei R. ABkamp und im Jahre 1989 bei E. Noll. Die folgenden Jahre trugen die ortliche Verantwortung 19901992 J. Hamecker, 1992 B. Rudnick, 19951997 M. Muller, 1998 T. Mattern und 1999 Chr. Ellinghaus. Die Grabungen fanden von 1985 bis 1992 als ArbeitsbeschaffungsmaBnahmen des Arbeitsamtes Reckling hausen in Tragerschaft der Stadt Haltem statt. Die folgenden Abktirzungen werden verwendet: AFWL Ausgrabungen und Funde in Westfalen Lippe. ABkarnp Kuhlborn R. ABkamp J.S. Ktihlbom, Die Ausgrabungen im romischen
Graberfeld von Haltem, AWFL 4 (1986). BAW Bodenaltertiimer Westfalens. Haffner A. Haffner in: A. Haffner (Hrsg.), Graber Spiegel des Lebens,
Kat. Mainz 1989. Katalog 2000 Jahre Romer in Westfalen =Trier, B. Trier (Hrsg.), 2000 Jahre Romer in West
falen, Kat. Munster 1989.
Mit den letzten Untersuchungen im Bereich der romischen StraBentrasse fanden t 999 die systematischen grolsflachigen Ausgrabungen innerhalb des romischen Graberfeldes von Haltern ihren AbschluB, die 1982, ausgelost durch ein Bebau ungsvorhaben, begonnen hatten 1.
Bis dahin war das romische Graberfeld von Haltern am FuBe des Osthan ges des Annaberges lokalisiert worden. Denn schon 1925 hatte A. Stieren im Laufe einer kleineren Ausgrabung hier zwei augusteische Graber aufdecken kon nen. Auch ein Grabfund im Jahre 1958 auf dem Hof eines Bauern in unmittelba rer Nahe zur Grabungsflache von 1925 verstarkten diese Vermutung. Erst ein weiterer, zufalliger Fund eines romischen Grabes im Jahre 1982 weit im Osten
Einleitung
Requies aetema ! Der Grabbau 12/1988 und die relative Chronologie innerhalb der romischen Graberstrasse von Haltern
(Tafeln 6,1-7,2)
STEPHAN BERKE
28
2 Zur Forschungsgeschichte siehe den Vorbericht van R. ABkamp J.S. Kuhlborn, Die Aus grabungen im romischen Graberfeld van Haltero, AFWL 4 (1986) 129ff. und S. Berke in: B. Trier (Hrsg.), Die romische Okkupation nordlich der Alpen zur Zeit des Augustus, Kollo quium Bergkamen 1989, BAW 26 (1991), 149ff. An Literatur zu dem Thema sind bisher erschienen: Kurze Notizen zu den Ausgrabungen finden sich in den NeujahrsgriiBen des Westfalischen Museums fur Archaologie 19831998. Langere Beitrage finden sich in AFWL 2 (1984) 339ff.; 3 (1985) 389; 4 (1986) 464ff.; 5 (1987) 780; 6A (1990) 290; 7 (1992) 238f.; S. Berke in: Altertumskornmission fur Westfalen. Niederschrift der Hauptversammlung vom 7/8 Oktober 1988 u. 11 Januar 1989, Munster (1989) 45ff.; ders. in: Katalog 2000 Jahre Romer in Westfalen 176ff. rnit Abb. 221, 228235; R. ABkamp in: H. G. Hellenkemper u. a. (Hrsg.), Archaologie in NordrheinWestfalen (1990) 187ff.; S. Berke, Mitteilungen der archaologischen Gesellschaft Steiermark 3/4 (1989/1990) 33ff. In den Jahren 1997, 1998 und 1999 konnten ostlich dieser Grabungsflache weitere Ausgra bungen durchgeftihrt werden. Hierbei koonte zwar der nordliche StraBengraben aufgedeckt werden, jedoch fanden sich keine Graber mehr.
4 DaB der modeme Weg eine altere Tradition besitzt, beweisen zwei auf seiner Nordseite gefun dene rnittelalterliche Votivfiguren aus Pfeifenton. Eine wurde 1986 auf dem Grundstiick Bilk ker bei Gartenarbeiten gefunden. Die zweite, ein Torso, in der Grabungsflache 1/1988. Bei dem OstWest verlaufenden Grabchen rnit rechteckigem Profil, welches J.S. Kuhlborn 1979 im nordlichen Teil seiner Grabungsflache am Wiegel aufdecken konnte, handelt es sich um ein Stuck des sudlichen StraBengriibchens (NJG 1979, 33). Die westliche Fortsetzung des Grabens konnte 1990 in einer kleineren Grabungsflache am Wiegel auf gedeckt werden (Taj 6,1). Freundl. Mitt. J. Harnecker. Siebe dazu auch NJG 1997, 74.
von Berghaltern, in Richtung auf das Hauptlager, lieB die gesamte Ausdehnung des Friedhofes erkennen2.
Die romischen Graber liegen in einer nach Osten leicht ansteigenden Gelandesenke zwischen dem Silverberg im Osten und dem Annaberg im Westen, auf einem zur Lippe im Siiden hin abfallenden Sandriicken (Taj. 6,1). Die Aus dehnung der Nekropole betragt mindestens 450m, gemessen von der Grabungs flache II/1988 bis zur Fundstelle des Grabes von 1958 auf dem Hof des Bauem BuBmann. Die Ausdehnung wird aber grofler sein, da sich die Graberstralse noch weiter nach Westen, bis in die Ausgrabungsflache Stierens von 1925 hinein erstreckte. Dagegen scheint das ostliche Ende des Graberstreifens erreicht wor den zu sein3. Denn in der Grabungsflache des Jahres 1990, die, getrennt <lurch einen Weg, ostlich der Flache II/1988 lag, konnten keine Bestattungen freigelegt werden.
Die bisher aufgedeckten Graber konzentrieren sich in einem 40m bis 60m breiten, von Nordost nach Siidwest ausgerichteten Streifen entlang einer romi schen StraBe (Taj. 7, 1). In weiten Bereichen liegt auf der ehemals romischen Trasse heute noch der Weg 'Im hohen Winkel', der sich erst weiter im Osten, hier als Feldweg, von der romischen StraBe trennt4.
Projeziert man die Ausrichtung der romischen StraBe auf den Gesamtplan der romischen Anlagen Haltems, wird deutlich, daB die StraBe im Osten zwi schen dem Hauptlager und den Anlagen auf dem Wiegel verlaufr'. Im Westen
Stephan Berke
6 Ware dies der Fall, lage der Grabfund van 1958 auf der sudlichen Seite der StraBe. 7 Zuro Vergleich: die Trasse der viapraetoria im Hauptlager betragt mnd 47,0m (S. v. Schnur
bein, Die romischen Militaranlagen bei Haltem, BAW 14 (1974] 54). 8 Grab 1/8; Grab 2/84; Grab 5/86; Grab 6/87; Grab 4/87; Grab 9/88; Grab 16/88; Grab 6/89
und Grab 3/92. Die beiden Kreisgraben 'Kreisgraben 3/84' und 'Graben B/84' wurden bei der Zahlung nicht berucksichtigt, da der Befund in beiden Fallen noch ausgesprochen unklar ist. Enthalten in dieser Zahlung ist das Grab von 1958.
9 Lediglich in der Anlage Fl. II Grab 2/88 handelte es sich wirklich um eine Doppelbestattung. Bei den beiden Leichenbranden aus Grab 14/85 ergab die Untersuchung, daB es sich um ein und diesselbe Person zu handeln scheint.
10 Zur Tenninologie T. Bechert, AKorrBl 10, 1980, 253ff. 11 Grab 14/85 u. Grab 2/88. 12 R. ABkamp J.S. Kuhlborn in: AFWL 4 (1986) 133. 13 T. Bechert, BJb 179, 1979, 490f. mit Anm. 35.
Nordlich dieser StraBe lieBen sich bisher 68 romische Graber, bzw. Grabanlagen aufdecken. Dabei konnte in acht Fallen nur noch der Grabbau ohne die zugeho rige Bestattung festgestellt werden8. Aus den beiden Anlagen Grab 14/85 und Fl. II Grab 2/88 gelang es dagegen, jeweils zwei Umen zu bergen9.
Bei der Mehrzahl der Bestattungen handelt es sich um Brandschiittungs graber'". Generell standen die tJmen zwischen den Scheiterhaufenruckstanden in der Grabgrube, doch zweimal lieB sich eine Abweichung beobachten. In beiden Fallen 11 war der Brandschutt in einer Grube neben den Leichenbrandbehaltern deponiert worden. Daneben kommen Urnengraber und Brandgrubengraber vor.
Busta haben sich bis heute nicht feststellen lassen12. Es bestatigt sich also die Vermutung, daB Bustabestattungen erst in nachaugusteischer Zeit aufkom men und vielleicht auf einen gallischbelgischen Brauch zuriickgehen 13. Es han delt sich also in alien Fallen um U strinabestattungen. Die Kremationsorte waren innerhalb der Grabungsflachen aulserst schwierig nachzuweisen, da sie nicht als abgegrenzte, deutliche Befunde hervortraten. Vielleicht wird man den Befund Fst. 76/87 als Rest einer ustrina interpretieren durfen. Dabei handelte es sich um eine groBe, zusammenhangende, im Schnitt dann ausgesprochen flache Verfar bung, die im groBen und ganzen aus Holzkohle bestand. Teilweise batten sich ganze Stucke von Asten erhalten. Zwischen den verkohlten Holzruckstanden
Die Graber
wird die weitere Trassenfiihrung auf der Nordseite des Annaberges verlaufen (Taf 6,1)6. Die StraBe wird im Norden und Suden von zwei Strallengraben begrenzt. Die Breite der Trasse liegt bei etwa 37,0m7. Im Bereich der StraBen trasse fanden sich in groBer Anzahl Karrenspuren, die etwa paralell zu den bei den Strafengraben verliefen. Hinweise auf einen sicheren romischen Ursprung gab es jedoch keine.
Requies aeterna!
30
14 M. Muller in: AFWL 9A (1997) 16 mit Abb. 8, 24. 15 Eine iihnliche Beobachtung lieB sich in unmittelbarer Nahe zu Grab 12/88 machen. Auch hier
zeigte sich eine flache, jedoch stark mit Holzkohle, Kerarnik und Leichenbrand (!) durch setzte Verfarbung.
16 H. Menzel in: FS RGZ Mainz zur Feier seines hundertjiihrigen Bestehens 1952 Bd. 3. (1953) 132; Mackensen 18.
17 Bisher wurden noch nicht alle Leichenbrande analysiert. Untersucht wurden bisher die Lei chenbrande aus den Grabungsjahren 19821984 durch Prof. Hermann, Gottingen, und die der Jahre 19851989 durch Dipl. Biol. S. Hummel, ebenfalls Gottingen.
18 Innerhalb der Anlage Grab II/2/88 fanden sich zwei Urnen. Die Leichenbrandanalyse ergab, daB es sich in der Tat um zwei verschiedene Individuen handelte. Bei dem einen Individuum handelte es sich um ein Kind, das sich der Alterstufe infans I zuordnen ]ieB, der zweite Lei chenbrand lieB sich nicht genauer bestimmen.
Zu den bemerkenswertesten Anlagen innnerhalb der Nekropole zahlen die Befunde offener oder geschlossener Kreisgraben, in deren Inneren sich, nicht imrner zentral, eine Grabgrube befand18. Der Durchmesser dieser Anlagen vari iert zwischen 4,00 und 14,00rn, die Breite der Graben schwankt zwischen 0,40 und 2,00rn. Abhangig von der Planumshohe liegt die Tiefe bei etwa 0,20 bis 0,60rn. Die Fullung dieser Graben besteht zurneist aus rotbraunen Sanden, die vor allern in der Grabenmitte teilweise hohe lehmige Anteile aufweisen. Auffal lig ist, daB Kreisgraben mit grolserem Durchrnesser, ab etwa 8,00rn, eine Unter brechung besitzen. Diese kann sowohl nach Norden als auch nach Suden ausgerichtet sein. Anlagen mit einem Durchrnesser von 10,0rn und rnehr weisen in der Regel zusatzlich einen innen liegenden Pfostenkranz auf. Dieser besteht aus acht radial angeordneten Pfostengruben, in denen sich nicht irnrner die Spu ren der eigentlichen Pfosten nachweisen lieBen. Wo der Nachweis moglich war, zeigten sich tief fundarnentierte, 0,80 bis 1,00rn unter das Planum reichende Pfo sten mit einer Starke von bis zu 0,40rn. Ganz besonders am Befund der Anlage Grab 5/87 wurde deutlich, daB alle Pfosten eine deutliche Neigung nach auBen, zum Graben hin, aufwiesen. Da sich kein Hinweis darauf finden liefs, daB dies
Zur Graban/age 1211988
fand sich ein alt geflickter Kasserollengriff+" aus Bronze. Inmitten dieser Fund stelle war das Grab 3/87 eingetieft15. Bernerkenswerterweise liegt der Befund in unmittelbarer Nahe der beiden groBen Anlagen 2/87 und 5/87.
DaB die ustrinae rnehrrnals genutzt wurden16, geht aus den Leichenbrand analyseu'" hervor. So fanden sich unter dern Leichenbrand der Graber 5/87 und 1/88 geringe Beirnengungen eines anderen Individuums. Dies deutet darauf hin, daf die Verbrennung zumindest dieser beiden Toten an Stellen erfolgt ist, an denen schon zuvor eine Krernation stattgefunden hatte.
.:Jlt:pll<LLI Dt:n\..t:
31
19 Bei dieser Anlage handelt es sich um die Einhegung des Grabfundes von 1982 (NJG 1983, 24, Bild 13; Katalog 2000 Jahre Romer in Westfalen, Abb. 228).
20 Diese Paare sind im Plan offen dargestellt. 21 Fst. I/88/69, Fst. I/88/70, Fst. I/88/72, Fst. I/88/73, Fst. 1/88/74, Fst. I/881128, Fst. 1/88/133,
Fst. 1/88/139, Fst. I/88/140, Fst. I/88/141, Fst. I/88/144, Fst. 1/88/145. 22 E. Neeb, MainzZ 8/9, 1913/14, 38. 23 W. Ebel, Die romischen Grabhugel des ersten Jahrhunderts im Treverergebiet. Marburger
Studien zur Vor und Frtihgeschichte 12 (1989) lOlff.; Haffner 83ff. mit weiterer Literatur; Mackensen 127ff.; W. v. Pfeffer, MainzZ 82, 1987, 241ff.; E. Wightman, BJb 170, 1970, 219; R. Nierhaus, Helinium 9, 1969, 261; A. v. Doorselaar, Les necropoles d'epoque romaine en gaule septentrionale. Dissertationes Archaelogicae Gandenses 10 (1967) 210ff.; H. Scher mer in: FS RGZ Mainz zur Feier seines hundertjahrigen Bestehens 1952 Bd. 3. (1953) 139ff.; A. Wigg, Die Grabhiigel des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. am Mittelrhein, Mosel und Saar, TrZ Beih. 16 (1993); dies., Germania 71, 2, 1993, 532ff.
24 S. Berke in: B. Trier (Hrsg.), Die romische Okkupation nordlich der Alpen zur Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989, BAW 26 (1991)152f.
schon beim Einsetzen der Pfosten beabsichtigt war, wird anzunehmen sein, daB diese Neigung <lurch einen entsprechenden Druck auf die aufgehenden Pfosten entstanden ist.
Von dieser Gruppe heben sich zwei Befunde besonders ab; die Grabanlage Fl. II Grab 1/88 wies einen im Suden offenen, kreisformigen Graben mit 14,0m Durchmesser auf, der keinen Pfostenkranz einschloB, sondern ein nach Suden geoffnetes Rechteck mitjeweils 8,50m Seitenlange19.
Die Einhegung des Grabes 12/88 bestand dagegen nicht aus einem Grab chen, sondem aus 12 radial angeordneten Paaren von Pfostengruben (Taf 7,2). Leider war das Planum im Nordwesten des Befundes durch eine Sickergrube so stark gestort, daB die drei, sich hier eventuell befindenden Pfostenpaare nicht erkannt werden konnten20. Nicht in allen Fallen lief sich aus dem Befund heraus sicher entscheiden, ob es sich wirklich um eine Pfostengrube handelte. Doch von 28 auf gedeckten Gruben lieBen sich immerhin 12 sic her als Pfostengruben ansprechen21. Zu diesen Pfostenpaaren treten noch drei Pfosten, deren zugehori ger Partner nicht erkannt werden konnte, die aber von ihrer Lage her zu dem Pfo stenkranz gehoren mussen. Obwohl im N ordwesten drei oder vier Paare fehlen, wird man mit einem Durchmesser des Pfostenkranzes von etwa 14 m zu rechnen haben.
Einhegungen um Graber, seien es nun offene oder geschlossene Graben, Pfostensetzungen oder Mauern sind von vielen Friedhofen des provinzialromi schen Bereiches lange22 bekannt und wurden auch schon ausfuhrlich bespro chen23. An anderer Stelle24 wurde schon ausgefiihrt, daB die Kreisgraben im Halterner Graberfeld wohl zur Aufnahme einer holzernen Palisadenwand oder einer Schwellbalkenkonstruktion dienten, die einen holzernen Zylinder bildeten und
Requies aetema!
32
25 Siebe zu dieser Idee auch E. Neeb, MainzZ 8/9, 1913/14, 38. Dieser bezog sich jedoch nur auf rechteckige Einfassungen. Eine Bestatigung dieser These konnte man auch im Fund eines eisernen Nagelziehers und eines MeiBels aus dem Graben der Anlage Grab 4/84 sehen. Zu diesen Funden auch ABkamp Ki.ihlbom 134. Die beiden Werkzeuge stammen eindeutig aus dem Graben und nicht aus einem der Pfostenlocher,
26 Bei dem Befund Grab 27/85 lag die Tiefe des Grabens bei mindestens 0,60m. Hier ware dann eine obertagige Hohe von etwa l,20m bis l,80m moglich. Es ist eher zu geringeren Hoben zu tendieren, da die Wand im Verhaltnis zu ihrer Gesarnthohe sicherlich tief fuodamentiert war, um dem Erddruck zu widerstehen. Aus diesem Gruode ist die Hohe des Tambours in der Rekonstruktionszeichnung sicher zu hoch angenommen (R. ABkamp in: H. G. Hellenkemper u. a. (Hrsg.), Archaologie in NordrheinWestfalen [1990] 187).
27 Wie Beispiele steinerner Grabhiigeleinfassungen zeigen, war es selbst bei diesen massiveren Konstruktionen notwendig, innen Versteifungsfacher anzulegen. So z. B. M. Eisner, Zur Typologie der Grabbauten im Suburbium Roms, 26. Ergh. RM (1986) 165.
28 DaB es sich in der Tat wohl um Grabhiigel gehandelt hat, bestatigt auch eine Quelle des 19. Jhs. Siebe Berke in: B. Trier (Hrsg.), Die romische Okkupation nordlich der Alpen zur Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989, BAW 26 (1991) 149.
29 z. B. B. Gotze, Ein romisches Rundgrab in Falerii. Baugeschichte des romischen Adels und Kaisergrabes. Grabbau und Grabplanung des Augustus (1939) 6ff.; R. Fellmann, Das Grab des Munatius Plancus bei Gaeta. Sehr. Inst. f. Ur u. Fri.ihgesch. d. Schweiz 11 (1957) 80ff.;
,, E. L. Caronna S. Panciera, NSc 100, 1975, 199ff. Grabhi.igel mit steinerner Einfassung von ca. 30,20m Durchrnesser. Eisner a. 0. Kat. Nr. A26a und A27a, Grabbauten der Horatier.
Wir haben es bier also mit Tumuli zu tun, die in der Tradition der spatrepublika nischen und augusteischen Grabhiigel ltaliens stehen29. Auch bei dem Befund des Grabes 12/88 handelte es sich hochstwahrscheinlich um einen Tumulus, jedoch mit einem einfacheren Konstruktionsprinzip. Anscheinend bildeten bier die radial angeordneten Pfostenpaare die Grundkonstruktion fiir die Wand des Erdzylinders. Bei dem groBen Durchmesser des Tumulus und der schwachen
den HtigelfuB vor der Erosion schiitzte25. Da sich bei Grab 5/87 in etwa die ursprtingliche Gesamttiefe des Grabens erschlieBen HiBt, die bei ca. 0,30m bis 0,40m gelegen hat, ist eine obertagige Wandhohe von ca. 1,00 denkbar26.
Im Falle der Graber mit einem innenliegenden Pfostenkranz, miiBte man auf einen zweischaligen Aufbau des Grabhiigels schlieBen. Dafiir spricht z. B. auch die beobachtete Neigung der Pfosten bei Grab 5/87 nach auBen, die anschei nend durch den Erddruck entstanden ist27. Die Pfostenreihe bildete also einen geschlossenen Innenzylinder, der den grolsten Erddruck aufzunehmen hatte. Nimmt man bei einem Abstand der Pfosten von 1,50 m von der Grabenmitte und einer Fundamentierungstiefe der Pfosten von 1,20m eine obertagige Hohe der Pfosten von etwa 1,50m an, wtirde sich fiir die Neigung der Hiigelaufschtittung ein MaB zwischen 30° bis 35° ergeben. Da ein spitzer Abschluf des Hiigels nicht anzunehmen ist, sondem eher ein im oberen Drittel abflachender Verlauf, durfte eine Gesamthohe der Aufschtittung zwischen 2,70 und 3,00m denkbar sein28.
33
30 Bei den Nageln handelte es sich in etwa zu gleichen Teilen um Bau und Schuhnagel. 31 Leichenbrandanalyse durch S. Hummel. Es wurden bislang die Leichenbrande von 43 Indivi
duen untersucht. Da die Kremation sehr intensiv war, lieB sich nur in 14 Fallen eine Geschlechtsbestimmung durchfuhren. Dabei erwiesen sich 9 Personen als weiblich, 5 als mannlich.
32 Es handelte sich um Scherben des Typus Dressel 6 mit sekundaren Brandspuren.
Wandkonstruktion wird man sicher nicht mit einer allzu groBen Hohe des Grab hligels zu rechnen haben.
Erweist sich dieser Befund also schon <lurch die Konstruktion seiner Ein hegung als Ausnahme innerhalb des Graberfeldes, so gilt dies auch fiir die Anlage seiner Bestattung. Dezentral, im Siiden der kreisformigen Anlage befand sich die annahernd runde, im Planum 1,26xl,22m groBe und im Schnitt noch 0,54m tiefe Grabgrube. Die Grube wies ein breitovales Profil auf; in ihrer Mitte stand ein GefaB vom Typ Ha 57c, das als Ume Verwendung gefunden hat (Taf 6,2). Es wurde <lurch ein umgedrehtes GefaB vom Typ Ha 56 abgedeckt, welches einen 4,2cm grolseren Miindungsdurchmesser aufwies und damit die Ume dicht abschloB. Uber diesem 51,Scm hohen Ensemble befand sich eine Schiittung, bestehend aus Holzkohle, Nagelrr", Keramik und ein wenig Leichenbrand. Die Fiillung der Ume bestand im oberen Bereich aus hart verkrustetem Sand, ver mischt mit wenigen Leichenbrandstiicken. Erst etwa 29,0cm unterhalb des Ran des fand sich eine Lage kompakten Leichenbrandes, die jedoch nur etwa 5,0cm stark war. Die Leichenbrandanalyse ergab, daB es sich bei der bier bestatteten Person um eine adulte Frau handelte31.
Zwar lieB sich auch in anderen wenigen Fallen in Haltem beobachten, daB die Mundungen der Umen verschlossen bzw. abgedeckt waren. So war z. B. die Offnung der Ume des Grabes 3/83, ein Topf Ha. 57, <lurch einen auf dem Kopf stehenden Becher der Form Ha 40b verschlossen worden und bei Grab 1/88 war die Ume, bestehend aus einem Gefaf der Form Ha 91, mit einer Lage Amphoren scherben32 abgedeckt. In allen Fallen handelte es sich jedoch um kleine Umen.
Eine weitere Besonderheit rundet den auffalligen Befund dieses Grabes ab. Sudwestlich der Grabanlage 12/88 liegt das Grabes 16/88 (Taf 7,2). Der Befund bestand aus einem aufseren, annahernd quadratischem Fundamentgraben mit einer Kantenlange von 7,21x7,29x7,42x7,32m und einer Breite zwischen 0,31 und 0,62m. Die durchschnittliche Tiefe unterhalb des Planums betrug 0,22m. Im Suden, zur StraBe bin ausgerichtet, wies dieser Graben eine Offnung von l,40m auf. Innerhalb dieses annahernden Quadrates befand sich ein zweiter, ebenfalls quadratischer Fundamentgraben mit den MaBen von 4,68x4,48x 4,62x4,86m und einer Breite zwischen 0,20 und 0,50m. Die Tiefe der Graben sohle lag durchschnittlich bei etwa 0,24 m. Korrespondierend zur Offnung des aulieren Grabens befand sich eine fast rechteckige Verbreiterung von 0,70m, die eindeutig auf die Offnung Bezug nahm. Sowohl in der inneren Nordwest als
Requies aeterna!
34
33 Bei dem Befund Grab 20/88 handelte es sich um eine ovale Grube mit einem wannenformi gem Profit und einer Tiefe von 0,52m unter Planum. Aus der Grube konnte keine geschlos sene Bestattung mehr geborgen werden. Die geborgenen Funde (Leichenbrand, Scherben eines Gefalles Ha 91B, Schuhnagel und Wandscherben feintoniger Keramik) lassen jedoch eine Interpretation als Grab sicher erscheinen.
34 RE II A.2 (1923), 1625ff. s. v. Sepulcri violatio (Pfaff). Siehe dazu Ii. BiirginKreis in: Pro vincialia. FS R. LaurBelart (1968) 25 ff.
35 Siebe dazu Cic. leg. 2, 26, 64 oder auch Dig. 47, 12, 4; 48, 24, 3, 8. 36 Dies legt zumindest ein Edikt des Augustus oder Tiberius nahe, welches eventuell aus Naza
reth stammt (SEG Vlll 13). Vgl. dazu den Kommentar von F. Cumont, Revue historique 163, 1930, 241 ff. (bes. 251 f.) und F. de Visscher, Le droit des tom beaux romains ( 1963) 168 f. L. Wenger, Zeitschrift der Savigny Stiftung fiir Rechtsgeschichte 51, 1931, 395. Siehe auch Plin, ep. 10, 68f.
Nach der ersten Beisetzung galten sepulcra als res religiosae34 und waren aus drucklich gesetzlich geschutzt. Im romischen Recht gab es <las Vergehen des sepulcri violatio, welches sich sowohl auf die Verletzung von Grabern und Monumenten, als auch auf die von Leichen vor und nach der Bestattung bezog35. Anscheinend gab es schon in augusteischer oder tiberischer Zeit eine Strafge setzgebung zum Schutze von Grabern36. Das Delikt galt als Sakrileg und konnte
auch Nordostecke lieBen sich zwei massive Pfostengruben (Fst. 85/88 Dm. 0,40m, Fst. 91 Dm. 0,30m) aufdecken. Dieser Befund geht sicher ebenfalls auf einen ursprunglich massiven Grabbau aus Holz und Erde zuruck, obwohl sich innerhalb der Anlage kein Grab mehr feststellen lieB.
In die Nordostecke des aufleren Fundamentgrabens eingetieft, fand sich das Pfostenpaar Fst. 73/88 und Fst. 139/8 der Anlage 12/88. Wahrend die innere Pfostengrube, Fst. 73/88, sich am Rande des Grabens befand und diesen nur gering stone, war die Pfostengrube Fst. 139/88 direkt in der Mitte des Funda mentgrabens angelegt warden. Wie sich im Schnitt zeigte, war sie zudem 0,29m tiefer fundamentiert als die Sohle des Grabens. Auch die Pfostengrube Fst. 133/ 88 des Paares Fst. 74/133/88 storte den Grabenbefund. Aus diesem Befund her aus ist zu konstatieren, daB das Grab 12/88 eindeutig junger als das Grab 16/88 ist.
Ein derartig klarer Befund lieB sich im Bereich des Grabes 20/8833 nicht gewinnen (Taf 7,2). Doch uberlagert der Radius der Grabanlage 12/88 den Bereich der Bestattung. Das gleiche Phanomen gilt fur den kreisformigen Funda mentgraben des Grabes 2/88. Auch dieser wird im sudlichen Teil vom vermutli chen Tumulus uberlagert, Leider lieB es die dunkle Einfullung des Grabens nicht zu, festzustellen ob die hier zu postulierenden Pfostengruben zum Befund Grab 12/88 in den Graben eingetieft oder von diesem uberlagert wurden.
Stephan Berke
35
37 L. Schumacher, Der Grabstein des Ti. Claudius Zosimus aus Mainz. Bemerkungen zu den kaiserlichen praegustarores und zum romischen Sepulkralrecht, Epigraphische Studien 11, (1976) 141 mit Anm. 61. Nach Schumacher tiberlagem sich bei diesem Verbrechen staats und sakralrechtliche Prinzipien, wobei die Letzteren die Bedeutenderen waren (ebd.).
38 BtirginKreis a. 0. 31. 39 Auch die Verwiinschungen, die sich gegen potentielle Grabschander richten sind ein Beleg
dafiir. Siebe BtirginKreis a. 0. 26, Arnn. 4 mit weiterfiihrender Literatur. 40 Ein schones Beispiel aus Ostia in: M. F. Squarciapino, Le tombe di eta republicana e augu
stea, Scavi di Ostia 3(1958) 23 mit Taf. 4, 1. Siebe dazu auch M. Grunewald, Der romische Nordfriedhof in Worms (1990) 14f.; M. Witteyer P. Fasold, Des Lichtes beraubt. Toteneh rung in der romischen Graberstralse von MainzWeisenau ( 1995) 69 ff.
41 So lief sich in Worms feststellen, daB aufgrund der Beigabenensembles zeitgleiche Graber sich nicht schneiden. Grunewald a. 0. 14. In MainzWeisenau kam es erst im Laufe des 2. Jhs. zu Zerstorungen von Grabern des l. Jhs. (Witteyer Fasold a. 0. 69f.). Auch bei den Beispielen, die Toynbee anfiihrt, zeigt sich immer eine groBere zeitliche Lucke zwischen der Anlage eines Grabes und seiner Zerstorung (J. M. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman world [1971] 76).
42 BurginKreis a. 0 25f. vermutete, daB <lurch die Pontifices, denen die Aufsicht iiber die Gra ber oblag, Graberverzeichnisse gefiihrt wurden.
nur <lurch ein Siihneopfer getilgt werden37. Denn das Grab ist die ewige Woh nung des Toten und die Totenruhe, requies aeterna, darf auf gar keinen Fall gestort werden38. Die Existenz der religiosen Vorschriften und staatlichen Regu lierungen beweist zum einen, daB derartige Vergehen vorkamen, zum zweiten aber auch, wie wichtig es dem Einzelnen bzw. den Angehorigen war, sein Grab, beziehungsweise Grabmal respektiert zu wissen39.
Uberbauungen von alteren Grabern lassen sich jedoch immer wieder beobachten'l'', <loch lag zwischen der Anlage des jeweiligen Grabes und seiner Zerstorung oft ein groBer Zeitraum41. In diesen Fallen ist davon auszugehen, daB gestorte Grabanlagen oberirdisch nicht mehr sichtbar waren und es nur dadurch zu ihrer Zerstorung kam42. Analog dazu wird man davon ausgehen miissen, daB auch die Haltemer Grabanlagen 16/88 und 20/88 und vielleicht auch der Befund des Grabes 2/88 bei der Errichtung des Grabes 12/88 oberirdisch nicht mehr kenntlich waren.
Sicher wird man die Graberstrasse in einem engen zeitlichen Kontext zu dem Hauptlager auf dem Silverberg sehen miissen, fur das bislang ein maximaler Belegungszeitraum von 15 bis 16 Jahren, von 7/5 v. Chr. bis 9 n. Chr., angenom men wird43. Bei diesem relativ kurzen Zeitraum scheidet eigentlich ein natiirli cher Verfall der recht massiv ausgefiihrten Grabbauten aus44. Man wird andere Griinde dafur suchen miissen und in der Tat scheint ein Befund aus unmittelbarer Nahe einen Hinweis zu geben.
Der Grabbau 13/88 bestand, wie die Grabanlage 16/88, aus zwei ineinan der geschachtelten Fundamentgraben (Taj. 7,2). Der aufsere Graben mit einer Breite von etwa 0,80m bildete einen fast quadratischen Rahmen von
Requies aeterna!
36
43 S. v. Schnurbein, Ber. RGK 62, 1981, 39ff. An anderer Stelle dehnt er diesen Zeitraum bis in die Zeit um Chr. Geb. aus. S. v. Schnurbein, Die unverzierte Terra Sigillata von Haltern, BAW 19/1(1982)137. Ftir einen Beginn um Christi Geburt siehe H. Schonberger, Ber. RGK 66, 1985, 332 u. J.S. Kiihlbom, Das Romerlager Oberaden III, BAW 27 (1992) 65 rnit Anm. 233 und 132 rnit Anm. 513 mit der gesamten alteren Lit. Zu erganzen sind J.S. Kiihlborn, in: J.S. Kuhlborn (Hrsg.), Gerrnaniam pacavi. Germanien babe ich befriedet. (1995) 98f.; B. Rudnick, Westfalische Forschungen 48, 1998, 557ff.; ders., Die romischen Topfereien von Haltem, BAW 36 (im Druck) 181ff. Zusatzlich heranzuziehen ist E. Ettlinger, Die italische Sigillata von Novaesium. Novaesium IX, Limesforschungen 21 (1982) 102. Welcher Zeit stellung das neu entdeckte 'Ostlager' zuzuordnen ist bleibt bislang noch unklar. Zurnindest scheidet jedoch die fruhe Okkupationsphase aus (NJG 2000, 88 ff).
44 S. v. Schnurbein, Ber. RGK 62, 1981, 43 weist darauf bin, daB ein »solide gebautes Holzwerk beginnt nach alter Erfahrung friihestens nach dieser Zeitspanne baufallig zu werden«.
45 NJG 1996, 65f. 46 ebd. 47 NJG 1989, 42. Es handelte sich dabei um sogenannte 'Aduatuker', die innerhalb des Hauptla
gers einen Antell von ca. 36% am Mtinzfundaufkommen haben (P. Illisch in: J.S. Kiihlborn, Das Romerlager Oberaden III, BAW 27 [1992] 175f.). Zur Problematik der Bennung siehe ebd. rnit Anm. 50.
48 Tac. ann. 2, 7. Das Phanomen der Toten oder Grabschandung laBt sich bis zum heutigen Tage bei ethnischen Konflikten beobachten. Im romischen Recht gab es den Begriff des sel- pucra hostium, das ausdriicklich nicht res religiosae war (Dig. 47, 12, 4).
10,70x 11,80m. Im Stiden wies er eine Unterbrechung von 2,70m auf. Der innere, geschlossene Fundamentgraben hatte ein MaB von 6,80x7,50m. Dezen tral innerhalb dieses Rahmens fand sich noch die Bestattung45.
Zwar wurde die Vermutung geauBert46, daB es sich bei dem auBeren Gra ben auf grund seiner unregelmalsigen Sohle um einen Pflanz grab en gehandelt haben konnte, doch ist dies eher unwahrscheinlich; denn bei der Ausgrabung des stidlichen Bereiches des auferen Grabens im Jahre 1988 fand sich in der Mitte des westlichen Schenkels eine stark lehmhaltige Spur mit groBen Mengen an Holzkohleeinschltissen. Innerhalb des ostlichen Schenkels konnten, auf einer Strecke von 1,24m, WestOst angeordnet, die unteren Reste von vier massiven, nebeneinander gestellten und verbrannten Holzbohlen auf gedeckt werden. Bei diesen handelte es sich um die Reste der aulseren Grabeinhegung. Direkt neben der ostlichsten Bohle fand sich, deutlich in den Graben eingetieft, eine Grube, die einen Mtinzschatz von 202 keltischen Kleinbronzen enthielt47.
Dieser Befund scheint auf eine gewaltsame Zerstorung der Grabanlage hinzudeuten, die eigentlich nur von den Germanen verursacht worden sein kann. DaB von deren Seite bewuBt romische Graber zerstort worden sind, zeigt das Beispiel der Zerstorung des von Germanicus angelegten Grabhugels fur die Gefallenen der Varusschlacht im Jahre 15 oder 16 n. Chr48.
37
49 Siehe hierzu B. Rudnick, Die romischen Topfereien von Haltern, BAW 36 (i. Druck) 181ff. 50 Von Frauen im Gefolge der romischen Armee berichten uns auch die Schriftquellen. So Cass.
Dio 56, 20, 2; 56, 22, 2 sowie Tac. Ann. 1, 40, 2. Durch eine Kinderbestattung in der Anlage Fl. II Grab 2/88 scheint sich die Vermutung v. Schnurbeins zu bestatigen, daB sich der Termi nus 1to:iowv im Text bei Cassius Dio auch rnit 'Kind' iibersetzen Hillt. v. Schnurbein, Ber. RGK 62, 1981, 80 (bes. 85). Siehe auch dazu B. Rudnick a. 0. 181ff und den Beitrag B. Rud nick (s. u. S. 270) der dazu gegensatzlich Stellung nimmt.
Hinweise fur eine gewaltsame Auseinandersetzung im Bereich der romischen Anlagen von Haltem gibt es schon langere Zeit. Die deutlichsten Befunde sind sicherlich die Skelette im Ofen 10 der Topferei 8 vor der porta praetoria des Hauptlagers bei denen es sich anscheinend um Germanen handelt und die zusatz lichen Sperrungen des Sud und des zweiten Osttores49. Obwohl an den Befun den der iiberbauten Grabanlagen wahrend der Grabungen nicht direkte Zerstorungsspuren beobachtet werden konnten, ist es denkbar, daB im Zuge die ser Auseinandersetzungen innerhalb der Graberstrasse die Grabanlagen soweit beschadigt wurden, daB sie obertagig ganz oder zum Teil nicht mehr sichtbar waren. Dies wurde ihre spatere Uberbauung erklaren. Bedeuten wiirde dies aber auch, daB es nach dieser Auseinandersetzung weiterhin eine so abgesicherte romische Prasenz im Raume Haltern gegeben hat, daB die romische Besatzungs truppe es sich leisten konnte, romanisierte weibliche Begleitung in ihrem Umfeld zu haben50.
Requies aeterna!