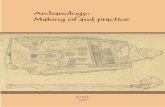Gruben als rituelle Räume, in: • A. Schäfer – M. Witteyer (Hrsg.), Rituelle Deponierungen in...
-
Upload
museenkoeln -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Gruben als rituelle Räume, in: • A. Schäfer – M. Witteyer (Hrsg.), Rituelle Deponierungen in...
237
Der Ethnologe Victor Turner (1920–1983) beschreibt in seinem klassischen Werk zur Ritualfor-schung komplexe Übergangsriten der Ndembu im heutigen Sambia.1 Diese Übergangsriten, die inner-halb von Erdgruben vollzogen wurden, bestimmten Status- oder Positionswechsel von Individuen und gewährleisteten den Fortbestand der Gemeinschaft. Die Teilnehmer des Rituals wiesen die Erd-gruben als umfriedete, klar begrenzte Räume aus. Die Aktionen folgten einem tradierten Schema, so dass sich Handlungssequenzen ergaben, die zwar variiert werden konnten, aber nicht jedes Mal neu gestaltet wurden. Die Semantik dieser südafrikanischen Initiationsriten kann im Rahmen eines Kol-loquiums, das sich mit rituellen Niederlegungen in Heiligtümern der hellenistisch-römischen Welt befasst, nicht näher erläutert werden. Die Analyse Turners ist gleichwohl für unsere Fragestellung von Relevanz, da sich sein theoretischer Ansatz detailliert mit Erdgruben als Räume von Ritualen ausei-nandersetzt. Im Folgenden geht es mir nicht um die Übertragung eines ethnologischen Modells auf archäologische Befunde, deren Untersuchung einer eigenen methodischen Vorgehensweise bedarf. Vielmehr sollen Fragen aufgegriffen werden, die das enge Verhältnis von Raum und Ritual näher erör-tern.2 Aus einer archäologisch-kulturhistorischer Perspektive ist gleichfalls zu fragen, ob Erdgruben mit ihren Verfüllungen Rückschlüsse auf rituelle Praktiken zulassen. Welchen Raum nutzte das Ritual und wer gehörte zu den Akteuren? Welche Bedeutung übernahmen diejenigen Gegenstände, die in den Gruben deponiert worden sind? Führte man rituelle Niederlegungen einem Publikum vor, so dass es sich um einen performativen Akt handelte? Eine Überlieferung von mehreren Gruben in einem Heiligtum wirft die Frage auf, ob ihre Verfüllungen auf identische rituelle Sequenzen, Varia-tionen oder Neugestaltungen von religiösen Praktiken zurückgehen. Am Fallbeispiel eines bakchi-schen Vereinslokals in der Colonia Aurelia Apulensis, in dem mehrere Gruben mit rituellen Deponie-rungen belegt sind, soll dieser Fragestellung nachgegangen werden.
1. Ein Versammlungslokal für Anhänger des Liber Pater-Kultes
In den Jahren von 1998–2003 fand eine internationale Lehrgrabung in Apulum, dem heutigen Alba Iulia in Rumänien, statt (Abb. 1).3 Die Untersuchungen, die von Alexandru Diaconescu, Ian Haynes und mir gemeinschaftlich geleitet wurden, konzentrierten sich auf ein bakchisches Kultlokal im nord-westlichen Stadtgebiet der Colonia Aurelia Apulensis. Im Folgenden soll die jüngste Steinbauphase des Heiligtums kursorisch beschrieben werden (Abb. 2).4 Der Sakralbezirk lag am westlichsten decu-manus (1) der römischen Kolonie. Das Grundstück besaß eine Länge von ungefähr 43 m und eine bisher erschlossene Breite von circa 20 m und war ostwestlich zur Straße ausgerichtet. Parallel zur nördlichen Temenos-Mauer verlief die Längsmauer des Nachbargrundstücks, auf dem sich wahr-scheinlich ein Mithräum befunden hat. Der Besucher gelangte über einen Vorplatz (2) zu einem Ves-tibül (3). Auf diesen Durchgangsraum folgte ein 23,5 × 8,5 m großer, zentral gelegenen Raum (4). An
1 Turner 1989, 10-43. 2 Vgl. Halbwachs 1991, 127–163; Smith 1992; Löw 2001; Van Gennep 2005, 25–33. 3 Schäfer 2000; Diaconescu / Haynes / Schäfer 2001; Haynes 2005; Schäfer / Diaconescu / Haynes 2006; Diaco-
nescu / Haynes / Schäfer 2007. 4 Während der so genannten Steinbauphase besaßen die Gebäude steinerne Fundamente, auf denen sich Lehmziegelmau-
ern erhoben.
GrubEn ALs rituELLE räumE : DAs FALLbEisPiEL EinEs bAKchischEn
VErsAmmLunGsLoKALs in DEr Colonia aurelia apulensis
Alfred Schäfer
238 Alfred Schäfer
seiner westlichen Schmalseite (5) sind bereits während der vorangegangenen Ausgrabungen von 1989-1992 zahlreiche Weihegaben entdeckt worden.5 Es handelt sich vor allem um marmorne Statuetten des Liber Pater und Reliefs mit dionysischen Szenen. Die Votive deuten auf ein Versammlungslokal einer religiösen Vereinigung, in welchem Liber Pater als herausragender Gott neben anderen Göttern verehrt worden ist. Um den langrechteckigen Kultraum (4) gruppierten sich im Norden mehrere Räume, die die Temenos-Mauer miteinander verband. Der an der Straße gelegene Raum (6) besaß einen Ofen. Im angrenzenden, offenen Korridor (7) wurden vier Gruben entdeckt, die mit Heilig-tumsmaterial verfüllt waren. Raum (8) in der nordwestlichen Ecke des Sakralbezirks weist einen u-för-migen Einbau auf, der möglicherweise als Weihgeschenkträger oder Opferstätte gedient hat. Ange-gliedert an Raum (8) ist ein Nebenraum (9). Im Westen wird der Bezirk gleichfalls von einer Mauer begrenzt. Zwischen dieser Mauer und dem langrechteckigen Gebäude (3-4) befand sich ein Töpfe-reibetrieb mit mehreren Öfen (10). Seit der frühesten Nutzungsphase des Baukomplexes ist eine Kera-mikproduktion in der westlichen Zone bezeugt. Dass die Töpferei bereits vor der Errichtung des Sak-
5 Schäfer / Diaconescu 1997; Diaconescu 2001.
Abb. 1: Geländerelief: Atlas der Donauländer, hrsg. von Josef Breu, Wien 1970, Karte Nr. 122.
Geländerelief: Atlas der Donauländer, hrsg. von Josef Breu, Wien 1970, Karte Nr. 122.
239Gruben als rituelle Räume
ralkomplexes existiert hat, wird durch eine große, mit Töpfereischutt verfüllte Lehmentnahmegrube unterhalb des Vorplatzes und teilweise unterhalb der angrenzenden Räume belegt. Die Lage eines Heiligtums innerhalb eines Handwerkerviertels ist für städtische Randlagen nicht ungewöhnlich.6 Die Nutzungsdauer des dionysischen Bezirks ist anhand der Gebrauchskeramik und Kleinfunde in das ausgehende 2. Jahrhundert bis etwa zur Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. zu datieren.7
2. intentionelle niederlegungen in Gruben
Während der internationalen Ausgrabungen im Liber Pater-Heiligtum von Apulum konnten meh-rere Gruben untersucht werden, die Aussagen zu religiösen Handlungen zulassen (Abb. 3).8 In die-sem Beitrag sollen allein die Gruben (A) und (B) innerhalb des Korridors besprochen werden, da sie vergleichbare rituelle Deponierungen aufwiesen. Die beiden Gruben gehören wie die Gruben (C) und (D) zur spätesten Nutzungsphase der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr.9 Dass die Gru-ben zum Zwecke der Niederlegung ausgehoben und nicht etwa sekundär genutzt worden sind, ergibt
6 Vgl. Mayer-Reppert 2004, 34. 7 Höpken / Fiedler 2002; Höpken 2004; Fiedler / Höpken 2004; Fiedler 2005.8 Die folgende Beschreibung stützt sich auf die Keramikauswertung von M. Fiedler und C. Höpken, deren Untersuchung
ich als Antragsteller im Rahmen des SPP 1080 der Deutschen Forschungsgemeinschaft fördern konnte; Fiedler 2005; Fiedler / Höpken 2007 1.
9 Grube (C) hat man als letzte der großen Gruben innerhalb des Korridors ausgehoben. Sie besitzt einen Randumfang von 5 × 5,3 m und ist in die Verfüllung der früheren, großen Lehmentnahmegrube gesetzt worden. Auf der Sohle konn-ten keine intentionellen Niederlegungen wie in den Gruben (A) und (B) nachgewiesen werden. Grube (C) ist zu einem großen Teil mit dem eigenen Aushub verfüllt worden. Eine rituelle Nutzung, die durch die Nachbarschaft zu den Gru-ben (A) und (B) zunächst nahe gelegt wird, ist nicht nachweisbar.
Abb. 2: Das bakchische Kultlokal von Apulum und seine Baubefunde, nach A. Diaconescu, I. Haynes u. A. Schäfer.
240 Alfred Schäfer
sich aus ihrer stratigraphischen Position. Grube (A) und (B) wurden teilweise in die oben genannte, weit ausgreifende Lehmentnahmegrube gesetzt, die mit Töpfereischutt verfüllt war. Bei diesem Arbeits-vorgang konnten vor allem Fehlbrände und beschädigte Gefäße der früheren Keramikproduktion ausgegraben werden. Zuerst wurde Grube (A) angelegt, die eine gedrungene rechteckige Form besaß.10 Sie war 6,50–6,80 m lang, 3,80–4,50 m breit und 1–1,50 m tief. Den Grubenboden konnte man über eine aufgeschüttete Rampe in der Nordostecke betreten. Der Boden war mit Gefäßkeramik voll-ständig bedeckt, die sorgsam niedergelegt und anschließend mit Steinen, einzelnen Ziegeln und Dolium scherben gezielt zerschlagen wurde (Abb. 4). Im Spektrum der Gefäßfunde dominieren ein-fache Schüsseln (CAM 306) und Teller, deren Anzahl bei jeweils 200 bis 300 Stück liegen (Abb. 5).11 Das Geschirr wurde ohne besonderen Qualitätsanspruch hergestellt. Überhängende Kanten und anhaftende Tonreste wurden im Produktionsablauf nicht nachgebessert. Die Töpfer produzierten die Stücke augenscheinlich als Massenware für einen kurzen oder einmaligen Gebrauch. Außer den Schüs-seln und Tellern fanden sich am Grubenboden vereinzelt Miniaturgefäße, darunter Spardosen (Abb. 6).12 Die Miniaturspardosen waren nicht funktionsfähig, da keine Münzen durch den Münz-schlitz gepasst hätten. Die meisten der ca. 10 Spardosen sind wiederum intentionell zerstört worden.13
Aufgrund der relativ großen Ausmaße von Grube (A), der Zugangsrampe und gezielten Zerstö-rung intakter Gefäße am Grubenboden ist von einem Aktionsraum für rituelle Handlungen auszu-gehen. Gleichwohl wurde das Gefäßdepot alsbald zugeschüttet. Nachdem die Grube etwa bis zur Hälfte verfüllt war, wurde ein Feuer am nördlichen Rand entfacht. Erst anschließend wurde Grube (A) in relativ kurzer Zeit vollständig aufgefüllt. Schichtübergreifende Zusammenpassungen von Scher-ben legen nahe, dass Grube (A) nur eine kurze Zeit offen stand.
10 Grube (A) wurde wie die anderen Gruben sorgsam innerhalb des Korridors ausgegraben, ohne die Stabilität der nörd-lich und südlich angrenzenden Mauern zu gefährden.
11 Fiedler 2005, 99 Abb. 4. 12 Ebd. 101 Abb. 5. 13 Zu den Spardosen aus Apulum: Fiedler / Höpken 2007 2.
Abb. 3: Liber Pater-Heiligtum von Apulum mit ‚Votivgruben‘.
241Gruben als rituelle Räume
Abb. 4: Apulum, Gefäßkonzentrationen am Boden von Grube (A).
Die Keramik innerhalb der Verfüllung hat einen vollkommen anderen Charakter als die Kera-mik auf dem Grubenboden. Die Gefäße sind durch einzelne Scherben überliefert und lassen sich nicht zu vollständigen Stücken zusammensetzen. Ähnliche, teils anpassende Fragmente stammen aus dem zentral gelegenen Raum (3–4), so dass vermutlich einige Gefäße, deren Fragmente in der Grube lagen, zuvor dort verwendet worden sind. Auffallend sind typische ‚Kultgefäße‘: weit geöffnete Kel-che auf hohem Fuß, die so genannten turibula (Abb. 7)14, Fragmente von Schlangengefäßen15 sowie hohe Standfußschalen. Außerdem sind in die Grube alle Arten des Tafelgeschirrs, Trinkgefäße und Essgeschirr hineingeworfen worden, das sehr wahrscheinlich bei Opferbanketten Verwendung fand. Zum Serviergeschirr gehören beispielsweise ovale Anrichteplatten, qualitätvolle Imitationen von Terra-Sigillata.16 Hinzu kommen zahlreiche Funde rauhwandiger ‚Gebrauchskeramik‘, vor allem Teller/Pfannen, Schüsseln, Töpfe und Deckel. Ihre Funktion als Kochgeschirr ist häufig durch Rußspuren belegt.17 Aus Grube (A) stammt neben der Gefäßkeramik eine Reihe von Kleinfunden. Das Fragment einer Hand, die einen Kantharos umfasst, gehörte ursprünglich zu einer Liber Pater-Statuette (Abb. 8). Die Beschaffenheit des Marmors lässt auf ein Importstück schließen. Außerdem sind Fragmente von insgesamt 38 Lampen, Glasgefäßfragmente, Bruchstücke von Terrakotten und einige Knochen-Arte-fakte aufgefunden worden.18 Zu den Terrakotten gehören unter anderen ein Hahn, ein Pferd und Fragmente von vier Venusstatuetten. Hinzu kommen zwei tönerne Miniatur-Wagenräder.19 Während für die Gefäße auf dem Grubenboden eine hohe Anzahl gleicher Gefäße und Vollständigkeit charak-teristisch sind, liegen in den Verfüllschichten Fragmente vieler unterschiedlicher Gefäße vor. Die Auf-füllung oberhalb der niedergelegten und absichtlich am Grubenboden zerschlagenen Gefäße bestand offensichtlich aus Heiligtumsschutt.
Die zweite Grube (B) innerhalb des Korridors schnitt im Osten Grube (A) und ist folglich spä-ter angelegt worden (Abb. 3). Ein weites Übergreifen in die ältere Grube wurde vermieden. Grube (B) besaß eine nahezu rechteckige Form von maximal 7 × 6 m, eine Tiefe von circa 1,5 m und einen
14 Fiedler 2005, 102–103 Abb. 6–7. 15 Ebd. 104 Abb. 8. 16 Ebd. 107 Abb. 9. 17 Ebd. 109 Abb. 10. 18 Für die Auswertung der Kleinfunde möchte ich M. Egri danken. 19 Dass Miniatur-Wagenräder den Göttern gestiftet werden konnten, zeigt ein Tonrädchen mit einer Isis-Weihung aus Köln;
Reuter / Scholz 2004, 66.
242 Alfred Schäfer
Abb. 5: Apulum, Schüsseln und Teller aus Grube (A), M 1 : 3.
Abb. 6: Apulum, Miniaturgefäße aus Grube (A): Schüsseln, Teller, Spardosen, M 1 : 3.
243Gruben als rituelle Räume
Abb. 7: Apulum, Räucherkelche aus Grube (A), M 1 : 3.
Abb. 8: Apulum, Fragment einer marmornen Liber Pater-Statuette: Hand mit Kantharos.
244 Alfred Schäfer
abgeflachten Boden.20 Während drei Seiten vertikal eingetieft waren, lag an der Westseite ein leich-tes Gefälle vor. Es dürfte sich um eine Zugangsrampe wie in Grube (A) handeln. Am nördlichen Gru-benrand befand sich eine doppelte Reihe von Ziegelplatten, vermutlich um eine feste Standfläche für Personen zu schaffen. Die stratigraphische Einbindung von Grube (A) und (B) legt nahe, dass nicht mit einem allzu großen Zeitabstand zwischen der Auffüllung der ersten und dem Ausheben der zwei-ten Grube zu rechnen ist. Auf dem Grubenboden wurden massenhaft Keramikgefäße aufgefunden. Eine Konzentration bestimmter Gefäße am Grubenboden wie bei Grube (A) lag nicht vor. Einige Gefäße waren am Ort zerbrochen, während Steine oder Ziegelfragmente auf den zusammengehöri-gen Scherben lagen (Abb. 9). Vermutlich wurden manche Gefäße intentionell zerschlagen. Allerdings ist dieser Vorgang nicht so eindeutig wie in Grube (A) belegt, denn nur zwei Kantharoi, eine Schüs-sel (CAM 306) und ein Topf konnten vollständig am Grubenboden geborgen werden. Ansonsten lagen die erhaltenen Randprozente fast immer gering unter 25 %. Nach der Hinterlegung der Gefäße und Keramikscherben am Boden von Grube (B) wurde das Depot mit Erde abgedeckt. In der halb-verfüllten Grube wurde eine Brandschicht am nördlichen Rand lokalisiert, die wie in Grube (A) auf ein Feuer in situ zurückgeht. Die von ihrer Position ähnlichen Feuerstellen könnten darauf hinwei-sen, dass es sich in beiden Gruben um Spuren eines Rituals handelt.21 Die vollständige Verfüllung von Grube (B) fand in einem relativ engen zeitlichen Zusammenhang statt, da Anpassungen von Gefäßscherben von Schicht zu Schicht nachgewiesen werden konnten.
An verschiedenen Stellen von Grube (B) hinterlegte man einige Gefäße, so dass sich ganz indi-viduelle Gruppierungen ergaben. In der südwestlichen Ecke der Grube wurde eine große Schüssel entdeckt, in der wiederum zwei umgedrehte Schüsseln vermutlich zur Abdeckung von Naturalien lagen (Abb. 10).22 An anderer Stelle fand sich ein Paar Miniaturspardosen, die mit ihren Oberseiten einander zugewandt waren.23 Die Positionierung der Stücke und ihr kleines Format legen nahe, dass man die Spardosen als Weihgeschenke in die Grube gab. Charakteristisch für Grube (B) sind damit
20 Fiedler 2005, 110–113. 21 Haynes 2005, 42. 22 Fiedler 2005, 111 Abb. 11, 3. 23 Ebd. Abb. 11, 2.
Abb. 9: Apulum, Gefäßkonzentrationen am Boden von Grube (B) mit Kieselsteinen.
245Gruben als rituelle Räume
Abb. 10: Apulum, Gefäßgruppierungen aus Grube (B).
kleine Gefäßgruppen, die offenbar sorgsam hinterlegt worden sind. Im Übrigen war die Grube mit bruchstückhaft erhaltenem Geschirr verfüllt, das in seinem Formenspektrum ungefähr dem Spekt-rum aus Grube (A) gleicht. Von den Kleinfunden aus Grube (B) sind Bruchstücke von Glasgefäßen, Terrakotta- und Lampenfragmente zu nennen. Insgesamt handelt es sich um 36 fragmentierte Lam-pen. Mit fünf Exemplaren sind tönerne Miniatur-Wagenräder relativ häufig belegt. Unter den figür-lichen Terrakotten sind neben Hähnen und Venus-Statuetten vor allem Statuetten des Telesphorus, des Begleiters von Aesculap und Hygia hervorzuheben.
Die beiden Gruben (A) und (B) scheinen vor allem aus zwei Motiven angelegt worden zu sein. Einerseits wurden vollständige Gefäße hinterlegt und viele von ihnen bewusst zerschlagen oder unbrauchbar gemacht.24 Andererseits entsorgte man fragmentierte Gefäße und Gegenstände, die zuvor im Sakralbezirk benutzt worden sind. Die zahlreichen Fragmente von Tafelgeschirr aus den Gruben belegen, dass Opferbankette stattfanden: Der Anteil an Trinkgeschirr, unter welchem sich neben den einfachen Bechern auch Kantharoi25 befinden, ist in den Gruben (A) und (B) hoch. An manchen Tellern sind Schnittspuren vom Zerteilen der Speisen erhalten. Einige Formen des Tafelge-schirrs, so genannte Waschbecken und ovale Keramik- und Glasplatten, sprechen für sehr aufwen-dige Bankette.
24 Vereinzelt sind selbst Tonlampen der Länge nach durchtrennt worden. 25 Fiedler 2005, 111 Abb. 11, 1.
246 Alfred Schäfer
Knochenreste von Tieren in Grube (A) und (B) dürften auf Opfer und kultische Mahlzeiten zurückgehen. So stammen aus den Verfüllschichten von Grube (A) Knochenfragmente von Huhn, Ferkel sowie Schaf/Ziege.26 Hervorzuheben sind drei rechte Unterschenkelknochen von Hunden. Sie stammen nicht von einem einzelnen Tier, sondern von einem kleinen, mittelgroßen und großen Hund. Oberhalb der ersten Verfüllschicht, welche die Gefäßkeramik auf dem Grubenboden abdeckte, lagen an verschiedenen Stellen Knochen von vier Pferdeläufen. Ob die drei Unterschenkelknochen von Hunden und die vier Pferdeläufe aus Grube (A) auf weit verbreitete Opferrituale, auf bodenstän-dige Kulte des Donauraumes oder etwa der germanischen Provinzen zurückgehen, bleibt zu unter-suchen.27 Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auf Depots mit Hundeskeletten, die sich im Hei-ligtum der Isis und Mater Magna in Mainz befunden haben.28 Die Identifizierung regionalspezifi-scher Tieropfer wird in Apulum durch den Kreis der Heiligtumsbesucher aus den Reihen des Militärs erschwert, für die eine hohe Mobilität charakteristisch ist.
3. Gemeinschaftlich und individuell praktizierte religion
Die Weihegaben im langrechteckigen Raum (3–4) und das Fundspektrum in den nahe gelegenen Gruben (A) und (B) lassen auf eine Fülle von Handlungen schließen, die auf die Bedürfnisse einer religiösen Mahlgemeinschaft als auch individuelle Anliegen ihrer Mitglieder zurückgingen. Dass es sich bei dem Sakralbezirk um den Versammlungsort einer Kultgemeinschaft handelt, deren gemein-same Handlung das Bankett gewesen ist, wurde anhand der Gebrauchs- und Kultkeramik deutlich. Die marmornen Statuetten und Reliefs weisen den langrechteckigen Raum (4) sehr wahrscheinlich als Kultlokal eines dionysischen Vereins aus.29 Spardosen im Miniaturformat versinnbildlichen einen wichtigen Aspekt des Vereinswesens, die Finanzierung der Festlichkeiten durch die Mitglieder. Ton-figürchen, die in den beiden Gruben (A-B) des Korridors gefunden wurden, dürften als Zeugnisse individueller Religion zu verstehen sein. Neben der Verehrung des zentralen Vereinsgottes Liber Pater konnte sich der einzelne Dedikant anderen Göttern im Heiligtum zuwenden.30
Auf die kollektiven Bedürfnisse der religiösen Gruppe wird die Niederlegung großer Mengen von Gefäßen am Boden von Grube (A) und ihr anschließendes Zerschlagen zurückzuführen sein. Niedergelegt wurden vermutlich vor allem organische Naturalien, die in den Gefäßen aufbewahrt worden sind. Sehr wahrscheinlich ist die hohe Anzahl von Schüsseln und Tellern/Pfannen auf dem Boden von Grube (A) mit einem bestimmten Fest der Mahlgemeinschaft zu verbinden.31 Anhand der geringen Zahl der Gruben kann allerdings nicht auf jährlich wiederkehrende Feste geschlossen werden, die dieses Ritual aufwiesen. Das Zerschlagen der Keramik am Grubenboden macht vor allem vor einem Publikum Sinn, das selbst beteiligt war. Mit der Einmaligkeit dieses Vorgangs geht die geringe Qualität des Geschirrs am Boden von Grube (A) einher, das als Massenware für einen kur-zen Gebrauch hergestellt worden ist. In diesem Zusammenhang sei auf verziegelte Erde hingewiesen, die in den halbverfüllten Gruben (A) und (B) jeweils an der nördlichen Innenwand lokalisiert wer-den konnte. Aufgrund der wiederholten Befundsituation könnte es sich um Brandschichten handeln, die auf kultische Handlungen direkt am Ort zurückgehen.32 Möglicherweise sollten die Niederle-
26 Alison Carnell möchte ich für die Untersuchung der Tierknochen danken. 27 Zu den Deponierungen von Pferden: Rech 2006. – Für die römische Kaiserzeit sind intentionelle Deponierungen von
Extremitätenknochen durchaus charakteristisch; Belke-Voigt 2006.28 In einem Fall hatte man nur den Schädel des Hundes deponiert. Daneben lag ein Balsamarium aus Glas; Witteyer
2003, 11–12. 29 Zu römischen collegia : Egelhaaf-Gaiser / Schäfer 2002; Harland 2003; Gutsfeld / Koch 2006; Perry 2006.30 Unter den figürlichen Terrakotten aus dem Sakralbezirk dominieren Venusstatuetten mit vierzig Exemplaren, gefolgt
von Telesphorus-Figürchen mit zehn Exemplaren, schließlich acht Exemplare für Aesculap und Hygia sowie sechs Exem-plare für Liber Pater oder seinen Thiasos.
31 Bei den Schüsseln handelt es sich um eine im römischen Reich relativ selten belegte Form, genannt Camulodunum 306, die vor allem in Heiligtums- und Grabkontexten auftritt; vgl. die Keramikfunde aus dem Walbrook-Mithräum in Lon-don; Sheperd 1998; Haynes 2005, 42.
32 Vgl. eine Opfergrube im Kultbezirk des Iuppiter Optimus Maximus Heliopolitanus in den östlichen Canabae von Carn-untum; Eschbauer / Gassner / Jilek / Kandler 2003, 157.
247Gruben als rituelle Räume
gungen auf dem Grubenboden durch ein Feuer gleichsam versiegelt werden, so dass es sich um ein Schließungsritual handelte. Sicherlich ist mit einer Ritualsequenz in beiden Gruben zu rechnen, die anhand der Befunde und Funde teilweise zu rekonstruieren ist.
Die Gruben (A) und (B) waren jeweils über eine Rampe vom Korridor aus zugänglich. Grube (A) wurde aus nordöstlicher Richtung und Grube (B) aus westlicher Richtung erschlossen. Als Ver-gleich für eine solch begehbare Kultgrube ist eine so genannte favissa im römischen Heiligtum von Baudecet in der Region Namur anzuführen (Abb. 11–12).33 Verwandt sind die großen Ausmaße der Grube, der Zugang über eine Rampe, die Deponierung von Heiligtumsmaterial und die Lage direkt neben einem langrechteckigen Kultgebäude. Die Rampe besaß eindeutig Trittstufen. Zu den Fun-den aus der Grube in Baudecet gehören unter anderen Räucherkelche, Lampen und ein großes Mes-ser – vielleicht ein Opfermesser. Als weiterer Vergleich sei eine Grube im Ostheiligtum der italischen Stadt Gabii angeführt.34 Die Grube, die mit größerem Aufwand in den anstehenden Tuff gehauen wurde, misst am äußeren Rand etwa 7 × 5 m und ist ungefähr 2 m tief. Von der Terrasse des Heilig-tums führte eine Treppe auf die Grubensohle. Die Grube wurde in mittelrepublikanischer Zeit ange-legt und war mit figürlichen Terrakotten, Architekturterrakotten und Keramik verfüllt. Aufgrund des punktuellen Kenntnisstandes sind zwar keine Rückschlüsse auf Kulttraditionen im jeweiligen regio-nalen Umfeld möglich. Die räumlich und zeitlich weit auseinander liegenden Beispiele zeigen aber
33 J. Plumier danke ich für die Überlassung des Grabungsplans; Plumier-Torfs / Plumier 1993, 789-802 Abb. 2, 6; Plu-mier 2004, Abb. 55, 57. – Als favissae werden im archäologischen Sprachgebrauch häufig Gruben bezeichnet, die mit Materialien aus Heiligtümern verfüllt worden sind. Begriffe für religiöse Handlungen dienen generell der Vereinheitli-chung und stellen damit eine Simplifizierung im Vergleich zur Vielfalt der archäologisch überlieferten Verfahrenweisen dar. Gerade die Bandbreite praktizierter Religion gilt es aber zu erschließen. Daher wird in diesem Beitrag auf eine Ver-wendung antiker Termini für rituelle Deponierungen und Gruben, wie bothros, thesauros, favissae oder mundus, weitge-hend verzichtet. Eine eigene Untersuchung zur antiken Terminologie ritueller Deponierungen, vor allem unabhängig von den archäologischen Befunden, ist gleichwohl notwendig. Dazu grundlegend: Hackens 1963; Bouma 1996, 43–54; ThesCRA IV (2005) 21–22 s.v. Bothros (U. Sinn); ThesCRA IV (2005) 240–241 s.v. Favisae (A.Comella); ThesCRA IV (2005) 282–284 s.v. Mundus (F. Marcattili).
34 P. Zaccagni, Gabii: la città ed il territorio, Archeologia Laziale 1, 1978, 44 Taf. 17,1. – Siehe hier den Beitrag von G. Zuchtriegel.
Abb. 11: Das römische Heiligtum von Baudecet (Gembloux).
248 Alfred Schäfer
deutlich, dass Gruben nicht allein Verfüllungen von ‚Heiligtumsschutt‘ 35, sondern auch Spuren von rituellen Aktionen aufweisen können. Im Liber Pater-Heiligtum von Apulum sind die Gruben (A) und (B) sicherlich als Handlungsräume von Ritualen zu begreifen. Sie waren groß genug, um von mehreren Personen betreten zu werden. Der von einer Temenosmauer von der Außenwelt abgeschlos-sene Korridor bot genügend Raum für ein Publikum, das den Vorgängen beiwohnte und sich zugleich daran beteiligte. Der nördliche Rand von Grube (B) wurde durch Ziegelplatten als Standfläche befes-tigt. Nachdem die Keramikgefäße am Grubenboden rituell zerschlagen wurden, verfüllte man beide Gruben mit Abfall aus dem Heiligtum. Die Bedeutung des Vorgangs auf der Grubensohle wurde durch das Ausmaß der hinterlegten Gefäße in Grube (A) zum Ausdruck gebracht. Das einzigartige Fest sollte durch demonstrativen Aufwand lange Zeit in Erinnerung bleiben. Trotz der Gemeinsam-keiten gehen die Verfüllungen der beiden Gruben nicht auf identische rituelle Sequenzen zurück. Am Boden von Grube (A) befanden sich zahlreiche Gefäße einer bestimmten Form, die gezielt zerschla-gen wurden. Am Boden von Grube (B) ist ein breiteres Keramikspektrum mit wenigen vollständig rekonstruierbaren Gefäßen belegt. Eine intentionelle Zerstörung von Gefäßen konnte gleichwohl für Grube (B) erschlossen werden. Charakteristisch für Grube (B) waren aber vor allem Niederlegungen von kleineren Gefäßgruppen. Aufgrund ihres begrenzten Umfangs dürften diese Deponierungen auf Opfer einzelner Akteure zurückgehen. Offenbar folgten die Aktionen in den Gruben (A) und (B) keinem tradierten Ablauf, sondern waren Variationen oder Neugestaltungen religiöser Praktiken. Zu den Besuchern des Sakralbezirks gehörten nach dem Zeugnis der Weihinschriften und militärischer Ausrüstungsgegenstände sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Für diese Klientel scheint das Neben-einander einer kollektiv und individuell getragenen Religion besonders attraktiv gewesen zu sein, die vielfältige Wahlmöglichkeiten religiösen Handelns eröffnete.
35 Vgl. Martens 2002; Martens 2004.
Abb. 12: Grube mit Zugangsrampe (Treppe) des römischen Heiligtums von Baudecet (Gembloux).
249Gruben als rituelle Räume
Abbildungsnachweis
Abb. 1: Karte der römischen Provinz Dakien, gezeichnet von Petra Fleischer, Karin Petrovsky und Radu Cotorobai, nach Schäfer 2007 3. Abb. 2–3: Nach A. Diaconescu, I. Haynes u. A. Schäfer. Abb. 4, 9–10: Foto M. Fiedler. Abb. 5: Foto/Zeichnung M. Fiedler. Abb. 6–7: Zeichnung M. Fiedler. Abb. 8: Foto A. Schäfer. Abb. 11: J. Plumier, MRW D.Pat; infographie: CRAN-UCL. Abb. 12: Foto J. Plumier, MRW, D.Pat.
Literaturverzeichnis
Belke-Voigt 2006 I. Belke-Voigt, Das Tieropfer in archäologischen und weiteren Quellenzeugnissen, Ethnogra-
phisch-Archäologische Zeitschrift 47, 1, 2006, 87–102. Bolindet 1993 V. Bolindet, Considérations sur l’attribution des vases de Dacie romaine décorés de serpents appli-
qués, Ephemeris Napocensis 3, 1993, 123–141. Bollmann 1998 B. Bollmann, Römische Vereinshäuser. Untersuchungen zu den Scholae der römischen Berufs-,
Kult- und Augustalen-Kollegien in Italien (Mainz 1998). Diaconescu 2000 A. Diaconescu, Un nou relief ceramic din Apulum, Ephemeris Napocensis 9–10, 2000, 245–274. Diaconescu 2001 A. Diaconescu, A Statue of Liber Pater from Apulum (Alba Iulia), Acta Musei Napocensis 38/I,
2001, 161–176.Diaconescu 2004 A. Diaconescu, The towns of Roman Dacia: an overview of recent archaeological research, in:
W. S. Hanson / I. P. Haynes (Hrsg.), Roman Dacia, Journal of Roman Archaeology Suppl. 56 (Portsmouth, Rhode Island 2004) 87–142.
Diaconescu / Haynes / Schäfer 2001 A. Diaconescu / I. Haynes /A. Schäfer, The Apulum Project. Summary report of the 1998 and 1999
seasons, in: S. Altekamp /A. Schäfer (Hrsg.), The Impact of Rome on Settlement in the North-western and Danube Provinces, BAR Int. Series 921, 2001, 115–128.
Diaconescu / Piso 1993 A. Diaconescu / I. Piso, Apulum, in: D. Alicu / H. Boegli (Hrsg.), La politique édilitaire dans les
provinces de l’Empire romain: Kolloquium Deva 1991 (Cluj-Napoca 1993) 67–82. Diaconescu / Haynes / Schäfer 2007. A. Diaconescu / I. Haynes /A. Schäfer, Exkurs: Das Liber Pater-
Heiligtum von Apulum in der römischen Provinz Dakien, in: J. Rüpke (Hg.), Gruppenreli gionen im römischen Reich (Tübingen 2007) 168–171.
Egelhaaf-Gaiser 2002 U. Egelhaaf-Gaiser, Religionsästhetik und Raumordnung am Beispiel der Vereinsgebäude von
Ostia, in: U. Egelhaaf-Gaiser /A. Schäfer (Hrsg.), Religiöse Vereine in der römischen Antike (Tübingen 2002) 123–172.
Eschbauer / Gassner / Jilek / Kandler 2003 P. Eschbauer / V. Gassner / S. Jilek / M. Kandler, Der Kultbezirk des Iuppiter Optimus Maximus
Heliopolitanus in den östlichen Canabae von Carnuntum, Carnuntum Jahrbuch 2003, 117–167. Fiedler / Höpken 2004 M. Fiedler / C. Höpken, Wein oder Weihrauch? – ‚Turibula‘ aus Apulum, in: C. Roman / C. Gazdac
(Hrsg.), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis (Cluj-Napoca 2004) 510–516. Fiedler 2005 M. Fiedler, Kultgruben eines Liber Pater-Heiligtums im römischen Apulum (Dakien), Germa-
nia 83, 2005, 95–125. Fiedler / Höpken 2007 1 M. Fiedler / C. Höpken, Das ‚gemeinschaftliche‘ und das ‚private‘ Opfer: Beispiele aus dem Spek-
250 Alfred Schäfer
trum von Votivpraktiken in römischen Heiligtümern, dargestellt an Befunden aus Apulum und Sarmizegetusa (Dakien), in: C. Frevel / H. von Hesberg (Hrsg.), Kult und Kommunikation. Medien in Heiligtümern der Antike (Wiesbaden 2007) 435-466.
Fiedler / Höpken 2007 2 M. Fiedler / C. Höpken, Spardosen und Miniatur-Spardosen – Neufunde aus dem römischen
Apulum (Rumänien), in: M. Harzenetter / G. Isenberg (Hrsg.), Keramik auf Sonderwegen. (Mainz 2007) 95–99.
Gassner 2004 V. Gassner, Snake-decorated vessels from the canabae of Carnuntum – evidence for another
mithraeum?, in: M. Martens / G. de Boe (Hrsg.), Roman Mithraism. The Evidence of the Small Finds (Brüssel 2004) 229–238.
Gutsfeld / Koch 2006 A. Gutsfeld / D.-A. Koch, Vereine, Synagogen und Gemeinden im kaiserzeitlichen Kleinasien
(Tübingen 2006). Halbwachs 1991 M. Halbwachs, Das kollektive Gedächtnis (Frankfurt am Main 1991). Harland 2003 P. Harland, Associations, Synagogues, and Congregations: Claiming a Place in Ancient Mediter-
ranean Society (Minneapolis 2003). Haynes 2005 I. Haynes, Apulum: the shrine of Liber Pater », Current World Archaeology (CWA) 10, 2005,
38–45. Höpken / Fiedler 2002 C. Höpken / M. Fiedler, Die römischen Gläser von der Grabung eines Liber Pater-Heiligtums in
Apulum (Rumänien) – ein Vorbericht, Kölner Jahrbuch 34, 2002, 375–389. Höpken 2004 C. Höpken, Die Funde aus Keramik und Glas aus einem Liber Pater-Bezirk in Apulum – Ein
erster Überblick, in: M. Martens / G. de Boe (Hrsg.), Roman Mithraism. The Evidence of the Small Finds. Kongreß Tienen 2001, Archeologie in Vlanderen 5 (Brüssel 2004) 239–258.
Jaccottet 2003 A.-F. Jaccottet, Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou la face cachée du dionysisme
(2 Bde.) (Zürich 2003). Kandler 2001 M. Kandler, Liber und Libera in Carnuntum, in: Carinthia Romana und die römische Welt, Fest-
schrift für G. Piccottini (Klagenfurt 2001) 63–77. Kloppenberg / Wilson 1996 J. S. Kloppenberg / S. G. Wilson, Voluntary Associations in the Graeco-Roman World (Lon-
don / New York 1996). Löw 2001 M. Löw, Raumsoziologie (Frankfurt am Main 2001). Martens 2002 M. Martens et alii, Ensemble détrique ou contexte cultuel? Etude du matériel archéologique et
de restes faunique d’une grande fosse (S 082) du vicus de Tirlemont (Tienen, Belgique), Revue du Nord 84, 2002, 43–89.
Martens 2004 M. Martens, Re-thinking sacred “rubbish”: the ritual deposits of the temple of Mithras at Tienen
(Belgium), Journal of Roman Archaeology 17, 1, 2004, 333–353. Mayer-Reppert 2004 P. Mayer-Reppert, Das römische Mithräum ‚Beim Kloster‘ in Riegel am Kaiserstuhl, Archäolo-
gische Nachrichten aus Baden, Heft 68/69, 2004, 33–43. Piso 2001 I. Piso, Inscriptions d’Apulum. Inscriptions de la Dacie romaine (Paris 2001).
251Gruben als rituelle Räume
Plumier-Torfs / Plumier 1993 S. Plumier-Torfs / J. Plumier, La plaquette en or inscrite de Baudecet (Gembloux, Belgique): décou-
verte, édition, commentaire, Latomus 52, 4, 1993, 797–804. Plumier 2004 J. Plumier, La favissa du fanum de Baudecet (Gembloux), in: La céramique cultuelle et le rituel
de la céramique en Gaule du Nord (Louvain-la-Neuve 2004) 39–41. Rech 2006 M. Rech, Pferdeopfer – Reiterkrieger, Bremer Archäologische Blätter Beiheft 4, 2006. Reuter / Scholz 2004 M. Reuter / M. Scholz, Geritzt und entziffert. Schriftzeugnisse der römischen Informationsgesell-
schaft (Esslingen 2004). Ruscu 1992 D. Ruscu, Über die Kuchenmatrizen aus dem Heiligtum des Liber Pater von Apulum, Epheme-
ris Napocensis 2, 1992, 125–134. Rusu-Pescaru / Alicu 2000 A. Rusu-Pescaru / D. Alicu, Templele romane din Dacia (I) (Deva 2000). Schäfer 2000 A. Schäfer, Ein Heiligtum des römischen Weingottes in Rumänien, Humboldt Spektrum 7, Heft
3, 2000, 34–36.Schäfer 2002 A. Schäfer, Raumnutzung und Raumwahrnehmung im Vereinslokal der Iobakchen von Athen,
in: U. Egelhaaf-Gaiser /A. Schäfer (Hrsg.), Religiöse Vereine in der römischen Antike (Tübingen 2002) 173–220.
Schäfer 2003 1 A. Schäfer, Sakrale Räume und Kultpraktiken in städtischen Zentren Dakiens, in: H. Cancik /
J. Rüpke (Hrsg.), Römische Reichsreligion und Provinzialreligion. Globalisierungs- und Regio-nalisierungsprozesse in der antiken Religionsgeschichte (Erfurt 2003) 168–174.
Schäfer 2003 2 A. Schäfer, Transfer von stadtrömischer Religion in die Provinz Dakien, in: P. Noelke (Hg.),
Romanisation und Resistenz (Mainz 2003) 421–439. Schäfer 2004 A. Schäfer, Religiöse Erkennungszeichen, in: C. Roman / C. Gazdac (Hrsg.), Orbis antiquus. Stu-
dia in honorem Ioannis Pisonis (Cluj-Napoca 2004) 125–131. Schäfer 2007 1 A. Schäfer, Öffentlich und privat getragene Heiligtümer in Apulum, in: E. Walde (Hg.), IX. Inter-
nationales Kolloquium über provinzialrömisches Kunstschaffen in Innsbruck (Innsbruck 2007) 55–67.
Schäfer 2007 2 A. Schäfer, Dionysische Gruppen als ein städtisches Phänomen der römischen Kaiserzeit, in:
J. Rüpke (Hg.), Gruppenreligionen im römischen Reich (Tübingen 2007) 161–180. Schäfer 2007 3 A. Schäfer, Tempel und Kult in Sarmizegetusa. Eine Untersuchung zur Formierung religiöser
Gemeinschaften in der Metropolis Dakiens (Paderborn 2007). Schäfer 2008 A. Schäfer, Religiöse Mahlgemeinschaften der römischen Kaiserzeit: Eine phänomenologische
Studie, in: J. Rüpke (Hg.), Festrituale in der römischen Kaiserzeit (Tübingen 2008) 169–199. Schäfer / Diaconescu 1997 A. Schäfer / A. Diaconescu, Das Liber-Pater-Heiligtum von Apulum (Dakien), in: H. Cancik /
J. Rüpke (Hrsg.), Römische Reichsreligion und Provinzialreligion (Tübingen 1997) 195–218. Schäfer / Fiedler / Höpken 2002 A. Schäfer / M. Fiedler / C. Höpken, Sakrale Räume und Kultpraktiken in städtischen Zentren
Dakiens, Humboldt-Spektrum 9 Heft 1, 2002, 24–28.
252 Alfred Schäfer
Schäfer / Diaconescu / Haynes 2006 A. Schäfer /A. Diaconescu / I. Haynes, Praktizierte Religion im Liber Pater-Heiligtum von Apu-
lum – Ein Vorbericht, Hephaistos 24, 2006, 183–200. Shepherd 1998 J. D. Shepherd, The Temple of Mithras, London. Excavations by W F Grimes and A Williams
at the Walbrook (London 1998). Smith 1992 Jonathan Z. Smith, To Take Place (Chicago 1992). Turner 1989 V. Turner, The Ritual Process. Structure and Anti-Structure 6 (Ithaca / New York 1989). Van Gennep 2005 Arnold van Gennep, Übergangsriten 3 (Frankfurt 2005).
••Anschrift des Autors••