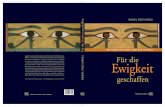Zwei Weihschriften aus dem Lager Butzbach, in: Mainzer Zeitschrift 86 (1991), Mainz 1993, p. 193-197
-
Upload
uni-rostock -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Zwei Weihschriften aus dem Lager Butzbach, in: Mainzer Zeitschrift 86 (1991), Mainz 1993, p. 193-197
MAINZER ZEITSCHRIFTMITTELRHEI NI S C H E S J AH R B UC H
FÜR ARCHAOLOGIE, KUNST UND GESCHICHTE
HERAUSGEGEBEN VOM ALTERTUMSVEREIN. DEM LANDES-
MUSEUM, DER ARCHAOLOGISCHEN DENKMALPFLEGE,
DEM STADTARCHIV UND DER STADTBIBLIOTHEK MAINZ
JAHRGANG 86, I99I
MAINZ I993
VERLAG DES MAINZER ALTERTUMSVEREINS
INHALTSVERZEICHNISSeite
Der »Fall Hans Backoffen«. Studien zur Bildnerei in Mainz und am Mittelrhein am Ausgangdes Spätminelalters, Teil II
von Wolf Goeltzer I
Mainzer Silberarbeiten der ersten Hälfte des 17. Jahrhundertsvon Sigrid Duchhardt-Bösken 65
Ein Mainzer Pfeifenbäcker im Dreißigjährigen Kriegvon Baron Ludwig Döry 73
Das verlorene Crab-Steinkreuz des Mainzer Tuchmachers Hans Kostertvon Friedrich Karl Azzola 77
Die alten Berufe des Mainzer Raumes im Spiegel vor allem der Familiennamen(spätes Mittelalter und fri.ihe Neuzeit)
von Rudolf Steffens . 83
Amerika-Auswanderung im 19. Jahrhundert am Beispiel des Binger Raumsvon Jürgen Krome 139
Ein Biergefäß aus Mainz. Barbotinedekorierte Terra Sigillata mit Inschriftenvon Susanna Künzl ....... l7l
Archäologische Berichte aus Rheinhessen und dem Kreis Bad Kreuznach, 6. Folge.Herausgegeben von der Archäologischen Denkmalpflege, Amt Mainz . 187
Funde der Großganacher Kultur im Erfurter Raumvon Eberhard Lippmann 189
Zwei Weihinschriften aus dem Lager Butzbachvon Sigrid Mratschek-Halfmann 193
Zwei vielteilige tauschierte Gürtelgamituren des 7. Jhs. aus Udenheimvon Gudula Zeller ....... 199
Der Münzschatzfund von Waldalgesheim, Kr. Mainz-Bingen(Mit einem Vorwort von Deten Zylmann)
von Eberhard Link . . . . . ....... 205
Die Flankenkasematten des ehemaligen Forts Bingen in Mainzvon Hans-Rudolf Neumann ....... 219
Anschriften der Autoren 231
ZWEI WEIHINSCHRIFTEN AUS DEM LAGER BUTZBACH
Fritz Gschnitzer zum 65. Geburtstag
v on S i grid M ratsc he k- H alfmann
1956 wurde im Bezirk des ehemaligen Lagerdorfesvon Butzbach, im Kanalgraben in der HolzheimerStraße, ein Inschriftstein gefunden, der seitherunpubliziert im Magazin des Hessischen Landes-museums in Darmstadt ruht. Auf der Inventarkarte(Nr. A 195612087,1) ist hinsichtlich der Fundum-stände die lapidare Notiz »Brunnen« verrnerkt. DerFundort läßt in jedem Falle auf eine mutwilligeZerstörung schließen, ob die Steine nun als heidni-sche Inschriften in christlicher Zeit ebenda hinein-gestürzt oder beim Vordringen der Alamannengegen den Rhein nach einer Beschädigung kultischvergraben wurden. um sie vor weiterer Profänie-rung zu schützen. Auch ein zweiter, weiter unten zubesprechender Weihestein wurde in einem Brunnengefunden.' Bei dem Denkmal handelt es sich umein Altarbruchstück aus Sandstein, das unten gebro-chen ist und oben auf dem Aufsatz eine quadrati-sche patera trägt. In der Mitte des Giebels isr, starkverwittert, zwischen zwei Rosetten ein dreiteiligesBlattornament zu erkennen. Der fast pfeilerhaftanmutende Typus des Altars ist von der Art, wie siedes öfteren zu mehreren in einem Heiligtum odervor Juppitergigantensäulen anzutreffen sind., Vonseiner ursprünglichen Gesamthöhe sind noch 39,5cm erhalten, die Maße des Inschriftfeldes betragen26,5 x 22,5 x 16 cm. Vergegenwärtigt man sich, daßsich die Proportionen von Höhe und Breite beijenem Typus von Altären gewöhnlich etwa in demVerhältnis 2:l zteinander verhalten. so dürften beieiner Breite von 22,5 cm ztJr rekonstruiertenGesamthöhe noch maximal ca. 20 cm. d.h. zweiSchriftzeilen, fehlen, falls sie nicht die Symbolevon Opfergeräten zierten oder ein Leerraum anzu-nehmen ist.r
Die Lesung des Inschriftentextes, dessen Aufnahmeim Februar 1987 im Rahmen der Arbeiten an demForschungsprojekt für das Supplement zum CILXIII erfolgteo, lauter nach Auropsie wie folgt:
IN.H.D.DI.O.MACCEPTISEVERNVS
VPT
Die Buchstaben sind ungleichmäßig gehauen, das Vam Ende der vierten Zeile kleiner (1,8 cm) und amAnfang der fünften Zeile in die Mitte der Buchsta-benhöhe versetzt; ansonsten schwankt die Buchsta-benhöhe zwischen 2,3 und 3,2 cm. Die Wörterbeziehungsweise Buchstaben in den ersten beiden
Zeilen sind durch Interpunktionen voneinandergetrennt. Die geehrte Person ist die domus divina,der Gott, der mit ihr gemeinsam verehrt wurde, Iup-piter Optimus Maximus (wobei optimus charakteri-stischerweise ursprünglich denjenigen bezeichnete,der im höchsten Maße ops, das heißt »hilfreicheMacht« besaßs). Daß Loyalitätsbekundungen an das
1 Siehe unten S. 195. Vergleichbare Brunnenfunde wurdenu.a. auch in Frankfurt-Heddernheim (CIL XIII 1352), inWiesbaden-Schierstein (XIII 7609), Bad Cannstadt (H.Nesselhauf, Ber. RGK 21 . 1937.81 Nr. l0l) und Obem-burg (U. Schillinger-Häfele, Ber. RGK 53, 1972, 487Nr. 55) gemacht. Zur Diskussion dieser Problematik inder Forschung siehe zuletzt G. Bauchhenß, Die Juppiter-gigantensäulen in der römischen Provinz Germaniasuperior. Beih. BonnerJahrb.4l (1981) 25f.
2 Siehe etwa G. Bauchhenß, CSIR II 2 (Mainz 1984) l0 f.Taf.35 über die große Juppitersäule aus Mainz, die alsVorbild für alle in Germanien und Gallien gefundenenKultstätten dieser Art gilt.
3 Zu Proportionen und Ornamentik vgl. den Altar ausMainz (siehe Anm.2).
4 Herrn Prof. Dr. R. Wiegels, dem Leiter des projektes.dem Landesmuseum in Darmstadt sowie meinen frühe-ren Mitarbeitem an der Universität Osnabrück möchteich für die Überlassung der Inschriften und der Fotoszur Publikation sehr herzlich danken.
5 J. Marouzeau, Eranos 54. 1956.221 fl.
IiIt
II
I:
194 Mratschek-Halfmann: Zwei Weihinschriften aus dem Lager Butzbach
Herrscherhaus gerade in Obergermanien keinenEinzelfall darstellten. hat M.-Th. Raepsaet-Charlier"mittels einer Statistik nachgewiesen. wonach dieFormel in h(onorem) d(omus) d(ivinae) mit 82datierten inschriftlichen Belegen in dieser Provinzam weitesten überhaupt verbreitet war. An IuppiterOptimus Maximus wenden sich die Hälfte ällerWeihungen in den römischen Lagern., Der Namedes Gottes als Empfänger der Weihung stehr imDativ, der des Dedikanten folgt in der dritten undvierten Zerle im Nominativ und ist durch einigesprachliche beziehungsweise orthographische Be-sonderheiten entstellt. So läßt denn auch das Genti-liz Accepti in der dritten Zelle zwei Deutungen zu:Entweder es handelt sich um einen Nominativ Plu-ral Masculinum des Gentilnamens Acceptus bzw.Acceptius und damit um zwei männliche Mitgliederein und derselben Familie, am ehesten wohl zweiBrüder, die den Weihestein stifteten. In diesem Fallmüßte das Cognomen des zweiten Dedikanten etwanach einer Wortverbindung mit e/ in einer sechstennicht erhaltenen Zeile unterhalb des Bruchesgestanden haben.3 Oder aber die maskuline Nomi-nativendung des Namens auf -ns im Singular wurdewie auch auf einer Inschrift aus Sens. dem römi-schen Agedincum, möglicherweise aus Platzgrün-den weggelassen.e Accepti wäre dann ausschließlichzu dem Gentilnamen Acceptius zu ergänzen, derwie Acceptus in Gallien und Germanien weit ver-breitet war und dort auch in der Ableitung Accepti-nlas vorkam.'oSevernus hingegen ist laut Kajanto und M6csyüberhaupt nicht belegt; als Cognomen in der vierrenZeile kommt daher rutr Severinrzs in Frage - einName, der überall im Imperium Romanum, bevor-zugt aber in keltischen Gebieten, verbreitet war.,,Auch existieren im gallisch-germanischen Sprach-raum beliebig viele epigraphische Zeugnisse, beidenen Vokale, insbesondere das l, meist infolgeeines Steinmetzfehlers zwischen zwei Konsonantenausgelassen wurden, zum Beispiel Censorn(us)(CII- Xm 2978) Fausrn as (8050), Maxminus (3983,6486, 8862) etc.r2 Cognomina mir dem Suffix -inus/-ina, die wie Severinus nach Kajanto nur dreimalfür Mitglieder des Senatorenstandes und zweimalfür Sklaven und Freigelassene, ansonsten aberl5lmal von Männern und l6mal von Frauenbezeugt sind, waren, soziologisch gesehen, unterder plebs ingenua in der Kaiierzeii am weitestenverbreitet.,.Von den drei Buchstaben in der letzten sichtbarenZelle der Inschrift oberhalb der Bruchstelle ist mitSicherheit nur noch ein nach oben in die Mine der
eingemeißelt zu sein scheinen, sowie die obereHälfte des Buchstabens T dessen Längshaste unten
-eleichfalls nicht vollständig erhalten ist. Als Lesungkommt daher m. E. nur VET, eine geläufige Abkür-zung für vet(eranus), in Frage. Eine Formel wiev(oto)J(ecit), welche man an dieser Stelle erwartenkönnte, stimmt mit der zugegebenermaßen schwie-rigen Lesung nicht überein.'1 Auch kommen Vetera-nen als Dedikanten von Denkmälern zu Ehren desKaiserhauses in Obergermanien besonders häufigvor'', so daß die Auflösung der Inschrift mit anSicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lautet:
In h(onorem) d(omus) d(ivinae)I( ovi ) O ( primo ) M ( aximo )Accepti bz.w. Accepti( us )Sever(i )nusvet(eranus)
t- - -t ( ? )Vielleicht hat f'erner eine Weiheformel (2.8.v.s.l.l.m.) oder eine ab,qekürzte Verbform tür den
6 La datation des inscriptions latines dans les provincesoccidentales de I'Empire Romain d'aprös les formules»IN H(ONOREM) D(OMUS) D(IVINAE)« et »DEO,DEAE«. In: ANRW II 3 (Berlin, New York 1975)232ff .
7 H. Ankersdorfer, Studien zur Religion des römischenHeeres von Augustus bis Diokletian (Diss. Konstanz1973) r30.
8 Parallelen für die Voranstellung des gemeinsamen Gen-tilnamens bei Brüderpaaren, wobei ein doppeltes I alsEndung im Nominativ Plural regelmäßig ausfällt, findensich in CIL XIII6083,6093,6098, 6t44.7270 erc., wieüberhaupt Weihungen männlicher Familienmitglieder,speziell von Brüdern, nach Bauchhenß (Anm. l, 45 mitweiteren Belegen) im Zusammenhang mit Juppiter inObergermanien sehr häufig vertreten waren.
9 CIL XIII 2978: Censorn(us).10 Siehe den Namensindex von CIL XIILS, p. l; vgl. A.
M6csy, Nomenclator provinciarum Europae Latinarumet Galliae Cisalpinae cum indice inverso (Budapest1983) 2, wo im Gebiet der Gallia Beleica und der bei-den germanischen Provinzen fiLr Acieptlas 9 Belegeangeführt werden, für Acceptus sogar 18.
ll Severinus war nach dem Computerindex von M6csy(Anm. l0) 264 in der Narbonensis 6lmal. in der GalliaCisalpina und Hispanien je 38mal, in Gallien und Ger-manien lTmal vertreten. S
Latin Cognomina (HelsinkiDie Personennamen in der r(Heidelberg 1969) 295.
12 Siehe auch die Indices zu CIL XIII, p. 176 s. v. gram-matica (i-omissa).
l3 Kajanto (Anm. I I ) 257, vgl. 28 und 36 f.14 Zu möglichen Votivtbrmeln sowie Abkürzungen siehe
etwa R. Cagnat, Cours d'dpigraphie latine, (paris l9l4)468 ff.
15 Von den Inschriften des Heeres in h(onorem) d(omus)d(ivinae) entfielen nach der Studie von H. Ankersdorler(Anm. 7) 72 immerhin 39 % au|Vereranen.
Akt der Stiftung (2.B. p. für posuit) in einer nichterhaltenen sechsten Zeile am Ende der Inschriftgestanden, wenn nicht vorher noch der Truppenkör-per, in dem der Veteran gedient hatte, oder ein wei-terer Familienangehöriger des Acceptius Severinusgenannt war.
Offenbar bei derselben Grabung wurde im SchnittB aus dem Brunnenschacht des sog. Iunobrunnensein weiterer kleiner Weihestein. ebenfalls aus Sand-stein, zutage gefördert. Er war im Februar 1987weder im Magazin noch in der Ausstellung desMuseums in Darmstadt aufzufinden und ist ledig-lich in einer Notiz der Fundchronik des Landes-denkmalamtes aus dem Jahre 1955 kurz erwähnt.'oNur das Negativ eines Fotos (Al715) ist noch vor-handen und konnte vervielfältigt werden. Nach denAngaben auf einer Inventarkarte (Nr. A 1956:369,1), die auch eine Abschrift des Inschrifttextesenthält, handelt es sich um eine Votivplatte mit denMaßen 30 x 25 x 9,7 cm: der Text lautet:
In h(onorem) d( omus ) d( ivinae )
deae (lrcdera)
IunoniMART/VSP///////////////
Das Foto zeigt mindestens drei Fragmente einerWeihinschrift zu Ehren des Kaiserhauses und derGöttin Iuno. Während eine hedera die Lücke nachdem Dativ deae am Schluß der zweiten Zeile füllt.ist der Name der geehrten Göttin in der drittenZelledurch eine größere Buchstabenhöhe als in den übri-gen Zellen deutlich hervorgehoben und endet ausPlatzgründen mit einer i-longa. Ein Bruch machtden unteren Teil des gerahmten. vertiefien Inschrift-f'eldes unkenntlich. Von seinem unteren Rand ist
195
nichts mehr. von der vierten Zeile noch das meisteerhalten; lediglich der viertletzte Buchstabe ist voll-ständig herausgebrochen. Obwohl der exakte Buch-stabenabstand auf der Zeichnung der Inventarkartefehlt, kann man anhand des Fotos hinsichtlich dervierten Zeile mit Sicherheit sagen, daß der Stifter,der den Stein gesetzt hat, das in Obergermanienweit verbreitete Gentiliz Martius trug, wie es auchder Verfasser der Fundchronik, W. Jorns. vor-schlägt.r' Die obere Hälfte des AnfangsbuchstabensM und die rechte Schräghaste eines V vor demEndbuchstaben S sind trotz starker Spuren einerBeschädigung an der Bruchstelle erkennbar. Marti-us gehört zur Gruppe der theophoren Namen, unterdenen die von dem Kriegsgott Mars abgeleitetenam gebräuchlichsten waren und deren Namensträ-ger wie der Dedikant der vorausgegangenen In-schrift selten aus den höchsten oder untersten sozia-len Schichten stammten. sondern vielmehr in derbreiten Masse der freigeborenen Bevölkerungzuhause waren.'* Ein Nomen wie Martius, daszuweilen auch anstelle eines Cognomens _qebrauchtwurde, wäre als Namensfbrmel insbesondere fürPeregrine, die häufig, dem Cognomen entspre-chend, nur einen einzigen Namen trugen, in derspäten Kaiserzeit etwa ab Mitte des zweiten Jahr-hunderts durchaus denkbar. Ein P für das Prädikatp(osuit) steht am Ende der vierten Zeile und signa-lisiert, daß die Inschrift damit vollständig ist. Einevorläufige Lesung, die jedoch erst durch eineAutopsie am Original verifiziert werden könnte,weist diesen der Iuno geweihten Inschriftstein dem-nach als exaktes Pendant zum ersten, ebenfalls imLagerdorf Butzbach gefundenen an Iuppiter Opti-mus Maximus aus, von dem er sich allein durch sei-ne Größe und das Fehlen eines militärischenDienstgrades u nterscheidet.
Die militärhistorische Entwicklung des Limeska-stells Hunneburg bei Butzbach und seiner Besat-zung liefert erste Hinweise zum sozialen Umfeld,aus dem die Dedikanten stammren. sowie für eineDatierung der Inschrifien. In dem Limeskastell,dessen früheste Besetzung nach Ansicht der neue-ren Forschung nicht vor das Jahr 100/101 zurück-
16 Germania 33, 1955, 12l (W. Jorns in Fundchronik 1.4.1952-31.t2.t954).
l7 Für Martius (als einziger Name bzw. Cognomen) führtMdcsy (Anm. I0) 179 in der Belgica und Cermanien 17,für Martinus I I inschritiliche Zeugnisse an. Weit selte-ner und meist auch zu lang waren Namen wie Martiali-nius, Martialius, Martillus. Martinianus. Martinius, Mar-tinulus. Martiolus und Martionius.
l8 Siehe Kajanto (Anm. ll) 53ff. zu Bedeurung und Ver-breitung solcher Cognomina. t'erner ll? zur sozialenZusammensetzung der Namensträger.
Mratschek-Halfmann: Zwei Weihinschriften aus dem Lager Butzbach
196 Mratschek-Halfmann: Zwei Weihinschriften aus dem Lager Butzbach
reichtre, war erst in trajanischer Zeit die cohors IIRaetorum civium Romanorum stationiert, die vor_her ihren Standort in Wiesbaden hatte und an_schließend um 135 durch die cohors II AugustaCltrenaica equitata aus Heidelberg-Neuen-heimersetzt wurde, bevor etwa um die Mitte des zweitenJahrhunderts, sei es als Reaktion auf die Charteneinfälle in den sechziger und siebziger Jahrenoder als Vorsichtsmaßnahme des Antoninus piusgegen die unruhig werdenden Germanen, die ala
seine endgültige Größe; er lag 200 Meter vomKastell entfernt an der römischen Fernstraße undbesaß kleinstädtischen Charakter.ro Zwar war dasKastell bis zum Ende des Limes 260 besetzt, aberdas Lagerdorf wurde durch einen Alamanneneinfallim Jahre 233 so stark in Mitleidenschaft gezogen,daß sich daraus ein terminus ante quem fUr aie Ent-stehung der Inschriften ergibt.Onomastik und Formular der Inschriften lassen dar-über hinaus auf einen un_qefähren terminus postquem schließen. Unter Berücksichtigung desien,daß die Angabe der Filiation außer bei-Ehrenin_schriften ohnehin häufig weggelassen wurde, han_delt es sich bei der Verbindung von Nomen undCognomen in der ersten Inschrift um die seit derMitte des zweiten Jahrhunderts üblichste Namens_formel im Römischen Reich überhaupt. Was denDedikanten der zweiten Inschrift anbälangt, wäreein Einzelname nach der Constitutio Antöniniana
h.d.d., die in der Germania superior seit AntoninusPius vorkam und in der Severerzeit am weitestenverbreitet war.r, Damit stimmt überein, daß in einerKombination der Formel in h.d.d. mir einer Gottheitdie Bezeichrutng deus/dea vor dem Götternamenbis zur-Regierung des Septimius Severus grundsätz_Iich fehlte; der Zusatz cleus/dea in den- datiertenInschriften taucht zum erstenmal im Jahre 196 auf
entstanden sind.
dem Dedikanten der zweiten Inschrift handelt essich um einen anderen, möglicherweise einheimi-schen Einwohner der canabae. Daß neben Ange-hörigen des Heeres auch weite Kreise der Zivilbe-völkerung i wur-den, war in undder Alaman Ger-mania superior nichts Ungewöhnliches und sicher
denn inngen fürals ein-
aten derLegions- und Hilfstruppenlager, sondern von Zivili-sten, die in deren Umkreis lebten.,, Wenn der Vete-ran tatsächlich einem der beiden berittenen Hilfs_truppenkontingente angehörte, die im zweiten Jahr_hundert im Kastell Butzbach stationiert waren, hatteseine Dienstzeit mindestens 25 Jahre betragen. Ober den Altar zu Ehren des Kaiserhauses naöh Voll-endung seiner Dienstzeit am Tage seiner missiohonesn oder zu einem späteren Zeitpunkt auseinem anderen Anlaß stiftete, muß offen bleiben.Fest steht jedoch, daß Weihealtäre von diesemblockhaften Typus, wie ihn der dem Iuppiter Opti-mus Maximus geweihte mit der ungewöhnlichenquadratischer. patera aufwies, die Soldaten desrömisc.hen Heeres gewöhnlich vor Juppitergigan-tensäulen aufzustellen pflegten - einö- Sitte,-diegerade für Obergermanien charakteristisch war.r. Sowar es sicher kein Zufall, wenn auch im Lagerdorfvon Butzbach zusammen mit den Weihesteinen dieBruchstücke einer Juppitergigantensäule zutage tra-
l9 So B. Pferdehirt, Die römische Okkupation Germaniensund Rätiens von der Zeit des Tiberius bis zum TodeTrajans - Untersuchungen zur Chronologie südgalli_scher Reliefsigillata. Jahrb. RGZM 33, 1936, 275. bies.
Hilfstrup-1983,317;
ung der 2.
vermutete sie ersr 106, sah sich aber "".n ,?lo?ä1,ä1
die vorausgehende Zeit zwei unbekannte cihortei equi_tatae als erste Besetzung anzunehmen. Anders C. MUt_ler, Untersuchungen am Kastell Butzbach. Limesfor_schungen 2 (Berlin 1962) 25 ff. Er harre die Gründungdes Kastells bisher in die Zeit zwischen dem Chattenlkrieg unter Domitian und dem Satuminusaufstand g9datiert; vgl. auch D. Baatz in: D. Baatz und F. R. Herr_mann, Die Römer in Hessen (Sturtgart l9g2) 246.
20 D. Baatz (Anm. t9) 247 f .2l M.-Th. Raepsaet-Charlier (Anm. 6) 241 tt.22 Ebd.23 H. Ankersdorfer (Anm.71 70ff. Ahnliche Beobachtun_
gen hat P. nd -pfeiler in derrömischen r. deih. BonnerJahrb. 4l I on für die Juppi-terweihung UntergermanGngemacht.
24 P. Noetke (Anm.23) bes.273 und 361; vgl. G. Bauch_henß (Anm. 1) 15 und 42 tT.
ten, die ursprünglich vier Meter hoch war und alsBekrönung einen gefesselten, liegenden Gigantentrug, über den Juppiter hinwegritt.'5 Auf dem Vier-göttersockel sind Minerva und Herkules zu erken-nen, darüber befand sich eine fragmentarische Säu-lentrommel mit Nischen für die sieben Wochengöt-ter sowie eine einen Meter hohe Schuppensäule undein mehrstufiges korinthisches Blattkapitell miteinem Kopf in der Mittelfläche als Unterbau für dieBekrönung. Gesetzt den Fall, daß die archäologi-schen Uberreste nicht unmittelbar vom bäuerlichenAnwesen des Veteranen Acceptius Sever<i>nusstammen:6, können wir davon ausgehen, daß wirmit den drei Denkmälern, der Juppitersäule, demdem gleichen Gott geweihten, pfeilerhaft anmuten-den Altar und dem kleineren, seiner Gattin Iunogewidmeten Weihestein das Zentrum des Kaiser-kultes vor uns haben, wie ihn die in Butzbach sta-tionierte Auxiliareinheit pflegte. Das Vorbild dürf-ten mit ihren zahlreicheren und qualitätvollerenDenkmälern die großen Legionslager der Provinz.namentlich Mainz, abgegeben haben (sieheAnm.2). Die Verbreitung der einleitenden Formelin h.d.d., die unter den Severern ihre größte Dichtein Obergermanien erreichte, ging dabei zweifellos
197
einher mit einer bewußten Intensivierung des Kai-serkultes und seiner schrittweisen Ausdehnung aufdas gesamte Herrscherhaus, die domus div,ina, injener Epoche, in der seit Marc Aurel die Kaiserinals mater castrorum, seit Pertinax als Augusta undseit den Severern schließlich als mater castrorum etsenatus et patriae geehrt wurde.2' Juppitergigan-tensäule, Altar und Votivplatte aber, womit das Kai-serhaus im Verein mit den höchsten Staatsgötternder kapitolinischen Trias, Juppiter, Juno und Miner-va, auch in den Auxiliarkastellen verehrt wurde,fügen sich nahtlos in eine Reihe mit den im Verlaufdes zweiten Jahrhunderts immer zahlreicher wer-denden, in die sakrale Sphäre gerückten Loyalitäts-bekundungen des Heeres und der in seinem Um-kreis lebenden zivilen Provinzbevölkerung gegen-über dem Herrscher ein.
W. Jorns (Anm. 16) l2l und G. Bauchhenß (Anm. l)I I I f., Nr. 100-103 mit Taf. 10. 2 und I l. l.Freundlicher Hinweis von R. Wiegels (Osnabrück).
Zur Titulatur der Kaiserinnen siehe Dio 71. 10. 5 (AnniaGaleria Faustina); 13,1 , I f. (Flavia Titiana) und CIL VI1035 (Iulia Domna).
Mratschek-Halfmann: Zwei Weihinschriften aus dem Lager Butzbach
25
2621
ANSCHRIFTEN DER AUTOREN
Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola,Fichtenstraße 2. 65468 Trebur.
Dr. Sigrid Duchhardt-Bösken.Erlenallee 8c. 48155 Münster.
Dr. Baron Ludwig Döry,Unterli ndau 31. 60323 Frankfurt.
Dr. Wolf Goeltzer.Hohenzollernstraße 7, 70178 Stuttgart.
Dr. Jürgen Krome.Oberstudienrat. Arndtstraße 30, 44135 Dortmund.
Susanna Künzl.Auf dem Stielchen 26.55130 Mainz.
Eberhard Link.Glashütte Budenheim, 55253 Budenheim.
Eberhard Lippmann.Hanoier Straße 6/43. 99091 Erfurt.
Dr. Sigrid Mratschek-Halfmann.Seminar tür Griechische und Römische Geschichte, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität. Gräfstruße 76 VI, 60486 Frankfurt.
Dr. Hans-Rudolf Neumann.Nahestraße 4. 55457 Gensingen.
Dr. Rudolf Steffens,Insritut tür Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Abt. II: Sprach- und Volkstbrschung,
Pfeiffer-Weg 3, 55099 Mainz.
Dr. Gudula Zeller.Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologische Denkmalpflege, Große Bleiche 49-51. 55116 Mainz.