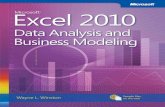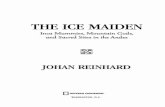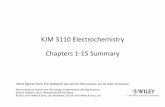Chapters 1-6 and 13 in: Für die Ewigkeit geschaffen. Die Särge des Imeni und der Geheset, Mainz...
Transcript of Chapters 1-6 and 13 in: Für die Ewigkeit geschaffen. Die Särge des Imeni und der Geheset, Mainz...
VERLAG PHILIPP VON ZABERN
Auch heute noch sind Entdeckungen unversehrter Gräber in Theben/West mög-lich. Im Oktober 2004 stießen Mitarbeiter des Deutschen Archäologischen
Instituts in der Nekropole Dra‘ Abu el-Naga auf Überreste eines fast ungestörtenEnsembles zweier reich dekorierter Holzsärge. Der äußere Sarg ist für einen Rich-ter namens Imeni angefertigt worden, der kleinere innere Sarg gehörte einer Damemit Namen Geheset (»Gazelle«). Aus Anlaß der 100-Jahrfeier des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo im November 2007 werden die Ergebnisse derEinzeluntersuchungen zu den Särgen erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.Der Leser des fast durchgehend farbig illustrierten Bandes nimmt teil an der Ent-deckung und Bergung der Särge. Texte und Dekorationen werden zum Sprechengebracht. Er berichtet über die menschlichen Überreste der Geheset, über die zumBau der Särge benutzten Holzarten und durchgeführte Restaurierungsmaßnahmen.
X, 139 Seiten mit 10 Schwarzweiß-, 170 Farbabbildungen, 2 Karten und DVD
Philipp von Zabern
Für dieEwigkeit
geschaffen
DA N I E L P O LZ ( H R S G .)
DI E SÄRG E D E S I M E N I U N D D E R G E H E S ETFür
die
Ewig
keit
gesc
haff
enD
AN
IEL
PO
LZ
(H
RS
G.)
für die Ewigkeit RZ neu 14.08.2007 11:35 Uhr Seite 1
FÜR DIE EWIGKEIT GESCHAFFENDie Särge des Imeni und der Geheset
Daniel Polz (Hrsg.)
inklusive DVD �
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite I
FÜR DIE EWIGKEIT GESCHAFFENDie Särge des Imeni und der Geheset
Daniel Polz (Hrsg.)
Verlag Philipp von Zabern
MIT BEITRÄGEN VON
Antonio LoprienoSandra Lösch / Albert R. Zink / Stefanie Panzer /Estelle Hower-Tilmann / Andreas G. NerlichReinder Neef / Viola PodsiadlowskiErico PeintnerUte RummelAnne Seiler
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite III
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-lierte bibliografische Daten sind im Internet über<http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
© 2007 by Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein
ISBN: 978-3-8053-3794-6
Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremdeSprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmi-gung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buchoder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photo-kopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen oder unter Verwen-dung elektronischer Systeme zu verarbeiten und zuverbreiten.
Gestaltung: Melanie Barth, scancomp GmbH,Wiesbaden
Printed in Germany by Philipp von ZabernPrinted on fade resistant and archival quality paper (PH 7 neutral) · tcf
X, 139 Seiten mit 10 Schwarzweiß-, 170 Farbabbildungen,2 Karten und DVD
Herausgeber: Daniel Polz
Redaktion: Daniel Polz, Jessica Schrinner, Nicole Kehrer
Photos: Peter Windszus, Daniel Polz, Erico Peintner
Zeichnungen: Pieter Collet (Pläne, Aquarelle),Anne Seiler/Susanne Michels (Keramik)
Dokumentarfilm: Michael Leuthner, Daniel Polz
Virtuelle Animation des Grabungsgeländes:Manja Maschke, Daniel Polz
Umschlag vorne: Das Udjat-Augenpaar im Inneren desImeni-Sarges.
Frontispiz: Detail der Dekoration des Imeni-Sarges.
Umschlag hinten: Das Udjat-Augenpaar auf der Außen-seite des Geheset-Sarges.
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite IV
Vorwort
Einleitung
KAPITEL 1 Historisches Umfeld Daniel Polz
KAPITEL 2 Die Nekropole von Theben vor dem Tal der Könige Daniel Polz
KAPITEL 3 Die Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Dra‘ Abu el-NagaDaniel Polz
KAPITEL 4 Die Grabanlage der Geheset und die Entdeckung der SärgeDaniel Polz
KAPITEL 5 Die Bergung des SargensemblesDaniel Polz
KAPITEL 6 Die Särge des Imeni und der GehesetDaniel Polz
KAPITEL 7 Texte für das Jenseits: Die Inschriften der Särge des Imeni und der GehesetAntonio Loprieno
KAPITEL 8 Auferstehung und Versorgung im Jenseits:Die bildlichen Darstellungen im Sarg des Imeni Ute Rummel
KAPITEL 9 Geschichte in Scherben:Die tönerne Grabausstattung der Geheset Anne Seiler
KAPITEL 10 Eine Nubierin in Ägypten? Anthropologisch-paläopathologische Untersuchungen an den menschlichen Überresten der Geheset
Sandra Lösch, Albert R. Zink, Stefanie Panzer, Estelle Hower-Tilmann und Andreas G. Nerlich
VII
IX
1
5
14
25
43
59
70
81
91
100
Inhalt
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite V
KAPITEL 11 Baumaterial für das Jenseits: Holzanatomische UntersuchungenReinder Neef und Viola Podsiadlowski
KAPITEL 12 Ein Sargensemble überdauert die Zeit: Restaurierung und Konservierung der Särge Erico Peintner
KAPITEL 13 „Ein schönes Begräbnis im Westen“:Leben und Tod einer Ägypterin im 18. Jahrhundert v. Chr.Daniel Polz
Bemerkungen zur DVD
Danksagungen
Autoren und Mitarbeiter dieses Bandes
Abbildungsnachweis
Zeittafel
Karte von Ägypten
Karte der Thebanischen Nekropole
DVD in Tasche
107
112
122
127
129
131
132
133
137
138
�
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite VI
Dieser Band ist eine erste zusammenfassende Ver-öffentlichung zweier dekorierter Holzsärge, dieim Oktober 2004 in einer Grabanlage des Fried-hofs der altägyptischen Metropole Theben, derheutigen Stadt Luxor, entdeckt wurden. Für dieseerste Publikation der Särge wurde bewußt einFormat gewählt, welches sich nicht ausschließ-lich an eine wissenschaftliche Leserschaft wendet,sondern als „Zielgruppe“ den an der Kulturge-schichte des Alten Ägypten interessierten, nicht-wissenschaftlichen Leserkreis im Auge hatte. DieGründe dafür liegen auf der Hand: Während sichdie wissenschaftliche Publikation auf eine kom-plette und damit sehr ausführliche Darstellungund Bearbeitung aller archäologischer, epigraphi-scher, philologischer, kunstgeschichtlicher undweiterer Aspekte zu konzentrieren hat und dabeifür den Nicht-Fachmann notwendigerweise zueiner eher trockenen Angelegenheit geraten kann,stellt eine an den interessierten Laien gerichteteVeröffentlichung die wesentlichen Ergebnisseeiner modernen archäologischen Ausgrabung inanschaulicher und verständlicher Weise dar.
Daß der vorliegende Band das Ergebnis einerintensiven Zusammenarbeit von Kollegen derunterschiedlichsten Fachrichtungen ist, geht be-reits aus dem Inhaltsverzeichnis hervor; was dieEntdeckung der Särge und ihre Bearbeitung ein-zelnen Personen und Institutionen verdankt, wirdausführlich in den Danksagungen am Ende desBandes aufgeführt.
An dieser Stelle seien deshalb diejenigen ge-nannt, die wesentlich an der Entdeckung derSärge und ihrer anschließenden Bearbeitung bishin zu ihrer Veröffentlichung in diesem Band be-
teiligt waren. Zunächst ist hier der ägyptischenAntikenverwaltung (SCA) und ihrem chairman,Zahi Hawass, herzlich für alle Unterstützungwährend der letzten Jahre zu danken. Sodann giltmein Dank dem Präsidenten des Deutschen Ar-chäologischen Instituts, Hermann Parzinger, fürdie Bereitstellung von Sondermitteln für die kon-servatorische Behandlung der Särge sowie demDirektor der Abteilung Kairo des Instituts, Günter Dreyer, für die längerfristige Abstellungdes Instituts-Photographen, Peter Windszus, der über mehrere Monate mit der photogra-phischen Dokumentation der Särge beschäftigtwar.
Ein besonderer Dank gebührt zum einen EricoPeintner, dessen immense restauratorische Kennt-nis und Erfahrung von unschätzbarer Hilfe beider Bergung, Konservierung und Dokumenta-tion der Särge war; zum anderen Peter Windszus,der mit seinem künstlerischen Einfühlungsver-mögen die grandiosen photographischen Aufnah-men der beiden Särge schuf; und schließlich den„Qurnauis“, unseren lokalen ägyptischen Mitar-beitern, deren enormer Erfahrung und Enga-gement es zu verdanken ist, daß die Särgeunbeschadet von ihrer Grabkammer in das Maga-zin des SCA gelangt sind. Stellvertretend für alleQurnauis möchte ich mich herzlich bei ihremVorarbeiter (rais) Mohammed Hassan sowie beiHassān Ahmed Taher, Mohammed Ahmed Taherund Sayed Ahmed Mas‘ud bedanken.
Dem Verlag Philipp von Zabern und seinenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern sei hier fürihr Engagement, ihre Sorgfalt und Geduld beider Herstellung dieses Bandes gedankt.
KAIRO, IM MÄRZ 2007
Vorwort
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite VII
Die beiden in diesem Band vorgestellten deko-rierten Holzsärge eines altägyptischen Würden-trägers namens Imeni und seiner vermeintlichenEhefrau Geheset stellen aus mehreren Gründeneine Besonderheit in der Archäologie des AltenÄgypten dar: Neben der Tatsache, daß sie an ex-akt dem Ort entdeckt wurden, an welchem mansie vor etwa 3750 Jahren deponierte, sind dieSärge – abgesehen von einigen durch Grabraubverursachten Schäden – nahezu perfekt erhalten.Zudem ließen sich trotz der zerstörerischenAktivitäten der Grabräuber noch einige Reste deralten Bestattung finden, wie etwa Teile derGrabausstattung, der Lebensmittelbeigaben undder Keramik sowie die menschlichen Überresteder einst im inneren Sarg bestatteten Geheset.Insgesamt ergibt sich somit ein Befund, der rechtweitreichende Aussagen nicht nur zu den Särgen,ihren Inschriften und ihrer Dekoration erlaubt,sondern auch zu den Vorgängen während derBestattung, zu den Beigaben und der Architekturder Grabanlage sowie der darin bestattetenPerson. Ein solcher Befund ist in Ägypten rechtselten, denn die genaue Herkunft der meistenSärge dieser Zeit in den Museen und Samm-lungen der Welt ist häufig unklar. In der Regelfehlen nähere Angaben zur Architektur der Grab-anlagen, den Grabbeigaben oder den bestattetenPersonen.
Hinzu kommt eine weitere Besonderheit diesesarchäologischen Befundes, welche die einstigeBenutzung der beiden Särge betrifft: Der äußereSarg, der den inneren Sarg der Geheset aufnahm,war ursprünglich nicht für Geheset bestimmt,sondern für Imeni angefertigt worden. Dies er-möglicht uns einen Einblick in einen besonderenEinzelfall altägyptischer Bestattungsvorstellungenund -praktiken.
In den folgenden 13 Kapiteln werden verschie-dene Aspekte der beiden Särge vorgestellt. Damitsoll versucht werden, sie nicht isoliert – gewisser-maßen als museale Einzelobjekte – zu betrach-ten, sondern sie in ihrem alten (d. h. altägyp-tischen) und ihrem modernen (d. h. archäo-logischen) Kontext zu präsentieren. Die beidenersten Kapitel enthalten kurze Einführungen in dashistorische und topographische Umfeld der Särgeund ihres Fundortes. In den Kapiteln 3 und 4werden die archäologische Unternehmung desDeutschen Archäologischen Instituts Kairo in derNekropole von Theben vorgestellt sowie das en-gere Ausgrabungsareal, in welchem die Särge ent-deckt wurden. Das folgende Kapitel 5 schildertdie eigentliche Entdeckung und die Bergung derSärge, während sich Kapitel 6 mit einer kurzenBeschreibung derselben beschäftigt. Kapitel 7enthält eine zusammenfassende Beschreibungund Deutung der umfangreichen religiösen Textevor allem des Imeni-Sarges, in Kapitel 8 werdendie bildlichen Darstellungen dieses Sarges vorge-stellt und besprochen. Von großer Bedeutung fürdie chronologische Einordnung der Bestattungder Geheset sind die in Kapitel 9 behandel-ten Keramikgefäße, welche Geheset mitgegebenwurden und deren Inhalt der Sicherung ihrerjenseitigen Existenz diente. Die Untersuchungenan den menschlichen Überresten der Gehesetund deren Ergebnisse sind in Kapitel 10 thema-tisiert. Kapitel 11 führt die für die Herstellungder beiden Särge verwendeten Holzarten auf, inKapitel 12 werden aus konservatorischer Sichtzunächst der Zustand der Särge bei ihrerAuffindung, sodann die an ihnen durchgeführ-ten restauratorischen und konservatorischenMaßnahmen beschrieben. Im abschließendenKapitel 13 werden einige der zuvor präsentierten
Einleitung
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite IX
X EINLEITUNG
Einzelergebnisse zusammenfassend interpretiertund es wird der Versuch einer vorläufigen Beur-teilung des Gesamtbefundes unternommen.
Die Hauptakteure in diesem Band sind zwei-fellos Imeni und Geheset. Leider kennen wirbeide nur von ihren Särgen, weitere Objekte oderMonumente, die ihnen zuzuweisen oder aufdenen sie genannt wären (wie etwa Stelen), sindbislang nicht bekannt. Namen und Titel der bei-den helfen hier nicht weiter: Imeni führt miteiner Ausnahme in den Inschriften seines Sargesstets nur den recht unspezifischen Titel„Richter“, einmal nennt er sich „Vorsteher derSchreiber“. Sein Name – eine verkürzte Form desNamens Amenemhat („[der Gott] Amun ist ander Spitze“) – ist insbesondere zur Zeit desMittleren Reiches überaus häufig. Der Name derGeheset („Gazelle“) ist demgegenüber relativ
selten, nicht so aber der einzige Titel, den sie inden Inschriften ihres Sarges trägt: Als „Haus-herrin“ werden im Alten Ägypten in der RegelEhefrauen bezeichnet, die ansonsten keine wei-teren Titel- oder Berufsbezeichnungen führen.
In pharaonischer Zeit war es der größteWunsch der Ägypter und ein Ziel des Totenkultes,die Namen der Verstorbenen zu „beleben“. Diesgehörte zu den primären Aufgaben der Personen,die den Totendienst für die Verstorbenen durch-führten, meist eben die Nachkommen, aberdurchaus auch angestellte Priester. Ob und vonwem der Totendienst für Imeni und Geheset indiesem Sinn durchgeführt wurde, ist uns nicht be-kannt. Der vorliegende Band soll aber dazu beitra-gen, die Namen von Imeni und Geheset (wieder)zu beleben.
A_VORSPANN.qxd 30.07.2007 13:42 Uhr Seite X
Die in diesem Band vorgestellten Särge des Imeniund der Geheset sind im späteren MittlerenReich bzw. der beginnenden Zweiten Zwi-schenzeit, oder genauer: im Zeitraum zwischender zweiten Hälfte der 12. und dem ersten Drit-tel der 13. Dynastie in der oberägyptischen StadtTheben angefertigt und letztlich für die Bestat-tung der Geheset benutzt worden. In absolutenDaten entspricht dieser Zeitraum maximal den150 Jahren von 1890–1740 v. Chr. Diese Datie-rung ergibt sich aus verschiedenen Merkmalen,die eine grobe chronologische Einordnung derSärge einerseits und der Bestattung der Geheset
andererseits erlauben und die im einzelnen in denfolgenden Kapiteln zur Sprache kommen. Umdie Särge und die Bestattung der Geheset in ihrengeschichtlichen Rahmen zu setzen, soll im Folgen-den ein kurzer zusammenfassender Überblicküber die geschichtliche Entwicklung Ägyptens biszu dieser Zeit gegeben werden1.
Die historische Entwicklung der pharaoni-schen Zeit Ägyptens wird im Allgemeinen alseine Art Kontinuum aufgefaßt, welches sich, soscheint es, relativ einfach definieren läßt. Dies ge-schieht in der Regel über das Herausheben einerReihe von Phänomenen, deren Entwicklungen
KAPITEL 1
Historisches UmfeldDaniel Polz
Abb. 1Ausschnitt aus dem Turiner Königspapyrus mit den Spalten VIund VII in hieroglyphischer Um-schrift. Die Spalte VI verzeichnetin den beiden Einträgen rechtsoben die letzten Herrscher der12. Dynastie, Amenemhat IV. undKönigin Nefru-Sobek, derenjeweilige Regierungslängen aufden Tag genau angegeben sind – bei Amenemhat IV. etwasind 9 Jahre, 3 Monate und 27 Tage aufgezählt. Die nächsteZeile enthält eine Summen-angabe der gesamten Regie-rungsdauer aller Könige der 12. Dynastie (213 Jahre, 1 Monatund 17 Tage). Der Rest der Spalte und die folgende Spalte VIIlisten zum Teil kaum bekannteKönige der frühen ZweitenZwischenzeit auf (ÄgyptischesMuseum Turin).
KAPITEL 1.qxd 30.07.2007 13:44 Uhr Seite 1
2 DANIEL POLZ
Abb. 2Detailaufnahme einer lebensgroßen Sitzstatue desHerrschers Nebhepetre Mentu-hotep aus einer Schachtanlagevor seinem Tempel in Deir el-Ba-hari/Theben-West (ÄgyptischesMuseum Kairo).
sich von vorgeschichtlicher bis in die Ptolemäer-zeit verfolgen lassen und welche die aufeinander-folgenden Perioden über knapp 3000 Jahre hinmiteinander verbinden. Neben dem über dengesamten Zeitraum nahezu gleichbleibenden geo-graphischen Kernbereich des alten Ägypten,nämlich dem Raum zwischen der Mittelmeer-küste des Nildeltas im Norden und dem erstenNilkatarakt im Süden, sind es die aufeinan-derfolgenden Entwicklungsstufen derselben Spra-che und derselben religiösen Grundvorstellungen,die dieses Bild eines „Kontinuums“ prägen. Ver-mutlich war auch den alten Ägyptern ein ähnli-ches Bild nicht ganz fremd: Während derpharaonischen Zeit läßt sich spätestens ab derRamessidenzeit im 13. Jh. v. Chr. eine Art „Ge-schichtsbewußtsein“, oder besser: das Bewußtseineiner kulturellen Identität, feststellen, welches u. a. auch zur Erstellung der großen Königslistenund des sog. Turiner Königspapyrus führte
(Abb. 1)2. Doch bereits in den Jahrhundertendavor muß ein ähnliches, vielleicht weniger expli-zit ausgedrücktes Bewußtsein der eigenen Ver-gangenheit bestanden haben, sonst hätten denKompilatoren der Königslisten ab der Ramessi-denzeit nicht die grundlegenden Daten für dieZeit ab dem Alten Reich zur Verfügung gestan-den. Anders läßt sich jedenfalls die bemerkens-werte Genauigkeit weder der Königslisten inköniglichem wie privatem Kontext noch etwajener fiktive, aber relativ-chronologisch erstaun-lich korrekte, bis in die 11. Dynastie zurück-reichende Stammbaum eines Priesters aus derZeit der 22. Dynastie erklären.
Die historische Entwicklung der dynastischenZeit des alten Ägypten läßt sich – stark verkürzt –folgendermaßen beschreiben: Nach einem zu-meist „Reichseinigung“ genannten und vermut-lich mit kriegerischen Aktionen verbundenenEreignis um etwa 3000 v. Chr. gelingt es einemwohl oberägyptischen Herrscher der Dynastie 0,sich zum „Vereiniger der beiden Länder“, d. h.zum Herrscher über Gesamtägypten zu erheben.Nach diversen Wirren und vielleicht kriege-rischen Auseinandersetzungen rivalisierenderGruppen am Ende der 2. Dynastie kommt es zuBeginn der 3. Dynastie unter König Djoser (ca.2680 v. Chr.) zu einer Konsolidierung des Kö-nigshauses und der Realisierung der ersten mo-numentalen Steinbauten Ägyptens. Unter KönigSnofru (ca. 2620 v. Chr.) erfolgt ein deutlicherund im ganzen Land zu verzeichnender Anstiegköniglicher Bauvorhaben sowie eine straffe Orga-nisation der Landesverwaltung. Die weitere Ent-wicklung führt zu einer ersten „Blütezeit“Ägyptens, der Pyramidenzeit des Alten Reichesmit den ausgedehnten Pyramidenfeldern vonGiza, Abusir, Sakkara und Dahschur.
Während der späten 5. und der 6. Dynastiewird eine kontinuierliche Schwächung der Zen-tralgewalt, d. h. des politischen Einflusses desHerrscherhauses greifbar. Diese ist als Folge u. a.der Erstarkung regionaler und von der Residenzim Norden weit entfernt amtierender Fürstenge-schlechter anzusehen. Die weitere Macht- undEinflußverschiebung zugunsten dieser Lokal-potentaten führt am Ende der 6. Dynastie (um2200 v. Chr.) zu einer nahezu vollkommenenAuflösung der Zentralgewalt sowie einer Parzel-lierung des Landes in mehrere regionale und
KAPITEL 1.qxd 30.07.2007 13:44 Uhr Seite 2
HISTORISCHES UMFELD 3
lokale Zentren, die von den sog. Gaufürsten mitunterschiedlich großem Wirkungsbereich regiertwerden. In der älteren Literatur wird diese die 8. bis 10. bzw. frühe 11. Dynastie umfassendeErste Zwischenzeit oft mit dem Prädikat „chao-tisch“ versehen und als ihr Hauptmerkmal einallgemeiner Niedergang auf politischer, wirt-schaftlicher, sozialer, geistesgeschichtlicher undreligiöser Ebene konstatiert. Diese Einschätzunghat sich erst in den letzten Jahren und vor allemdurch die Untersuchungen von S. J. Seidlmayergrundlegend gewandelt: Von einem Niedergangin der beschriebenen Breite kann keine Rede sein,vielmehr lassen sich deutlich Zeichen für eine aufregionaler Ebene durchaus prosperierende Zeitfinden3.
Dies wiederum führt während der teilweisegleichzeitigen 10. und 11. Dynastien in mehrerenregionalen Zentren Ägyptens zur Etablierung vongefestigten Machtstrukturen. Wenigstens zweidavon werden gegen Ende dieser Zeit durchAusdehnung ihres jeweiligen Einfluß- undMachtbereiches zu rivalisierenden Kräften, dieunterägyptische 10. (Herakleopoliten-) und diethebanische 11. (Intef-)Dynastie. Nach offen-sichtlich heftigen kriegerischen Auseinander-
setzungen zwischen den beiden Rivalen gelingtes dem thebanischen Herrscher NebhepetreMentuhotep um 2020 v. Chr., den amtierendenHerakleopolitenkönig Cheti zu entmachten undseinen eigenen Herrschaftsanspruch über ganzÄgypten auszudehnen – Mentuhotep gilt denalten Ägyptern wie den modernen Ägyptologenals Herrscher, der zusammenfügt, was zusam-mengehört, als „(Wieder-)Vereiniger der beidenLänder“ (Abb. 2). Ein ausgedehntes Baupro-gramm und diverse Expeditionen belegen dieumfangreichen Tätigkeiten des Königs, der dieGrundlagen für die zweite Blütezeit Ägyptens,das Mittlere Reich, die (ausgehende) 11. und die12. Dynastie, schuf.
Die noch unter dem ersten Herrscher der 12. Dynastie, Amenemhat I., als politisch not-wendig erachtete Verlegung der königlichen Residenz und offenbar des gesamten Hofstaatesvon der Metropole Theben in die Stadt Itj-Tauibei Lischt ging einher mit einem bewußtenRückgriff auf theologische und architektonischeVorstellungen des Alten Reiches. Dies zeigt sichz. B. an der Gestaltung der königlichen wie pri-vaten Grabanlagen – die während der gesamten11. und frühen 12. Dynastie in Theben benutzte
Abb. 3Pyramide des Königs Amenem-hat III. in Dahschur (12. Dyna-stie). Ihr heutiges Aussehenverdankt die Pyramide einemmassivem Raub ihrer einstigenVerkleidung aus Kalkstein-blöcken, die den Pyramidenkernaus Lehmziegeln umgab.
KAPITEL 1.qxd 30.07.2007 13:44 Uhr Seite 3
4 DANIEL POLZ
spezifische Grabform des Saff-Grabes wurde ab-rupt ersetzt durch die traditionellen regionalenFormen der Pyramide bei königlichen (Abb. 3)und der Mastaba bei privaten Grabbauten.
Die fast 200 Jahre andauernde 12. Dynastie(ca. 1976–1794 v. Chr.) ist geprägt von einerReihe sehr aktiver und machtvoller Herrscherge-stalten. Dies findet seinen Niederschlag in einerexpansiven Außenpolitik, mit welcher die süd-liche Grenze Ägyptens bis jenseits des 2. Nilkata-raktes verschoben wird, in einer intensivenlandesweiten Bautätigkeit und, damit zusammen-hängend, in immens personal- und materialauf-wendigen Expeditionen in die Steinbruch- undGoldminengebiete der östlichen Wüste undschließlich in einer straffen (Neu-)Organisationder innerägyptischen Verwaltung. Letzterer fal-len – wenn auch erst unter Sesostris III. – Machtund Privilegien der mittelägyptischen Gaufürstenzum Opfer, den letzten Nachkommen der loka-len Potentaten der Ersten Zwischenzeit.
Bis weit in die folgende 13. Dynastie (ca.1794–1649 v. Chr.) hinein scheint sich zunächstan der Struktur der politischen Machtverhältnissenicht allzuviel geändert zu haben, selbst die admi-nistrativen Abläufe in den ägyptischen Forts inNubien spiegeln keine grundsätzlich veränderteSituation wider. Erst allmählich, zur Mitte der13. Dynastie hin, verliert die Zentralgewalt anEinfluß in Nubien und sieht sich zugleich miteiner Einwanderungsbewegung aus Vorderasienkonfrontiert, der sie letztlich nur mehr wenig ent-gegenzusetzen hat. Ab diesem Zeitpunkt scheintsich der Hof in Itj-Taui oder Memphis tatsächlichaufzulösen und nach Oberägypten zu verlagern.Jetzt beginnt allmählich der eigentliche Zerfallder Zentralmacht, der etwa zur Mitte dieser weitüber 200 Jahre währenden Zweiten Zwischenzeitzu einer erneuten Parzellierung Ägyptens führt,in der mehrere politische Machtzentren auf re-gionaler Ebene teilweise gleichzeitig bestehen.Am Ende dieser Zwischenzeit steht ein Ereignis,welches allgemein als Markierung des Beginns
des Neuen Reiches betrachtet wird, die „Vertrei-bung der Hyksos“. Wieder schaffen militärischeAktionen die Grundlage für die weiteren Ent-wicklungen und ermöglichen, wie es gelegentlichformuliert wurde, den „Aufstieg Ägyptens zurWeltmacht“, d. h. die Blütezeit des Neuen Rei-ches.
Dies ist zusammengefaßt das weitere histori-sche Umfeld der Särge des Imeni und der Gehe-set; für viele der in den folgenden Kapitelnangestellten Überlegungen ist es wichtig daraufhinzuweisen, daß Theben zu der Zeit, in der dieSärge hergestellt und benutzt wurden, nicht daspolitische und wirtschaftliche Zentrum des Lan-des war. Die königliche Residenz und der Hof-staat befanden sich wie die königlichen und diegroßen privaten Nekropolen im Norden des Lan-des. Theben war zu dieser Zeit sicher nicht mehrals eine bedeutendere Provinz-Metropole, in deraber durchaus in mancher Hinsicht eigene Wegegegangen wurden – so etwa bei der Konzeptionreligiöser Texte (siehe Kap. 7).
Anmerkungen
1 Siehe grundlegend J. von Beckerath, Chronologie des pha-raonischen Ägypten,Münchner Ägyptologische Studien 46,Mainz 1997; vgl. D. Polz, Der Beginn des Neuen Reiches.Zur Vorgeschichte einer Zeitenwende, Sonderschriftendes Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 31, Berlin2007, S. 1–3.
2 J. Assmann, Stein und Zeit. Mensch und Gesellschaft imalten Ägypten, München 1991,S.305–308; vgl.E.Hornung,Geschichte als Fest.Zwei Vorträge zum Geschichtsbild derfrühen Menschheit, Darmstadt 1966, S. 14–22.
3 S. J. Seidlmayer, Gräberfelder aus dem Übergang vomAlten zum Mittleren Reich, Studien zur Achäologie undGeschichte Altägyptens 1, Heidelberg 1990.
KAPITEL 1.qxd 30.07.2007 13:44 Uhr Seite 4
Im Bewußtsein der heutigen Besucher der West-seite von Luxor wird das Bild der thebanischenNekropole weitgehend geprägt von den farben-prächtig ausgemalten Grabanlagen im Tal derKönige, von den gewaltigen Tempelanlagen derKönige des Neuen Reiches wie dem Terrassen-tempel der Hatschepsut oder dem Tempel Ram-ses’ III. von Medinet Habu sowie von den zahl-reichen mit Relief oder Malerei dekoriertenGräbern der hohen altägyptischen Würdenträger –allesamt Monumente, die während der Blütezeitdes Neuen Reiches, der 18. bis 20. Dynastie, zwi-schen 1550 und 1080 v. Chr. entstanden sind.Dabei war die Westseite Thebens bereits ein hal-bes Jahrtausend zuvor schon einmal der Bestat-tungsort für Könige, deren Familien und derenZeitgenossen. Die Friedhöfe dieser 11. Dynastie(ca. 2119 bis 1976 v. Chr.) konzentrieren sich aufzwei Gebiete der ausgedehnten Nekropole The-bens: In ihrem nördlichsten Bereich und direktgegenüber dem Tempel des Amun von Karnakgelegen befindet sich in dem heutigen Dorf el-Tarif der früheste Königsfriedhof Thebens, inwelchem sich mindestens die ersten drei Herr-scher der Dynastie bestatten ließen (Abb. 4–5und Karte der Thebanischen Nekropole am Endedes Bandes). In der zweiten Hälfte der 11. Dy-nastie wird dieser Ort als Königsnekropole auf-gegeben, und an einem neuen, bis dahin nahezuunberührten Platz errichtet der HerrscherMentuhotep Nebhepetre seine beeindruckendeGrab- und Tempelanlage.
In el-Tarif befinden sich drei gewaltige Felsgrä-ber, von denen wenigstens eines seit dem Fundeiner großen Königsstele im Jahre 1860 als könig-liche Grabanlage der frühen 11. Dynastie bekanntwar. Gleichwohl waren diese Anlagen auch nochüber ein Jahrhundert später nicht zusammenhän-
gend archäologisch untersucht. Dies änderte sicherst in den Jahren 1970–75, als das DeutscheArchäologische Institut Kairo unter der Leitungvon Dieter Arnold umfangreiche Ausgrabungs-und Vermessungsarbeiten an diesem Ort durch-führte1. Das ursprüngliche Ziel dieser Unterneh-mung war eine archäologische Untersuchung dergenannten Felsgräber sowie der sie umgebendenprivaten Grabanlagen, deren Erhalt durch dierapide Ausdehnung des modernen Dorfes starkgefährdet schien. Diese Befürchtung hat sich in-zwischen in traurigem Maße bewahrheitet: Etwaein halbes Dutzend großer Fürsten- und Königs-gräber und wohl 250 bis 300 private Grabanla-gen sind heute nicht mehr einer archäologischenAufnahme zugänglich, da sie vollständig von dermodernen Bebauung überdeckt und von derenFundamenten zum großen Teil zerstört sind.
Die Arbeiten des Instituts in el-Tarif galtenzunächst zwei Hauptinteressen: Zum einen sollteeine topographische Aufnahme der Gesamtne-kropole erfolgen, die die drei großen königlichenGrabanlagen sowie die zugänglichen, in derenUmgebung liegenden Privatgräber sowie alle wei-teren antiken Strukturen beinhaltete. Diese Ver-messung in Form einer Meßtischaufnahme imMaßstab 1:1000 wurde in den Jahren 1971–75von Josef Dorner durchgeführt und in zwei Blät-tern als topographische Karte in Vierfarbendruckpubliziert (ein Ausschnitt daraus ist in Abb. 5wiedergegeben). Sie stellt die bislang detailliertesteKarte eines Teils der Thebanischen Nekropole dar.Das zweite Hauptinteresse galt den drei größtenFelsgrabanlagen in el-Tarif, die in der Literaturschon seit längerer Zeit verschiedenen Königender 11. Dynastie zugeschrieben wurden. AuchArnold hatte bereits in einer früheren Studieaufgrund einer ersten Architekturaufnahme eine
KAPITEL 2
Die Nekropole von Theben vor dem Tal der KönigeDaniel Polz
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:47 Uhr Seite 5
6 DANIEL POLZ
Abb. 4Undatierte Luftaufnahme vomnördlichen Ende der theba-nischen Nekropole, die die Fried-höfe von el-Tarif und Dra‘ Abuel-Naga noch in relativ unbe-bautem Zustand zeigt. Da diesichtbaren Wege erst Ende der60 er Jahre des 20. Jh.s geteertwurden, muß die Aufnahme vordieser Zeit entstanden sein. Dasdurch viele kleine Vertiefungengekennzeichnete Gebiet in derBildmitte ist die Nekropole vonDra‘ Abu el-Naga; die große,längliche Struktur am rechtenBildrand ist eines der drei Königs-gräber der frühen 11. Dynastiemit seinem riesigen, in den Felsvertieften Vorhof. Am Frucht-landrand unten rechts liegt dervon einer massiven Umfassungs-mauer umgebene TempelSethos’ I. (19. Dynastie).
zeitliche Abfolge der Gräber und damit deren Zu-weisung an bestimmte Könige rekonstruiert – dieErgebnisse der nun erfolgten archäologischenTeilaufnahme der Gräber ergaben allerdings einegenau umgekehrte Reihenfolge2. Demnach wur-den die Grabanlagen nacheinander von Süd nachNord angelegt und spiegeln so auch die chrono-logische Abfolge der drei Herrscher mit den Na-men Intef Seher-Taui, Intef Wah-Anch und IntefNacht-Neb-Tep-Nefer wider. Von diesen warzweifellos König Intef Wah-Anch der Bedeutend-ste; in seiner Grabanlage fand der französische Ar-chäologe Auguste Mariette bereits 1860 die schonerwähnte königliche Stele, die wegen der auf ihrdargestellten Lieblingshunde des Königs allge-mein auch als „Hundestele“ bekannt ist (Abb. 6).Im Haupttext dieser Stele ist u. a. die Rede vonkriegerischen Unternehmungen, durch die Intef
Wah-Anch offensichtlich das von ihm kontrol-lierte Gebiet um Theben herum erfolgreich nachNorden ausdehnte. Hier deuten sich bereits dieunter einem seiner Nachfolger, König Mentuho-tep Nebhepetre, stattfindenden militärischenAuseinandersetzungen mit einem königlichenKontrahenten im Norden des Landes an, welcheschließlich zu einer Vereinigung Ägyptens unterMentuhotep führten.
Die Grabanlagen der Intef-Könige in el-Tarifweisen eine eigentümliche Architektur auf: Eingroßer, in den Felsboden vertiefter, offener Hof(von bis zu 300 m Länge) erhält an seinem öst-lichen Ende einen aus Ziegeln errichteten „Tor-bau“, in dessen Innenraum sich eine kleineKapelle befand. In den Grabungen des Institutsist es Arnold gelungen, den zur Hälfte von derheutigen Überlandstraße von Qena nach Esna
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:47 Uhr Seite 6
DIE NEKROPOLE VON THEBEN 7
überlagerten Torbau der Anlage des Intef Wah-Anch zu lokalisieren und seine einstige Architek-tur zu rekonstruieren. Von hierher stammt die„Hundestele“, von der Arnold einige weitere Teileentdeckte, u. a. wohl vom äußeren Rahmen derStele. Auch bei den beiden anderen Grabanlagensind an dieser Stelle ähnliche Torbauten zu erwar-ten, in denen ursprünglich ebenfalls königlicheStelen aufgestellt gewesen sein dürften. Am west-lichen Ende des gewaltigen Hofes findet sich eineDoppelreihe von zweimal 20 bis 24 aus dem Felsgearbeiteten Pfeilern, die diesem Grabtyp auchseinen Namen Saff-Grab gaben (saff ist das arabi-sche Wort für „Reihe“). Mittig in dieser Pfeiler-fassade öffnet sich im Anschluß an die durch diePfeilerreihen gebildete Halle der Eingang zur ei-gentlichen königlichen Grabstätte, in allen dreiFällen undekorierte Felsräume von eher beschei-denen Ausmaßen, die aber einst wohl größereSteinsarkophage enthielten. Dekoriert waren dieseGrabanlagen nur an wenigen Stellen: So wur-
den wohl gelegentlich an den Hofwänden klei-nere Stelen aufgestellt, vermutlich von Mitglie-dern des Königshauses, die ihre Grabanlagen ent-lang der Längsseiten des Hofes angelegt hatten.Oberhalb der Pfeilerfassade war eine Reihe kegel-förmiger Tonstifte in regelmäßigem Abstand an-gebracht, die mit ihrem spitzen Ende in eine derFelsfassade aufgesetzte Ziegelmauer eingesetztwaren. Ihre sichtbaren runden Enden (mit 10 bis20 cm Durchmesser) waren mit roter Farbe über-zogen und sollten die herausragenden Enden vonHolzbalken der Deckenkonstruktion von ländli-chen Wohnhäusern oder Gehöften imitieren3.Neben anderen Gründen erklärt sich auch hier-aus entwicklungsgeschichtlich die Herkunft derArchitektur dieser Grabanlagen: Man übernahmdas architektonische Grundkonzept eines profa-nen Hauses oder einer Gehöftanlage mit offenemHof und einer überdachten Pfeilerstellung vordem Hauseingang und setzte dies um in Stein –ein Gehöft für die Existenz im Jenseits.
Abb. 5Ausschnitt der in 1975 im Maß-stab 1:1000 gedruckten topogra-phischen Karte der Nekropolevon el-Tarif von Josef Dorner. Dieriesige Grabanlage in der Mitteist das Saff-Grab des HerrschersIntef Wah-Anch, die kleineren, rotgezeichneten Strukturen sindPfeilergräber seiner Zeitgenos-sen. Die hellbraun dargestelltenBauwerke geben den damaligenStand der modernen Bebauungin el-Tarif wieder.
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:47 Uhr Seite 7
8 DANIEL POLZ
Abb. 6Die sog. Hundestele des Herr-schers Horus Wah-Anch Intef(„der Große“) aus dem Torbauseines Saff-Grabes in el-Tarif.Neben dem großformatig dar-gestellten Herrscher sind einhoher namenloser Würdenträgersowie die fünf „Lieblingshunde“des Königs mit Nennung ihrerNamen abgebildet. Rekonstruk-tionszeichnung von GabrieleWenzel auf der Grundlage derFragmente im Museum Kairo.
Auffällig und für altägyptische Verhältnisseeher ungewöhnlich ist die Tatsache, daß sich dieArchitektur der nicht-königlichen Grabanlagengrundsätzlich nicht von jener der königlichen un-terscheidet: Auch die privaten Gräber bestehenaus dem in den Boden vertieften, offenen Hof,der Pfeilerfassade, dem dahinterliegenden Pfeiler-raum und dem anschließenden Grabinnenraum,welcher häufig über eine doppelte oder vierfachePfeilerstellung als Deckenstützen verfügt; ober-halb der Pfeilerfassade konnten rotgefärbte Ton-kegel angebracht werden und an den Wänden be-
fanden sich vereinzelt Stelen der Grabbesitzer.Einzig in den Dimensionen und der Anzahl derPfeiler liegt der Unterschied zwischen königlichund privat: Während die Breite der Fassaden beiden privaten Grabanlagen zwischen 8 und 25 mliegt und die Pfeileranzahl nur selten zehn über-steigt, weisen die drei Königsgräber Fassadenbrei-ten von 65 bis 79 m auf. Man ist versucht, diegeringen Unterschiede zwischen der Gestaltungder königlichen und privaten Gräber in diesemFriedhof der frühen 11. Dynastie jenseits derEbene der bloßen Architektur zu interpretieren.Schon Arnold äußerte die Vermutung, daß sichin der Architektur der Grabanlagen das sozialebzw. kulturelle Gefüge dieser Zeit widerspiegelnkönnte. Der thebanische König der frühen 11. Dynastie war vielleicht weniger Gott-gleichoder Gott-ähnlich und somit weit über dieSphäre seiner Untergebenen erhoben, sonderneher ein primus inter pares.
Der Friedhof von el-Tarif wurde für Gräberund Bestattungen von Privatleuten noch einigeZeit später, bis weit in die 12. Dynastie hinein,benutzt. Davon zeugen die dort gefundenenGrabstelen der hier bestatteten Personen. DieNachfolger der Intef-Könige und ein großer Teildes Hofstaates mit den hohen und höchstenBeamten dagegen wählten für die Anlage ihrerGrabbauten einen neuen, bis dahin recht weniggenutzten Bereich auf der thebanischen West-seite: Ein weiter Talkessel, in dem auch eines derbekanntesten und beindruckendsten Bauwerkedes Alten Ägypten liegt, der Terrassentempel derHatschepsut von Deir el-Bahari (das „nördlicheKloster“, benannt nach einer über den Ruinendes pharaonischen Tempels angelegten kopti-schen Klosteranlage). Über die Beweggründe fürdiesen „Umzug“ ist nichts bekannt, es ist aber da-von auszugehen, daß die natürliche Beschaffen-heit des Talkessels mit seiner nach Westen hinsteil ansteigenden Felswand als Hintergrund fürein höchst ehrgeiziges Bauprojekt eine gewisseRolle spielte (siehe die Karte der ThebanischenNekropole am Ende des Bandes). Es mag an die-sem ungemein beeindruckenden Ort auch einealte lokale Kultstelle für eine Ortsgottheit inForm einer Grotte oder Felsnische gegeben ha-ben – im Alten Ägypten durchaus häufiger Anlaßfür die Errichtung eines Heiligtums oder einesTempels. Am Fuße dieser Felswand jedenfalls ließ
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:47 Uhr Seite 8
DIE NEKROPOLE VON THEBEN 9
sich der bereits erwähnte König MentuhotepNebhepetre (ca. 2046–1995 v. Chr.) eine gewal-tige, in Terrassen angelegte Tempelanlage errich-ten, die auch den Eingang zu seiner Grabstätteenthielt (Abb. 7–8).
Die Tempelanlage war bereits seit der Mitte des19. Jh.s mehrfach das Ziel von meist unkontrol-lierten Ausgrabungen und Beraubungen. Erst zuBeginn des 20. Jh.s wurde die Anlage von demSchweizer Ägyptologen Eduard Naville im Auf-trag der englischen Egyptian Exploration Societyzwar systematisch, aber doch nur teilweise ausge-graben und veröffentlicht. Weitere Ausgrabungenfolgten in den 20er Jahren des letzten Jahrhundertsdurch den amerikanischen Archäologen HerbertE. Winlock für das Metropolitan Museum of Art in New York, die aber nur in kurzenBerichten publiziert wurden. Trotz der intensivenAusgrabungstätigkeit blieben grundsätzliche Fra-gen zur Architektur, Archäologie und Dekorationdes Tempels unbeantwortet, weshalb das Institutunter Dieter Arnold in den Jahren 1966–71 eineNachuntersuchung des Tempelareals unternahm,die allerdings zunächst eher als epigraphische,denn als archäologische Aufnahme geplant war.Erst die Entdeckung einiger von den früherenAusgräbern übersehener Objekte und das Auffin-den von zwei weiteren kleinen Kammern mitkleinen Holzmodellen machte weitere archäolo-gische Arbeit nötig. Arnold übernahm auch dieabschließende Publikation der früheren ArbeitenWinlocks nach dessen Aufzeichnungen4.
Die Arbeiten Arnolds an der Tempel- und Grab-anlage des Königs Mentuhotep ergaben eine Fülle neuen Materials und erlaubten die Beant-wortung vieler der offen gebliebenen Fragen. Eswurde beispielsweise deutlich, daß der Tempelüber einen längeren Zeitraum hinweg und inmehreren Bauphasen errichtet worden ist.
Die Tempelanlage zeigt eine höchst eigenwilligeArchitektur, die im Alten Ägypten ohne Paral-lele ist: Nachdem zunächst der Baugrund vordem eigentlichen Tempelareal eingeebnet wordenwar, errichtete man über einem stehengelassenenFelskern ein 60 auf 43 m messendes „Podium“von etwa 5 m Höhe, das auf seiner Nord-, Ost-und Südseite mit einem Mantel aus Kalkstein-quadern umgeben wurde. Auf dieses Podiumhinauf führt von Osten her eine lange Rampe,die seine Fassade in zwei (ungleiche) Hälften teilt.
Der Fassade ist nördlich und südlich der Rampejeweils eine Halle aus zwei Reihen von 2 mal 13 Pfeilern im Norden und 2 mal 10 Pfeilern imSüden vorgeblendet. Die Hallenböden sind miteinem Pflaster aus Sandsteinblöcken ausgelegt,die Pfeiler enthielten an ihrer Ostseite ein In-schriftfeld mit Titulatur und Namen des Herr-schers. Das Podium bildet die Terrasse für denKernbau, das sie umgebende „Ambulatorium“und die obere Pfeilerhalle, die auf drei Seiten umdas Ambulatorium herumführt. An der Ostseite,dem Nil zugewandt, besteht diese obere Pfeiler-
Abb. 7Blick auf den Mentuhotep-Tem-pel von oben (1983). Die deutlichsichtbaren kreisförmigen Vertie-fungen im Vorfeld des Tempelssind alte Gruben von Bäumen,die einst den Aufweg zum Tem-pel flankierten.
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:47 Uhr Seite 9
10 DANIEL POLZ
�Abb. 8Der Tempel des Königs Nebhe-petre Mentuhotep in Deir el-Bahari, Blick von Süden. DieAufnahme gibt den heutigenZustand des Tempels und seinererhaltenen Bauteile wieder.Vergleiche hierzu die Rekon-struktionsvorschläge in Abb. 9.
�Abb. 9Zwei Rekonstruktionsvorschlägefür den oberen Abschluß desMentuhotep-Tempels. Oben D. Arnolds Vorschlag eines kubi-schen Blocks, unten der einerkleinen, mit Kalkverputz oderSteinblöcken verkleideten Lehm-ziegel-Pyramide (nach D. Polz).
�Abb. 10Die Pfeilerfassade der Saff-Grab-anlage des Siegelbewahrers und Generals Intef (TT 386) nachdessen Freilegung.
halle aus 2 mal 24 Pfeilern (vgl. die Anzahl derPfeiler an den Fassaden der königlichen Saff-Grä-ber in el-Tarif!). Zwischen den beiden mittlerenPfeilern befindet sich der Eingang in das Ambu-latorium durch ein Tor in dessen mit 2,50 m auf-fallend massiven Umfassungsmauer. Das Inneredes Ambulatoriums besteht aus insgesamt 140 Säulen, die sich auf der Nord-, Ost- undSüdseite in drei, auf der Westseite in zwei Reihenan der Umfassungsmauer entlangziehen. Der ge-samte weitere Innenraum ist ausgefüllt mit demeigentlichen Kernbau der Tempelanlage, einemriesigen quadratischen und in seinem Innerenmassiven Block von 22,20 m Seitenlänge. Überdie Gestalt und den Sinn dieses schon bei seinerAuffindung durch Naville stark zerstörten Kern-baus ist viel diskutiert worden. Zweifelsfrei istnur, daß seine Höhe mindestens die der ihn um-gebenden Säulenstellung erreicht haben muß, daer wohl sicher das innere Auflager für die
Deckenplatten des Ambulatoriums bildete. Wieaber war der obere Abschluß des Kernbaus?Naville und Winlock gingen davon aus, daß deruntere Teil des Baus einen riesigen Sockel für eine aus Stein errichtete, massive Pyramide dar-stellte und rekonstruierten die Tempelanlage ent-sprechend. Arnold hingegen konnte sich dieserInterpretation aus baugeschichtlichen und ande-ren Gründen nicht anschließen und rekon-struierte den oberen Abschluß des Kernbaus alseinen weiteren quadratischen und etwas kleine-ren Massivbau. Er schlägt vor, diesen als eine Artsteinerne Version eines „Urhügels“ zu interpretie-ren, wobei der obere Teil des Kernbaus gegenüberdem unteren abgestuft wäre, man architektonischalso eine Art Pyramidenstumpf hätte (Abb. 9). Injüngster Zeit ist allerdings auch diese Rekon-struktion in Zweifel gezogen worden und einneuer Ansatz kehrt zu einer kleinen, aus Lehm-ziegeln erbauten Pyramide als oberem Abschluß
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:48 Uhr Seite 10
DIE NEKROPOLE VON THEBEN 11
des Kernbaus zurück. Mit letzter Sicherheit wirdsich die Frage aber nicht mehr klären lassen.
An das Ambulatorium schließt sich nach Wes-ten hin und durch ein weiteres Tor betretbar einoffener Hof („Mittelhof“) an, der eine doppelteSäulenreihe im Osten und je eine einfache Säu-lenreihe im Norden und Süden aufweist. Etwa inder Mitte des Hofes liegt der Eingang zu demKorridor, der zur königlichen Sargkammer führt.Westlich des Mittelhofes wiederum befindet sichein großer Säulensaal („Hypostyl“) mit 82 Säu-len, der das „Allerheiligste“ enthält, d. h. das inder Raumachse errichtete Sanktuar und eine einstmit Steinplatten ausgekleidete Felsnische, welcheeine überlebensgroße Statue des Königs enthielt.
Der Zugang zur Grabanlage im Mittelhofwurde nach der erfolgten Bestattung des Herr-schers mit den Bodenplatten des Hofes überdecktund war nicht mehr zugänglich. Der über 150 mlange, zunächst mit Bruchsteinmauern, dann mitSandstein ausgekleidete Korridor führt tief in dasFelsmassiv und endet in einer Sargkammer, dieeinst den Sarg und die Grabbeigaben des Königsenthielt. Diese Kammer ist komplett ausgeklei-det mit mächtigen Blöcken aus Rosengranit undenthält noch heute den Alabasterschrein, dereinst den königlichen Holzsarg barg. Von der ein-stigen Bestattung des Königs und seinem Holzsarghat sich außer Spuren nichts erhalten, allerdingskonnten von allen drei Ausgräbern noch umfang-reiche Teile seiner Grabaustattung im Schutt undin kleinen Seitenkammern des Korridors aufge-funden werden, so u. a. eine große Anzahl vonHolzmodellen.
Wie bereits erwähnt, sind auch hohe Würden-träger und Mitglieder des Hofstaates dieser Zeitmit ihren Grabbauten ihrem Herrscher in dienähere und weitere Umgebung der königlichenGrabanlage gefolgt: In den Hängen und in derEbene des sich östlich an den Mentuhotep-Tem-pel von Deir el-Bahari anschließenden, heuteAsasif genannten, Gebietes ließen sie sich zumTeil höchst aufwendige Saff-Gräber errichten –womöglich mit Blickrichtung auf den könig-lichen Tempel oder dessen Aufweg vom Frucht-land. Allerdings unterscheidet sich die Architek-tur dieser Saff-Gräber in vielen Punkten erheblichvon jenen im Vergleich eher einfacheren Anlagenin el-Tarif: Die Pfeilerfassaden werden nun gele-gentlich nicht aus dem Fels gearbeitet, sondern
Abb. 9
Abb. 10
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:48 Uhr Seite 11
12 DANIEL POLZ
Abb. 11Wandmalerei im Grab desGenerals Intef, in der die Belage-rung und Eroberung einer wohlsyrischen Festung dargestelltsind. Bemerkenswert ist dereinseitig auf Rädern bewegbareAngriffsturm der ägyptischenSoldaten (Rekonstruktion).
aufgemauert. Die in el-Tarif häufig anzutreffen-den Pfeilerräume im Inneren der Anlagen ver-schwinden und werden durch einen einzigen,mitunter außergewöhnlich langen Korridorersetzt, von dem aus Passagen oder Schächte zuden Bestattungsanlagen führen. In einigen Fällenhaben sich Reste einer sehr aufwendigen Verklei-dung der Korridore mit reliefierten und bemal-ten Kalk- oder Sandsteinblöcken erhalten, dievermuten lassen, daß nun weite Bereiche derGrabinnenräume vollständig dekoriert waren.
Auch am Fuß der Hänge und in der Mitte desTalkessels werden zu dieser Zeit Saff -Gräbererrichtet, die teilweise über eine bemerkenswertreiche Dekoration verfügen. Eine dieser Graban-lagen wurde vom Deutschen ArchäologischenInstitut Kairo unter der Leitung von Dieter Ar-nold und Jürgen Settgast in den Jahren 1963–70ausgegraben und aufgenommen5. Sie soll hierstellvertretend für den Grabtyp dieser Zeit kurzbeschrieben werden: Das Grab des Siegelbewah-rers und Generals Intef, der zur Zeit König
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:48 Uhr Seite 12
DIE NEKROPOLE VON THEBEN 13
Mentuhoteps lebte, besitzt einen großen recht-winkeligen, in den Felsboden vertieften Hof miteiner Fassade von zehn außen stark geböschtenPfeilern (Abb. 10). An der Fassade führt zwischenden beiden mittleren Pfeilern ein Eingang ineinen 7,60 m langen Korridor, der in einer klei-nen, länglich-rechteckigen Kultkammer mit ei-ner Nische für die Statue des Grabherrn endet.Der eigentliche Bestattungsort des Grabherrnliegt hier nun nicht – wie sonst in den Saff -Grä-bern häufig anzutreffen – in einem inneren Teilder Grabanlage, sondern befindet sich fast außer-halb des Grabes, am Ende eines senkrechtenSchachtes zwischen zwei Pfeilern der Fassade.
Das Grab des Intef war einst reich mit farbi-ger Malerei und mit bemaltem Relief dekoriert,sowohl an den Pfeilerflächen der Fassade und mitinsgesamt neun in den Fels eingelassenen Stelenim Pfeilerraum, als auch auf den Steinplatten, mitdenen Korridor und Kultkammer ursprünglichverkleidet waren. Die Darstellungen beinhaltenverschiedene Szenen von Handwerkern bei ihrenTätigkeiten (etwa in einer Bäckerei oder Brauerei,in einer Leder-, Tischler- und Metallwerkstatt)oder Szenen aus der Landwirtschaft und vomFischfang. Darüber hinaus finden sich Darstel-lungen, die in Zusammenhang mit dem Berufdes Grabherrn stehen und kriegerische Auseinan-dersetzungen zu Wasser und zu Lande zeigen.Eindrucksvoll ist die Darstellung eines Kampfesum eine wohl syrische Festung auf einem derFassadenpfeiler (Abb. 11).
Durch den politisch motivierten Umzug desköniglichen Hofes am Anfang der 12. Dynastiein eine neue Residenz im Norden Ägyptens ver-liert Theben für längere Zeit den Status derHauptstadt und des religiösen Zentrums des Lan-des. Mit dem Herrscher lassen sich nun auch diehohen und höchsten Würdenträger nicht mehrin Theben, sondern in verschiedenen Nekropolenim Norden bestatten, etwa in Lischt, Dahschurund den beiden Friedhöfen im Fayum, Hawaraund Illahun. Im Verlauf der auf das MittlereReich folgenden Zweiten Zwischenzeit (d. h. die13. bis 17. Dynastie) wird die Situation zuneh-mend unübersichtlicher: Von den Herrscherndieser Zeit kennen wir oft wenig mehr als ihreNamen, überliefert auf einigen spärlichen Objek-ten oder in später verfaßten Königslisten. In vie-len Fällen sind die Orte, an denen diese Könige
residierten, ebenso unbekannt wie die Nekropo-len, in denen sie und ihr vermutlich überschau-barer Hofstaat bestattet wurden. Erst gegen Ende dieser Zweiten Zwischenzeit, in der 17. Dy-nastie, sind wir aus verschiedenen zeitgenössi-schen Quellen über einige Herrscher besser in-formiert. Aus den Quellen geht hervor, daßTheben wieder die Residenz dieser Könige warund sie sich auf der thebanischen Westseite ineinem Teil der Nekropole bestatten ließen, derheute unter dem modernen arabischen NamenDra‘ Abu el-Naga bekannt ist. Mit diesem Fried-hof und seinen Grabanlagen beschäftigt sich seit1991 eine archäologische Unternehmung desDeutschen Archäologischen Instituts Kairo, überderen Zielsetzung und Ergebnisse auf den folgen-den Seiten berichtet wird.
Anmerkungen
1 Vorberichte: D. Arnold, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 28, 1972, S. 13–31; 29,1973, S. 135–162; 30, 1974, S. 155–164. Abschließende Publikationen: D. Arnold, Gräber des Alten und MittlerenReiches in El-Tarif, Archäologische Veröffentlichungen desDeutschen Archäologischen Instituts Kairo 17, Mainz1976; B. Ginter, J. K. Kozłowski, M. Pawlikowski, J. Sliwa,H.Kammerer-Grothaus,Frühe Keramik und Kleinfunde ausEl-Târif, Archäologische Veröffentlichungen des Deut-schen Archäologischen Instituts Kairo 40, Mainz 1998.
2 D. Arnold, Gräber des Alten und Mittleren Reiches in El-Tarif,Archäologische Veröffentlichungen des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo 17, Mainz 1976, S. 22.
3 D. Polz, Der Beginn des Neuen Reiches. Zur Vorgeschichteeiner Zeitenwende, Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 31, Berlin 2007, Kap. 5.
4 Vorberichte: D. Arnold, in: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 28, 1972, S. 13–15; ab-schließende Publikationen: D. Arnold, Der Tempel desKönigs Mentuhotep von Deir el-Bahari I, Architektur undDeutung, Archäologische Veröffentlichungen des Deut-schen Archäologischen Instituts Kairo 8,Mainz 1974; ders.,Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir el-Bahari II,Die Wandreliefs des Sanktuars, Archäologische Veröffent-lichungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo 11, Mainz 1974; ders., Der Tempel des Königs Mentu-hotep von Deir el-Bahari III, Die Königlichen Beigaben,Archäologische Veröffentlichungen des Deutschen Archäo-logischen Instituts Kairo 23, Mainz 1981; D. Arnold fromthe notes of Herbert Winlock,The Temple of Mentuhotepat Deir el-Bahari,Publications of the Metropolitan Museumof Art, Egyptian Expedition Vol. XXI, New York 1979.
5 D. Arnold, Das Grab des Jnj-jtj.f, Band I, Die Architektur, Ar-chäologische Veröffentlichungen des Deutschen Archäo-logischen Instituts Kairo 4, Mainz 1971; B. Jaros-Deckert,Das Grab des Jnj-jtj.f, Band V, Die Wandmalereien der 11. Dynastie, Archäologische Veröffentlichungen desDeutschen Archäologischen Instituts Kairo 12,Mainz 1984.
KAPITEL 2.qxd 30.07.2007 13:48 Uhr Seite 13
Fragestellung und Zielsetzung
Dra‘ Abu el-Naga ist der moderne arabischeName des nordöstlichen Bereiches der ausge-dehnten Friedhöfe auf der Westseite Thebens.Der Name bezieht sich sowohl auf ein heutigesDorf als auch auf ein nördlich daran angrenzen-des Gebiet, das von moderner Besiedelung weit-gehend verschont blieb. In diesem unbebautenTeil des Friedhofs liegt das Konzessionsgebiet derarchäologischen Unternehmung des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo (Abb. 12–13 undKarte der Thebanischen Nekropole am Endedes Bandes)1.
Das Ausgrabungsprojekt widmet sich haupt-sächlich der Erforschung der königlichen undprivaten Friedhöfe der Zweiten Zwischenzeit unddes frühen Neuen Reiches (13. bis frühe 18. Dy-nastie, um 1794–1425 v. Chr.): Bis vor wenigenJahren war über die Architektur und die Beschaf-fenheit der Gräber sowie über die Bestattungs-praxis dieser Zeit nur wenig bekannt. Einenbesonders wichtigen Teil des Projektes bilden da-bei die Königsgräber der 17. Dynastie. Bis vorBeginn der Arbeiten des Instituts beruhte dieallgemeine Kenntnis dieser Bestattungen aufvereinzelten Objekten ihres Inventars ohne ein-deutige Herkunft, wie etwa drei königliche, teil-weise vergoldete Holzsärge und ein Pyramidionaus Kalkstein, die sich heute in Museen von Pa-ris und London befinden. Diese Objekte sindnach Beraubung der Gräber im 19. Jh. in denAntikenhandel und schließlich in verschiedeneeuropäische Sammlungen gelangt. Die Bestat-tungsanlagen selbst sowie ihre genaue Lage blie-ben undokumentiert. Ein Anliegen des Projektesist es daher, diese Gräber zu lokalisieren, ihreArchitektur zu erfassen und den Kontext für diedaraus stammenden Objekte wiederzugewinnen.
Das übergeordnete Ziel des Forschungsprojek-tes ist jedoch, die Belegungs- und Entwicklungs-geschichte des Friedhofes von Dra‘ Abu el-Naganachzuzeichnen. Folgende Fragestellungen liegender archäologischen Arbeit zugrunde: Zunächsteinmal ist die Klärung von Form und Architekturvor allem der Zwischenzeit-Gräber ein besonde-res Anliegen. Die Auswertung des Architekturbe-funds sowie des geborgenen Beigaben- und Kult-inventars wiederum soll Rückschlüsse auf dieangewandte Kult- und Bestattungspraxis ermög-lichen. Des weiteren wird untersucht, wie einzelneAnlagen bzw. Gruppen von Gräbern in die Nekro-
KAPITEL 3
Die Ausgrabungen des Deutschen Archäolo-gischen Instituts in Dra‘ Abu el-NagaDaniel Polz
Abb. 12Das Grabungsgebiet des Institutsin Dra‘ Abu el-Naga, Blick nachOsten. Das Konzessionsgebietdes Deutschen ArchäologischenInstituts umfaßt den Hügel unddie davor liegende Ebene bis hinzur modernen Teerstraße.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:49 Uhr Seite 14
DIE AUSGRABUNGEN IN DRA‘ ABU EL-NAGA 15
polenstruktur eingebettet waren (in Bezug aufProzessionswege, Kultplätze, heilige Orte): Gabes beabsichtigte Beziehungen zwischen verschie-denen Grabanlagen? Wodurch ist die Anordnungbestimmter Gräber bzw. die Verteilung bestimm-ter Grabformen bedingt? Darüberhinaus liegt einweiteres Augenmerk auf der Erfassung des sozia-len Spektrums und des sozialen Verteilungsmu-sters der Bestattungen.
Dra‘ Abu el-Naga ist eine der belegungsstärk-sten Nekropolen des Alten Ägypten, die vomMittleren Reich bis in frühchristliche/koptischeZeit hinein – d. h. über einen Zeitraum von rund2700 Jahren – fast durchgehend als Bestattungs-platz genutzt wurde. Die ältesten bislang von unsdokumentierten Gräber datieren in die ausgehende11. Dynastie (um 2000 v. Chr.). In der 17. undfrühen 18. Dynastie wurden hier zudem einigeder Könige und deren Gemahlinnen beigesetzt.Das soziale Spektrum der Privatnekropole reichtvon einfachen, beigabenarmen Mattenbestattun-gen (Abb. 14) bis hin zu den riesigen Felsgräbernhochgestellter Persönlichkeiten wie z. B. denHohenpriestern des Gottes Amun von Karnak. Inder Zeit des frühen Mittleren Reiches, am Endeder Zweiten Zwischenzeit und zu Beginn desNeuen Reiches war Dra‘ Abu el-Naga der Resi-denzfriedhof für die Hauptstadt und den Regie-rungssitz Theben. Seine besondere Bedeutung alsheiliger Bestattungsplatz – welche durch die Prä-senz der Königsgräber natürlich noch gewachsenist – beruht jedoch auch auf seiner Lage direkt ge-genüber dem Tempel von Karnak auf der Ostseitedes Nils: Dieser ist seit dem Mittleren Reich alsHauptkultzentrum des Gottes Amun belegt undentwickelte sich im frühen Neuen Reich zu einemder wichtigsten Heiligtümer des Landes.
Eine zusammenhängende, großflächige Unter-suchung der Nekropole von Dra‘ Abu el-Nagaexistiert bislang nicht. Eine solche wird einerseitsdurch die Tatsache erschwert, daß weite Teile desGebietes von enormen Schuttmassen überlagertsind, welche meist ein Resultat der langen Nut-zungszeit dieses Bestattungsortes (d. h. Aus-schachtungsabraum; Abb. 15) darstellen. Ande-rerseits ist eine solche Untersuchung heute auch mit dem im frühen 19. Jh. massiv einset-zenden Grabraub (genährt durch das wachsendeInteresse der europäischen Museen und Privat-sammler an ägyptischen Objekten) sowie den
�Abb. 13Luftbild des Grabungsgebietes(Herbst 2003). Im unteren Bildbe-reich sind die Ruine der Pyramidedes Königs Nub-Cheper-Re Intefmit ihrer Umfassungsmauersowie einige der Grabschächtesichtbar.
�Abb. 14Einfache Mattenbestattung ausder späten 11. bis frühen 12. Dy-nastie in Dra‘ Abu el-Naga. Derweibliche Leichnam war nurgrob mumifiziert, dann in einegroße Bastmatte gewickelt undzwischen zwei Felsblöcken in-mitten der Nekropole H bestattetworden. Die einzige Beigabe be-stand aus dem links sichtbarenGefäß am Fußende der Leiche.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:49 Uhr Seite 15
16 DANIEL POLZ
Abb. 15Das Nekropolengebiet von Dra‘Abu el-Naga / Nord. Stellenweiseist die alte Nekropole von gewal-tigen Massen an „Nekropolen-schutt“ bedeckt, der beimAushauen der Felsgräber und -schächte entstand.
Abb. 16Die Ruinen einer Grabkapelle ausLehmziegeln im Grabungsareal Avon Dra‘ Abu el-Naga (frühe 18. Dynastie). Im Vordergrundder Eingang und der offene Hof,im Hintergrund die eigentlicheKapelle mit einer Opferstelle.An der Westwand dieser Kapellebefanden sich die Grabstelen derhier Bestatteten (wie etwa die inAbb. 17).
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 16
DIE AUSGRABUNGEN IN DRA‘ ABU EL-NAGA 17
verschiedenen mehr oder weniger systematischenGrabungsaktivitäten des 19. und frühen 20. Jh.skonfrontiert. Vereinzelte Szenen aus dekoriertenGräbern des Neuen Reiches in diesem Nekropo-lenteil wurden bereits 1845 im Rahmen der Ex-pedition unter der Leitung von Carl RichardLepsius aufgenommen und später publiziert. Dieersten nennenswerten und ansatzweise dokumen-tierten Ausgrabungen wurden in den Jahren1822–25 von Joseph Passalacqua durchgeführtund konzentrierten sich auf einige Schachtgräber.Ein besonderes Interesse an Dra‘ Abu el-Nagasetzte durch den Fund dreier Königssärge derZweiten Zwischenzeit ein, u. a. jenem des Nub-Cheper-Re Intef, welcher hier 1827 von Grab-räubern aufgefunden und 1835 vom BritishMuseum in London angekauft wurde. In denJahren 1860–62 machte sich Auguste Marietteauf die offenbar erfolgreiche Suche nach dem ei-gentlichen Grab dieses Königs, dessen Lage er je-doch nicht dokumentierte und von dem nur einesehr kursorische Kurzbeschreibung existiert. Endedes 19. und im frühen 20. Jh. haben diverseUnternehmungen in Dra‘ Abu el-Naga stattge-funden, im Rahmen derer einzelne Gräber bzw.
Abb. 17Eine Grabstele aus Dra‘ Abu el-Naga aus Kalkstein (frühe 18. Dynastie). Die Stele ist derdargestellten Dame gewidmet,deren Berufsbezeichnung „Sängerin des Amun“ lautet.Ihr Name ist schon in alter Zeitausgelöscht worden, ebenso derName des ihr gegenüberstehen-den Priesters, der ihr die Opfer-gaben auf dem kleinen Tischzwischen beiden darreicht.
Abb. 18Blick über das Grabungsareal Hin Dra‘ Abu el-Naga vor Beginnder Ausgrabungen im Frühjahr2001. Das zu dieser Zeit noch völ-lig von Schutt überdeckte Gebietlinks neben der Hütte enthielt dieRuinen der Pyramide des Nub-Cheper-Re Intef sowie mehr alsein Dutzend Schachtgraban-lagen der Zweiten Zwischenzeit.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 17
Abb. 19Areal H in Dra‘ Abu el-Naga, Ansicht von Osten. Etwa in Bildmitte die Ruine der Pyramide des Königs Nub-Cheper-Re Intef, unterhalb einige der Schächte der Privatgräber der Zweiten Zwischenzeit.
Abb. 20Übersicht der Nekropole H, Ansicht von Norden. Im Vordergrund sind die terrassenförmig angelegten Ausgrabungsflächen zu erkennen. Die Ruine der Pyramide ist oberhalb der Holzdachkonstruktion in der rechten Bildmitte sichtbar.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 18
DIE AUSGRABUNGEN IN DRA‘ ABU EL-NAGA 19
Gräbergruppen ausgegraben wurden bzw. derenDekoration aufgenommen wurde. Das Interessean Dra‘ Abu el-Naga hält bis in die Gegenwartan, und so sind auch in den letzten Jahren ver-schiedene, auf die Bearbeitung von Einzelgräbernkonzentrierte Projekte entstanden.
In den Jahren 1991 bis 1994 führte das Insti-tut unter der Leitung des Verfassers umfangrei-che Ausgrabungen im Nordteil von Dra‘ Abu el-Naga durch. Im Zuge dieser Arbeiten wurdenrund 20 Schachtgrabanlagen freigelegt. Diesesind zwischen 5 und 7 m tief und weisen in derRegel zwei nach Ost und West abgehende Kam-mern am Schachtboden auf. Einigen dieserSchächte konnten zudem die Reste von Grab-oberbauten aus ungebrannten Lehmziegeln zu-gewiesen werden, in denen Kulthandlungen derBestattungsrituale vollzogen wurden (Abb. 16).Graboberbauten dieser Art waren in Theben bisdahin für die Zeit des frühen Neuen Reiches nurvereinzelt dokumentiert. Sie können gemäß demeindeutigen Grabungsbefund als typischer Auf-stellungsort der Grabstelen des Neuen Reichesgelten (Abb. 17). Einige der Schächte wurden inder Dritten Zwischenzeit sowie in der Spätzeit(21. bis 26. Dynastie, um 1070–525 v. Chr.) fürNachbestattungen genutzt. Die meisten warenstark gestört: zum einen durch Plünderung, zumanderen durch Wassereinbruch aufgrund der inunregelmäßigen Abständen auftretenden hefti-gen Regenfälle. Innerhalb dieses Grabungsarealskonnten zwei nahezu ungestörte Bestattungsan-lagen entdeckt werden, welche ein aufschlußrei-ches Beigabeninventar enthielten.
In den Jahren 1994 bis 2000 wurden weitereEinzelprojekte archäologisch bearbeitet. Nebeneinem Pfeilerfassaden-Grab („Saff-Grab“) aus derspäten 11. oder frühen 12. Dynastie wurde vorallem eine riesige Felsgrabanlage nahe der Hügel-spitze von Dra‘ Abu el-Naga ausgegraben. DiesesGrab war vermutlich die ursprüngliche Grabstättedes Königs Amenophis’ I. zu Beginn der 18. Dynastie (um 1510 v. Chr.) und wurde mehrals 400 Jahre später von dem Hohepriester desAmun von Karnak, Ramsesnacht, wiederbenutztund umgestaltet2.
Die Nekropole H: Die Pyramide desKönigs Nub-Cheper-Re Intef und umliegende Grabanlagen
Im Frühjahr 2001 wurde in der Verfolgung einesder Hauptziele des Gesamtprojektes in einemneuen Areal archäologische Arbeiten begonnen,die bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt andauern(Abb. 18–19). Im Verlauf der Frühjahrskampa-gne 2001 konnten die Überreste der Pyramidedes Königs Nub-Cheper-Re Intef (einem der letz-ten Herrscher der 17. Dynastie) aufgefunden undfreigelegt werden. Unterstützt wurde die erfolg-reiche Suche durch die Angaben im über 3000Jahre alten Papyrus Abbott (heute im BritishMuseum London), der u. a. das Pyramidengrab
Abb. 21Zeichnerischer Querschnittdurch die Grabanlage des Jayse-neb (K01.12) aus der 13. Dynas-tie. Deutlich sichtbar ist die nochfast vollständig erhaltene Ziegel-mauer, mit der der Eingang zurGrabkammer nach erfolgterBestattung vermauert wurde.In der Grabkammer wurde auchdie Stele des Jayseneb gefunden(Abb. 22).
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 19
20 DANIEL POLZ
Abb. 22Kalkstein-Grabstele des Jaysenebaus seiner Grabanlage K01.12 inDra‘ Abu el-Naga (erste Hälfteder 13. Dynastie). Die Stele zeigtden Grabbesitzer Jayseneb stehend vor einem Opfertisch,auf welchem sich verschiedeneGaben befinden. Die fünfzeiligeOpferformel über der Szene führtneben den Totengöttern Osiris-Chontamenti und Upuaut be-merkenswerterweise auch zweivergöttlichte Könige der Vergan-genheit auf: Die Namensringeenthalten die Namen der KönigeNebhepetre Mentuhotep und Seanchkare Mentuhotep, diemehr als 250 Jahre vor Jaysenebgelebt haben.
dieses Königs erwähnt und Anhaltspunkte zuseiner Lage enthält. Bei der Ausgrabung in dersteilen Hanglage wird für die Anlage der Schnitteein spezielles Terrassensystem angewendet, umdas oftmals nur in den unteren Schichten tatsäch-lich aussagekräftig stratifizierte Schuttmaterialsystematisch abzutragen (Abb. 20).
Um die Pyramide herum wurden zahlreichezeitgenössische, jedoch auch ältere Grabschächte(13. Dynastie, um 1790–1645 v. Chr.) aufgefun-den, die auf die Bedeutung dieses Ortes als tradi-tioneller, heiliger Bestattungsplatz schließen las-sen. Unter anderem wurden die Grabkapelle unddie dazugehörige Schachtanlage eines hohenHofbeamten Nub-Cheper-Re Intefs namens Teti entdeckt. Alle Gräber sind, teilweise schon
in pharaonischer Zeit, geplündert worden undwiesen bei ihrer Ausgrabung nur noch z. T. starkzerstörte Reste ihres ehemaligen Beigabenbestan-des (Keramikgefäße, kleine Dienerfigürchen[Uschebtis], Zeremonialstäbe, Möbel, Matten,Körbe, Textilien, Nahrungsmittel, Pflanzen-schmuck etc.) auf. Von den Bestattungen selbstkonnten in den meisten Fällen nur noch Teilevon Mumien (bzw. einzelne Knochen) und ihrerUmwicklung sowie Fragmente der Holzsärgegeborgen werden. Eine Ausnahme hierzu undeine kleine archäologische Sensation stellt das indiesem Band vorgestellte und außergewöhnlichgut erhaltene Holzsarg-Ensemble des Imeni undder Geheset aus der Schachtanlage K03.4 dar (zurLage des Grabes siehe Abb. 23): Es stand nochan dem Ort, an dem es vor mehr als 3700 Jahrendeponiert wurde, und ist – abgesehen von einemLoch, welches Grabräuber in sein Fußteil geschla-gen haben – nahezu unversehrt.
Die Grabungsergebnisse der letzten fünf Jahrein Dra‘ Abu el-Naga ermöglichen es, ein deut-licheres Bild der Bestattungsbräuche und Jenseits-vorstellungen wie auch der zeitlichen Abfolge derHerrscher der Zweiten Zwischenzeit zu zeichnen.Zum einen ist es nun möglich, die Entwicklungder Grabtypen von der 13. bis in die 18. Dyna-stie nachzuvollziehen sowie die Existenz vongleichzeitig nebeneinander benutzten Grabtypenund -formen festzustellen. Die klassische Formder frühen Zweiten Zwischenzeit ist das Schacht-grab, bestehend aus einem zwischen 7 und 10 mtiefen Schacht, von dessen Boden eine Bestat-tungskammer nach Westen abgeht (Abb. 21). Zudiesen Gräbern ließen sich in Dra‘ Abu el-Nagabemerkenswerterweise bislang keine Oberbauten(Kapellen oder Schreine) feststellen, allerdingsfanden sich vereinzelt Stelen der Grabbesitzer inden Kammern (Abb. 22). Der Schachtmund istmit ungebrannten Lehmziegeln ummauert.
In der ausgehenden Zweiten Zwischenzeit liegtdie Schachttiefe zwischen knapp 3 und 5 m, undzwei unterirdische Kammern (eine im Osten,eine im Westen) sind die Regel. Ein weiteresNovum sind kleine Graboberbauten (Kapellen)aus ungebrannten Lehmziegeln, von denen inAreal H bislang zwei nachgewiesen werden konn-ten. Parallel dazu setzt in der 17. Dynastie dasAnlegen von Felsgräbern ein, die wiederum einereigenen morphologischen Entwicklung folgen.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 20
DIE AUSGRABUNGEN IN DRA‘ ABU EL-NAGA 21
Abb. 23Übersichtsplan der Nekropole H in Dra‘ Abu el-Naga. Die mit sich kreuzenden Linien markierten dunklen Rechtecke geben die Schachtanlagen der früheren und späteren Zweiten Zwischenzeit wieder.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 21
22 DANIEL POLZ
�Abb. 24Virtuelle Rekonstruktion der Pyramidenanlage des KönigsNub-Cheper-Re Intef (Standbildder Animation auf der DVD).Die kleine Kapelle an der Ostseiteder Pyramide ist ergänzt, ebensoder Obelisk vor der Pyramide,den Auguste Mariette 1860 aneinem unbekannten Ort in dernäheren Umgebung entdeckthat. Seine Plazierung auf demhier gefundenen Sandstein-sockel dient lediglich der Veran-schaulichung; tatsächlich standauf der Basis ein in Resten eben-falls hier entdeckter, aber un-beschrifteter Obelisk.
�Abb. 25Die Pyramidion-Fragmente der Pyramide des Königs Nub-Cheper-Re Intef. Sichtbar sind diebeiden Seiten, die Reste der ineinen Namensring („Kartusche“)geschriebenen Namen des Herr-schers enthalten. Die Oberflächedes Kalksteins weist Reste vongelber Farbe auf, die Hierogly-phen-Zeichen waren mit blauerFarbe ausgefüllt – die göttlichenFarben Gold und Lapislazuli.
Beide Grabtypen laufen bis in die mittlere 18. Dynastie (Zeit Hatschepsuts / Thutmosis’ III.)hinein parallel3.
Eines der wichtigsten Ergebnisse der bishe-rigen Arbeit in Dra‘ Abu el-Naga ist durch dieAuffindung der Pyramidenanlage des Nub-Cheper-Re Intef erzielt worden. Mit ihr wurdedie in der Ägyptologie lange umstrittene Fragenun eindeutig positiv beantwortet, ob dieKönigsgräber der 17. Dynastie tatsächlich Pyra-miden besaßen. Die aus Lehmziegeln errichtetePyramide, deren Mauerwerk heute nur noch biszu maximal 1,20 m hoch ansteht, war einst ca. 13 m hoch und mit einem weißen Verputzversehen (Abb. 23–24). Bekrönt wurde sie voneinem Abschlußstein, dem sog. Pyramidion,welcher mit den Namen und der Titulatur des Königs beschriftet war (Abb. 25). Von die-sem aus Kalkstein gearbeiteten Pyramidionkonnten drei Bruchstücke geborgen werden, derRest ist wohl verloren oder befindet sich uner-kannt in irgendwelchen Magazinen oder Samm-lungen.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 22
DIE AUSGRABUNGEN IN DRA‘ ABU EL-NAGA 23
Die Pyramide ist von einer kleinen Umfas-sungsmauer umgeben, welche ebenfalls ausLehmziegeln besteht und ehemals weiß verputztwar. Die Pyramide ist in Schalenbauweise erbaut,d. h. nur der äußere Mantel ist gemauert, wohin-gegen der Innenraum mit Schutt aufgefülltworden ist. Die eigentliche Bestattungsanlagekonnte bislang noch nicht entdeckt werden. Zuunserem Verständnis der Nekropolenentwick-
Abb. 26Eine Gruppe von großen Kera-mikgefäßen (sog. Bierflaschen)aus der Grabanlage der Geheset(K03.4) der ersten Hälfte derZweiten Zwischenzeit (13. Dy-nastie). Gefäße dieser Art ließensich – wenn auch stark zerbro-chen – häufiger noch an demPlatz finden, an welchem sie an-läßlich der Bestattung deponiertworden waren. Sie enthieltenteilweise noch Reste der Flüssig-keiten, die den Verstorbenen mitins Jenseits gegeben wurden.
Abb. 27Ein Teller, Flaschen und Bechereiner Bestattung der zweitenHälfte der Zweiten Zwischenzeit(17. Dynastie). Für diese Zeit typisch sind der rote Überzugund bei bestimmten Formen diePolitur der Außenseite. Im Gegensatz zur früheren Praxis(Abb. 26) enthielten diese Gefäßemeist keine realen Lebensmittel,sondern versinnbildlichten derenExistenz im Grab durch ihre jeweilige unterschiedliche Form.
lung trägt der Pyramiden-Befund ebenfalls bei:König Nub-Cheper-Re Intef hat bemerkenswer-terweise einen traditionellen Bestattungsplatz ge-wählt, indem er seine Grabanlage in der Nekro-pole der 13. Dynastie hat bauen lassen. DiePyramide selbst wurde über einem Schacht dieserZeit errichtet. Die genauen Gründe hierfür sindunklar (eventuell familiäre Beziehung?). Auch in-nerhalb der einzelnen Schachtgräber in Areal H
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 23
24 DANIEL POLZ
konnten teilweise bis zu vier verschiedene Nut-zungsphasen festgestellt werden, wobei bei deneinzelnen Nachbestattungen jeweils Rücksicht aufdie bereits vorhandenen Begräbnisse genommenwurde.
Die geborgenen Reste von Grabausstattungen,insbesondere die in großer Zahl aufgefundenenBeigaben- und Kultgefäße aus Keramik, lassenzudem Rückschlüsse auf die am Grab ausgeführ-ten Kulthandlungen und davon ausgehend aufdie Entwicklung der dahinterstehenden Jenseits-vorstellungen zu (siehe Kap. 9). Die Analyse deskeramischen Materials aus Areal H stellt hinsicht-lich der Keramik der Zweiten Zwischenzeit inTheben Grundlagenforschung dar: Wie sich ge-zeigt hat, ist das Formenspektrum von einer loka-len Keramiktradition geprägt und unterscheidetsich z. T. in wesentlichen Aspekten von zeitgenös-sischem Material anderer Fundorte besonders imNorden des Landes. Außerdem wird im kerami-schen Material ein Wandel im Bestattungsgedan-ken sichtbar: Während in der 13. Dynastie diematerielle Versorgung des Verstorbenen mitLebensmitteln und den entsprechenden Gefäß-formen (Abb. 26) im Vordergrund steht, wirddieses Inventar in der 17. Dynastie durch neueFormen abgelöst, von denen einige eine beson-dere Bedeutung von Ritual und Magie in der
Totenversorgung bezeugen (Abb. 27). Außerdemkonnten durch die Analyse der Keramik der 17. Dynastie neue Erkenntnisse über die Entste-hung einiger keramischer Leitformen der 18. Dy-nastie gewonnen werden.
Anmerkungen
1 Siehe den letzten Vorbericht der Unternehmung mit wei-terer Literatur D. Polz / E. Mählitz / U. Rummel / A. Seiler, in:Mitteilungen des Deutschen Archäologischen InstitutsKairo 59,2003,S.389–409 sowie die Einzelveröffentlichun-gen D. Polz / A. Seiler, Die Pyramidenanlage des KönigsNub-Cheper-Re Intef, Sonderschriften des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo 24, Mainz 2003; A. Seiler,Tradition & Wandel.Die Keramik als Spiegel der Kulturent-wicklung Thebens in der Zweiten Zwischenzeit, Sonder-schriften des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo32, Mainz 2005; D.Polz, Der Beginn des Neuen Reiches.ZurVorgeschichte einer Zeitenwende, Sonderschriften desDeutschen Archäologischen Instituts Kairo 31,Berlin 2007.
2 D. Polz, in: Studien zur Altägyptischen Kultur 25, Hamburg1998, S.257–293; U.Rummel, in: Egyptian Archaeology 14,London 1999, S. 3–6; U. Rummel, in: M. Eldamaty / M. Trad(Hrsg.), Egyptian Museum Collections around the World.Studies for the Centennial of the Egyptian Museum, Cairo,Kairo 2002, S. 1025–1034; U. Rummel, in: N. Kloth et al.(Hrsg.), Es werde niedergelegt als Schriftstück. Fs HartwigAltenmüller, Studien zur Altägyptischen Kultur Beiheft 9,Hamburg 2003, S. 367–377.
3 D. Polz, in: H. Guksch et al. (Hrsg.), Grab und Totenkult imAlten Ägypten, München 2003, S. 75–87.
KAPITEL 3.qxd 30.07.2007 13:50 Uhr Seite 24
Wie die meisten der im Grabungsareal Hwährend der letzten Jahre entdeckten Grab-schächte war auch die Anlage K03.4, das Grabder Geheset, vollkommen von Schutt bedeckt.Im Gegensatz zu vielen tiefer in der Ebeneliegenden Grabschächten ließ sich also die Posi-tion dieses Schachtes nicht durch eine kreisrundeVertiefung an der Oberfläche erkennen (sieheoben Abb. 4, 12). Erst das systematische Ab-tragen des teilweise meterhohen Oberflächen-schuttes bis hinunter zum anstehenden Fels-
boden in eigens dafür angelegten Grabungs-terrassen (Beispiel siehe oben, Abb. 20 und Abb. 28–29) führte schließlich zur Entdeckungeiner Reihe von bislang fünf eng beieinanderliegenden Schächten (Abb. 30–31 zeigen dreibzw. vier dieser Schächte). Diese Schächte erhiel-ten nach dem von uns angewandten Bezeich-nungssystem eine fortlaufende Numerierung, in der der Buchstabe „K“ (für [Grab-]Komplex)von zwei Zahlengruppen gefolgt wird, z. B.K03.4. Dabei bezeichnet die erste Gruppe die
KAPITEL 4
Die Grabanlage der Geheset und die Entdeckung der SärgeDaniel Polz
Abb. 28Das Grabungsareal H im Okto-ber 2003. Im Schutt südlich derPyramide des Nub-Cheper-ReIntef wird der Schachtmund derGrabanlage K03.4 sichtbar.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:51 Uhr Seite 25
Abb. 29Über dem Schachtmund vonK03.4 (rechts) und einer danebenliegenden Grabanlage (K03.5)werden Dreibeine aus Holzbal-ken errichtet, um die Körbe mitdem Abraum des Schutts ausdem Schacht zu befördern.
Abb. 30Östlich der Terrasse mit den fünf Schachtgräbern wird einPhototurm errichtet, um Aufnah-men der Grabanlagen von oben anzufertigen (vgl. Abb. 31).
Jahreszahl, in der eine Grabanlage entdeckt wor-den ist, die zweite Zahl gibt die zeitliche Reihen-folge der Entdeckung der Anlagen wieder.
Aus dem Übersichtsplan (Abb. 23) und denAbb. 30–31 ist erkenntlich, daß die Anlage derGeheset, K03.4, der am weitesten nordöstlichgelegene Schacht dieser Gruppe ist. Der Schacht-mund, also die Oberkante des Schachtes imFelsboden, wurde am 19.10. 2003 entdeckt (Abb. 28). Bereits die Grundfläche des Schacht-mundes von etwa 1,60 auf 3,05 m ließ daraufschließen, daß es sich hier um eine der größerenGrabanlagen innerhalb des Grabungsareals Hhandeln könnte. Allerdings konnten zu diesemZeitpunkt noch keine Aussagen über die zuerwartende Tiefe des Schachtes gemacht werden –die Grundfläche eines Schachtes, so die bisherigeErfahrung mit Grabanlagen dieser Art in Dra‘Abu el-Naga, läßt sich nicht immer mit seinerTiefe korrelieren.
Die Ausgrabung des Schachtes wurde am11.11. 2003 begonnen (Abb. 29). Dabei wurdeauch in diesem Fall eine seit längerer Zeit in un-
26 DANIEL POLZ
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:51 Uhr Seite 26
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 27
Abb. 33Ausgrabungsarbeiten in der Vorkammer der Grabanlage K03.5. Wiein den Grabschächten wird auch der Schutt in den Kammern in etwa
20–25 cm tiefen Abhüben und dazu in kleineren Abschnitten entfernt;das darin enthaltene Material wird gesiebt und für die anschließendeBearbeitung nach Abhüben und Objektgruppen getrennt gelagert.
Abb. 31Vier der fünf auf einer Ebene liegende Schachtgräber, von links:K03.5, K03.3, K03.2 und K03.4. Die beiden deutlich kleineren Anlagen in der Mitte wurden am Ende der Zweiten Zwischenzeit angelegt, diebeiden äußeren Anlagen K03.5 und K03.4 datieren in die frühe ZweiteZwischenzeit. Dieser Teil des Friedhofes war am Ende der ZweitenZwischenzeit offensichtlich als Grabstätte so begehrt, daß man sichmit der Anlage neuer Schächte in gefährliche Nähe zu bereits exi-stierenden Gräbern begab. Dies führte häufiger zu Durchbrüchen in die älteren Anlagen, wie hier im Fall des Schachtes K03.2, bei dessenAusschachtung sich bereits im oberen Bereich ein massiver Durch-bruch in die Anlage K03.4 ergab.
Abb. 32Dieser tönerne osmanische Pfeifenkopf wurde im Schutt der Grab-kammer von K01.9 aufgefunden – ein Beweis für die Beraubung dieser Grabanlage während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 27
28 DANIEL POLZ
Abb. 34Dekorierte Fußplatte des Holz-sarges der „Hausherrin Geheset“.Ihr Titel und Name findet sich inder linken Hälfte der waagrechtenInschriftzeile am oberen Rand.
Abb. 35Die unerwartete Entdeckung einerweiteren Kammer in der Graban-lage K03.4. Zunächst sind imSchutt, mit dem die Vorkammerzur Sargkammer angefüllt war,nur die Oberkante des Kammer-einganges und die Oberseite eineskastenförmigen, weiß überzoge-nen und noch verschlossenenHolzsarges sichtbar.
serer Unternehmung etablierte Grabungstechnikangewandt, die sich aus den spezifischen archä-ologischen Gegebenheiten in diesem Teil derthebanischen Nekropole ergab: Die meistenSchachtgräber in Dra‘ Abu el-Naga sind sehrhäufig über die Jahrhunderte hinweg mehrfachbenutzt worden. In manchen Fällen wurdenschon in altägyptischer Zeit ältere Grabkammernschlichtweg ausgeräumt, um Raum für neueBestattungen zu schaffen. In anderen Fällenwurden ältere Gräber wiederbenutzt und die be-reits vorhandenen Bestattungen mehr oder weni-ger komplett und in einem gewissen Sinn „pietät-
voll“ nur beiseite geräumt und neue Bestattun-gen hinzugefügt. Darüberhinaus ist fast jedeGrabanlage der Nekropole im Laufe der Zeitenhäufig mehrfach von Grabräubern heimgesuchtworden, wobei die Beraubung von Gräberndurchaus keine Erfindung der Neuzeit ist; schonin altägyptischen Dokumenten (etwa in denberühmten „Grabräuberpapyri“ im BritischenMuseum London) wird detailliert nicht nur dieTatsache der Grabräuberei an sich, sondern auchdas wenig rücksichtsvolle Vorgehen der Diebe beider Beraubung der Anlagen beschrieben. Ausdiesen Texten geht etwa hervor, daß – im Jahre1120 v. Chr. – Diebe nach erfolgter Plünderungder Grabanlage eines Herrschers der späten Zwei-ten Zwischenzeit mit Namen Sobekemsaef (um1580 v. Chr.) die Mumien des Königs und seinerGemahlin in Brand steckten, um deren Rache zuverhindern.
Diese Wiederbenutzungen und Beraubungenlassen sich im archäologischen Befund gut nach-weisen, vorausgesetzt, das Schuttmaterial derSchächte wird auf eine Weise entfernt und doku-mentiert, die eine spätere Rekonstruktion derFundtiefen einzelner Objekte innerhalb desSchachtes erlaubt. Dazu wird das Material ingleichmäßigen sog. Abhüben von ca. 20 cmHöhe abgetragen (vgl. Abb. 33), anschließendgesiebt und das verwertbare Inventar, nachObjektgruppen getrennt und mit einer fortlau-fenden Abhubnummer versehen, gelagert. JederSchritt in diesem Prozeß wird vor Ort in „Feld-tagebüchern“ handschriftlich festgehalten. EineUntersuchung der Zusammensetzung des Inven-tars des Schuttmaterials gibt die ersten Hinweiseauf die Geschichte eines Schachtes, inklusiveeventueller antiker und moderner Störungen. Inder Regel erweist sich dabei die Objektgruppe derKeramik bzw. der tönernen Gefäßscherben als dieaussagekräftigste: Wenn z. B. die Scherben in denAbhüben derselben Zeitstufe angehören, kanndas ein Anzeichen dafür sein, daß eine Grabanlagenur einmal benutzt wurde, eben zu der Zeit, aus der die Scherben stammen. Das bedeutetnicht, daß eine solche Anlage nicht in alterund/oder moderner Zeit beraubt worden seinkönnte. Nicht selten lassen sich in tieferen Ab-hüben und besonders in der Nähe der Eingängezu den Grabkammern und in den Grabkammernselbst rezente Objekte finden, durch die sich mo-
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 28
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 29
derne Beraubungen eines Grabes relativ genaudatieren lassen. Dazu zählen sehr oft Streichholz-schachteln (auch Grabräuber benötigen für ihreTätigkeiten Licht!), aber auch Zigarettenschach-teln, Zeitungsausschnitte, moderne Stoffetzenetc. In einer Grabanlage in Areal H beispielsweisefanden sich im Schacht und in der GrabkammerFragmente mehrerer tönerner Köpfe von sog.osmanischen Tabakpfeifen (Abb. 32), die sichrecht gut datieren ließen und eine Beraubungdieser Grabanlage in der ersten Hälfte des 19. Jh.sbelegen. Eine Durchmischung des Schacht-inventars mit Keramikscherben aus verschiede-nen altägyptischen Zeiten dagegen kann einAnzeichen dafür sein, daß diese Grabanlageschon zu jener Zeit einmal oder mehrfach wieder-benutzt wurde.
Dieses System einer schicht- bzw. abhubwei-sen Entfernung des Schuttmaterials wird auch inder oder den Grabkammern fortgeführt, die vomBoden eines Schachtes ausgehen (Abb. 33).Dabei zeigt sich oft, daß sich das Inventar derAbhübe unmittelbar oberhalb des Felsbodens vonSchacht und Kammern grundsätzlich von demder höher liegenden unterscheidet: In den boden-nahen Abhüben lassen sich erfreulicherweiseauch bei scheinbar vollkommen beraubten Grab-anlagen noch Reste des alten Bestattungsinven-tars finden, die eine Datierung der Bestattungund teilweise Rekonstruktion der Beigaben erlau-ben. Der Grund dafür liegt in der Arbeitsweiseder Grabräuber, die – im Gegensatz zu denmodernen Archäologen – die Schächte und Kam-mern nie vollständig vom Schutt befreiten, son-dern sich lediglich durch den Schutt „tunneln“,bis sie an die Objekte ihrer Gier herankommen.
Die Ausgrabung der Grabanlage der Gehesetzog sich über zwei Kampagnen hin. Nach derEntdeckung des Schachtes in der Herbstkampa-gne 2003 konnte das Schuttmaterial bis zumGrabungsende Anfang Dezember bis in eineTiefe von 4,99 m unterhalb des Schachtmundesentfernt werden, ohne daß sich der Eingang ineine Grabkammer abzeichnete. Das Schachtin-ventar bestand bis zu diesem Punkt aus einemfast „üblich“ zu bezeichnenden Gemisch ausObjekten verschiedenster Epochen: In den ober-flächennahen Abhüben ließen sich zunächst neu-zeitliche Objekte finden, wie etwa Teile von Ziga-rettenschachteln der Marken „Matossian“ und
Abb. 36Wenige Abhübe später ist auch die Öffnung erkennbar, die Grabräuber mit einem Metallwerkzeug gewaltsamin Deckel und Fußplatte des Sarges geschlagen hatten. Zu diesem Zeitpunkt blockiert ein großer Kalkstein-brocken die Sicht in das Innere des Sarges. Rechts im Bild sind die Reste des alten Speiseopfers noch fast in ihrerursprünglichen Position sichtbar – der Schädel und Schenkelknochen eines Rindes (siehe Abb. 46). Die großenSteinbrocken im Vordergrund sind die Reste der alten Vermauerung des Kammereingangs, den die Grabräuberentfernt hatten, um zum Sarg zu gelangen.
Abb. 37Ein erster Blick in das Innere des Sarges zeigt nicht nur den Titel und Namen des Sargbesitzers (die Hierogly-phen in der waagrechten Inschriftzeile), den „Richter Imeni“, sondern auch die farbenprächtige und außerge-wöhnlich gut erhaltene Dekoration der Innenseiten des Sarges.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 29
30 DANIEL POLZ
Abb. 38Nach dem Entfernen der Stein-brocken vor dem Sarg wird dasdurch die Grabräuber geschla-gene Loch in der Fußplatte desImeni-Sarges deutlich erkennbar.Der Blick ins Innere des Sargeszeigt den Innensarg der Geheset,dessen Deckel und Fußplatte vonden Grabräubern entfernt wur-den, um an die Mumie der Gehe-set zu gelangen. Während dieFußplatte nahezu unversehrt imSchutt der Vorkammer aufgefun-den wurde, fehlte vom Sarg-deckel bis auf einige Fragmentejede Spur.
Abb. 39Ein Blick ins Innere des Imeni-Sarges läßt die hervorragendeErhaltung seiner Dekoration undder Farben erkennen. Deutlichsichtbar sind an den Längsseitender Sargwanne die sog. Geräte-friese, die Teile einer idealenGrabausstattung darstellen,sowie die fast vollkommen vonreligiösen Texten bedeckte In-nenseite des Sargdeckels.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 30
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 31
„Maspero Freres Ltd.“, die in die ersten Jahrzehntedes 20. Jh.s zu datieren sein dürften. Analtägyptischen Objekten fanden sich in denAbhüben Holzfragmente, Tier- und Menschen-knochen, Mumienbinden, Sarg- und Karto-nagefragmente, Perlen, Uschebtis (kleine „Diener-figuren“ aus Ton und Fayence) und Fragmentebearbeiteten Gesteins von Gefäßen, Statuen oderGrabstelen (z. B. Kalkstein, Sandstein, Granit).Die häufigste Fundgruppe bildete auch in diesemSchacht das keramische Material, das fast aus-nahmslos in zerscherbter Form gefunden wurde.Die Analyse der Keramik ergab zunächst, daßsich auch in dieser Anlage Aktivitäten über einengrößeren Zeitraum belegen ließen: Im kerami-schen Material befanden sich Scherben sowohlder früheren wie späteren Zweiten Zwischenzeit,der 18. Dynastie, der Ramessiden- und der Spät-zeit; insgesamt spiegelt das Inventar der Schutt-verfüllung des Schachtes also Aktivitäten über ei-nen Zeitraum von über 1000 Jahren wider. Indiesem speziellen Fall ist das u. a. darauf zurück-zuführen, daß im Lauf der Zeiten das Materialdes Schachtes von K03.4 durch einen größeren
Durchbruch mit dem Material der daneben lie-genden Anlage K03.2 stark vermischt wurde.
Die Arbeiten im Schacht wurden am4.10. 2004 wieder aufgenommen. In einer Tiefevon 6,20 m unterhalb des Schachtmundes wurdedie Oberkante eines Eingangs zu einer Grabkam-mer sichtbar. Im Schachtinventar direkt davorfanden sich größere Mengen an stark zerstörtenMumienresten und Knochen, was bereits vor derAusgrabung der Kammer ein deutliches Zeichenfür deren komplette Beraubung darstellte. Umeine möglichst klare Trennung des Schachtinven-tars vom Inventar der Kammer zu erhalten, wur-de auch nach Entdeckung der Kammer zunächstnur der Schutt des Schachtes so weit abgegraben,bis sich der Kammerboden abzeichnete. Erstdann begannen die Abhübe in der Kammer, diesich zunächst als bemerkenswert fundleer erwies;wir mußten demnach davon ausgehen, daß siesich tatsächlich als komplett beraubt herausstel-len würde. Im Verlauf der Ausgrabungen inner-halb der Kammer zeigte sich allerdings bald, daßdiese im Grunde nur eine Vorkammer zur eigent-lichen Sargkammer darstellt, die einen leichten
Abb. 40–41Die in farbenprächtigenHieroglyphen ausgeführtenmonumentalen, horizontalen Inschriften der Sargwanne ent-halten Opferformeln für die „Ka-Seele“ des Verstorbenen;am Ende der Zeilen sind jeweilsTitel und Name des Imeni genannt.
Abb. 40
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 31
32 DANIEL POLZ
�Abb. 42Auch in den insgesamt achtsenkrechten Inschriftkolumnender Außenseite der Sargwannewerden regelmäßig Titel undName des Imeni genannt – mitAusnahme zweier Kolumnen inder Mitte von Kopf- und Fußteil:Mit diesen Inschriften wird derSarg „umgewidmet“ und dieHausherrin Geheset zur neuenBesitzerin des Imeni-Sarges.
Knick zur Längsachse des Schachtes aufwies. ImSchutt der Vorkammer fanden sich dann dieersten Objekte, die sich einer Bestattung zuwei-sen ließen. Diese bestanden neben einigen grünbemalten Fragmenten eines hölzernen Kasten-sarges vor allem aus der fast vollständig erhalte-nen Fußplatte der Sargwanne dieses Sarges, diemit dem Titel und dem Namen seiner Besitzerinbeschriftet war: Vor uns lagen die offenbar spär-
lampe zeigte, daß wir hier auf eine für die gesamtethebanische Nekropole in jüngerer Zeit einzig-artige archäologische Situation gestoßen waren.Hier ruhte ein großer Holzsarg aus dem spätenMittleren Reich noch exakt an dem Ort, an demer vor über 3700 Jahren deponiert worden war(Abb. 35). Mehr noch: Dieser erste Blick berech-tigte zu der Annahme, daß sich die Bestattung alsintakt, jedenfalls aber als unberaubt, erweisenkönnte, denn der Deckel des großen kastenför-migen Sarges befand sich offenbar noch in seineralten Position. Zu diesem Zeitpunkt konnten wirnoch keine Verbindung zwischen diesem Sargund der kurz zuvor aufgefundenen, herausgebro-chenen Fußplatte des Geheset-Sarges herstellen,denn die Särge gehörten zwei unterschiedlichenTypen an. Eine Zeile in den Eintragungen diesesTages in dem sonst in nüchtern-sachlichem Tongehaltenen Feldtagebuch gibt die Euphorie derAusgräber wieder: „Alles in allem die Sensa-tion!!!“.
Die Euphorie verflog auch dann nicht, als sichwährend der folgenden Abhübe eine etwas andereund komplexere Befundsituation ergab: Der neu entdeckte Sarg befand sich zwar an seiner al-ten Position, auch der Sargdeckel war noch anseinem Platz. Allerdings hatten Grabräuber in dieFußplatte des Sarges mit einem scharfen Metall-werkzeug ein etwa 80 cm breites und 40 cmhohes Loch geschlagen, das ihnen ausreichendRaum bot, in das Innere des Sarges einzudringen(Abb. 36). Die Verwendung eines Metallwerk-zeuges läßt darauf schließen, daß es sich hier eherum eine Beraubung der Neuzeit als um einesolche der Antike handelt. Als die Grabräuber ihrWerk erfolgreich beendet hatten und die Vor-kammer verließen, löste sich aus dem Schutt derKammer ein großer Felsbrocken und rutschte vorden Sarg; dieser Block verstellte uns während derweiteren Ausgrabung zunächst den Blick in dasInnere des Sarges (Abb. 37). Einige Abhübespäter war der Befund aber klar (Abb. 38–41)und ein erster Teil der Geschichte dieser Bestat-tung konnte rekonstruiert werden: Im Innerendes großen Sarges befand sich ein weiterer kleine-rer Holzsarg, der einst die Mumie der hier bestat-teten Person enthielt (Abb. 38–39). Von dieseminneren Sarg fehlten nun aber sowohl der Sarg-deckel als auch – die Fußplatte. Die Inschriftendes inneren Sarges ließen keinen Zweifel, daß die
lichen Reste der Bestattung einer „Hausherrin“namens Geheset (Abb. 34).
Damit war bereits an diesem Punkt ein wich-tiges Ziel unseres Projektes in der Nekropole vonDra‘ Abu el-Naga erreicht, nämlich die Zuwei-sung einer Grabanlage an eine bestimmte Personaus einer bestimmten Zeit. Allein die Fußplattedes Geheset-Sarges erlaubte eine erste chrono-logische Fixierung ihrer Bestattung. Aufgrundähnlich dekorierter, typologisch grob datierbarerSärge ließ sich die Bestattung der Geheset aufeinen Zeitraum zwischen der 12. und der 13. Dynastie einschränken – ihre Bestattungstellt somit eine der älteren in einer Felsgraban-lage in diesem Areal von Dra‘ Abu el-Naga dar.
Die weitere Ausgrabung der Sargkammerergab außer einigen, meist kleineren Fragmentendes Sarges der Geheset kaum weiterführendeFunde oder archäologische Befunde. Die an-schließend fortgesetzten Grabungen in der Vor-kammer, deren Felsboden noch nicht erreichtwar, führten indes am 21.10. 2004 zu einer uner-warteten Entdeckung: Etwa 1 m unterhalb desBodens der Sargkammer und 8,90 m unterhalbdes Schachtmundes, leicht nach Osten versetztund in der Längsachse des Schachtes liegend,tauchte unvermittelt die Oberkante des Eingangseiner weiteren Kammer auf. Schon ein ersterBlick in diese Kammer im Licht einer Taschen-
Abb. 41Titel und Name des Sargbesit-zers: „Der Richter Imeni, gerecht-fertigt“.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 32
34 DANIEL POLZ
Abb. 43Die komplett erhaltene Wid-mungsinschrift an Geheset in der Mitte des Kopfteils lautet:„Er hat (ihn, d. h. den Sarg) seinergeliebten Frau, der HausherrinGeheset, gerechtfertigt und ehr-würdig, gegeben“.
Abb. 44Die Detailaufnahme vom Kopf-teil des Imeni-Sarges läßt deut-lich die unterschiedlicheAusführung und Erhaltung derInschriften erkennen: Währenddie waagrechte Zeile stellen-weise Verwitterungsspuren aufweist und auch die Innen-zeichung der einzelnen Zeichenmit der weißen Außenfarbe desSarges überzogen sind, erwecktdie senkrechte Widmungs-inschrift den Eindruck, als sei siegerade erst graviert worden. DieInnenflächen der Hieroglyphenzeigen das „frisch“ bearbeiteteHolz. Auch haben sich nur in dieser Inschrift Reste der sog.Vorzeichnung der Linien undHieroglyphen erhalten.
wenige Tage zuvor im Schutt der Vorkammer ge-fundene Fußplatte des Sarges der Geheset zu die-sem Sarg gehörte. Da die Grabräuber den Deckeldes großen Sarges wegen der geringen Höhe derSargkammer nicht anheben konnten, zerstörtensie die Fußplatte und den Deckel des inneren Sar-ges durch das Loch, das sie zuvor in den äußerenSarg geschlagen hatten und entfernten dieMumie und vermutlich weitere Gegenstände derGrabaustattung der Geheset aus dem Innerenbeider Särge. Die Fußplatte ließen die Grabräu-ber im Schutt der Vorkammer zurück; denDeckel entfernten sie, aus welchen Gründen auchimmer, fast vollständig, bis auf einige wenigeTeile, die sich im Schutt der Schachtanlage fan-den (siehe Kap. 12).
Der Blick durch das Grabräuberloch amFußende des äußeren Sarges zeigt aber vor allem,worin die eigentliche Besonderheit der Ent-deckung liegt (Abb. 39–41). Die Innenwände desSarges sind vollständig mit verschiedenen Dar-stellungen dekoriert, vor allem aber mit Texten.Ungemein beeindruckend ist dabei der fast per-fekte Erhaltungszustand der Farben, die währendder vergangenen 3700 Jahre kaum an Leuchtkraftverloren zu haben scheinen. Die Inschriften desSarges geben an vielen Stellen auch den Titel undden Namen seines Besitzers wieder, besondershervorgehoben in den farbenprächtigen, umlau-fenden Monumentalinschriften (Abb. 40–41):Der Sarg wurde demnach für einen „Richter“namens Imeni angefertigt, der an einer einzigenweiteren Stelle noch den zusätzlichen Titel „Vor-steher der Schreiber“ trägt (Abb. 44). Sein Titelund Name finden sich auch in den senkrechtenInschriftkolumnen auf der Außenseite, so etwaan den Kanten der Fußseite (Abb. 42). Nur hierund an der Kopfseite wurde aber jeweils nocheine weitere Inschriftkolumne angebracht, diesich in Inhalt und Ausführung grundsätzlich vonallen Inschriften, die den Richter Imeni nennen,unterscheiden – denn in diesen beiden Inschrif-ten wird die Eigentümerin des inneren Sarges ge-nannt, die Hausherrin Geheset. Mehr noch: Mitdiesen kurzen Inschriften wird sie zur offiziellenBesitzerin auch des großen Sarges, der ursprüng-lich für Imenis Bestattung angefertigt wurde. DerText lautet: „Er hat (ihn, d. h. den Sarg) seinergeliebten Frau, der Hausherrin Geheset, gerecht-fertigt und ehrwürdig, gegeben“ (Abb. 42–43).
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 34
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 35
Abb. 45Die Särge an ihrem alten Standort während der weiteren Ausgrabung. Noch ist der Felsboden in der Vorkammer nicht erreicht; vor dem Imeni-Sarg sind noch einzelne Steinblöcke der einstigen Vermauerung der Kammer in situ erhalten. Auf der westlichen „Mastaba“ am linken Bildrand liegen noch einige dergroßen „Bierflaschen“, die Teil der Grabausstattung der Geheset waren.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 35
36 DANIEL POLZ
Wie ein direkter Vergleich zeigt (Abb. 44) sinddiese beiden Inschriftenkolumnen deutlich späterangebracht worden als die übrigen Inschriften derAußenseite des Imeni-Sarges. Die Imeni-Inschrif-ten sind erheblich verwitterter als die der Gehe-set, insbesondere an den Rändern der einzelnenHieroglyphen. Die Inschriften der Gehesetweisen überdies noch Reste der mit schwarzerFarbe aufgetragenen Vorzeichnung auf, die demGravieren der Zeichen vorausging. Zudem sinddie Imeni-Hieroglyphen auch in ihren Innen-flächen mit dem weißen Verputz überzogen, mitdem der ganze Sarg angestrichen war – dieHieroglyphen der Geheset-Inschrift dagegenzeigen diesen Verputz nicht, sie müssen also nach dem Anstrich des Sarges angebracht wor-den sein.
Diese Umwidmung des Imeni-Sarges anGeheset wirft Fragen auf: Warum läßt sich Imenieinen sehr aufwendigen Sarg herstellen, den erdann in nur wenigen Inschriften an der Außen-seite seiner Gattin widmet? Ließ er sich einenneuen Sarg anfertigen oder wurde der „alte“ Sargfür seine eigene Bestattung gar nicht mehrbenötigt? War Imeni vielleicht nicht in Thebenbestattet? Ist der Angabe der ehelichen Beziehungzwischen Imeni und Geheset überhaupt zu trauen?
Doch zunächst zurück zur Ausgrabung derGrabanlage K03.4. Die weiteren Abhübe in derVorkammer ergaben eine kleine archäologischeÜberraschung: Noch bevor der Felsboden derVorkammer erreicht war, tauchten aus demSchutt zu beiden Seiten der Kammer schmaleAbsätze im Fels auf, die uns schon aus anderenGrabanlagen in Areal H von Dra‘ Abu el-Nagabekannt sind. Oft waren diese steinernen „Bän-ke“ (oder, nach dem arabischen Wort für Bank,„Mastaba“) parallel zu den Längsseiten einesSarges angelegt worden, wo sie als Deponierungs-
Abb. 46Detailaufnahme des Schädels und der Schenkelknochen eines Rindes in ihrer Fundposition auf der östlichen„Mastaba“. Die Knochen haben sich hier seit ihrer Deponierung vor 3700 Jahren durch die Verwesung desFleisches und den Druck des Schuttes nur wenig bewegt: So hat sich z. B. im Lauf der Zeit das linke Horn desRinderschädels von seinem Hornzapfen gelöst (am linken Bildrand sichtbar).
�Abb. 47Zeichnerischer Schnitt durch die Grabanlage der Geheset, der dieFundposition des Sarges, aber auch die geringe Größe der Sargkam-mer im Vergleich zu den Ausmaßen des Sarges verdeutlicht. Schon aus dieser Zeichnung wird ersichtlich, daß die Sargkammer nicht ur-sprünglich für den Sarg des Imeni angelegt worden ist, bzw. der Sargnicht für den endgültigen Standort in dieser Kammer konzipiert war. Bemerkenswert ist das starke Gefälle, mit dem der Felsbodenkontinuierlich vom Schacht bis in die Sargkammer absinkt.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:52 Uhr Seite 36
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 37
Abb. 48Ansicht der ersten, oberen Kammer, des Vorraumes und der Sargkammer nach Abschluß der Ausgrabungen in der Grabanlage der Geheset. Auch hier ist klar erkennbar, daß die Sargkammer nur unwesentlich größer als der Sarg ist – ein Umstand, der im Grunde auch den altägyptischen Bestattern frühzeitighätte auffallen müssen.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:53 Uhr Seite 37
Abb. 49Der Deckel des Imeni-Sarges vonoben nach der Restaurierung;der kopfseitige Querbalken istwieder auf dem Deckel befestigt,an der Fußseite markiert nur dasFehlen der weißen Überzugs-farbe die alte Position des dorti-gen Querbalkens. Von diesemließen sich weder innerhalb nochaußerhalb der Kammern Restefinden.
Abb. 50Ansicht des Inneren der Sarg-kammer nach dem Entfernendes Sarges. Die Fundlage des hiersichtbaren Querbalkens vomDeckel des Imeni-Sarges wareine Überraschung: Wegen dergeringen Größe der Kammerkonnte der Balken nur währendder Bestattung an diese Stellegelangt sein.
Abb. 51Detailaufnahme des kopfseiti-gen Querbalkens auf dem Deckeldes Imeni-Sarges. An drei Stellensind deutliche Spuren mechani-scher Bearbeitung sichtbar, dienicht in Zusammenhang mit derHerstellung des Sarges stehen:Am rechten Ende des Balkenswurden mit einem scharfenWerkzeug einige Zentimeterabgeschlagen, in der Mitte undam linken Rand finden sich dieSpuren von Stößen , welcheunter großer Kraftaufwendungmit einem Stab- oder Stock-ähn-lichen Gegenstand ausgeführt worden sein mußten.
38 DANIEL POLZ
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:53 Uhr Seite 38
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 39
ort für eine spezielle Art von Grabbeigaben dien-ten. Diese kleinen Mastabas waren der Ort, andem während der Bestattungszeremonien ein Teilder materiellen Versorgung des Toten abgelegtwurde, d. h. in erster Linie Lebensmittel im wei-testen Sinne. In der Grabanlage der Geheset hat-ten sich nun unter dem Jahrtausende alten Schuttder Vorkammer auf beiden Mastabas Reste dieserLebensmittel bzw. ihre Behälter erhalten. Auf derwestlichen Mastaba fanden sich sieben großeVorratsgefäße an ihrem alten Platz (Abb. 45, amlinken unteren Bildrand), die zwar unter demDruck des Schuttes stark zerstört worden waren,sich aber nahezu vollständig rekonstruierenließen (dazu ausführlich A. Seiler in Kap. 9 mitAbb. 126–133). Diese Vorratsgefäße, in derÄgyptologie häufig „Bierflaschen“ genannt, ent-hielten einst Bier, Wasser und/oder Wein für dieVersorgung der Toten im Jenseits. Auf der öst-lichen Mastaba dagegen lagen die skelletiertenKnochen eines Rinderschenkels und einesRinderkopfes noch an ihrem alten Deponie-rungsort (Abb. 36 und 46) – beides „Standard“-Grabbeigaben dieser Zeit, wie sie auch in den
Darstellungen von Opfertischen und -aufbautenhäufig zu sehen sind (vgl. Kap. 8 und Abb. 117).
Erst mit den letzten Abhüben der Ausgrabungin der Vorkammer vervollständigte sich unser
Abb. 52Detailansicht vom rechten Ende des Querbalkens. Die sicht-baren Spuren der Abarbeitungmachen die Verwendung einesBeil- oder Axt-ähnlichen Werk-zeugs wahrscheinlich.
Abb. 53Zeichnerische Rekonstruktionder letzten Phase der Bestattungder Geheset. Das Sargensemblewird vom Schacht in den Vor-raum und weiter in die Kammergeschoben. Hier zeigt sich, daßder Imeni-Sarg zu groß für dieKammer ist, die rechte Ecke desvorderen Querbalkens stößt ander niedrigen Decke an.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:53 Uhr Seite 39
40 DANIEL POLZ
Abb. 54Mit einem Beil- oder Axt-ähn-lichen Metallgerät wird die Eckedes Querbalkens soweit abge-arbeitet, daß der Sarg weitergeschoben werden kann.
Abb. 55Bald jedoch steckt der Sargwieder fest, da der Boden derSargkammer leicht ansteigt.Der vordere Querbalken wirdnun mit einem langen Stab oder Stock vom Sargdeckel herabgestoßen …
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:53 Uhr Seite 40
DIE GRABANLAGE DER GEHESET 41
Bild der Architektur der Grabanlage. Nun wurdedeutlich, daß die Sargkammer der Geheset alsFortsetzung des Schachtes konzipiert war, wobeidie Felsböden des Schachtes, der Vorkammer undder Sargkammer bei nahezu gleichbleibendstarkem Gefälle nahtlos ineinander übergingen(Abb. 47). Dagegen lag die von uns zunächst alseigentliche Sargkammer der Anlage interpretierteKammer auf höherem Niveau und in einemleichten Winkel zur Achse des Schachtes (Abb. 48). Auf der zeichnerischen Schnittansichtder Gesamtanlage in Abb. 47 wird zudem ersicht-lich, daß die Sargkammer der Geheset im Grundezu klein für den großen Sarg des Imeni ist.
In der Tat lassen sich am Imeni-Sarg selbst wei-tere deutliche Indizien für die Annahme finden,daß die Kammer ursprünglich nicht für die Auf-nahme dieses Sarges angelegt worden war. Dazuist ein genauer Blick auf den Deckel des Imeni-Sarges nötig (Abb. 49): Wie bei den Särgen die-ser Zeit häufig, war auf der Oberseite des Deckelsan Kopf- und Fußende einst jeweils ein mächti-ger Querbalken angebracht, der dem Sarg einschreinartiges Aussehen verleihen sollte. Bei der
Auffindung und Bergung des Sarges waren beideQuerbalken nicht mehr auf dem Deckel befe-stigt. Während der Querbalken des Fußendesverschwunden blieb, ließ sich der Querbalken desKopfendes wiederfinden – hinter dem Sarg in derSargkammer! Da sich nach der erfolgten Depo-nierung des Sarges vor 3700 Jahren niemandmehr in der Kammer aufgehalten haben kann,muß der Querbalken vor bzw. während der Be-stattung in die Position gelangt sein, in welcher ervon uns aufgefunden wurde, nämlich am Endeder kleinen Sargkammer (Abb. 50). Bei nähererBetrachtung der Innenseite des Querbalkens er-gibt sich die Erklärung für diesen Befund:Zunächst weist der Querbalken dort an seinemrechten Ende (Abb. 51–52) eine Abarbeitung auf,die mit einem Beilklingen-ähnlichen Werkzeugausgeführt worden sein muß. Da die Schnitt-flächen im Vergleich zur sonst leicht verwittertenOberfläche der Außenwände des Sarges auchheute noch fast frisch aussehen und nicht wiedermit dem weißen Verputz überzogen wurden, liegtes nahe, die Abarbeitung in Zusammenhang mitder Bestattung zu bringen: Bereits vor dem Ein-
Abb. 56… und befindet sich nun vordem Sarg. Beim weiteren Be-wegen des Sarges wird der Quer-balken mit dem Sarg tiefer in die Kammer geschoben. An die-sem Ort konnte er nach der Bergung des Sarges wieder entdeckt werden (siehe Abb. 50).Den ebenfalls entfernten Quer-balken am Fußende des Sargesnahmen die Bestatter aus derGrabanlage mit.
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:53 Uhr Seite 41
42 DANIEL POLZ
bringen des Sarges in die Kammer müssen die be-stattenden Personen erkannt haben, daß derkopfseitige Querbalken des Sargdeckels an derKammerdecke hängen bleiben würde. Daraufhinwurde mit dem genannten Werkzeug die kriti-sche östliche Ecke des Querbalkens abgearbeitet,wobei man sicher davon ausging, daß die weitereEinbringung des Sarges in die Kammer nunproblemlos vonstatten gehen würde. Ein Betre-ten der Kammer, um etwa die Kammerhöhegenauer zu vermessen, war in diesem Stadiumwohl nicht mehr möglich, der Sarg blockierte be-reits den Kammereingang.
Der Sarg konnte nun weiter in die Kammergeschoben werden, allerdings nur bis etwa zurKammermitte, denn hier steigt der Felsbodenleicht an (siehe Abb. 47) – der Sarg steckte end-gültig fest. Es muß den Bestattern klar gewesensein, daß es hier nur um wenige (altägyptische)Fingerbreiten ging und die Lösung des Problemsnur in der Entfernung des blockierenden Quer-balkens liegen konnte. Um aber an diesen über-haupt herankommen zu können, mußte auch derQuerbalken an der Fußseite des Deckels entferntwerden. Nachdem dies geschehen war, führteman einen oder zwei lange Stäbe oder Stöckezwischen der Oberseite des Sarges und der Kam-merdecke hindurch und hieb mit diesen solangeauf die Mitte und das linke Ende des Querbal-kens ein, bis sich dieser aus seiner Verankerunglöste und hinter die Kopfseite des Sarges fiel. Diemassiven Stoßspuren am Querbalken zeigen, daß
zumindest der in der Mitte benutzte Stock einenquadratisch-rechteckigen Querschnitt hatte undan seinem Ende mit einer leicht abgerundeten,vielleicht metallenen Hülse umgeben war (Abb. 51). Der Sarg konnte nun vollständig indie Kammer eingebracht werden; er schob dabeiden auf dem Kammerboden liegenden Querbal-ken vor sich her bis zum Ende der Kammer, wo er nach der Bergung des Sarges von uns auf-gefunden wurde. Der zuvor abgenommene fußseitige Querbalken wurde nach erfolgter Bestattung und Zumauerung der Sargkammeroffensichtlich aus der Grabanlage entfernt, vonihm ließ sich nicht das kleinste Fragment finden.Das geschilderte Prozedere bei der Bestattung der Geheset ist in einer Sequenz auf vier Aqua-rellen von Pieter Collet illustriert worden (Abb. 53–56).
Diese Beschreibung von eher technischenBegleitumständen der Einbringung des Sarges indie Kammer wurde bewußt ausführlicher gestal-tet, denn gerade hier ergeben sich Fragen imHinblick auf die Hintergründe der Bestattungvon Geheset: Offensichtlich war die Grabanlageursprünglich nicht für die Aufnahme des Imeni-Sarges vorgesehen. Aber war sie vielleicht fürGeheset und ihre Bestattung lediglich in ihreminneren Sarg, der bequem in die Sargkammergepaßt hätte, angelegt worden? Warum kam eszu der für uns verwirrenden Unsicherheit seitensder Bestatter über die Größenverhältnisse vonSargkammer und Imeni-Sarg?
KAPITEL 4.qxd 30.07.2007 13:53 Uhr Seite 42
KAPITEL 5
Die Bergung des SargensemblesDaniel Polz
Die sich über mehrere Wochen hin erstreckendenVorbereitungen und die anschließende Bergungder Särge sind in wesentlichen Zügen in demDokumentarfilm auf der DVD dargestellt, diediesem Band beigegeben ist. Hier sollen deshalbim Folgenden nur einige ergänzende Bemer-kungen und Illustrationen hinzugefügt werden.Nachdem am 3.11. 2004 die letzten Reste desSchutts in der Vorkammer entfernt und dieAusgrabungen in der Grabanlage der Gehesetdamit abgeschlossen waren, stellte sich natur-gemäß die Frage, wie die Bergung der Särge undihr Transport in ein Magazin der ÄgyptischenAntikenverwaltung durchzuführen sei. Bei allenÜberlegungen hierzu hatte die Sicherung derSärge, insbesondere ihrer Dekoration, oberstePriorität. Es mußte ein Bergungsverfahren ge-wählt werden, durch das die Gefahr einer Beschä-digung der Dekoration so gering wie möglichgehalten würde. Sicherlich stellten die Ausmaßeder Kammer und die Größe des Imeni-Sargeshierbei das größte Problem dar: Wie den vor3700 Jahren mit der Bestattung der Gehesetbetrauten Personen war es auch uns unmöglich,in die Grabkammer zu gelangen. Wegen dergeringen Höhe der Kammer konnten die Särgezudem nicht weit genug angehoben werden, umsie etwa komplett mit einer Plattenkonstruktionzu unterfangen, auf der sie aus der Kammerhätten gezogen werden können.
Noch bevor die ersten konkreten Überle-gungen zum eigentlichen Bergungsverfahrenangestellt werden konnten, mußte zunächst derErhaltungs- und Gefährdungszustand der beidenSärge untersucht und dokumentiert werden.Diese Aufgabe übernahm der Restaurator EricoPeintner, der sich schon seit langer Zeit mit derKonservierung und Restaurierung von Holzob-
jekten auf Ausgrabungen in Ägypten beschäftigt.Bevor diese erste Phase der Bergung begonnenwerden konnte, d. h. die Untersuchungen zumZustand der Särge und ihrer Dekoration, mußtenaus dem Inneren der Särge der Schutt und einigegrößere Kalksteinbrocken entfernt werden, dieim Lauf der Zeit durch das von den Grabräuberngeschlagene Loch dorthin gelangt waren, aberauch Holzfragmente von beiden Särgen undReste der Bestattung der Geheset wie Mumien-binden und Knochen (Abb. 57). Dabei konnten
Abb. 57Durch das Grabräuberloch derFußplatte hindurch werden Holz-fragmente, Mumienbinden undKnochen aus dem Inneren derSärge entfernt.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 43
44 DANIEL POLZ
Abb. 58Eine erste Dokumentation desZustandes der Dekoration imInneren des Imeni-Sarges ge-schieht ebenfalls durch das vonden Grabräubern geschlageneLoch. Hierbei wird untersucht,inwieweit die Dekorationwährend der letzten Jahrtau-sende Schaden genommenhaben könnte und in welcherWeise sie durch die Aktionen der Grabräuber beschädigtwurde.
Abb. 59Es zeigte sich bald, daß einevorläufige Notsicherung derDekoration für den geplantenTransport der Särge durch-geführt werden mußte. Diesekonnte nun aber nicht allein von außen durch das Grab-räuberloch vorgenommenwerden.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 44
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 45
Abb. 60Nachdem der Restaurator EricoPeintner vorsichtig in das Inneredes Innensarges gehoben wor-den war, konnte er dort mit derDokumentation der entstande-nen Schäden beginnen.
Abb. 61Die Zerstörungen an der Dekora-tion des Imeni-Sarges erwiesensich insgesamt als erfreulichgering. An einigen Stellen warenkleinere Bereiche der Dekorati-onsschicht vom Untergrundabgeplatzt, andere Bereichewaren leicht verwischt.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 45
46 DANIEL POLZ
Abb. 62Die gefährdeten Bereiche derDekoration wurden mit sog.Japanpapier und einer Cellulose-Alkohol-Lösung gesichert, diesich später rückstandsfrei wiederentfernen ließen.
naturgemäß zunächst nur die Objekte aus demSarginneren geborgen werden, die durch dasGrabräuberloch erreichbar waren. Die erstenUntersuchungen galten der Dekoration an denInnenwänden des Imeni-Sarges, die ebenfallszunächst nur von außen durchgeführt wurden(Abb. 58–59). Allerdings war der Handlungs-spielraum lediglich durch das Loch im Fußteildes Sarges zu begrenzt, um auch den kopfseitigenBereich der Sargwanne erreichen zu können. Eswurde deshalb ein weiteres Vorgehen beschlossen,das auf den ersten Blick ungewöhnlich erschei-nen mag, aber nach Lage der Dinge das einzigerfolgversprechende war: Der Restaurator wurdein der Waagrechten in das Innere des Geheset-Sarges „geschoben“, von wo aus er sowohl dasweitere Entfernen von Objekten wie auch dieUntersuchung und Dokumentation in denvorderen Bereichen der Särge durchführenkonnte (Abb. 60–62).
Die Untersuchung ergab, daß die Dekora-tionsschicht an verschiedenen Stellen Risse undAbhebungen aufwies (Abb. 61); diese Stellen
waren diejenigen, die bei jeder Bewegung desSargensembles am stärksten gefährdet sein würden und die deshalb einer Notsicherung bedurften. Diese wurde von E. Peintner ebenfallsvom Inneren des Geheset-Sarges aus durchge-führt. Sie bestand u. a. darin, die gefährdetenBereiche der Dekoration des Imeni-Sarges mitsog. Japanpapier und einer speziellen Cellulose-Alkohol-Lösung so zu sichern, daß zu einemspäteren Zeitpunkt eine rückstandslose Entfer-nung gewährleistet war (Abb. 62). Anschließendwurden die Zwischenräume zwischen äußeremund innerem Sarg mit umwickelten Styropor-platten zugesetzt, um zu verhindern, daß sich derGeheset-Sarg während der Bergung des Ensem-bles im Inneren des Imeni-Sarges bewegen undso die Dekoration gefährden konnte (sichtbar inAbb. 65–66; zu der Untersuchung und dengetroffenen Maßnahmen im Einzelnen sieheausführlich Kap. 12).
Nach diesen Sicherungsmaßnahmen konntedie zweite Phase der Bergung in Angriffgenommen werden, die darin bestand, die Särge
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 46
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 47
Abb. 63Die eigentliche Bergung des Sarges war durch die beengten räumlichen Verhältnisse in Schacht und Vorkammer beeinträchtigt. Zum Bewegen der Särgehielten sich hier zeitweise zwischen 12 und 14 Mitarbeiter auf.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 47
48 DANIEL POLZ
Abb. 64Langsam werden die Särge mitHilfe der seitlich vorbeigeführtenStahlrohre und einem um einender Fußbalken befestigten Trans-portgurt aus der Kammer gezo-gen.
aus ihrer Kammer zu entfernen. Die Hindernisse,die hierbei zu überwinden waren, bestanden zumeinen in dem auf etwa 600–700 kg geschätztenGesamtgewicht des Sargensembles, zum anderenin dem extremen Gefälle, das der Felsboden desVorraums und der Kammer aufwies – die Särgemußten schließlich gegen den stark ansteigendenFelsboden bewegt werden. Als weiteres Hinderniserwies sich die geringe Bewegungsfreiheit, dieSchachtraum und Vorkammer boten. Nach einerlängeren Überlegungs- und Testphase wurdeschließlich folgendes Verfahren angewandt: Andie Enden zweier langer Stahlrohre wurdenrechtwinkelig Stahlwinkel angeschweißt; dieRohre wurden entlang der beiden Längsseiten desImeni-Sarges zwischen diesen und den Kammer-wänden bis hinter das Kopfende des Sargesgeführt und dann um 90° so gedreht, daß die mitSchaumstoff umwickelten Stahlwinkel etwa inhalber Höhe der Sargwand fassen konnten. Amanderen Ende der Stahlrohre wurden Hanfseileangebracht. Der Imeni-Sarg wurde an seinemFußende behutsam um 2–3 Zentimeter ange-
hoben, um zunächst einen breiten Transportgurtum den zweitletzten der vier quersitzendenFußbalken des Sarges zu winden. Daraufhinkonnten zwei zuvor fein geschliffene und miteiner schmierenden Lösung aus Wachs, Terpentinund Leinöl bestrichene Holzplanken unter diebeiden hinteren Fußbalken des Sarges geschobenwerden. Diese sollten das Bewegen des Sargeserleichtern und gleichzeitig verhindern, daß dieFußbalken bei der Bewegung über der un-regelmäßigen Felsoberfläche des Kammerbodensabbrachen. Am 29. 11. wurden die Särge zenti-meterweise aus ihrer Kammer geborgen. Dabeizogen jeweils sechs bis acht Mitarbeiter an den Seilen bzw. den mit diesen verbundenenStahlrohren, gleichzeitig zogen zwei bis dreiweitere an dem Transportgurt, der am zweit-letzten Fußbalken angebracht worden war (Abb. 63–65). Im Verlauf des Tages konnte dasSargensemble vollständig aus der Kammerbewegt und in dieser Position in der Vorkammer,also zwischen den beiden Mastabas, gesichertwerden (Abb. 66).
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 48
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 49
Abb. 65Um das Ziehen der Särge zuerleichtern, wurden zwei mitWachs und Leinöl bestricheneHolzplanken unter die beidenhinteren Fußbalken geschoben.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:56 Uhr Seite 49
50 DANIEL POLZ
Abb. 66Nachdem der Sarg in ganzerLänge aus der Kammer bewegtworden war, wurde er in der Vor-kammer in der hier sichtbarenPosition zwischen den beidenMastabas gesichert.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 50
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 51
Abb. 67In einem Stahlbearbeitungsbe-trieb im heutigen Dorf el-Tarifwerden die einzelnen Stahlträgerdes Käfigs zugeschnitten, mitSchraubenlöchern versehen …
Abb. 68… und probeweise zusammen-gesetzt.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 51
52 DANIEL POLZ
Abb. 69In der Vorkammer wird der Käfigum den Imeni-Sarg gebaut,wobei die Stahlträger durchSchrauben miteinander verbun-den werden. Durch die hier sicht-baren Ösen an der Oberseite desKäfigs wurden später die Hanf-seile geführt, an denen die Särgeaus dem Schacht gezogen wer-den sollten (siehe nächsteAbbildung).
Für die beiden nächsten Phasen der Bergung,das Bewegen der Särge von der Vorkammer inden Schacht und vom Schacht an die Oberfläche,mußte ein Verfahren entwickelt werden, mit demdie Särge selbst einer möglichst geringenBelastung ausgesetzt sein würden. Es bot sich an,eine Art Käfig um den Imeni-Sarg zu konstru-ieren, in welchem der Sarg relativ berührungsfreiaus Vorkammer und Schacht bewegt werdenkonnte. Das Material für den Käfig bestand aus Vierkant-Stahlträgern, die auf dem lokalenMarkt beschafft und zugeschnitten wurden (Abb. 67–68). In der Vorkammer wurden dieeinzelnen Stahlträger des Käfigs so um den Sargherum verschraubt, daß dieser nur an denäußeren Enden der vier Fußbalken auf denLängsträgern des Stahlrahmens aufsaß und sonstkeine weiteren Berührungspunkte mit dem Käfighatte (Abb. 69). Anschließend wurde ein dau-mendickes Hanfseil doppelt um den Käfig gelegt,das mit dem Stahlseil einer an der Oberfläche vordem Schachtmund angebrachten Winde verbun-den werden sollte. Durch vorsichtiges Anheben
des Sarges hätte dieser dann langsam aus derVorkammer in den Schacht und von dort ausnach oben transportiert werden sollen. Bald nachBeginn der weiteren Bergung stellte sich aberheraus, daß der Käfig um wenige Zentimetergrößer als die engste Stelle des Durchgangszwischen Vorkammer und Schacht war (Abb. 70): Auf diese Weise ließen sich die Särge also nicht aus der Vorkammer bewegen.Die oberen Teile des Käfigs mußten wiederentfernt und der Sarg mühsam auf dem unterenRahmen des Käfigs in den Schacht gescho-ben bzw. gezogen werden (Abb. 71). Erst imSchacht konnte der Käfig wieder zusammen-gesetzt und das Hanfseil angebracht und mit dem Stahlseil der Winde verbunden werden(Abb. 72).
Die letzte Phase der Bergung, das Emporhebendes Sargensembles im Schacht, erwies sichletztlich als unproblematisch, obwohl sich derKäfig bereits nach nur wenigen ZentimeternHöhe verzog und die Särge innerhalb des Käfigsverrutschten (Abb. 73). Um zu verhindern, daß
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 52
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 53
Abb. 70Der fertig installierte Käfig mitVerschnürung. Obwohl sich Käfigund Sarg nur an den Fußbalkenberührten, wurden die nahe am Sarg vorbeigeführten Stahl-träger sicherheitshalber mit Luft-folie umwickelt.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 53
54 DANIEL POLZ
Abb. 71Erst nach Fertigstellung desKäfigs stellte sich heraus, daß derDurchgang von der Vorkammerin den Schacht an einer Stelleschmaler war als die Käfigkon-struktion. Der gesamte obere Teildes Käfigs mußte deshalb wiederentfernt und die Särge mühsamgegen die Steigung des Bodensin den Schacht geschoben undgezogen werden.
Abb. 72Im Schacht wurde das Oberteildes Käfigs wieder am unterenRahmen befestigt, nachdemdieser in eine waagrechte Posi-tion gehoben worden war.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 54
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 55
Abb. 73Bereits kurz nach Anheben desKäfigs im Schacht verzog sich dieKonstruktion und das Sargen-semble verschob sich in Richtungdes Kopfendes.
Abb. 74Während des Emporziehenswurden die Bewegungen derKäfigkonstruktion mit einem am unteren Rahmen befestigtenSeil korrigiert.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 55
56 DANIEL POLZ
Abb. 75Am Schachtmund angelangt,schwebten die Särge in ihrerKäfigkonstruktion 10 m überdem Schachtboden.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 56
DIE BERGUNG DES SARGENSEMBLES 57
Abb. 77Als die Särge sicher und un-beschädigt auf dem Felsbodenneben dem Schachtmund stan-den, war der schwierigste Teil derSargbergung abgeschlossen.
Abb. 76Am Schachtmund wurde unterdem Käfig zunächst eine Behelfs-plattform aus massiven Holz-balken errichtet.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 57
58 DANIEL POLZ
Abb. 78Die Särge auf dem Weg in dasMagazin der ägyptischen Anti-kenverwaltung.
sich der Käfig während des Emporziehens imSchacht verkantete, wurde an seinem unterenRahmen ein weiteres Seil befestigt, mit dem vomSchachtboden aus die Bewegungen des Käfigswährend des Emporhebens korrigiert werdenkonnten (Abb. 74). Nachdem die Särge oberhalb
des Schachtmundes angelangt waren, wurde miteinigen Holzbohlen eine Behelfsplattformgeschaffen, von der aus der Weitertransporthügelabwärts durchgeführt werden sollte (Abb. 75–77). Von dort aus konnten sieschließlich auf der Ladefläche eines Kleinlastersin ein Magazin der ägyptischen Antikenver-waltung transportiert werden (Abb. 78).
Als die Särge am 2.12. 2004 wohlbehalten undohne Beschädigungen durch den Transport ihrenvorläufigen Bestimmungsort erreicht hatten(Abb. 79), war die Bergung dieses ungewöhn-lichen Sargensembles nach fast vier WochenVorbereitung und vier Tagen eigentlicher Ber-gungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Bis zumFrühjahr 2007 wurden die Särge restauratorischbehandelt, vermessen, gezeichnet, dokumentiertund photographiert. Ein Teil der Ergebnissedieser Bearbeitung wird in den folgendenKapiteln vorgestellt.
Abb. 79Das Ende einer langen Reise: das Sargensemble im Magazin der ägyp-tischen Antikenverwaltung, wo es in den Jahren 2004–2007 intensivbearbeitet wurde.
KAPITEL 5.qxd 30.07.2007 13:57 Uhr Seite 58
Die Särge des Imeni und der Geheset gehörenbeide zum Typ der kastenförmigen Särge (Abb.80–81) – im Gegensatz etwa zu mumienförmigenoder anthropoiden Sargtypen. Der Sarg des Imeniist 249,7 cm lang, 101,5 cm breit und 105,3 cmhoch (95,5 cm ohne Deckel); die Wände sinddurchschnittlich etwa 13,5 cm stark, womit dieInnenmaße des Sarges bei etwa 220,5 cm Länge,75,5 cm Breite und 92 cm Höhe liegen. Der Sargder Geheset weist erheblich kleinere Ausmaße auf:Er ist 185,7 cm lang, 51,7 cm breit und maximal69 cm hoch (63,5 cm ohne den Aufsatz am Kopf-ende); bei einer mittleren Wandstärke von ca.
4,5 cm betragen seine Innenmaße 177 cm Längeauf 43 cm Breite und 59 cm Höhe, d. h. der Sargbot ausreichend Platz für die Mumie einer eherkleineren Person.
Die Särge zeigen aber nicht nur hinsichtlichihrer Ausmaße Unterschiede, sondern auch in derArt und Ausführung ihrer Dekoration, ihrerKonstruktionsweise (Abb. 82), der Behandlungihrer Oberflächen und der Art des verwendetenHolzes. Auf manche dieser Themen wird in denfolgenden Kapiteln näher eingegangen, weshalbhier lediglich einige zusätzliche Beobachtungenwiedergegeben werden sollen, die u. a. das Zu-
KAPITEL 6
Die Särge des Imeni und der GehesetDaniel Polz
Abb. 80Die westliche Längsseite desImeni-Sarges. Die horizontale Inschriftzeile beinhaltet eine Opferformel an den Gott Anubis,in dem dieser um allerlei Opfer-gaben und ein „schönes Begräb-nis im Westen in seinem Grab inder Nekropole“ gebeten wird.Die beiden senkrechten Inschrif-ten enthalten eine Anrufung an zwei Schutzgottheiten, die„Horuskinder“ Hapi und Kebehsenuef (vgl. Abb. 104).
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:00 Uhr Seite 59
60 DANIEL POLZ
standekommen der Bestattung der Geheset be-treffen. Wie bereits erwähnt lassen sich am Sargdes Imeni deutlich Anzeichen für eine Überar-beitung finden: Am klarsten erscheinen diese anden beiden nachträglich hinzugefügten Inschrift-kolumnen an Kopf- und Fußseite der Sargwanne,in denen der Sarg an Geheset umgewidmet wird.Dies ist aber nicht die Einzige: Schon zuvor mußeine Überarbeitung der gesamten Außenflächenvon Sargwanne und Sargdeckel stattgefundenhaben. An einigen wenigen Stellen ist der nachder Gravur der Imeni-Inschriften aufgetrageneweiße Überzug so dünn, daß eine frühere Farb-schicht erkennbar wird. Bei dieser scheint es sichum einen dunklen, rotbraunen Anstrich gehan-delt zu haben, mit dem möglicherweise dieStruktur von Rosengranit wiedergegeben werdensollte. Damit hätte man versucht, dem Holzsargdas Aussehen eines Granitsarkophages zu verlei-hen – eine durchaus nicht ungewöhnliche Deko-rationsweise an Holzsärgen des MittlerenReiches1. Diese vielleicht ursprüngliche Farbe desImeni-Sarges wurde nun zunächst mit einer er-sten weißen „Grundierung“ überdeckt, wobeiunklar bleibt, ob dies bereits während der erstengeplanten Nutzung des Sarges für Imeni geschahoder erst im Zuge der späteren Umwidmung. Aufdiese Grundierung trug man dann während derUmwidmung die in schwarzer Farbe ausgeführ-
�Abb. 81Die westliche Längsseite desGeheset-Sarges. Die horizontaleInschrift enthält ebenfalls eineOpferformel an Anubis mit derBitte um ein „schönes Begräbnis".Die Inschrift ist fast identisch mit der des Imeni-Sarges, auchwenn sie wegen des geringerenRaumes etwas verkürzt wurde.Die beiden äußeren senkrechtenInschriften sind – wie bei Imeni –Anrufungen an die GottheitenHapi und Kebehsenuef, in denmittleren werden zwei Göttinnender Neunheit,Tefnut und Nut,angerufen (vgl. Abb. 105). DieseAufnahme wurde bewußt unterstarkem Streiflicht angefertigt,das die Struktur der für den Sarg-bau benutzten Holzbretter an-schaulich darstellt und erkennenläßt, daß die einzelnen Bretteraus demselben Stamm gesägtwurden.
�Abb. 82Teil der Dokumentation derSärge: Eine Bleistiftzeichnung derSüdseite des Imeni-Sarges nochan seinem alten Standort in derSargkammer. Die am oberenBildrand erkennbare Kammer-decke verdeutlicht – zusammenmit dem ergänzten, gestricheltdargestellten hinteren Quer-balken des Sargdeckels – diegeringe Höhe der Kammer imVergleich zu der des Sarges.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:00 Uhr Seite 60
DIE SÄRGE DES IMENI UND DER GEHESET 61
Abb. 83Kleine Gesamtansicht der öst-lichen Längswand des Imeni-Sarges mit der Position derDetailansicht. Unter der Eulen-Hieroglyphe und direkt unter-halb der Begrenzung derInschriftzeile sind geringe Restevon in schwarzer Farbe aus-geführten Zeichen zu erkennen.
Abb. 84Eine unter starkem Rotlichtaufgenommene und digitalbearbeitete Aufnahme derselbenStelle wie in Abb. 83 zeigt deut-lich Reste von Hieroglyphen undvon den Begrenzungslinien derInschriftkolumne (am rechtenBildrand).
ten Vorzeichnungen für die Widmungsinschrif-ten an Kopf- und Fußseite auf (siehe oben, Abb.43–44). Die detaillierte Aufnahme und Doku-mentation des Sarges ergab allerdings, daß dieseVorzeichnungen nicht die Einzigen waren: Anzwei Stellen der östlichen Längsseite der Sarg-wanne ließen sich Reste von Vorzeichnungen fin-den, die aus unbekannten Gründen nie aus-geführt, also in Holz graviert wurden. Die bei-den Stellen befinden sich jeweils oberhalb derbeiden mittleren Fußbalken und hätten, wärensie ausgeführt worden, die Längsseiten des Sargesauf ähnliche Weise durch senkrechte Inschriftko-lumnen gegliedert, wie dies beim Sarg der Gehe-set zu sehen ist (Abb. 81).
Welche Texte standen hier bzw. hätten an die-ser Stelle stehen sollen? Die Vorzeichnungsrestesind mit bloßem Auge kaum zu erkennen, da sievon einem abschließenden weißen Anstrich über-deckt wurden. Dennoch ließen sich Teile der In-schriften unter starkem Rotlicht und mit Hilfeeiner Infrarotkamera sichtbar machen (Abb. 83–85)2. Obwohl die Zeichenreste auch jetzt nochschwer zu erkennen waren – sie sind offensicht-lich zum Teil bewußt ausgewischt worden – er-lauben die erhaltenen Spuren eine zweifelsfreieLesung und damit Deutung der hier zu einembestimmten Zeitpunkt geplanten Inschriften:Während in Abb. 84 deutlich Reste des spitzenOpferbrotes und einer liegenden Hornviper er-kennbar sind, lassen sich die darunter befindli-chen Spuren in Abb. 85 ohne Schwierigkeiten zuden folgenden vier Hieroglyphen ergänzen:
Die sich aus den Zeichenresten ergebendeÜbersetzung lautet „er (hat) (ihn) seiner (gelieb-ten) Frau gegeben …“. Es liegt hier also dieselbeZeichenfolge und -anordnung vor, wie sie sich ineingravierter Form in den beiden Widmungsin-schriften an Kopf- und Fußseite der Sargwannefinden. Das bedeutet, daß auch an den vier Stel-len der äußeren Längsseiten oberhalb der Fuß-balken die Inschriften vorgesehen waren, mit
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:00 Uhr Seite 61
62 DANIEL POLZ
Abb. 85Ein ebenfalls unter Rotlichtaufgenommenes Detailfoto derInschrift läßt Reste des Wasser-linienzeichens und der Hierogly-phen für „seine Frau“ erkennen.Die übermalte Inschrift hättedemnach den beiden Widmungs-texten an Kopf- und Fußende desImeni-Sarges entsprechen sollen(siehe Abb. 42–44 und 106).
denen der Imeni-Sarg an Geheset umgewidmetwurde. Es bleibt die Frage, warum die Inschriftennur an Kopf- und Fußseite ausgeführt und anden Längsseiten zwar geplant, dann aber wiederausgewischt und mit dem weißen Anstrich über-zogen wurden.
Eine weitere Beobachtung gilt einer Detail-frage zur Dekoration der beiden Särge: Eindirekter Vergleich der beiden auffälligsten Deko-rationselemente, des jeweiligen Udjat-Augenpaa-res und der Scheintür, legt die Interpretationnahe, daß sich der Maler des Geheset-Sarges an den entsprechenden Darstellungen des Imeni-Sarges orientiert hat (Abb. 86–88). Dies gilt imÜbrigen auch für die Zusammensetzung und denInhalt der Inschriften des Geheset-Sarges, diezweifellos von denen des Imeni-Sarges beeinflußtsind (dazu siehe Kap. 7 und Abb. 105). Bei denUdjat-Augen und der Scheintür des Geheset-Sar-
ges sind nun nicht nur die Aufteilung der Ge-samtfläche, sondern selbst kleinste Details nahezuidentisch mit denen des Imeni-Sarges. Dies giltetwa für die Dekorationsmuster der einzelnenquadratischen Felder oberhalb der Scheintür,wobei hier in zwei Feldern vom Geheset-Maleroffensichtlich bewußt eine Variante gewähltwurde. Auch die Darstellungen der zweiflügeli-gen Holztüren mit ihren Riegeln, Türstürzen undSchwellen ähneln sich auf verblüffende Weise.Gerade bei diesen Darstellungen zeigt sich aberauch ein deutlicher Unterschied in der Qualitätder Malereien auf beiden Särgen: Die des Imeni-Sarges weisen eine weitaus höhere Detailliebeund Filigranität auf, was sich etwa an der Dar-stellung der Maserung des Holzes der beidenTüren erkennen läßt – darauf wurde beim Sargder Geheset verzichtet, die Innenflächen derTüren blieben hier unstrukturiert.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 62
Man muß deshalb davon ausgehen, daß derMaler des Geheset-Sarges direkten Zugang zurDekoration des Imeni-Sarges hatte, dieser alsoohne Deckel irgendwo zugänglich gelagert war.Befanden sich beide Särge zu einem bestimmtenZeitpunkt in derselben Werkstatt?
Welch hohe Qualität die Dekoration desImeni-Sarges aufweist, ist sehr eindrucksvoll auchan den Hieroglyphen der monumentalen In-schriftzeilen von Sargwanne und Sargdeckel er-sichtlich (Abb. 89–96). Die große Sorgfalt, dieauf das Ausmalen der Hieroglyphen verwandtwurde, läßt sich an den Stellen ablesen, an denensich Reste der Vorzeichnungslinien erhalten ha-ben, zu sehen etwa an Kopf und Füßen desWachtelkückens in Abb. 91 oder am rechten Ohrder Gesichtshieroglyphe in Abb. 95. Dem An-bringen wenigstens der komplizierteren Hiero-glyphen ging demnach ein erster „Entwurf“ inroter Vorzeichnung voraus, der dann – teilweise
nach einer Korrektur – polychrom ausgemaltwurde.
Im Hinblick auf die eigentliche Bestattung derGeheset ist auch ein Blick ins Innere ihres Sargesaufschlußreich (Abb. 97–99). Auf dem Bodenund der nördlichen, östlichen und westlichenWand der Sargwanne zeichnen sich unterschied-lich große Verfärbungen ab, die von den bei derMumifizierung des Leichnams verwendeten Es-senzen herrühren. Offensichtlich wurde dieMumie regelrecht in Harze und Öle getränkt, diezum Zeitpunkt der Bestattung noch in flüssigemZustand gewesen sein mußten. Dafür sprichtauch eine Verfärbung im Schädelinneren der Ge-heset, die weiter unten beschrieben wird (Kap.10 und Abb. 136). Die Verfärbungen an Bodenund Wänden des Sarges erlauben nähere Anga-ben zur Lage der Mumie im Sarg: Im unteren,südlichen Viertel finden sich weder am Bodennoch an den Wänden Verfärbungen, auch am
Abb. 86Nördliche Hälfte der östlichenLängswand des Geheset-Sargesmit der Darstellung der Udjat-Augen und der Scheintür.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 63
64 DANIEL POLZ
Abb. 87Udjat-Augenpaar und Scheintüran der östlichen Innenseite desImeni-Sarges.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 64
DIE SÄRGE DES IMENI UND DER GEHESET 65
Abb. 88Udjat-Augenpaar undScheintür an der öst-lichen Außenseite desGeheset-Sarges.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 65
66 DANIEL POLZ66 DANIEL POLZ
Abb. 89
Abb. 90
Abb. 91
Abb. 92
Abb. 93
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 66
DIE SÄRGE DES IMENI UND DER GEHESET 67
Abb. 89–96Hieroglyphen in den monumentalen Inschriften von Wanne undDeckel des Imeni-Sarges. Die Zeichen in der Wanne (Abb. 89–91) sindTeil einer an den Gott Geb gerichteten Opferformel an der östlichenLängswand, dessen Name mit dem Bild der Gans geschrieben wird(Abb. 89). In der Opferformel wird unter anderem um Nahrungsmittelfür den Verstorbenen gebeten, wie etwa Brot, Bier, Rinder und Geflügelin einer formelhaft abgekürzten Schreibweise (Abb. 90), oder allge-mein um Lebensmittel (Abb. 91). In der senkrechten Inschriftkolumnedes Deckels (Abb. 92–96) wird der Gott Anubis angerufen, der „Herrvon Sepa“ (Abb. 92–93), der „zu Gast ist in (dem mythischen Ort) Rase-tau“ (Abb. 94–95). Von Anubis wird u. a. erbeten, daß Imeni „bestattetwerden möge“ (Abb. 96). Allen Hieroglyphen der monumentalen In-schriften gemein ist die bemerkenswerte Liebe zum Detail, mit der sieausgeführt sind.
Abb. 94
Abb. 95Abb. 96
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 67
68 DANIEL POLZ
�Abb. 97Innenansicht des Geheset-Sarges von oben mit den deutlich sicht-baren Verfärbungen auf dem Sargboden und den Wänden, die durchdie bei der Mumifizierung benutzten Essenzen entstanden sind.
�Abb. 98Innenansicht von Boden, Nord-, Ost- und Westwand der Wanne desGeheset-Sarges. Wie die Verfärbung an der Nordwand zeigt, muß derKopf der Mumie die Stirnseite des Sarges berührt haben.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:01 Uhr Seite 68
wieder eingesetzten Fußteil fehlen sie (Abb. 101).Sie sind dagegen massiv in der Sargmitte und amnördlichen Viertel vorhanden, an der Kopfseiteder Sargwanne läßt sich sogar die Position desKopfes erkennen (Abb. 98–99). Die Mumie derGeheset stieß demnach mit ihrem Kopf an dieNordseite der Wanne an und berührte gleichzei-tig Ost- und Westseite. Insgesamt ergibt sich alsoder Eindruck, daß sich die Mumie innerhalb desSarges eher in dessen nördlicher Hälfte befand –möglicherweise bewegte sie sich während desEinbringens des Sargensembles in die stark ab-schüssige Kammer zum Kopfende des Sarges hin.
Anmerkungen
1 Grundsätzlich: H. Willems, Chests of Life. A Study of theTypology and Conceptual Development of Middle King-dom Standard Class Coffins, Leiden 1998; G. Lapp,Typolo-gie der Särge und Sargkammern von der 6. bis 13.Dynastie,Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens 7,Heidelberg 1993.
2 Die Infrarotkamera-Ausrüstung wurde uns freundlicher-weise vom Württembergischen Landesmuseum Stuttgartzur Verfügung gestellt,wofür ich mich bei dessen Direkto-rin, Cornelia Ewigleben, herzlich bedanken möchte.
Abb. 99Ansicht des Geheset-Sarges vorRestituierung der von denGrabräubern herausgebroche-nen Fußplatte.
Abb. 100Das restituierte Fußteil des Gehe-set-Sarges. Der fehlende Sarg-deckel lag ursprünglich auf denbeiden schmalen Stegen derLängswände der Sargwanne aufund war offensichtlich nur anseinem Fußende mit wenigenDübeln gesichert (siehe Abb. 97,rechter Bildrand). Er konntedeshalb von den Grabräubernleicht abgezogen werden.
Abb. 101Innenansicht des restituiertenFußteils. Nachdem die Grabräu-ber den Sargdeckel entfernthatten, schlugen sie von außen mit einem scharfkantigenMetallwerkzeug auf die Innen-seite der Fußplatte ein. Die dabeientstandenen Abdrücke sind im oberen Bereich der Fußplattedeutlich sichtbar.
KAPITEL 6.qxd 30.07.2007 14:02 Uhr Seite 69
KAPITEL 13
„Ein schönes Begräbnis im Westen“: Leben undTod einer Ägypterin im 18. Jahrhundert v. Chr.Daniel Polz
In diesem Band wurden verschiedene Aspekte derSärge des Imeni und der Geheset vorgestellt. Daßdies möglich war, ist zunächst den beteiligtenKollegen zu verdanken, die die Einzeluntersu-chungen vorgenommen und ihre Ergebnisse inentsprechender Form hier dargestellt haben. Diewichtigste Voraussetzung für diese Einzelunter-suchungen aber liegt in der Tatsache, daß dasSargensemble in einer kontrollierten archäolo-gischen Ausgrabung an seinem alten Platz auf-gefunden wurde, denn nur dadurch konnten be-stimmte Aspekte überhaupt in Zusammenhangmit der Bestattung der Geheset behandelt wer-den. Dies gilt für die Architektur der Grabanlage,auch als Teil einer Nekropole dieser Zeit, für dieReste der Beigaben wie die Keramik und dieSpeiseopfer und insbesondere natürlich für diemenschlichen Überreste der Geheset. Darausergibt sich eine Fülle an Informationen zu eineraltägyptischen Bestattung. Hierin liegt die eigent-liche Bedeutung des Fundes: Die Särge können„verortet“, d. h. einem Nekropolenteil, einerGrabanlage, einer Zeit und der Bestattung einerPerson zugewiesen werden und bilden auch des-halb eine Ausnahme unter den vielen Särgen ausder Zeit der 12. und 13. Dynastie in den Museenund Sammlungen der Welt. Insbesondere aus derthebanischen Nekropole waren Särge bzw. Bestat-tungen dieser Zeit bislang so selten, daß schondarüber spekuliert wurde, ob zur Zeit des späte-ren Mittleren Reiches in Theben überhauptBestattungen in nennenswertem Umfang vor-genommen worden sind.
Die genannten Informationen erlauben es, fürbestimmte Bereiche ein relativ differenziertes Bildder Bestattung von Geheset zu zeichnen. Es liegtallerdings in der Natur der Sache, daß sich dabeiauch neue Fragen ergeben, die nicht alle klar zu
beantworten sind. Hierzu zählt zunächst dieWiederbenutzung des Imeni-Sarges durch Gehe-set: Der Sarg des Imeni spielte in den Darstellun-gen der vorangehenden Kapitel schon wegenseiner Dekoration und seiner Texte eine domi-nante Rolle. Es sollte dabei aber nicht in Verges-senheit geraten, daß es nicht Imeni war, der indiesem Sarg „seine letzte Ruhe“ gefunden hat,sondern eben Geheset, die nach den beidenWidmungsinschriften auf Imenis Sarg dessenGattin gewesen ist. Eine „Fremdnutzung“ vonSärgen ist im Alten Ägypten durchaus nichtunbekannt; allerdings fand sie meist unter ande-ren Voraussetzungen statt: Wenn sich etwa in der21. Dynastie um 1055 v. Chr. der Hohenpriesterdes Amun und Titularkönig Pinedjem I. in einem von vermutlich drei Särgen des HerrschersThutmosis’ I. bestatten ließ, so geschah diessicher nicht deshalb, weil Pinedjem die nötigenfinanziellen Mittel zur Herstellung eines eigenenSarges fehlten. Pinedjem wollte sich vielmehrdurch die Übernahme des Sarges eines berühm-ten Herrschers der Vergangenheit dessen könig-liche Würde und Status aneignen, auch wenndieser fast ein halbes Jahrtausend vor Pinedjemregiert hatte. Bei diesem Sarg handelte es sich im Übrigen um einen der äußeren des dreitei-ligen Ensembles, dessen innerer Sarg mit derMumie des Königs schon vor geraumer Zeit vomRest des Ensembles getrennt und in ein anderesGrab im Tal der Könige verlegt worden war. Durch die dann im weiteren Verlauf der 21. Dynastie erfolgten Umbettungen der im Tal der Könige bestatteten Herrscher in dieberühmte cachette von Deir el-Bahari wurde eine ganze Reihe von weiteren Königssärgen„frei“, die zum Teil ebenfalls wiederbenutzt wor-den sein dürften.
KAPITEL13.qxd 30.07.2007 14:20 Uhr Seite 122
Aus mehreren Gründen liegen die Verhältnissebei den Särgen des Imeni und der Geheset aberanders. Auf den ersten Blick mag nichts unge-wöhnlich daran erscheinen, daß ein vermutlichgut situierter altägyptischer Würdenträger fürseine Gattin einen Sarg anfertigen läßt. Durchdie intensive Beschäftigung mit den Särgen, ihrerDekoration und ihren Fundumständen ergabensich aber mehrere Ungereimtheiten und es kom-men Zweifel auf, ob die in den Widmungs-inschriften des Imeni-Sarges ausgedrückte Bezie-hung zwischen Imeni und Geheset der Realitätentsprochen haben kann.
Zunächst ergibt sich aus den schon obenerwähnten Beobachtungen an den äußeren
Inschriften des Imeni-Sarges eindeutig, daß diebeiden Widmungsinschriften an Nord- und Süd-seite erheblich später angebracht wurden als alleanderen Außeninschriften. Der Sarg muß übereinen längeren, allerdings unbestimmbaren Zeit-raum hinweg teilweise ohne Abdeckung im Freiengestanden haben, was an einigen Stellen zustarker Erosion und zu Abrieb des Holzes führte(siehe Kap. 12). Wie aber hat man sich dieselängere Lagerung eines komplett und vollständigdekorierten Sarges vorzustellen? Es ist davon aus-zugehen, daß insbesondere innerhalb der kleinenGruppe hoher und höchster Würdenträgerbereits frühzeitig mit der Anlage eines Grabesund der Anfertigung der Grabaustattung begon-
Abb. 177Innenansicht des Imeni-Sarges.
„EIN SCHÖNES BEGRÄBNIS IM WESTEN“ 123
KAPITEL13.qxd 30.07.2007 14:20 Uhr Seite 123
124 DANIEL POLZ
nen wurde. Die Särge, aber auch die anderenTeile der Grabaustattung wurden dabei abersicher noch nicht in der Grabanlage gelagert,sondern erst im Rahmen von Bestattungszeremo-nien während des Begräbnisses dort deponiert.Der Sarg des Imeni war demnach ebenfalls fürdie Bestattung seines Auftraggebers angefertigtworden, danach aber irgendwo über längere Zeitgelagert. Bevor er wie vorgesehen für die Bestat-tung des Imeni benutzt werden konnte, wurde erdurch die beiden Widmungsinschriften an Kopf-und Fußteil „seiner geliebten Frau, der Haus-herrin Geheset“ übereignet.
Das war so gewiß nicht von langer Handgeplant: während der eigentlichen Bestattung derGeheset wurde der Sarg zunächst den Schachthinunter gelassen und hätte dann mit seinerNordseite zuerst in die Grabkammer geschoben
werden sollen. Doch schon bevor das Kopfendedes Sarges den Kammereingang passieren konntezeigte sich, daß der Sarg um wenige Zentimeterhöher als Kammereingang und Kammerdeckewar. Auch die oben beschriebenen weiteren Pro-bleme, die sich beim Einbringen des Sargensem-bles in die Kammer ergaben, belegen, daß dieseKammer ursprünglich nicht für die Aufnahmedes Imeni-Sarges vorgesehen war – die GrabanlageK03.4 sollte also zu keinem Zeitpunkt dieBestattung des Imeni aufnehmen, sondern war(vielleicht schon früh?) als Grab für Gehesetangelegt worden.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Datierungder beiden Särge, oder genauer: die Datierungihrer Herstellung und Benutzung. Hier ergibtsich das Problem, daß nur wenige Holzsärge ausdieser Zeit überhaupt verläßlich datiert sind1.Man kommt nicht umhin, wie auch in diesemBand geschehen, sich relativ ungenauer chrono-logischer Begriffe wie „Zweite Hälfte der 12. Dy-nastie“ bzw. „Erstes Drittel der 13. Dynastie“ alsdie Herstellungsdaten der beiden Särge zu bedie-nen (dazu siehe die entsprechenden Bemer-kungen in den Kap. 7 und 9). Dies mag zunächstals ausreichend exakte Datierung betrachtet wer-den, immerhin sprechen wir über eine Epoche,die fast 4000 Jahre zurückliegt. Übersetzt manaber diese Datierungsansätze in Jahre, ergibt sichfür die „Zweite Hälfte der 12. Dynastie“ eineZeitspanne von knapp 100 Jahren, für „ErstesDrittel der 13. Dynastie“ eine solche von etwa 50 Jahren, innerhalb derer die beiden Särge ange-fertigt worden sind. Immerhin erlaubt die Analyseder Beigabenkeramik der Geheset, ihre Bestat-tung auf die besagten 50 Jahre einzugrenzen –damit ist aber über die Datierung des Imeni-Sarges noch nichts ausgesagt. Wir sind also(noch) nicht in der Lage, aufgrund der Datierungder Särge zu überprüfen, ob die Angaben derWidmungsinschrift korrekt sein können, wonachGeheset die Gattin des Imeni war. Natürlichbietet sich hier eine ganze Bandbreite von Inter-pretations-Szenarien an, von denen die beidenam weitesten auseinander liegenden kurzerwähnt seien. Das Eine: Imeni könnte seinenSarg bereits in jungen Jahren angefertigt habenlassen und erst in hohem Alter eine sehr jungeGeheset geheiratet haben; in einem solchen Fallkönnten zwischen der Anfertigung des Imeni-
Abb. 178Ansicht der äußeren Kopfseitedes Geheset-Sarges.
KAPITEL13.qxd 30.07.2007 14:20 Uhr Seite 124
„EIN SCHÖNES BEGRÄBNIS IM WESTEN“ 125
Sarges und der des Gehest-Sarges durchaus etwa70–80 Jahre liegen. Das Andere: Imeni läßt sichseinen Sarg anfertigen, es kommt aber, auswelchen Gründen auch immer, nicht zu einerBestattung Imenis in diesem Sarg. Der Sarg steht„herrenlos“ in einer Werkstatt und wird nachdem Tod der Geheset von deren Verwandten fürihre Bestattung annektiert (oder erworben?); umdiesen Vorgang gewissermaßen zu legitimieren,werden die Widmungsinschriften auf Imenis Sargangebracht. In diesem Fall hätten Imeni undGeheset nicht das Geringste miteinander zu tunund die Herstellung der beiden Särge könntezeitlich durchaus auch weiter auseinander liegen.Auf die Gefahr hin, hier den Boden gesicherterInformationen zu verlassen, soll noch ein Indizgenannt werden, das den zweiten Interpretations-ansatz oder eine Variante desselben als wahr-scheinlicher erscheinen läßt: Wenn Imenitatsächlich selbst seinen Sarg an seine GemahlinGeheset übergeben hätte, wäre er wohl auch fürdie Wahl des Ortes und der Art von GehesetsGrabanlage zuständig gewesen. Dann allerdingswäre es kaum erklärbar, warum bei der Anlageoder Auswahl des Grabes keine Rücksicht auf dieAusmaße seines Sarges genommen wurde. Imenihätte seiner Frau eine Grabanlage anlegen lassen,in der die eigentliche Sargkammer zu klein fürden umgewidmeten Sarg gewesen wäre.
Auf deutlich soliderem Grund stehen hinge-gen andere Ergebnisse der durchgeführten Ein-zeluntersuchungen. Aufgrund etwa der anthro-pologisch-paläopathologischen Untersuchungenläßt sich doch Entscheidendes zum Leben derGeheset sagen: Sie war wohl afrikanischer, ver-mutlich nubischer Herkunft bzw. Abstammung,was grundsätzlich zu jener Zeit in Oberägyptensicherlich keine Besonderheit darstellte. Durchdie intensive Nubienpolitik der Herrscher der 12. Dynastie war Nubien bis weit über das sog. 2. Katarakt hinaus zu einem Teil der ägyptischenEinflußsphäre geworden. In dieser Zeit muß vonregen Handels- und damit Wanderbewegungenin beide Richtungen ausgegangen werden, dieauch zu Ansiedlungen von Ägyptern in Nubienund von Nubiern vor allem im südlichenOberägypten geführt haben, selbst wenn dieoffizielle ägyptische Politik zeitweise versuchthaben mag, den Zuzug von Nubiern nach Ägyp-ten streng zu reglementieren2. Auf welche Weise
Geheset nach Theben gelangte und ob sie selbsterst hierhin kam oder bereits in zweiter oderdritter Generation hier lebte, läßt sich nicht feststellen. Jedenfalls weisen die erhaltenen Über-reste ihrer Bestattung keinerlei nicht-ägyptischeElemente auf und gerade die Tatsache, daß manihren eigenen Sarg mit einem weiteren umgab,dessen Dekoration zum größten Teil ausSprüchen der Sargtexte besteht, verdeutlicht, daßwir es hier mit einer rein ägyptischen Bestattungzu tun haben. Auch ihr Name Geheset („Gazel-le“) ist rein ägyptisch und auch sonst gelegent-lich belegt.
Das auffälligste an den menschlichen Überres-ten der Geheset sind zweifellos die an beidenHänden zu beobachtenden Fehlstellungen, diemöglicherweise auf eine frühkindliche Gehirn-schädigung, eine sog. zerebrale Parese, zurück-zuführen sind (siehe ausführlich Kap. 10). Dieseist wohl auch der Grund für die stärkere Ab-kauung der linksseitigen Zähne und damit diestärkere Beanspruchung des linken Kiefergelenks.Die Folgen dieser Gehirnschädigung müssenGeheset behindert haben, wenn auch unklar ist,in welchem Maße. Immerhin war sie bei ihremTod zwischen 50 und 60 Jahre alt und erreichtedamit ein für altägyptische Verhältnisse rechthohes Alter.
Die weiteren Untersuchungen an den mensch-lichen Überresten der Geheset vervollständigenunser Bild über ihre Lebensumstände: Die Tatsa-che, daß ihre Zähne zwar massive Zahnstein-bildung aber weder Zahnverlust zu Lebzeitennoch Karies aufweisen, läßt auf eine ausgewogene,eiweißreiche Ernährung schließen, die nicht nuraus pflanzlichen Nahrungsmitteln bestand, sondern auch Fleisch und/oder Fisch beinhaltethaben muß. Am sonstigen Skelett der Gehesetfanden sich keine pathologischen Befunde, d. h.es fehlen Indizien für schwere Krankheiten oderVerletzungen.
Dieser Gesamtbefund allein gestattet bereitsdie Aussage, daß es sich bei Geheset um eine An-gehörige der sozialen Oberschicht Thebens ge-handelt haben muß. Die Interpretation wirdauch durch weitere Beobachtungen gestützt: Diein erheblichen Mengen vor und in den Särgenaufgefundenen Haare der Geheset zeigen eineaußergewöhnlich aufwendige Haartracht miteiner Haarverlängerung, bei der kunstvoll einzelne
KAPITEL13.qxd 30.07.2007 14:20 Uhr Seite 125
126 DANIEL POLZ
Haarsträhnen von dunkelblonder Farbe in dieschwarzen Haare eingeflochten wurden. Auch diewenigen erhaltenen Reste der einstigen Mumi-fizierung des Leichnams an der linken Handbelegen eine durchaus aufwendige Mumifizie-rungstechnik, in der etwa die Gliedmaßeneinzeln umwickelt wurden. Letztlich spricht diegesamte Grabausstattung für ein „gehobenes“Begräbnis, unabhängig davon, ob Geheset ihrenäußeren Sarg von ihrem Gatten erhalten hat odersich ihre Angehörigen den Sarg des Imeni fürGeheset angeeignet haben. Sollte sich demnachdie Interpretation der anthropologisch-paläopa-thologischen Untersuchungen bestätigen, wo-nach Geheset nubischer Herkunft war, würde siejedenfalls eine Ausnahme darstellen: Die meisten
der bislang aus den Quellen bekannten Nubierund Nubierinnen jener Zeit gehörten nicht derOberschicht, sondern den unteren Bevölkerungs-schichten an.
Anmerkungen
1 G. Lapp, Typologie der Särge und Sargkammern von der 6. bis 13. Dynastie, Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptens 7, Heidelberg 1993, vor allem S. 239–249.
2 Dazu siehe G. Meurer, Nubier in Ägypten bis zum Beginndes Neuen Reiches, Abhandlungen des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo, Ägyptolog. Reihe 13,Berlin 1996.
KAPITEL13.qxd 30.07.2007 14:20 Uhr Seite 126
Die auf den vorangegangenen Seiten geschilder-ten Ergebnisse der Ausgrabungen des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo im Areal H derNekropole von Dra‘ Abu el-Naga von 2001 bis2006 wären ohne die tatkräftige Unterstützungder ägyptischen Antikenverwaltung (SupremeCouncil of Antiquities) unmöglich gewesen. Es seihier deshalb zu allererst dem chairman der Antikenverwaltung, Herrn Zahi Hawass, und seinem Vorgänger im Amt, Herrn Gaballa AliGaballa, herzlich für die Erteilung der Konzes-sion und der Ausgrabungsgenehmigungen ge-dankt. Mein Dank gilt auch den Direktorenverschiedener Sektionen der Antikenverwaltung,den Herren Sabri Abd el-Azis, Megdi el-Ghan-dour, Yehia el-Masri, Holeil Ghaly, Mansour Boreik, Mohammed el-Bialy, Ali el-Asfar, SoltanMohammed Eid, Ibrahim Soleiman, Moham-med Abd el-Azis und el-Kazafy Abd el-Rahim el-Asab; darüberhinaus den Inspektorinnen undInspektoren der SCA, die die Ausgrabungen vorOrt stets überaus engagiert unterstützten: denDamen Magda Saadi, Nefissa el-Azab, AsmaaKamel Ahmed und Sophie Sobhy Wahaby undden Herren Fathi Yaseen, Mahmud MohammedMousa, Mostafa el-Saghir, Abd el-Nasser, Megdiel-Badri, Ayman Mohammed Ibrahim, Ahmedel-Dowi, Mohammed Hassan, Yassir YussefAhmed, Ahmed Mahmud Yaseen, Ahmed Has-san Ebeid, Ahmed Ezz el-Din Ismail, MohammedYussef Mohammed Hassan, Emad Abdallah Abdel-Ghany, Mostafa Ali Hashim, Hany IbrahimGomaa Ibrahim, Osama Saadalla Hamdeun, Abdel-Fatah Hamid und Fawzy Helmi Abdin.
Aus den verschiedenen Beiträgen in diesemBand ist ersichtlich, daß archäologische Ent-deckungen und ihre Bearbeitung heute nichtmehr die Arbeit einer einzelnen Person sind, son-
dern eine ganze Reihe von Wissenschaftlern undMitarbeitern unterschiedlichster fachlicher Quali-fikationen und Kompetenzen erfordern. Nur imZusammenwirken vieler verschiedener Fachrich-tungen lassen sich archäologische Funde und Be-funde heute sinnvoll aufbereiten, auswerten undinterpretieren.
Die Grundlage dafür ist die anfänglicheAufnahme archäologischer Befunde, d. h. die eigentliche Ausgrabung. Gerade hier hat in denletzten Jahren eine Vielzahl von – auch studenti-schen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit-gewirkt, die die höchst verantwortungsvolleAufgabe der archäologischen Dokumentationübernommen haben. Ich möchte mich deshalban dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitwirken-den der Grabungskampagnen im Areal H derNekropole von Dra‘ Abu el-Naga während derJahre 2001–2006 bedanken:
Ägyptologen und Archäologen
Maria BürgleJannett BuschMelanie FloßmannValentine HacquardConstanze HollerMelanie JostAndrea KilianElisabeth KruckKristina LahnKonstantin LakomyAntonio LoprienoJulia LückeClaudia Maderna-SiebenKatrin MaurerSusanne Michels
Danksagungen
Mark PieperUte RummelJessica SchrinnerAnne SeilerSusanne VoßRuth Zillhardt
Y_DANK etc.qxd 30.07.2007 14:22 Uhr Seite 129
130 DANKSAGUNGEN
Anthropologen, Pathologen und Biologen
Hjalmar HagedornEstelle Hower-TilmannAnna-Maria MekotaAndreas G. NerlichHelmut RohrbachAlbert R. Zink
Architekten, Bauforscher, Vermesser und Zeichner
Walter BarthPieter ColletUlrike FauerbachFlorian KeresManja Maschke
Paläobotaniker
Reinder NeefViola Podsiadlowski
Photographen und Kameraleute
Fritz BarthelMichael LeuthnerJan SebeningPeter Windszus
Restauratoren
Christian EckmannKatrin FischerErico PeintnerAnnett Richter
Der Gesellschaft der Freunde des DeutschenArchäologischen Instituts – Theodor WiegandGesellschaft e. V. und ihrem Vorsitzenden, WeertBörner, sei hier herzlich gedankt für die groß-zügige Unterstützung bei der Anschaffung einesTachymeters im Jahre 2006. Mit diesem konnte
in Dra‘ Abu el-Naga u. a. ein Teil der für dieErstellung der 3D-Animation des Geländesnotwendigen Vermessungen der Oberfläche undder unterirdischen Grabanlagen durchgeführtwerden.
Y_DANK etc.qxd 30.07.2007 14:22 Uhr Seite 130
Pieter ColletArchäologischer Zeichner und VermesserKairo
Dipl.-Biologin Estelle Hower-TilmannSektion Paläopathologie, Institut für Pathologie,Klinikum München-Bogenhausen
Michael LeuthnerDokumentarfilm-RegisseurMünchen
Dipl.-Biologin Sandra LöschSektion Paläopathologie, Institut für Pathologie,Klinikum München-Bogenhausen
Prof. Dr. Antonio LoprienoÄgyptologe, Rektor der Universität Basel Ägyptologisches Seminar der Universität Basel
Dipl.-Ing. arch. Manja MaschkeArchitektinDresden
Susanne Michels M.A.Ägyptologin und KeramologinÄgyptologisches Institut der Universität Heidelberg
Drs. Reinder NeefArchäobotanikerLabor für Archäobotanik, Referat Naturwissen-schaften, Zentrale des Deutschen Archäologi-schen Instituts, Berlin
Prof. Dr. Andreas G. NerlichPathologe und Anthropologe, Direktor derSektion Paläopathologie, Institut für Pathologie,Klinikum München-Bogenhausen
Dr. Stefanie PanzerAbteilung Radiologie, BG-Unfall-Klinik Murnau
Erico PeintnerSelbständiger RestauratorKairo / Stuttgart
Viola PodsiadlowskiTechnische AssistentinLabor für Archäobotanik, Referat Naturwissen-schaften, Zentrale des Deutschen Archäologi-schen Instituts, Berlin
PD Dr. Daniel PolzÄgyptologe und Archäologe, Stellvertr. Leiter des Deutschen Archäologischen Instituts Kairo
Dr. Ute RummelÄgyptologin und ArchäologinDeutsches Archäologisches Institut Kairo
Dr. Anne SeilerÄgyptologin und KeramologinBerlin / Wien
Peter WindszusPhotographDeutsches Archäologisches Institut Kairo
PD Dr. Albert R. ZinkAnthropologe und PaläopathologeDepartment für Geo- und Umweltwissenschaf-ten, Ludwig Maximilians Universität München
Autoren und Mitarbeiter dieses Bandes
Y_DANK etc.qxd 30.07.2007 14:22 Uhr Seite 131
Archiv Deutsches Archäologisches Institut Kairo:2, 4, 103
Pieter Collet: 21, 23, 47, 53–56, 82
Dieter Johannes: 16–17
Nicole Kehrer: 102
Sandra Lösch: 135 (rechts)
Manja Maschke: 24, 179
Reinder Neef: 151–157
Stefanie Panzer: 145–146
Erico Peintner: 43, 74, 84–85, 161–168, 171–175
Viola Podsiadlowski: 150
Daniel Polz: 3, 7–8, 12–15, 18–19, 28–30, 33–40, 46, 50–52, 61, 79, 135 (links), 137–138,140–141, 143–144, 147–149, 170
Ute Rummel: 32
Anne Seiler / Susanne Michels: 127–133
Gabriele Wenzel (mit freundlicher Genehmi-gung): 6
Peter Windszus: 20, 22, 25–27, 31, 41–42, 44–45, 48–49, 57–60, 62–73, 75–78, 80–81,83, 86–101, 104–126, 158–160, 169, 176–178
Albert R. Zink: 134, 136, 139, 142
Folgende Abbildungen stammen aus Publikationen:
1 Ausschnitt aus: A.H. Gardiner, The RoyalCanon of Turin, Oxford 1959, Pl. III
5 Ausschnitt aus: D. Arnold, Gräber des Altenund Mittleren Reiches in El-Tarif, Archäo-logische Veröffentlichungen des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo 17, Mainz1976, Planbeilage 1
9 D. Polz, Der Beginn des Neuen Reiches. ZurVorgeschichte einer Zeitenwende, Sonder-schriften des Deutschen ArchäologischenInstituts Kairo 31, Berlin 2007, S. 203, Abb. 51 (nach D. Arnold)
10 D. Arnold, Das Grab des Jnj-jtj.f, Band I,Die Architektur, Archäologische Veröffent-lichungen des Deutschen ArchäologischenInstituts Kairo 4, Mainz 1971, Taf. XXVIIId
11 B. JaroÁ-Deckert, Das Grab des Jnj-jtj.f,Band V, Die Wandmalereien der 11. Dyna-stie, Archäologische Veröffentlichungen desDeutschen Archäologischen Instituts Kairo12, Mainz 1984, Faltkarte 1(Malerei: W. RUHM)
Abbildungsnachweis
Y_DANK etc.qxd 30.07.2007 14:22 Uhr Seite 132
Zeittafel
Nur die historisch bedeutenderen und / oder die im Text genannten Könige sind einzeln aufgeführt.Die absoluten Daten folgen J. von Beckerath (Chronologie des pharaonischen Ägypten, MünchnerÄgyptologische Studien 46, Mainz 1997).
Prädynastische Zeit
0. DYNASTIE (in Oberägypten) etwa 150 Jahre um 3180–3030Reichseinigung um 3000
Frühzeit
1. DYNASTIE (um 3032–2853)
2. DYNASTIE (um 2853–2707)
Altes Reich
3. DYNASTIE (2707–2639)
Djoser 2690–2670
4. DYNASTIE (2639–2504)
Snofru 2639–2604
Cheops um 2604–2581
Chephren 2572–2546
Mykerinos 2539–2511
5. DYNASTIE (2504–2347)
Userkaf 2504–2496
Sahure 2496–2483
Neferirkare 2483–2463
Niuserre 2445–2414
Djedkare Asosi 2405–2367
Unas 2367–2347
6. DYNASTIE (2347–2216)
Teti 2347–2337
Pepi I. 2335–2285
Pepi II. 2279–2219
Z_Zeittafel.qxd 30.07.2007 14:23 Uhr Seite 133
134 ZEITTAFEL
8. DYNASTIE (17 Könige) (um 2216–2170)
1. Zwischenzeit
9./10. DYNASTIE (in Herakleopolis, 18 Könige) (um 2170–2020)
Mittleres Reich
11. DYNASTIE (zunächst nur in Oberägypten, ab etwa 2020 in ganz Ägypten) (2119–1976)
Mentuhotep I. 2119–
Seher-Taui Intef I. –2103
Horus Wah-Anch Intef II. 2103–2054
Nacht-Neb-Tep-Nefer Intef III. 2054–2046
Nebhepetre Mentuhotep II. 2046–1995
Seanchkare Mentuhotep III. 1995–1983
12. DYNASTIE (1976–1794/93)
Amenemhat I. 1976–1947
Sesostris I. 1956–1911/10
Amenemhat II. 1914–1879/76
Sesostris II. 1882–1872
Sesostris III. 1872–1853/52
Amenemhat III. 1853–1806/05
Amenemhat IV. 1807/06–1798/97
Nefrusobek 1798/97–1794/93
2. Zwischenzeit
Daten und Definition nach J. von Beckerath und K. S. B. Ryholt. Abfolge der Könige der 17. Dynastie nach D. Polz
13. DYNASTIE (ca. 50 Könige) (1794/93–1649)
14. DYNASTIE (Kleinkönige im Delta) (?–1649)
15. DYNASTIE (Hyksos) (1649–1540)
Chajan 1648–1590
Apophis 1590–1549
Chamudi 1549–1539
16. und 17. DYNASTIE (in Theben) (1649–1550/49)
17. DYNASTIE
Sechemre Wach-Chau Rahotep
Z_Zeittafel.qxd 30.07.2007 14:23 Uhr Seite 134
ZEITTAFEL 135
Sechemre Wadj-Chau Sobekemsaef (I.)
Sechemre Sched-Taui Sobekemsaef (II.)
Sechemre Wep-Maat Intef (IV.)
Nub-Cheper-Re Intef (V.)
Sechemre Heru-Her-Maat Intef (VI.)
Senachtenre
Seqenenre Ta-aa
Wadj-Cheper-Re Kamose
Neues Reich
18. DYNASTIE (1550–1292)
Ahmose 1550–1525
Amenophis I. 1525–1504
Thutmosis I. 1504–1492
Thutmosis II. 1492–1479
Hatschepsut 1479–1458/57
Thutmosis III. 1479–1425
Amenophis II. 1428–1397
Thutmosis IV. 1397–1388
Amenophis III. 1388–1351/50
Amenophis IV. / Echnaton 1351–1334
Semenchkare 1337–1333
Tutanchamun 1333–1323
Eje 1323–1319
Haremhab 1319–1292
19. DYNASTIE (1292–1186/85)
Ramses I. 1292–1290
Sethos I. 1290–1279/78
Ramses II. 1279–1213
Sethos II. 1199–1194/93
20. DYNASTIE (1186/85–1070/69)
Ramses III. 1183/82–1152/51
Ramses IV. 1152/51–1145/44
Ramses VI. 1142/40–1134
Ramses IX. 1125–1107
Ramses XI. 1103–1070/1069
Z_Zeittafel.qxd 30.07.2007 14:23 Uhr Seite 135
136 ZEITTAFEL
3. Zwischenzeit
21. DYNASTIE (1070/69–946/45)
Pinedjem I. 1044/43–994/93
22. DYNASTIE (946/45–736)
23. DYNASTIE (756–722)
24. DYNASTIE (740–714)
Spätzeit
25. DYNASTIE (Kuschiten) (746–655)
Pianchi um 746–715
Taharqa 690–664
26. DYNASTIE (Saiten) (664–525)
Psammetich I. 664–610
Apries 589–570
Amasis 570–526
27. DYNASTIE (sog. 1. Perserherrschaft) (525–401)
Kambyses 525–522
Dareios I. 522/21–486/85
Xerxes I. 486/85–465/64
Artaxerxes I. 465/64–424
Dareios II. 423–405/04
28. DYNASTIE (404/401–399)
29. DYNASTIE (399–380)
30. DYNASTIE (380–342)
Nektanebos I. 380–362
Nektanebos II. 360–342
31. DYNASTIE (sog. 2. Perserherrschaft) (342–332)
GRIECHISCHE HERRSCHER (332–306)
Alexander der Große 332–323
PTOLEMÄER (306/304–30)
RÖMISCHE KAISER (30 v. Chr.–313 n. Chr.)
Z_Zeittafel.qxd 30.07.2007 14:23 Uhr Seite 136
KARTE VON ÄGYPTEN 137
Karte von Ägypten mit den Hauptorten bzw. Regionen (z. B. SINAI) und den im Text erwähnten Orten (z. B.Theben-West). Nach einer Vorlage von Ulrike Fauerbach.
Z_Zeittafel.qxd 30.07.2007 14:23 Uhr Seite 137
138 KARTE DER THEBANISCHEN NEKROPOLE
Die Thebanische Nekropole.Ausschnitt der Karte 1:10 000 desSurvey of Egypt (1922–24). Etwain der Bildmitte liegt das DorfDra‘ Abu el-Naga, nordöstlichdavon das Grabungsareal derUnternehmung des DeutschenArchäologischen Instituts Kairo.Am rechten Bildrand befindetsich die Nekropole von el-Tarifmit einem der langgestrecktenköniglichen Saff-Gräber der 11. Dynastie, am linken oberenRand sind die zwei Tempelan-lagen des Nebhepetre Mentuho-tep und der Hatschepsutsichtbar.
Z_Zeittafel.qxd 30.07.2007 14:24 Uhr Seite 138