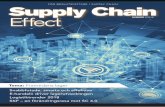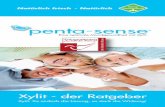INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES (IST) PROGRAMME Cognitive Vision Systems�CogVis (IST-2000-29375)
Lagerkarotten: Wie entscheidend ist der Erntezeitpunkt für die Höhe des Ausfalls am Lager?
-
Upload
kingsdivinity -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Lagerkarotten: Wie entscheidend ist der Erntezeitpunkt für die Höhe des Ausfalls am Lager?
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Projekt 117
Abschlussbericht; 2003, 2004 & 2005
Projektausführung und Verfasser Roger Wellinger
Projektleiter
Robert Theiler
Datum der Ausgabe: 21.07.2006 (noch nicht abgeschlossen!)
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ............................................................................................................................... 3 2. Ausgangslage ......................................................................................................................... 4
2.1 Qualitätsprobleme bei Karotten ....................................................................................... 4 2.2Wissensstand ..................................................................................................................... 4
3. Material und Methoden .......................................................................................................... 5 3.1 Anbau FAW ..................................................................................................................... 5 3.2 Erhebungen....................................................................................................................... 5 3.3 Erhobene Parameter ......................................................................................................... 5 3.4 Auswertungen................................................................................................................... 5
4. Resultate ................................................................................................................................. 6 4.1.1 Wädenswil und Aussenstationen 2003.......................................................................... 6 4.1.2 Wädenswil und Aussenstationen 2004.......................................................................... 6
4.1.3 Wädenswil und Aussenstationen 2005...................................................................... 7 4.1.4 Klimaverlauf Wädenswil 2003, 2004 & 2005 .......................................................... 7 4.1.5 Klimaverlauf Aussenstationen 2004 ......................................................................... 8 4.1.5 Klimaverlauf Aussenstationen 2004 ......................................................................... 9 4.1.6 Bodencharakteristiken 2004.................................................................................... 10
4.2 Wachstumsverlauf.......................................................................................................... 10 4.2.1 Wädenswil 2003, 2004 & 2005............................................................................... 11 4.2.2 Aussenstationen....................................................................................................... 12 4.2.3 Frischgewicht / Trockengewicht ............................................................................. 13 4.2.3 Frischgewicht / Trockengewicht ............................................................................. 14 4.2.4Blattfläche / Anzahl Blätter...................................................................................... 15 4.2.5 Brix.......................................................................................................................... 16
4.3 Ergebnisse Einlagerung.................................................................................................. 18 4.3.1 Einlagerung 2003 .................................................................................................... 18 4.3.2 Einlagerung 2004 .................................................................................................... 19 4.3.3 Einlagerung 2005 .................................................................................................... 19 4.3.4 Vergleich Einlagerung 2003 – 2005........................................................................ 20
4.4 Ergebnisse Auslagerung 2003........................................................................................ 22 4.4.1 Ertrag....................................................................................................................... 22 4.4.2 Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Inhaltsstoffe................................................. 23 4.4.3 Einfluss der Sorte auf die Inhaltsstoffe ................................................................... 24 4.4.4 Einfluss der Anbauweise auf die Inhaltsstoffe ........................................................ 24
4.5 Ergebnisse Auslagerung 2004........................................................................................ 25 4.5.1 Ertrag....................................................................................................................... 25 4.5.2 Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Inhaltsstoffe................................................. 26 4.5.3 Einfluss der Sorte auf die Inhaltsstoffe ................................................................... 27 4.5.4 Einfluss der Anbauweise auf die Inhaltsstoffe ........................................................ 28
4.6 Ergebnisse Auslagerung 2005........................................................................................ 28 4.6.1 Ertrag....................................................................................................................... 29 4.6.2 Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Inhaltsstoffe................................................. 29 4.6.3 Einfluss der Sorte auf die Inhaltsstoffe ................................................................... 29 4.6.4 Einfluss der Anbauweise auf die Inhaltsstoffe ........................................................ 30
5. Diskussion ............................................................................................................................ 31 Schlussfolgerung ...................................................................................................................... 34 Fazit (Schlussfolgerung für die Praxis).................................................................................... 34 Offene Fragen........................................................................................................................... 35
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 1 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Literaturverzeichnis.................................................................................................................. 36
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 2 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
1. Einleitung
Bezüglich der Bestimmung des Optimalen Erntezeitpunktes für Lagerkarotten ist eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Diese wirken sich auf die Ertragshöhe und den Verlust am Lager und die innere und sensorische Qualität aus. Diese Arbeit hatte zum Ziel, unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren den optimalen Erntezeitpunkt für Lagerkarotten zu ermitteln. Dazu wurden über zwei Jahre Feldversuche an verschiedenen Standorten und mit den beiden Hauptlagersorten, Bolero und Maestro (für den Schweizer Anbau) und deren Ein-, sowie Auslagerung, durchgeführt. Primär wurden untersucht: -Einfluss des Erntezeitpunktes auf den Ertrag und die Qualität -Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Lagerfähigkeit und den Anteil an Inhaltsstoffen Zusätzlich wurde abgeklärt: -Wachstumsverlauf und die Rübenentwicklung von zwei Sorten verschiedene Standorte verschiedene Anbauweisen Auch wenn es möglich ist, aus der gewonnenen Erkenntnissen einen Vorschlag zum optimalen Erntezeitpunkt für die Lagerkarotten in der Schweiz zu machen, ist dessen Anwendung von einigen zusätzlichen Faktoren abhängig: 1. Der Boden muss mit den Erntemaschinen befahrbar sein. Die Ernte der Karotten ist im Spätherbst
und desshalb stärker von Witterungsschwankungen abhängig 2. Der Abnehmer hat seine Logistik, welche frühzeitig auf den Erntetermin eingerichtet sein will 3. Sind Gebinde und Maschienen für die Ernte vorhanden 4. Starke Frühfröste können für einen späteren Erntetermin schädigend bezüglich der inneren
Qualität der Karotten und deren Verhalten am Lager wirken. Ausserdem nimmt das Laub schon bei niedrigeren Frösten Schaden und dies könnte sich negativ auf die Erntetechnik auswirken.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 3 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
2. Ausgangslage
QS Karotten Projekte E. Höhn
Siehe Gemüsebau 1/2001 2.1 Qualitätsprobleme bei Karotten
Produktion & Lagerhaltung
Braunverfärbung nach Auslagerung
Andere Schwierigkeiten Parasitäre Krankheiten (Fäulnis)
Detailhandel
Bitterkeit & ungenügende Geschmacksqualität
2.2Wissensstand Bitterkeit; Folge von Stress
Stress infolge von ungünstigen - Wachstumsbedingungen - Hohen Phosphorgehalten - Pilzbefall
W. Heller: - Thielaviopsis / Chalara →Schwarzfäule →Bitterkeit
- Verletzungen - Ethylen während der Lagerung (Äpfel) →Isocumarinbildung
Sorteneinflüsse:
- Brixwerte - Gesamtzuckergehalt - Nitratgehalt
Standorteinflüsse:
- Nitrat - Isocumarin; jedoch je nach Jahr unterschiedlich (siehe Gemüsebau 12/2001)
Vorernte:
- Sorte - Saatzeitpunkt - Standort
- Boden - Düngung - Feuchtigkeits, -Wasserkapazität - Alternaria / Schwarzflecken
- Erntezeitpunkt - Mechanische Belastung
Abb. 1: Einflüsse auf die Bitterkeit der Karotten
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 4 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
3. Material und Methoden
3.1 Anbau FAW
Versuchsdauer: 3 Jahre Wiederholungen: 4 im Sandhof und im Jahr 2004 plus 4 Aussenstationen (Diepoldsau, Basadingen,
Utzensdorf und Ins), sowie im Jahr 2005 plus 1 Aussenstation (Wauwiler Moos). Zwei Sorten: Bolero und Maestro Anbau: Damm und Flachbeet Saatdichten: 100 Korn/m-1 und 150 Korn/m-1
3.2 Erhebungen
Wöchentlich im Sandhof; 14 täglich in den Aussenstationen Drei Erntezeitpunkte (Sandhof): jeweils Mitte Sept. (97d/98d/92d) Okt. (127d/128d/127d)
und Nov (153d/156d/155d). Erhebung des Ertrags nach Stk. und Gewicht bei der Einlagerung
(Ebenfalls Erhebung der Faulen und Beschädigten) Erhebungen der Auslagerung jeweils im Mai des Folgejahres
3.3 Erhobene Parameter
Wöchentlich; resp. 14 täglich: Wurzellänge, -Durchmesser Blattlänge, -Anzahl, -Fläche Frischgewicht / Trockengewicht (Wurzel und Blätter) Brix-Wert
Bei den Ernten (Gruppe E. Höhn FAW): Makro-, Mikroelemente, Nitrat, Zucker, phänolische Verbindungen, Säuren, Carotinoide,
Isocumarin, Sensorik Temperaturmessungen im Bestand Modellierung des Bodenwasseranteils (NFK) über die gesamte Kulturdauer mit VegIrr
(Modellierung des Bodenwassergehalts im Gemüsebau, R. Wellinger)
3.4 Auswertungen Wachstumskurven Prüfung auf signifikante Unterschiede Einbindung der Klimadaten zwecks Modellierung der Entwicklung im Feld Einbindung eines Modells zur Bestimmung des Bodenwassergehalts (nFK)
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 5 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4. Resultate
Es ist zu beachten, dass am Standort Wädenswil die Dammkultur im Jahr 2003 eine ausserordentlich schwache Keimungsrate aufwies und nur die Flachbeetkultur ausgewertet werden konnte. Dies lässt ein direkter Vergleich zwischen den Versuchsjahren 2003 einerseits und 2004 & 2005 andererseits, in welchen vor allem die Dammkultur ausgewertet wurde da dies das dominierende Anbausystem ist, nur bedingt zu. Ausserdem änderten die Qualitätsbestimmungen im Jahr 2004, so dass ab 2004 bei der Einlagerung sowie Auslagerung andere Anforderungen an die geernteten Karotten gestellt wurde. Dieser Bericht trägt bei der Umsetzung der Resultate diesen Tatsachen so gut es geht Rechnung. 4.1.1 Wädenswil und Aussenstationen 2003 Im Jahr 2003 wurde der Versuch in Wädenswil und bedingt in Sünikon sowie .... durchgeführt. Wie oben erwähnt wurde in der Dammkultur eine schlechte Keimrate erzielt was es verunmöglichte, diese auszuwerten. Die Bodencharakteristiken für Sünikon und .... wurden nicht bestimmt. Die Kulturführung in Wädenswil geschah 2003 zum letzten mal unter der alten Versuchsbetriebleitung. Angaben zur Kulturführung wie Bewässerung, Düngung und sonstige Arbeiten wurden nicht festgehalten (oder sind unauffindbar) und daher ist die Bodenfeuchte im Nachhinein nicht mit VegIrr (Modellierung des Bodenwassergehalts im Gemüseanbau) Modellierbar. Dies gilt ebenfalls für die Aussenstandorte Sünikon und .... . 4.1.2 Wädenswil und Aussenstationen 2004 Im Jahr 2004 konnte der Versuch auf 5 Stationen ausgedehnt werden. Neben Wädenswil wurden die Standorte Ins, Utzensdorf (Anglia), Basadingen, und Diepoldsau einbezogen. Neben den unterschiedlichen Klimabedingungen konnten auch verschiedene Bodentypen in den Versuch einbezogen werden. Die Palette reichte vom stark lehmigen Sandboden in Diepolsau über sandiger Lehm in Wädenswil bis zu humusreichem, schwachtonigem Lehm in Ins. Im Standortvergleich wurde nur die Sorte Bolero (Utzensdorf die Sorte Anglia) in den Versuch einbezogen. Die Abbildungen 2-4 zeigen die unterschiedlichen (Bodenfeuchte) (Modelliert mit VegIrr) des Bodens sowie den Temperaturverlauf (Tmax) und die Niederschlagsverteilung der drei Standorte Ins, Basadingen und Wädenswil.
Verlauf nutzbare Feldkapazität in %, Niederschlag und Temperaturverlauf in Wädenswil 2004
0
5
10
15
20
25
30
35
400 12 24 36 48 60 72 84 96 108
120
132
144
156
Kulturtage
Tmax
[°C
]
0
20
40
60
80
100
Geh
alt B
oden
was
ser i
n %
der
nF
K (u
nd N
iede
rsch
lag
In m
m)
Niederschlag 04
Tmax WAE
Bodenfeuchte 04
Abb. 2: Klimaverlauf und Bodenfeuchte des Standortes Wädenswil 2004
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 6 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Verlauf nutzbare Feldkapazität in %, Niederschlag und Temperaturverlauf in Basadingen 2004
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102
108
114
Kulturtage
Tmax
[°C
]
0
20
40
60
80
100
Geh
alt B
oden
was
ser i
n %
der
nF
K (u
nd N
iede
rsch
lag
In m
m)
Niederschlag 04
Tmax
Bodenfeuchte 04
Abb. 4: Klimaverlauf und Bodenfeuchte des Standortes Basadingen 2004
Verlauf nutzbare Feldkapazität in %, Niederschlag und Temperaturverlauf in Diepoldsau 2004
35
40 100
0
5
10
15
20
25
30
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 88 96 104
112
120
128
136
144
Kulturtage
Tmax
[°C
]
0
20
40
60
80
Geh
alt B
oden
was
ser i
n %
der
nF
K (u
nd N
iede
rsch
lag
In m
m)
Niederschlag 04
Tmax
Bodenfeuchte 04
Abb. 3: Klimaverlauf und Bodenfeuchte des Standortes Diepoldsau 2004
Der Verlauf der nutzbaren Feldkapazität (Bodenfeuchte) wurde anhand von VegIrr (R. Wellinger 2004), einem Programm für die Optimierung der Bewässerung im Gemüsebau, modelliert.
4.1.3 Wädenswil und Aussenstationen 2005 Im Jahr 2005 wurde der Versuch neben Wädenswil am Standort Wauwilermoos durchgeführt. Proben für die Ermittlung des Wachstumsverlaufs wurden weniger und unregelmässiger als in den beiden vorherigen Jahren genommen. Die Erntezeitpunkte wurden jedoch eingehalten. 4.1.4 Klimaverlauf Wädenswil 2003, 2004 & 2005 Das Jahr 2003 war gegenüber dem Jahr 2004 zu Beginn der Kultur (mitte Juni) bis Anfang September deutlich Wärmer. Ab Mitte September zeichnete sich jedoch das Jahr 2004 mit deutlich höheren Temperaturen aus (Abb.5). Dies wirkte sich auch auf den Temperaturverlauf im Boden in 10cm Tiefe aus. Die Temperaturkurven (TS mean –10) unterschieden sich jedoch wie erwartet schwächer voneinander, als die Lufttemperatur (TS max).
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 7 von 37
Vergleich TSmax von '03 - '05 in 200cm höhe
0500
100015002000250030003500
0 20 40 60 80 100
120
140
160
KulturtageDaten: Meteo Schweiz
Tsm
ax [°
C]
Tsmax '03TSmax '04Tsmax '05
Vergleich TSmean von '03 - '05 in -10 cm im Boden
0500
10001500200025003000
0 20 40 60 80 100
120
140
160
Kulturtage
Tsm
ax [°
C] TS mean -10
'03Tsmean -10'04Tsmean -10'05
Daten: Meteo Schweiz
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Vergleich Tmean von '03 - '05 in -10 cm im Boden
0
5
10
15
20
25
30
0 20 40 60 80 100
120
140
160
KulturtageDaten: Meteo Schweiz
Tsm
ax [°
C]
Tmean -10 '03Tmean -10 '04Tmean -10 '05
Summierter Niederschlag für die Jahre 2003-2005
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
110
120
130
140
150
160
Kulturtage
[mm
] 200320042005
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 8 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.1.5 Klimaverlauf Aussenstationen 2004 Anhand eines Vergleiches zwischen den eingesetzten Daten-Loggern (Elpro HOTDOG DH3) im Feld und den Klimadaten von Meteostationen welche sich in der Nähe befinden, konnte eine sehr hohe Deckungsgleichheit zwischen dem Temperaturverlauf in 2 Meter über dem Boden sowie 10 cm im Boden festgestellt werden (Abb. 7). Es kann somit angenommen werden, dass die Klimadaten der nächstgelegenen Meteostation ausreichend sind, um die Temperatursummen für den jeweiligen Standort zu bilden.
Vergleich Logger Diepoldsau / Meteo Vaduz 2004
0500
100015002000250030003500
12.06.04 01.08.04 20.09.04 09.11.04
Datum
Ts [°
C]
TsmaxLogger
Tsmean -10cmLoggerTsmaxMeteoVaduzTsmean -10cmMeteo Vaduz
Abb. 7: Vergleich Messstation METEO mit Logger Elpro für den Standort Diepoldsau
Die Temperaturverläufe der fünf Versuchsorte wichen nur gering von einander ab. Während die in der Luft gemessenen Temperaturen eine maximale Differenz von 280 °C betrug (Luft), wiesen die in 10 cm Tiefe gemessenen Temperaturen nur eine maximale Differenz von 180 °C auf.
Vergleich Temperatursumme max. Aussenstationen + Wae (2004)
0500
100015002000250030003500
0 50 100 150 200
Tsm
ax
Kulturtage
Tsmax Ins
Tsmax Utzensdorf
Tsmax DiepoldsauTsmax Basadingen
Tsmax Wädenswil
Abb. 8: Vergleich der TSmax der verschiedenen Standorte
Vergleich Temperatrusumme -10cm Aussenstationen + Wae (2004)
0500
10001500200025003000
0 50 100 150 200
Kulturtage
Ts -1
0cm
Tsmean -10 Ins
Tsmean -10Utzensdorf
Tsmean -10Diepoldsau
Tsmean -10Basadingen
Tsmean -10Wädenswil
Abb. 9: Vergleich der Bodentemperaturen der verschiedenen Standorte
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 9 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.1.6 Bodencharakteristiken 2004 Die Böden der Versuchsstandorte unterschieden sich zum Teil stark voneinander. Während Wädenswil, Basadingen und Utzensdorf der Bodentypgruppe Sandiger Lehm zugeordnet werden konnten, wies der Standort Diepoldsau einen Stark lehmigen Sand (Schluffboden) aus und die Karotten in Ins wuchsen in einem Humusreichen, Schwachtonigem Lehm. Auch die Dichten der Böden Schwankten von 1.4 t m-3 bis 1.7 t m-3. Der Standort Ins wies die geringste nutzbare Feldkapazität auf und Diepoldsau die höchste.
Tab. 1: Bodencharakteristiken der Versuchsstandorte
Standort Dichte Feldkapazitätnutzbare Feldkapazität Bodenart
Wädenswil 1.4 44% 20% Sandiger Lehm
Diepoldsau 1.4 45% 25%
stark lehmiger Sand / Schluff-boden
Basadingen 1.6 36% 17% Sandiger LehmUtzensdorf 1.5 41% 19% Sandiger Lehm
Ins 1.7 32% 15%
humusreicher, schwachtoniger Lehm
Bodencharakteristiken der Versuchstandorte (0-30cm)
4.2 Wachstumsverlauf Für die Bestimmung der Wachstumskurve hinsichtlich Ertrag wurde der Durchmesser an der dicksten Stelle der Karotte gemessen. Dieser Korreliert sehr stark (R2 = 0.91) mit dem Gewicht der Karotte.
Korrelation zwischen Wurzel-Durchmesser und Wurzel-Gewicht
y = 0.1423x + 19.358R2 = 0.9152
0
10
20
30
40
50
60
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270Wurzelgewicht [gr]
Wur
zeld
urch
mes
ser [
mm
Abb. 20: Abhängigkeit zwichen Wurzelgewicht und Wurzeldurchmesser
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 10 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.2.1 Wädenswil 2003, 2004 & 2005
SaatdichteBolero Maestro
100 Samen m-1 63 66150 Samen m-1 90 71
Sorte
Auflaufrate der Versuchsstation Wädenswil (Pflanzen pro Laufmeter)
Tab.2: Keimungsrate und Bestandesdichte am Standort Wädenswil (2004)
Die Keimungsrate lag zwischen 60 und 70% (Dammkultur). Während das Jahr in einem mehr oder wenig starken sigmoiden Wachstumsverhalten resultierte, nahm die Wachstumsrate gegen Ende der Kultur im Jahr 2004 bei beiden Sorten nur schwach ab, resp. steigerte sich nochmals in den letzten 3-4 Wochen. Bei den Jahren 2003 und 2004 ist ein Knick im Wachstumsverlauf bei ca. 85 KT oder bei 2001°C resp. 1600°C (Tsmax / TS Boden –10cm) zu erkennen. Im Jahr 2005 fand dieser Knick rund 15 Tage später statt (oder bei 2300°C resp. 2000°C (TSmax / TS Boden -10cm)) Trotz der unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ist im Wachstumsverlauf eine hohe Korrelation zwischen den Jahren und den Sorten zu erkennen. Da die Bodentemperatur ein gewisser Puffer bezüglich Temperaturschwankungen ist und die Wachstumskurven aufgetragen gegen TS –10cm stark übereinstimmen, wird angenommen, dass die Temperatur in –10cm Tiefe als mögliches Mass für die
optimale Wurzelentwicklung genommen werden kann.
Verlauf Wurzeldurchmesser in Abhängigkeit der K-Tage: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
05
101520253035404550
20 40 60 80 100 120 140 160Kulturtage
Wur
zeld
urch
mes
ser
[mm
]
Maestro'03Bolero'03Maestro'04Bolero'04Maestro'05Bolero'05
Verlauf Wurzeldurchmesser in Abhängigkeit der Tsmax: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
05
101520253035404550
500 1000 1500 2000 2500 3000TSmax
Wur
zeld
urch
mes
ser
[mm
]
Maestro'03Bolero'03Bolero'04Maestro'04Maestro'05Bolero'05
Verlauf Wurzeldurchmesser in Abhängigkeit der Tsmean -10cm: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
05
10152025303540455055
500 1000 1500 2000 2500 3000Tsmean -10cm
Wur
zeld
urch
mes
ser
[mm
] Maestro '03
Bolero '03
Bolero '04
Maestro '04
Maestro '05
Bolero '05
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 11 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.2.2 Aussenstationen Der Vergleich des Wachstumsverlaufs über alle Standorte zeigte trotz den Unterschieden in der Bodenart sowie der klimatischen Bedingungen eine ziemlich hohe Korrelation (R2 = 0.98 aufgetraggen gegen Kulturtage; und R2 = 0.97 aufgetragen gegen Ts –10cm). Es ist jedoch anzufügen, dass nur jeweils die 10 grössten Karotten innerhalb der vermarktbaren Grösseklassen gemessen wurden. Somit wurde die Breite des Vergleiches der Durchmesser bereits stark eingeengt was zwingend zu einer mehr oder weniger hohen Korrelation führen muss. Da aber die Vermarktbaren Karotten von Interesse sind, ist diese Auswahl durchaus zu vertreten.
Tab.3: Keimungsraten und Bestandesdichte an den Aussenstandorten
Standort Anzahl Anbau
Basadingen 602 Reihen pro Damm
Diepoldsau 753 Reihen pro Damm
Inforama 552 Reihen pro Damm
Utzensdorf
Auflaufraten der Aussenstandorte (Pflanzen pro Laufmeter)
Sorte Anglia
Verlauf Wurzeldurchmesser:Standortvergleich der Sorte Bolero bezogen auf Kulturtage
05
1015202530354045
0 20 40 60 80 100 120 140 160Kulturtage
Wur
zeld
urch
mes
ser [
mm
]
InforamaUtzensdorf*Diepoldsau 04BasadingenWädenswil
Verlauf Wurzeldurchmesser:Standortvergleich der Sorte Bolero bezogen auf Ts -10cm (Mittelwert) (2004)
05
1015202530354045
500 1000 1500 2000 2500 3000Ts -10cm
Wur
zeld
urch
mes
ser [
mm
]
InforamaUtzensdorf*Diepoldsau 04BasadingenWädenswil
Abb. 35: Verlauf Wurzeldurchmesser in Abhängigkeit der Tmean -10cm
Abb. 44: Verlauf Wurzeldurchmesser in Abhängigkeit der KT (Aussenstandorte)
Obwohl an allen Aussenstandorten (ausser Basadingen) zwischen 110 und 140 KT geerntet wurde, wird deutlich, dass bezogen auf die Bodentemperatursumme bis knapp 500°C Unterschiede herrschen.
Verlauf Wurzeldurchmesser: Standortvergleich der Sorte Bolero ( Diepoldsau: Maestro) bezogen auf Kulturtage (2003)
0
5
10
15
20
25
30
35
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Kulturtage
Wur
zeld
urch
mes
ser [
mm
]
WädenswilDiepoldsauSünikon
Verlauf Wurzeldurchmesser: Standortvergleich der Sorte Bolero (Diepoldsau: Maestro) bezogen auf TS -5cm (2003)
0
5
10
15
20
25
30
35
500 1000 1500 2000 2500 3000
TS -5cm °C
Wur
zel-D
urch
mes
ser (
mm
)
Wädenswil
Diepoldsau
Sünikon
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 12 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 13 von 37
Verlauf Wurzeldurchmesser: Standortvergleich der Sorten Bolero & Maestro bezogen auf Kulturtage (2005)
0
10
20
30
40
50
60
0 20 40 60 80 100 120 140 160Kulturtage
mm
WädenswilBoleroWädenswilMaestroWauwilermoos
Verlauf Wurzeldurchmesser: Standortvergleich der Sorten Bolero & Maestro bezogen auf TS -10cm (2005)
0
10
20
30
40
50
60
500 1000 1500 2000 2500 3000
Tsmean -10cm
mm
WädenswilBoleroWädenswilMaestroWauwilermoos
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.2.3 Frischgewicht / Trockengewicht Das Verhältnis zwischen Frischgewicht und Trockengewicht der Wurzel korrelierte in den Jahren 2003 und 2004 sehr stark (R2 = 0.98; resp. R2 = 0.96). Der Anteil Trockengewicht an Frischgewicht schwankte im Jahr 2004 zwischen 9.5 und 13.5 % (Ausreisser beglichen). Bezüglich des Verhältnisses Frisch-, Trockengewicht der Blätter fand sich eine ähnlich hohe Korrelation im Jahr 2004 von R2 = 0.96 bei einem prozentuellen Anteil des Trockengewichts von durchschnittlich 16.68 % (STABW = 3.9).
Verhältnis FS / TS Wurzel '05
y = 0.1346x - 0.2844R2 = 0.9864
0
5
10
15
20
25
30
0 50 100 150 200 250
Frischgewicht WurzelTr
ocke
ngew
icht
Wur
zel
Ts Wurzel
Linear (Ts Wurzel)
Verhältnis FS / TS Blätter '05
y = 0.1529x + 0.0759R2 = 0.91
0
1
2
3
4
5
6
7
0 10 20 30 40 50
Frischgewicht Blätterl
Troc
keng
ewic
ht B
lätt
er
Linear
Verhältnis FS / TS Bolero Saatdichte1 '04
y = 0.1118x + 0.3064R2 = 0.9765
0
5
10
15
20
25
0 50 100 150 200
Frischgewicht Wurzel
Troc
keng
ewic
ht W
urze
l
TS Wurzel
Linear (TS Wurzel)
Abb. 66: Verhältnis von Frischgewicht zu Trockengewicht (Wurzel)
Verhältnis FG / TG Bolero Saatdichte1 '04
y = 0.1521x + 0.2515R2 = 0.9284
0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0
10.0
0 20 40 60 80
Frischgewicht Blätter
Troc
keng
ewic
ht B
lätte
r
TG BlätterLinear (TG Blätter)
Abb. 57: Verhältnis von Frischgewicht zu Trockengewicht (Blätter)
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 14 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.2.4Blattfläche / Anzahl Blätter Die Blattfläche erreichte in Wädenswil im Jahr 2003 sowie 2004 zwischen 70 bis 90 Kulturtagen ihren maximalen Wert und verringerte sich gegen Ende der Kulturzeit nach etwa 130 KT. Die Werte schwankten zwischen den Jahren und den Sorten relativ stark, wobei das Jahr 2003 tendenziell zu einer höheren Blattfläche führte. Dies vor allem während den ersten 80 Kulturtagen.
Blattflächen der Sorte Maestro 2003 - 2005
0
100
200
300
400
500
600
30 50 70 90 110 130 150
Kulturtage
[cm
^2] B-Fläche Maestro 04
B-Fläche Maestro 03
B-Fläche Maestro05
Blattflächen der Sorte Bolero 2003 - 2005
0
100
200
300
400
500
600
30 50 70 90 110 130 150
Kulturtage
[cm
^2] B-Fläche Bolero 04
B-Fläche Bolero 03
B-Fläche Bolero05
Die Anzahl Blätter des Jahres 2003 in Wädenswil lagen bei beiden Sorten unterhalb des Durchschnittes des Jahres 2004.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 15 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.2.5 Brix Der Brix-Wert zeigt die Konzentration von gelösten Feststoffen in einer Probe (wässrige Lösung) in Prozenten an. Dieser Wert zeigt das Total aller gelösten Feststoffen im Wasser an. Diese sind neben Zucker auch Salze, Proteine, Säuren usw... Brix wird oft für die Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Früchten benutzt.
Verlauf Zuckergehalt: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
6
7
8
9
10
11
12
13
40 60 80 100 120 140 160
Kulturtage
Zuck
erge
halt
[Bri
x] Bolero'03
Bolero'04
Bolero'05
Verlauf Zuckergehalt: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
6
7
8
9
10
11
12
13
40 60 80 100 120 140 160
Kulturtage
Zuck
erge
halt
[Bri
x] Maestro'03
Maestro'04
Maestro'05
Verlauf Zuckergehalt: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
6
7
8
9
10
11
12
13
900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300TsMax
Zuck
erge
halt
[Brix
]
Bolero'03Bolero'04Bolero'05
Verlauf Zuckergehalt: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
6
7
8
9
10
11
12
13
900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300TsMax
Zuck
erge
halt
[Bri
x] Maestro'03Maestro'04Maestro'05
Verlauf Zuckergehalt: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
6
7
8
9
10
11
12
13
900 1300 1700 2100 2500TsMax Boden -10cm
Zuck
erge
halt
[Bri
x] Bolero'03Bolero'04Bolero'05
Verlauf Zuckergehalt: Maestro & Bolero 2003, 2004 & 2005 FAW
6
7
8
9
10
11
12
13
900 1300 1700 2100 2500TsMax Boden -10cm
Zuck
erge
halt
[Brix
] Maestro'03Maestro'04Maestro'05
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 16 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Die Abbildung 23 zeigt die Abhängigkeit des Brixwertes von dem Trockengewicht. Ein hoher Anteil an Trockensubstanz erhöht auch den Gehalt an gelösten Feststoffen.
Verlauf Trockengewicht und Brix (mit Niederschlag) der Sorten Bolero und Maestro 2004
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156Kultrutage
°Brix
(und
Ant
eil %
Tr
ocke
ngew
icht
)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Nie
ders
chla
g In
mm
Niederschlag04Brix Bolero 04
Brix Maestro 04
TrockengewichtBolero in % '04
Abb. 73: Verlauf des Trockengewichts und des Brixwertes in Wädenswil 2004
Verlauf Trockengewicht und Brix (mit Niederschlag) der Sorten Bolero und Maestro 2005
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156Kultrutage
°Brix
(und
Ant
eil %
Tro
cken
gew
icht
)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Nie
ders
chla
g In
mm Niederschalg 05
Brix Bolero 05
Brix Maestro 05
TS% Bolero 05
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 17 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.3 Ergebnisse Einlagerung Es wurden in allen drei Jahren 3 Erntezeitpunkte festgelegt:
Erntezeitpunkte 2003: 17. September 97 Kulturtage 15. Oktober 127 Kulturtage 11. November 153 Kulturtage
Erntezeitpunkte 2004:
20. September 98 Kulturtage 20. Oktober 128 Kulturtage 17. November 156 Kulturtage
Erntezeitpunkt 2005:
19. September 92 Kulturtage 24. Oktober 127 Kulturtage 21. November 155 Kulturtage
Es wurden jeweils 3 mal 2 Meter Karotten pro Wiederholung / Sorte und Saatdichte geerntet und in
.3.1 Einlagerung 2003
ErntetermineTsmax [°C] Ts -10cm [°C] Tsmax [°C] Ts -10cm [°C] Tsmax [°C] Ts -10cm [°C]
1 2546 2098 2263 1958 2118 18592 3054 2561 2736 2435 2667 23763 3263 2786 3006 2739 2976 2672
2003 2004 2005
G1 Gemüseharasse welche mit Folien ausgelegt waren bei 0.3 °C / 95% rel. Luftfeuchte eingelagert. 4
nzahl sowie Gewichtmässig erreichte die erste Ernte 2003 den höchsten Ertrag an vermarktbaren
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2.Ernt
e
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero 1.Ernt
e
Bolero 2.Ernt
e
Bolero 3.Ernt
ezu klein <20mm
zu gross >40mm
0
200
400
600
800
1000
1200
Anza
hl (s
tk.)
Anzahl eingelagerte Karotten aufgeteilt in Kalibrierung und Erntezeitpunkt (2003)
Abb.24: Anzahl eingelagerte Karotten 2003; Kalibriert
Maestr
o 1. E
rnte
Maestr
o 2. E
rnte
Maestr
o 3. E
rnte
Bolero
1. Ernt
e
Bolero
2. Ernt
e
Bolero
3. Ernt
ezu klein <20
zu gross >35
0
10
20
30
40
50
60
Gew
icht
(kg)
Gewicht eingelagerter Karotten aufgeteilt in Kalibrierung und Erntezeitpunkt (2003)
Abb.25: Gewicht eingelagerter Karotten 2003; Kalibriert und nach Erntezeitpunkt und nach Erntezeitpunkt
AKarotten. Zugleich wies dieser Erntezeitpunkt den kleinsten Anteil an zu kleinen oder zu grossen Karotten auf. Je später die Ernte desto geringer der Ertrag an vermarktbaren Karotten und dementsprechend ein höherer Anteil an unter- oder übergrossen. Alle drei Ernten waren signifikant Unterschiedlich von einander (1.Ernte kg > 2.Ernte kg > 3. Ernte kg).
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 18 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.3.2 Einlagerung 2004 Entgegen dem Jahr 2003 erzielte im Jahr 2004 die zweite Ernte den höheren Ertrag (Anzahl). Diese unterschied sich signifikant gegenüber dem Subset der 1. und 3. Ernte (P<0.05) bei Maestro. Bei Bolero erreichte ebenfalls die 2. Ernte den höchsten Ertrag. Dieser unterschied sich jedoch von der 1. und von der 3. Ernte (P<0.001). Vom Gewicht her gesehen, was auch den Anbauer interessiert, erzielte die 2. und 3. Ernte den höheren Ertrag bei Meastro wie bei Bolero (P<0.01). Die Ernten 2 Und 3 waren signifikant nicht unterschiedlich.
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2. E
rnte
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero
1.Ernt
e
Bolero
2.Ernt
e
Bolero
3.Ernt
ezu klein <20mm
zu gross >50 mm
0102030405060708090
100
Gew
icht
(kg)
Gewicht eingelagerte Karotten aufgeteilt in Kalibrierung und Erntezeitpunkt (2004) Qualitätsnorm 2004
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2.Ernt
e
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero 1.Ernt
e
Bolero 2.Ernt
e
Bolero 3.Ernt
ezu klein <25
zu gross >50
0100200300400500600700800900
Anza
hl (s
tk.)
Anzahl eingelagerte Karotten aufgeteilt in Kalibrierung und Erntezeitpunkt (2004) Qualitätsnorm 2004
Abb. 26: Anzahl eingelagerte Karotten 2004; Kalibriert und nach Erntezeitpunkt
Abb. 27: Gewicht eingelagerter Karotten 2004; Kalibriert und nach Erntezeitpunkt
4.3.3 Einlagerung 2005 Im Jahr 2005 wurden im Bezug auf das Gewicht gegenüber den Vorjahren etwas mehr Karotten geerntet. Die Ernte 2005 unterschied sich gegenüber der Ernte 2003 signifikant. Gegenüber der Ernte
2004 konnte dies nicht festgestellt werden (ausser Maestro in der 3 Ernte). Das Jahr 2005 stellte bezüglich Anzahl geernteter Karotten jedoch eine Ausnahme dar. Diese unterschied sich gegenüber den beiden Vorjahren deutlich signifikant (P<0.001). So wurden zwischen 400 und 600 stk. Karotten an Marktfähigen mehr geerntet als in den beiden Vorjahren.
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2.Ernt
e
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero 1.Ernt
e
Bolero 2.Ernt
e
Bolero 3.Ernt
ezu klein <25
zu gross >50
Marktfähig
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Anzahl eingelagerte Karotten aufgeteilt in Kalibrierung und Erntezeitpunkt (2005)
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2.Ernt
e
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero 1.Ernt
e
Bolero 2.Ernt
e
Bolero 3.Ernt
ezu klein <25
zu gross >50
Marktfähig
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Gewicht eingelagerte Karotten aufgeteilt in Kalibrierung und Erntezeitpunkt (2005)
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 19 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.3.4 Vergleich Einlagerung 2003 – 2005
Bolero
1. Ernt
e
Bolero
2. Ernt
e
Bolero
3. Ernt
e
Maestr
o 1.E
rnte
Maestr
o 2.E
rnte
Maestr
o 3.E
rnte
20052004
20030
100
200
300
400
500
600
700
800
Einlagerung marktfähige Karotten (25mm-50mm) der Sorten Bolero & Maestro 2003-2005 (Anzahl)
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 20 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.3.5 Einlagerung Dämme / Flachbeet In der Schweiz hat sich in den letzten Jahren die Dammkultur als Standart bei der Karottenproduktion etabliert. Neben den Vorteilen eines schnelleren Abzugs von überschüssigem Wasser wird vor allem durch eine höhere Bodenwärme und größere Beetoberfläche eine höhere Ausbeute an erster Qualität und insgesamt eine Qualitätsverbesserung (Rübenform) erreicht. Demgegenüber steht die schnelle Abtrocknung der Dämme was ein vermehrtes Bewässern nötig macht. Die Gefahr für zu lange Rüben besteht dann, wenn die Dämme zu trocken sind und die Karotten das Wasser in der Tiefe suchen müssen.
Kalibrierung Bolero, Dichte 1, Erntezeitpunktversuch-04
0
20
40
60
80
100
120
BO-D-1-
1
BO-N-1-
1
BO-D-2-
1
BO-N-2-
1
BO-D-3-
1
BO-N-3-
1
Kg
in G
röss
enkl
asse
n
Übergrosszu kleinFaul40 - 50mm25 - 40mm
Abb. 28: Ertrag der Sorte Bolero gegen Dichte und Anbauweise (Damm-, Normalkultur)
Kalibrierung Maestro, Dichte 1, Erntezeitpunktversuch-04
0
20
40
60
80
100
120
MA-D-1-
1
MA-N-1-
1
MA-D-2-
1
MA-N-2-
1
MA-D-3-
1
MA-N-3-
1
Kg
in G
röss
enkl
asse
n
Übergrosszu kleinFaul40 - 50mm25 - 40mm
Legende:BO = BoleroMA = MaestroD = DammN = Normalkultur (Flachbeet)1-1 = 1.Ernte 100 Samen m-1
2-1 = 2.Ernte 100 Samen m-1
3-1 = 3.Ernte 100 Samen m-1
Abb.29: Ertrag der Sorte Maestro gegen Dichte und Anbauweise (Damm-, Normalkultur)
Der Ertrag der Karotten, Maestro sowie Bolero, welche in Dämmen kultiviert wurden war deutlich höher als derjenige welcher in Flachbeetkultur gezogen wurde (P<0.001). Evars et al. (1997) beobachtete allerdings genau das Gegenteil. Die höchsten Erträge wurden bei seinen Untersuchungen auf Flachbeeten erzielt. Wie auch immer, bei der Sortierung des Versuchs in Wädenswil, konnte festgestellt werden, dass die Karotten der Dammkultur einen schöneren, gleichmässigeren Wuchs aufwiesen. Die relativ hohen Werte von Faulen Karotten bei Bolero unter Dammkultur und erster Ernte waren erste Verluste am Lager, da die Kalibrierung erst nach der 3. Ernte erfolgte. Das heisst, diese Karotten hatten bereits 2 Monate Lager bei 0.3°C / 95% rLF hinter sich. In der Diskussion wird näher darauf eingegangen.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 21 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.4 Ergebnisse Auslagerung 2003
Auslagerung Ernte 2003: 5.Mai bis 7.Mai 2004 (225; 197;170 Lagertage) Lagerung bei 0.5°C / 97% rel. Luftfeuchte
4.4.1 Ertrag Bei der Auslagerung vom 5. – 7. Mai wurden mit Fäulnis befallene Karotten nach 2 Grössenklassen ausgesondert. Die 1. Ernte wies dabei einen sehr hohen Anteil an faulen Karotten auf, sowohl bei Maestro als auch bei Bolero. Der Verlust bei der 2. Ernte betrug lediglich noch ca. 3% bei Maestro und 5% bei Bolero. Die 3. Ernte wies bei beiden Sorten keine nennenswerte Verlust mehr auf.
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2.Ernt
e
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero
1.Ernt
e
Bolero
2.Ernt
e
Bolero
3.Ernt
e20-40mm
>40mm
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Fäul
nis
in %
von
ein
gela
gert
(100
%)
Starke Fäulnis an ausgelagerten Karotten nach Erntezeitpunkt und Grösse gegliedert (2003)
Abb.30: Anteil der an Fäulnis befallenen Karotten bei der Auslagerung.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 22 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.4.2 Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Inhaltsstoffe Parallel zur Auslagerung wurden die Karotten auf ihre Inhaltsstoffe und die sensorische Qualität untersucht. Tabelle 5 veranschaulicht die Ergebnisse bezüglich der 3 Erntezeitpunkten. Maestro sowie Bolero wiesen bei der dritten Ernte eine starke Zunahme an Isocumarin auf (R2 = <0.001). Der Mittelwert an Isocumarin lag bei Maestro während der 1. und 2. Ernte bei 1.5 bis 2 mg/100g FG. Sowohl unter der Pflanzdichte 100 Korn pro Laufmeter wie auch 150 Korn pro Laufmeter. Beim 3. Erntetermin lag der Isocumarinwert bei 62 mg/100g FG bei der niedrigeren Saatdichte und bei 53 mg/100g FG bei der höheren Saatdichte. Bei Bolero lagen die Isocumarin Werte ähnlich derjenigen von Maestro zwischen 0.5 bis 2.3 mg/100g FG. Bei der 3. Ernte zeigte die Sorte Bolero jedoch ein anderes Verhalten. Die Menge an Isocumarin unter 100 Samenkorn pro Laufmeter wies mit 39.5 mg/100g einen deutlich geringeren Gehalt gegenüber Maestro auf. Etwas höher als Maestro und deutlich höher als die Werte resultierend aus der niedrigeren Saatdichte bei Bolero kam die höhere Saatdicht mit 68 mg/100g zu liegen. Das Verhalten von Hexose (Fructose und Glucose) und Saccharose verhielt sich wie in der Literatur beschrieben und Saccharose war gegen Ende der dominierende Speicherzucker mit Zunahme der Kulturdauer. Der Erntezeitpunkt hat Einfluss auf folgende Parameter DC-03 Parameter Positiv 1.Ernte Positiv 2.Ernte Positiv 3.ErnteBrixSaccharoseGlucoseFructoseGesamtzuckerCitronensäureÄpfelsäure Hoch MittelAlfa-CarotinIsocumarinTerpinolen Tief MittelSaftigkeitBitterkeitTerpengeschmackNachgeschmack
Legende:=Subset=0.001=0.01=0.05
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 23 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.4.3 Einfluss der Sorte auf die Inhaltsstoffe Der Einfluss der Sorten Bolero und Maestro wird in Tabelle 6 dargestellt. Die Sorte Bolero weist gegenüber der Sorte Maestro bessere qualitative sowie sensorische Eigenschaften auf. Bemerkenswert ist der tiefere Gehalt an Nitrat sowie der höhere Gehalt an ∀- sowie ∃-Carotin. Aber auch durch Saftigkeit sowie die Süssigkeit besticht die Sorte Bolero. Das Gesamturteil fiel dann auch deutlich für Bolero aus.
Parameter Positiv Bolero Positiv Maestrotitrierte SäureBrixNitratNaMgSaccharoseGlucoseGesamtzuckerÄpfelsäureAlfa-CarotinBeta-CarotinAlfa-Humulen Hoch TiefCaryophyllen Hoch TiefTerpinolen Hoch TiefSaftigkeitSüssigkeitKarottengeschmackGeschmacksintensitätGesamturteil
Legende:= 0.001= 0.01
Die Sorte hat 2003 Einfluss auf folgende Parameter
4.4.4 Einfluss der Anbauweise auf die Inhaltsstoffe Zwischen Flachbeet und Dammanbau konnte festgestellt werden, dass die Saatdichte 2 (150 Korn/m-1) und das Flachbeet zu einer höheren Nitrateinlagerung in den Karotten führen. Während die Pflanzdichte nicht signifikant unterschiedlich war, betrug diejenige der Anbauform P<0.01. Zudem fanden sich in der Sorte Maestro signifikant höhere Nitratgehalte gegenüber Bolero (P<.001).
Bolero 2.Ernte '03
050
100150200250300350400450500
NitratMitt
elw
ert M
iner
alst
offe
(mg
/ l S
aft)
D-100
D-150
N-100
N-150
Maestro 2.Ernte '03
050
100150200250300350400450500
NitratMitt
elw
ert M
iner
alst
offe
(mg
/ l S
aft)
D-100
D-150
N-100
N-150
Abb.32: Einfluss der Anbauweise auf den Nitratgehalt bei der Sorte Bolero
Abb.31: Einfluss der Anbauweise auf den Nitratgehalt bei der Sorte Bolero
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 24 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.5 Ergebnisse Auslagerung 2004
Auslagerung Ernte 2004: 23 Mai 2005 (225; 197;170 Lagertage) Lagerung bei 0.5°C / 97% rel. Luftfeuchte
4.5.1 Ertrag Der Anteil an von Fäulnis befallenen Karotten bei der Auslagerung am 23. Mai 2005 war mit 36% bei Maestro, resp. 27% bei Bolero relativ hoch. Während für die Sorte Maestro in der zweiten und dritten Ernte ein markant kleinerer Anteil an Faulen erzielt wurde, war die Abnahme des Anteils an faulen Karotten nach Erntezeitpunkt relativ linear und erreichte den selben Anteil wie Maestro unter der 3. Ernte. Ein signifikanter Unterschied konnte jedoch bei beiden Sorten unter allen drei Erntezeitpunkten nicht festgestellt werden. (vgl. Abb. 33)
Karotten % faule Auslagerung 23.05.05
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Maestr
o 1.Ernt
e
Maestr
o 2.Ernt
e
Maestr
o 3.Ernt
e
Bolero
1.Ernt
e
Bolero
2.Ernt
e
Bolero
3.Ernt
e
Fäul
nis
in %
von
ein
gela
gert
(100
%)
Werden die Ernten der Jahre 2003 und 2004 gegenübergestellt, kann ein signifikant höherer Anteil an faulen Karotten festgestellt werden. Dies unter jedem Erntezeitpunkt für beide Sorten. Es ist hier anzumerken, dass für die Gegenüberstellung sowie die einzelnen Betrachtungen des Anteil an faulen Karotten nur die Daten der Flachbeetkultur ausgewertet wurden. Dies da die Ernte 2003 für alle drei Erntezeitpunkte nur in Flachkultur kultiviert wurden.
Maestro 1.Ernte
Maestro 2.Ernte
Maestro 3.Ernte
Bolero 1.Ernte
Bolero 2.Ernte
Bolero 3.Ernte
2003
200405
10152025303540
Karotten faule % im Vergleich 2003/2004Bolero / Maestro
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 25 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.5.2 Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Inhaltsstoffe Der Erntezeitpunkt hat Einfluss auf folgende Parameter DC-04 Parameter Positiv 1.Ernte Positiv 2.Ernte Positiv 3.ErnteBrixSaccharose Mittel HochGlucose Hoch MittelFructose Hoch MittelGesamtzuckerCitronensäureÄpfelsäure Hoch MittelAlfa-CarotinIsocumarinTerpinolenSaftigkeitBitterkeit Tief MittelTerpengeschmackNachgeschmack
Ausserdem DC-04SüssigkeitGesamturteilNitrat
Legende:=Subset=0.001=0.01=0.05= wurde bei DC-04 nicht erhoben
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 26 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.5.3 Einfluss der Sorte auf die Inhaltsstoffe
Parameter Positiv Bolero Positiv Maestrotitrierte SäureBrixNitratNaMgSaccharoseGlucoseGesamtzuckerÄpfelsäureAlfa-CarotinBeta-CarotinAlfa-HumulenCaryophyllenTerpinolenSaftigkeitSüssigkeitKarottengeschmackGeschmacksintensitätGesamturteil
Legende:= 0.001= 0.01=sig. Unterschied bei DC-04 (+=stärke)= wurde bei DC-04 nicht erhoben
Die Sorte hat 2004Einfluss auf folgende Parameter
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 27 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.5.4 Einfluss der Anbauweise auf die Inhaltsstoffe Zwischen Flachbeet und Dammanbau konnte festgestellt werden, dass die Saatdichte 2 (150 Korn/m-1) und das
Maestro 2.Ernte '04
050
100150200250300350400450500
Nitrat
Nitr
at (m
g / l
Saf
t)
D-100 '04
D-150 '04
N-100 '04
N-150 '04
Bolero 2.Ernte '04
050
100150200250300350400450500
NitratMitt
elw
ert M
iner
alst
offe
(mg
/ l S
aft)
D-100 '04
D-150 '04
N-100 '04
N-150 '04
4.6 Ergebnisse Auslagerung 2005 Auslagerung Ernte 2005: 14 März 2005 (177; 142; 114 Lagertage) 11 April 2005 (205; 170; 142 Lagertage) 10 Mai 2005 (234; 199; 171 Lagertage) Lagerung bei 0.5°C / 97% rel. Luftfeuchte
Maestro 1.Ernte
Maestro 2.Ernte
Maestro 3.Ernte
Bolero 1.Ernte
Bolero 2.Ernte
Bolero 3.Ernte
2003
2005
2004
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% faule Karotten nach Auslagerung 2003/2004/2005Bolero / Maestro
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 28 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.6.1 Ertrag Verglichen mit der Ernte 2004 weist die Ernte 2005 bei der Auslagerung einen signifikant geringeren Anteil an faulen Karotten aus. Die Werte der Ernte 2005 unterscheiden sich dagegen kaum von der Ernte 2003. Es ist hier bei der Interpretation Vorsicht geboten, da im Jahr 2006 drei, in Abständen von jeweils einem Monat, gefolgten Auslagerungen vorgenommen wurden. Dies mit der Absicht, den Einfluss der Lagerdauer auf die Bildung von Fäule im Lager abzuklären. Durch falsche Versuchsführung wurde jedoch bei jeder Auslagerung gesundes Karottengut mit Fäule kontaminiert und wieder eingelagert. Aus diesem Grund kann nur die erste Auslagerung vom 14.03.06 berücksichtigt werden. Im Vergleich mit den Jahren 2003 & 2004 fehlen dementsprechend 60 Lagertage.
Karotten % faule Auslagerung 14.03.06
0.0
10.0
20.030.0
40.0
50.0
Maes
tro 1.Ernt
e
Maes
tro 2.Ernt
e
Maes
tro 3.Ernt
e
Bolero 1.E
rnte
Bolero 2.E
rnte
Bolero 3.E
rnte Fä
ulni
s in
% v
on e
inge
lage
rt (1
00%
)
Maestro 1.Ernte
Maestro 2.Ernte
Maestro 3.Ernte
Bolero 1.Ernte
Bolero 2.Ernte
Bolero 3.Ernte
2003
2005
2004
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% faule Karotten nach Auslagerung 2003/2004/2005Bolero / Maestro
4.6.2 Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Inhaltsstoffe 4.6.3 Einfluss der Sorte auf die Inhaltsstoffe
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 29 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
4.6.4 Einfluss der Anbauweise auf die Inhaltsstoffe
Nitrat in Maestro / Bolero 2.Ernte '05
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
Nitr
at (m
g / l
Saf
t)
Maestro D-100 '05Bolero D-100 '05Maestro N-100 '05Bolero N-100 '05
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 30 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
5. Diskussion Wachstumsverlauf Aufgrund unterschiedlicher Erhebungen während der Kulturzeit, hervorgerufen durch geänderte Qualitätsbestimmungen bezüglich der Grössenklassifikation, war es nur mit Vorbehalten möglich, den Wachstumsverlauf der Jahre 2003 und 2004 miteinander zu vergleichen. Deshalb wird in diesem Bericht bei der Betrachtung der Entwicklung der Karotten stärker auf den Vergleich zwischen den Standorten eingegangen. Wurzelwachstum Die Analyse des Wachstumsverlaufs der Wurzelbildung liess eine sigmoide Wachstumskurve erkennen. Bis 75 Kulturtage konnte einerseits zwischen den Jahren 2003 und 2004, sowie zwischen den Versuchsstandorten im Jahr 2004 eine sehr gute Übereinstimmung bezüglich der Zunahme des Wurzeldurchmessers festgestellt werden. Danach setzte eine leichte Streuung ein. Im Jahr 2004 sanken bei ca. 100 Kulturtagen die Zuwachsraten der Wurzelbildung bei allen 5 Versuchstandorten. Suojala (1999) fand in Versuchen in Finnland über die Jahre 1996-1997 die selben Ergebnisse trotz unterschiedlichen Ertragsmengen. Die minimale Temperaturlimite welche noch ein Wachstum der Wurzel zulässt, ist einer der essenziellen Parameter bei Wachstumsmodellen im Gemüsebau. Brewster und Sutherland (1993) berechneten den Minimalwert von 1.0°C für das Wachstum von Karotten. Benjamin und Aikman (1995) gebrauchten einen Wert von 1.3°C. Dieser Wert wurde zwar von Wagenwoort und Bierhuizen (1977) als die minimale Temperatur bestimmt, bei welcher Karottensamen anfangen zu keimen, Benjamin und Aikman (1995) vermuteten aber, dass dieser Wert auch für das weiter Wachstum der Karotten als die minimal Temperatur gilt. Suojola (1997) bestätigte diese niedrigen Werte für die gesammte Wachstumsphase der Wurzel. Die Karotte ist also fähig, bei sehr tiefen Temperaturen noch zu Wachsen. Während Fritz und Habben (1977) in Versuchen in Deutschland einen Stopp des Wurzelwachstums zwischen Ende September bis Ende Oktober beobachteten, konnte dies für die vorliegenden Versuche 2004 nicht bestätigt werden. Auch das Jahr 2003, trotz seiner kühleren Witterung im Herbst, fürte nicht zu einem Stillstand des Wurzelwachstums in der von Fritz und Habben (1977) beschriebenen Zeitspanne. Der Zuwachs nahm jedoch stärker ab als im Jahr 2004. Es wird angenommen, dass das deutlich wärmere Wetter im Spätherbst im Jahr 2004 einen zusätzlichen Zuwachst der Rüben verursacht hat. Da die Karotte ein Wurzelgewächs ist, kann angenommen werden, dass die Bodentemperatur ein bedeutender Parameter ist für das Wurzelwachstum. Vergleiche zwischen 2003 und 2004 in der Versuchstation Wädenswil haben gezeigt, dass die aufsummierte mittlere Bodentemperatur (-10 cm) eine sehr gute Korrelation (R2 =9.5) zum Wurzelwachstum aufweist. Die maximale Temperatursumme weist ein gering schlechteres R2 von 9.4 auf. Dies bestätigt ansatzweise auch der Standortvergleich bei welchem die Bodentemperatur ebenfalls eine leicht bessere Korrelation aufweist. In der Literatur konnte bis zum momentanen Zeitpunkt keine Angaben bezüglich dieser Frage gefunden werden. Blattfläche / Anzahl Blätter Obwohl im Jahr 2003 die Blattflächen beider Sorten grösser waren als die des Jahres 2004, war die Anzahl Blätter deutlich geringer. Suojala (2000) hat das bei seinen Versuchen auch beobachtet und bringt dies mit dem unterschiedlichen Temperaturverlauf in Verbindung. Bei hohen Temperaturen investiert die Karotte mehr in die Blattproduktion durch das Ausbilden von einer geringeren Anzahl Blätter die aber dicker und länger sind. Diese Beobachtung kann durch den ausserordentlich warmen Sommer im 2003 in den vorliegenden Untersuchungen bestätigt werden.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 31 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Brix-Wert Die Werte der Jahre 2003 und 2004 zeigen ähnliche Verlaufskurven. Trotz anfänglich tieferen Werten im Jahr 2004 wurden bem 3. Erntezeitpunkt die fast exakt gleichen Werte ermittelt. Gemessen an der maximalen Temperatursumme brauchten die Karotten des Jahres 2003 rund 300°C mehr um den Endwert zu erreichen. Bei der mittleren Temperatursumme in –10cm Boden verliefen die Kurven ab Anfang Oktober deckungsgleich das heisst, es wurden die gleichen TS –10 cm erreicht. Dies sowohl bei Bolero als auch bei Maestro. Die anfänglich sehr hohen Brix-Werte im Jahre 2003 konnten 2004 nur in einer stark abgeschwächten Weise bestätigt werden. Der starke Abfall der Kurve nach den anfänglich hohen Werten konnte bei beiden Sorten über beide Jahre beobachtet werden. Nicht so der zweite starke Peak im Jahr 2003 bei beiden Sorten. Steingröver (1983) unterteilte die Entwicklung der Karotte in drei Entwicklungsphasen. Diese umfassen die Periode 1 (1-25 Tage nach der Aussat bei konstanter Temperatur von 20°C) in welcher keine löslichen Zucker gespeichert werden. Die Periode 2 (25-32 Kulturtage) in welcher vor allem reduzierte Zucker gespeichert werden und die 3. Periode (30-50 Kulturtage) in welcher die Rate der Saccharose schneller zunimmt als diejenige der Hexosen. Somit ist Saccharose der dominante transport- und Speicherzucker bei der Reife (Suojala, T. 2000). Die Analyse der Karotten aus dem Jahr 2003 vom Versuch Wädenswil bestätigten diese Angabe. Aufgrund dieser beschriebenen drei Perioden kann angenommen werden, dass die Anfänglich starken Schwankungen des Brix-Wertes auf die Umstellung der Anteile der Zuckerarten und differenzierten Bildungsraten derselben zurück zu führen sind. Ausserdem konnte im Versuch 2004 festgestellt werden, dass der Brix-Wert mit dem Anteil an Trockengewicht der Karotte während der ersten ca. 100 KT stark korrespondiert. Später verliert sich dieses Verhalten. Trockengewicht der Wurzel Der Verlauf des Trockengewichts der Karottenrüben verlief in starker Abhängigkeit zu der des Frischgewichts (R2 = 0.98). In den Stationen Basadingen, Diepoldsau und Ins konnte eine Beeinflussung des Bodenwassergehalts auf die Trockensubstanz festgestellt werden. Für Wädenswil konnte das für die ersten 100 Kulturtage nicht bestätigt werden. Später konnte eine Beeinflussung der TS druch den Bodenwassergehalt ebenfalls beobachtet werden. Einfluss der Bodencharakteristik / Standorteinfluss Karotten können auf einer Vielzahl von Bodentypen kultiviert werden. Agung, I. et al (1989) weist auf den signifikanten Einfluss der Bodendichte auf den Ertrag hin. Böden mit einer Dichte von 1.7 t m-3 zeigten bei sämtlichen gemessenen Parametern eine signifikante Reduktion. Die optimale Dichte schien bei 1.40 t m-3 zu liegen, da bei dieser Dichte der höchste Ertrag erzielt wurde. Die Standorte Wädenswil, Diepoldsau und Utzensdorf entsprachen dieser Dichte. Ins lag mit 1.7 t m-3 im oben beschriebenen suboptimalen Bereich. Basadingen mit 1.6 t m-3 knapp darunter. Ebenfalls sind steinreiche- und sehr schwere Böden ungünstig für die Kultur, da sie sich auf den Wuchs der Karotten negativ auswirkt (Deformation). Day (1984) beobachtet anhand eines Versuchs, bei welchem er verschiedene Bodentypen auf die Ertragsleistung hin überprüfte, dass sich weder sandige- noch Torfböden besser eigneten bezüglich des Ertrags und der Qualität. Dies bestätigen auch Künsch et al. (2003) in ihrem Versuch bezüglich Carotingehalt der Karotten von verschiedenen Standorten, sowie Rüsch und Koch (2003) anhand einer Verleihung des Anabauerpreises „Goldene Karotte“. Der Standortvergleich des Jahres 2004 in dieser Untersuchung führte bezüglich des Ertrags ebenfalls zum gleichen Ergebnis, wobei beim Standort Diepoldsau (Sandboden) die äussere Qualität (Gleichförmigkeit und Abrundung der Wurzelspitze) am besten war. Erntezeitpunkte / Einlagerung Die Karotte weist die Fähigkeit auf, bei noch sehr geringen Temperaturen (>2°C) ein Wachstum zu verzeichnen (Suojala, T. 2000). Dies sollte in der Schweiz je nach Lage und Jahr bis anfangs / mitte November der Fall sein. Die Gefahr von starken Frosteinwirkungen welche den Zuckerhaushalt der Rübe stark beeinflussen steigt jedoch mit zunehmender Kulturdauer (Suojala, T. 2000). Ebenfalls nehmen Schäden an den Karotten und die Menge an übergrossen Rüben zu.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 32 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Ertrag Der höchste Ertrag an vermarktbaren Karotten wurde im Jahr 2003 bei beiden Sorten bei der ersten Ernte nach 97 Kulturtagen erzielt. Dies steht im Gegensatz zur Literatur. Die Tatsache dass die Karotte wie oben beschrieben noch sehr geringe Temperaturen für ein Wachstum nutzen kann, würde unter den klimatischen Bedingungen welche ab dem 1. Erntetermin herrschten, zu einem weiteren Zuwachs führen. Die im Jahr 2003 geltende Grössenklassifikation für vermarktbare Karotten betrugen 20 bis 35 mm. Aus diesem Grund wurden alle Karotten welche einen grösseren Durchmesser als 35 mm aufwiesen nicht unter die Vermarktbaren aufgenommen. Desshalb führte ein weiteres Wachstum nach dem ersten Erntetermin unweigerlich zu einem erhöhten Ausschuss an übergrossen Karotten welches den Ertrag der 2. sowie der 3. Ernte massiv schmälerte. Im Versuchsjahr 2004 änderte die Grössenklassifikation der Vermarktbaren Karotten auf 40 bis 200 Gramm, was in etwa 25 bis 50 mm Durchmesser entspricht. Das ergab ein ganz anderes Bild gegenüber dem Jahr 2003. Erwartungsgemäss erreichte der 2. Erntetermin den besten Ertrag, welcher jedoch gegenüber dem Ertrag des 3. Erntetermins nicht signifikant unterschiedlich war. Das gilt für Maestro wie Bolero. Maestro erzielte gegenüber Bolero den höheren Ertrag, welcher aber im Jahr 2004 von Bolero nicht nicht signifikant verschieden war. 2003 war dies jedoch der Fall (R2 = ?). Verluste Die sehr hohen Verluste durch übergrosse Karotten im Jahr 2003 bei den Ernten 2 und 3 konnte aus obenbeschriebenen Gründen nicht bestätigt werden. Einzig Bolero wies bei der 1. Ernte einen Verlust durch zu kleine Karotten, gemessen an den Vermarktbaren, von ca. 10% auf. Auslagerung An dieser Stelle kann nur auf die Ergebnisse des Auslagerungsjahres 2004 (Ernte 2003) eingegangen werden. Die Auslagerung der Ernte 2004 wird erst anfangs Mai stattfinden und die Ergebnisse dementsprechend frühestens ende Mai / anfangs Juni vorliegen. Lagerverluste Die sehr hohen fäulnisbedingten Verluste der ersten Ernte bei beiden Sorten lassen sich möglicherweise auf die noch hohe Bodentemperatur (-10 cm) bei der Ernte von 17.5°C zurückführen. Diese Annahme wird auch durch die Tatsache unterstützt, dass vor allem dicke Karotten (>40 mm) von der Fäulnis betroffen waren. Die hohe Temperatur konnte eventuell nicht schnell genug aus der Karotte rausgebracht werden und die erntebedingten Verletzungen an der Karotte könnten eine Erstinfektion zugelassen haben. Suojala (2000) hat dies auch beobachtet, stellt aber die Hypothese auf, dass die gegen Ende der Vegetationszeit angestiegene Einlagerung an anti-phytopathogenen Stoffen in der Karotte die Bildung von Fäulnis am Lager erfolgreich unterdrücken. Inhaltsstoffe Der Erntezeitpunkt hat Einfluss auf den Gehalt an Inhaltsstoffen bei den Karotten. So stieg z.B. der Gehalt an Isocumarin in den Karotten der 3. Ernte stark an. Dies sowohl bei den beiden Sorten wie auch den beiden Saatdichten. Dieser Effekt konnte jedoch nur in Wädenswil beobachtet werden. Untersuchungen von Karotten anderer Standorte die Mitte November geerntet wurden, wiesen keine erhöhten Isocumarin-Gehalte auf (Höhn, E. 2004; unpublizierte Mitteilung). Suojala (2000) beobachtete 1996 das selbe in seinen Untersuchungen. Nur in einem Standort beeinflusste der Erntezeitpunkt die Bitterkeit der Karotten. Sensorische Qualität Die sensorische Qualität der Karotten über beide Sorten unterschied sich in einzelnen Parametern wie Saftigkeit, Bitterkeit, Nachgeschmack und Terpengeschmack signifikant bezüglich des Erntezeitpunktes (3. Ernte > als 2./1. Ernte). Im Gesamturteil konnte jedoch kein signifikanter Unterschied festgestellt werden. Bolero schien stärker als Maestro auf den Einfluss des Erntezeitpunktes zu reagieren. Suojala (2000) beschreibt ein unterschiedliches Verhalten zwischen den verschiedenen Versuchsstandorten. An einem Standort konnte ein Einfluss des Erntezeitpunktes auf die sensorische Qualität auf jeden untersuchten Parameter beobachtet werden. An anderen Standorten hingegen gar keine Unterschiede oder nur in einem Parameter.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 33 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Schlussfolgerung
Der Erntezeitpunkt hat Einfluss auf den Ertrag, das Verhalten am Lager sowie die innere Qualität. Zu diesem Zeitpunkt ist es jedoch erst möglich, ein provisorischer Vorschlag bezüglich des optimalen Erntezeitpunktes zu machen. Die Daten der Auslagerung 2005 müssen abgewartet werden und mit denen des Jahres 2004 verglichen werden, um über den Anteil an Inhaltsstoffen, die sensorische Qualität, swoie das Verhalten am Lager definitiv eine Tendenz feststellen zu können. Es wird vorgeschlagen als Mass für die Bestimmung der Kulturdauer die kumulierte Bodentemperatur in 10 cm Tiefe zu benutzen. Durch die Synthese der Resultate und Diskussion lässt sich sagen, dass generell auf eine frühe Ernte verzichtet werden soll. Ein Erntetermin Mitte / Ende Oktober ist vorzuziehen welcher bei ungefähr zwischen 2400 und 2550°C entspricht. Eine Kulturdauer in Tagen von 120 KT sollte dabei nicht unterschritten werden.
Fazit (Schlussfolgerung für die Praxis)
Wachstumsverlauf - Jahr / Standort →Unterschiedlich - Sorten →eher geringer Unterschied - Bodentemperatur ist zu >85% bestimmend →R2 0.86 (Rest Bodenfeuchte?) - Wurzeldurchmesser als Grössenmass - Blattfläche
Streuung / Saatdichte
- Keimfähigkeit - Saatgutablage →Unregelmässig (Herde / Lücken etc.) - Grosse Variabilität bezüglich Erntegut →Kalibrierung ist Problem No. 1
Zusätzlich Daten von 2003 überprüfen ( Diepoldsau / Sünigen / FAW)
Frage: Wie kann dies Verbessert werden
- Zusätzlich im 2005 Aufnahmen im Feld & Auszählung Erntezeitpunkt
- Ertrag an vermarktbaren Karotten ● 2003 1. Ernte höchste Einlagerung, jedoch zu viel Ausschuss im Lager ● 2004 2. Ernte höchste Einlagerung.
→Deutliche Diskrepanzen a) unterschiedliche Bodentemperaturen b) unterschiedliche Temp. gegen Ende der Kulturdauer
→Verschiebung der Grössenklassen aufgrund von weiterem Wachstum
Einfluss der Saatdichte auf den Ertrag
Parameter die nicht berücksichtigt wurden & in Zukunft geklärt werden sollten
- Homogenität / Heterogenität in den Parzellen ( Bodenfeuchte und Bodentemp.) →Stichprobenumfang
- Düngung - Regelmässige Samenablage (gleichmässig)
→Einfluss auf Rübenentwicklung →Experimentell in hors sol Anlage überprüfen - nicht destruktive Wachstumsmessungen
- Erntetechnik →Kühlkette
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 34 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
- Nichtinvasive Qualitätskontrolle
Offene Fragen
- Wieweit kann die Produktion auf die obgenannten Faktoren / Parameter Einfluss nehmen wie z.B.
- Regelmässige Samenablage / Keimung - Witterung - Standort
- Gibt es Beurteilungskriterien für einen optimalen Standart? - Bodenphysik - Bodenchemie - Bodenbiologie (Pathogene)
Künsch et al. (Der Gemüsebau 1/2003
- Versuch über die Jahre 1999 bis 2001 bezüglich Gehalt an ∀- & ∃-Carotin - Berücksichtigte Faktoren: Sorte / Standort / Jahr / Anbauweise & Lagerung
→Signifikante Unterschiede (1999, 2000 und 2001) bei Bolero von Betrieb zu Betrieb; jedoch nicht Regional ( Seeland / Ostschweiz) Höhn Fragen welche Betriebe →ev. Bodenproben für Wasserkap / biol. Aktivität
- Keine Unterschiede zwischen IP & Bio Betrieben (1999 & 2001) - Sehr geringe Jahresunterschiede - Keine Bestätigung auf unterschiedliche Bodenarten (mineralisch oder Humos) →Daraus lässt sich folgern, dass Unterschiede an erster Stelle auf die Wasserhaltekapazität (nFK) zurückzuführen sind und an zweiter Stelle auf die biologische Aktivität sowie ev. das Nährstoffangebot.
Rüsch, A. und Koch, W. (Der Gemüsebau 2/2003)
- Versuch über die Jahre 2001 & 2002 bezüglich des Einflusses der Anbautechnik auf die geschmackliche Qualität der Karotte
- 2001 wiesen die geschmacklich am Besten klassierten Karotten gegenüber den schlechter platzierten eine um 2 Wochen verlängerte Kulturdauer auf. Die Hypothese nach einem optimalen Reifezeitpunkt konnte aber durch die Resultate von 2002 nicht erhärtet werden.
Fazit: Offensichtlich beeinflussen weitere Faktoren, wie Klima, Boden und Düngung, die Länge der Vegetationszeit.
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 35 von 37
Bestimmung des optimalen Erntezeitpunktes bei Lagerkarotten
Literaturverzeichnis Agung, I.G.A.M.S. et al. (1989) Effects of soil bulk density and water regime on carrot yield harvested
at different growth stages. Journal of Horticultural Science 64 (1), 17-25 Benjamin, L.R. and Sutherland, R.A. (1992) Control of mean root weight in carrots (Daucus carota) by
varying within- and between-row spacing. Journal of Agricultural Science 119 (1), 59-70 Benjamin, L.R. and Aikman, P.D. (1995) Predicting growth in stands of mixed species from that in
individual species. Annals of Botany 76, 31-42 Brewster, J.L. and Sutherland, R.A. (1993) The rapid determination in controlled environments of
parameters for predicting seedling growth rates in natural conditions. Annals of Applied Biology 122, 123-133
Day, M.J. (1984) The effect of soil type, delayed harvest and variety on canning carrot yield quality.
Journal of the National Institute of Agricultural Botany 16 (3), 567-579 Fritz, D. and Habben, J. (1975) Determination of ripeness of carrot (Daucus carota L.). Acta
Horticulturae 52, 231-238 Fritz, D. and Habben, J. (1977) Einfluss des Erntezeitpunktes auf die Qualität verschiedener
Möhrensorten. Gartenbauwissenschaft 42, 185-190 Habben, J. (1972) Einfluss einiger Stanortfaktoren auf Ertrag und Qualität der Möhre (Daucus carotta
L.). Gartenbauwissenschaft 37, 345-359 Höhn, E. et al. (2003) Einfluss von Sorte, Standort, Jahr und Abauweise auf den Mineralstoffgehalt.
Der Gemüsebau 6, 14-15 Künsch, U. et al. (2003) Einfluss von Sorte, Standort, Jahr, Anbauweise und Lagerung auf den
Carotingehalt. Der Gemüsebau 1, 4-5 Rüsch, A. and Koch, W. (2003) Hat die Anbautechnik einen Einfluss auf die geschmackliche Qualität
von Karotten? Der Gemüsebau 2, 10-11 Steingröver. (1983) Storage of osmotically active compounds in the taproot of Daucus carota L.
Journal of Experimental Botany 34, 425-433 Suojala, T. (2000) Pre- and postharvest development of carrot yield and quality. In Agricultural
Research Centre of Finland, pp. 47 Suojala, T. (2000) Growth of and partitioning between shoot and storage root of carrot in a northern
climate. Agricultural and Food Science in Finland 9 (2000), 49-59 Suojala, T. (2000) Variation in sugar content and composition of carrot storage roots at harvest and
during storage. Scientia Horticultrae 85 (1-2), 1-19 Suojala, T. (1999) Effect of harvest time on the storage performance of carrot. Journal of Horticultural
Science and Biotechnology. 74 (4), 484-492 Suojala, T. et al. (1998) Optimal harvest time of carrot and white cabbage for storage. In Agri-Food
Quality II: quality management of fruits and vegetables - from field to table (Hagg, M. et al., eds.), pp. 227-231, Royal Society of Chemistry; Cambridge; UK
Suojala, T. and Damato, G. (1997) Optimizing the harvest time of carrot. In 8th International
Symposium on Timing of Field Production in Vegetable Crops (Vol. 533) (Stoffella, P.J. and Cantliffe, D.J., eds.), pp. 475-481, Acta Horticultrae
Wagenwoort, W.A. and Bierhuizen, J.F. (1977) Some aspects of seed germination in vegetables. II. The effect of temperatrue fluctuation, depth of sowing, seed size and cultivar, on heat sum and minimum temperature for germination. Scientia Horticulturae 6, 259-270
J:\P_04230401_ExtGem\16 Erntezeitpunkt Karotten (rt)\16-04_Berichte_u_Daten\Uebergreifend\Abschlussbericht-11.07.06.docSeite 36 von 37