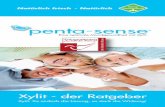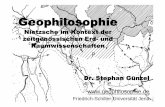Was ist der Nutzen von eHealth
Transcript of Was ist der Nutzen von eHealth
Was ist der Nutzen von eHealth? Eine Studie zur Nutzenevaluation von eHealth in der Schweiz
Verfasser: René Fitterer, Tobias Mettler, Dr. Peter Rohner Datum: 27. Mai 2009 Berichtnr.: BE IWI/HNE/02 Erstellt im Auftrag des Koordinationsorgans eHealth Bund-Kantone Universität St. Gallen – Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG)
Institut für Wirtschaftsinformatik Lehrstuhl Prof. Dr. Robert Winter Müller-Friedberg-Strasse 8 CH-9000 St. Gallen Tel.: + 41 (0) 71 224 2420 Fax: + 41 (0) 71 224 2777
Koordinationsorgan eHealth
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 2
Inhaltsverzeichnis 1 Einführung............................................................................................................................... 6
1.1 Ausgangslage .................................................................................................................. 6
1.2 Zielsetzungen und Aufbau der Studie ............................................................................. 6
2 Was ist eHealth?...................................................................................................................... 7
2.1 Begriffsverständnis.......................................................................................................... 7
2.2 Ziele von eHealth ............................................................................................................ 8
2.3 Akteure ............................................................................................................................ 9
2.4 Prozesse......................................................................................................................... 10
2.5 Elektronische Dienste.................................................................................................... 13
3 Was ist Evaluation und Evaluationsforschung? .................................................................... 16
3.1 Begriffsverständnis........................................................................................................ 16
3.2 Evaluationsforschung im Kontext von eHealth ............................................................ 16
3.3 Überblick über aktuelle eHealth-Evaluationsstudien.................................................... 18
4 Methode zur Bewertung von eHealth-Services..................................................................... 22
4.1 Grundlagen der Methodenentwicklung......................................................................... 22
4.2 Nutzendimensionen und Nutzenkriterien...................................................................... 24
4.3 Methodik - Entwicklung der Studie .............................................................................. 28
4.4 Anwendung der Methode .............................................................................................. 30
5 Beurteilung ausgewählter eHealth-Services.......................................................................... 32
5.1 Datenerhebung und Grundgesamtheit ........................................................................... 32
5.2 Datenreduktion und Reliabilität .................................................................................... 33
5.3 Gewichtung der Nutzenkriterien ................................................................................... 36
5.4 Beurteilung Service „Medizinische Dokumentation“ am Beispiel des Elektronischen Patientendossiers ....................................................................................................................... 37
5.5 Beurteilung Service „Überweisung“ am Beispiel eines Zuweiserportals ..................... 41
5.6 Beurteilung Service „Gesundheitsportal“ ..................................................................... 44
5.7 Beurteilung Service „Leistungsstatistik“ ...................................................................... 47
5.8 Zusammenfassende Betrachtung der beurteilten Services ............................................ 49
6 Zusammenfassung und Ausblick .......................................................................................... 52
7 Literaturverzeichnis............................................................................................................... 54
I Glossar................................................................................................................................... 59
II Anhang: Spezifizierung der Akteure..................................................................................... 62
III Anhang: Definition der eHealth-Services ............................................................................. 65
IV Fragebogen zur Beurteilung von eHealth-Services............................................................... 79
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 3
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Erwarteter und realisierbarer Nutzen der Services ...................................................5
Abbildung 2: Abgrenzung der Begriffe in Anlehnung an [30] .......................................................7
Abbildung 3: Ziele von eHealth ......................................................................................................9
Abbildung 4: Netzwerkmodell des Gesundheitswesens ...............................................................10
Abbildung 5: Prozesslandkarte eHealth ........................................................................................13
Abbildung 6: Landkarte der eHealth-Services ..............................................................................15
Abbildung 7: Aspekte bei der Evaluation von eHealth-Services ..................................................17
Abbildung 8: Grundgesamtheit der Studie....................................................................................32
Abbildung 9: Screeplot zur Bestimmung der Faktorenzahl ..........................................................34
Abbildung 10: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen eines Elektr. Patientendossiers......40
Abbildung 11: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen eines Zuweiserportals....................43
Abbildung 12: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen eines Gesundheitsportals...............46
Abbildung 13: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen einer Leistungsstatistik..................49
Abbildung 14: Aggregierte Wirkungsbündel in Bezug auf die einzelnen Nutzenfaktoren ..........50
Abbildung 15: Aggregierte Sicht auf die Kontextfaktoren ...........................................................51
Abbildung 16: Erwarteter und realisierbarer Nutzen der Services ...............................................52
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 4
Tabellenverzeichnis Tabelle 1: eHealth-Evaluationsstudien 2003-2008 .......................................................................18 Tabelle 2: Drei Ebenen der Betrachtung im Rahmen von eHealth-Evaluationen in Anlehnung an [83] ................................................................................................................................................23 Tabelle 3: Ausgewählte eHealth-Services der Studie ...................................................................29 Tabelle 4 Zusammensetzung der Rollen je Akteur für die berücksichtigten Datensätze..............33 Tabelle 5: Erklärte Gesamtvarianz................................................................................................34 Tabelle 6: Rotierte Faktorenmatrix ...............................................................................................35 Tabelle 7: Gewichtung der Nutzenfaktoren ..................................................................................36 Tabelle 8: Erwarteter Nutzen eines Elektronischen Patientendossiers .........................................38 Tabelle 9: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung eines Elektr. Patientendossiers ...........................................................................................................................40 Tabelle 10: Erwarteter Nutzen eines Zuweiserportals ..................................................................42 Tabelle 11: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung eines Zuweiserportals.......................................................................................................................................................43 Tabelle 12: Erwarteter Nutzen eines Gesundheitsportals .............................................................44 Tabelle 13: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung eines Gesundheitsportals ........................................................................................................................46 Tabelle 14: Erwarteter Nutzen einer Leistungsstatistik ................................................................47 Tabelle 15: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung einer Leistungsstatistik...........................................................................................................................48
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 5
Management Summary Mit eHealth könnten im Schweizer Gesundheitswesen wesentliche Verbesserungen hinsichtlich Effektivität, Effizienz und Qualität errungen werden. Dieser angestrebte Nutzen von eHealth ist ein kompliziertes Phänomen und kann nicht einfach auf eine konkrete Grösse (beispielsweise Kosten) reduziert werden. Eine methodische Beurteilung der vielschichtigen Wirkung von ein-zelnen eHealth-Services ist jedoch sehr wohl möglich. Im Rahmen der vorliegenden Studie wur-de eine Auswahl von vier konkreten und rasch realisierbaren eHealth-Services von einer Fokus-gruppe aus Vertretern des Gesundheitswesens systematisch und aus unterschiedlichen Blickwin-keln auf ihren Nutzen auf nationaler Ebene hin beurteilt:
• "Elektronisches Patientendossier", • "Überweisung", • "Gesundheitsportal", • "Leistungsstatistik".
Alle vier untersuchten Services wurden durch die Fokusgruppe differenziert, jedoch insgesamt deutlich positiv beurteilt:
Abbildung 1: Erwarteter und realisierbarer Nutzen der Services1
Damit stehen Entscheidungsgrundlagen für entsprechende Vorhaben bereit. Eine weitere Nut-zenevaluation während und nach der Implementierung der nationalen Services kann dazu dienen, die ex ante Evaluation auch für die Beurteilung weiterer Services nutzen zu können.
1 Der realisierbare Nutzen berücksichtigt die Schaffung notwendiger Voraussetzungen sowie die Einschränkungen aufgrund von Rahmenbedingungen. Vgl. dazu Abschnitt 4.4.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 6
1 Einführung
1.1 Ausgangslage Die Globalisierung der Märkte, die Differenzierung und Individualisierung von Produkten und Dienstleistungen, technische Innovationen sowie die stetig leistungsfähiger und kostengünstiger werdende Informations- und Kommunikationstechnologie haben in wettbewerbsintensiven Bran-chen wie beispielsweise der Automobil- oder Elektroindustrie dazu geführt, dass sich eine aus-geprägte Vernetzung mit hoher Arbeitsteilung und optimierter Prozessorganisation zwischen den einzelnen Marktteilnehmenden entwickelt hat. Auch im Gesundheitswesen werden diese Potenziale erkannt und es sind erste Anzeichen einer zunehmenden organisatorischen und technischen Vernetzung zu sehen. Das Schlagwort eHealth nimmt in diesem Zusammenhang eine besondere Rolle ein. Es liegen dazu eine Vielzahl von Berichten von nationalen und internationalen Stellen vor, und es herrscht innerhalb der eHealth-Community eine Art „Common Sense“ darüber vor, dass eHealth einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Qualität und der Patientensicherheit sowie zur Einsparung von Kosten leisten kann [12, 93]. Fundierte Evaluationsergebnisse zum Nutzen konkreter eHealth-Vorhaben, wel-che diese Annahme bestätigen, sind jedoch erst spärlich vorhanden und eine Gesamtsicht dazu fehlt gänzlich. Auf der Stufe von politischen Entscheidungsträgern, der Führung von Verbänden usw., welche sich mit dem Gesundheitswesen befassen, sind Nutzenpotenziale noch zu wenig be- oder anerkannt. Es hat sich, trotz einiger Medienberichte in einer breiteren Öffentlichkeit [62, 81], welche ansonsten häufig mit Themen aus dem Gesundheitswesen konfrontiert ist, noch kein Bewusstsein für die Bedeutung des Themas eHealth etabliert [80].
1.2 Zielsetzungen und Aufbau der Studie Ziel der vorliegenden Studie ist es deshalb, Hilfestellung bei der Einordnung und Bewertung von eHealth-Vorhaben zu bieten und eine Auswahl von eHealth-Services perspektivisch zu bewerten. Hierfür wird im nachfolgenden Kapitel 2 das für die Studie geltende Begriffsverständnis geklärt und die für eHealth zentralen Akteure, Prozesse und eHealth-Services identifiziert. In Kapitel 3 wird spezifiziert, was unter dem Begriff der Evaluation verstanden wird und was aktuelle eHealth-Evaluationsstudien bisher an Erkenntnisgewinn geleistet haben. Kapitel 4 entwickelt, aus dieser Gesamtsicht heraus, ein Rahmenwerk zur Bestimmung der Nutzenpotenziale von eHealth-Services. Die Anwendung der Methodik wird anhand von vier ausgewählten Beispielen (welche starken Bezug zur eHealth-Strategie des Bundes besitzen) in Kapitel 5 beschrieben. Ka-pitel 6 schliesst mit der Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnisse und gibt zusätzlich einen Ausblick für weitere Forschungsthemnim betrachteten Bereich.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 7
2 Was ist eHealth?
2.1 Begriffsverständnis In den späten 90er Jahren, angespornt durch die breite Verfügbarkeit von Internet und entspre-chenden Diensten, setzte eine fortschreitende Informatisierung der Gesellschaft ein. Zu jener Zeit wurde deutlich, dass in der digitalen Übertragungstechnik wesentliche Vorteile gegenüber kon-ventionellen Verfahren liegen [39]. Dies führte zur Begriffsbildung der sog. Telematik, die als getrennte oder gemeinsame Anwendung von Telekommunikationstechnik und Informatik ver-standen werden kann [28]. Telematische Basisverfahren und Infrastrukturen sind in der Regel branchen- und anwendungsneutral. Im Laufe der Zeit entstand jedoch als Orientierungshilfe für die Praxis Anwendungsdomänen wie z. B. E-Business/E-Commerce (allgemeiner Geschäftsbe-trieb), e-Government/e-Administration (öffentliche Verwaltung) und e-Health (Gesundheitswe-sen). Oftmals wurden als Synonyme für die letztgenannte Domäne auch die Begriffe Gesund-heitstelematik (Health Telematics), Telehealth, Telemedizin (Telemedicine) oder Medizininfor-matik (Health Informatics), welche jedoch nur Teilaspekte von eHealth abbilden (vgl. Abbildung 2) verwendet.
Abbildung 2: Abgrenzung der Begriffe in Anlehnung an [30]
Ein allgemeingültiges Begriffsverständnis für eHealth existiert demzufolge nicht. Nachfolgend seien beispielhaft einige Definitionen aufgeführt, welche die unterschiedlichen Aspekte und Schwergewichte aufzeigen: 2 Unter „eHealth” oder „Elektronischen Gesundheitsdiensten“ (offizielle Übersetzung der EU) versteht man den integrierten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und Teilnehmenden im Ge-sundheitswesen [14]. „Unter eHealth wird der integrierte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und Teilnehmer im Gesundheits-wesen verstanden.“ [88]
2 Gute Übersichtsartikel, die sich mit der Begriffsklärung von eHealth beschäftigen sind bspw. [64, 67].
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 8
„eHealth means Information and Communication Technologies tools and services for health. Whether eHealth tools are used behind the scenes by healthcare professionals, or directly by pa-tients, they play a significant role in improving the health of European citizens. […] The term eHealth covers a range of technological areas. In the fast-moving world of ICT, different names have been used for applications which are now seen as part of the eHealth field. These include medical informatics, telemedicine, health telematics, and ICTs for health.“ [30] „Here we define in a holistic fashion eHealth as encompassing ICT-enabled solutions providing benefits to health – be it at the individual or at the societal level.“ [84] „eHealth is the use of information and communication technologies (ICT) for health.“ [94] „eHealth is an emerging field in the intersection of medical informatics, public health and busi-ness, referring to health services and information delivered or enhanced through the Internet and related technologies. In a broader sense, the term characterizes not only a technical devel-opment, but also a state-of-mind, a way of thinking, an attitude, and a commitment for net-worked, global thinking, to improve health care locally, regionally, and worldwide by using in-formation and communication technology.“ [31] „eHealth is the process of providing health care via electronic means, in particular over the In-ternet. It can include teaching, monitoring ( e.g. physiologic data), and interaction with health care providers, as well as interaction with other patients afflicted with the same conditions.“ [71] „eHealth is a consumer-centred model of health care where stakeholders collaborate utilizing ICTs including Internet technologies to manage health, arrange, deliver, and account for care, and manage the health care system.“ [65] „Health care’s component of business over the Internet.“ [9] Durch die oben zitierten Definitionen wird klar, dass eHealth je nach Begriffsverständnis unter-schiedliche Aspekte fokussiert. Die vorliegende Studie basiert auf dem folgenden Begriffsver-ständnis:
• eHealth steht in engem Zusammenhang mit allem, was mit Gesundheit, Medizin und Technologien, insbesondere Internet und Portalen zu tun hat (ganzheitlich).
• eHealth liefert integrierte und komplette Gesundheitsinformationen (integriert).
• eHealth ist stets im Kontext der unterschiedlichen Akteuren zu sehen (kundenorientiert).
• eHealth unterstützt dabei die Akteure in der Erfüllung bestimmter Aufgaben und Aktivi-täten (prozessorientiert).
• eHealth besteht aus einer Reihe von Services respektive ermöglicht neue Services (servi-ceorientiert).
• eHealth ist kein Selbstzweck, sondern ein marktorientiertes Konzept (geschäftsorien-tiert).
2.2 Ziele von eHealth Was die Ziele eines Gesundheitssystems sind und wie man die Zielerreichung evaluieren kann, wird in diversen wissenschaftlichen Beiträge kontrovers diskutiert (vgl. [27, 93]). Je nach Beg-riffsverständnis von eHealth herrschen unterschiedliche Vorstellungen darüber, was eHealth
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 9
konkret bewirken soll. Grundsätzlich ist man sich jedoch einig, dass eHealth einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der generellen Ziele des Gesundheitssystems leisten muss (vgl. Abbildung 3). Die wichtigsten Ziele von eHealth sind (vgl. [31, 39, 41]):
• Equity: Gesundheitsleistungen sollen unabhängig von Ort und gesundheitlichem Zustand (beispielsweise auch für Personen mit Behinderungen) allen und jederzeit zugänglich sein.
• Empowerment & Encouragement: Durch die Bereitstellung von laienverständlichen In-formationen bezüglich medizinischer (beispielsweise Behandlungsmöglichkeiten) aber auch administrativer Belange (beispielsweise Versicherungsschutz), soll der Bürger ver-mehrt in die Entscheidungsfindung einbezogen werden (vgl. Patient-Empowerment [78]).
• Efficiency & Enhancing Quality: Durch die Gestaltung neuer und die Verbesserung be-stehender Gesundheitsleistungen, sollen Qualität und Effizienz der Leistungserbringung erhöht und Doppelspurigkeiten in der Behandlung vermieden werden.
• Evidence-based & Education: Durch die Verbreitung von abgesichertem medizinischem Wissen (beispielsweise PubMed oder Medline) sowie dem vermehrten Einsatz neuer technologischer Möglichkeiten in der Ausbildung medizinischer Berufe, soll die Leis-tungserbringung ganzheitlich verbessert werden.
Abbildung 3: Ziele von eHealth
2.3 Akteure Bei der Bewertung des Nutzens von eHealth spielen insbesondere die Akteure eine zentrale Rol-le. Als Akteur wird ein Individuum oder eine Institution verstanden, welches in der Bereitstel-lung und/oder Nutzung eines eHealth-Services involviert ist (vgl. Abbildung 4). Da die Akteure oftmals unterschiedliche Rollen innerhalb der Behandlungskette einnehmen, ist eine überschneidungsfreie Kategorisierung nicht möglich. Um die vom Gesundheitswesen aus-gehende Komplexität zu minimieren, werden auf der Grundlage von [56, 60] in der vorliegenden Studie vier grundsätzliche Typen von Akteuren unterschieden (vgl. auch detaillierte Spezifikati-on im Anhang II):
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 10
• Leistungserbringer: Medizinische, pflegerische und pharmazeutische Organisationen und Fachpersonal sind primär für die Leistungserbringung/Versorgung im Gesund-heitswesen zuständig und werden im Folgenden als Leistungserbringer bezeichnet.3 Im Zusammenhang mit eHealth nehmen sie eine zentrale Rolle als Nutzer und/oder Bereit-steller von Informationen wahr. Typische Beispiele dieses Akteurtyps sind Ärzte, Apotheker, Pflegekräfte und eng mit diesen verbundene Führungskräfte.
• Empfänger sind die Adressaten der angebotenen Leistungen. Im Zusammenhang mit eHealth nehmen sie eine aktive (beispielsweise Datenlieferant) und/oder passive (bei-spielsweise Informationskonsument) Rolle ein. Typische Beispiele dieses Akteurtyps sind Patienten, Gesunde und deren Vertreter.
• Controller sind für die Sicherung der Qualität, Effektivität und Effizienz der angebotenen Leistungen verantwortlich. Im Zusammenhang mit eHealth helfen sie, die tatsächliche Zielerreichung von eHealth zu ermitteln. Typische Beispiele dieses Akteurtyps sind mit Gesundheitsfragen befasste Ämter des Bundes respektive der Kantone und Versicherer.
• Unterstützer nehmen unterschiedliche Aufgaben vor (beispielsweise Ausbildung von Leistungserbringern und Empfängern), während (beispielsweise Lieferung von Material und Sicherstellung der technischen Infrastruktur) und nach (beispielsweise Beratung in administrativen Bereichen) der Erbringung einer medizinischen Leistung wahr. Im Zu-sammenhang mit eHealth nehmen die von den Unterstützern erbrachten Leistungen, wel-che in der Regel nicht Teil der medizinischen Versorgung sind, einen subsidiären Cha-rakter ein. Typische Beispiele dieses Akteurtyps sind Logistiker, Verwaltungsmitarbeiter in Spitä-lern oder Hersteller von medizinischen Produkten und technischer Infrastruktur.
Abbildung 4: Netzwerkmodell des Gesundheitswesens
2.4 Prozesse eHealth orientiert sich an den Prozessen des Gesundheitswesens die von den involvierten Akteu-ren ausgeführt werden. Unter einem Prozess wird eine definierte Abfolge von Aufgaben (beste-
3 Im Gegensatz zum KVG-Verständnis beinhaltet dieser Akteurtyp jedoch nicht das administrative Personal oder Management der leistungserbringenden Einrichtungen, sondern ist beschränkt auf die genannten Fachkräfte.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 11
hend aus Aktivitäten und Informationsobjekten), die durch Startereignisse angestossen und mit einem definierten Ergebnis abgeschlossen werden, verstanden [20, 21]. Prozesse zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie einen bereichs- und organisationsübergreifenden Charakter aufwei-sen. Zur Erklärung und Gestaltung des Betrachtungsgegenstands prozessorientiertes eHealth wird eine Prozesslandkarte verwendet. Eine Prozesslandkarte ist eine übersichtliche Zusammen-stellung der Prozesse im Gesundheitswesen. Sie enthält jedoch keine detaillierten Informationen über die Prozessablauffolge, Input/Output sowie Prozessinhalte (vgl. Abbildung 5). Auf der Grundlage von [29, 42, 49, 63] wurden die folgenden eHealth-Prozesse identifiziert:
• Prävention umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Leistungserbrin-gers), mit denen die Stärkung der Gesundheitsressourcen und –potenziale der Menschen erreicht werden sollen. Prävention ist als Prozess zu verstehen, der darauf abzielt, alle Bürger zu verantwortungsbewussten Entscheidungen hinsichtlich ihrer Gesundheit zu be-fähigen. Wesentliche Aktivitäten sind beispielsweise Aufklärung und Beratung (z. B. Un-fallverhütung), Prophylaxe (z. B. Impfungen, körperliche Betätigung) und die Früherken-nung (z. B. Screening) von Krankheiten.
• Diagnose umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Leistungserbrin-gers), um eine möglichst genaue Zuordnung von Befunden und Symptomen zu einem Krankheitsbegriff gewährleisten zu können. Die Diagnose als Prozess beinhaltet Aktivitä-ten wie beispielsweise Untersuchungen von Laborproben, den Einsatz von bildgebenden Verfahren (z. B. Endoskopie, MRT), Messungen der elektrischen Felder des Körpers (z. B. EKG) und Funktionsuntersuchungen (z. B. Provokations- und Belastungstests).
• Behandlung umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Leistungserb-ringers) zur Therapierung von Krankheiten und Verletzungen. Die Behandlung als Pro-zess zielt darauf ab, durch die Beseitigung oder Linderung der Symptome, körperliche oder psychische Funktionen wiederherzustellen. Wesentliche Aktivitäten sind beispiels-weise die Verabreichung von Medikamenten, chirurgische Eingriffe in den Körper, oder die psychologische Einwirkung auf den Geist.
• Rehabilitation umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Leistungs-erbringers), die darauf zielen, die körperlichen, psychischen und sozialen Folgen einer Behinderung und die daraus resultierende Störung der gesellschaftlichen Teilhabe auf ein Minimum zu beschränken. Rehabilitation als Prozess beinhaltet beispielsweise ambulante und stationäre medizinische Rehamassnahmen (z. B. Kuren), Massnahmen zur berufli-chen Wiedereingliederung (z. B. Umschulungen) sowie Leistungen zur Bewältigung des gemeinschaftlichen und kulturellen Lebens (z. B. Haushaltshilfe, heilpädagogische Leis-tungen).
• Informationssuche umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Emp-fängers), um die Bedürfnisse nach bestimmten medizinischen oder administrativen In-formationen zu befriedigen. Für den Prozess der Informationssuche stehen in der Regel eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien zur Verfügung (z. B. Suchmaschinen wie Google oder spezifische Gesundheitsportale), die teilweise eine Enablerfunktion einneh-men können (z. B. Versichertenkarte).
• Selbstpflege umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Empfängers), um Gesundheit sowie persönliches Wohlbefinden zu erlangen, zu erhalten oder wieder-herzustellen. Selbstpflege kann die medizinische Behandlung durch Dritte teilweise oder sogar vollkommen ersetzen. Wesentliche Aktivitäten sind beispielsweise die Einnahme von Medikamenten, das Führen eines Gesundheitstagebuchs oder die Planung und
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 12
Durchführung der Selbstpflege-Handlungen (z. B. Beschaffung eines frei erhältlichen Medikaments).
• Erfahrungsaustausch umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Emp-fängers), um Inhalte, wie beispielsweise Erfahrungsberichte, Leistungsbeurteilungen, zu erstellen und zu bearbeiten. Massgebliche Inhalte werden nicht mehr nur zentralisiert von Unternehmen erstellt und über das Internet verbreitet, sondern auch von einer Vielzahl von Individuen, die sich mit Hilfe sozialer Software zusätzlich untereinander vernetzen. Beispiele hierfür sind Wikis, Blogs, Foto- und Videoportale.
• Zulassung & Bewilligung umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Controllers) zur Freigabe und Überprüfung einer behördlichen Erlaubnis. Beispiele hier-für sind die Genehmigung zur Ausübung eines Berufes (Approbation) oder die Freigabe eines Gerätes oder Produktes für den Gesundheitsmarkt (z. B. Arzneimittelzulassung).
• Finanzierung umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Controllers) zur Deckung aller Investitionen und Kosten, die im Gesundheitswesen anfallen werden.
• Monitoring & Controlling umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Controllers) für die systematischen Erfassung, Beobachtung oder Überwachung bestimm-ter Vorgänge oder Sachverhalte im Gesundheitswesen. Wesentliche Aktivitäten sind bei-spielsweise die Messung oder Bewertung von Leistungen oder das Reporting respektive die Berichterstattung der gemessenen Leistungen.
• Qualitätssicherung und -kontrolle umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Controllers) zur Sicherstellung festgelegter Qualitätsanforderungen bestimmter Gesundheitsleistungen. Ziel ist es, dadurch Vertrauen zu erzeugen und das Qualitätsni-veau zu erhöhen.
• Aus- und Weiterbildung umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Unterstützers) für die Vermittlung von anwendbaren Fähigkeiten und praktischen Kennt-nissen in einem bestimmten Bereich. Die Bereitstellung aktueller und evidenzbasierter Informationen über das Internet (z. B. PubMed oder Medline) zum Zwecke der Aus- und Weiterbildung nimmt dabei eine wichtige Rolle ein.
• Administration & Management umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Unterstützers) für die Planung, Ausführung und Kontrolle administrativer Aufgaben, die darauf zielen, die medizinische Behandlung so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Beispielhafte Aktivitäten sind umfassende Aufgaben wie Führung oder einzel-ne Tätigkeiten wie die Ressourcenplanung (Disposition), Leistungserfassung (Codie-rung), Aufnahme – und Überweisung von Patienten, oder Fakturierung.
• Material & Logistik umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Unter-stützers) für die Planung, Ausführung und Kontrolle der Material- und Informationsflüs-se, mit dem Ziel, die medizinische Behandlung so effektiv und effizient wie möglich zu gestalten. Beispielhafte Aktivitäten sind die Beschaffung von Arzneimitteln und Medi-zinprodukten (Einkauf) oder die Lagerhaltung.
• Technik & Infrastruktur umfasst alle Massnahmen und Aktivitäten (aus der Sicht des Unterstützers) zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlich-keit und Sicherheit von Organisationen und deren Informationssystemen.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 13
Abbildung 5: Prozesslandkarte eHealth
2.5 Elektronische Dienste Elektronische Dienste respektive Services bilden die Basis von eHealth [30]. Services sind abs-trakte, grob granulare Leistungen (zugänglich über standardisierte Schnittstellen), welche eine bestimmte Funktionalität bieten. Sie lassen sich beispielsweise anhand der Art der bereitgestell-ten Funktionalität dahin gehend unterscheiden, ob sie eine geschäftsorientierte (fachliche Servi-ces) oder eher eine technische, unterstützende Funktionalität (technische Services) liefern [16]. Anhand des fachlichen Leistungsumfangs lassen sich Services weiterhin danach unterschieden, ob sie einen kompletten Prozess, eine Aktivität oder eine Querschnittsfunktion unterstützen (vgl. Abbildung 6). Des Weiteren können Services aufgrund ihrer primären Wirkungsrichtung in indi-viduenspezifische (z. B. Elektronische Gesundheitsakte) oder institutionenspezifische Services (Elektronische Abrechnung) untergliedert werden. Die Gesamtheit aller eHealth-Services bildet die sogenannte eHealth Collaboration Infrastructure (vgl. Abbildung 4). Auf der Grundlage von [53, 63, 87] wurden die folgenden eHealth-Services identifiziert (vgl. auch S. 65f.):
• Teleberatung umfasst die wesentlichen Funktionen für die medizinische Befundaufnah-me und Beratung unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwi-schen Arzt und Patient.
• Telediagnostik umfasst die wesentlichen Funktionen für die Erstellung von Diagnosen (z. B. aufgrund von Bilddaten) unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient.
• Telelabor umfasst die wesentlichen Funktionen für die Auswertung und Rückverfolgung von Laborproben unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwi-schen Arzt und Patient.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 14
• Telemedizin umfasst die wesentlichen Funktionen für die Erbringung therapeutischer Leistungen unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient.
• Medikation umfasst die wesentlichen Funktionen für die Verordnung von Arznei- und Heilmitteln in maschinenlesbarer Form.
• Medizinische Dokumentation umfasst die wesentlichen Funktionen für die Sammlung und Verwaltung aller für den Krankheits- und Behandlungsverlauf relevanten Daten eines Patienten in maschinenlesbarer Form.
• Telemonitoring umfasst die wesentlichen Funktionen für die Erbringung pflegerischer Leistungen unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient.
• Gesundheitsportal umfasst die wesentlichen Funktionen zur Breitstellung von (laienver-ständlichen) Gesundheitsinformationen und Dienstleistungen über das Internet.
• Versicherungsschutz umfassen die wesentlichen Funktionen zur Bereitstellung von ver-sicherungstechnischen Informationen zum Zwecke der vereinfachten Abklärung des Ver-sicherungsschutzes und der Abrechnung von Leistungen.
• Persönliches Gesundheitsmanagement umfasst die wesentlichen Funktionen für die Sammlung und Verwaltung aller persönlichen Gesundheitsinformationen in maschinen-lesbarer Form.
• Netzgemeinschaften umfassen die wesentlichen Funktionen für den Austausch von In-formationen bzgl. Krankheits- und Behandlungsverläufe, etc. über das Internet.
• Fachliche Verzeichnisdienste umfassen die wesentlichen Funktionen für die zentrale Sammlung von Daten von im Gesundheitswesen zugelassenen Materialien, Individuen oder Institutionen.
• Leistungsstatistik umfasst die wesentlichen Funktionen für die Sammlung und Bereitstel-lung von Daten, welche sich mit der Qualität, Effizienz und Kosten der im Gesundheits-wesen erbrachten Leistungen beschäftigt.
• Medizinische Statistik umfasst die wesentlichen Funktionen für die Sammlung und Be-reitstellung von Daten, welche sich mit der Verbreitung von gesundheitsbezogenen Zu-ständen und Ereignissen der Bevölkerung befassen.
• Akkreditierung umfasst die wesentlichen Funktionen für die Kontrolle und Verbesserung der Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Gesundheitsinformationen und der angebote-nen Dienste.
• Literaturmanagement umfasst die wesentlichen Funktionen zur Bereitstellung von evi-denzbasiertem, medizinischem Wissen für Forschungs- und Ausbildungszwecke über das Internet.
• E-Learning umfasst die wesentlichen Funktionen für die Bereitstellung und Vermittlung von medizinischem Basis- und Experten-Wissen für das multimedial unterstützte Lernen über das Internet.
• Fakturierung umfasst die wesentlichen Funktionen für die Bereitstellung aller medizin-administrativ relevanten Daten in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Verrechnung einer bezogenen Leistung.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 15
• Überweisung umfasst die wesentlichen Funktionen für die Bereitstellung aller medizin-administrativ relevanten Daten in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Überwei-sung, Zuweisung und Einweisung von Patienten.
• Ressourcenplanung umfasst die wesentlichen Funktionen für die Bereitstellung aller medizin-administrativ relevanten Daten (Personen, Termine, Räumlichkeiten, Material, Geräte etc.) in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Planung einer medizinischen Leistungserbringung.
• Einkauf umfasst die wesentlichen Funktionen für die Abwicklung und Planung des Ein-kaufs und der Beschaffung von Materialien, welche für die medizinische Leistungserstel-lung oder Selbstpflege benötigt werden.
• Logistik umfasst die wesentlichen Funktionen für die Abwicklung und Planung der Lo-gistik (u.a. Lagerhaltung, Bestandsmanagement, Transport), welche für die medizinische Leistungserstellung oder Selbstpflege benötigt werden.
• E-Collaboration umfasst die wesentlichen Funktionen für die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz.
• Datenschutz und -sicherheit umfasst die wesentlichen Funktionen für den Schutz perso-nen- oder organisationsbezogener Daten vor Missbräuchen aller Art, sowie für die Si-cherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität dieser Daten.
• Technische Verzeichnisdienste umfasst die wesentlichen Funktionen für die zentrale Sammlung von Daten (Individuen oder Institutionen) zur Erleichterung der Verwaltung von Identitäten, Rechten und Rollen.
Abbildung 6: Landkarte der eHealth-Services
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 16
3 Was ist Evaluation und Evaluationsforschung?
3.1 Begriffsverständnis Evaluationsforschung in der Wirtschafts- und Medizininformatik beschäftigt sich mit der Prü-fung des Erfüllungsgrads materieller oder immaterieller Gegenstände (Artefakte) in Hinblick auf ein Ziel oder eine Anforderung. „Evaluation“ wird demzufolge als gezielte Bewertung von Arte-fakten unter Rückgriff auf Kriterien und (wissenschaftliche) Verfahren verstanden, welche der Vorbereitung und der Legitimation von Entscheidungen dienen [43, 68, 91]. Mit dem Begriff der Evaluation wird deshalb oft das Bemühen um Objektivität assoziiert. Allerdings ist aus erkennt-nistheoretischer Sicht klar, dass die Bewertung eines Sachverhalts oder Gegenstandes die subjek-tive Wahrnehmung und das Urteilsvermögen des Bewertenden voraussetzt. Demzufolge ist eine gänzlich objektive Evaluation nicht möglich [32]. Zum einen muss vorab eine Auswahlentschei-dung getroffen werden, welche Messkriterien für die Evaluation Anwendung finden sollen (sub-jektive Auswahlentscheidung). Zum anderen sollten die Evaluationsergebnisse möglichst eindeu-tig sein, so dass dem potenziellen Verwender des Artefakts oder dem Auftraggeber der Evaluati-on die Einschätzung bezüglich der „Nützlichkeit“ des Gegenstandes möglichst leicht fällt (Ver-zerrung der Ergebnisse durch Verdichtung). Diesem „Dilemma der Evaluation“ kann jedoch entgegengewirkt werden, indem die subjektiven Auswahlentscheide explizit begründet (siehe Kapitel 4) und anerkannte wissenschaftliche Methoden für die Verdichtung der Daten angewen-det werden (siehe Kapitel 5).
3.2 Evaluationsforschung im Kontext von eHealth Ein Bezugsrahmen, wie Artefakte im Allgemeinen und eHealth-Services im Speziellen aus der Sicht der Wirtschafts- und Medizininformatik evaluiert werden sollen, ist Gegenstand der aktuel-len Forschung (siehe beispielsweise [6, 17, 25, 34, 66, 73, 89, 97]). Grundsätzlich lassen sich jedoch folgende Aspekte im Hinblick auf die Bewertung von eHealth-Services ableiten (vgl. Abbildung 7):
• Bewertungsmethoden: Gemeinhin wird zwischen naturalistischen (d. h. Methoden, die eine gewisse Realitätsnähe benötigen) und künstlichen (d. h. Methoden, die auf einem in sich geschlossenen System oder artifiziellen Abbild der Realität basieren) Verfahren un-terschieden [72]. Naturalistische/empirische Methoden sind beispielsweise Fallstudien, Interviews, Fokusgruppen oder Umfragen. Zu den künstlichen/experimentellen Bewer-tungsmethoden gehören beispielsweise Laborexperimente, Simulationen oder szenario-basierte Evaluationen [40]. Im Kontext von eHealth-Evaluationen verwenden ca. 75% der Studien naturalistische und ca. 25% künstliche Verfahren [4].
• Bewertungszeitpunkt: Evaluationen können ex ante (d. h. vor der eigentlichen Einfüh-rung und dem Betrieb eines eHealth-Services) oder ex post (d. h. nach der Einführung oder dem langjährigen Betrieb eines eHealth-Services) erfolgen [72]. Die Durchsicht ak-tueller eHealth-Bewertungsstudien lässt vermuten, dass die überwiegende Mehrheit der Evaluationen im Kontext von eHealth ex post stattfinden.
• Bewertende: Da die Evaluationsergebnisse stark vom Urteilsvermögen des Bewertenden abhängen (siehe oben), ist eine klare Deklaration der Bewertenden äusserst wichtig. Je-doch wird dies in vielen Evaluationen ausgeklammert oder nicht explizit spezifiziert. Im Kontext von eHealth lassen sich vier grundsätzliche Akteurtypen – Leistungserbringer, Empfänger, Controller und Unterstützer – definieren, welche eine Bewertung vornehmen
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 17
können, respektive für welche die eHealth-Services einen Nutzen erbringen sollen (siehe S. 9f.).
• Bewertungsaspekte: In Anlehnung an [36] lassen sich unterschiedliche Ebenen abgren-zen, auf denen eine Untersuchung erfolgen kann. Eine Evaluation von eHealth-Services kann auf der Individual- oder Gruppenebene (beispielsweise Effekte von E-Learning bei der Vermittlung von medizinischem Basis- und Expertenwissen innerhalb einer Klinik), auf der intraorganisationalen Ebene (beispielsweise Effekte der Online-Ressourcenplanung innerhalb eines Spitals), auf der interorganisationalen Ebene (bei-spielsweise Effekte eines Zuweiserportals in Bezug auf die Kommunikation zwischen Spitälern und Hausärzten) oder auf der gesellschaftlichen Ebene (beispielsweise Effekte eines Gesundheitsportals in Bezug auf die Gesundheitskompetenz der Bürger) erfolgen.
• Bewertungskriterien: Grundsätzlich lassen sich quantitative (beispielsweise Kosten- und Zeitersparnisse) und qualitative (beispielsweise Nutzenpotenziale, Befähigung) Messkri-terien abgrenzen. Die Mehrheit der Evaluationen (ca. 85%) basieren auf quantitative Messungen [4]. Die restlichen Studien bewerten anhand qualitativer Messkriterien oder nutzen eine Kombination aus beiden.
• Bewertungsgegenstand: Gegenstand von Evaluationen im Bereich der Wirtschafts- und Medizininformatik sind Artefakte, d. h. Konstrukte (beispielsweise Ontologien), Modelle (beispielsweise Prozessmodelle), Methoden (beispielsweise Design- und Entwicklungs-methoden) und Instantiierungen (beispielsweise klinische Applikationen oder Websites). Im Bereich von eHealth wurden bisher vorwiegend Instantiierungen beurteilt. Dabei wurden in den letzten Jahren v.a. Expertensysteme (ca. 24% der Evaluationsstudien), Te-lediagnostik-Systeme (ca. 20% der Evaluationsstudien), Klinische Informationssysteme (ca. 15% der Evaluationsstudien) und andere Systeme wie bildbearbeitende Systeme (PACS), Pharmazie Informationssysteme (PIS) beurteilt [4].
Abbildung 7: Aspekte bei der Evaluation von eHealth-Services
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 18
3.3 Überblick über aktuelle eHealth-Evaluationsstudien Da eHealth unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt, ein relativ breites Spektrum an Prozessen und Services abdeckt und demzufolge eine Vielzahl von Akteuren tangiert, kann es keine globale Evaluation von eHealth geben. In der nachfolgenden Tabelle 1 soll deshalb überblicksartig eine Aufstellung aktueller eHealth-Evaluationsstudien gezeigt werden, welche unterschiedliche As-pekte von eHealth aufgreifen. Dabei fällt auf, dass die überwiegende Mehrheit der aufgelisteten Studien auf quantitativ-empirische Verfahren zurückgreift und rückwärtsgerichtet sind (Ex post Analysen). Ex ante Analysen zur Entscheidungsvorbereitung, ob man in einen eHealth-Service investieren soll oder nicht, gibt es selten und sind meistens vage in ihren Aussagen. Des Weite-ren scheinen multiperspektivische oder Multi-Stakeholder-Ansätze für die Evaluation nicht sehr verbreitet zu sein (die meisten Studien fokussieren auf ein bis max. zwei Akteurtypen).
Tabelle 1: eHealth-Evaluationsstudien 2003-2008
Jahr Studie Gegenstand Methode Bewerten-
de
Messung Zeit-
punkt
Erkenntnisse
2003 "Factors Affect-
ing and Affected by User Accep-
tance of Com-puter-based Nursing Docu-
mentation: Results of a Two-
year Study" [5]
Vergleich der
Benutzerakzeptanz vor und nach der
Einführung einer elektronischen Pflegedokumenta-
tion.
Empirisch,
Interviews
Leistungs-
erbringer
Qualitativ Ex ante
und ex post
Die Studie zeigte, dass die Akzeptanz
zur Benutzug einer elektronischen Pflegedokumentation initial und auch
nach dem Projekt relativ hoch war. Allerdings zeigte die Studie auch, dass Faktoren wie das Alter und "Compu-
teraffinität" des Pflegepersonals einen wesentlichen Einfluss auf die Akzep-
tanzbewertung hatten.
2003 "A Cost-benefit Analysis of Electronic Medi-
cal Records in Primary Care"
[90]
Analyse des öko-nomischen Nut-zens einer elektro-
nischen Patienten-akte.
Empirisch anhand einer
Umfrage und Exper-
ten-interviews
Leistungs-erbringer
Quantitativ Ex post Die Studie zeigte, dass 5 Jahre nach der Einführung einer EPA ein ökono-mischer Nutzen von insgesamt
$84'000 erzielt wurde. Darüber hinaus wurden signifikante Einsparungen im
Verbrauch von Medikamenten und von diagnostischen Mitteln erzielt. Allerdings beziehen sich diese Er-
kenntnisse weitestgehend auf Aussa-gen von 7 Fachexperten.
2003 "Effects of Scan-ning and Elimi-
nating Paper-based Medical Records on
Hospital Physi-cians' Clinical
Work Practice" [51]
Analyse, ob ges-cannte Patienten-
akten eine gangba-re Übergangslö-sung zu einer
Elektronischen Patientenakte
sind.
Empirisch anhand
einer Umfrage und Exper-
ten-interviews
Leistungs-erbringer
Quantitativ und quali-
tativ
Ex post Die Studie zeigte, dass durch das Scannen von papierbasierten Patien-
tenakten die Wiederauffindung von Informationen erheblich gesteigert werden konnte. Die Zufriedenheit der
User bezgl. dieser Übergangslösung ist jedoch sehr begrenzt.
2003 "Usefulness and Effects on Costs and Staff Man-
agement of a Nursing Re-source Manage-
ment Informa-tion System" [77]
Untersuchung der ökonomischen Effekte eines
Resourcenpla-nungs-systems in der Pflege.
Empirisch, Experten-interviews,
Sekundär-daten-analyse
Leistungs-erbringer
Quantitativ und quali-tativ
Ex post Die Studie zeigte, dass nach der Einführung des Systems insgesamt 41% weniger Ausgaben in der Pflege
anfielen. Auch stieg die Zufriedenheit seitens der Pflegenden aufgrund der erhöhten Informationstransparenz.
2003 "Use of an Electronic Medi-
cal Record Improves the Quality of Urban
Pediatric Primary Care" [2]
Untersuchung der Qualität der medi-
zinischen Doku-mentation vor und nach der Einfüh-
rung einer Elekt-ronischen Patien-tenakte.
Empirisch, Sekundär-
daten-analyse
Leistungs-erbringer
und Emp-fänger
Qualitativ Ex ante und ex
post
Die Studie zeigte, dass durch die Einführung einer Elektronischen
Patientenakte die Informationsquali-tät erheblich gesteuert werden konn-te. Dadurch konnte ebenfalls die
Zufriedenheit der Patienten erhöht werden, da diese sich besser infor-miert fühlten. Allerdings zeigte die
Studie auch, dass das System zu einer pers. Distanzierung zwischen Patient
und Arzt führte.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 19
2004 "Analysis of cost and assessment
of computerized patient record systems in Japan
based on ques-tionnaire survey" [98]
Untersuchung der ökonomischen
Effekte der Einfüh-rung und Betriebs einer elektroni-
schen Patientenak-te.
Empirisch, Umfrage
Leistungs-erbringer
Quantitativ Ex post Die Studie zeigte, dass die durch-schnittlichen Kosten für die Imple-
mentierung einer elektronischen Patientenakte bei $14'300 lagen. Für den Betrieb ist durchschnittlich mit
jährlichen Kosten von $457'000 zu rechnen. Dafür gaben 82% der Leis-tungserbringer an, dass dadurch die
Qualität ihrer Leistung erhöht und Fehler vermieden werden konnten.
2004 "Comparison of Handheld Com-puter-Assisted
and Conven-tional Paper Chart Documen-
tation of Medical Records" [82]
Vergleich der Qualität der medi-zinischen Doku-
mentation auf Handheld Compu-ter im Vergleich
zur Papierversion.
Künstlich, Experiment
Leistungs-erbringer
Qualitativ Ex post Die Studie zeigte, dass die Qualität der medizinischen Dokumentation durch die Benutzung eines Handheld Com-
puters anstatt der herkömmlichen Dokumentation auf Papier erheblich gesteigert werden konnte.
2004 "Physician and
Nurse Satisfac-tion with an Electronic Medi-
cal Record System" [54]
Untersuchung der
Benutzerakzeptanz nach der Einfüh-rung einer Elekt-
ronischen Patien-tenakte.
Empirisch,
Umfrage
Leistungs-
erbringer
Qualitativ Ex post Die Studie zeigte, dass der Wille zur
Nutzung einer Elektronischen Patien-tenakte relativ hoch war. 87% der Ärzte und 85% der Pflegefachkräfte
bestätigten die tägliche Nutzung des Systems. Dies nicht zu letzt, weil
dadurch Fehler und Administration reduziert werden konnten.
2004 "Patient Opinion
- EHR Assess-ment from the
Users Perspec-tive" [99]
Untersuchung der
Patientenzufrie-denheit bei der
Verwendung einer elektronischen Patientenakte.
Empirisch,
Observati-on und
Interviews
Empfänger Qualitativ Ex post Die Studie zeigte, dass die Aufge-
schlossenheit der Bevölkerung gegen-über neuen Medien auch im Gesund-
heitswesen zutrifft. Allerdings waren die Patienten stark sensibilisiert auf die Datenschutzthematik.
2004 "A Tale of Two
Hospitals: A Sociotechnical
Appraisal of the Introduction of Computerized
Physician Order Entry in Two Dutch Hospitals"
[1]
Untersuchung
technischer und sozialer Effekte der
Einführung eines elektronischen Rezeptes.
Empirisch,
Interviews
Leistungs-
erbringer
Qualitativ Ex post Die Studie zeigte, dass die Einführung
von elektronischen Rezepten in den Niederlanden eher problematisch
verlief. Dabei waren nicht nur techni-sche, sondern v. a. soziale Aspekte ausschlaggebend während der Einfüh-
rung.
2004 "Computerized Reminders
Reduce the Use of Medications
during Short-ages" [10]
Untersuchung der ökonomischen
Effekte der Einfüh-rung eines Res-
sourcenplanungs-systems (compute-rized Reminders)
für die Medikation.
Künstlich, Experiment
Leistungs-erbringer
Quantitativ Ex post Die Studie zeigte, dass durch die Einführung von Remindern hinsicht-
lich der Ressourcenplanung jährlich bis zu $36'500 an Medikationskosten
gespart werden konnte.
2005 "The Costs of a
National Health Information Network" [45]
Untersuchung der
Kosten für die Einführung einer nationalen Tele-
matik-Infrastruktur.
Empirisch,
Umfrage, Interviews
Leistungs-
erbringer
Quantitativ Ex ante Die Studie zeigte, dass für die Einfüh-
rung einer nationalen Telematik-Infrastruktur in den USA insgesamt $156 Mia. investiert werden müssten
(ca. 2% der Gesundheitsausgaben). Die Betriebskosten würden jährlich $48 Mia. ausmachen.
2005 "An Incremental
Cost Analysis of Telehealth in Nova Scotia from
a Societal Per-spective" [69]
Untersuchung der
ökonomischen Effekte der Nut-zung von Telebera-
tungsleistungen aus Gesellschafts-
perspektive.
Empirisch,
Umfrage
Empfänger Qualitativ Ex ante
und ex post
Die Studie zeigte, dass Teleberatung
im Vergleich zu herkömmlicher Kon-sultation beim Hausarzt volkswirt-schaftlich gesehen mehr Kosten
verursachen. Jedoch waren die Kosten für den Patienten insgesamt geringer.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 20
2005 "Role of Com-puterized Physi-
cian Order Entry Systems in Facilitating
Medication Errors" [48]
Untersuchung der Effekte auf die
Qualität des Medi-kations-prozesses nach der Einfüh-
rung eines elekt-ronischen Rezep-tes.
Empirisch, Observati-
on und Interviews
Leistungs-erbringer
und Unter-stützer
Qualitativ Ex post Die Studie zeigte, dass insgesamt 22 unterschiedliche Fehlerquellen wäh-
rend des Medikationsprozesses beho-ben werden konnten.
2006 "Kosten-Nutzen-Analyse der
Einrichtung einer Telematik-
Infrastruktur im deutschen Gesundheits-
wesen" [8]
Untersuchung der ökonomischen
Effekte der Einfüh-rung einer elekt-
ronischen Ge-sundheitskarte und der damit
verbundenen Telematik-Infrastruktur.
Empirisch, Expertenin-
terviews, Sekundär-
datenana-lyse
Vorwie-gend
Unterstüt-zer
Quantitativ Ex ante Die Studie macht keine klaren Aussa-gen darüber, ob die Einführung einen
ökonomischen Nutzen erbringt order nicht. Je nach Zeithorizont und Zu-
kunftsszenario kann aus der Einfüh-rung der elektronischen Gesundheits-karte einen negativen oder positiven
ökonomischen Nutzen erfolgen.
2006 „Die Versicher-tenkarte und der Aufbau einer
Telemati-kinfrastruktur - Kosten-Nutzen-
Analyse“[22]
Untersuchung der ökonomischen Effekte der Einfüh-
rung einer elekt-ronischen Versi-chertenkarten und
der damit verbun-denen Telematik-
Infrastruktur.
Empirisch, Expertenin-terviews,
Investiti-ons-kosten-
rechnung
Leistungs-erbringer und Unter-
stützer
Quantitativ Ex ante Die Studie stellt Investitionskosten und laufende Betriebskosten für die Versichertenkarte möglichen Einspa-
rungen gegenüber und ermittelt, dass die Pflichtanwendungen der Karte bereits eine Refinanzierung ermögli-
chen. Darüber hinaus werden mögli-che weitere Nutzen für Leistungserb-
ringer und Unterstützer diskutiert.
2006 "eHealth is
Worth it: The economic bene-fits of imple-
mented eHealth solutions at ten European sites"
[84]
Untersuchung der
ökonomischen Effekte der Einfüh-rung unterschiedli-
cher eHealth-Services.
Empirisch,
Sekundär-datenana-lyse und
Fallstudien
Leistungs-
erbringer und Emp-fänger
Quantitativ
und quali-tativ
Ex post Die Studie zeigte, dass bei den 10
untersuchten eHealth-Services durch-schnittlich 51% der Kosten eingespart werden konnten. Hauptprofiteure
waren dadurch v. a Leistungserbringer (52%) und Bürger (43%).
2007 "Von eHealth zu
€Health? Studie zur Nutzenbe-wertung von
eHealth aus Kliniksicht" [52]
Untersuchung der
ökonomischen Effekte der Einfüh-rung einer Telema-
tik-Infrastruktur für das Gesund-
heitswesen.
Empirisch,
Expertenin-terviews
Leistungs-
erbringer
Quantitativ Ex ante Die Studie prognostiziert für Deutsche
Kliniken eine durchschnittliche Einspa-rung von €100 pro Fall. Dadurch können €1,25 Mio. je 50'000 Patien-
ten pro Jahr gespart werden. Neben den Kosteneinsparungen sollen auch
Erlössteigerungen und Verweildauer-verkürzungen resultieren.
2008 "The Impact of eHealth on the
Quality & Safety of Healthcare"
[15]
Untersuchung des aktuellen Stands
der Evaluations-forschung im
Bereich von eHealth.
Empirisch, Sekundär-
datenana-lyse
Leistungs-erbringer
und Emp-fänger
Quantitativ und quali-
tativ
Ex post Diese umfassende Studie kommt zum Schluss, dass eHealth-Services wie
beispielsweise die elektronische Patientenakte oder elektonische
Rezepte einen positiven Effekt auf die Qualität der Leistungserbringung haben. Jedoch räumen die Autoren
auch ein, dass die untersuchten Fälle vielen Limitationen unterliegen, wie beispielsweise methodische Schwä-
chen in der Evaluation.
2008 "Evaluation der
E-Health-Anwendung Stop-Simply.de"
[26]
Untersuchung der
Benutzerfreund-lichkeit einer eHealth-Website.
Künstlich,
Experi-ment, Heuristiken
Empfänger Qualitativ Ex post Die Studie zeigte, dass anhand von
Heuristiken eHealth-Websites evalu-iert werden können.
2008 "Consumer Evaluation of E-
Health Informa-tion Quality: The
Role of Process-ing Styles and Decision-
Making" [70]
Untersuchung der Informationsquali-
tät von eHealth-Websites.
Künstlich, Heuristiken
Empfänger Qualitativ Ex post Die Studie zeigt, dass anhand von Heuristiken und einer systematischen
Klassifizierung die Qualität der Infor-mation auf eHealth-Websites erhöht
werden kann.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 21
2008 “HEALTH ICT: Indicators for
international comparisons of health ICT adop-
tion and use.”[75]
Überblick ver-schiedener Evalua-
tionsstudien mit dem Ziel internati-onal vergleichbare
Indikatioren zu identifizieren.
Sekundär-daten
Leistungs-erbringer,
Controller und Unter-stützer
Qualitativ Ex ante und ex
post
Die Studie kommt zum Schluss, dass bestehende Studien nur bedingt
vergleichbar sind und fordert die Etablierung einer Standardbewertung zur besseren internationalen Ver-
gleichbarkeit von eHealth-Studien.
2008 „Für ein effizien-
teres Gesund-heitswesen,
eHealth publifo-cus und elektro-nisches Patien-
tendossier, Bericht eines Dialogverfah-
rens“[74]
Technologiefolgen-
Abschätzung zur Einführung des
elektronischen Patientendossiers unter Einbezug
von Laien aus den drei grossen Sprachräumen der
Schweiz und verschiedenen
Stakeholdern des Gesundheitswe-sens.
Empirisch,
Fokusgrup-pen
Leistungs-
erbringer, Controller,
Unterstüt-zer und Empfänger
Qualitativ Ex ante Bei den Bürgerinnen und Bürger
konnte eine grundsätzlich positive Einstellung zur Einführung des elekt-
ronischen Patientendossiers festge-stellt werden. Die Haltung der ande-ren Stakeholder des Gesundheitswe-
sens (vertreten durch verschiedene Interessengruppen) war deutlich kritischer. Die Studie kommt zum
Schluss, dass insbesondere die mögli-chen inhaltlichen Vorteile den finan-
ziellen Mehrkosten gegenüber abzu-wägen sind.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 22
4 Methode zur Bewertung von eHealth-Services
4.1 Grundlagen der Methodenentwicklung Betrachtet man eHealth aus dem Gesichtspunkt der Vernetzung aller Prozesse und Akteure des Gesundheitswesens [14] so fällt auf, dass die oben gezeigten Evaluationsstudien nur sehr be-grenzt geeignet sind, um klare Aussagen hinsichtlich der Eignung von eHealth-Services für das Schweizer Gesundheitswesen zu machen [7]. Ausschlaggebende Einflussgrössen wie beispiels-weise die regulatorischen Rahmenbedingungen oder der technologische Fortschritt (respektive die Bereitschaft und Fähigkeit der Bürger Informations- und Kommunikationstechnologien ein-zusetzen) sind stets aus Sicht des jeweiligen Landes zu betrachten [58, 59]. Zur Vorbereitung und Legitimation von Entscheidungen im Hinblick auf die Schweizer eHealth-Strategie braucht es deshalb:
• Stakeholder-Orientierung, d. h. einen Ansatz, der die Interessen möglichst aller Akteure des Schweizer Gesundheitswesens berücksichtigt,
• Multiperspektivität, d. h. Messkriterien quantitativer und qualitativer Art und eine akteur-spezifische Gewichtung dieser Kriterien,
• Kontextorientierung, d. h. die Berücksichtigung der zu schaffenden Voraussetzungen und der herrschenden Rahmenbedingungen des Schweizer Gesundheitswesens,
• Vorausschau, d. h. einen Ansatz, der nicht allein auf die Eruierung des vergangen Nut-zens beruht, sondern auch hilft, den zukünftigen Nutzen von eHealth zu bewerten,
• Offenheit, d. h. einen Ansatz, der flexibel genug ist, um zukünftige Entwicklungen zu in-tegrieren.
Um die Problematik des „Dilemmas der Evaluationsforschung“ (vgl. Abschnitt 3.1) zu adressie-ren, wird im Folgenden die Grundlage der Auswahlentscheide für die Entwicklung der Bewer-tungsmethode beschrieben. Auf Basis der Ausführungen in den Abschnitten 3.2 und den aufge-listeten fünf primären Anforderungen zur Vorbereitung von Entscheidungen bezüglich der Schweizer eHealth-Strategie, können Anforderungen an die Methode zur Nutzenevaluation von eHealth in der Schweiz abgeleitet werden. Diese bilden die Grundlage der Bewertungsmethode, die anschliessend in den folgenden zwei Abschnitten beschrieben wird. Mit Bezug auf den Betrachtungsaspekt der Nutzenevaluation (vgl. Abschnitt 3.2) konnten, im Rahmen einer Studie zum Beitrag von IKT zur Produktivität und Effizienz des Gesundheitswe-sens, spezifische Vor- und Nachteile der Nutzenbewertung je nach Betrachtungsobjekt identifi-ziert werden (vgl. Tabelle 2). Wenngleich sich die Ausführungen und Analyseergebnisse von [83] auf die Bewertung quantitativer Bewertungskriterien (Kosteneffizienz, Behandlungseffi-zienz, etc.) beschränken, so deuten diese auf eine Grundproblematik zahlreicher bisheriger eHealth-Evaluationsstudien hin: die Auswahl eines adäquaten Betrachtungsobjekts. Aufgrund der Schwierigkeit der Nutzenevaluation im Rahmen von (inter-)nationalen Studien (Herausforde-rung der Bemessung des Beitrags von IKT) und der mangelhaften Verallgemeinerbarkeit von Projektevaluationen, erscheint eine Evaluation des Nutzens von eHealth mit Fokus auf das Be-trachtungsobjekt Organisation als besonders aussagekräftig. Im Gesundheitswesen besteht je-doch die Herausforderung, dass eine aggregierte Bewertung des Nutzens auf Basis des Betrach-tungsobjekts Organisation bei der Bewertung von IS-Nutzen aufgrund der stark unterschiedli-chen Zielsysteme der Stakeholder-Gruppen in Krankenhäusern (Ärzte, Pflege, Verwaltung, Be-trieb, etc.) einerseits zu weit gefasst ist. Anderseits ist diese Betrachtung auch zu eng gefasst, da
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 23
Effekte auf regionale oder nationale Gesundheitssysteme, also die makroökonomische Perspek-tive des IS-Nutzens im Gesundheitswesen, ignoriert werden [18, 46].
Tabelle 2: Drei Ebenen der Betrachtung im Rahmen von eHealth-Evaluationen in Anlehnung an [83]
Betrach-tungsebene
Vorteile Herausforderungen
(Inter-) National
Bewertung des Einflusses von IKT auf das Gesundheitswesen im Allgemeinem. Ermöglicht internationale Verglei-che.
Der „Output“ des Gesundheitswesens ist schwer messbar. Direkte Volumenmessung nicht aussage-kräftig ;keine Qualitätsindikatoren. Beitrag der Informatik schwer messbar.
Organi-sation
Erlaubt die Identifikation unter-schiedlicher Nutzenkriterien der „IS-Landschaft“. Ermöglicht die Abbildung von verschieden Auswirkungen je Or-ganisation(styp).
Notwendigkeit nur Gleiches mit Gleichem zu messen. Resultate können stark vom inhaltlichen Fokus und der Analysetechnik abhängen.
Projekte Sehr spezifische Bewertung ent-sprechend der Art der IS-Investition. Ermöglicht Vergleich von Investi-tionsalternativen.
Schwierigkeit die Auswirkungen auf die IS-Investition zurückzuführen und die Er-gebnisse zu verallgemeinern. Vorausschauende Nutzenabschätzung oft nur bedingt aussagekräftig.
Um den zuvor beschriebenen Limitierungen einer eHealth-Nutzenevaluation, die lediglich auf eine der Betrachtungsebenen fokussiert, entgegenzuwirken, verfolgt die im Folgenden beschrie-bene Methode zur Bewertung von eHealth-Services einen multiperspektivischen Ansatz. Als adäquater Betrachtungsgegenstand der Nutzenevaluation wurden eHealth-Services ausgewählt. Diese abstrakten, grob granularen IKT-Leistungen bieten eine bestimmte Funktionalität (vgl. Abschnitt 2.5 für einen Überblick der Services), die in der Regel von mehreren Akteurtypen des Gesundheitswesen – auf teils unterschiedliche Weise – genutzt wird. eHealth-Services stellen somit in sich abgeschlossene Betrachtungsgegenstände dar, die eine multiperspektivische und stakeholderorientierte Nutzenevaluation ermöglichen (vgl. Ausführungen zum integrierten Ein-satz von IKT zur Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung von Prozessen und Akteuren im Gesundheitswesen im Abschnitt 2.1). Die Grundlage einer stakeholderorientierten Evaluation dieser Services, bildet ein Katalog von Evaluationskriterien, welcher die Bewertung des Nutzens von eHealth aus Sicht der in Abschnitt 2.3 beschriebenen Akteure des Gesundheitswesens ermöglicht. Dieser Katalog integriert ver-schiedene Nutzendimensionen auf intraorganisationaler, interorganisationaler und auch gesell-schaftlicher Ebene und ermöglicht somit eine ganzheitliche Bewertung der Services. Die Nut-zendimensionen der Bewertungsmethode wurden auf Basis der in Abschnitt 3.3 beschriebenen Studien entwickelt unter Berücksichtigung verschiedener Meta-Studien [3, 18, 24, 38, 73, 85, 96], die bestehende eHealth Studien hinsichtlich deren Betrachtungsaspekten und Analyseme-thoden analysieren und bewerten. Die resultierende Bewertungsmethode umfasst sechs Nutzen-dimensionen – Führung, Wirtschaftlichkeit, Outcome, Informationsqualität, Vertrauen, Zu-gang/Befähigung – und entsprechende Nutzenkriterien, die im folgenden Abschnitt beschrieben werden. Zur Bewertung des Nutzens der eHealth-Services entsprechend der Nutzenkriterien, wurden anschliessend verschiedene Nutzenindikatoren definiert, die in Form eines Fragebogens abgefragt werden. Der Nutzenkatalog spiegelt hierbei die ganzheitliche Sicht auf die Nutzeneva-
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 24
luation wider, da ein möglicher Nutzen von eHealth-Services unabhängig von den einzelnen Ak-teurtypen definiert wird. Um eine qualifizierte Nutzenbewertung zu realisieren, wird der ganzheitliche, akteurtypenunab-hängige Nutzenkatalog auf Basis eines Stakeholder-Ansatzes für den jeweiligen Akteurtyp kon-figuriert. Die Umsetzung dieser Stakeholder-Orientierung der Nutzenevaluation basiert auf der Definition von [33]: „A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization's objectives”. Entsprechend dieser Definition, wird die Bewertung der eHealth-Services auf die jeweiligen Nutzen-Stakeholder eingeschränkt, d. h. es dürfen nur solche Akteurtypen eine Bewertung bezüglich einer bestimmten Nutzendimension bzw. eines Nutzenkriteriums (z. B. Behandlungssicherheit) vornehmen, die den Nutzen unmittelbar erfahren oder beeinflussen können (Akteurtyp Leis-tungserbringer und -unterstützer am Beispiel Behandlungssicherheit). Da die Nutzenkriterien darüber hinaus je nach Akteurtyp eine unterschiedliche Priorität haben können, wird vorgängig zur eigentlichen Nutzenevaluation eine Priorisierung vorgenommen (vgl. detaillierte Ausführun-gen zur Anwendung der Methode in Abschnitt 4.4). Die eHealth-Strategie der Schweiz [12] schafft die Grundlagen für einen Grossteil der eHealth-Services für das Schweizer Gesundheitswesen. Die Strategie sieht vor, dass bis Ende 2010 für alle Leistungserbringer die sichere Authentifizierung und die rechtsgültige elektronische Signa-tur verfügbar sind. Ausserdem soll bis Ende 2012 die elektronische Übermittlung von medizini-schen Daten unter den Teilnehmenden im Gesundheitssystem strukturiert, medienbruchfrei und verlustfrei etabliert sein. Somit bedarf es aus heutiger Sicht einer ex ante Evaluation des Nutzens von eHealth für das Schweizer Gesundheitswesens, da eHealth-Services maximal in loka-len/regionalen Services umgesetzt werden können und eine ex post Bewertung mit Blick auf den Gesamtnutzen derzeit aufgrund nicht vorhandener Umsetzung noch nicht möglich ist. Um die bereits vorhandenen externen Rahmenbedingungen des Schweizer Gesundheitswesens sowie die beim jeweiligen Akteurtypen zu schaffenden Voraussetzungen in die Bewertung mit einfliessen zu lassen, werden abschliessend die Kontextfaktoren des jeweiligen Akteurs erhoben.
4.2 Nutzendimensionen und Nutzenkriterien Die Nutzendimensionen und entsprechenden Nutzenkriterien dieser Studie wurden auf Basis einer ausführlichen Literaturrecherche in der Wissensbasis der eHealth-Evaluationsforschung entwickelt. Als Grundlage dienten teilweise die in Abschnitt 3.3 aufgeführten Studien, primär wurden jedoch Ergebnisse aus den zuvor erwähnten Meta-Studien [3, 18, 24, 38, 73, 85, 96] für die Ausarbeitung der Bewertungsdimensionen herangezogen. Entsprechend der Ausführungen von [24], können für die ausgewählten Betrachtungsebenen – intraorganisational, interorganisational und gesellschaftlich – unterschiedliche Fokusbereiche hervorgehoben werden. Der intraorganisationale Nutzen spiegelt sich primär in eHealth-Beiträgen zur Leistungsfähigkeit und Qualität der Leistungen, also dem Output einer Organisati-on wider. Diese Betrachtungsebene ist primär für die Akteurtypen Leistungserbringer und Unter-stützer relevant. Auf der interorganisationalen Betrachtungsebene liegen die primären Nutzen-beiträge im Bereich der organisationsübergreifenden Leistungserstellungsprozesse im Gesund-heitswesen (z. B. Behandlungsprozess). Die beiden zuvor beschriebenen Ebenen gesamtheitlich integrierend, liegt der Fokus der gesellschaftlichen Betrachtungsebene von eHealth-Services im kumulierten Beitrag beim Leistungsempfänger und entsprechendem volkswirtschaftlichen Nut-zen. Bevor im Folgenden auf die einzelnen Dimensionen und Nutzenkriterien im Detail eingegangen wird, soll kurz noch auf die Anwendbarkeit von wertbasierten, finanz- und kostenorientierten
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 25
Nutzenbewertungen von IKT eingegangen werden. Solche Ansätze (z. B. Return-on-Investment-Berechungen) werden häufig in Projekt- und Investitionsbewertungen eingesetzt. Diese Studie verfolgt jedoch die Zielsetzung einer ex ante Evaluation von eHealth-Services, die insbesondere im Rahmen einer vernetzten Leistungserbringung ihren vollen Nutzen erwirken. Ein solch über-greifender, vernetzter Nutzen spiegelt sich bei einer Grosszahl von Stakeholdern mit (teils stark) unterschiedlichen Zielen und Anreizen wider. Die Stakeholder sind teilweise direkt, teilweise nur indirekt vom Service betroffen und erfahren häufig keinen direkten materiellen/finanziellen Nut-zen (Kostensenkung, Umsatz-/Durchsatzsteigerung), sondern primär immateriellen Nutzen wie beispielsweise erhöhte Qualität, Sicherheit, etc. Insbesondere solch immaterieller Nutzen lässt sich in einer wertebasierten Nutzenevaluationen nur mangelhaft abbilden [38]. Da gerade der immaterielle Nutzen, im Gegensatz zu vielen anderen Industrien, im Gesundheitswesen jedoch häufig den Kernbeitrag von IKT („Health outcome“ [3]) darstellt, wird im Rahmen dieser Studie der primäre Fokus auf diese immateriellen, nicht rein finanziellen Nutzendimensionen gelegt. Dimension Führung Die Aufgabe der operativen Führung von Organisationen liegt primär in „der Prozessführung [(Zielfindung, Steuerung und Controlling)] der einzelnen Geschäfts- und Unterstützungsprozesse anhand von Führungskenngrössen“ und kann grundsätzlich in drei Teilbereiche unterschieden werden: Mitarbeiterführung, finanzielle Führung und Qualitätsmanagement [76]. eHealth-Applikationen und -Services leisten in Form von Unternehmenssteuerungs- und Controllingsys-temen [37, 57] einen Beitrag zur Führung der Organisation. Der Nutzen von eHealth spiegelt sich im Bereich der Führung entsprechend in zwei Nutzenkriterien wider, Steuerungsfähigkeit und Konformität. Die Steuerungsfähigkeit bezieht sich hierbei auf die Fähigkeit zur Koordinati-on von Organisationsabläufen sowie die Fähigkeit zur Gestaltung von patientenzentrierten, be-reichsübergreifenden Prozessen [73]. Unter Konformität wird die Einhaltung von gesetzlichen und anderen Anforderungen an Prozesse (Best Practices) im Gesundheitswesen und die Fähig-keit diese nachzuweisen verstanden, beispielsweise durch verbesserte Einhaltung von Behand-lungsrichtlinien, Dokumentation und Überwachung sowie entsprechend reduzierter Fehlerraten [73]. Dimension Wirtschaftlichkeit Wenngleich die Ausführungen im vorderen Teil dieses Abschnitts verdeutlichen, dass die wirt-schaftliche Nutzendimension von eHealth keinesfalls als alleiniges Kriterium zur Nutzenbewer-tung herangezogen werden dürfen, so stellen Steigerungen in der Produktivität respektive Zeiter-sparnisse sowie die Reduktion der Kosten der medizinischen und administrativen Leistungs-erbringung, -vorhaltung aber auch der Zusammenarbeit einen beträchtlichen Nutzen für das Ge-sundheitswesen der Schweiz dar [73, 83, 96]. Eine gesteigerte Produktivität kann insbesondere in Form einer erhöhten Leistungsfähigkeit verschiedener Berufsgruppen innerhalb der Leistungs-erbringer und Unterstützer gemessen werden. Sie spiegelt sich auch wider in veränderten Aufga-ben (z. B. Reduktion administrativer Aufgaben, Fokus auf Kernaufgaben) [95], verbesserter und schnellerer Ausbildung von Mitarbeitern [92] und daraus folgend eine höhere Kapazität von ganzen Abteilungen [50]. Neben der höheren Produktivität in den Kernprozessen kann eHealth insbesondere im Bereich der Unterstützungsprozesse durch Integration, Ablaufunterstützung und Automatisierung einen Beitrag zur Kosten- und Zeiteffizienz leisten [18, 46, 85] und somit die Gesamtkosten der Leistungserbringung reduzieren.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 26
Dimension Outcome (medizinische Qualität) Die Dimension der medizinischen Qualität ist die zentrale Komponente des Nutzens von eHealth-Services. Insbesondere medizinische Applikationen, aber auch solche an der Schnittstel-le zwischen medizinischen und administrativen Aufgaben können einen Beitrag zur Qualität der medizinischen Leistungen beisteuern [3, 24, 85]. Der Beitrag zu einer gesteigerten medizini-schen Qualität lässt sich primär in drei Dimensionen messen: Behandlungseffektivität, Behand-lungseffizienz und Behandlungssicherheit. Effekte im Bereich Behandlungseffektivität sind auf Seiten der Leistungserbringer und Unter-stützer in Form von medizinischer Entscheidungsunterstützung (Evidence-based Medicine, elekt-ronische Unterstützung von Medikationsverordnungen, etc.) zu sehen [24, 85, 96]. Darüber hin-aus wird unter anderem durch die Unterstützung und Promotion von Leitlinien und deren Einhal-tung [24] ein Beitrag zur Angemessenheit der medizinischen Behandlung [73] und entsprechend gesteigerter Lebensqualität beziehungsweise reduzierter Last von Krankheiten beigetragen [18, 46]. Neben der Behandlungseffektivität – die richtigen Dinge tun – kann eHealth auch einen Beitrag zur Behandlungseffizienz – die Dinge richtig tun – leisten [3, 73]. Die Wirkungen liegen hier primär im Bereich der intraorganisationalen und interorganisationalen Leistungserbringungs- und Unterstützungsprozesse. So kann eHealth einen Beitrag an der Schnittstelle zwischen Akteu-ren leisten, indem Aufnahmezeiten oder Liege- bzw. Transportzeiten in den Prozessen [73, 92] reduziert werden und übergreifende, gemeinsam erbrachte Leistungen besser koordiniert und gesteuert werden [96]. IKT-Unterstützung am Ort der Behandlung kann den Zeitaufwand redu-zieren, beispielsweise durch den direkten Zugang zu medizinischen Daten, und eine Integration von Leistungsdokumentation und -abrechnung kann den Arbeitsaufwand für administrative Auf-gaben reduzieren [24]. Diese Effekte steigern die Leistungsfähigkeit des medizinischen Perso-nals und können sich je nach Krankheitsbild und –verlauf positiv auf die Behandlungsdau-er/Hospitalisierung auswirken [24, 73, 92]. Eine dritte Dimension des Nutzens von eHealth im Bereich Outcome/medizinische Qualität liegt im Beitrag zur erhöhten Behandlungssicherheit [85]. Zu bewertende Aspekte der evaluierten Services sind der Beitrag zur Reduktion von unerwünschten Medikations- oder Behandlungser-eignissen [96] sowie von Komplikationen [46]. Die Einhaltung von Behandlungsrichtlinien und Angemessenheit der Medikation [24], (vgl. auch die Nutzendimension Konformität) leistet eben-falls einen Beitrag zur Reduktion von Fehlerraten respektive Critical Incidents [24, 85] und kön-nen somit einen positiven Einfluss auf Morbidität und Mortalitätsraten haben [46]. Dimension Informationsqualität Die Qualität von medizinischen, patientenbezogenen (Identifikationsdaten) und administrativen Daten und Informationen beeinflusst Entscheidungsfindungsprozesse und die Effektivität von Handlungen und Abläufen. Sie hat somit einen direkten Einfluss auf die Qualität der Leistungs-erbringung [3, 23]. Zur Bewertung der Qualität von Informationen können verschiedene Bewer-tungskriterien genützt werden, es kann grundsätzlich zwischen Aspekten der Verfügbarkeit von Informationen, deren Korrektheit und der Fähigkeit zum Austausch von Information zwischen verschiedenen Akteuren unterschieden werden. Die Verfügbarkeit von Informationen ist einer-seits abhängig von deren Vollständigkeit und Aktualität [50], andererseits von der Relevanz für den jeweiligen Akteur [23, 96]. Als Grundlage von medizinischen und anderen Entscheidungen muss gerade im Kontext von eHealth neben der Verfügbarkeit ein grosses Augenmerk auf die Korrektheit von Informationen gelegt werden. So kann eHealth einen Beitrag zur Widerspruchs-freiheit von Informationen durch Vermeidung von Redundanzen leisten und durch Nachvoll-ziehbarkeit der Informationsflüsse deren Verlässlichkeit erhöhen [96]. Im Rahmen einer integ-rierten Versorgung ist dabei nicht nur die „interne“ Verfügbarkeit und Korrektheit von Informa-
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 27
tionen von Nutzen, sondern auch der Zugang zu „externen“, durch andere Akteure erstellten oder verarbeiteten, Information zu betrachten. Entsprechend ist der Beitrag von eHealth-Services zum Austausch von Informationen zu bewerten, da dies die Koordination zwischen verschiedenen Leistungserbringern unterstützt [24, 96] und einen Einfluss auf die effiziente Verwaltung von Patienteninformationen hat [61, 85]. Dimension Vertrauen Neben den technischen Nutzendimensionen von eHealth-Services wird der Gesamtnutzen von IKT-Lösungen im Gesundheitswesen auch durch sozio-technische Aspekte determiniert. Das Vertrauen der Nutzer von eHealth-Services und deren Befähigung zum adäquaten Umgang mit den IKT-Lösungen beeinflusst demnach den Nutzen [96]. Die Akzeptanz der Behandlung kann durch eHealth-Services beeinflusst werden. Sie ist abhängig von der Wirkung auf den Umgang der Leistungserbringer mit den Leistungsempfängern [3], welche durch mögliche technische Barrieren (mangelnde Fähigkeit zum Umgang mit/fehlendes Verständnis für IKT) und die Wir-kung auf den persönlichen Kontakt zwischen diesen beiden Akteurtypen [24] beeinflusst wird. Neben diesem Einfluss auf die Interaktion zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens hängt der Nutzen vom Vertrauen der Akteure in die eigentlichen eHealth-Services ab. Aspekte, die es hierbei zu betrachten gilt, sind das Vertrauen der Akteure in die Vertraulichkeit von Informatio-nen [24] und in deren Verlässlichkeit [18]. Dimension Zugang/Befähigung Die obligatorische Grundversicherung und die kantonal beauftragte Grundversorgung durch die Leistungserbringer stellen ein gleichwertig gutes und allen Versicherten zugängliches Leistungs-angebot sicher. Beim Einsatz von eHealth-Services müssen diese Gleichbehandlung und der Zu-gang zu Leistungen unabhängig von Alter, Ort, Bildung oder persönlichem Handicap gewahrt oder gegebenenfalls ausgebaut werden. Durch Schaffung alternativer Zugangswege zu Produk-ten und Leistungen verschiedener Akteure des Gesundheitswesens, können diese teils über grös-sere Distanzen, ortsunabhängig angeboten und konsumiert werden. Es kann somit der Zugang zu einem grösseren Leistungsangebot beispielsweise auch geografisch benachteiligten Orten der Schweiz ermöglicht werden [18, 46]. Darüber hinaus kann ein erweitertes Leistungsangebot auch die Wahlfreiheit der Leistungsempfänger erhöhe. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass wei-terhin alternative, nicht-elektronische Zugangswege zu den Leistungen des Schweizer Gesund-heitswesens gewahrt bleiben und somit eine Gleichbehandlung sichergestellt ist. Die zuvor genannten Aspekte beeinflussen primär den Willen bzw. die persönliche Bereitschaft zur Nutzung von eHealth-Services und bestimmen deren sozio-technischen „Nettonutzen“ in Bezug auf den technisch möglichen „Bruttonutzen“. Dieser Nettonutzen wird neben dem Ver-trauen in eHealth-Services auch durch die Befähigung der Akteure beeinflusst. Die Befähigung adressiert hierbei einerseits „eHealth-Literacy“ [13], d. h. die technische Fähigkeit zum Umgang mit eHealth-Services [3, 13], andererseits aber auch den Einfluss auf die Gesundheitskompetenz im Allgemeinen und den entsprechenden Einfluss auf eine gesündere Lebensweise der Leis-tungsempfänger.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 28
4.3 Methodik - Entwicklung der Studie Die Methode zur Bewertung des Nutzens von eHealth wurde durch das Kompetenzzentrum Health Network Engineering des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der Universität St. Gallen auf der Grundlage der in Kapitel 3 beschriebenen Ergebnisse zur Evaluationsforschung im Kon-text von eHealth entwickelt. Die Entwicklung der Methode kann grundsätzlich in drei Phasen unterteilt werden: Literaturrecherche, Entwicklung der Studie sowie eine Fokus-Gruppen-Evaluation und anschliessende Überarbeitung. Die Phasen werden im Folgenden kurz beschrie-ben. Literaturrecherche Das Ziel der Literaturrecherche liegt primär in der Strukturierung und wissenschaftlichen Einbet-tung der Studie zum Nutzen von eHealth. Die Ergebnisse der Literaturrecherche finden sich ei-nerseits in der Begriffsdefinition und der Strukturierung der Fragestellung nach Zielen, Akteu-ren, Prozessen und elektronischen Diensten wieder, die in Kapitel 2 beschrieben sind. Anderer-seits enthält die aktuelle Wissensbasis eine breite Grundlage zur Thematik der Nutzenevaluation von IKT im Allgemeinem und von eHealth-Services im Speziellen. Insbesondere die im vorigen Abschnitt beschriebenen Nutzenkriterien wurden für die Entwicklung des Fragebogens zur Er-hebung der Nutzenbewertung (vgl. Anhang IV) von eHealth-Services durch die Akteure des Ge-sundheitswesens herangezogen. Entwicklung der Studie Auf Basis der Literaturrecherche wurde der in Anhang IV beschriebene Fragebogen erstellt. Die-ser bildet die Grundlage für die Bewertung einzelner eHealth-Services, die entsprechend der in Abschnitt 4.2 beschriebenen Nutzendimensionen multiperspektiv bewertet werden. Der Frage-bogen berücksichtigt die Interessen und Kenntnisse der einzelne Stakeholder dadurch, dass für jede Frage entsprechend des jeweiligen Nutzenkriteriums eine Bewertung vorgenommen wurde, ob diese dem Zielsystem des jeweiligen Akteurtyps zugeordnet und hinreichend kompetent be-wertet werden kann. Somit wird gewährleistet, dass lediglich diejenigen Befragten eine Bewer-tung bezüglich eines bestimmten Nutzenkriteriums durchführen dürfen, die von diesem direkt betroffen sind (vgl. Spalten „Adressaten/ Fähigkeit zum Beantworten“ des Fragebogen im An-hang IV). Da die Studie eine Evaluation von eHealth-Services ex ante durchführt, ist eine sorgfältige Aus-wahl der zu bewertenden Services sehr wichtig. Weil eine vorausschauende Bewertung von eHealth-Services stark von der Distanz zwischen dem Status quo der Bewertenden und den zu-künftigen eHealth-Services abhängt, ist es das Ziel der Studie eine möglichst ausgewogene Aus-wahl zu treffen. Als Grundlage der Auswahl wurde eine Bewertung bezüglich der Zeitverhältnis-se (kurz-, mittel- oder langfristig) sowie des Investitionsaufwandes (Kosten, Grösse, Komplexi-tät) der eHealth-Services vorgenommen. Als Ergebnis dieser Bewertung wurde eine Auswahl von vier Services getroffen: Medizinische Dokumentation, Überweisung, Gesundheitsportal und Leistungsstatistik (vgl. Tabelle 3).
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 29
Tabelle 3: Ausgewählte eHealth-Services der Studie
eHealth-Service Zeitverhältnisse Investitions-aufwand
Kontext
Medizinische Dokumentation
Langfristig Gross - Ziel A7 der Strategie „eHealth” Schweiz
- Fokus: Leistungserbringer Gesundheitsportal Kurzfristig Klein - Handlungsfeld „Online-Dienste“
der Strategie „eHealth“ Schweiz - Fokus: Empfänger - Ziel: Gesundheitskompetenz
Überweisung (Zuweiserportal)
Mittelfristig Mittel - Interaktion im Kontext „Online Dienste“ der Strategie „eHealth“ Schweiz
- Fokus: Leistungserbringer und Unterstützer
Leistungsstatistik Mittelfristig Mittel - Verbesserung der Qualität der medizinischen Leistungen durch Qualitätsindikatoren
- Fokus: Controller Die der Studie zugrunde liegende Methode ist jedoch keinesfalls auf diese vier Services be-schränkt sondern kann auch für andere Services angewendet werden (vgl. Abschnitt 4.4). Es wurde eine Auswahl von repräsentativen Services auf Basis der eHealth-Strategie vorgenommen, die eine Bandbreite zwischen State-of-the-Art und zukunftsorientierten Diensten abbildet. Pre-Test - Fokus-Gruppen-Evaluation und anschliessende Überarbeitung Der Fragebogen der Studie wurde anhand der vier ausgewählten Services im Rahmen einer Fo-kus-Gruppen-Evaluation getestet. Im November 2008 wurde hierzu gemeinsam mit 10 Vertre-tern der beschriebenen Akteure des Gesundheitswesens (2 Leistungserbringer, 2 Empfänger, 4 Unterstützer, 2 Controller) ein Workshop in Bern durchgeführt. Der Ablauf des Workshops war zweigeteilt. Im ersten Teil wurde eine Vorstellung und Diskussion des der Studie zugrunde lie-genden Begriffsverständnisses (vgl. Kapitel 2) durchgeführt. Das grundsätzliche Verständnis von eHealth konnte hierbei bestätigt werden. Bezüglich der Definition der vier zu evaluierenden Ser-vices konnten geringfügige Anpassungen zur Abgrenzung und Klarheit der Definitionen vorge-nommen werden. Im zweiten Teil wurde die Nutzenbewertung der Services anhand des Frage-bogens zuerst für den Service „Medizinische Dokumentation“ im Plenum durchgeführt um mög-liche Unklarheiten bezüglich der Fragestellungen und der Struktur des Fragebogens identifizie-ren und anpassen zu können. Die weiteren drei Services wurden dann durch die Workshop-teilnehmende in selbstständiger Arbeit bewertet. Entsprechend des Feedbacks zum Fragebogen wurden einzelne Fragen in ihrem Wortlaut angepasst, um mögliche Missverständnisse zu mini-mieren. Bezüglich des Bewertungsrasters wurde die verwendete Likert-Skala mit fünf Antwort-möglichkeiten durch zwei alternative nicht-bewertende Optionen erweitert: „nicht anwendbar“ und „weiss nicht“. Durch diese zwei Optionen wurde der Komplexität und Breite des Betrach-tungsgegenstands eHealth Sorge getragen und eine weitere Eingrenzung der Wichtigkeit der Nutzenkriterien durch den Befragten ermöglicht. Als besonders erfolgskritisch für die Aussage-kraft der Befragung wurde die Einbettung in einen Workshop zur Erläuterung des Begriffsver-ständnis von eHealth und der genauen Spezifikation der zu bewertenden eHealth-Services erach-tet.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 30
4.4 Anwendung der Methode Dieses Kapitel beschreibt die Anwendung der Methode zur Nutzenbewertung von eHealth-Services. Das im folgenden beschriebene Vorgehensmodell wurde im Rahmen der Fokus-Gruppen-Evaluation sowie während des eigentlichen Evaluationsworkshops (vgl. folgendes Ka-pitel) angewendet. Das Vorgehensmodell ist, wie zuvor erwähnt, nicht auf die vier eHealth-Services dieser Studie beschränkt, sondern kann für die Bewertung weiterer eHealth-Services herangezogen werden, um die Nutzenbetrachtung von eHealth weiter zu fundieren. Schritt 1 – Selektion eines oder mehrerer Services Da eHealth je nach Begriffsverständnis auf unterschiedliche Aspekte fokussieren kann, muss eine zielgerichtete Auswahl der zu bewertenden eHealth-Services vorgenommen werden. Durch diese Auswahl kann den Ergebnissen einer solchen Studie somit auch nur eine eingeschränkte Repräsentativität ausgewiesen werden (vgl. Auswahl-Bias in [86]). Im Rahmen der hier be-schriebenen Studie wurde die Auswahl primär an der Strategie „eHealth“ Schweiz ausgerichtet. Schritt 2 – Konfiguration des Fragebogens Der in Anhang IV beschriebene Fragebogen stellt einen Referenzfragenkatalog dar, der je nach Art des e-Health Service und entsprechendem Evaluationsfokus angepasst werden kann. Insbe-sondere bezüglich der Adressaten respektive deren Fähigkeit zur kompetenten Bewertung der einzelnen Nutzenkriterien muss je nach Auswahl der Services, insbesondere bei Auswahl recht spezifischer Services (z. B. Medizinische Statistik/Epidemiologie), eine Prüfung der Zuordnung zu den Akteurtypen vorgenommen werden. Schritt 3 – Gewichtung des Zielsystems Da die inhaltliche Gruppierung der Bewertung nach Nutzendimensionen (vgl. Abschnitt 4.2) noch keine Aussage über die Priorität der einzelnen Nutzenkriterien für den jeweiligen Akteur-typ respektive für die Gesamtheit der Akteure des Gesundheitswesens zulässt, sollte im Vornhin-ein eine Gewichtung der Nutzenkriterien vorgenommen werden. Im Rahmen dieser Studie wurde dies in Form einer Auswahl der fünf priorisierten Nutzenkriterien durch die Teilnehmenden der Studie realisiert. Schritt 4 – Bewertung des Nutzens von eHealth-Services Durch die Erhebung der einzelnen Punkte des Fragebogens wird eine ex ante Bewertung des möglichen Nutzens der eHealth-Services durchgeführt. Diese Bewertung bezieht sich auf den theoretischen „Brutto-Nutzen“, der bei einer Umsetzung der vollen in der jeweiligen Spezifikati-on des Services beschriebenen Funktionalität und bei einer Anwendung durch alle relevanten Akteure realisiert werden kann. Schritt 5 - Bewertung der Voraussetzungen & Rahmenbedingungen Das Risiko eines Optimismus-Bias bei ex ante Evaluationen [55] ist abhängig von der Distanz des Status quo zum Betrachtungsobjekt der ex ante Bewertung. Um einen möglichen positiven Bias gerade für eHealth-Services mit einem längerfristigen, stärker zukunftsorientierten Zeitho-rizont zu berücksichtigen, wird eine Einordnung des zuvor erwähnten Brutto-Nutzens in beste-hende Voraussetzungen und Rahmenbedingungen vorgenommen. Dementsprechend nehmen die Befragten im letzten Teil des Fragebogens eine Bewertung der Voraussetzungen, d. h. der intern durch die jeweilige Organisation des Befragten adressierbaren Einflussfaktoren, sowie der Rah-menbedingungen, d. h. externe nicht beeinflussbare Faktoren wie beispielsweise gesetzliche Grundlagen, vor (vgl. Anhang IV). Diese Information ermöglicht eine Einordnung der erhobenen Daten im Sinne einer Abschätzung des möglichen Netto-Nutzens.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 31
Schritt 6 – Analyse der Ergebnisse und Thesenbildung Aufgrund der Breite der Nutzendimensionen von eHealth-Services (vgl. Abschnitt 4.2) und der Unterschiedlichkeit der Funktionalitäten und Einsatzgebiete von eHealth-Services (vgl. Ab-schnitt 2.5 und Anhang III) kann eine Anwendung von quantitativen Analysen im Rahmen der beschriebenen Methode nur bedingte statistische Repräsentativität und Validität erreichen, bzw. bedürfte einer sehr hohen Fallzahl. Die Ergebnisse der beschriebenen Methode sind somit explo-rativer Natur und bilden die Grundlage für eine Thesenbildung des möglichen Nutzen von eHealth-Services. Diese Thesen sind im Sinne einer ex post Analyse im Anschluss an die Ein-führung der Services zu testen, um statistisch reliable und valide Nutzenbewertungen durchfüh-ren zu können. Solche Thesen wurden im Rahmen dieser Studie aufgrund der Bewertung der vier Services erstellt und sind im folgenden Kapitel jeweils am Ende der Abschnitte 5.4-5.7 aufge-führt.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 32
5 Beurteilung ausgewählter eHealth-Services
5.1 Datenerhebung und Grundgesamtheit Im Rahmen eines Evaluationsworkshops wurden insgesamt 79 Personen mit direktem Bezug zum Gesundheitswesen dazu aufgefordert, eine Beurteilung der vier vorgeschlagenen eHealth-Services (siehe Tabelle 3) vorzunehmen. Für diesen Anlass wurden deshalb vorrangig 200 Per-sonen postalisch und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals 500 Personen per eMail angeschrie-ben. Die Rücklaufquote beträgt demnach 11,3%. Aufgrund der organisationalen Funktionszuge-hörigkeit der teilnehmenden Personen konnte die am Evaluationsworkshop geltende Zuteilung zu einem der Akteurtypen vorgenommen werden. Diese Zuteilung diente zum einen dazu, die drei Fragestellungen (1) Nutzengewichtung, (2) Nutzenbeurteilung der vier ausgewählten Servi-ces und (3) Beurteilung der zu schaffenden Voraussetzungen und Rahmenbedingungen in den entsprechenden Gruppen zu bearbeiten, zum anderen konnten so externe Einflüsse durch andere Akteurtypen minimiert werden. In einem nächsten Schritt wurden die Daten auf ihre Vollständigkeit und Eignung geprüft. Dabei wurden alle Datensätze ausgeschlossen, die unvollständig (beispielsweise Fehlen eines der drei Fragenbogenteile) oder für die Analyse untauglich waren (beispielsweise Tendenz zu neutralen oder extremen Antworten auch bei Kontrollfragen). Deshalb wurden für die nachfolgende Ana-lyse lediglich die Datensätze von 39 Teilnehmenden verwendet (siehe Abbildung 8).
Abbildung 8: Grundgesamtheit der Studie
Zu den Befragten gehörten Personen mit den Rollen Apotheker, niedergelassene Ärzte, Fachärz-te, Spitalärzte, Spitaldirektoren, Spitalmitarbeitende mit unterstützender Funktion, Gesunde Bür-ger, Patienten, Spitex, Mitarbeitende des Bundes, Mitarbeitende der Kantone, SUVA, Kranken-versicherer, Dienstleister der Medikamentenlogistik und IT-Dienstleister. Die Zusammensetzung der Rollen der für die Analyse berücksichtigen Datensätze ist in Tabelle 4 aufgeführt.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 33
Tabelle 4: Zusammensetzung der Rollen je Akteur für die berücksichtigten Datensätze
Akteur Rolle Datensätze
Controller Bund 3
Kanton 4
Krankenversicherer 2
SUVA 1
Controller Total 10
Empfänger Gesunde Bürger 2
Patient 7
Empfänger Total 9
Leistungserbringer Apotheker 1
Arzt 1
Labor 1
Medizinische Dienste 1
Niedergelassener Arzt 1
Medizinische Leitung/Management 3
Spitex 1
Leistungserbringer Total 9
Unterstützer Dienstleistermanagement 1
IKT-Anbieter 4
Medikamentenlogistik 2
Spital-IT 4
Unterstützer Total 11
Total 39
5.2 Datenreduktion und Reliabilität
Ein Grundproblem vielschichtiger Phänomene − wie in diesem Fall der „Nutzen von eHealth“ − ist, dass eine Vielzahl von Einflussfaktoren für deren Erklärung benötigt wird. Je grösser jedoch die Zahl der notwendigen Erklärungsvariablen wird, um so weniger ist gesichert, dass diese auch tatsächlich unabhängig voneinander zur Erklärung des Phänomens notwendig sind (setzen sich die Erklärungsvariablen gegenseitig voraus, dann führt die Einbeziehung aller Variablen u.U. zu unbefriedigenden Erklärungswerten). Aus diesem Grund wurde zur Entdeckung der untereinan-der unabhängigen Erklärungsvariablen (und einer dementsprechenden Reduktion der Erklä-rungsvariablen) eine Faktorenanalyse mit dem zugrundeliegenden Datenmaterial durchgeführt. Von den ursprünglichen 53 Nutzenkriterien können, nach der Extraktion von Kontrollfragen und stark korrelierenden Erklärungsvariablen, noch 31 Nutzenkriterien für eine gesicherte Erklärung des Phänomens „Nutzen von eHealth“ herangezogen werden (vgl. Tabelle 6). Anhand eines Scree-Tests (Ellenbogenkriterium) wurde die optimale Faktorenzahl bestimmt. Aufgrund der Knickstelle zwischen dem fünften und dem siebten Faktor kann deshalb geschlossen werden, dass für die zugrundeliegenden Daten sechs Faktoren als optimale Anzahl zu erachten ist (vgl. Abbildung 9).
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 34
Abbildung 9: Screeplot zur Bestimmung der Faktorenzahl
Die durch die Faktorenanalyse ermittelten sechs Faktoren erklären rund 49.9% der Gesamtvari-anz, wobei jeder Faktor zwischen 7% und 9% der Varianz erklären (vgl. Tabelle 5)4. Zur Über-prüfung der Sinnhaftigkeit der gefundenen Faktoren wurde das Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium (measure of sampling adequacy) herangezogen. Das KMO-Kriterium zeigt an, in welchem Um-fang die 31 Nutzenkriterien zusammengehören und dient somit als Indikator für die Adäquanz einer Faktorenanalyse. Für die vorliegende Faktorenanalyse konnte ein Wert von 0,73 ermittelt werden, was als vergleichsweise gut zu werten ist [44]. Desweiteren wurde die interne Konsis-tenz der verbleibenden Erklärungsvariablen untersucht. Hohe interne Konsistenz bedeutet, dass die verschiedenen Erklärungsvariablen, die einen Faktor bilden, im Wesentlichen das Gleiche messen. Eine gebräuchliche Kenngrösse für die interne Konsistenz ist das Cronbach‘s Alpha Kriterium. Eine Messung ist hiernach reliabel, wenn α > 0,7 ist. Der ermittelte Wert der restli-chen 31 Erklärungsvariablen ist α = 0.84 und daher akzeptabel5.
Tabelle 5: Erklärte Gesamtvarianz
Für die Interpretation der Faktoren wurde eine rotierte Faktorenmatrix verwendet (vgl. Tabelle 6). Eine nähere Betrachtung der einzelnen Nutzenkriterien und deren Korrelation zu einem be-stimmten Faktor lassen die folgenden Schlüsse bezüglich der Bezeichnung der Faktoren zu:
• Gleichbehandlung: Faktor 1 beinhaltet all diejenigen Nutzenkriterien, die sich mit der Gleichwertigkeit der Behandlung von Patienten und Bürgern beschäftigen (beispielswei-se Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Bildung, Ort und Handicap).
4 Während in den Naturwissenschaften Erklärungsgrade von bis zu 95% der Gesamtvarianz erreicht werden, ist in den Sozialwissenschaften mit max. 60% der Gesamtvarianz zu rechnen [35]. 5 Die Nützlichkeit der Verwendung von Cronbach’s Alpha zur Beurteilung der Reliabilität einer Messung wird der-zeit kontrovers diskutiert [19, 79]. Den Autoren ist bewusst, dass diese Masszahl lediglich als Anhaltspunkt zur Beurteilung der Reliabilität dienen kann.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 35
• Informationsqualität: Faktor 2 beinhaltet all diejenigen Nutzenkriterien, die mit der Qua-lität der Informationsversorgung zusammenhängen (beispielsweise Verfügbarkeit und Aktualität von Informationen).
• Effektivität: Faktor 3 beinhaltet all diejenigen Nutzenkriterien, die mit der Planung, Durchführung und Steuerung der Erbringung medizinischer und administrativer Leistun-gen zu tun haben (beispielsweise Planbarkeit und Steuerungsfähigkeit von Arbeitsabläu-fen).
• Behandlungssicherheit: Faktor 4 beinhaltet all diejenigen Nutzenkriterien, die mit medi-zinischen Behandlungsrisiken zusammenhängen (beispielsweise Risiko falscher Medi-kamenteneinnahme oder Risiko von Behandlungsfehlern).
• Befähigung und Vertrauen: Faktor 5 beinhaltet all diejenigen Nutzenkriterien, die mit der Befähigung von Patienten und Bürgern und der Akzeptanz der Behandlung zusam-menhängen (beispielsweise Gesundheitsbewusstsein der Bürger).
• Effizienz: Faktor 6 beinhaltet all diejenigen Nutzenkriterien, welche das Verhältnis zwi-schen Aufwand (beispielsweise mehr Administration) und Zeitersparnis (beispielsweise geringere Verweildauer) durchleuchten.
Tabelle 6: Rotierte Faktorenmatrix
Die resultierenden Nutzenfaktoren bestätigen die im Kapitel 4 beschriebenen Nutzenkriterien, resultieren jedoch in einer teilweise abweichenden Gruppierung gegenüber den aus der Literatur abgeleiteten Nutzendimensionen. So zeigt sich das zwei primäre Ziele des Gesundheitswesens im Allgemeinen und des schweizerischen im Besonderen - Behandlungssicherheit und Gleichbe-handlung – als eigenständige Nutzenfaktoren identifiziert werden können. Darüber hinaus spie-gelt sich die zunehmende Integration administrativer und medizinisch/pflegerischer Aufgaben und entsprechender IKT-Unterstützung in einer übergreifenden Gruppierung von effizienz- re-
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 36
spektive effektivitätsbeeinflussenden Nutzenkriterien wider. Die Dimension Informationsqualität wurde im entsprechenden Faktor bestätigt, die Dimension des Vertrauens um Nutzenkriterien der Befähigung erweitert. Im Sinne der Datenreduktion und der Reliabilität der Auswertung basieren die weiteren Analysen auf den in diesem Abschnitt beschriebenen Nutzenfaktoren.
5.3 Gewichtung der Nutzenkriterien Eine zentrale Fragestellung bei der Einführung von eHealth-Services ist, ob dadurch auch tat-sächlich die richtigen Nutzenkriterien tangiert werden. Beispielsweise bringt es wenig, einen Service, der primär auf Effizienz getrimmt ist, für gesunde Bürger und Patienten einzuführen, wenn diese Effizienz nicht als wichtig erachten. In Anbetracht möglicher Unterschiede in den Präferenzen bei den verschiedenen Akteurtypen, wurden die Teilnehmenden des Evaluations-workshops deshalb hinsichtlich der Priorisierung des Nutzens befragt. Die Befragten hatten da-bei die Möglichkeit aus den Nutzenkriterien (vgl. Abschnitt 4.2) die für sie wichtigsten zu selek-tieren und zu priorisieren (von 1 wichtig bis 5 extrem wichtig; unwichtige Kriterien erhielten demnach keine Punkte). Diese Kriterien wurden wiederum den einzelnen aus der Faktorenanaly-se resultierenden Nutzenfaktoren zugeordnet (vgl. Tabelle 7).
Tabelle 7: Gewichtung der Nutzenfaktoren
Controller EmpfängerLeistungs-
erbringer
Unter-
stützer
Gleichbehandlung
Informationsqualität
Effektivität
Behandlungssicherheit
Befähigung und Vertrauen
Effizienz
NutzendimensionenAkteurtyp
Gesamt-beurteilung
In Bezug auf die Nutzengewichtung können unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Stichprobe (vgl. Abschnitt 5.1) folgende Thesen aufgestellt werden:
• Controller schätzen die Faktoren Gleichbehandlung, Informationsqualität und Effizienz gleichermassen wichtig ein, jedoch weniger wichtig als die Faktoren Effektivität, Be-handlungssicherheit und Befähigung & Vertrauen.
• Empfänger schätzen die Faktoren Gleichbehandlung und Informationsqualität gleicher-massen wichtig ein, jedoch weniger wichtig als Effektivität, Effizienz, Behandlungssi-cherheit und Befähigung & Vertrauen.
• Leistungserbringer schätzen die Faktoren Informationsqualität und Effizienz gleicher-massen wichtig ein, jedoch weniger wichtig als Behandlungssicherheit und Befähigung & Vertrauen. Noch wichtiger als die genannten Faktoren ist für die Leistungserbringer die Effektivität. Am wenigsten wichtig ist ihnen die Gleichbehandlung.
• Unterstützer schätzen die Faktoren Behandlungssicherheit und Effizienz gleichermassen wichtig ein, jedoch weniger wichtig als Informationsqualität, Effektivität und Befähigung & Vertrauen. Gleichbehandlung ist ihnen weniger wichtig als die anderen Faktoren.
• Der Faktor Gleichbehandlung wird insgesamt gleich wichtig erachtet wie Informations-qualität und Effizienz, jedoch weniger wichtig als Effektivität, Behandlungssicherheit und Befähigung & Vertrauen. Gleichbehandlung wird von den Controllern und Empfän-gern im Vergleich zu den Leistungserbringern und Unterstützern als wichtiger einge-schätzt.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 37
• Der Faktor Informationsqualität wird insgesamt als gleich wichtig erachtet wie Gleichbe-handlung und Effizienz, jedoch weniger wichtig als Effektivität, Behandlungssicherheit und Befähigung & Vertrauen. Informationsqualität wird besonders von den Unterstützern geschätzt.
• Der Faktor Effektivität wird insgesamt gleich wichtig erachtet wie Behandlungssicherheit und Befähigung & Vertrauen. Effektivität wird jedoch wichtiger eingeschätzt als Infor-mationsqualität, Gleichbehandlung oder Effizienz und wird durch die Leistungserbringer als extrem wichtig eingestuft.
• Der Faktor Behandlungssicherheit wird insgesamt gleich wichtig erachtet wie Effektivität und Befähigung & Vertrauen. Behandlungssicherheit wird jedoch wichtiger eingeschätzt als Informationsqualität, Gleichbehandlung oder Effizienz und wird durch die Unterstütz-ter im Vergleich zu den anderen Akteurtypen als weniger wichtig eingestuft.
• Der Faktor Befähigung & Vertrauen wird insgesamt gleich wichtig erachtet wie Effekti-vität und Behandlungssicherheit. Befähigung & Vertrauen wird jedoch wichtiger einge-schätzt als Informationsqualität, Gleichbehandlung oder Effizienz und wird durch alle Akteurtypen gleich wichtig eingestuft.
• Der Faktor Effizienz wird insgesamt gleich wichtig erachtet wie Informationsqualität und Gleichbehandlung, jedoch weniger wichtig als Effektivität, Behandlungssicherheit und Befähigung & Vertrauen. Effizienz wird von den Empfängern im Vergleich zu den ande-ren Akteurtypen als wichtiger eingeschätzt.
5.4 Beurteilung Service „Medizinische Dokumentation“ am Beispiel des Elektro-nischen Patientendossiers
Der Service „Medizinische Dokumentation“ stellt die zentrale Komponente in einer nationalen eHealth-Infrastruktur dar und wird in zahlreichen Evaluationsstudien, wenn auch oft nur auf or-ganisationaler Ebene, beurteilt (siehe S. 18f.). In der Schweiz soll, im Zuge der Umsetzung der eHealth-Strategie, dieser Service in Form eines elektronischen Patientendossiers umgesetzt wer-den. Primäre Aufgabe des Patientendossiers ist die Sammlung und Verwaltung aller für den Krankheits- und Behandlungsverlauf relevanten Daten eines Patienten in maschinenlesbarer Form. Um ein einheitliches Begriffsverständnis zu erhalten und um die Konsistenz der Aussagen zu erhöhen, wurde den teilnehmenden Personen des Evaluationsworkshops wie auch im Rahmen des Pre-Tests die Absicht des Elektronischen Patientendossiers wie folgt erklärt: Ziel des Elekt-ronischen Patientendossiers ist die Bereitstellung aller patientenbezogenen (nicht nur fallbezoge-nen) medizinischen und administrativen Angaben in einer strukturierten Weise. Diese sollen einrichtungsübergreifend verfügbar sein sowie ärztliche und pflegerische Aufzeichnungen, Do-kumentationen zu Diagnosen, Zielen, Behandlungen, Verordnungen, Ergebnissen, Verläufen, und Problemen enthalten. Entsprechend beinhaltet dies standardisierte Dokumente, Metadaten zu wer, wann, was, warum, mit wem, für wen, mit welchem Ergebnis im CDA-Standard sowie Im-port von und Export zu Gesundheitskarten mit u.a. Notfalldaten . Die am Evaluationsworkshop teilnehmenden Personen wurden als nächstes aufgefordert, ihre Einschätzung bezüglich bestimmter Nutzenkriterien abzugeben. Wie in Kapitel 4 beschrieben, basiert die vorliegende Nutzenbeurteilung auf dem Prinzip der stakeholderorientierten Evaluati-on, d. h. den Teilnehmenden wurden unterschiedliche Fragebögen ausgehändigt, je nach Zutei-lung zu einem Akteurtyp. Dabei wurde eine 5-stufige Likert-Skala (von 1 verschlechtert sich stark bis 5 verbessert sich stark) verwendet. Die Resultate der Einschätzung hinsichtlich des er-warteten Nutzens des Elektronischen Patientendossiers ist in Tabelle 8 illustriert, wobei Werte < 2,5 einen ↓-Pfeil, Werte 2,5 ≥ x ≥ 3,5 einen →-Pfeil und Werte > 3,5 einen ↑-Pfeil entsprechen. Entsprechend kann es im Rahmen der jeweiligen Auswertung der Gesamtbeurteilung eines Nut-zenkriteriums zu Rundungseffekten kommen. Fehlende Angaben können aufgrund von drei Kri-terien eintreten: (1) Befragter konnte Nutzenkriterium aufgrund fehlenden Wissens nicht bewer-
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 38
ten, (2) Befragter empfand Nutzenkriterium als unpassend, (3) die Bewertung des Nutzenkriteri-ums durfte vom entsprechenden Akteurtyp nicht bewertet werden.
Tabelle 8: Erwarteter Nutzen eines Elektronischen Patientendossiers
Controller EmpfängerLeistungs-erbringer
Unter-stützer
B1: Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen
B2: Risiko von Behandlungsfehlern
B3: Risiko unerwünschter Transfusionsereignisse
B4: Medikations-/Radiologiebelastung der Patienten
B5: Risiko von Komplikationen
B6: Risiko falscher Medikamenteneinnahme
B7: Risiko von Fehlern in der Diagnoseunterstützung
BV1: Verständnis über Gesundheitsinformationen
BV2: Gesundheitsbewusstsein der Bürger/Patienten
BV3: Überblick über mögliche BehandlungsoptionenBV4: Akzeptanz der Behandlung
EF1: Fähigkeit zur Gestaltung von ProzessenEF2: Fähigkeit zur Steuerung von ProzessenEF3: Leistungsfähigkeit der Organisation
EF4: Erlernen von Fähigkeiten
EF5: Dauer der Ausführung von Tätigkeiten
EF6: Planbarkeit der Auslastung der Organisation
EZ1: Aufwand an administrativer Arbeit
EZ2: Fokus auf Kernaufgaben
EZ3: Verweildauer des Patienten
EZ4: Wartezeiten des Patienten
G1: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Alter
G2: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von HandicapG3: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von OrtG4: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Bildung
I1: Nachvollziehbarkeit von InformationenI2: Aktualität der InformationenI3: Verfügbarkeit von InformationenI4: Widerspruchsfreiheit von InformationenI5: Zugang zu InformationenI6: Redundanz/Doppelspurigkeit der Informationen
Akteurtyp Gesamt-beurteilung
Nutzenkriterien
Legende: B: Kriterien des Nutzenfaktors Behandlungssicherheit Service hat negative Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium BV: Kriterien des Nutzenfaktors Befähigung & Vertrauen Service hat keine Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EF: Kriterien des Nutzenfaktors Effektivität Service hat positive Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EZ: Kriterien des Nutzenfaktors Effizienz G: Kriterien des Nutzenfaktors Gleichbehandlung I: Kriterien des Nutzenfaktors Informationsqualität
Auf Grundlage von Tabelle 8 können folgende Aussagen hinsichtlich des erwarteten Nutzens des Elektronischen Patientendossiers gemacht werden:
• Alle Akteurtypen erwarten bei der Einführung des Elektronischen Patientendossiers we-sentliche Verbesserungen in Bezug auf die Behandlungssicherheit, die Informationsquali-tät, die Effizienz sowie die Effektivität medizinischer und administrativer Abläufe. Hin-gegen wird mit keinen Wirkungen bezüglich der Befähigung und dem Vertrauen der Bürger gerechnet. Bezüglich der Gleichbehandlung sehen die Akteure gleichbleibende
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 39
bis negative Effekte. Insbesondere befürchten Empfänger und Leistungserbringer, dass Bürger mit geringer Bildung ausgeschlossen werden könnten.
• Insgesamt schätzten die Leistungserbringer den Service am positivsten ein. In Bezug auf die Akzeptanz der Behandlung, dem Erlernen von Fähigkeiten (Wissensbildung) sowie der Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Alter, Handicap, Ort und Bildung wird jedoch mit gleich bleibenden bis negativen Wirkungen gerechnet.
• Die anderen Akteure teilen diese positive Erwartung, sind jedoch in Bezug auf Kriterien der Faktoren Befähigung & Vertrauen (beispielsweise Gesundheitsbewusstsein der Bür-ger, Verständnis der Gesundheitsinformationen) oder Informationsqualität (beispielswei-se Widerspruchsfreiheit der Informationen) kritischer eingestellt und sehen dort nur mar-ginale bis gar keine Verbesserungen.
• Kontrovers eingeschätzt wird insbesondere das Nutzenkriterium „Aufwand an administ-rativer Arbeit“. Während Leistungserbringer eine Verbesserung durch die Einführung des Elektronischen Patientendossiers erwarten, sehen die Unterstützer eine Verschlechterung der aktuellen Situation. Entsprechend ist die folgende Vermutung zu klären: Die Unter-stützer fürchten, dass die Leistungserbringer die administrativen Aufwände an sie dele-gieren wollen.
Neben der Beurteilung der potenziellen Wirkungen der Einführung des Elektronischen Patien-tendossiers wurden die Teilnehmenden auch nach einer Einschätzung unterschiedlicher Kontext-faktoren befragt (siehe Abschnitt 4.4), welche helfen, den realisierbaren Nutzen zu ermitteln. Hierfür wurde wiederum eine 5-stufige Likert-Skala verwendet (von 1 = nicht vorhanden bis 5= umgesetzt). Für das Elektronische Patientendossier wurden die Rahmenbedingungen und Vor-aussetzungen wie folgt beurteilt (vgl. Tabelle 9):
• Insgesamt wurden die strukturellen, gesetzlichen, verhaltensbezogenen und finanziellen Rahmenbedingungen schlechter eingestuft als die organisatorischen Grundvoraussetzun-gen.
• Controller schätzen die derzeitigen Rahmenbedingungen, insbesondere in Bezug auf die Finanzen, tendenziell schlechter ein, als Leistungserbringer und Unterstützer. Auch hin-sichtlich der zu schaffenden Voraussetzungen, wie beispielsweise strategische und orga-nisatorische Grundvoraussetzungen, sehen sie mehr Handlungsbedarf. Insbesondere in Bezug auf die Einschätzung der Reife der technischen Infrastruktur scheinen die Control-ler im Vergleich zu den Leistungserbringern und Unterstützern nicht so optimistisch zu sein.
• Leistungserbringer und Unterstützer schätzen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen praktisch identisch ein. Lediglich in Bezug auf den Willen zur Nutzung des Services ge-hen die Unterstützer davon aus, dass diese Bereitschaft noch nicht soweit fortgeschritten ist.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 40
Tabelle 9: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung eines Elektr. Patientendossiers
ControllerLeistungs-
erbringer
Unter-
stützer
R1: Strukturelle Rahmenbedingungen
R2: Gesetzliche Rahmenbedingungen
R3: Finanzielle Rahmenbedingungen
R4: Wille zur Nutzung
V1: Strategische Grundvoraussetzungen
V2: Organisatorische Grundvoraussetzungen
V3: Applikationslandschaft
V4: Technische Infrastruktur
V5: Befähigung zur Nutzung
V6: Investitionsbereitschaft
Gesamt-beurteilung
Akteurtyp
Kontextfaktoren
Betrachtet man nun das Zusammenspiel zwischen Nutzengewichtung (Priorisierung der Nutzen-faktoren), erwartetem Nutzen (Beurteilung der Nutzenkriterien) und realisierbarem Nutzen (Be-urteilung der Rahmenbedingungen und Grundvoraussetzungen), so können folgende finale Aus-sagen für den Service „Medizinische Dokumentation“ respektive für das Elektronische Patien-tendossier getroffen werden (vgl. Abbildung 10):
• Alle Akteurtypen erwarten vom Elektronischen Patientendossier einen hohen Nutzen. Je-doch unterscheiden sich diese Einschätzungen in Bezug auf den tatsächlich realisierbaren Nutzen.
• Leistungserbringer schätzen den realisierbaren Nutzen dieses Services als insgesamt sehr hoch ein, während Empfänger und Unterstützer diesen als mittelmässig bis hoch und Controller als mittelmässig erachten.
Abbildung 10: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen eines Elektr. Patientendossiers6
6 Aufgrund der agreggierten Nutzenbetrachtung der eHealth-Services kann keine signifikante Unterscheidung in der Nutzengewichtung vorge-nommen werden. Dementsprechend sind die Durchmesser der Kreise identisch und implizieren keine Unterschiede in der Nutzenbetrachtung. Für eine detaillierte Bewertung der Nutzengewichte wird auf Abschnitt 5.3 verwiesen.
Niedrig Hoch Mittel Erwarteter Nutzen
Niedrig
Hoch
Realisierbarer Nut zen
Mittel
Controller Empfänger Leistungserbringer Unterstützer
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 41
Die Studie zur Technologiefolgenabschätzung, die durch TA-Swiss in 2008 durchgeführt wurde [74], adressiert eine ähnliche Fragestellung wie die hier beschriebene Nutzenbewertung des eHealth Services Elektronisches Patientendossier. Die oben beschriebenen Ergebnisse werden deshalb kurz in den Zusammenhang der TA-Swiss-Studie gestellt. Die primären Vorteile eines elektronischen Patientendossiers, die im Rahmen der TA-Swiss-Studie identifiziert werden konnten - Grössere Transparenz für die Leistungserbringer und Unterstützer, verbesserte Zu-griffsmöglichkeiten auf Patientendaten (u.a. auch aus dem Ausland), Dokumentation der lang-fristigen Gesundheitsentwicklung – spiegeln sich auch im Rahmen der positiven Nutzenbewer-tung der Faktoren Behandlungssicherheit, Informationsqualität, Effizienz und Effektivität medi-zinischer und administrativer Abläufe wieder. Diese positiven Effekte werden im Rahmen der TA-Swiss-Studie insbesondere möglichen Kosten einer Einführung und des Betriebs des Dos-siers gegenübergestellt. Der stärkere Fokus auf die immateriellen Nutzenkriterien von eHealth-Services und die nur bedingte Betrachtung von finanziellen Aspekten kann somit die tendenziell positivere Nutzenbewertung des Services im Verhältnis zur TA-Swiss-Studie begründen.
5.5 Beurteilung Service „Überweisung“ am Beispiel eines Zuweiserportals Der zweite Service „Überweisung“, der von den Teilnehmenden des Evaluationsworkshops be-urteilt werden sollte, adressiert die Thematik der Ein-, Über- und Zuweisung von Patienten7. Wie beim Service „Medizinische Dokumentation“ wurde auch dieser Service anhand eines Beispiels, des Zuweiserportals, präsentiert und folgendermassen definiert: „Ziel des Zuweiserportals ist es, alle Prozesse und Datenflüsse für Anmeldung, Einbestellung, Eintritt und Austritt zwischen Leis-tungserbringern zu unterstützen. Im Zentrum steht die Planung von Ressourcen, Abläufen, die Erstellung von Berichten (beispielsweise Eintritts- und Austrittsbericht) usw. Diese kann interak-tiv (Web) oder nicht interaktiv (beispielsweise via EAI) erfolgen“.
Gleich wie im vorherigen Beispiel wurden zuerst die für die unterschiedlichen Akteurtypen zu-lässigen Nutzenkriterien beurteilt. Die Resultate der Einschätzung hinsichtlich des erwarteten Nutzens eines Zuweiserportals sind in Tabelle 10 dargestellt. Es können folgende Aussagen hin-sichtlich des erwarteten Nutzens eines Zuweiserportals gemacht werden:
• Die Akteure erwarten bei der Einführung eines Zuweiserportals, dass sich die Informati-
onsqualität, die Effektivität und die Behandlungssicherheit erhöhen. Jedoch sind sie sich einig, dass dieser Service keinen Einfluss auf die Gleichbehandlung, die Befähigung und das Vertrauen der Bürger hat.
• Leistungserbringer und Controller schätzen, dass die Einführung eines Zuweiserportals keine negativen Effekte zur Folge hat. Hingegen sind die Empfänger in Bezug auf den Faktor Befähigung & Vertrauen eher skeptisch und sehen insbesondere bei den Kriterien „Verständnis über Gesundheitsinformationen“ und „Gesundheitsbewusstsein der Bür-ger/Patienten“ einen negativen Effekt durch die Einführung eines solchen Service.
• Unterstützer erwarten, gleich wie beim Elektronischen Patientendossier, einen Zuwachs an administrativer Arbeit, während die Leistungserbringer eine Verbesserung der aktuel-len Situation sehen.
• Insgesamt schätzen die Empfänger im Vergleich zu den anderen Akteurtypen den Nutzen eines Zuweiserportals geringer ein. Dies ist vermutlich dadurch zu begründen, dass die Empfänger nur indirekt vom Service profitieren.
7 Ein in diesem Zusammenhang interessanter Projektbericht ist in [11] zu finden.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 42
Tabelle 10: Erwarteter Nutzen eines Zuweiserportals
Controller EmpfängerLeistungs-erbringer
Unter-stützer
B1: Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen
B2: Risiko von Behandlungsfehlern
B3: Risiko unerwünschter Transfusionsereignisse
B4: Medikations-/Radiologiebelastung der Patienten
B5: Risiko von Komplikationen
B6: Risiko falscher Medikamenteneinnahme
B7: Risiko von Fehlern in der Diagnoseunterstützung
BV1: Verständnis über Gesundheitsinformationen
BV2: Gesundheitsbewusstsein der Bürger/Patienten
BV3: Überblick über mögliche BehandlungsoptionenBV4: Akzeptanz der Behandlung
EF1: Fähigkeit zur Gestaltung von ProzessenEF2: Fähigkeit zur Steuerung von ProzessenEF3: Leistungsfähigkeit der Organisation
EF4: Erlernen von Fähigkeiten
EF5: Dauer der Ausführung von Tätigkeiten
EF6: Planbarkeit der Auslastung der Organisation
EZ1: Aufwand an administrativer Arbeit
EZ2: Fokus auf Kernaufgaben
EZ3: Verweildauer des Patienten
EZ4: Wartezeiten des Patienten
G1: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Alter
G2: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von HandicapG3: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von OrtG4: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Bildung
I1: Nachvollziehbarkeit von InformationenI2: Aktualität der InformationenI3: Verfügbarkeit von InformationenI4: Widerspruchsfreiheit von InformationenI5: Zugang zu InformationenI6: Redundanz/Doppelspurigkeit der Informationen
Akteurtyp Gesamt-beurteilung
Nutzenkriterien
Legende:
B: Kriterien des Nutzenfaktors Behandlungssicherheit Service hat negative Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium BV: Kriterien des Nutzenfaktors Befähigung & Vertrauen Service hat keine Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EF: Kriterien des Nutzenfaktors Effektivität Service hat positive Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EZ: Kriterien des Nutzenfaktors Effizienz G: Kriterien des Nutzenfaktors Gleichbehandlung I: Kriterien des Nutzenfaktors Informationsqualität
In Bezug auf die Rahmenbedingungen und organisationalen Grundvoraussetzungen für die Ein-führung eines Zuweiserportals ergibt sich das folgende Bild (vgl. Tabelle 11):
• Gleich wie beim Elektronischen Patientendossier schätzen die Akteure die Rahmenbe-dingungen im Vergleich zum Vorhandensein organisatorischer Grundvoraussetzungen insgesamt schlechter ein. Jedoch scheinen strukturelle Rahmenbedingungen weiter fort-geschritten zu sein, als gesetzliche, finanzielle und verhaltensbezogene Rahmenbedin-gungen.
• Die Befragten beurteilen die Bereitschaft strategischer und organisatorischer Grundvor-aussetzungen sowie ihre Befähigung zur Nutzung als hoch. Besonders die technische Inf-rastruktur scheint bei allen Beteiligten „bereit“ zu sein.
• Weniger Bereitschaft herrscht bei den Befragten in Bezug auf die Freisetzung von finan-ziellen Mitteln. Insbesondere Controller und Unterstützer bewerten diesen Punkt weniger hoch als Leistungserbringer.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 43
• Leistungserbringer beurteilen die Bereitschaft ihres Umfelds im Vergleich zu den ande-ren Akteuren generell etwas höher. Lediglich bei den organisatorischen Grundvorausset-zungen sehen sie im Vergleich zu den Controllern noch mehr Handlungsbedarf.
Tabelle 11: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung eines Zuweiserportals
ControllerLeistungs-
erbringer
Unter-
stützer
R1: Strukturelle Rahmenbedingungen
R2: Gesetzliche Rahmenbedingungen
R3: Finanzielle Rahmenbedingungen
R4: Wille zur Nutzung
V1: Strategische Grundvoraussetzungen
V2: Organisatorische Grundvoraussetzungen
V3: Applikationslandschaft
V4: Technische Infrastruktur
V5: Befähigung zur Nutzung
V6: Investitionsbereitschaft
Gesamt-beurteilung
Akteurtyp
Kontextfaktoren
Betrachtet man nun wiederum das Zusammenspiel zwischen Nutzengewichtung (Priorisierung der Nutzenfaktoren), erwartetem Nutzen (Beurteilung der Nutzenkriterien) und realisierbarem Nutzen (Beurteilung der Rahmenbedingungen und Grundvoraussetzungen), so können folgende finale Aussagen für den Service „Überweisung“ respektive für das Zuweiserportal aufgestellt werden (vgl. Abbildung 11):
• Alle Akteurtypen erwarten vom Zuweiserportal einen hohen Nutzen. Empfänger schätzen
diesen jedoch etwas geringer ein als beispielsweise Controller oder Leistungserbringer. • In Bezug auf den tatsächlich realisierbaren Nutzen unterscheiden sich vor allem die Ein-
schätzungen der Unterstützer und der Leistungserbringer. Während Leistungserbringer den realisierbaren Nutzen dieses Services als insgesamt hoch einschätzen, empfinden Empfänger und Controller diesen als mittelmässig bis hoch und Unterstützer als mittel-mässig.
• Insgesamt unterscheidet sich die Einschätzung des Nutzens für diesen Service nur margi-nal.
Niedrig HochMittel
Erwarteter Nutzen
Nie
dri
gH
och
Rea
lisie
rbar
er N
utz
en
Mit
tel
Controller
Empfänger
Leistungserbringer
Unterstützer
Abbildung 11: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen eines Zuweiserportals
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 44
5.6 Beurteilung Service „Gesundheitsportal“ Der dritte Service, den die teilnehmenden Personen des Evaluationsworkshops beurteilen sollten, war ein Gesundheitsportal. Der Service wurde den Teilnehmenden wie folgt beschrieben: „Das Ziel des Gesundheitsportals ist es, laienverständliche und vertrauenswürdige (ggf. zertifizierte) Gesundheitsinformationen bereit zu stellen und Zugriff auf das Elektronische Patientendossier (ohne direkte Interaktion zwischen Leistungserbringer und Empfänger) zu gewährleisten“8. Wie in den vorherigen Beispielen wurden zuerst die für die unterschiedlichen Akteurtypen zuläs-sigen Nutzenkriterien beurteilt. Die Resultate der Einschätzung hinsichtlich des erwarteten Nut-zens eines Gesundheitsportals sind in Tabelle 12 dargestellt.
Tabelle 12: Erwarteter Nutzen eines Gesundheitsportals
Controller EmpfängerLeistungs-erbringer
Unter-stützer
B1: Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen
B2: Risiko von Behandlungsfehlern
B3: Risiko unerwünschter Transfusionsereignisse
B4: Medikations-/Radiologiebelastung der Patienten
B5: Risiko von Komplikationen
B6: Risiko falscher Medikamenteneinnahme
B7: Risiko von Fehlern in der Diagnoseunterstützung
BV1: Verständnis über Gesundheitsinformationen
BV2: Gesundheitsbewusstsein der Bürger/Patienten
BV3: Überblick über mögliche BehandlungsoptionenBV4: Akzeptanz der Behandlung
EF1: Fähigkeit zur Gestaltung von ProzessenEF2: Fähigkeit zur Steuerung von ProzessenEF3: Leistungsfähigkeit der Organisation
EF4: Erlernen von Fähigkeiten
EF5: Dauer der Ausführung von Tätigkeiten
EF6: Planbarkeit der Auslastung der Organisation
EZ1: Aufwand an administrativer Arbeit
EZ2: Fokus auf Kernaufgaben
EZ3: Verweildauer des Patienten
EZ4: Wartezeiten des Patienten
G1: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Alter
G2: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von HandicapG3: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von OrtG4: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Bildung
I1: Nachvollziehbarkeit von InformationenI2: Aktualität der InformationenI3: Verfügbarkeit von InformationenI4: Widerspruchsfreiheit von InformationenI5: Zugang zu InformationenI6: Redundanz/Doppelspurigkeit der Informationen
Akteurtyp Gesamt-beurteilung
Nutzenkriterien
Legende: B: Kriterien des Nutzenfaktors Behandlungssicherheit Service hat negative Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium BV: Kriterien des Nutzenfaktors Befähigung & Vertrauen Service hat keine Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EF: Kriterien des Nutzenfaktors Effektivität Service hat positive Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EZ: Kriterien des Nutzenfaktors Effizienz G: Kriterien des Nutzenfaktors Gleichbehandlung I: Kriterien des Nutzenfaktors Informationsqualität
8 Um ein einheitliches Verständnis betr. Zweck und Funktionalität eines Gesundheitsportals bei den teilnehmenden Personen zu schaffen, wurde die verwendete Definition bewusst an [47] angelehnt.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 45
Auf Grundlage von Tabelle 12 können folgende Aussagen hinsichtlich des erwarteten Nutzens eines Gesundheitsportals gemacht werden:
• Im Gegensatz zu den bisher untersuchten Services, scheinen die Akteure einen positiven Effekt hinsichtlich der Befähigung und des Vertrauen der Bürger mit der Einführung ei-nes Gesundheitsportals zu erwarten. Insbesondere in Bezug auf die Akzeptanz der Be-handlung, den Überblick über Behandlungsoptionen sowie das Verständnis von Gesund-heitsinformationen sehen alle Akteure wesentliche Verbesserungen gegenüber der aktuel-len Situation.
• Weitere positive Effekte sehen die Befragten im Zugang zu Informationen, in der Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig vom Ort und in der Aktualität und Verfüg-barkeit von Informationen, obgleich die Leistungserbringer nicht ganz so positiv ge-stimmt waren, wie die anderen Akteurtypen.
• Mit keinen oder geringen positiven Effekten ist im Bereich der Effizienz und der Gleich-behandlung zu rechnen. Im Bereich der Effektivität scheinen Controller und Unterstützer in Bezug auf die Dauer der Ausführung von Tätigkeiten negative Effekte zu erwarten.
• In Bezug auf die Behandlungssicherheit erwarten die Leistungserbringer keine bis gering-fügig negative Effekte (siehe Medikationsbelastung der Patienten).
Hinsichtlich der organisatorischen Grundvoraussetzungen und externen Rahmenbedingungen haben die Befragten eine ähnliche Einschätzung geliefert wie bei der vorherigen Beurteilung des Zuweiserportals (vgl. Tabelle 11). Die Kontextfaktoren für die Einführung eines Gesundheits-portals wurden wie folgt beurteilt:
• Grundsätzlich scheinen strukturelle Vorbedingungen zur Einführung eines Gesundheits-portals vorhanden und umgesetzt zu sein, jedoch sind die Befragten der Meinung, dass bezüglich des Willens zur Nutzung eines solchen Services sowie bei gesetzlichen und fi-nanziellen Rahmenbedingungen noch Handlungsbedarf besteht. Unterstützer beurteilten diesen Bereich generell schlechter, als die Controller und Leistungserbringer.
• Wie bei den vorherigen Services wurde die Bereitschaft der technischen Infrastruktur im Vergleich zu den anderen organisationalen Grundvoraussetzungen relativ hoch bewertet. Im Allgemeinen haben Leistungserbringer eine hohe Bereitschaft signalisiert, während Controller und Unterstützer Bereiche wie die Investitionsbereitschaft oder Applikations-landschaft weniger positiv einschätzten.
• Insgesamt wurden die finanziellen Rahmenbedingungen und die Bereitschaft eine Investi-tion in diesem Bereich zu tätigen im Vergleich zu den vorherigen Services schlechter eingestuft. Dadurch wird der tatsächlich realisierbare Nutzen eines Gesundheitsportals stark gemindert.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 46
Tabelle 13: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung eines Gesundheitsportals
ControllerLeistungs-
erbringer
Unter-
stützer
R1: Strukturelle Rahmenbedingungen
R2: Gesetzliche Rahmenbedingungen
R3: Finanzielle Rahmenbedingungen
R4: Wille zur Nutzung
V1: Strategische Grundvoraussetzungen
V2: Organisatorische Grundvoraussetzungen
V3: Applikationslandschaft
V4: Technische Infrastruktur
V5: Befähigung zur Nutzung
V6: Investitionsbereitschaft
Gesamt-beurteilung
Akteurtyp
Kontextfaktoren
Wird, wie bei den vorherigen beiden Services, der erwartete Nutzen dem realisierbaren Nutzen gegenüber gestellt (vgl. Tabelle 13), so können folgende finale Aussagen daraus abgeleitet wer-den:
• Alle Akteurtypen erwarten von der Einführung eines Gesundheitsportals positive Effekte in Bezug auf den Nutzen. Die Gruppe der Empfänger beurteilten den erwarteten Nutzen sogar als überaus hoch, während die anderen Akteure diesen etwas geringer einschätzen.
• Hinsichtlich des realisierbaren Nutzens unterscheiden sich die Akteure insofern, dass Leistungserbringer diesen als mittelmässig bis hoch, die übrigen Akteurtypen diesen als eher mittelmässig einstufen.
Niedrig HochMittel
Erwarteter Nutzen
Nie
dri
gH
och
Rea
lisie
rbar
er N
utz
en
Mit
tel
Controller
Empfänger
Leistungserbringer
Unterstützer
Abbildung 12: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen eines Gesundheitsportals
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 47
5.7 Beurteilung Service „Leistungsstatistik“ Zuletzt wurden die Teilnehmenden des Evaluationsworkshops gebeten den Service „Leistungs-statistik“ hinsichtlich des erwarteten und realisierbaren Nutzens zu beurteilen. Der Service wurde vorab wie folgt erklärt: „Ziel des Service Leistungsstatistik ist die Sammlung und Bereitstellung von Daten, welche sich mit der Qualität, der Effizienz und den Kosten der im Gesundheitswesen erbrachten Leistungen (Outcome) beschäftigt“. Im Gegensatz zum Service „Medizinische Statis-tik“, welche die wesentlichen Funktionen für die Sammlung und Bereitstellung von Daten, wel-che sich mit der Verbreitung von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereignissen der Bevölke-rung (Epidemiologie) bereit stellt, steht bei dem von den teilnehmenden Personen zu beurteilen-den Service demzufolge die mit der Erbringung einer Leistung zusammenhängenden Daten (bei-spielsweise Behandlungskosten, Verweildauer, Patientenzufriedenheit etc.) im Zentrum. Die Ergebnisse der Einschätzung des erwarteten Nutzens eines solchen Services sind in Tabelle 14 dargestellt.
Tabelle 14: Erwarteter Nutzen einer Leistungsstatistik
Controller EmpfängerLeistungs-erbringer
Unter-stützer
B1: Risiko unerwünschter Arzneimittelwirkungen
B2: Risiko von Behandlungsfehlern
B3: Risiko unerwünschter Transfusionsereignisse
B4: Medikations-/Radiologiebelastung der Patienten
B5: Risiko von Komplikationen
B6: Risiko falscher Medikamenteneinnahme
B7: Risiko von Fehlern in der Diagnoseunterstützung
BV1: Verständnis über Gesundheitsinformationen
BV2: Gesundheitsbewusstsein der Bürger/Patienten
BV3: Überblick über mögliche BehandlungsoptionenBV4: Akzeptanz der Behandlung
EF1: Fähigkeit zur Gestaltung von ProzessenEF2: Fähigkeit zur Steuerung von ProzessenEF3: Leistungsfähigkeit der Organisation
EF4: Erlernen von Fähigkeiten
EF5: Dauer der Ausführung von Tätigkeiten
EF6: Planbarkeit der Auslastung der Organisation
EZ1: Aufwand an administrativer Arbeit
EZ2: Fokus auf Kernaufgaben
EZ3: Verweildauer des Patienten
EZ4: Wartezeiten des Patienten
G1: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Alter
G2: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von HandicapG3: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von OrtG4: Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Bildung
I1: Nachvollziehbarkeit von InformationenI2: Aktualität der InformationenI3: Verfügbarkeit von InformationenI4: Widerspruchsfreiheit von InformationenI5: Zugang zu InformationenI6: Redundanz/Doppelspurigkeit der Informationen
Akteurtyp Gesamt-beurteilung
Nutzenkriterien
Legende:
B: Kriterien des Nutzenfaktors Behandlungssicherheit Service hat negative Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium BV: Kriterien des Nutzenfaktors Befähigung & Vertrauen Service hat keine Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EF: Kriterien des Nutzenfaktors Effektivität Service hat positive Wirkung in Bezug auf Nutzenkriterium EZ: Kriterien des Nutzenfaktors Effizienz G: Kriterien des Nutzenfaktors Gleichbehandlung I: Kriterien des Nutzenfaktors Informationsqualität
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 48
Auf Grundlage von Tabelle 14 können folgende Aussagen hinsichtlich des erwarteten Nutzens einer Leistungsstatistik gemacht werden:
• Alle Akteure erwarten vom Service „Leistungsstatistik“ keine wesentlichen Verbesserun-gen in Bezug auf die Behandlungssicherheit und Gleichbehandlung der Patienten und Bürger. Controller, welche den Service insgesamt am positivsten bewertet haben, erhof-fen sich wesentliche Verbesserungen bezüglich Effektivität und Informationsqualität. Für die anderen Akteure entstehen situative Vor- oder Nachteile.
• Positive Effekte erhoffen sich die meisten Befragten im Hinblick auf die Akzeptanz der Behandlung, der Fähigkeit zur Gestaltung und Steuerung von Prozessen sowie bei der Verfügbarkeit von und dem Zugang zu Informationen.
• Während Controller und Unterstützer mit gleich bleibenden und positiven Wirkungen rechnen, erwarten Leistungserbringer Verschlechterungen in den Punkten „Leistungsfä-higkeit der Organisation“, „Dauer für die Ausführung von Tätigkeiten“, „Aufwand ad-min. Arbeit“ und „Fokus auf Kernaufgaben“. Hingegen sieht die Gruppe der Empfänger negative Auswirkungen betreffend der Redundanz der zur Verfügung stehenden Informa-tionen.
Im Allgemeinen wurden die organisationalen Grundvoraussetzungen und externen Rahmenbe-dingungen im Vergleich zu den anderen beurteilten Services etwas schlechter eingeschätzt (vgl. Tabelle 15):
• Insbesondere Controller und Unterstützer scheinen die externen Rahmenbedingungen als noch zu wenig „bereit“ für die Einführung einer Leistungsstatistik zu empfinden.
• Leistungserbringer scheinen im Vergleich zu den anderen Akteuren die Voraussetzung en zur Einführung und Nutzung eines solchen Services relativ hoch einzuschätzen, speziell in Bezug auf strategische Grundvoraussetzungen und Investitionsbereitschaft.
• Wie beim vorherigen Service „Gesundheitsportal“ scheinen die finanziellen Rahmenbe-dingungen und die Bereitschaft zu investieren auch bei diesem Service eher gering zu sein. Dafür scheinen alle anderen Grundvoraussetzungen vorhanden zu sein.
Tabelle 15: Einschätzung der Kontextfaktoren im Rahmen der Einführung einer Leistungsstatistik
ControllerLeistungs-
erbringer
Unter-
stützer
R1: Strukturelle Rahmenbedingungen
R2: Gesetzliche Rahmenbedingungen
R3: Finanzielle Rahmenbedingungen
R4: Wille zur Nutzung
V1: Strategische Grundvoraussetzungen
V2: Organisatorische Grundvoraussetzungen
V3: Applikationslandschaft
V4: Technische Infrastruktur
V5: Befähigung zur Nutzung
V6: Investitionsbereitschaft
Gesamt-beurteilung
Akteurtyp
Kontextfaktoren
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 49
Analysiert man, wie bei den vorherigen Beispielen, die Verbindung zwischen Nutzengewicht, erwartetem Nutzen und dem realisierbaren Nutzen, so können folgende finalen Aussagen ge-macht werden (vgl. Abbildung 13):
• Alle Akteurtypen erwarten von der Einführung einer Leistungsstatik einen mittleren bis hohen Nutzen. Controller schätzen diesen etwas höher ein als beispielsweise Empfänger oder Leistungserbringer.
• In Bezug auf den tatsächlich realisierbaren Nutzen unterscheiden sich vor allem die Ein-schätzungen der Leistungserbringer und Controller. Während Leistungserbringer den rea-lisierbaren Nutzen dieses Services als insgesamt hoch einschätzen, empfinden Controller und Unterstützer diesen als mittelmässig.
Niedrig HochMittel
Erwarteter Nutzen
Nie
dri
gH
och
Rea
lisie
rbar
er N
utz
en
Mit
tel
Controller
Empfänger
Leistungserbringer
Unterstützer
Abbildung 13: Erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen einer Leistungsstatistik
5.8 Zusammenfassende Betrachtung der beurteilten Services Bei der Einführung einer nationalen eHealth-Infrastruktur, wie sie in der Schweiz vorgesehen ist, sollte nicht nur der Nutzen eines einzelnen Service, sondern der Gesamtheit aller geplanten Ser-vices betrachtet werden, da diese aufeinander aufbauen oder miteinander interagieren (beispiels-weise bietet das geplante Gesundheitsportal einen integrierten Zugriff auf das Elektronische Pa-tientendossier). Demzufolge sollte nebst der Betrachtung der einzelnen Services stets eine ab-schliessende Gesamtbeurteilung erfolgen. Eine aggregierte Sicht der Wirkungen (im Sinne ag-gregierter Wirkungsbündel) in Bezug auf die einzelnen Nutzenfaktoren ist in Abbildung 14 dar-gestellt.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 50
Abbildung 14: Aggregierte Wirkungsbündel in Bezug auf die einzelnen Nutzenfaktoren
Daraus werden folgende Punkte ersichtlich:
• Alle betrachteten Services haben nur sehr schwache positive oder negative Wirkungen in Bezug auf die Gleichbehandlung von Bürgern und Patienten.
• In Hinblick auf die Informationsqualität wirken sich insbesondere das Elektronische Pati-entendossier, das Zuweiserportal und die Leistungsstatistik positiv aus. Vom Gesund-heitsportal ist mit nur schwachen positiven Effekten zu rechnen.
• Positive Effekte in Bezug auf die Effektivität des täglichen Handelns gehen vom Elektro-nischen Patientendossier und vom Zuweiserportal aus. Die Leistungsstatistik hat diesbe-züglich eine schwach positive, das Gesundheitsportal eine schwach negative Wirkung.
• Ebenfalls positiv wirken sich das Elektronischen Patientendossier und das Zuweiserportal bezüglich der Behandlungssicherheit aus. Die anderen Services haben hier keinen Effekt.
• Auf die Befähigung und das Vertrauen wirkt sich das Gesundheitsportal positiv aus, wäh-rend Leistungsstatistik lediglich eine schwach positive, das Elektronische Patientendos-sier und das Zuweiserportal keine Wirkung besitzen.
• Schlussendlich hat das Elektronische Patientendossier als einziger Service eine positive Wirkung in Bezug auf die Effizienz des täglichen Handelns. Das Zuweiserportal und das Gesundheitsportal haben keinen, die Leistungsstatistik sogar einen negativen Effekt.
Bezüglich der unterschiedlichen Wahrnehmung des Nutzens durch die vier befragten Akteurty-pen kann, unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Stichprobe (vgl. Abschnitt 5.1), festgestellt werden, dass insgesamt der grösste Nutzen der vier analysierten eHealth-Services in den Bereichen Informationsqualität, Effektivität und Behandlungssicherheit gesehen wird. Be-zügliche der Behandlungssicherheit bilden die Leistungserbringer eine Ausnahme, da sie eine schwächere Auswirkung auf diesen Nutzenfaktor sehen, welcher durch den Einsatz anderer qua-litätssichernder Massnahmen dieses Akteurtyps (Standardabläufe, klinische Behandlungspfade, etc.) begründet sein kann. Die Nutzenwirkung auf den Faktor Effizienz wird insbesondere durch die Controller vergleichsweise gering eingeschätzt. Da dieser Faktor einen engen Zusammen-hang mit den Kosten der Gesundheitsversorgung aufweist, sollte vor der Einführung der eHealth-Services eine detaillierte Analyse der zu erwartenden Kosten durchgeführt werden. Eine aggregierte Sicht auf die Bereitschaft des Schweizerischen eHealth-Umfeldes wird in Abbildung 15 illustriert. Aus Sicht der Akteurtypen kann festgestellt werden, dass die Leistungs-
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 51
erbringer die Rahmenbedingungen durchschnittlich um 0,7 Skalenpunkte positiver einschätzen, als die Controller und Unterstützer.
Abbildung 15: Aggregierte Sicht auf die Kontextfaktoren
Es fällt auf, dass
• die befragten Personen dazu tendieren, organisatorische Grundvoraussetzungen grund-sätzlich besser einzustufen als die externen, von Staat und Gesellschaft vorgegebenen, Rahmenbedingungen,
• die finanziellen Rahmenbedingungen und die Bereitschaft Investitionen zu tätigen im Vergleich zu den anderen Kontextfaktoren prinzipiell schlechter bewertet wurden,
• die organisationalen Voraussetzungen für die Einführung und Nutzung eines Elektroni-schen Patientendossiers vorhanden sind,
• strategische, organisatorische und finanzielle Voraussetzungen für die Einführung eines Gesundheitsportals zu schaffen sind,
• die technische Infrastruktur bei allen beurteilten Services weit fortgeschritten ist, • die Befähigung zur Nutzung der Services grundsätzlich vorhanden ist, jedoch der Wille
nicht überall vorhanden ist.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 52
6 Zusammenfassung und Ausblick In der vorliegenden Studie wurde gezeigt, welche Ziele mit eHealth verfolgt und welche Servi-ces in welchen Prozessen für welche Akteure dafür benötigt werden. Nach einer Einführung in die Thematik der Nutzenevaluation und der Evaluationsforschung im Kontext von eHealth sowie der Schaffung eines Überblicks über aktuelle Evaluationsstudien zu eHealth-Services und Vor-haben wurde festgestellt, dass keine Methoden für die ex ante Beurteilung des Nutzens von eHealth-Serives etabliert sind. Eine solche Methode wird in der gegenwärtigen Lage für die Schweiz jedoch benötigt. In der Folge wurde zur ex ante Bewertung von eHealth-Services eine entsprechende Methode entwickelt. Diese konnte mit einer Pre-Test-Fokusgruppe erfolgreich getestet werden und durch eine weitere grössere Fokusgruppe anschliessend auf vier ausgesuchte und spezifizierte eHealth-Services angewendet werden. Untersucht wurde der Einsatz - auf nati-onaler Ebene - der folgenden Services:
• "Elektronisches Patientendossier", • "Überweisung", • "Gesundheitsportal", • "Leistungsstatistik".
Schlussendlich scheinen erwarteter Nutzen und realisierbarer Nutzen bei allen beurteilten Servi-ces nahe beieinander zu liegen (vgl. Abbildung 16). Der erwartete Nutzen ist beim Gesundheits-portal am grössten, während der grösste realisierbare Nutzen beim Elektronischen Patientendos-sier liegt. Die Betrachtung des Nutzens in unterschiedlichen Dimensionen aus der Sicht der un-terschiedlichen Stakeholder des Gesundheitswesens hat gezeigt, dass sich sowohl ein potenziel-ler und ein um Kontextfaktoren (Voraussetzungen, Rahmenbedingungen) korrigierter Gesamt-nutzen pro eHealth-Service aggregieren und darstellen lässt, um Entscheidungsgrundlagen für entsprechende Vorhaben zu gewinnen. Alle vier untersuchten Services wurden durch die Fokus-gruppe insgesamt positiv beurteilt.
Abbildung 16: Erwarteter und realisierbarer Nutzen der Services
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 53
Für den künftigen Einsatz und die Weiterentwicklung der Methode, welche die Beurteilung der potenziellen Wirkung eines Services durch die Stakeholder des Gesundheitswesen ermöglicht, sind die folgenden Erkenntnisse zu beachten:
• Der Nutzen von eHealth ist ein vielschichtiger Wert und kann nicht auf eine konkrete (beispielsweise monetäre) Grösse reduziert werden; die Studie basiert darum primär auf qualitativen Nutzenkriterien.
• Die Stakeholder haben stark unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich der Nutzengewich-tung.
• Ex ante können lediglich Thesen zum Nutzen aufgestellt werden. • Um die Thesen zu überprüfen muss eine weitere Nutzenevaluation während und nach der
Implementierung der nationalen Services erfolgen.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 54
7 Literaturverzeichnis [1] J. Aarts, und M. Berg, A Tale of Two Hospitals: A Sociotechnical Appraisal of the Intro-
duction of Computerized Physician Order Entry in Two Dutch Hospitals, Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 107, Nr. 999-1002, 2004.
[2] W. G. Adams, A. M. Mann, und H. Bauchner, Use of an Electronic Medical Record Im-proves the Quality of Urban Pediatric Primary Care, Pediatrics, Vol. 111, Nr. 3, S. 626-632, 2003.
[3] E. Ammenwerth, und N. de Keizer, An inventory of evaluation studies of information technology in health care: Trends in evaluation research 1982 - 2002, in MEDINFO 2004: Proceedings of the 11th World Congress on Medical Informatics, M. Fieschi, E. Coiera und Y.-C. J. Li (Hrsg.) Amsterdam: IOS Press, 2004, S. 1289--1294.
[4] E. Ammenwerth, und N. de Keizer, An Inventory of Evaluation Studies of Information Technology in Health Care: Trends in Evaluation Research 1982 - 2002, Methods of In-formation in Medicine, Vol. 44, Nr. 1, S. 44-56, 2005.
[5] E. Ammenwerth, U. Mansmann, C. Iller et al., Factors Affecting and Affected by User Acceptance of Computer-based Nursing Documentation: Results of a Two-year Study, Journal of the American Medical Informatics Association, Vol. 10, Nr. 69-84, 2003.
[6] J. G. Anderson, C. E. Aydin, und S. J. Jay, Evaluating Health Care Information Systems - Methods and Applications, London, New Delhi: Sage Publications, 1994.
[7] B. Bergh, Fallbeispiel Heidelberg: Schlussfolgerungen für das Nutzenpotential von eHealth, Zentrum für Informations- und Medizintechnik ZIM, UniversitätsKlinikum Hei-delberg, 2009.
[8] R. Bernnat, Kosten-Nutzen-Analyse der Einrichtung einer Telematik-Infrastruktur im deutschen Gesundheitswesen, Booz Allen Hamilton GmbH, Düsseldorf, 2006.
[9] M. J. Blutt. (2001). The Rise & Fall and ??? Of e-Health, [Online]. Abrufbar unter: http://www.upenn.edu/ldi/healthpolicyseminarjan26_Jan.%2022%20'01.ppt.
[10] B. Bogucki, B. J. Jacobs, und J. Hingle, Computerized Reminders Reduce the Use of Me-dications during Shortages, Journal of the American Medical Informatics Association, Vol. 11, Nr. 4, S. 278-280, 2004.
[11] W. M. Bugnar. (2006). eUZE – elektronische Überweisung / Zuweisung/Einweisung: Ge-schäftsprozessanalyse Teilprojekt Wien, [Online]. Abrufbar unter: http://portal.wko.at/wk/dok_detail_file.wk?AngID=1&DocID=709445&StID=337497.
[12] Bundesamt für Gesundheit, Strategie "eHealth" Schweiz, Bern, 2007. [13] Bundesamt für Gesundheit, eHealth Schweiz - Zwischenbericht Teilprojekt Online-Dienste
und Befähigung, Bundesamt für Gesundheit (BAG), Bern, 2008. [14] Bundesamt für Gesundheit. (2008). Häufige Fragen zum Thema eHealth, [Online]. Abruf-
bar unter: http://www.bag.admin.ch/einheitskasse/03406/index.html?lang=de. [15] J. Car, A. Black, C. Anandan et al., The Impact of eHealth on the Quality & Safety of
Healthcare, NHS Connecting for Health Evaluation Programm, London, 2008. [16] K. Channabasavaiah, K. Holley, und E. M. Tuggle. (2003). Migrating to a service-oriented
architecture, Part 1, [Online]. Abrufbar unter: http://www-106.ibm.com/developerworks/library/ws-migratesoa/.
[17] J. S. Clark, F. S. Mair, C. O'Donnell et al., E-Health: Implementation and Evaluation Re-search in Scotland – A Scoping Exercise, Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 14, Nr. 3, S. 119-121, 2008.
[18] N. A. D. Connell, und T. P. Young, Evaluating Healthcare Information Systems Through an "Enterprise" Perspective, Journal of Information \& Management, Vol. 44, Nr. 433-440, 2007.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 55
[19] J. M. Cortina, What is Coefficient Alpha? Examination of Theory and Applications, Jour-nal of Applied Psychology, Vol. 78, Nr. 1, S. 98-104, 1993.
[20] B. Curtis, M. I. Kellner, und J. Over, Process Modeling, Communications of the ACM, Vol. 35, Nr. 9, S. 75-90, 1992.
[21] T. H. Davenport, und J. E. Short, The New Industrial Engineering: Information Technol-ogy and Business Process Redesign, Sloan Management Review, Vol. 31, Nr. 4, S. 11-27, 1990.
[22] Debold & Lux, Die Versichertenkarte und der Aufbau einer Telematikinfrastruktur - Kos-ten-Nutzen-Analyse, Hamburg, 2006.
[23] W. H. DeLone, und E. R. McLean, Information Systems Success - The Quest for the De-pendent Variable, Information System Research, Vol. 3, Nr. 1, S. 60--95, 1992.
[24] C. Delpierre, L. Cuzin, J. Fillaux et al., A Systematic Review of Computer-Based Patient Record Systems and Quality of Care: More Randomized Clinical Trials or a Broader Ap-proach?, International Journal for Quality in Health Care, Vol. 16, Nr. 5, S. 407-416, 2004.
[25] J. S. Dumas, User-based Evaluations, in The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, A. Sears (Hrsg.) New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2003.
[26] M. Eiholzer, A. Frias, und S. Gaiser, Evaluation der E-Health-Anwendung Stop-Simply.de, Fachhochschule Nordwestschweiz Olten, 2008.
[27] N. Ellen, M. McKee, und S. Wait, Describing and evaluating health systems, in Handbook of Health Research Methods, A. Bowling und S. Ebrahim (Hrsg.) Maidenhead, UK: Open University Press, 2005, S. 12-43.
[28] Europäische Union, Building the Information Society: The Telematics Applications Pro-gramme 1994-1998, Brüssel, 1996.
[29] Europäische Union. (2008). Good eHealth, [Online]. Abrufbar unter: http://www.good-ehealth.org.
[30] Europäische Union. (2008). What is eHealth?, [Online]. Abrufbar unter: http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/whatis_ehealth/index_en.htm.
[31] G. Eysenbach. (2001). What is e-health?, [Online]. Abrufbar unter: http://www.jmir.org/2001/2/e20/.
[32] U. Frank, Evaluation von Artefakten in der Wirtschaftsinformatik, in Evaluation und Eva-luationsforschung in der Wirtschaftsinformatik, L. Heinrich und I. Häntschel (Hrsg.) Mün-chen, Wien: Oldenbourg, 2000, S. 35-48.
[33] E. R. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Boston, MA: Pitman, 1984.
[34] C. Friedman, und J. C. Wyatt, Evaluation Methods in Medical Informatics, New York: Springer, 1997.
[35] C. Frings. (2009). Multivariate Verfahren Faktoranalyse & Co., [Online]. Abrufbar unter: www.uni-saarland.de/fak5/excops/download/faktor.pdf.
[36] R. D. Galliers, M. L. Markus, S. Newell (Hrsg.), Exploring Information Systems Research Approaches, London, New York: Routledge, 2007.
[37] V. Govindarajan, und J. K. Shank, Strategic Cost management: Tailoring Controls to Strategies, in Readings and issues in cost management, J. M. Reeve (Hrsg.) New York, NY: Warren Gorham and Lamont, 1995.
[38] D. Green, und T. Young, Value Propositions for Information Systems in Healthcare in, 1-9. [39] P. Haas, eHealth verändert das Gesundheitswesen - Grundlagen, Anwendungen, Konse-
quenzen, HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik, Vol. 251, Nr. 6-19, 2006. [40] S. R. Haynes, S. Purao, und A. L. Skattebo, Situating Evaluation in Scenarios of Use, in
Proceedings of 2004 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work. Chi-cago, 2004, S. 92-101.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 56
[41] A. Hein, W. Thoben, H.-J. Appelrath et al., Preface, in Proceedings of the 2nd European Conference on eHealth, Lecture Notes in Informatics, Bonn: Gesellschaft für Informatik, 2007.
[42] M. Helfert, S. Leist, G. Zellner et al., Process Improvement in healthcare based on critical performance indicators, in Proceedings of Workshop " Potenziale des Informations- und Wissensmanagements". Bern, 2005, S. 1-15.
[43] E. R. House, Professional Evaluation: Social Impact and Political Consequences, Newbury Park: Sage Publications, 1993.
[44] H. F. Kaiser, und J. Rice, Little Jiffy, Mark IV, Educational and Psychological Measure-ment, Vol. 34, Nr. 1, S. 111-117, 1974.
[45] R. Kaushal, D. Blumenthal, E. G. Poon et al., The Costs of a National Health Information Network, Annals of Internal Medicine, Vol. 143, Nr. 3, S. 165-173, 2005.
[46] A. Kazanjian, und C. J. Green, Beyond effectiveness: the evaluation of information sys-tems using A Comprehensive Health Technology Assessment Framework, Computers in Biology and Medicine, Vol. 32, Nr. 3, S. 165-177, 2002.
[47] Koordinationsorgan eHealth. (2009). eHealth Schweiz: Zwischenbericht Teilprojekt Onli-ne-Dienste und Befähigung, [Online]. Abrufbar unter: http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/04108/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkId2fnp7bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==.
[48] R. Koppel, J. P. Metlay, A. Cohen et al., Role of Computerized Physician Order Entry Sys-tems in Facilitating Medication Errors, Journal of the American Medical Association, Vol. 293, Nr. 10, S. 1197-1203, 2005.
[49] M. Krämer, T. Norgal, und T. Penzel, Short Strategic Study: Strategies for harmonisation and integration of device-level and enterprise-wide methodologies for communication as applied to HL7, LOINC and ENV 13734, CEN/TC 251/N01-033rev2 Europäisches Ko-mitee für Normung, Stockholm, 2001.
[50] H. Laerum, T. Karlsen, und A. Faxvaag, Use of and Attitudes to a Hospital Information System by Medical Secretaries, Nurses and Physicians Deprived of the Paper-Based Medi-cal Record: A Case Report, BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol. 4, Nr. 1, S. 18, 2004.
[51] H. Laerum, T. H. Karlsen, und A. Faxvaag, Effects of Scanning and Eliminating Paper-based Medical Records on Hospital Physicians' Clinical Work Practice, Journal of the American Medical Informatics Association, Vol. 10, Nr. 6, S. 588-595, November 1, 2003, 2003.
[52] P. Langkafel, D. Ralfs, und H. Deutsch, Von eHealth zu €Health? Studie zur Nutzenbewer-tung von eHealth aus Kliniksicht, Accenture/SAP eHealth Allianz, St. Leon-Rot, 2007.
[53] R. Lenz, M. Beyer, C. Meiler et al., Informationsintegration in Gesundheitsversorgungs-netzen - Herausforderungen an die Informatik, Informatik Spektrum, Vol. 22, Nr. 105-119, 2005.
[54] A. Likourezos, D. B. Chalfin, D. G. Murphy et al., Physician and Nurse Satisfaction with an Electronic Medical Record System, Journal of Emergency Medicine, Vol. 27, Nr. 4, S. 419-424, 2004.
[55] D. Lovallo, und D. Kahneman, Delusions of success. How optimism undermines execu-tives' decisions, Harv Bus Rev, Vol. 81, Nr. 7, S. 56-63, 2003.
[56] V. Mantzana, M. Themistocleous, Z. Irani et al., Identifying healthcare actors involved in the adoption of information systems, European Journal of Information Systems, Vol. 16, Nr. 1, S. 91-102, 2007.
[57] J. H.Mayer und R. Winter, Anforderungsanalyse für ein One-Page-Reporting - Funktions-bestimmung, Gestaltungsziele und Entwicklungsstand, Tagungsband der MKWI 2008, 2008.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 57
[58] T. Mettler, und P. Rohner, An Analysis of the Factors Influencing Networkability in the Healthcare Sector, Health Services Management Research (in press), 2009.
[59] T. Mettler, und P. Rohner, Faktoren zur Steigerung der Vernetzungsfähigkeit im Gesund-heitswesen, Gesundheitsökonomie und Qualitätsmanagement (in press), 2009.
[60] T. Mettler, P. Rohner, und L. Baacke, Improving Data Quality in Health Information Sys-tems: A Holistic Design-oriented Approach, in Proceedings of 16th European Conference on Information Systems. Galway, Ireland, 2008, S. 1883-1893.
[61] E. Mitchell, und F. Sullivan, A descriptive feast but an evaluative famine: systematic re-view of published articles on primary care computing during 1980-97, British Medical Journal, Vol. 322, Nr. 7281, S. 279-282, 2001.
[62] Neue Zürcher Zeitung. Sparen mit elektronischer Gesundheitskarte, 15. 12. 2006. [63] J. Neuhaus, W. Deiters, und M. Wiedler, Mehrwertdienste im Umfeld der elektronischen
Gesundheitskarte, Informatik Spektrum, Vol. 29, Nr. 5, S. 332-340, 2006. [64] H. Oh, C. Rizo, M. Enkin et al., What Is eHealth (3): A Systematic Review of Published
Definitions, Journal of Medical Internet Research, Vol. 7, Nr. 1, S. e1, 2005. [65] Ontario Hospital eHealth Council. (2001). An eHealth Blueprint: Setting the Course For
Action, [Online]. Abrufbar unter: http://www.oha.com/oha/reports.nsf/($Att)/ pspr55vmtq/$FILE/eHealthBlueprintDecember2001.pdf?OpenElement.
[66] C. Pagliari, Design and Evaluation in eHealth: Challenges and Implications for an Interdis-ciplinary Field, Journal of Medical Internet Research, Vol. 9, Nr. 2, S. e15, 2007.
[67] C. Pagliari, D. Sloan, P. Gregor et al., What is eHealth (4): A scoping exercise to map the field, Journal of Medical Internet Research, Vol. 7, Nr. 1, S. e9, 2005.
[68] R. Pawson, und N. Tilley, Realistic Evaluation, London: Sage Publications, 1997. [69] D. D. Persaud, S. Jreige, C. Skedgel et al., An Incremental Cost Analysis of Telehealth in
Nova Scotia from a Societal Perspective, Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 11, Nr. 2, S. 77-84, 2005.
[70] R. Pfister, M. Dutta, und C. Kosmoski, Consumer Evaluation of E-Health Information Quality: The Role of Processing Styles and Decision-Making, in Proceedings of NCA 94th Annual Convention. San Diego, USA, 2008.
[71] R. Pretlow. (2000). eHealth International: A Cutting Edge Company For A New Age In Health Care, [Online]. Abrufbar unter: http://www.ehealthnurse.com/ehealthi.html.
[72] J. Pries-Heje, R. Baskerville, und J. Venable, Strategies for Design Science Research Eval-uation in Proceedings of 16th European Conference on Information Systems. Galway, Ir-land, 2008, S. 255-266.
[73] B. Rahimi, und V. Vimarlund, Methods to Evaluate Health information Systems in Health-care Settings: A Literature Review, Journal of Medical Systems, Vol. 31, Nr. 5, S. 397-432, 2007.
[74] L. Rey, Für ein effizienteres Gesundheitswesen, eHealth publifocus und elektronisches Patientendossier, Bericht eines Dialogverfahrens, Bern: Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung, 2008.
[75] E. Ronchi, HEALTH ICT: Indicators for international comparisons of health ICT adoption and use, DELSA/HEA(2008)15, Oecd, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, Paris, 2008.
[76] J. Rüegg-Stürm, Das neue St. Galler Management-Modell - Grundkategorien einer integ-rierten Managementlehre - Der HSG-Ansatz, 2 Aufl., Bern-Stuttgart-Wien: Haupt, 2003.
[77] C. M. Ruland, und I. H. Ravn, Usefulness and Effects on Costs and Staff Management of a Nursing Resource Management Information System, Journal of Nursing Management, Vol. 11, Nr. 3, S. 208-215, 2003.
[78] M. Schmid, und J. Wang, Der Patient der Zukunft: Das Arzt-Patienten-Verhältnis im Um-bruch, Schweizerische Ärztezeitung, Vol. 84, Nr. 41, S. 2133-2135, 2003.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 58
[79] N. Schmitt, Uses and Abuses of Coefficient Alpha,, Psychological Assessment, Vol. 8, Nr. 4, S. 350-353, 1996.
[80] D. Silber, The Case for eHealth, in E-Health: Current Situation and Examples of Imple-mented and Beneficial E-Health Applications, I. Iakovidis, P. Wilson und H. J. C. (Hrsg.) Amsterdam et al.: IOS Press, 2004, S. 3-27.
[81] St. Galler Tagblatt. St. Galler Leaderrolle bei E-Health 13. 11. 2006. [82] D. Stengel, K. Bauwens, M. Walter et al., Comparison of Handheld Computer-Assisted
and Conventional Paper Chart Documentation of Medical Records. A Randomized, Con-trolled Trial, Journal of Bone and Joint Surgery, Vol. 86, Nr. 3, S. 553-560, 2004.
[83] A. Street, The Contribution of ICT to Health Care System Productivity and Efficiency: What Do We Know?, DELSA/HEA/ICT/RD(2007)1, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Directorate for Employment Labour and Social Af-fairs, Paris, 2007.
[84] K. A. Stroetmann, T. Jones, A. Dobrev et al., eHealth is Worth it: The economic benefits of implemented eHealth solutions at ten European sites, eHealth Impact, Luxemburg, 2006.
[85] M. F. Thouin, J. J. Hoffman, und E. W. Ford, The effect of information technology in-vestment on firm-level performance in the health care industry, Health Care Manage Rev, Vol. 33, Nr. 1, S. 60--68, 2008.
[86] M. Tohen, E. Bromet, J. M. Murphy et al., Psychiatric Epidemiology, Harvard Review of Psychiatry, Vol. 8, Nr. 3, S. 111-125, 2000.
[87] J. Van Bemmel, und M. A. Musen, Handbook of Medical Informatics, New York: Sprin-ger, 1997.
[88] Verein für Informatik im Gesundheitswesen. (2008). eHealth, [Online]. Abrufbar unter: http://www.sg.ch/home/gesundheit/organisation_gd/informatik_vig/ehealth.html.
[89] S. G. Walter, und T. W. Spitta, Approaches to the Ex-ante Evaluation of Investments into Information Systems Wirtschaftsinformatik, Vol. 46, Nr. 3, S. 171-180, 2004.
[90] S. J. Wang, B. Middleton, C. G. Bardon et al., A Cost-benefit Analysis of Electronic Med-ical Records in Primary Care, The American Journal of Medicine, Vol. 114, Nr. 5, S. 397-403, 2003.
[91] G. A. Welty, The Logic of Evaluation, Educational Resources Institute, 1968. [92] A. M. Wicks, Competing values in healthcare: balancing the (un)balanced scorecard, Jour-
nal Of Healthcare Management, Vol. 52, Nr. 5, S. 309-323, 2007. [93] World Health Organization. (2000). The World Health Report 2000: Health Systems - Im-
proving Performance, [Online]. Abrufbar unter: http://www.who.int/whr/2000/en/. [94] World Health Organization. (2006). Global Observatory for eHealth (GOe), [Online]. Ab-
rufbar unter: http://www.who.int/kms/initiatives/ehealth/en/. [95] M. M. Yusof, J. Kuljis, A. Papazafeiropoulou et al., An Evaluation Framework for Health
Information Systems: Human, Organization and Technology-Fit Factors (HOT-fit), Inter-national Journal of Medical Informatics, Vol. 77, Nr. 6, S. 386-398, 2008.
[96] M. M. Yusof, A. Papazafeiropoulou, R. J. Paul et al., Investigating evaluation frameworks for health information systems, International Journal of Medical Informatics, Vol. 77, Nr. 6, S. 377--385, 2008.
[97] C. Zannier, und F. Maurer, A Qualitative Empirical Evaluation of Design Decisions SIG-SOFT Software Engineering Notes, Vol. 30, Nr. 4, S. 1-7, 2005.
[98] W. P. Zhang, K. Yamauchi, S. Mizuno et al., Analysis of Cost and Assessment of Comput-erized Patient Record Systems in Japan Based on Questionnaire Survey Informatics for Health and Social Care, Vol. 29, Nr. 3 & 4, S. 229-238 2004.
[99] L. Zurita, und C. Nøhr, Patient Opinion - EHR Assessment from the Users Perspective, Studies in Health Technology and Informatics, Vol. 107, Nr. 1333-1336, 2004.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 59
I Glossar Akteur Als Akteur wird ein Individuum oder eine Institution verstanden,
welches in der Bereitstellung und/oder Nutzung eines eHealth-Services involviert ist.
Aktivität Aktivitäten sind in sich geschlossene Verrichtungseinheiten inner-halb eines Prozesses. Sie fassen Arbeitsschritte zusammen, die der Akteur im gleichen fachlichen und zeitlichen Zusammenhang an-wendet und in einem Zug ausführt.
Artefakt Im Kontext der Wirtschafts- und Medizininformatik sind Artefakte künstlich erstellte Gegenstände zur Lösung eines Problems. Dabei unterscheidet man zwischen Konstrukten (beispielsweise Ontologien, Frameworks), Modelle (beispielsweise Daten- oder Prozessmodelle), Methoden (beispielsweise Entwicklungs- oder Evaluationsmethoden) und Instantiierungen (beispielsweise medizinische Applikationen).
Dienst Siehe Service.
Elektronisches Patien-
tendossier
Ziel des Elektronischen Patientendossiers ist es, die Bereitstellung aller patientenbezogenen (nicht nur fallbezogenen) medizinischen und administrativen Angaben in einer strukturierten Weise; einrich-tungsübergreifend verfügbar; ärztliche und pflegerische Aufzeich-nungen; Dokumentation zu Diagnosen, Zielen, Behandlungen, Ver-ordnungen, Ergebnissen, Verläufen, Problemen usw. sicher zu stel-len. Dazu gehören standardisierte Dokumente; Metadaten zu wer, wann, was, warum, mit wem, für wen, mit welchem Ergebnis im CDA-Standard; Import von und Export zu Gesundheitskarten mit u.a. Notfalldaten.
Evaluation Unter Evaluation wird die gezielte Bewertung von Artefakten unter
Rückgriff auf Kriterien und Verfahren verstanden, welche der Vorbe-reitung und der Legitimation von Entscheidungen dienen.
eHealth eHealth ist ein ganzheitlicher, integrierter Ansatz zur Unterstützung und Vernetzung der Akteure des Gesundheitswesens. Dabei orientiert sich eHealth stets an Kunden (kundenorientiert), Prozesse (prozess-orientiert), Services (service-orientiert) und dem Markt (marktorien-tiert).
eHealth Collaboration
Infrastructure
Gesamtheit aller zur Verfügung stehenden eHealth-Services eines Gesundheitssystems.
eHealth-Prozess Siehe Prozess.
eHealth-Service Siehe Service.
Gesundheitstelematik Siehe Telemedizin.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 60
Informationssystem Informationssysteme konkretisieren Prozesse in Form einer detail-lierten Spezifikation der automatisierten Informationsverarbeitung. Zur Abwicklung von Prozessen kommen Anwendungen bzw. Appli-kationen zum Einsatz, welche eine Menge von Funktionen unter Rückgriff auf Datensammlungen zur Verfügung stellen. Basis für die Implementierung von Applikationen bilden Informationstechnologie-Komponenten in Form von Hardware, Netzwerken oder Systemsoft-ware.
Medizininformatik Die Medizininformatik befasst sich mit der systematischen Verarbei-tung von Daten, Informationen und Wissen in der Medizin und im Gesundheitswesen.
Prozess Unter einem Prozess wird eine definierte Abfolge von Aufgaben (be-stehend aus Aktivitäten und Informationsobjekten), die durch Start-ereignisse angestossen und mit einem definierten Ergebnis abge-schlossen werden verstanden.
Prozesslandkarte Eine Prozesslandkarte ist eine übersichtliche Zusammenstellung über die Prozesse ohne jedoch detaillierten Informationen über die Pro-zessablauffolge, Input/Output sowie Prozessinhalte zu geben.
Rolle Rollen gruppieren Berechtigungen, die Akteure aufgrund ihrer marktlichen Aktivitäten auf Ressourcen haben. Dadurch wird ver-mieden, dass nicht jedem Akteur eine Vielzahl von Einzelberechti-gungen zugeordnet werden muss, sondern dieser seine Berechtigun-gen über Gruppenzugehörigkeiten oder zugewiesene Rollen erhält.
Service Services sind abgrenzbare, grob granulare Leistungen in Form stan-dardisierter Schnittstellen. Sie lassen sich beispielsweise anhand der Art der bereitgestellten Funktionalität dahingehend unterscheiden, ob sie eine geschäftsorientierte (fachliche Services) oder eher eine tech-nische, unterstützende Funktionalität (technische Services) anbieten.
Telehealth Telehealth beinhaltet sämtliche gesundheitsbezogenen Dienste und Informationen welche durch Telekommunikation bereitgestellt wer-den können.
Telekommunikation Telekommunikation bezeichnet ganz allgemein jeglichen Austausch von Informationen über eine gewisse Distanz hinweg.
Telematik Telematik ist eine Technologie, welche die Technologiebereiche Te-lekommunikation und die Informatik verknüpft. Telematik ist also das Mittel der Informationsverknüpfung von mindestens zwei EDV-Systemen mit Hilfe eines Telekommunikationssystems, sowie einer speziellen Datenverarbeitung.
Telemedizin Die Telemedizin bezeichnet Diagnostik und Therapie unter Überbrü-ckung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt, Apotheker und Patienten oder zwischen zwei sich konsultierenden Ärzten mittels Telekommunikation.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 61
Zuweiserportal Ziel des Zuweiserportals ist es, alle Prozesse und Datenflüsse für
Anmeldung, Einbestellung, Eintritt und Austritt zwischen Leistungs-erbringern zu unterstützen. Im Zentrum steht die Planung von Res-sourcen, Abläufen, Erstellung von Berichten (beispielsweise Ein-tritts- und Austrittsbericht) usw. Diese kann interaktiv (Web) oder nicht interaktiv (beispielsweise via EAI) erfolgen.
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 62
II Anhang: Spezifizierung der Akteure
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Leistungserbringer
Definition Leistungserbringer sind primär für die medizinische Versor-gung zuständig. Im Zusammenhang mit eHealth nehmen sie eine zentrale Rolle als Nutzer und/oder Bereitsteller von In-formationsangeboten wahr.
Prozesszuordnung Prävention, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation
Servicezuordnung Teleberatung, Telediagnostik, Telelabor, Medikation, Med. Dokumentation, Telemedizin, Telemonitoring
Bsp. Institutionen • Alters- und Pflegeheime • Apotheken • Arztpraxen • Drogerien • Kurhäuser • Labore • Managed-Care-Organisationen • Organisationen für die häusliche Pflegehilfe (Spitex) • Spitalverbände • Psychiatrische Einrichtungen • Rettungsdienste • Röntgeninstitute • Universitätskliniken
Bsp. Individuen • Allgemeinmediziner • Apotheker • Chiropraktiker • Drogisten • Ergotherapeuten • Fachärzte (z.B. Dermatologen, Neurologen, Urologen etc.) • Hebammen • Homöopathen • Laboranten • Logopäden • Pfleger • Psychotherapeuten • Physiotherapeuten • Zahnärzte
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 63
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Empfänger
Definition Empfänger sind die Nutzniesser der angebotenen Leistungen. Im Zusammenhang mit eHealth nehmen sie eine aktive (bei-spielsweise Datenlieferant) und/oder passive (beispielsweise Informationskonsument) Rolle ein.
Prozesszuordnung Informationssuche, Selbstpflege, Erfahrungsaustausch
Servicezuordnung Gesundheitsportale, Pers. Gesundheitsmanagement, Netzge-meinschaften, Versicherungsschutz
Bsp. Institutionen • Patientenorganisationen
Bsp. Individuen • Gesunde • Kranke (Patienten) • Angehörige von Patienten
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Controller
Definition Controller sind für die Sicherung der Qualität, Effektivität und Effizienz der angebotenen Leistungen verantwortlich. Im Zu-sammenhang mit eHealth helfen sie die tatsächliche Zielerrei-chung von eHealth zu ermitteln.
Prozesszuordnung Zulassung & Bewilligung, Monitoring & Controlling, Leis-tungsbewertung & Statistik
Servicezuordnung Fachliche Verzeichnisdienste, Leistungsstatistik, Medizinische Statistik, Qualitätssicherung und -kontrolle
Bsp. Institutionen • Eidgenössisches Departement des Innern • Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport • Gesundheitsbehörden der Kantone • Gesundheitsbehörden der Städte und Gemeinden • Kantonale IV Stellen und Ausgleichskassen • Krankenversicherer • Unfallversicherer
Bsp. Individuen • Angestellter im Öffentlichen Dienst • Versicherungsmitarbeiter
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 64
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Unterstützer
Definition Unterstützer nehmen unterschiedliche Aufgaben vor (bei-spielsweise Ausbildung von Leistungserbringern und Empfän-gern), während (beispielsweise Lieferung von Material und Sicherstellung der techn. Infrastruktur) und nach (beispiels-weise Beratung im administrativen Bereichen) der Erbringung einer med. Leistung wahr. Im Zusammenhang mit eHealth nehmen die von den Unterstützern erbrachten Leistungen, welche i.d.R. nicht Teil der medizinischen Versorgung sind, einen subsidiären Charakter ein.
Prozesszuordnung Aus- und Weiterbildung, Administration & Management, Ma-terial & Logistik, Technik & Infrastruktur
Servicezuordnung E-Learning, Literaturmanagement, Fakturierung, Ressourcen-planung, Überweisung, Einkauf, Logistik, E-Collaboration, Datenschutz und –sicherheit, Technische Verzeichnisdienste
Bsp. Institutionen • Beratungsunternehmen • Bildungsinstitutionen • Grossisten und Grosshandel • Hersteller von med. Produkten, Arzneimittel und techn.
Infrastruktur • Printmedien/Publikumsmedien • Stellenvermittlungsbüros • Rechtsanwaltskanzleien • Transportunternehmen
Bsp. Individuen • Administratoren • Ausbildner • Einkäufer • Forscher • Juristen • Logistiker • Sekretärinnen • Techniker
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 65
III Anhang: Definition der eHealth-Services
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Teleberatung / Teleconsultation, Telepsychologie, Health Coaching
Definition Medizinische Befundaufnahme und Beratung unter Überbrü-ckung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient mittels Telekommunikation.
Prozesszuordnung Prävention
Schnittstelle(n) Selbstpflege, Diagnose
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger
Beispiele • http://www.online-beratung.usz.ch
• http://www.medgate.ch/f%C3%BCrPatienten/Sprechstund
e24h/WebDoctor/tabid/118/Default.aspx
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Telediagnostik / Telediagnose, Telepathologie
Definition Erstellung von Diagnosen aufgrund von Bilddaten unter Über-brückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwi-schen Arzt und Patient mittels Telekommunikation.
Prozesszuordnung Diagnose
Schnittstelle(n) Prävention, Behandlung, Selbstpflege
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger
Leistungserbringer � Leistungserbringer
Beispiele • http://www.sg.ch/home/gesundheit/organisation_gd/inform
atik_vig/ehealth/projekte/projekte.html
• http://dicom.offis.de/
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 66
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Telelabor / E-Labor, Papierloses Labor
Definition Erstellung von Diagnosen aufgrund von Laborproben unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz mittels Telekommunikation.
Prozesszuordnung Diagnose
Schnittstelle(n) Prävention, Behandlung, Selbstpflege
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger
Leistungserbringer � Leistungserbringer
Beispiele • http://www.futurebiolab.ch/site/index.cfm/id_art/27512/vs
prache/DE
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Medikation / E-Rezept, Arzneimitteldokumentation, E-Prescription,
Definition Verordnung von Arznei- und Heilmittel in maschinenlesbarer Form.
Prozesszuordnung Behandlung
Schnittstelle(n) Diagnose, Rehabilitation, Selbstpflege
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger
Leistungserbringer � Leistungserbringer
Leistungserbringer � Unterstützer
Beispiele • http://www.mediservice.ch/index.cfm?s=TmpStandard&ac
tion=hm23&hmID=23&um1ID=29&contentID=60&z=2
• http://www.i2-health.org/
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 67
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Medizinische Dokumentation / Elektronische Patientenakte, Elektronische Fallakte, Patientendossier, Befunddaten, Anam-nese
Definition Sammlung und Verwaltung aller den Krankheits- und Behand-lungsverlauf relevanter Daten eines Patienten in maschinen-lesbarer Form.
Prozesszuordnung Behandlung
Schnittstelle(n) Prävention, Diagnose, Rehabilitation, Selbstpflege
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger
Leistungserbringer � Leistungserbringer
Beispiele • http://www.fallakte.de/
• http://www.de.medxchange.org/
• http://www.arge-elga.at/
• http://www.egesundheit.nrw.de/content/e2571/index_ger.h
tml
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Telemedizin / Teletherapie, Telechirurgie, Telemanipulation
Definition Erbringung therapeutischer Leistungen unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient mittels Telekommunikation.
Prozesszuordnung Behandlung
Schnittstelle(n) Diagnose, Rehabilitation
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger,
Leistungserbringer � Leistungserbringer
Beispiele • http://mic.uni-tuebingen.de/mic/index.php?id=112&lang=dt
• http://www.dlr.de/rm-neu/desktopdefault.aspx/tabid-3835//6288_read-9047/
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 68
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Telemonitoring / Disease Management, Telehomecare, Case Management
Definition Erbringung pflegerischer Leistungen unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz zwischen Arzt und Patient mittels Telekommunikation.
Prozesszuordnung Rehabilitation
Schnittstelle(n) Diagnose, Behandlung, Selbstpflege
Akteurzuordnung Leistungserbringer
Involvierte Akteure Leistungserbringer � Empfänger
Leistungserbringer � Leistungserbringer
Beispiele • http://www.hitech-
projects.com/euprojects/myheart/objectives.html
• http://www.vitaphone.de/de/aerzte/medizinisches-service-
center/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Gesundheitsportale / Med. Online-Dienste, Informationsporta-le
Definition Breitstellung von laienverständlichen Gesundheitsinformatio-nen und Dienstleistungen über das Internet.
Prozesszuordnung Informationssuche
Schnittstelle(n) Selbstpflege, Erfahrungsaustausch, Prävention
Akteurzuordnung Empfänger
Involvierte Akteure Empfänger � Empfänger
Empfänger � Leistungserbringer
Empfänger � Controller
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 69
Beispiele • http://www.diabetesgesellschaft.ch/
• http://www.medgate.ch
• http://www.sprechzimmer.ch/
• http://www.netdoktor.de/
• http://www.patienten-information.de/
• http://www.meine-gesundheit.de/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Persönliches Gesundheitsmanagement / Elektronische Ge-sundheitsakte, Gesundheitstagebuch, Patientenfach, Notfallda-ten
Definition Sammlung und Verwaltung aller, persönlicher Gesundheitsin-formationen in maschinenlesbarer Form.
Prozesszuordnung Selbstpflege
Schnittstelle(n) Prävention, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation
Akteurzuordnung Empfänger
Involvierte Akteure Empfänger � Leistungserbringer
Beispiele • https://www.lifesensor.com/de/ch/
• http://www.google.com/intl/de-DE/health/tour/index.html
• http://www.gesundheitsakte.de/
• http://www.private-gesundheitskarte.de
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Netzgemeinschaften / Social Networks, Online-Kontaktnetzwerke, Gemeinschaftsportal, Medizin Foren, Aus-tauschplattform, Web 2.0
Definition Bereitstellung einer Plattform für den Informations- und Erfah-rungsaustausch bzgl. Krankheits- und Behandlungsverläufe und Gesundheitstipps.
Prozesszuordnung Erfahrungsaustausch
Schnittstelle(n) Behandlung, Selbstpflege
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 70
Akteurzuordnung Empfänger
Involvierte Akteure Empfänger � Empfänger
Empfänger � Leistungserbringer
Beispiele • http://www.washeilt.de/
• http://www.chirurgie-portal.de/forum.html
• http://www.medizin-forum.de/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Versicherungsschutz / Versichertenkarte, elektronisches Ar-beitsunfähigkeitszeugnis
Definition Bereitstellung von versicherungstechnischen Informationen zum Zwecke der vereinfachten Abklärung des Versicherungs-schutzes und der Abrechung von Leistungen.
Prozesszuordnung Informationssuche
Schnittstelle(n) Selbstpflege, Erfahrungsaustausch, Behandlung
Akteurzuordnung Empfänger
Involvierte Akteure Empfänger � Leistungserbringer
Empfänger � Unterstützer
Empfänger � Controller
Beispiele • http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/04
108/04109/index.html
• http://www.ehealthnet.ch/136/Produkte_Dienste/deutsch/V
eka-Service.html
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme E-Learning / Teleeducation, E-Lernen, Online-Lernen, Com-puter Based Training, Distance Learning
Definition Bereitstellung und Vermittlung medizinisches Basis- und Ex-perten-Wissens für das multimedial unterstützte Lernen über das Internet.
Prozesszuordnung Aus- und Weiterbildung
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 71
Schnittstelle(n) Prävention, Behandlung, Informationssuche
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Beispiele • http://telemed.ipath.ch/ipath/
• http://e-learning.studmed.unibe.ch/
• http://www.tellmed.ch/tellmed/Fortbildung/e_Learning
/e_Learning_Fortbildung_Medizin.php
• http://www.campus-med.de/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Literaturmanagement / e-Library, Informationsdatenbanken, Literaturdatenbanken
Definition Bereitstellung einer Plattform für die Dissemination von medi-zinischen Wissen für Forschungs- und Ausbildungszwecke über das Internet.
Prozesszuordnung Aus- und Weiterbildung
Schnittstelle(n) Prävention, Behandlung, Informationssuche
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Beispiele • http://www.ebm-netzwerk.de/
• http://www.pubmed.de/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Fakturierung / E-Rechnung, Elektronische Abrechnung
Definition Bereitstellung aller medizin-administrativ relevanten Daten in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Verrechnung einer bezogenen Leistung.
Prozesszuordnung Administration & Management
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 72
Schnittstelle(n) Behandlung, Selbstpflege
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.ehealthnet.ch/78/deutsch/>_eFaktura_/_Prin
ting.html
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Ressourcenplanung / elektronische Auftragskommunikation, Behandlungsplanung, Operationsplanung, Personalplanung, Terminplanung, Online-Terminvereinbarung, e-Appointment
Definition Bereitstellung aller medizin-administrativ relevanten Daten (Personen, Termine, Räumlichkeiten, Material, Geräte etc.) in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Planung einer medi-zinischen Leistungserbringung.
Prozesszuordnung Administration & Management
Schnittstelle(n) Behandlung
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Beispiele • http://www.termidat.de/6/demo.html
• http://www.appoint24.com/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Überweisung/ E-Arztbrief, E-Entlassungsdokumentation
Definition Bereitstellung aller medizin-administrativ relevanten Daten in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der Überweisung, Zu-weisung und Einweisung von Patienten.
Prozesszuordnung Administration & Management
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 73
Schnittstelle(n) Behandlung, Selbstpflege
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.kvno.de/mitglieder/kvnoaktu/06_09/d2d.html
• http://www.innomed.at/index.php?pid=1481&etxsid=4b49
a4178f56001a5b8b54d693f35235
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Einkauf / E-Commerce, E-Business, E-Procurement, eSRM, eSCM, Webshop, Einkaufsportale
Definition Bereitstellung einer Plattform für den Einkauf und die Be-schaffung von Materialen zur Unterstützung der medizinischen Leistungserstellung oder Selbstpflege.
Prozesszuordnung Material & Logistik
Schnittstelle(n) Prävention, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation, Selbstpfle-ge
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.ghx.com/
• http://apo-discounter.ch/apotheke/
• http://www.versandapo.de/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Logistik / E-Logistik, Elektronischer Wareneingang, eSCM, eOrder-Entry, elktronisches Bestandsmanagement, Inventory Control
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 74
Definition Bereitstellung einer Plattform für die Logistik (u.a. Lagerhal-tung, Bestandsmanagement, Transport) zur Unterstützung der medizinischen Leistungserstellung oder Selbstpflege.
Prozesszuordnung Material & Logistik
Schnittstelle(n) Prävention, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation, Selbstpfle-ge
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/patient_safety/
GS1_Standards_in_Healthcare.pdf
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme E-Collaboration / Telekooperation, Teleconference, Videocon-ferencing, E-Mail, VoIP, Chat
Definition Zusammenarbeit zwischen den Akteuren unter Überbrückung einer räumlichen oder auch zeitlichen Distanz mittels Tele-kommunikation.
Prozesszuordnung Technik & Infrastruktur
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.skype.com/intl/de/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Datenschutz und –sicherheit / Digitale Signatur, Verschlüsse-lung, Privacy, Archivierung, E-Archiv
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 75
Definition Schutz personen- oder organisationsbezogener Daten vor Missbräuchen aller Art, sowie Sicherstellung der Vertraulich-keit, Verfügbarkeit und Integrität dieser Daten.
Prozesszuordnung Technik & Infrastruktur
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.hin.ch/d/hinadsl.htm
• https://postzertifikat.ch/
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Technische Verzeichnisdienste
Definition Zentrale Sammlung von Daten (Individuen oder Institutionen) zur Erleichterung der Verwaltung von Identitäten, Rechten und Rollen für ausgewählte Dienste.
Prozesszuordnung Technik & Infrastruktur
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Unterstützer
Involvierte Akteure Unterstützer � Empfänger
Unterstützer � Leistungserbringer
Unterstützer � Controller
Beispiele • http://www.refdata.ch/
• http://www.medwin.ch/
• http://www.projectliberty.org/
• http://www.ehvd.at/
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 76
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Fachliche Verzeichnisdienste / Register, Arzneimittelliste, Arzneimittelregister, Ärzteliste
Definition Zentrale Sammlung von Daten von im Gesundheitswesen zu-gelassenen Materialien, Individuen oder Institutionen.
Prozesszuordnung Zulassung
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Controller
Involvierte Akteure Controller � Empfänger
Controller � Leistungserbringer
Controller � Unterstützer
Beispiele • http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00411/index.html
?lang=de
• http://www.refdata.ch/
• http://www.medwin.ch/
• http://www.spitalpharmazie-
basel.ch/dienstleistungen/inhalt.php
• http://www.gaeso.ch/cms/fileadmin/links/Arzneimittelliste.
htm
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Leistungsstatistik / Performance Reporting, Krankenhausstatis-tik
Definition Sammlung und Bereitstellung von Daten, welche sich mit der Qualität, Effizienz und Kosten der im Gesundheitswesen er-brachten Leistungen beschäftigt.
Prozesszuordnung Monitoring & Controlling
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Controller
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 77
Involvierte Akteure Controller � Empfänger
Controller � Leistungserbringer
Controller � Unterstützer
Beispiele • http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/erhe
bungen__quellen/blank/blank/kh/01.html
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Medizinische Statistik / Epidemiologie
Definition Sammlung und Bereitstellung von Daten, welche sich mit der Verbreitung von gesundheitsbezogenen Zuständen und Ereig-nissen der Bevölkerung befassen.
Prozesszuordnung Monitoring & Controlling
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Controller
Involvierte Akteure Controller � Empfänger
Controller � Leistungserbringer
Controller � Unterstützer
Beispiele • http://ifgitest.uni-
muenster.de/3_projekte/loegd/GIS_Gesundheit.htm
Eigenschaft Ausprägung
Name(n) / Synonyme Akkreditierung
Definition Kontrolle und Verbesserung der Qualität und Vertrauenswür-digkeit von Gesundheitsinformationen und der angebotenen Dienste.
Prozesszuordnung Qualitätssicherung und -kontrolle
Schnittstelle(n) Alle Prozesse
Akteurzuordnung Controller
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 78
Involvierte Akteure Controller � Empfänger
Controller � Leistungserbringer
Controller � Unterstützer
Beispiele • http://www.hon.ch/
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 79
IV Fragebogen zur Beurteilung von eHealth-Services Gewichtung des Zielsystems - Bitte wählen sie die 5 Ziele, die für sie am relevantesten sind und definieren Sie deren Reihenfolge durch Eintragen der Zahlen 1-5 in die rechte Spalte. Meine Rolle: ______________.
Führung
Steuerungsfähigkeit Fähigkeit zur Koordination von Organisationsabläufen sowie die Fähigkeit zur Gestaltung von patientenzentrierten, bereichsübergreifenden Prozessen
Konformität Einhaltung von gesetzlichen und anderen Anforderungen an Prozesse (Best Practi-ces) im Gesundheitswesen und die Fähigkeit diese nachzuweisen
Wirtschaftlichkeit
Produktivität Verhältnis zwischen eingesetzten Ressourcen und erbrachten Leistungen pro Zeit-einheit
Kosten Materialkosten, Personalkosten, Lager- und Transportkosten, Wartungs- und Be-triebskosten, etc..
Outcome (medizinische Qualität)
Behandlungseffektivität Fähigkeit, die richtigen Entscheide bezgl. Problemen und Massnahmen zu treffen (Angemessenheit der Behandlung, Evidenzbasierte Medizin)
Behandlungseffizienz Fähigkeit, die getroffenen Entscheide speditiv und mit optimalem Ressourcenein-satz durchzuführen
Behandlungssicherheit Einfluss auf das Risiko bei der Diagnoseunterstützung, Risiko von unerwünschten Arzneimittelwirkungen, Behandlungsfehler oder -komplikationen
Informationsqualität
Verfügbarkeit von Informationen
Zugang zu vollständigen und aktuellen Informationen
Korrektheit von Infor-mationen
Widerspruchsfreiheit und Nachvollziehbarkeit von Informationen
Austausch von Infor-mationen
Fähigkeit zum Austausch von Informationen mit Leistungserbringern, Unterstüt-zern, Empfänger und Controllern
Vertrauen
Akzeptanz der Behand-lung
Vertrauen des Empfängers, gut umsorgt zu sein (med. Qualität)
Vertraulichkeit von Informationen
Vertrauen in den adäquaten Umgang mit persönlichen Informationen
Verlässlichkeit von Informationen
Verlässlichkeit der Informationen von Dritten
Zugang/Befähigung
Gesundheitskompetenz Technische (Umgang mit elektronischen Diensten) und inhaltliche (health literacy) Fähigkeit der Bürger/Patienten Gesundheitsinformation zu verarbeiten
Gleichbehandlung Gleichwertigkeit der Behandlung unabhängig von Alter, Bildung, Handicaps und Ort
Wahlmöglichkeit Fähigkeit, sich einen Überblick über mögliche Behandlungsoptionen zu verschaf-fen
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 80
-- - 0 + ++ Adressaten/ Fähigkeit zum Beantworten
Nicht anw
endbar
weiss nicht
V
erschlechtert sich stark
V
erschlechtert sich
Bleibt unverändert
Verbessert sich
Verbessert
sich stark
Leistungserbringer
Unterstützer
Controller
Em
pfänger
Outcome (med. Qualität)
Beeinflusst den Bedarf an Nachforschungen (z.B. wegen Unleserlichkeit).
X X X X
Beeinflusst die Transparenz des Behandlungs-ablaufes (Verantwortlichkeiten, Nachvollzieh-barkeit) für mich.
X X X X
Beeinflusst meine Sicherheit bzgl. Angemes-senheit der Behandlung (z.B. Vermeidung von Nachbehandlungen).
X X X X
Beeinflusst das Risiko falscher Medikamenten-einnahme.
X X X X
Beeinflusst die Integration und Durchgängigkeit der medizinischen Versorgung (Niedergelasse-ne Ärzte, Spital, etc.).
X X X
Beeinflusst das Risiko unerwünschter Arznei-mittelwirkungen (Verordnung, Verabreichung).
X X X
Beeinflusst die mit meinen Leistungen in Zu-sammenhang stehenden Transportzeiten (z.B. Übermittlung der Analyseergebnisse).
X X
Beeinflusst meine Entscheidungssicherheit (z.B. durch Einsatz evidenzbasierter Medizin, Unterstützung von Konsilien).
X X
Beeinflusst die Medikations- / Radiologiebelas-tung der Patienten.
X X
Beeinflusst das Risiko von Fehlern in der Diag-noseunterstützung (z.B. Labor, Radiologie).
X X
Beeinflusst das Risiko unerwünschter Transfu-sionsereignisse (Verordnung, Verabreichung).
X X
Beeinflusst das Risiko von Behandlungsfehlern. X X
Beeinflusst das Risiko von Komplikationen. X X
Beeinflusst meine Antwortzeit (z.B. bei Patien-tenanfragen).
X X
Beeinflusst die Liegezeiten (d. h. Zeiten, in denen Ergebnisse vorliegen aber nicht weiter-verarbeitet werden) von Leistungen, die ich konsumiere (z.B. Laborergebnisse).
X X
Beeinflusst die beim Patienten durch Krankhei-ten verursachte Last (beispielsweise weniger Spitalbesuche oder für chronisch Kranke).
X X
Beeinflusst die Verweildauer des Patienten. X
Beeinflusst die Verfügbarkeit um sich seinen Kernaufgaben zuzuwenden(Präsenz beim Pati-enten, Laborauswertung, etc.).
X
Beeinflusst meinen Aufwand an administrativer Arbeit.
X
Beeinflusst die Wartezeiten des Patienten. X
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 81
Wirtschaftlichkeit
Beeinflusst die Dauer der Ausführung meiner Tätigkeiten.
X X X
Beeinflusst die Anzahl der Leistungen, die meine Organisation pro Periode erbringen kann.
X X X
Beeinflusst das Erlernen von Fähigkeiten, die innerhalb meiner Organisation benötigt werden.
X X X
Beeinflusst die Personalkosten meiner Organi-sation.
X X X
Beeinflusst die Lager- und Transportkosten meiner Organisation.
X X X
Beeinflusst die Materialkosten meiner Organi-sation.
X X
Beeinflusst die Wartungs- und Betriebskosten. X X
Führung
Beeinflusst die Einhaltung gesetzlicher und anderer Anforderungen (z.B. Datenschutz, Ethik).
X X X X
Beeinflusst die Durchführung der haftungs- und rechtssicheren Dokumentation und deren Auf-bewahrung (z.B. Leistungsdokumentation).
X X X
Beeinflusst die Fähigkeit zur Gestaltung von Prozessen (z.B. Behandlungspfade).
X X X
Beeinflusst die Fähigkeit zur Steuerung von Prozessen.
X X X
Beeinflusst die Planbarkeit der Auslastung meiner Organisation.
X X X
Zugang zu Leistungen/Befähigung
Beeinflusst die Fähigkeit der Bürger/Patienten, Gesundheitsinformationen zu verstehen (Health Literacy).
X X X X
Beeinflusst das Gesundheitsbewusstsein der Bürger/Patienten.
X X X X
Beeinflusst die Gleichwertigkeit der Behand-lung von Patienten, unabhängig von Alter.
X X X X
… von Bildung. X X X X
… von Ort. X X X X
… von Handicap. X X X X
Beeinflusst die Fähigkeit der Bürger/Patienten, mit Informationen bezüglich ihrer Gesundheit technisch umzugehen (Umgang mit Portalen, etc.).
X X X
Beeinflusst die Fähigkeit des Patienten, sich einen Überblick über mögliche Behandlungsop-tionen zu verschaffen.
X X X
Informationsqualität
Beeinflusst den Zugang zu Informationen, die von mir benötigt werden (d. h. den Aufwand, den ich erbringen muss, um Zugriff auf benötig-te Informationen zu erhalten).
X X X X
Beeinflusst die Verfügbarkeit sämtlicher von X X X X
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 82
mir benötigten Informationen (z.B. Historie, Informationen anderer Institutionen, Integrati-on).
Beeinflusst die Redundanz/Doppelspurigkeit der Informationen.
X X X X
Beeinflusst die Aktualität der von mir benötig-ten Informationen.
X X X X
Beeinflusst inwiefern die von mir benötigten Informationen frei von Widersprüchen sind.
X X X X
Beeinflusst die Nachvollziehbarkeit (Ursprung, Anpassung) der von mir benötigten Informatio-nen.
X X X X
Beeinflusst meine Fähigkeit, mit Leistungserb-ringern Informationen auszutauschen.
X X X X
Beeinflusst meine Fähigkeit, mit Patienten Informationen auszutauschen.
X X X X
Beeinflusst meine Fähigkeit, mit Controllern Informationen auszutauschen.
X X X X
Beeinflusst meine Fähigkeit, mit Unterstützern Informationen auszutauschen.
X X X
Vertrauen
Beeinflusst mein Vertrauen in einen adäqua-ten/vertraulichen Umgang mit persönlichen Informationen.
X X X X
Beeinflusst die Glaubwürdigkeit der Informati-onen, welche durch Dritte beigesteuert wurden.
X X X X
Beeinflusst die Akzeptanz der Behandlung (z.B. durch bessere Informationen darüber).
X X X
Weitere Punkte Gibt es aus Ihrer Sicht weitere wichtige Punkte , auf die eHealth einen Einfluss hat und die in diesen Fragen nicht berücksichtig sind?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 83
Vorraussetzungen und Rahmenbedingungen des eHealth-Services … Meine Rolle: ______________. Bitte bewerten Sie diese aus der Sicht Ihrer Rolle.
-- - 0 + ++
Nicht anw
endbar
Weiss nicht
Nicht vorhanden
Konzept teilw
eise vor-handen
Konzept vorhanden aber
nicht umgesetzt
Konzept vorhanden und
teilweise um
gesetzt
Konzept vorhanden und vollständig um
gesetzt
Vorraussetzungen
Strat-
egie
Inwiefern schaffen Unternehmens- und IKT-Strategie die Anreize, damit die Organisation die Services effizient und effektiv einsetzt?
Organi-
sation
Inwiefern sind bezüglich Organisationsstruktur und Abläu-fen die Vorrausetzungen geschaffen, um die Services mög-lichst effizient und effektiv zu nutzen?
Inte-gration
Inwiefern sind Applikationen, die mit diesem Service inter-agieren, in Ihre Arbeitsabläufe integriert und unterstützen diese?
Soft-
ware
Inwiefern sind die Applikationen vorhanden, welche benö-tigt werden, um den Service innerhalb ihrer Organisation zu nutzen?
Infra-struktur
Inwiefern sind technische Infrastrukturen zur Nutzung des Services vorhanden (Geräte, Computer, Netzwerkinfrastruk-tur)?
Kosten
Inwiefern sind Massnahmen zur Finanzierung von internen Investitionskosten, Ausbildungskosten, Wartungs- und Be-triebskosten und etwaiger anderer Kosten, die im Zusam-menhang mit dem Service anfallen, vorhanden?
Befähi-gung
Inwiefern sind die Mitarbeiter Ihrer Organisation technisch und inhaltlich in der Lage, den Service innerhalb ihrer Auf-gaben zu nutzen?
Kultur
Inwiefern ist Ihre Organisation willens, den Service inner-halb ihrer Aufgaben zu nutzen?
Externe Rahmenbedingungen
Struk-
turen
Inwiefern sind strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen, wie beispielsweise Netzwerkinfrastrukturen, übergreifende Prozesse oder verantwortliche Organisationen?
Politik/
Gesetz-
gebung
Inwiefern sind politische und gesetzliche Rahmenbedingun-gen geschaffen, wie beispielsweise Regelungen bezüglich Datenschutz, Datenaustausch, etc., die diesen Service betref-fen?
Netz-
werk-
kosten
Inwiefern sind Massnahmen zur Finanzierung von Investiti-onskosten, Ausbildungskosten, Wartungs- und Betriebskos-ten und etwaiger andere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Service anfallen, vorhanden?
Kultur
Inwiefern sind Massnahmen zur Förderung von Akzeptanz /Bereitwilligkeit für die Nutzung dieses Services und der notwendigen Technologien vorhanden?
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 84
Pondération du système des objectifs – Choisissez les cinq objectifs qui sont les plus importants pour vous et définissez leur ordre de priorité en reportant les chiffres 1 à 5 dans la colonne de droite.
Mon rôle : _____________.
Gestion
Capacité à diriger Aptitude à coordonner les processus organisationnels ainsi qu’à structurer des processus multisectoriels, axés sur les patients
Conformité Respect des exigences légales et autres pour les processus (bonnes pratiques) dans le secteur de la santé et capacité à les démontrer
Caractère économique
Productivité Rapport entre les ressources utilisées et les prestations fournies par unité de temps
Coûts Coûts de matériel, de personnel, frais de transport, de stockage, de maintenance, d’exploitation, etc.
Résultats (qualité médicale)
Efficacité thérapeutique
Capacité de prendre les bonnes décisions pour régler les problèmes et adopter les mesures qui s’imposent (adéquation du traitement, médecine factuelle)
Efficience thérapeutique
Aptitude à exécuter les décisions prises de manière expéditive et avec une utilisation optimale des ressources
Sécurité thérapeutique Influence sur le risque lors de l’aide au diagnostic, risque d’effets secondaires indésirables des médicaments, erreurs ou complications dans le traitement
Qualité des informations
Disponibilité des informations
Accès à des informations complètes et actuelles
Exactitude des informations
Incontestabilité et traçabilité des informations
Echange d’informations
Capacité d’échanger des informations avec les fournisseurs de prestations, les personnes de soutien, les destinataires et les contrôleurs
Confiance
Acceptation du traitement
Le destinataire est sûr d’être bien soigné (qualité médicale)
Confidentialité des informations
Les patients sont sûrs que leurs informations personnelles sont utilisées de manière adéquate
Fiabilité des informations
Fiabilité des informations provenant de tiers
Accès / capacités
Culture sanitaire Les citoyens / patients ont les capacités techniques (recours aux services électroniques) et les connaissances sur les contenus (culture sanitaire) leur permettant de traiter des informations sanitaires
Egalité de traitement Même traitement, indépendamment de l’âge, de la formation, des handicaps et du lieu
Possibilité de choisir Capacité d’avoir un aperçu des options de traitement possibles
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 85
-- - 0 + ++ Destinataires / capacités à répondre
Non applicable
Ne sait pas
Se détériore nettem
ent
Se détériore
Reste inchangé
S’am
éliore
S’am
éliore nettem
ent
Fournisseurs de prestationss
Pers. de soutien
Contrôleurs
Destinataires
Résultats (qualité médicale)
Influence le besoin de recherches ultérieures (p. ex., pour raison d’illisibilité)
X X X X
Influence, à mon sens, la transparence du processus thérapeutique (responsables, traçabilité)
X X X X
Influence ma sécurité concernant l’adéquation du traitement (p. ex. suppression de traitements ultérieurs)
X X X X
Influence le risque de prise de médicaments inappropriée
X X X X
Influence l’intégration et l’accessibilité des soins médicaux (médecins établis, hôpital, etc.)
X X X
Influence le risque d’effets secondaires non souhaitables de médicaments (prescription, administration)
X X X
Influence les temps de transport liés à mes prestations (p. ex. communication des résultats d’analyse)
X X
Influence ma sécurité en matière de décision (p. ex., en utilisant la médecine factuelle, soutien avec l’aide de consultants médicaux)
X X
Influence la charge des patients en matière de médication et de radiologie
X X
Influence le risque d’erreurs dans l’aide au diagnostic (p. ex. laboratoire, radiologie)
X X
Influence le risque d’incidents non souhaitables lors de transfusions (prescription, administration)
X X
Influence le risque d’erreurs thérapeutiques X X
Influence le risque de complications X X
Influence mon temps de réponse (p. ex., questionnaires adressés aux patients)
X X
Influence les temps d’attente (c’est-à-dire les périodes durant lesquelles les résultats existent mais n’ont pas été traités) de prestations auxquelles je recours (p. ex. résultats de laboratoire)
X X
Influence la charge occasionnée aux patients par la maladie (p. ex., moins de visites à l’hôpital ou pour des malades chroniques)
X X
Influence la durée du séjour du patient X
Influence ma disponibilité pour me vouer à mes tâches principales (présence auprès des
X
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 86
patients, évaluation d’analyses de laboratoires, etc.)
Influence ma contribution au travail administratif
X
Influence les temps d’attente des patients X
Caractère économique
Influence la durée d’exécution de mes activités
X X X
Influence le nombre de prestations que mon organisation peut fournir par période
X X X
Influence l’apprentissage de capacités nécessaires au sein de mon organisation
X X X
Influence les frais de personnel de mon organisation
X X X
Influence les coûts de stockage et de transport de mon organisation
X X X
Influence les coûts matériels de mon organisation
X X
Influence les coûts de maintenance et d’exploitation
X X
Gestion
Influence le respect d’exigences légales et autres (p. ex., protection des données, éthique)
X X X X
Influence l’exécution de documentation sûre en matière de responsabilité et de droit et sa conservation (p. ex., documentation sur les prestations)
X X X
Influence la capacité à structurer des processus (p. ex., voies de traitement)
X X X
Influence la capacité à piloter les processus X X X
Influence la planification de la charge de mon organisation
X X X
Accès aux prestations / capacités
Influence la capacité des citoyens / patients à comprendre les informations sanitaires (culture sanitaire)
X X X X
Influence « l’esprit de santé » des citoyens / patients
X X X X
Influence l’égalité de traitement des patients, indépendamment de l’âge,
X X X X
... de la formation X X X X
... du lieu X X X X
... du handicap X X X X
Influence la capacité des citoyens / patients d’aborder techniquement les informations concernant leur santé (utilisation des portails, etc.)
X X X
Influence la capacité des patients d’avoir un aperçu sur les options de traitement possibles
X X X
Qualité des informations
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 87
Influence l’accès aux informations qui me sont nécessaires (c’est-à-dire l’investissement que je dois faire pour accéder à ces informations)
X X X X
Influence la disponibilité de toutes les informations qui me sont nécessaires (p. ex. historique, informations d’autres institutions, intégration)
X X X X
Influence la redondance / les doublons en matière d’informations
X X X X
Influence l’actualité des informations qui me sont nécessaires
X X X X
Influence le stade auquel les informations qui me sont nécessaires sont incontestables
X X X X
Influence la traçabilité des informations qui me sont nécessaires (origine, adaptation)
X X X X
Influence ma capacité à échanger des informations avec des fournisseurs de prestations
X X X X
Influence ma capacité à échanger des informations avec des patients
X X X X
Influence ma capacité à échanger des informations avec des contrôleurs
X X X X
Influence ma capacité à échanger des informations avec des personnes de soutien
X X X
Confiance
Influence ma confiance dans une utilisation appropriée / confidentielle des informations personnelles
X X X X
Influence la crédibilité des informations qui ont été co-pilotées par des tiers
X X X X
Influence l’acceptation du traitement (p. ex., au moyen de meilleures informations sur celui-ci)
X X X
Autres points : Existe-t-il, à votre avis, d’autres points importants sur lesquels la cybersanté a une influence et qui ne sont pas considérés dans ces questions ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Was ist der Nutzen von eHealth? Seite 88
Exigences et conditions-cadre du cyberservice « .... »
Mon rôle :_____________ Veuillez évaluer le service en tenant compte de votre rôle
-- - 0 + ++
Non applicable
Ne sait pas
Non prévu
Concept
partiellement prévu
Concept prévu,
mais pas réalisé
Concept prévu et
partiellement
réalisé
Concept prévu et
entièrement réalisé
Exigences
Strat-
égie
Dans quelle mesure les stratégies de l’entreprise et des TIC créent-elles les incitations pour que l’organisation mette en place les services de manière efficace et efficiente?
Organi-
sation
Dans quelle mesure les exigences du point de vue structure organisationnelle et processus sont-elles créées pour que l’organisation mette en place les services de manière efficace et efficiente?
Inté-gration
Dans quelle mesure les applications interactives avec le service sont-elles intégrées à vos processus de travail et les soutiennent-elles ?
Logiciel
Dans quelle mesure des applications nécessaires pour utiliser le service au sein de votre organisation sont-elles prévues?
Infra-structure
Dans quelle mesure les infrastructures techniques pour l’utilisation du service existent-elles (appareils, ordinateurs, infrastructure de réseau) ?
Coûts
Dans quelle mesure les exigences permettant le financement de coûts d’investissement internes, de formation, de maintenance et d’exploitation ainsi que d’autres coûts éventuels en relation avec le service sont-elles réunies ?
Capacités
Dans quelle mesure les collaborateurs de votre organisation sont-ils techniquement et matériellement en mesure d’utiliser le service parmi leurs tâches ?
Culture
Dans quelle mesure votre organisation souhaite-t-elle intégrer le service à ses tâches ?
Cnditions-cadres externes
Structure
Dans quelle mesure les conditions-cadres structurelles sont-elles créées, p. ex., les infrastructures de réseau, les processus multisectoriels ou les organisations responsables ?
Politique
/législation
Dans quelle mesure les conditions-cadre politiques et légales qui concernent ce service sont-elles créées, p. ex., les réglementations concernant la protection des données, l’échange de données, etc. ?
Coûts de réseau
Dans quelle mesure les conditions permettant le financement de coûts d’investissement internes, de formation, de maintenance et d’exploitation ainsi que d’autres coûts éventuels en relation avec le service sont-elles réunies ?
Culture
Dans quelle mesure les conditions encourageant l’acceptation / l’adhésion pour l’utilisation de ce service et des technologies nécessaires sont-elles prévues?