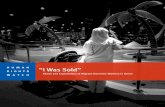institut for sundhedstjenesteforskning (ist) - Syddansk Universitet
Was ist Glück?
Transcript of Was ist Glück?
2
Erste und einzige Auflage, ohne Verlag: Santiago de León de Caracas, Venezuela, 2013
unter einer Creative Commons-Lizenz:
Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen - 4.0 Internationale Lizenz.
3
Nevim Sotoje
Was ist Glück? oder
Das Leben, einfach.
Eine kurze, wenn nicht unmissverständliche, so
doch noch nicht abschließende Betrachtung
dieser immer offenen Frage
geäußert von einem nicht notwendig
überpersönlichen Standpunkt aus, aber aus
einem des Irreduzibel-Subjektiven
im Verstehen der Welt und damit einem der
unaufhebbaren Pluralität von Meinungen über
ebendiese heraus.
UNWIRSCH/ FRANZINE
4
“I show you a falling sun, passing like a lover, to be near you, allowing no star, no bulb on a corner lamp to possess you as you are.”
James Ragan: The World Shouldering I
5
Was ist Glück? oder Das Leben, einfach.
Glück ist ein voller Magen. Das Gefühl, keinen
Hunger zu leiden und keinen Durst. Zu essen,
einfach, weil man will, und nur, wenn es einem
danach verlangt. Zu schlafen, weil man will und
kann. Weil man seiner Müdigkeit nicht
widersprechen oder man sich von dieser noch
lossagen muss, weil einen etwas drängt, man
doch noch muss… Ja, die Abwesenheit überhaupt
eines solchen «Muss», jeder Bedürftigkeit, die
Abwesenheit jeder Notwendigkeit, aber auch
keiner Möglichkeit, eines möglichen oder
unbedingten Andersseins, das sich da noch
aufzudrängen vermag –: nein, ein tiefes
Einverständnis in die Welt, die in diesem Zustand
im tiefen Einklang und nichts anderes als das sie
konstituierende Bewusstsein ist. Das sich da
selbst genügt, ohne ein Bewusstsein «von …» zu
sein. Von etwas, was da noch sein könnte, weil
da ist nichts, worüber in diesem Moment es sich
nachzudenken lohnt; irgendetwas, was sich
aufdrängt, das sich problematisieren ließe,
dessen Dringlichkeit einen einem Sklaven gleich
vor sich her triebe.
6
Nein, man isst, man schläft, man hat sein stilles
Vergnügen, das man augenblicklich schon wieder
vergisst, vergessen hat, man lässt sich treiben,
ganz im Strome seines wie anonymen
Bewusstseins, der einvernehmlichen Stille, des
einverständlichen Verstummens. Und dies alles:
eben ganz ohne darüber nachzudenken,
nachdenken zu müssen,ohne dies hinterfragen zu
müssen; allenfalls nur, weil es einem danach,
nach diesem oder jenem, verlangt, handelt man,
regt man sich; manist, man verliert sich, ist in
seiner Anwesenheit fast abwesend, ist eine
anwesende Abwesenheit, man klagt nicht an,
und ist auch nicht in Frage gestellt oder auch zur
Verantwortung gerufen, sondern ist nur ein
Bewusstsein, das ganz bei sich ist: «Ich» ist es,
was in sich ruht. Glück ist nicht zu wissen, was
heute Abend im Fernsehen laufen wird, also
auch nicht zu wissen, was einem alles entgehen
wird. Weil es einem nicht entgeht. Weil das gar
nicht wichtig ist. Weil dieses Mögliche gar keine
Option ist, die sich stellt, stellen würde.
„Alles ist gut.“, ist ein Satz, der, wenn ein
Anderer ihn einem sagt, zumeist um einen zur
Ruhe zu bringen, der, nur zur Beruhigung einem
gesagt, gerade sein Gegenteil bewirkt, weil das
7
eigene Bewusstsein vor diesem fremden Befund
doch keinen Halt machen kann: erbefremdend
wirkt, notwendig, und man ihm widersprechen
muss, weil doch aber auch gar nichts und auch
nur im Ansatz «gut» ist. Ganz so, wie dieses
unser Bewusstsein in der Nachfolge sein Glück
auch nur zu gern an das der anderen zu ketten
pflegt, ich kann nicht glücklich sein, weil du es
nicht bist, nicht sein kannst, ich bin nicht
glücklich, solange es dir nicht gut geht, weil du
nicht glücklich sein kannst… ist eine nicht-
notwendige Verknüpfung; ein nicht-notwendiges
Bedingtsein, ein nicht-notwendiges Konditional,
was zwar nur allzu verständlich ist, indem es uns
den Anspruch im Augenblick des Anderen vor
eben die unseren Augen führt, und uns – für uns
– wünschen lässt, dass er, der Andere, den wir
lieben, den wir mögen und dem wir wohlwollen,
ihm möge es doch auch gut gehen. – Nur
verkehrt das die Lage, unseren Standpunkt und
die Perspektive: Schließlich obliegt es ihm, und
nur ihm, seinem Befinden und seiner Verfassung,
seinem Glücksgefühl, diesem Wunsch auch zu
entsprechen. Ein Glück, das immer ein gefühltes
ist. Und bleibt. Was ganz unabhängig von uns ist;
und der Wunsch allenfalls das intendierte
Streben eines aber notwendig äußerlich
bleibenden Vermögens. Kurzum: unser Nicht-
8
Vermögen, glücklich zu machen, dieses, Glück, zu
stiften, welches wir nur allzu oft damit
verwechseln, dass wir fähig sind, Glück zu
nehmen, unglücklich zu machen. Was wiederum
ein Leichtes ist. Das Glück ist auch der volle
Magen der Anderen. Und ist es nicht. Weil dieser
Zustand eines zufriedenen, eines befriedeten
Seins nur punktuell erreicht ist, nur sein kann
und nur eine Voraussetzung darstellt, glücklich
zu sein, dieses zu empfinden. Weil das Sein, zu
leben, immer im Vollzug ist, ein Gerade-
Geschehen, ein Sich-Ereignen in der nur-eigenen
Gegenwart. In dem sich dann und wann der
Punkt findet, nur kurz einstellt, zwischen einem
materialiter gestillten Hunger, der nichts anderes
als Abwesenheit eines solchen defizitären
Gefühls ist, noch ohne ein Gefühl der Völle, des
übermäßigen Gesättigtseins. Was noch kein
Glück ist. Aber eine Voraussetzung dazu, dieses
zu empfinden. Der Ruhepol in einer für dieses
Momentum zum Stillstand gebrachten Welt.
Mesotes, die ‚Mitte‘ (vgl. hierzu: Aristoteles
1972), Lehrmeisterin des richtigen Maßes und
der Tüchtigkeit, des richtigen oder
angemessenen Sich-Verstehens «auf…». Die
einem auch lehrt, dass es in einem ganz
9
bestimmten Hunger, einem immateriellen Durst
keinen solchen Punkt geben kann, des Sattseins
oder überhaupt -werdens. Weil dies ein
fortgesetztes ist, eben weil das Sein «für sich»
eines im stetigen Flusse ist, es ist schon immer
im Vollzug, und es darum auch keinen Weg, sich
in und zu diesem zu halten und zu verhalten,
geben kann, der schon ein festgeschriebener ist.
Der schon von Vornherein bekannt und ein
Gegebener ist; ein Überkommenes, dem ich nur
Folge zu leisten brauche. Das «gute» Leben oder
ein gelingendes, ein dem Glück zugeneigtes
Leben ist eines, das sich einstellt, das sich diesem
Befund stellt: Das um diesen Balanceakt weiß,
und sich darauf eingestellt hat,dass es sich nicht
fest-stellen lässt, dass es sich nicht fest-stellen
kann. Das sich erst einstellen muss. Dass lebt,
aber nicht mehr fragt – nach dem «Wie?»
10
Vom Unsinn einer Wette auf die
Zukunft
Ich habe schon immer alles nicht besser gewusst.
Weil eine abschließende Beurteilung dessen,
eben dieses «Wie?» zu leben sei, «wie» ich leben
soll, notwendig ein Wissen davon einschließen
müsste, was ich nie habe, nicht haben kann –
einer Zukunft, die nicht die meine ist, der ich
immer doch nur eine Gegenwart vor Augen habe,
die in diesem Augenblick eingeschlossene
Gegenwart, die die meine ist; jener blanken
Kette von Augenblicken, welche sich fortsetzt, in
deren bloßer Aneinanderreihung. Angesichts des
Grades – und mag es vielleicht auch nur der von
diesem zugrunde liegenden winzigen,
quantenmechanischen, nicht vorhersagbaren,
scheinbar unmotivierten Sprüngen sein –
angesichts der erweist sich oder besser, wird sich
Zukunft als etwas erweisen, in dem etwas In-
oder Unterdeterminiertes liegt oder zu liegen
scheint. Was Aussagen über dieselbe, als nicht
viel mehr als bloße Wetten auf eine Zukunft
betrachten lässt, die sich als richtig erweisen
können. Oder aber auch nicht.
11
Insofern ist es ein Leichtes, aus dem
rückwärtigen Blick ganze Lebensläufe
abzukanzeln, diese seien «das Richtige» oder
eben «falsch»; plötzlich waren alle im
Widerstand oder: wären gewesen. Dieses Leben
im Konjunktiv ist aber eben keines. Dieses
geschieht aus einem Vorschuss aus Wissen, den
ich, als der, der lebt, nicht habe. Das
Angemessene, die richtige Haltung, und zwar für
mich, die richtige ‚Mitte‘, ich muss sie mir in dem
Gegebenen für mich finden. Ich muss sie mir
womöglich er-finden. Alles darüber hinaus, von
außen oder auch da-nach(-gesagt), sagt
genaugenommen nichts. Sprengstoff für alle, die
glauben, es gäbe einen Königsweg. Sprengstoff
für eine so eben auch heraufbeschworene,
behauptete, das heißt, über die Grenze der
Person hinaus angenommene Identität (Die im
Übrigen in alles andere als in den Widerstand
führt, sondern zum gleichgeschalteten Status als
nur ein Atom in der anonymen Masse der nur-zu-
guten bürgerlichen Gesellschaft.) aller: Es gibt
nur einen Königsweg, und alle anderen sollten
sich in schöner Eintracht an diesen halten. Nicht
doch!
12
Leben ist ein solitäres Vergnügen, ja, und bleibt
dieses auch notwendig. Leben, zu sein, ist in
ausgezeichneter Weise Einsamsein. Ein,
notwendig oder nicht, Geschiedensein von den
Anderen; und die sprachlichen Krücken oder
Formen des nonverbalen Ausdrucks allenfalls
Mittel desselben ebendiese interpersonalen
Barrieren zunächst und erst einmal (und noch
vor dem Einsatz einer Vermittlung) intersubjektiv
anzuerkennen. Weswegen Menschen, die fremd
gehen, sehr gut mit der vermeintlichen «Schuld»,
den Anderen zu hintergehen, leben können: Sie
lieben diesen Anderen ja auch! Ohne, dass diesen
das berührte! Es berührt ihn aber umso mehr, er
sieht sich aber eben um so mehr getroffen,
indem er sich eben nichtgetroffen sieht: Da er
eine Ausschließlichkeit in dieser Fähigkeit zu
lieben verlangt, auf diese pocht, die diese gar
nicht zu leisten vermag: Man liebt immer einen
Anderen, der dort ist, wo man, wo «ich» nicht ist,
verlangt aber im Gegenzug das «als ob»: die
Ausschließlichkeit nur als genau dieses «Ich», der
Nicht-Andere, der dieser nicht sein kann, selbst
geliebt zu werden.
13
Die Zu-neigung, dies beschreibt es ganz gut,
erklärt sich doch auch aus unserer Sicht auf den
Anderen: Dieser neigt sich uns (scheinbar) zu. Er
neigt sich uns zu, er schmeichelt uns. Es scheint,
und dies kann auch ein Zufall sein oder auch
einfach auf einer Missinterpretation der ganzen
Situation beruhen (die diese aber genau
genommen immer ist, da der Andere ja auch nur
dieselbe «Hier, ich!»-Karte ausspielen möchte,
wie wir doch selbst auch) – jedoch erscheint es
für uns, als bestätige er in dieser Zuneigung
zunächst uns. Und zwar, als uns selbst: in
unserem Immer-schon- oder auch auch Vor-
Eingenommen-Sein von uns selbst, unserem
blanken Da-Sein, diesem Körper, den wir fühlen
und den dieser Andere – wir wissen nicht genau,
als was oder auch wie – ebenso wahrzunehmen
scheint, er ebendiesem offenbar Beachtung
schenkt.
Wozu aber nun auch nicht sonderlich viel gehört,
denn da, wo ein Körper ist, kann schließlich kein
anderer sein. Aber allein schon diese erste
Begegnung auf Ebene vagabundierender und
zunächst rein nonverbaler Körperlichkeit genügt,
um unseren Blick fokussieren zu lassen. Der
Andere findet etwas an ihm; ihm jenem
14
stumpfen Körper, mit dem ich nichts als aus mir
heraus be-greifen kann; er findet etwas an uns,
er nimmt mich wahr, in meinem Da-Sein – und
damit nur mich, das heißt, er bestätigt jenes
recht konturlose «Ich-selbst», von dem
genaugenommen «ich» auch nur recht ungenaue
Vorstellungen und eine vage Ahnung habe, was
dieses eigentlich ist, in seiner Anwesenheit.
Eine solch anfängliche Zuneigung, die eben auch
eine zufällige sein kann oder wir sie schlicht
missinterpretieren, steht da am Anfang der
Attraktion. Das spricht uns an, wir sind nicht
mehr ungerührt, selbst wenn da noch keine
Berührung stattgefunden hat, haben muss, selbst
wenn da noch nicht ein Wort getauscht wurde,
unserer Interesse an ihm ist gleichsam geweckt,
es zieht uns gleichsam zu ihm hin. In diesem
anfänglichen Missverständnis nimmt die
Attraktivität ihren Anfang, aus der heraus wir
«ebenso» geneigt sind, uns ihm «gleichsam»
zuzuwenden; wir empfinden «ebenso» (und
eben gar nicht), weil wir ja doch nicht aus
unserer Haut heraus, diese von uns streifen
können. So wie der Andere für uns auch immer
der Andere verbleibt.
15
Ein nicht zu ergründender Rest fremder
Spontaneität
Letztlich verbleibt immer ein nicht zu
durchschauender, ein nicht zu ergründender
Rest: Selbst bei den Leuten, die ich gut zu kennen
glaube, wo ich vielleicht sogar gute Gründe
anführen kann, in dem ich auf meine
Erinnerungen verweisen kann, auf ein darin
konserviertes Wissen über die (vermeintliche)
Vergangenheit, eines dort ge- oder erlebten
Erfahrungswissens, das sich darin erhalten hat,
wie sich ein Anderer in dieser oder jener
Situation verhalten, sich positioniert hat, – sagt
mir letztlich eben nicht gänzlich oder auch gar
nicht, wie er sich genau jetzt verhalten wird. Die
Leute, selbst die, die ich gut zu kennen meine,
erscheinen mir auch dann und wann wie ein
geschlossenes Buch. Und es ist eine Anmaßung
zu glauben, ich könnte sie lesen. Genau
genommen kann ich zwar nichts als das, nicht
viel mehr als das. Als den Versuch zu
unternehmen, sie zu lesen trotz ihres dieses
unaufkündbaren Rests, der ihnen als simples
Anrecht der ihnen eben auch zueigenen
16
Spontaneität anerkannt werden muss und
verliehen bleiben muss. Und welcher auf meiner
Seite wiederum, im besten Fall nur ein simples
Nicht-Können markiert.
Was aber auch heißt, dass Glück notwendig auch
ein solitäres ist. Und immer nur punktuell. Ein
Punkt. Im All. Und in der Vielheit, in der man sich
als Singularität eben unter (den) Vielen weiß.
Weil Bewusstsein zunächst und zuerst immer
eine singuläre Erscheinung ist, die noch von
keinem (A)nderen weiß. Eine Gegenwart, die nur
sich selber weiß, und noch an keine andere
grenzt. Das Widerfahren von Koinzidenz, das
Erleben eines Eingebettetseins in ein (dann
gemeinsames) Kontinuum von Welt, ist dann
vielleicht nicht mehr als das: eine notwendige
Illusion. Erweist man sich doch gerade darin als
der am weitesten entfernte Punkt im All –
entfernt und geschieden von allen anderen.
Entweder dies, oder hier demonstriert sich eine
Fähigkeit, ein Fähig-Sein zur Synchronisation
verschiedenen Lebens und verschiedener Leben
in einer grundlegend aber Asynchronität. Fähig
zu sein zur Einfühlung, zu Empathie, Mimesis,
17
Imitation, …, letztlich zur Teilhabe: einem immer
schon Eingebettetsein in einer sich erst aber aus-
, ver- oder zu erschließenden Intersubjektivität
jenseits des anfänglichen Geteilt- und Alleinseins,
dieses überragend, über dieses hinausschießend.
(vgl. hierzu etwa: Lévinas 32002)
Nichtsdestotrotz «zusammen glücklich» zu sein,
heißt dann, es jeder «für sich» und es auch allein
zu sein. Der «Beischlaf» ist in diesem
Zusammenhang, ein gutes, weil anschauliches
Wort: Genauer, dieser Punkt im aber auch
vertrautesten Miteinander, in dem,
gewissermaßen in der der höchsten Anspannung,
kurz bevor sich aus dieser alles ergießt und
zusammenzieht, man zufrieden und matt sich
zusammenrollt, man wieder überhaupt Augen
«für…» einander hat… dieser Punkt, an dem alles
schwarz wird vor Weiß und bevor man dem
Anderen überhaupt wieder gewahr wird, man
wieder überhaupt Augen hat «für ihn»; und
umgekehrt dieser für einen, das Für-einander,
das Mit-einander, in das man wieder sinkt. Für
diesen Moment stimmt dies, zu sagen, man
schlafe nur «bei …»: denn für dieses kleine, sich
in sich erfüllende Momentum, diesem Hauch,
dieser Kleinigkeit eines egoistischen Glücks tritt
18
dieser, der oder die Andere, notwendig in den
Hintergrund, gerät, wenn auch nur kurz, zur
Kulisse meiner gerade eben sich ablegenden
Obsessionen und meiner Erregung; für diesen
Augenblick ist es wieder jenes unbestimmte
«Ich», das in sich ruht, sein eigener Ruhepol nicht
wird, sondern ist, der Nordpol inmitten Eiswüste
des gestillten Verlangens außer dem es nichts
gibt, keinen Anderen, nur eine Anwesenheit, die
«ich» ist und satt. In diesem Moment dann
schlafe ich nur, bin ich nur «bei …», und bin es
auch nicht, bin augenblicklich wieder verbannt in
die Einsamkeit, bin meine auf sich
zurückgeworfene Gegenwart von einem
Augenblick auf den anderen, der genauso
unvermittelt, mit eben einem solchen Augen-
blick wieder zurückkehrt. Denn wir schlafen ja
auch nicht. Wir ruhen, jeder «bei …», in sich, für
sich. Was das Schweigen in diesen Moment so
schön macht. Weil es das Zerreden da noch gar
nicht wieder braucht, es ein Reden da gar nicht
bedarf.
19
«Ich» ganz bei «sich» und das Nur-
Erahnen des Anderen
Ein Ganz-bei-sich-zu-Hause-Sein, so wie man es
als Kind noch erfährt, wenn einem ein Ball
ungestüm und unvermittelt zum Gefährten
gerät: Das Bewusstsein – im kindlichen Spiel der
da noch ausgelebten Naivität – diesem, dem Ball,
ein anderes solches zuschreibt, ganz so, wie man
dem «bösen Tisch», dessen Kante, an der man
sich stößt, ein bewusstes Wollen zuschreibt und
diesen für seine Niedertracht schilt, und dabei
doch nur den Beobachterstandpunkt verschiebt,
man unverwandt zum Spielball und «Ballspiel»
unseres nur je eigenen Bewusstseins gerät; und
ebendieses unser Bewusstsein es ist, das für uns
die Welt belebt – noch bevor wir lernen, dass ein
Ball doch nur ein Ding sei, dieses in der
unbelebten Materie eines unter vielen ist und
wir nur eine Einzelner, der sich in der anonymen
Masse verliert.
Umgekehrt ist dieses Ganz-bei-sich-Sein kein
Grund, warum man schreibt. In Wirklichkeit
interessiert sich niemand für das ihm
20
vorgehaltene Glück eines Anderen. Es rührt ihn
ja nicht. Es rührt ihn nicht an. Genauso wie das
Glück, das dem Anderen, wodurch auch immer,
vorbehalten wird, mir nur zum Motor werden
kann, indem ich ganz einfach dessen
Voraussetzungen, Glück empfinden zu können,
mit den meinen vertausche. Ich die meinen,
meine eigenen Voraussetzungen daran knüpfen
möchte: Was ein verfehltes Tun! Weil die Kinder
auf dem afrikanischen Kontinent so wenig, zu
wenig, zu essen haben oder der Zufall der Geburt
malaysische Näherinnen in ein Schicksal drängt,
bei merklich zu geringen Löhnen und
katastrophalen Arbeitsbedingungen chronisch
unterbezahlt und überarbeitet zu schuften, soll
ich hier und jetzt nicht glücklich sein? Nur weil
eine Geburt andernorts mir ein Leben mit
anderen Privilegien zufällig ermöglicht hat? Im
Gegenteil! Gerade im Bewusstsein eben der
Privilegien, die ich hier (und im Übrigen nur
scheinbar) genieße, wäre es einfach (auch) nicht
das Richtige, die Momente, die diese (vor allem
materielle) Absicherung mir ermöglicht, nicht
wahrzunehmen. Diese – mit dem Wissen und um
der Anderen, weil unterprivilegierten, willen –
nicht genießen zu können. Das bedeutet eine
Verkehrung der Lage, die keine notwendige ist,
die sogar eine recht anmaßende ist, da sie das
21
grundlos empfangene Glück nicht einmal und
gerade ungeachtet des vermeintlichen Leids der
Anderen nicht einmal zu schätzen weiß. (In
Wirklichkeit habe ich zudem, besieht man es
noch einmal, absolut keine Ahnung, wie genau
eine malaysische Näherin sich fühlen mag.)
Umgekehrt bedeutet eben eine solche materielle
Absicherung aber eben noch keinen Garanten
auf ein glückliches oder geglücktes Leben,
genauso wie ein, in unseren Augen rein materiell
recht beschränktes Leben, einfach kein Unglück
bedeuten muss, sondern auch eines sein kann,
dass diese vermeintliche Beschränkung gar nicht
bemerkt, sondern trotz alledem reich an
Erfahrung und Frohsinn sein könnte.
Aber komme ich zurück auf das Schreiben: Ein
Leben, das reich ist an solch stillen Erfahrungen
des Glücks, nicht der lauteren Freude, deren Ort
ich eher im Miteinander und der gegenseitigen
Anteilnahme sehe, wird keines sein, das zum
Papier drängt. Glück treibt nicht an, zu nichts, ist
kein Motor. Warum auch? Der Grund, warum
glückliche Menschen einfach keine Bücher
schreiben. Oder zumindest keine guten. Keine
Literatur, nicht Verbleibendes. Weil doch nichts
verbleibt: Alles wird ausgelöscht sein. Weil
22
Schreiben bedeutet notwendig immer schon ein
Bewusstsein von etwas Anderem, einem
Anderssein, etwas, das fehlt, «du» oder «es»
fehlt, ich schreibe, weil «du» fehlst, «ich» aber
ganze Welten erschaffen, auferstehen lassen
(und eben doch genauso wieder zertrümmern
kann), aber weil ich den Tod doch nicht aufhalten
kann, weil ich ihn doch nicht aufhalten konnte,
schreibe ich, ich schreibe an, obwohl ich doch
weiß, dass auch diese schriftliche Fixierung – an
sich immaterieller – Worte doch nichts an deren
Vergehen ändern wird: Mit meinem Bewusstsein
stirbt eine ganze Welt. Nämlich, die von mir nur
Wahrgenommene, welche dieses konstituiert.
Schreiben daher ist Utopie. Das Zielen auf eine
Unmöglichkeit. Das Ahnen auf eine Vermittlung
ebendieser Welt. Von der man jetzt schon weiß,
dass sie schon darum ausgelöscht sein wird, weil
diese Vermittlung bedeutet eben doch auch
schon ein Anderssein, sie nicht dieselbe bleiben
kann, weil sie eine nur Mittel- und nur
Mitteilbare darin wird. Schreiben ist ein Nur-
Erahnen des ganz Anderen. Ein Ertasten. Ein
absurdes Tun gleich aber jedweden Tuns. Der
bedingenden Möglichkeit oder der unbedingten
Notwendigkeit einer Veränderung. Des
Nichtfixierbaren, welches das Denken ist:
flüchtig, auch das eigene, lässt sich nicht fassen.
23
Vice versa ist Lesen, ganz gleich, wie viel und wie
oft und was, daher nicht nur auch immer
Aufbruch, sondern auch Ausbruch: es hilft einem,
einen aus diesen klammen Hallen des nur je
eigenen Kopfes zu befreien – diesem Hort der
höchsten Hochstimmung, der sich einem von
jetzt auf gleich in ein Gefängnis verkehren kann.
Indem sie, die Sprache, das Zu-Lesende einen
immer mit etwas Anderem konfrontiert, sofern
man nicht der Sprechende ist, liegt in ihr eine
wahrhaft bewusstseinserweiternde Wirkung. Zu
lesen bedeutet auch immer schon die
Konfrontation mit der subjektiv gebrochenen
Wirklichkeit eines Anderen. Und umgekehrt, was
zur Sprache drängt, was mich zum Sprechen
drängt, sind immer auch bereits die Anderen.
Sonst verbliebe es ja bei jenem formlos wie
sinnfreien Daher-Brabbeln des kleinen Kindes:
Eine Privatsprache bedürfte nicht des Laut-
Gegeben-Werdens, einer Artikulation, der Aus-
sprache. –
24
Mutter sagt, drängt das Kind, das eh zu spät
spricht, zur Antwort: „Sag mal: ‹Ma-ma›!“ Das
Kind, mitteilsam ob der Freude ihrer
Anwesenheit, formt, spitzt die Lippen, quiekt
einvernehmlich, – und lacht, schreit: „PA-PA!“
Freude erscheint mir vor allem als etwas, was ich
nicht allein an mir finden kann, ich empfinde
diese nicht losgelöst von allem anderen und nur
aus mir heraus, ganz so, wie man sich eben einen
Witz auch nicht selber erzählt; ja, gar nicht
erzählen kann: Ich kenne die Pointe ja da bereits
schon, es macht wenig Sinn und auch keinen
Spaß. Während ein Witz – und lese ich einen
solchen auch nur in der Zeitung –, der mir gefällt,
der mir Freude bereitet, der mich lächeln oder
auch lauthals loslachen lässt, eben einen Anteil
nehmen lässt: Ganz einfach, indem er mir so,
und nur so, mit-geteilt wird. – Darin buhlt
implizit etwas, ein Anderer oder ein Anderes,
und auch wenn dieses gerade auch als abwesend
erscheint, eben ganz um die meine
Aufmerksamkeit, bestätigt mich darin, wird aber
auch gleichsam von mir wahrgenommen.
Umgekehrt trifft man immer wieder auch Leute,
die rücken sich gerade durch recht derbplatte
oder nur grobe Scherze mitten ins Licht, drängen
sich einem auf, werben damit um Sympathie und
Anerkennung für ihre Person. Was bei einem
25
Narzissten, den ich einmal traf, in der
Verkehrung gipfelte, dass dieser, nur um in der
Aufmerksamkeit, der Zuneigung der anderen zu
stehen (dies schien mir, als Laien, ein Symptom
für sein, aber auch ohnehin als krankhaft
diagnostiziertes Verhalten), bereit war, sich
selbst über die Maßen zu verunglimpfen und zu
erniedrigen eben in einem solchen
vermeintlichen Scherz, das von diesem ebenso
nur um Selbstbestätigung ringenden «Ich» kein
guter Schein und Haarteil mehr übrig blieb.
Freude ist zumeist die geteilte Zeit, Zeit als
solche vielleicht gar eine Teilung, eine zuvor-
gehende grundlegende Asynchronität. Das Leben
ist in Spaltung. Freude bedeutet jedoch meiner
Erfahrung nach implizit immer schon das
Anwesendsein eines Anderen. Und dies, auch
wenn dieser oft auch abwesend sein mag: wie
oben im Ballspiel, wenn uns unser Bewusstsein
einen Streich spielt, dieser Andere derart
abwesend ist, indem es ihn doch gar nicht gibt.
Jedoch auch dort, wo wir uns als abgeschieden,
zurückgezogen und in scheinbar «stiller Freude»
scheinbar nur mit uns selbst finden (und wo,
nicht auszuschließen, Freude und Glück
womöglich in einander übergehen können oder
26
korrespondieren), selbst dort, in jenem
vorgeblich stillen In-sich-hinein-Lächeln, richtet
sich dieses Lächeln an etwas oder den Anderen:
Es hat eben auch nicht viel von Sinn, dröge vor
sich her zu grinsen. Sofreuen wir uns doch über
ein Anderes; oder auch mit, oder vielleicht auch
für den einen oder Anderen; dieser buhlt darin
um unsere Aufmerksamkeit, was uns wieder
schmeichelt, es scheint wieder so, als spricht es
uns, und nur uns, an. Das Glück hingegen ist
nicht so mitteilsam, ist vielleicht gar nicht mit-
teilbar, weil ein unmittelbares Empfinden:
Derjenige, der das sagt, „Ich bin eben glücklich.“,
lügt da bereits und vielleicht nur unbewusst
schon, weil er es schon nicht mehr ist, es, das
Glück, ihn, um dies zu artikulieren, schon wieder
muss losgelassen, ihn verlassen, von ihm
abgelassen haben.
Insofern ist Sprache (vgl. Lévinas 32002) aber
auch immer schon ein Gerufensein, ein
Aufgerufensein zur Antwort, ich bin aufgerufen
zu antworten, mich auszudrücken, zu ver-
antworten, mich und den Anderen und den sich
stiftenden Sinn dazwischen mit-zu-teilen. Indem
sie hilft, allein schon die Grautöne
wahrzunehmen (von Farben und deren Nuancen
27
muss ja zunächst nicht einmal wortwörtlich die
Rede sein), man lernt, dass es böse Menschen
beispielsweise so vielleicht gar nicht gibt, dafür
aber vielleicht eine Gemengelage aus weit
verstreuten, verschlungenen, mitunter sehr
persönlichen Motiven, von denen manche
schlechter sind als andere, indem sie dem
vielleicht mehr berechtigten Interesse anderer
zuwiderlaufen... usw. usf. kann man vermittels
des kleinen Umwegs der Sprache zu einer
bewussten Erweiterung und einer
differenzierteren Betrachtungsweise gelangen,
zumal so es nur allzu oft für uns scheint, dass
andere Menschen manchmal kontraintuitiv oder
gar grob anders, als man selbst würde, handeln.
– Sprich, im günstigsten Fall wird man toleranter,
hält sich dann und wann mit vorschnellen
Urteilen zurück und glaubt nicht allem nur vom
Hörensagen.
28
Eine defizitäre Fülle: Krisis und
Sackgassen des Denkens
Es gibt da aber noch einen anderen Grund,
warum man sich üben sollte, «aus sich»
auszubrechen üben sollte, aus eben jener
selbstzentrierten Perspektive, aus der man doch
nie heraus kann; darin schlicht geübt sein sollte
diese zu relativieren, indem man «sich» in
Relation setzt: Nur allzu oft steht auch da, ganz
ohne jene Repressalien von außen, denen wir
uns als Bewohner der westlichen Hemisphäre in
dieser besten aller möglichen Welten, so heißt
es, weit weniger ausgesetzt sehen, trotzdem
doch noch eben derselbe Befund. (Ich möchte
hier nicht das Privileg, mit dem ausgestattet wir
uns sehen, dass diese Repression und
Restriktionen auf ein Minimum reduziert sind
oder sein sollen, nicht kleinreden. Andererseits
schreibe ich dies auch in dem Bewusstsein, dass
diese verbunden sind mit einer Ideologie und ich
mir nicht sicher bin, ob diese Privilegien, von
denen wir genau genommen nicht wissen, wie
sie uns zukommen, nicht auf der anderen Seite
vielleicht teuer erkaufte sind. Es unter diesen
ideologischen Schranken einfach nur andere
Probleme auswerfen, die sich uns indes und
29
ohne große Beachtung eingepfercht unter
diesem uns gut behütenden und überdeckenden
Mantel trotzdem doch aufdrängen.)
Mitunter wird doch auch da Leben noch zu einer
schwer zu oder kaum mehr noch erfüllbaren
Aufgabe. Mag sein, vielleicht generieren wir
dann nur andere Probleme, jedoch gelingt es
letztlich ebenso schwer, diese zu erfüllen:
Irgendwann gelangt das eigene Denken auch da
und selbst dort– oder gerade dort: bedenkt man
die Freiräume, die ihm, dem Denken, im
(vermeintlichen) Streben nach und dem Drang
auf Individualisierung eröffnet werden –an einen
Punkt, da findet es sich gefangen: All der
Übermut, die Freuden der Jugend, von denen ich
nicht einmal weiß, ob die uns überkommene
Lebensweise des Westens uns auch in einer Art
und Weise privilegiert, dass diese sich häuften,
halten diesem nicht stand. Plötzlich findet man
«sich», drücken wir es durchaus so unpersönlich
aus, gefangen in seinem nur-eigenen Denken
wieder: Und all das, was man bisher als
Unbestimmt- und Frei-Sein erlebt hat, jene
vorgebliche Autonomie, die Grundlage unserer
unbedingten Individualität sei, mit denen uns die
Ideologie des Westens, sie ist eben auch nur das,
30
ausgestattet sieht und hat, diese verkehrt sich
urplötzlich in ein Gegenteil; man findet sich
stockend, zögernd und zurückhaltend vor all den
sich vor einem auftuenden Möglichkeiten, die
den Weg und die Strecke für das künftige Leben
abstecken könnten.
Nur findet diese vorgebliche Zukunft nie statt.
Indem man eine Wahl herauszögert (und obwohl
man sich doch schon immer, zumindest ein Stück
weit, doch auch festgelegt hat) –, man alle diese
möglichen Alternativen immer vor Augen in der
Schwebe lässt und die Tage ins Land ziehen sieht
– zeigt man dem eigenen Bewusstsein nur seine
eigenen Aporien, eben ‚nicht-gangbare Wege‘
auf. Und infolge der es nicht wundert, dass es, so
bedrängt, zu einem ‚Umschlag‘ drängt – nichts
anderes meint das dem Altgriechischen
entlehnte Krisis, die wir spät und gern erst mit
und in der Mitte des Lebens als verorten –
alsMidlife-Crisis, Letztere ursprünglich das
‚Moment, in dem etwas umschlägt‘. Ebenso wie
hier der kindlich-naive Glaube an eine
Autonomie umschlagen muss: der nichts anderes
als ein Egoismus ist. – Einer, der sich bis dahin
nicht hinterfragen muss, der unhinterfragt bleibt.
Eine Genusssucht, Lust, eine Maßlosigkeit und
31
Fülle, die plötzlich erkennt, dass sie eine
defizitäre ist. Eine defizitäre Fülle, die einen
immer nur in «sich» selbst verharren lässt, seiner
nur-eigenen Gegenwart und letztlich einer
Passivität, in der «man» sich einrichtet und an
die gekettet «man» sich findet; die jede mögliche
Zukunft sich offen lassend, gerade eine solche
unmöglich macht. Diese sich verkehren lässt. In
die schiere Unmöglichkeit eben einer solchen
Zukunft: «Man» ist immer nur man selbst, lebt
allein, getrennt und abgeschieden von den
Anderen. Leben, das Sein, ist Last, ist Gekettet-
Sein, ist Einsamkeit und Identität nur ein sich
fortsetzende «Sich»-nicht-entrinnen-Können.
„Ich empfand Mitleid mit ihr – da sie so
unbedarft war und keine Ahnung von der
Wirklichkeit hatte.“, ist ein harter Satz, der in
diesem Fall ein ganzes Erklärungs- und
Deutungsmuster abkanzelt. Umso härter ist
dieser, wenn man weiß, dass es der Satz eines
Kindes ist, der aus seiner Perspektive über eben
ein solches, das ihm in persona der Mutter eines
Freundes begegnet ist, die für seinen Geschmack
zu sehr der Esoterik und dem Aberglauben
anhängt, urteilt. Sympathisch wird einem dieses
altkluge Kind, das nichts anderes als das für eine
32
der Geschichten in „Brave and Cruel“ (1948)
wiederauflebende kindlicheAlter Ego Denton
Welchs ist, aber wieder sofort, wenn nur vier
Sätze danach es selbst ein solches Bedürfnis nach
einem eben solchen Muster des Verstehens
signalisiert: „Zuerst freute ich mich; aber dann
regte sich in mir das Gefühl, von keinem
verstanden zu werden, und ich sehnte mich
danach, wegzukommen und allein zu sein.“
(Welch 1992, S. 43), bekennt dieses dann.
Nicht verstehen, was mit einem geschieht und in
der Welt vorgeht,vice versa auch (in diesem
Fragen) nicht verstanden werden, scheint mir
eine der basalsten (aber auch banalsten) Fragen,
die man an sich und dieses Leben stellen
kann.“What the hell are we doing?”, diese nur
scheinbar simple Frage – einer Szene aus einem
Lukas Moodysson-Film entnommen – wie der
Befund: “We‘re fucking crazy!”, „“man, wir, ich,
… stelle mir sie viel zu selten, was, welche man
sich doch in der absurdesten aller Situationen –
und absurd sind sie letztlich alle – ohnehin fragt.
Im Alltagstrott vergisst man sie; tritt nicht hinter
diesen, hinter sich zurück, nimmt sich beiseite
und fragt sich nur kurz: „Was, verdammt
nochmal, mache ich hier eigentlich?“ Vielleicht
33
wäre dies heilsam und ließe einen öfter mal
ausbrechen – ganz ohne jene Scheuklappen
eines nun mal so eingeschlagenen Pfads durch
die eingegangenen Verpflichtungen und
Entscheidungen, die getroffen man hat.
Ebenjenes vermeintlichen «Müssens», von dem
aber genau besehen und, ist man sich der
einzigartigen Chance, die dieses Leben bedeutet,
erst mal bewusst, keines so recht von Bestand
ist, ist man erst mal in der Lage seinen
Standpunkt zu verlagern. Dasmuss man können.
Seine Perspektive ändern, seinen Horizont
verlagern, bei Seite treten können – all das kann
man sich aneignen. Und plötzlich ist alles, nein,
nicht weniger absurd, nur empfunden wird dies
weniger als Problem als ehedem; es trübt nicht
die Wahrnehmung, diese Tristesse eines als
ohnehin sinnlos wahrgenommenen Alltags, der
Grauschleier endlos vergeudeter Tage, die
Stunden, die keiner einem wiederbringt, die
besser zu nutzen, man aber auch nicht weiß. All
dies – wie weggefegt, und nur durch eine
Standpunktverlagerung, die mich eben jene Tage
nicht aus einer Deckung der Distanzierung
erleben lassen, sondern als das distanzlose
Tagewerk eines sich an bietender Erfahrung
34
reichen Lebens, das zu füllen, zu erfühlen und
ertasten, mir aufgegeben ist. – Bis auf Widerruf.
Der mich ereilt, wenn ich schon nicht mehr bin,
und von dem ich bis dahin nicht weiß, wann
genau er eintreten mag. Leben daher ist eine
ganz sinnfreie Wette auf die Zukunft. Von
ebender ich nur weiß, dass ich gute Gründe
anzunehmen habe, dass diese irgendwann an
einen Endpunkt gelangen wird, die persönliche
Zeit folglich immer eine begrenzte sein wird,
aber bis dahin auch eine unbestimmte, mit der
ich nicht geizen muss, wo es mir nicht beliebt:
der Tod wird immer ein vertragter sein, bis er
eintritt, und die Zeit, die bleibt, wird die Spanne
sein, in der und von der ich mich ab und zu öfter
fragen sollte, was, zur Hölle, ich da eigentlich
gerade mache.
Sie ist die mir zur Verfügung stehende, immer
auch mich begrenzende, auf mich begrenzte
Gegenwart. Das bin nicht-feststellbar, immer-
noch-zu-bestimmen: «ich». Zukunft ist immer
schon ein Nicht-bei-mir-Sein, etwas, das mir
zustößt, etwas, das schon nicht mehr «ich» ist.
35
Eine kurze Verlagerung des Horizonts
Leben ist notwendige Last, aber auch ein
Glücksempfinden ab und an. Ich sagte oben, es
gebe nun mal keinen Königsweg, und zu sagen,
die Arbeitsbedingungen und damit die
Voraussetzungen, die es jenen ebenda schlicht
erschweren oder in manchem Falle es gar
unmöglich machen, so etwas wie Glück zu
empfinden (kehren wir noch einmal zurück zu
den Näherinnen Malaysias, deren Ausbeutung
und damit auch dem Elend dieser Welt), liege
nur in deren Eigenverantwortung, dies von
ebendiesen zu sagen, was nichts anderes ist, als
dies zu diesenzu sagen, wäre eben auch nur der
zynische Kommentar aus eben einer
privilegierten Position heraus – die um eben
diese Privilegien wissen und es daher für sich
besser wissen sollte und es im Grunde ja auch
weiß: Nichts anderes meint ja der
beißreflexartige Verweis auf eine soeben da
vorgehaltene Eigenverantwortung, von der ich
gar nicht nichts weiß, nicht einmal, ob ich sie
dem Anderen so zumuten kann oder darf, und
welcher hier nur die Bürde der je eigenen, der
36
meinen Verantwortung verschiebt, von der ich
sehr wohl weiß, weil es mir, und nur mir, obliegt,
mich oder überhaupt zu ver-antworten. Was also
kann ich tun? Was ist das Angemessene?
Nun, zunächst nicht viel. Zunächst lehrt dies
Demut, oder sollte diese lehren, und ruft zur
Verantwortung auf, die man eben nicht
losgelöst, die man eben nicht nur «für sich»
selbst hat – das ist eine Vorstellung, die es sich
zu einfach macht –, sondern sich als Selbst
immer schon in Beziehung weiß, eingebettet in
eine Pluralität vieler, konkreter, zwar äußerlich
bleibender, aber unveräußerlicher Anderer. In
deren Verantwortung wir uns finden, sobald wir
unsere nur-subjektive Gegenwart durch deren
Anwesenheit aufgebrochen wissen.
Was nun aber nicht heißt, man sollte (oder
könnte überhaupt) solche Momente des Glücks,
des in-sich-gekehrten Bei-sich-Seins missen – um
des Leids oder momentanen Unglücks der
Anderen willen. Das ist schlecht möglich, und
auch eine ziemlich sinnlose Unternehmung:
Weil,was änderte das auch? Weil ich mir mein
Glück versage, ist noch niemanden geholfen.
37
Dennoch lehrt diese Erfahrung der «Zu-kunft»
(vgl. hierzu: Levinas 2003) oder des Hinzutretens
des Anderen zum einen, dass der eigene
Standpunkt in der Welt des Interpersonalen, die
ihm da begegnet, nur ein begrenzter Wirkkreis
ist: der Andere oder das Andere setzt meinem
Können eine Grenze, gebietet Einhalt. (vgl. ebd.,
aber auch: Lévinas 32002) Weshalb es nun auch
ziemlich einfältig ist, zu denken, ich allein könnte
die Macht- und Verteilungsprinzipien,die
Regulationstechniken und
(bevölkerungs)strukturbedingten Maßnahmen
und Mechanismen, die andernorts, an einem
weit entfernten Ort der Welt (und trotz all der
virtuell suggerierten Nähe eines sich
globalisierenden Dorfs) dazu führen, dass Kinder
nichts zu essen haben oder Frauen bis zur
Erschöpfung unter nicht akzeptablen
Arbeitsbedingungen schuften zu lassen, aus den
Angeln heben. Ich kann es nicht. Das kann ich
nicht allein, das verkennt meinen begrenzten
Wirkkreis, und ist nicht nur ein zu hoher
Anspruch, sondern auch ein recht
chauvinistischer, der in seinem
Gutmenschentum und Sendungsbewusstsein
den alten Kolonialherren, die diese Prinzipien
und Mechanismen erst mit angestoßen haben,
38
besieht man es einmal recht nüchtern, doch in
nichts nach steht: Eine Änderung der
Verhältnisse sollte zuerst da ansetzen, wo sie
auch verlangt wird, verlangt ist, das heißt, ein
Bedürfnis wird: Im Kopf, und zwar genau, in
jenen der eben davon Betroffenen. Weil
ansonsten eine Veränderung von einem
privilegierten Standpunkt aus immer (wieder)
nur ein oktroyierter, paternalistischer Akt von
oben herab bleiben wird. Die Verantwortung, die
ich ohne Frage zwar habe und die diese
bestehenden Verhältnisse nicht entschuldigt
(diese aber auch nicht verschuldet hat, solange
sie nicht beiträgt, diese zu zementieren), reicht
aber nicht so weit, kann das Denken und
Handeln dem Anderen nicht abnehmen. Dies
würde seinen Standpunkt schier missachten.
Außerdem stoße ich schon an meine Grenzen,
versuche ich auch nur an der direkten
Nachbarstür irgendetwas aus den Angeln zu
heben.
Hier, vor Ort, kann ich nur so viel tun, diese
bestehende Ungerechtigkeit nicht insofern
aufrecht zu erhalten, indem ich sie auch noch
unterstütze, ich – was schon schwer genug zu
kontrollieren oder nachvollziehen für mich ist –
nicht deren leichtfertiger Nutznießer bin. Zum
39
anderen lehrt es mir Demut, für meine Lage,
lässt mein nur-persönliches Glück ab und an in
den Hintergrund treten, was kein Verzicht sein
muss, nicht als solcher empfunden werden muss,
gewinne ich doch in der geteilten Zeit mit dem
Anderen, doch auch an Profil, an Kontur – in dem
sich dieser an mich, und nur an mich, wendet, an
Freude – die sich als eine geteilte einstellt – und
an einem das persönliche Glück und Geschick
übersteigernde Auffassung vom Leben, die mich
nicht ohne Sinn zwischen Anderen einen Platz
einnehmen lässt: Kein Mensch trägt die Welt
allein, und ich kann zutun, das dem so bleibt.
Allerdings auch nicht mehr als das.
40
Was ist Glück? oder Das Leben, einfach.
Eine kurze, wenn nicht unmissverständliche, so doch noch nicht
abschließende Betrachtung dieser immer offenen Frage
geäußert von einem nicht notwendig überpersönlichen
Standpunkt aus, aber aus einem des Irreduzibel-Subjektiven
im Verstehen der Welt und damit einem der unaufhebbaren
Pluralität von Meinungen über ebendiese heraus.
Verzeichnis der angeführten Schriften und
der darüber hinaus verwendeten Quellen:
Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, Übersetzt und
herausgegeben von Olof Gigon, München 1972.
[=Zweite, überarbeitete Auflage der Ausgabe des
Artemis Verlags aus der »Bibliothek der Alten Welt«,
Zürich und München 21967.]]
Levinas, Emmanuel: Die Zeit und der Andere (Übersetzung
von: Le Temps et l‘Autre, Neuauflage, Montpellier 1979),
Übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Ludwig
Wenzler, Neuausgabe, Hamburg 2003. [=Meiner
Philosophische Bibliothek Bd. 546]
Lévinas, Emmanuel: Totalität und Unendlichkeit. Versuch
über die Exteriorität (Übersetzung von: Totalité et infini.
41
Essai sur l’extériorité, Den Haag 1961), Übers. von
Wolfgang Nikolaus Krewani, Studienausgabe, Freiburg im
Breisgau, München 32002.
Raus aus Åmål (Fucking Åmål), Regie und Buch: Lukas
Moodysson, Darsteller: Alexandra Dahlström, Rebecka
Liljeberg u. a., Spielfilm (Coming of Age-, Jugend-,
Drama), 89 Min. Laufzeit, Schweden, Dänemark 1998.
Welch, Denton: III. Narcissus Bay, in: Tapfer und grausam.
Und andere Erzählungen (Übersetzung von: Brave and
Cruel, London 1948), Deutsch von Helga Pfetsch,
Frankfurt am Main 1992.