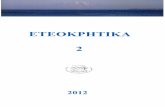Die Konkurrenz der Gruppen. Visualisierungsstrategien von Erzbischöfen und Domkanonikern im Mainzer...
Transcript of Die Konkurrenz der Gruppen. Visualisierungsstrategien von Erzbischöfen und Domkanonikern im Mainzer...
2
Kasseler Studien zur SepulkralkulturHerausgeber: Prof. Dr. theol. Reiner SörriesZentralinstitut für Sepulkralkultur, Kassel
unter Mitwirkung des Beirats für Grundlagenforschungder Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V.:
Dr. phil. Norbert Fischer Claus Peter Müller-von der GrünDr. phil. Barbara Happe Prof. Dr. theol. Peter PoscharskyEsther Haß Prof. Dr. Ing. Gerhard RichterDr. phil. Barbara Leisner Dr. phil. Gerhard Seib
Band 11herausgegeben in Verbindung mit Dr. Stefanie Knöll
3
Creating IdentitiesDie Funktion von Grabmalen und öff entlichen Denkmalenin Gruppenbildungsprozessen
Internationale Fachtagung vom 30. Oktober bis 2. November 2003veranstaltet von der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur
Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V.
4
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publi kation in der Deutschen Nationalbibliografi e;detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Gefördert von:
Redaktion:Wolfgang Neumann
© Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. V., Kassel 2007Alle Rechte vorbehalten – Printed in GermanyISBN 3-924447-33-0
documenta-Stadt
Sponsoren:
Gerda Henkel StiftungKuratorium Deutsche Bestattungskultur e. V.Trauerhilfe Denk GmbH & Co KGDeutscher Naturwerkstein Verband e. V.
5
Inhalt
Reiner Sörries Vorwort Seite 9
Stefanie Knöll Einführung Seite 11
GESELLSCHAFTLICHE GRUPPEN
Caroline Huguenot Die Bedeutung der makedonischen Kammergräber für die Selbstdefi nition der makedonischen Oberschicht Seite 17
Marshall Walker Hearing the Individual Voice Seite 27
Annika Backe-Dahmen Kinderdarstellungen in der stadtrömischen Grabkunst der Freigelassenen in iulisch-claudischer Zeit Seite 35
Tilo Grabach Sic ars extollitur arte. Der Trauerapparat für Michelangelo Buonarroti als ephemeres Denkmal zur Nobilitierung der bildenden Künste Seite 47
Britta Kusch-Arnhold Ein Monument der Familie oder der Akademie? Zum Grabmal Michelangelo Buonarrotis in Santa Croce zu Florenz Seite 55
Kerstin Gernig Das Grabmalporträt als Ausdruck der Persönlichkeit Seite 67
6
KLERIKER UND KONFESSIONELLE GRUPPEN
Arne Karsten und Philipp Zitzlsperger Gesellschaftliche Gruppen und ihre sepulkralen Schnittmengen. Grabmäler in Santa Maria del Popolo zu Rom Seite 77
Stefan Heinz und Wolfgang Schmid Die Konkurrenz der Gruppen: Visualisierungsstrategien von Erzbischöfen und Domkanonikern im Mainzer Dom Seite 85
Kerstin Merkel Kardinal Albrecht von Brandenburg. Ein Individualist kehrt in die Gruppe zurück Seite 99
Katrin Bender Public life and death – Commemorating the Württemberg élite during the 16th and 17th centuries in the district town of Urach Seite 107
NATIONALE, REGIONALE UND ETHNISCHE GRUPPEN
Oliver Hülden Überlegungen zur identitätsstiftenden Wirkung lykischer Gräber Seite 121
Hadwiga Schörner Die griechische intraurbane Bestattung: eine identitätsstiftende Ausnahme von der Regel? Seite 135
Rafael Arnold Kontrastierende Sepulkraltraditionen: Sprach-, Schrift- und Grabmalswahl der sephardischen Juden in Venedig Seite 145
Paul Cockerham “Th ree into one won’t go”: monument selection in early modern Cornwall Seite 155
Michael Niedermeier Vor- und frühgeschichtliche Grabdenkmäler im frühen Landschaftsgarten Seite 163
Sonja Žitko Die Durchsetzung des slowenischen Nationalbewusstseins in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Grabdenkmäler für bedeutende Persönlichkeiten in Ljubljana Seite 173
7
Sanja Cvetnić Follow me: Popular public memorials in Croatia Seite 179
GRUPPEN UND CLANS
Stefan Rees Ein Grabdenkmal für Oscar Wilde Seite 187
Norbert Fischer Maritime Memorials – Tod, Gedächtnis und regionale Identität an der Nordseeküste Seite 197
Barbara Leisner Identität durch Krankheit? – Aids-Grabstätten in Deutschland Seite 205
GELEHRTE
Ruth Wolff Zur „Gruppe“ der Gelehrtengrabmäler des Mittelalters in Oberitalien Seite 219
Stefanie Knöll Funeral monuments to professors in 17th century Oxford Seite 231
KRIEGER, SIEGER, OPFER
Ann MacSween “Th e towering dead with their nightingales and psalms”: Scottish society refl ected in battlefi eld monuments Seite 243
Bettina Frederking Dem Helden zur Ehre oder der Nation zur Sühne? Die Denkmäler für den Duc de Berry im Frankreich der Restaurationszeit Seite 251
Roland Müller Ein Lob der Feigheit. Deserteure-Denkmale in der Bundesrepublik Deutschland Seite 263
8
Sabine Marschall Commemorating “Struggle Heroes”: Constructing a Genealogy for the New South Africa Seite 271
Ingeborg M. Rocker Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Erinnern, Bewahren, Hinterfragen Seite 285
DYNASTIEN UND FAMILIEN
Angelika Wulff Wohin mit den Kindern? Die Kindergräber von Royaumont: Denkmäler des Widerstreits zwischen Familienzugehörigkeit und Königswürde Seite 301
Andreas Zajic „Einen grabstain und schrüff t, meinen standt gezimblich …“ Grabdenkmal, Identität und soziale Gruppe beim österreichischen Adel in Spätmittelalter und Frühneuzeit Seite 321
Kurzbiografi en der Autorinnen und Autoren Seite 333
Abbildungsnachweis Seite 339
85
Stefan Heinz und Wolfgang Schmid
Die Konkurrenz der Gruppen: Visualisierungsstrategienvon Erzbischöfen und Domkanonikern im Mainzer Dom
Die Mainzer Stiftsfehde von 1462 markierte in allen Bereichen des politischen und wirtschaftlichen sowie des kirchlichen und kulturellen Lebens der Rheinmetropole eine folgenschwere Zäsur: Im Jahr 1459 war Diether von Isenburg zum Erzbischof gewählt worden, jedoch kam es 1461, aufgrund seiner ablehnenden Haltung gegenüber der hohen Palliumsgebühr der Kurie, zu seiner Exkommu-nikation, zur Absetzung und zur Inthronisation Adolfs von Nassau. Beide Erzbischöfe versuchten, den Streit für sich zu entscheiden, und so gewann Diether 1462 zwar die Schlacht bei Seckenheim, aber Adolf gelang es in einem Handstreich, Mainz zu erobern. Die Stadt wurde geplündert und teilweise niedergebrannt, zahlreiche Bürgerfamilien vertrieben, vor allem aber – und das ist für die Entwicklung der Stadt in den folgenden 300 Jahren von entscheidender Bedeutung – verlor Mainz seine Freiheiten und Privilegien sowie das Recht der Selbstverwaltung. Die Rheinmetropole wurde – so die Formulierung von Wolfgang Dobras – eine „Pfaff enstadt“.1
Trotz der überregionalen wirtschaftlichen Bedeutung des Ortes war Mainz somit seit dem Ende des 15. Jahrhunderts deutlich klerikal geprägt. Auch der Nürnberger Humanist Cochlaeus bezeichnet Mainz in seiner Deutschlandbeschreibung von 1512 als eine urbs clero insignis, archiepiscopo subdita.2
Ein Anzeichen für die soziale wie kulturelle Dominanz des Klerus ist die Tatsache, dass es kaum bür-gerliche Kunststiftungen gibt, während diese andernorts gerade in den Jahren vor der Reformation eine ausgesprochene Hochkonjunktur erlebten.3 Kunstpolitik bzw. Kunstförderung blieb folglich überwiegend den geistlichen Eliten vorbehalten, die sich in mehrere Gruppen einteilen lassen. Ne-ben dem Erzbischof ist an dieser Stelle der vielfältig gegliederte Welt- und Ordensklerus zu nennen, an der Spitze die Stiftsherren des Domkapitels und anderer Mainzer Stifte, wie St. Stephan, dann die Pfarrer, Vikare und Altaristen sowie schließlich die Mönche und Nonnen der verschiedenen Kon-gregationen mit ihren Vorstehern und Vorsteherinnen. Der Klerikerstand war also sozial vielfältig in sich gegliedert und brachte die Zugehörigkeit zu verschiedenen Korporationen durch bestimmte Zeichensysteme, u. a. durch eine standesspezifi sche Kleidung zum Ausdruck. Die Erzbischöfe und die Angehörigen des Domkapitels sind dabei die beiden exklusivsten und einfl ussreichsten Personen-verbände der Kathedralstadt, die ebendies auch in Form von Denkmälern deutlich machten.4
ERZBISCHOF UND DOMKAPITEL
Die Funktion eines Bischofs im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit unterscheidet sich grund-legend von der eines heutigen Oberhirten. Zur Leitung einer Diözese musste er nicht unbedingt
86
Priester sein, seine liturgischen Aufgaben konnte ein Weihbischof übernehmen. Der Mainzer Erzbi-schof bekleidete neben seinem Bischofsamt seit dem 8. Jahrhundert zudem das eines Metropoliten, der 13 Bistümern vorstand. Weiterhin war er weltlicher Herrschaftsträger in seinem Erzstift, war Heerführer und Burgenbauer, war Reichserzkanzler und gehörte seit dem 14. Jahrhundert als einer der sieben Kurfürsten dem exklusiven Personenverband an, der den römischen König wählte.5 Die Mainzer Erzbischöfe vermochten es stets, die uns heute schwer vereinbar erscheinenden geistlichen und weltlichen Seiten ihres Amtes unter einen Hut zu bringen.
Die Domkapitel bildeten seit dem frühen Mittelalter Klerikergemeinschaften, die das Stundengebet an den Kathedralkirchen organisierten. Die Domkanoniker lebten gemeinsam nach der Benedik-tinerregel (vita canonica), legten aber kein Armuts- und kein Gehorsamsgelübde ab. An ihrer Spitze stand als Vorsteher der Bischof. Im 10. Jahrhundert löste sich die gemeinsame Lebensform auf, gleichzeitig erfolgte eine Trennung von Bischofs- und Kapitelsgut; die Domkapitel wurden zu selb-ständigen Institutionen mit eigenem Wappen und eigenem Siegel. Im 13. Jahrhundert konsolidierte sich auch der personelle Umfang des Domkapitels, es entstand ein capitulum clausum mit begrenzten Zugangsmöglichkeiten. Das Mainzer Domkapitel bestand seit 1405 aus 41 Kanonikern, davon 24 Kapitulare und 17 Domizellare. Die Domherren verfügten über einen Sitz im Kapitel, einen Platz im Chor und waren Bezieher eines Einkommens. Innerhalb des Kapitels gab es außerdem einen en-geren Führungskreis, die fünf Dignitare. Er bestand aus dem Propst, dem Dekan, dem Kustos, dem Scholaster und dem Kantor.
Von seiner Funktion her gesehen, war das Domkapitel primär für die Organisation und feierliche Gestaltung des Gottesdienstes im Mainzer Dom verantwortlich, eine Aufgabe, für die später eine Vielzahl von Altaristen und Vikaren beschäftigt wurde. Weiter war das Kapitel ein zentrales geist-liches Verwaltungsorgan des Stiftes, es stellte die 19 Archidiakone und die Richter am geistlichen Gericht. Sein vornehmstes Recht war jedoch die Wahl des Erzbischofs, es war ferner sein Berater-gremium und übernahm seine Vertretung in Fällen der Sedisvakanz. Durch geschickte Wahlkapi-tulationen gelang es dem Domkapitel, seine Machtposition immer mehr auszubauen, zumal die Erzbischöfe vornehmlich ex gremio, also aus den eigenen Reihen gewählt wurden.6
Seit 1252 besaß das Mainzer Domkapitel ein Selbstergänzungsrecht, jedoch fehlte es nicht an Ver-suchen des Kaisers, des Papstes und des Erzbischofs, auf die Pfründenvergabe Einfl uss zu nehmen. Seit 1326 setzte die Aufnahme ins Kapitel die Ritterbürtigkeit des Kandidaten voraus. Mit einer „Ahnenprobe“ wurde der Nachweis des ritterlichen Standes von vier Vorfahren, also der Eltern und Großeltern, erbracht.7 In der Frühen Neuzeit stiegen die Anforderungen, man verlangte den Nach-weis einer standesgemäßen Abkunft von acht oder gar 16 Ahnen. Dadurch entstand ein exklusiver Personenverband, der sich zunächst gegen das Mainzer Bürgertum und zunehmend vom Niederadel abschloss. Die Rolle der „Ahnenprobe“ macht deutlich, warum an Grabmälern der Frühen Neuzeit die Heraldik einen so hohen Stellenwert besitzt.8 Neben der adeligen Geburt waren ein Residenzjahr, der Empfang der Subdiakonsweihe und ein mindestens zweijähriges Universitätsstudium weitere Voraussetzungen für die Aufnahme ins Domkapitel. Es entstand so ein eng mit einander verwandter Kreis von Personen, die versuchten, eine möglichst große Zahl von Pfründen an verschiedenen geist-lichen Institutionen zu erlangen. Die Pfründenkumulation vergrößerte nicht nur das Einkommen,
87
sondern auch den politischen und kirchenpolitischen Einfl uss, zumal die nicht selten promovierten Th eologen und Juristen die Schaltstellen in der geistlichen bzw. weltlichen Verwaltung besetzten. Auch an der Hochschule waren sie tätig, und es ist ein bemerkenswertes Faktum, dass wir gerade im Kölner, Trierer, Mainzer, Wormser und Straßburger Domkapitel eine ganze Reihe von Repräsentan-ten des rheinischen Humanismus fi nden.9 Kurzgefasst handelt es sich also um einen kleinen, selbst-bewussten und elitären Personenverband, der in der geistlichen Verwaltung, der Landesverwaltung und auf dem Weg der Pfründenhäufung in der Reichs- und Kirchenpolitik einen großen Einfl uss entfalten konnte. Ein nicht zu unterschätzender Faktor in diesem Verhältnis waren die oft vorhande-nen verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen Mitglieder.10
Stellt man beide Gruppen, die Erzbischöfe und Domkanoniker, einander gegenüber, so ist zu kon-statieren, dass beide – nicht nur gesellschaftlich und verfassungsrechtlich – eng zusammenhängen. Dennoch steht nach der Wahl und der Inthronisation der Erzbischof als ein aus dieser Gruppe gelöstes Individuum da. Er wird jedoch – wenn man einen längeren Zeitraum überblickt – vom individuellen Amtsinhaber zum Teil einer neuen Gruppe, die eine eigene Tradition kreierte, die auf eine Sukzession zurückblicken kann, die bis ins 5. Jahrhundert reicht, und die diese Ideen in Form einer steingehauenen Galerie der Amtsinhaber im Kirchenraum zum Ausdruck brachte.11
In der Kathedralkirche bietet sich nun die Möglichkeit, die Repräsentation der beiden Gruppen einander gegenüberzustellen, um in einer vergleichenden Perspektive zwei Fragen zu klären: Wie wird die Gruppenzugehörigkeit anhand von Grabdenkmälern dokumentiert und wie interagieren die Gruppen, wie reagieren sie auf die künstlerischen Vorgaben und Herausforderungen der anderen Würdenträger.12
DIE GRABMÄLER DER ERZBISCHÖFE
Die Mainzer Bischofsgrabmäler13 des 13. Jahrhunderts waren Tumben, von denen sich die Deck-platten erhalten haben, wie die berühmten Beispiele Siegfried von Eppstein († 1249) und Peter von Aspelt († 1320) belegen, die ikonografi sch zudem die Rolle der Mainzer Erzbischöfe bei der Königs-wahl thematisieren. Wie weit diese Bezüge gehen und ob man von „Königsmachern“ sprechen kann, ist dennoch schwer zu entscheiden.14
Der Typus der Tumba wird zwar im 14. Jahrhundert beibehalten, es wird jedoch ein neuer Grabmal-typ entwickelt, den man als „Mainzer Schema“ defi nieren kann. Den Anfang macht das Grabmal für Matthias von Bucheck († 1328). Einige Motive der Tumba werden beibehalten. So steht der Dargestellte immer noch auf Löwen und Drachen, immer noch in vollem Ornat und ist immer noch mit Krummstab und Mitra ausgerüstet. Ebenso bleibt die ausführliche Inschrift, welche die Tugend, die Frömmigkeit und die Amtsführung des Verstorbenen lobt. Neu ist hingegen die Organisation der Rahmung. Die Figur befi ndet sich zwar nach wie vor unter einem Architekturrahmen, allerdings wird dieser jetzt zur Aufnahme von Heiligenstatuetten umgerüstet. Dieser Vorgabe, einem weitge-hend festgelegten Schema aus einer Standfi gur des Bischofs im Architekturrahmen mit kleineren Heiligenfi guren, folgen alle bischöfl ichen Grabmäler im Mainzer Dom.
88
Den endgültigen Auftakt zur Serienbildung bildet das Grabmal des Diether von Isen-burg († 1482) (Abb. 1), welches in etwa so breit ist wie das als Vorbild dienende Nas-saugrabmal von 1419, aber deutlich höher. Die Pfeilerbreite des Mittelschiff s bildet das Standardmaß, das wie der Typus für die Monu mente verbindlich bleibt. Das Grab zeigt ein Bild Isenburgs mit durchaus indi-viduellen Zügen, der die liturgischen Ge-wänder trägt und in einem aufgeschlagenen Buch liest. Die Figur steht auf einem Sockel und wird von einem prachtvollen Baldachin aus ineinander verschränkten Eselsrücken bekrönt. Die Seiten entwickeln Nischen, in denen wiederum kleine Figuren eingestellt sind. – Das Isenburg-Monument befi ndet sich noch in einer Zwitterstellung zwischen dem Typus der Tumba und dem des Wand-denkmals: Die Höhe sprengt deutlich die Proportion der Grabplatte und ermöglicht so die Entfaltung der Rahmenarchitektur. Auf das Kissen wird ebenso verzichtet wie auf die Tiere zu Füßen des Verstorbenen; konsequent tritt an ihre Stelle ein Sockel für die Standfi gur. Beibehalten werden dagegen andere charakteristische Eigenheiten wie die Anbringung der Wappen an den vier Ecken oder das umlaufende Inschriftenband.
In dem letzten Viertel des 15. Jahrhun-derts, vermutlich im Zusammenhang mit
dem Sieg des Erzbischofs im Kampf um die Stadtherrschaft, verfestigte sich dieses Schema, es ent-stand eine eindrucksvolle Serie an den Pfeilern zum Mittelschiff .15 Dem Isenburg-Grabmal folgten die Monumente für den Administrator Adalbert von Sachsen († 1484), für Berthold von Henneberg († 1504) und schließlich für Jakob von Liebenstein († 1508) (Abb. 2). An sie erinnern eindrucksvolle Denkmäler, die formal alle dem „Mainzer Typus“ verpfl ichtet waren, die aber Größe und Aufwand von Grabmal zu Grabmal steigerten.
Am Epitaph für den 1514 verstorbenen Erzbischof Uriel von Gemmingen änderte sich zumindest kurzzeitig die Typologie der Monumente. Auf die Standfi gur wird verzichtet, und statt dessen fi ndet sich die szenische Darstellung einer „Ewigen Anbetung“: Der verstorbene Bischof kniet in Beglei-tung der Bistumspatrone Martin und Bonifaz vor dem Gekreuzigten. Diese Szenerie fi ndet in einem
Abb. 1: Mainz, Dom, Grabmal für
Erzbischof Diether von Isenburg († 1482)
89
Architekturrahmen statt, über dem sich Kapitelle und Kämpfersteine befi nden. Diese tragen einen Rundbogen, aus dem ein Baldachin hinausragt, der aus verfl ochtenen Kielbögen besteht. Man kann die Motivwahl und den Traditionsbruch sicherlich über den Auftraggeber, Uriels Nachfolger, den großen Mainzer Kirchenfürsten Albrecht von Brandenburg erklären, wobei es zu bedenken gilt, dass einige Ele-mente dem „Mainzer Schema“ vertraut bleiben. So ist das Festhalten an der Baldachinbekrönung und die Orientierung an der Pfeilerbreite ein deutliches Bekenntnis zur Tradition. Ob dieses traditionsorien-tierte Zugeständnis auch die Auswahl des Bildhauers mit einbezog, ist nicht auszuschließen.16 Unabhängig davon waren mit der Fertigstellung dieses Grabmals alle prominenten Plätze des Mittelschiff s besetzt.
Der 1545 verstorbene Albrecht plante seine Grab-stätte zunächst nicht in Mainz, sondern in Halle an der Saale. Als die religionspolitische Situation in Mitteldeutschland ein Begräbnis in der Rheinstadt notwendig machte, wählte er ein vergleichsweise traditionelles Denkmal im nördlichen Seitenschiff .17
Auch seine Nachfolger Sebastian von Heusenstamm († 1555), Daniel Brendel von Homburg († 1582) und Wolfgang von Dalberg († 1601) erhielten dort ihre Grabmonumente. Diese Denkmäler orientieren sich alle am „Mainzer Schema“, das jetzt im Sinne der Renaissance und des Manierismus umgedeutet wird. Danach bricht die Reihe für einige Jahrzehnte ab: Nach dem Grabmal für den 1601 verstorbenen Wolfgang von Dalberg entstand 80 Jahre lang kein Bischofsgrabmal im Mainzer Dom; eine Lücke, die bemerkenswert ist, weil eine andere Gruppe in diesem Zeitraum ausgesprochen aktiv ist, nämlich die Domkanoniker.
DIE GRABMONUMENTE DER DOMKANONIKER
Aus dem 13. und 14. Jahrhundert haben wir kaum Zeugnisse von monumentalen Kanonikergrab-mälern in Mainz. Meist handelt es sich um fl ache Grabsteine oder schmucklose Inschriftentafeln.18
Im Laufe des 15. Jahrhunderts vergrößert sich die Anzahl der Belege, beispielsweise erhielt der 1497 verstorbene Domdekan und Jerusalempilger Bernhard von Breidenbach eine Sandsteingrabplatte mit einer Liegefi gur des Verstorbenen, die im selben Atelier wie das Grabmal für Erzbischof Adalbert
Abb. 2: Mainz, Dom, Grabmal für
Erzbischof Jakob von Liebenstein († 1508)
90
von Sachsen († 1484) entstanden ist.19 Es kommt jedoch erst im 16. Jahrhundert zu einer ausge-sprochenen Wachstumsphase im Bereich der Grabmalstiftungen.
Einen ersten Vorstoß markiert das Grabmal für den einfl ussreichen Johann von Hattstein († 1518), der Domherr in Mainz und ma-gister fabricae war gister fabricae war gister fabricae (Abb. 3); es wurde gemäß der Inschrift „von seinen überlebenden Freunden“ 1522 gestiftet. Das Epitaph be-steht aus einem ornamentierten Sandsteinrahmen und einer aus Tuff stein gearbeiteten Pieta mit Maria Magdalena und Johannes. Vor diesen kniet der kleiner dar-gestellte Verstorbene als betender Stifter. Die Pieta ist sicherlich in dem Mainzer Atelier entstanden, welches am Mainzer Marktbrun-nen tätig war, wahrscheinlich
dem des Peter Schro.20 Darüber hinaus zeigen sich erstaunliche Parallelen zu Michelangelos berühm-ter Pieta in St. Peter. Auch wenn man in ähnlichem Maße auf spätgotische Vesperbilder verweisen könnte und die direkten Vorbilder somit ebensogut nördlich der Alpen liegen könnten, so sollte ein weiterer Faktor bedacht werden. Die dreisprachige Inschrift am Bogen (auf Latein, Griechisch und Hebräisch) macht das humanistisch geprägte Anspruchsniveau der Stifter deutlich. Diese Auftrag-geber – die „überlebenden Freunde“ – waren der Mainzer Humanistenkreis um Dietrich Zobel von Giebelstadt und Johanns Neff en Marquard von Hattstein, die in Rom das Pallium für Albrecht von Brandenburg in Empfang genommen hatten.
Die Kanoniker des Domstiftes standen folglich bei der Sorge um die eigene Memoria bzw. die Memoria eines Freundes nicht hinter den Erzbischöfen zurück. Diese Entwicklung einer im frühen 16. Jahrhun-dert beginnenden Steigerung des Repräsentationsbedürfnisses der Domkanoniker und deren Umset-zung in Form von Grabdenkmälern ist keineswegs singulär auf Mainz zu beziehen. Auch in den beiden anderen rheinischen Kathedralstädten lässt sich eine solche Entfaltung ablesen. Nachdem in Trier um 1523 das Grabmal für Otto von Breitbach sicherlich in Kenntnis der Hattstein-Pieta entstand, ließ um 1531 der Domdekan Christoph von Rheineck († 1535) in der Liebfrauenkirche, der Annexkirche des Doms, einen sechs Meter hohen Triumphbogen errichten.21 Weitaus kleiner, aber nicht minder spektakulär war das Epitaph, welches der Kölner Domkanoniker Jakob von Croy († 1516) aus vergol-deter Bronze in einem Brüsseler Atelier für den Kölner Dom anfertigen ließ.22 Die Grabdenkmäler für
Abb. 3: Mainz, Domkreuzgang,
Grabmal für Johannes von Hattstein († 1518)
91
Hattstein, Rheineck und Croy stellen als Grabmalstiftungen von Domkanonikern des begin-nenden 16. Jahrh. drei Stücke von außergewöhnlichem An-spruch dar. Sie sind zudem ein Beleg für ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein der Kanoni-ker, welches bereits ein Konkur-renzdenken vermuten lässt.23
Die Hattstein-Pieta von 1522 bleibt in Mainz vorerst eine Ausnahme. Erst am Ende des 16. Jahrhunderts setzt sich eine wahre Ausstattungswelle von Seiten des Domkapitels in Gang. Den Anfang dazu macht das Monument für den Dompropst und Bischof von Worms, Ge-org von Schönenburg († 1595) (Abb. 4), wobei bemerkenswert ist, dass mit dem neu einset-zenden Standesstolz des Kapi-tels auch eine Verlagerung der Begräbnisorte einhergeht. Die Hattstein-Pieta befi ndet sich noch heute an ihrem ursprüng-lichen Ort im Domkreuzgang. Dieser diente als Begräbnisplatz der Kanoniker; hier wurden auch die Domvikare und sogar einige Laien beerdigt. Das Quadrum war ein – wie Fritz Arens es formulierte – „wahres Museum von Grabsteinen und Kunstwerken“.24 Weitere bevorzugte Grabplätze lagen im Dom, in der Memorie, die in der Ecke zwischen dem südlichen Seitenschiff und dem westlichen Querhaus angebaut ist. Es handelt sich ursprünglich um den Kapitelsaal, der dann zunehmend als Begräbnisstätte genutzt wurde; vergleichbare Phänomene fi ndet man in Bamberg, Würzburg und Eichstätt. Auf dem Grund-riss, den der Mainzer Jurist Valentin Ferdinand von Gudenus 1747 anfertigte, sieht man die zahlrei-chen Grabplatten eingezeichnet, die belegen, dass der Boden und die Wände nahezu vollständig mit Grabplatten, Epitaphien und Totenschilden bedeckt gewesen sind.25 Mit dem Schönenburg-Grabmal begannen die Pröpste 1595, auch die Räume innerhalb der Kathedrale zu besetzen. Die Pfeiler des Gotteshauses blieben dabei den erzbischöfl ichen Monumenten vorbehalten. Die Kanoniker suchten sich eigene Repräsentationsplätze und wurden in den Querhäusern fündig.
Abb. 4: Mainz, Dom,
Grabmal für Dompropst Georg von Schönenburg († 1595)
92
Der Schönenburg-Grabaltar befi ndet sich an der Westwand des Südquerhauses.26 Das Monument, welches mit einer Höhe von 7m und einer Breite von 4m deutlich größer als die Bischofsgrabmäler ist, zeigt in der Mittelzone den Verstorbenen in „Ewiger Anbetung“ vor einem Kreuz, fl ankiert von den Apostelfürsten Petrus und Paulus. Darüber wird in einem Rundbogen das Amtswappen des Bistums Worms gezeigt, daneben der Namenspatron Georg und der Bistumspatron Martin, beide zu Pferd. Das kleinteilige manieristische Denkmal stammt von Peter Osten und seinem Schüler Hans Junker. Wie im zur gleichen Zeit in Trier tätigen Atelier des Hans Ruprecht Hoff mann verweisen die Formen in die Niederlande. Dieses Phänomen lässt sich über den Zeitstil sowie die Verwendung gleicher Vorlagen und Musterbücher erklären und kann nichtsdestoweniger als Treue zu Rom und als Bekenntnis zur katholischen Reform gedeutet werden.27
Im nördlichen Querhaus befand sich ursprünglich kein Bischofsgrabmal. Hier ist an der Westwand das Grabdenkmal des Domherren Johann Bernhard von der Gablentz († 1592) plaziert, im Aufbau ein Pendant zum Denkmal Schönenburgs, wenn auch weitaus kleiner. Eine zusätzliche Möglichkeit der Raumnutzung für Grabdenkmäler und Altäre boten die um 1300 an Nord- und Südseite des Domes angebauten Kapellenreihen. Allerdings muss man bei der heutigen Grundrissgestalt berück-sichtigen, dass die Domwiederherstellung des 19. Jahrhunderts massive Veränderungen verursacht hat. Die ehemals einjochigen Kapellen wurden zu größeren Räumen zusammengefasst, wodurch auch einige Altäre verloren gingen. In diesen Räumlichkeiten plazierten die Kanoniker im 17. Jahr-hundert ihre Grabdenkmäler, die gleichzeitig auch als Altäre dienten und ihre Namen bewahrten.
Zwischen 1601 und 1678 ist eine auff ällige Lücke in der Serie der Mainzer Bischofsdenkmäler fest-zustellen. In diesem Zeitraum von annähernd 80 Jahren saßen in Mainz sechs Bischöfe auf dem Th ron, aber nur ein einziges Bischofsgrabmal ist entstanden. Zudem handelt es sich bei diesem um eine Ausnahme, um einen Grabaltar, der an Georg Friedrich von Greiff enklau († 1629) erinnert. Der erst 1662 fertiggestellte, nur fragmentarisch erhaltene Altar zeigte ursprünglich den knienden Kurfürsten vor einem Relief der Marienkrönung. Dieser Altar schließt die relevante Lücke von 80 Jahren zum Teil, lässt sich aber dennoch wegen seiner Ikonografi e und seiner Aufstellung in der Mi-chaelskapelle als „Ausreißer“ auff assen, zumal er nicht den Repräsentationsanspruch eines Bischofs-grabmals preisgibt. Im Gegenzug muss man festhalten, dass im gleichen Zeitraum 1601 bis 1678 mindestens neun monumentale Kanonikergrabmäler entstanden sind. Zwar gab es wesentlich mehr Kanoniker als Bischöfe, auch existierten Kanonikergrabmäler schon vorher und in ungewöhnlicher Ausprägung, allerdings ist die Verhältnismäßigkeit auff ällig, vor allem da sie eine Umkehrung der Zahlen in vorangegangenen Jahrhunderten darstellt.
Daher sei festgehalten, dass der Grabaltar des Georg von Schönenburg von 1595 einen Neuanfang markiert und danach eine ganze Serie von Monumenten in rascher Folge errichtet werden: Um 1604 der Allerheiligenaltar des Philipp Cratz von Scharfenstein, 1605 das Epitaph Bodelschwing, um 1608 der Johannesaltar für Friedrich von Fürstenberg, 1610 der Bassenheimer Grabaltar, 1622 der Riedtsche Altar, 1656 der Lambertusaltar, 1657 Johann von Heppenheims Kreuzaltar, 1662 der heute verlorene Nazariusaltar und um 1668 der Saulheimer Altar.
93
Im Jahr 1678 entstand mit dem Grabdenkmal für Damian Hartard von der Leyen zwar wiederum ein Monument für einen Erzbischof, aber nur wenige Jahre später wurden im Ostchor weitere sechs Altäre geweiht, die auf Stiftungen der Mitglieder des Domkapitels zurückgehen.28 Danach gab es nur noch eine monumentale Kanonikerstiftung, die des Dompropstes Heinrich Ferdinand von der Leyen, wobei diese noch einmal alle Register sepulkraler Repräsentation zieht. Im Südquerhaus, ge-genüber dem Schönenburg-Grabmal und dem vergleichsweise kleinen Grabdenkmal für Erzbischof Konrad von Weinsberg, steht das noch zu Lebzeiten 1706 errichtete Monument, mit einer Höhe von 8,33 m und einer Breite von 4,73 m das größte Denkmal im Dom. Immer noch kniet der Propst, jetzt aber vor einem Vorhang, in pathetischer Geste vor dem Kruzifi x, begleitet von Figuren der Zeit und des Todes. Dieses Grabmal ist ein später Beleg für das Selbstbewusstsein der Kanoniker, insbe-sondere der Dignitare und hier vor allem der Dompröpste, deren Grabmäler die der Erzbischöfe an Größe und gestalterischem Aufwand überragten.
BISCHÖFE GEGEN KANONIKER?
Erhebt sich zunächst der Verdacht, die Mainzer Erzbischöfe hätten im 17. Jahrhundert auf eine monumentale Form der Selbstdarstellung verzichtet und die Mainzer Domkanoniker seien selbst-bewusst in diese Lücke geprescht, so muss man die Konkurrenz der beiden Gruppen diff erenzierter sehen: Die Serie der Domherren-Grabaltäre setzt vor der Lücke in der Reihe der Bischofsgräber ein und wird auch danach noch fortgeführt. Es wird im frühen 17. Jahrhundert eine Modeerscheinung, dass die Dignitare – also der engere Kreis des Domkapitels – aufwendige Grabaltäre errichten. Sie be-sitzen jedoch eigene Visualisierungstrategien mit eigenen Regeln, die sich von jenen der Erzbischöfe deutlich unterscheiden.
Eine Untersuchung der „gruppenbildenden Funktion von Grabdenkmälern“ erfordert für das Bei-spiel Mainz eine gleichzeitige Änderung des Betrachterstandpunkts und den Vergleich der Reihen über Jahre, sogar Jahrhunderte hinweg: Analysiert man die Topografi e des Gedenkens, so stellt man fest, dass sich zwei ganz unterschiedliche Konzepte entwickelt haben, die parallel zueinander in der-selben Kirche realisiert werden konnten. Die Bischöfe besetzen die in der Hierarchie off ensichtlich wichtigeren Plätze des Mittelschiff s; Rang- und Statusfragen spielten in der ständischen Gesellschaft eine so zentrale Rolle, etwa im Zeremoniell und in der Liturgie, dass man diesen Aspekt nicht ver-nachlässigen darf.29 Für die Domherren bleiben außer dem Kreuzgang die Memorie, die Querhäuser und die Kapellen der Seitenschiff e. Es gibt sozusagen ein Zentrum und eine Peripherie von Memoria und Repräsentation, die wiederum mit der Liturgie der Domkirche korrespondiert.30 Auch wenn die bischöfl ichen Monumente mit Beginn der Frühen Neuzeit hinsichtlich der Parameter Größe und liturgische Relevanz zurückstanden, so behaupteten sie bezüglich des Standorts und der Bildnisfor-mulare ihren Vorrang: auch die Darstellung in Form einer lebensgroßen Standfi gur in liturgischen Gewändern blieb den Erzbischöfen vorbehalten – die Kanoniker wurden zumeist in „Ewiger Anbe-tung“ gezeigt.
Die Konsequenz dieser Entwicklung ließe sich als Th ese folgendermaßen formulieren: Den Mangel an topografi scher Zentralität versuchen die Kanoniker durch Größe und Aufwand der Grabdenk-
94
ANMERKUNGEN
1 Wolfgang Dobras, Die kurfürstliche Stadt bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges (1462–1648): Franz Dumont/
Ferdinand Scherf/Friedrich Schütz (Hgg.), Mainz. Die Geschichte der Stadt, Mainz ²1999, 227–263; Kai–Michael
Sprenger, Die Mainzer Stiftsfehde 1459–1463: Ebda., 205–225.
2 Karl Langosch (Hg.), Johannes Cochlaeus: Brevis Germaniae Descriptio (1512) mit der Deutschlandkarte des Erhard
Etzlaub von 1501, Darmstadt ²1969, VIII, 37.
3 Winfried Wilhelmy, Zwischen Krummstab und Schnabelschuh. Kunstpolitik und Stiftungswesen an Rhein und Main
im Zeitalter Johanns von Dalberg: Gerold Bönnen/Burkhard Keilmann (Hgg.), Der Wormser Bischof Johann von Dal-
berg (1482–1503) und seine Zeit, Mainz 2005, 187–205; Für die beiden anderen rheinischen Kathedralstädte Trier und
Köln vgl. Wolfgang Schmid, Der Bischof, die Stadt und der Tod. Kunststiftungen und Jenseitsfürsorge im spätmittel-
alterlichen Trier: Michael Borgolte (Hg.), Stiftungen und Stiftungswirklichkeiten. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart,
Berlin 2000, 171–256; Ders., Stifter und Auftraggeber im spätmittelalterlichen Köln, Köln 1994.
4 Um nur wenige Titel zu nennen: Otto Gerhard Oexle/Andrea von Hülsen-Esch (Hgg.), Die Repräsentation der Grup-
pen. Texte – Bilder – Objekte, Göttingen 1998; Neithard Bulst/Robert Jütte (Hgg.), Zwischen Sein und Schein. Klei-
dung und Identität in der ständischen Gesellschaft, Freiburg/München 1993; Rudolf Holbach, Zu Ergebnissen und
Perspektiven neuerer Forschung zu spätmittelalterlichen deutschen Domkapiteln: Rheinische Vierteljahrsblätter 56
(1992), 148–180; Ders., Kanoniker im Dienste von Herrschaft. Beobachtungen am Beispiel des Trierer Domkapitels:
Hélène Millet (Hg.), I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli XIII–XVI, Ferrara 1992, 121–148.
5 Bester Überblick bei Friedhelm Jürgensmeier (Hg.), Handbuch der Mainzer Kirchengeschichte, Bd. 2, Würzburg 1997,
§ 15–16; Peter Claus Hartmann (Hg.), Der Mainzer Kurfürst als Reichserzkanzler. Funktionen, Aktivitäten, Ansprüche
und Bedeutung des zweiten Mannes im alten Reich, Stuttgart 1997; Ders. (Hg.), Kurmainz, das Reichserzkanzleramt
und das Reich am Ende des Mittelalters und im 16. und 17. Jahrhundert, Stuttgart 1998.
6 Irmtraud Liebeherr, Das Domkapitel: Wilhelm Jung (Hg.), 1000 Jahre Mainzer Dom (975–1975). Werden und Wan-
del, Mainz 1975, 115–125; Günter Rauch, Das Mainzer Domkapitel in der Neuzeit: Zeitschrift der Savignystiftung für
mäler zu kompensieren; außerhalb der Orte bischöfl icher Amtsmemoria, in einer anderen Gattung (Grabaltar) und in einem anderen Darstellungsmodus (Ewige Anbetung) konnte der Kirchenraum zur Selbstdarstellung genutzt werden. Dabei gibt es durchaus Gemeinsamkeiten, zunächst die Do-kumentation der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Stand, ein hohes Maß an Bildung und die Bekleidung leitender Positionen in der kirchlichen Hierarchie. Oftmals wurden auch die gleichen Bildhauer beschäftigt. Vor allem handelt es sich – sowohl bei den Grabdenkmälern der Bischöfe als auch bei denen der Kanoniker – fast ausschließlich um die Produkte einheimischer Werkstätten. Dies gilt es zu betonen, weil sich in Trier und Köln eine ganz andere Entwicklung nachzeichnen lässt. Dort ist zwar auch das Gros der Denkmäler von ortsansässigen Werkstätten geliefert worden, aller-dings gibt es in den beiden anderen Kathedralstädten in weitaus stärkerem Maße fremde Ateliers, welche entweder vor Ort tätig waren oder die Grabmäler als Fernlieferungen übersendet haben.
95
Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung 92 (1975), 161–227, 93 (1976), 194–278, 94 (1977), 132–179; Irmtraud
Liebeherr, Der Besitz des Mainzer Domkapitels im Spätmittelalter, Mainz 1971; Michael Hollmann, Das Mainzer
Domkapitel im späten Mittelalter (1306–1476), Mainz 1990.
7 Stephan Kekule von Stradonitz, Ahnenproben auf Kunstwerken: Ders., Ausgewählte Aufsätze aus dem Gebiete des
Staatsrechts und der Genealogie, Berlin 1905, 253–260; Klaus Schreiner, Art. Ahnenprobe: Lexikon des Mittelalters,
Bd. 1, München/Zürich 1980, 233; Mainzer Beispiele bei Wolfgang Dobras, Metallene Aufschwörurkunden. Zu zwei
Medaillen der Mainzer Erzbischöfe Johann Schweikhard von Kronberg (1604–1626) und Anselm Kasimir Wambolt
von Umstadt (1629–1647): Reiner Cunz (Hg.), Fundamenta Historiae. Geschichte im Spiegel der Numismatik und
ihrer Nachbarwissenschaften, Hannover 2004, 185–194.
8 Kilian Heck/Bernhard Jahn (Hgg.), Genealogie als Denkform in Mittelalter und Früher Neuzeit, Tübingen 2000; Ders.,
Genealogie als Monument und Argument. Der Beitrag dynastischer Wappen zur politischen Raumbildung der Neuzeit,
München 2002.
9 Für Mainz vgl. Peter Walter, Albrecht von Brandenburg und der Humanismus: Berthold Roland (Hg.), Albrecht von
Brandenburg. Kurfürst. Erzkanzler. Kardinal. 1490–1545, Kat. Mainz 1990, 65–82; Sigrid von der Gönna: Albrecht
von Brandenburg als Büchersammler und Mäzen der gelehrten Welt: Friedhelm Jürgensmeier (Hg.), Erzbischof Al-
brecht von Brandenburg (1490–1545). Ein Kirchen– und Reichsfürst der Frühen Neuzeit, Frankfurt 1991, 381–477.
Für Worms: Rüdiger Fuchs (Bearb.), Die Inschriften der Stadt Worms, Wiesbaden 1991; Peter Walter, „Inter nostrae
tempestatis Pontifi ces facile doctissimus“. Der Wormser Bischof Johannes von Dalberg und der Humanismus: Bönnen/
Keilmann, Wormser Bischof (Anm. 3), 89–152.
10 Zur Patronage vgl. Kurt Andermann, Gemmingen – Michelfeld. Eine personengeschichtliche Fallstudie zum Th emen-
kreis Patronage – Verwandtschaft – Freundschaft – Landsmannschaft: Paul-Joachim Heinig u. a. (Hgg.), Reich, Regionen
und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, Berlin 2000, 459–477; Heiko Droste, Patronage
in der Frühen Neuzeit – Institution und Kulturform: Zeitschrift für historische Forschung 30 (2003), 555–590; Sylvia
Schraut, Das Haus Schönborn. Eine Familienbiographie. Katholischer Reichsadel 1640–1840, Paderborn u. a. 2005.
11 Ursula Nilgen, Amtsgenealogie und Amtsheiligkeit. Königs- und Bischofsreihen in der Kunstpropaganda des Hochmit-
telalters: Studien zur mittelalterlichen Kunst 800–1250. Festschrift für Florentine Mütherich, München 1985, 217–
234; Christine Sauer, Fundatio und Memoria. Stifter und Klostergründer im Bild 1100 bis 1350, Göttingen 1993.
12 Unberücksichtigt bleiben müssen die Möglichkeiten eines Vergleichs mit Trier und Köln, wo die Domkapitel nicht
in diesem Maße hervorgetreten sind. Unberücksichtigt bleiben muss auch die Nutzung der Kathedrale durch andere
Gruppen der Stadtbevölkerung wie Adelige, Bürger, Zünfte und Bruderschaften, vgl. Wolfgang Schmid, Memoria in
der Kathedralstadt – zu den Grablegen der Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz vom 14. bis ins 16. Jahrhundert:
Hanno Brand/Pierre Monnet/Martial Staub (Hgg.), Memoria, communitas, civitas. Mémoire et conscience urbaines en
Occident à la fi n du Moyen Âge, Sigmaringen 2003, 243–262.
13 Die Grabdenkmäler der Mainzer Erzbischöfe sind recht gut erforscht. Vgl. in Auswahl Fritz Arens, Die Inschriften der
Stadt Mainz von frühmittelalterlicher Zeit bis 1650, Stuttgart 1958; Ders., Mainzer Inschriften von 1651 bis 1800.
Bd. 1: Die Inschriften des Domes zu Mainz, Mainz 1982; Gisela Kniffl er, Die Grabdenkmäler der Mainzer Erzbi-
schöfe vom 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert. Untersuchungen zur Geschichte, zur Plastik und zur Ornamentik,
Köln/Wien 1978; Nicole Beyer, Künstlerischer Ausdruck der Ansprüche und Stellung der Mainzer Erzbischöfe in der
Frühen Neuzeit: Das Beispiel von Grabdenkmälern: Hartmann, Kurmainz (Anm. 5), 173–196; Stefan Heinz/Barbara
Rothbrust/Wolfgang Schmid, Die Grabdenkmäler der Erzbischöfe von Trier, Köln und Mainz. Trier 2004, 153 –206;
Luzie Bratner, Die erzbischöfl ichen Grabdenkmäler des 17. und 18. Jahrhunderts im Mainzer Dom, Mainz 2005.
14 Verena Kessel, Memorialfunktionen Mainzer Erzbischofsgrabmäler von 1249 bis 1434: Kunst in Hessen und am Mit-
telrhein 34 (1994), 13–39; Kathryn Brush, Th e Tomb Slab of Archbishop Siegfried III von Eppstein in Mainz Cathe-
96
dral: Th e Th irteenth-Century Image and its Interpretative Contexts: Wilhelm Maier/Wolfgang Schmid/Michael Viktor
Schwarz (Hgg.), Grabmäler. Tendenzen der Forschung an Beispielen aus Mittelalter und früher Neuzeit, Berlin 2000,
33–50; Sebastian Scholz, Totengedenken in mittelalterlichen Grabinschriften vom 5. bis zum 15. Jahrhundert: Marbur-
ger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 26 (1999), 37–59; Ernst–Dieter Hehl, Die Erzbischöfe von Mainz bei Erhebung,
Salbung und Krönung des Königs (10. bis 14. Jahrhundert): Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos,
Kat. Aachen 2000, Bd. 1, 97–104; Winfried Wilhelmy, Ein unbekanntes Krönungsrelief der Mainzer Erzbischöfe.
Bonifatius und die Bildpropaganda der sedes Moguntiae im Zeitalter der Goldenen Bulle. In: Mainzer Zeitschrift 99
(2004), 17–30.
15 Wolfgang Schmid, Zwischen Amtsmemoria und Landesherrschaft: Die Grabdenkmäler der Mainzer Erzbischöfe in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts: Gutenberg – aventur und kunst. Vom Geheimunternehmen zur ersten Medienre-
volution, Kat. Mainz 2000, 466–473.
16 Die Meisterfrage ist am Gemmingen-Grabmal längst nicht geklärt. Nach Hans Backoff en und Peter Schro wurde jüngst
der sächsische Bildhauer Franz Maidburg vorgeschlagen. Vgl. Hartmut Krohm, Franz Maidburg. Ein obersächsischer
Bildhauer in der Nachfolge Tilman Riemenschneiders: Claudia Lichte (Hg.), Tilman Riemenschneider. Werke seiner
Blütezeit, Kat. Regensburg 2004, 225–240; Dagegen Stefan Heinz/Wolfgang Schmid, Große Kunst in einer kleinen
Stadt – Zu den Residenzen zwischen Rhein und Maas: Bodo Brinkmann/Wolfgang Schmid (Hgg.), Hans Holbein und
der Wandel in der Kunst des frühen 16. Jahrhunderts, Turnhout 2005, 191–227.
17 Kerstin Merkel, Jenseits-Sicherung. Kardinal Albrecht von Brandenburg und seine Grabdenkmäler, Regensburg 2004;
vgl. auch den Beitrag der Autorin im vorliegenden Band.
18 Im Gegensatz zu den recht gut aufgearbeiteten Epitaphien der Mainzer Erzbischöfe sind die Kanoniker-Grabmäler in
der Forschung stark unterrepräsentiert. Für die Grabplatten des 14. und 15. Jahrhunderts plant Dr. Winfried Wilhelmy
(Dom- und Diözesanmuseum Mainz) eine größere Publikation.
19 Zu Breidenbach vgl. Elisabeth Geck: Bernhard von Breydenbach: Die Reise ins Heilige Land. Ein Reisebericht aus
dem Jahre 1483 mit 17 Holzschnitten, 5 Faltkarten und 6 Textseiten in Faksimile, Wiesbaden 1977; Die Reise nach
Jerusalem. Bernhard von Breydenbachs Wallfahrt ins Heilige Land, Kat. Mainz 1992; Paula Giersch/Wolfgang Schmid,
Rheinland – Heiliges Land. Pilgerreisen und Kulturkontakte im Mittelalter, Trier 2004, 142–167.
20 Inschriftentext bei Arens, Inschriften I (Anm. 13), Nr. 319; Paul Kautzsch, Der Mainzer Bildhauer Hans Backoff en und
seine Schule, Leipzig 1911, 58–61; Irnfriede Lühmann-Schmid, Peter Schro. Ein Mainzer Bildhauer und Backoff en-
Schüler: Mainzer Zeitschrift 70 (1975), 1–62, 71/72 (1976/77), 57–100, bes. 45–48; Stefan Heinz, O Bedenck das End
– Der Mainzer Marktbrunnen. Ein Beitrag zur Memoria Albrechts von Brandenburg: Andreas Tacke (Hg.), Kontinuität
und Zäsur. Ernst von Wettin und Albrecht von Brandenburg, Göttingen 2005, 264–349, hier 342–343.
21 Peter Seewaldt (Hg.), Das Grabdenkmal des Christoph von Rheineck. Ein Trierer Monument der Frührenaissance im
Zentrum memorialer Stiftungspolitik, Trier 2000.
22 Die Heiligen Drei Könige – Darstellung und Verehrung, Kat. Köln 1982, Nr. 42; Walter Schulten, Der Kölner Dom-
schatz, Köln [1980], Nr. 45; Leonie Becks/Rolf Lauer, Die Schatzkammer des Kölner Domes, Köln 2000, Nr. 84.
23 Zum Mäzenatentum der Domkanoniker von Trier, Köln und Mainz um 1500 vgl. Florian Gläser/Wolfgang Schmid,
Das Testament des Christoph von Rheineck. Ein Schlüsseldokument zur westdeutschen Landesgeschichte des sechzehn-
ten Jahrhunderts: Seewaldt, Grabdenkmal (Anm. 21), 139–272, hier 194–198.
24 Arens, Inschriften I (Anm. 13), [30].
25 Valentin Ferdinand von Gudenus, Codex diplomaticus exhibens anecdota ab anno DCCCLXXXI ad MCCC Mogun-
tiaca, ius Germanicum et R. I. Illustrantia, 4 Bde., Göttingen 1743–1758.
26 Fritz Arens, Der Dom zu Mainz. Neu bearbeitet und ergänzt von Günther Binding, Darmstadt 1998, 113; Heinz/Roth-
brust/Schmid, Grabdenkmäler (Anm. 13), 177–178.
97
27 Wolfgang Schmid, Grabdenkmäler und Kunstpolitik der Erzbischöfe von Trier und Köln im Zeitalter der Gegenrefor-
mation: Sancta Treveris. Beiträge zu Kirchenbau und bildender Kunst im alten Erzbistum Trier. Festschrift für Franz J.
Ronig zum 70. Geburtstag, Trier 1999, 515–552.
28 Fritz Arens, Neue Forschungen und Veränderungen an der Ausstattung des Mainzer Domes: Mainzer Zeitschrift 70
(1975), 106–140.
29 Karl-Heinz Spieß, Rangdenken und Rangstreit im Mittelalter: Werner Paravicini (Hg.), Zeremoniell und Raum, Sig-
maringen 1997, 39–61; Michail Bojcov, Qualitäten des Raumes in zeremoniellen Situationen: Das Heilige Römische
Reich, 14.–15. Jahrhundert: Werner Paravicini (Hg.), Zeremoniell und Raum, Sigmaringen 1997, 129–153; Jörg Jochen
Berns/Th omas Rahn (Hgg.), Zeremoniell als höfi sche Ästhetik in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Tübingen 1995.
30 Dieser Aspekt ist für Mainz viel zu wenig aufgearbeitet, Franz Kohlschein/Peter Wünsche (Hgg.), Heiliger Raum. Archi-
tektur, Kunst und Liturgie in mittelalterlichen Kathedralen und Stiftskirchen, Münster 1998.