Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers. Am Beispiel von Äquatorialguinea
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers. Am Beispiel von Äquatorialguinea
ISSN 0344-8622 36(2013)1+2
Zeitschrift für Medizinethnologie • Journal of Medical Anthropology
hrsg. von/edited by: Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEM
Curare
36(2013)1+2
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung ISBN 978-3-86135-773-5
Sonderbände – Special Volumes
Vol. 6 Schmerz – Interdisziplinäre Perspektiven. Beiträge zur 9. Internationalen Fachkonferenz Ethnomedizin in Heidelberg 6.–8.5.1988 • K. Greifeld, N. Kohnen & E. Schröder (Hg) • 1989 • 191 S.
Vol. 7 Anthropologies of Medicine. A Colloquium on West European and North American Perspectives • B. Pfleiderer & G. Bibeau (eds) • 1991 • 275 pp.
Vol. 8 Gebären – Ethnomedizinische Perspektiven und neue Wege • W. Schiefenhövel, D. Sich & C. E. Gottschalk-Batschkus (Hg) 1995 • 461 S. • ISBN 978-3-86135-560-1
Vol. 9 Ethnomedizinische Perspektiven zur frühen Kindheit/Ethnomedical Perspectives on Early Childhood • C. E. Gottschalk-Batschkus & J. Schuler (Hg) • 1996 • 470 S. • ISBN 978-3-86135-561-8
Vol. 10 Transkulturelle Pflege • C. Uzarewicz & G. Piechotta (Hg) • 1997 • 262 S. • ISBN 978-3-86135-564-9
Vol. 11 Frauen und Gesundheit – Ethnomedizinische Perspektiven/Women and Health – Ethnomedical Perspectives • C. E. Gottschalk-Batschkus, J. Schuler & D. Iding (Hg) • 1997 • 448 S. • ISBN 978-3-86135-563-2
Vol. 12 The Medical Anthropologies in Brazil • A. Leibing (ed) • 1997 • 245 pp. • ISBN 978-3-86135-568-7
Vol. 13 Was ist ein Schamane? Schamanen, Heiler, Medizinleute im Spiegel west-lichen Denkens/What is a Shaman? Shamans, Healers, and Medicine Men from a Western Point of View • A. Schenk & C. Rätsch (Hg) • 1999 • 260 S. • ISBN 978-3-86135-562-5
Vol. 14 Ethnotherapien – Therapeutische Konzepte im Kulturvergleich/Ethnotherapies—Therapeutic Concepts in Transcultural Comparison • C. E. Gottschalk-Batschkus & C. Rätsch (Hg) • 1998 • 240 S. • ISBN 978-3-86135-567-0
Vol. 15 Kulturell gefordert oder medizinisch indiziert? Gynäkologische Erfahrungen aus der Geomedizin/Postulated by Culture or Indicated by Medicine? Gynecological Experiences from Geomedicine • W. Föllmer & J. Schuler (Hg) • 1998 • 344 S. • ISBN 978-3-86135-566-3
Vol. 16 Trauma und Ressourcen/Trauma and Empowerment • M. Verwey (Hg) • 2001 • 358 S. • ISBN 978-3-86135-752-0
Medizinethnologische Diskurse um Körpermodifikationen im interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologie und Medizin:
• Body Mass Index• Wellness• Anabolika• Mensch und Ding• Tätowierung und
Skarifizierungen• Beschneidung
von Mädchen und Frauen
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
ImpressumU2
Herausgeber im Auftrag der / Editor-in-chief on behalf of:Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin e.V. – AGEMEkkehard Schröder (auch V.i.S.d.P. ) mit Herausgeberteam / Editorial Board Vol. 33(2010) - 35(2012):Gabriele Alex (Tübingen) [email protected] // Hans-Jörg Assion (Dortmund) [email protected] // Ruth Kutalek (Wien) [email protected] // Bernd Rieken (Wien) bernd. [email protected] // Kristina Tiedje (Lyon) [email protected] Geschäftsadresse / office AGEM: AGEM-Curarec/o E. Schröder, Spindelstr. 3, 14482 Potsdam, Germanye-mail: [email protected], Fax: +49-[0]331-704 46 82Beirat/Advisory Board: Katarina Greifeld (Frankfurt) //Mi-chael Heinrich (London) // Mihály Hoppál (Budapest) // Sushrut Jadhav (London) // Annette Leibing (Montreal, CAN) // Danuta Penkala-Gawęcka (Poznań) // Armin Prinz (Wien) // Hannes Stub-be (Köln)Begründet von/Founding Editors: Beatrix Pfleiderer (†) – Ger-hard Rudnitzki (Heidelberg) – Wulf Schiefenhövel (Andechs) – Ekkehard Schröder (Potsdam)Ehrenbeirat/Honorary Editors: Hans-Jochen Diesfeld (Starn-berg) – Horst H. Figge (Freiburg) – Dieter H. Frießem (Stuttgart) – Wolfgang G. Jilek (Vancouver) – Guy Mazars (Strasbourg)
IMPRESSUM Curare 36(2013)1+2Verlag und Vertrieb / Publishing House:VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Amand AglasterPostfach 11 03 68 • 10833 Berlin, GermanyTel. +49-[0]30-251 04 15 • Fax: +49-[0]30-251 11 36e-mail: [email protected]://www.vwb-verlag.comBezug / Supply:Der Bezug der Curare ist im Mitgliedsbeitrag der Arbeitsgemein-schaft Ethnomedizin (AGEM) enthalten. Einzelne Hefte können beim VWB-Verlag bezogen werden // Curare is included in a regular membership of AGEM. Single copies can be ordered at VWB-Verlag.Abonnementspreis / Subscription Rate:Die jeweils gültigen Abonnementspreise finden Sie im Internet unter // Valid subscription rates you can find at the internet under: www.vwb-verlag.com/reihen/Periodika/curare.htmlCopyright:© VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin 2013ISSN 0344-8622 ISBN 978-3-86135-773-5
Die Artikel dieser Zeitschrift wurden einem Gutachterverfahren unterzogen // This journal is peer reviewed.
Zum Titelbild/Front picture Curare 36(2013)1+2: Brauch und Ritual: Die Kinder werden nicht gefragt./Custom and Ritual: The Voice of the Children is not Requested.Photo taken from the booklet of Terre des Hommes, 1977, on the occasion of a press conference in Geneva, Switzerland: «Les mutilations sexuelles féminines infligées aux enfants», with the following words:Tout enfant est unique, irremplaçable, / jamais vu sur terre auparavant / et que l’on ne vera plus jamais / sur terre ensuite. / Entité absolue et ultime d’humanité. Each child is unique, irreplaceable, / never seen on earth before, / never to be seen again, / absolute and ultimate entity of mankind.
Die letzten Hefte:Curare 35(2012)3: „Wa(h)re Medizin. Zur Authentizität und Kommodifizierung von Gesundheit und Hei-lung“, hrsg./ed.: Gabriele alex, bettina beer & bernhard hadolt
Curare 35(2012)4: Objekte sammeln, sehen und deuten. Die Spache der ObjekteDie nächsten Hefte:Curare 36(2013)3 zur Ethnobotanik und EthnopharmakologieCurare 36(2013)4 zu Themen aus der Transkulturellen Psychologie
Zeitschrift für MedizinethnologieJournal of Medical Anthropology
Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – www.agem-ethnomedizin.de – AGEM, Herausgeber derCurare, Zeitschrift für Medizinethnologie • Curare, Journal of Medical Anthropology (gegründet/founded 1978)
Die Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM) hat als rechtsfähiger Verein ihren Sitz in Hamburg und ist eine Verei-nigung von Wissenschaftlern und die Wissenschaft fördernden Personen und Einrichtungen, die ausschließlich und un-mittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt. Sie bezweckt die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen der Medizin einschließlich der Medizinhistorie, der Humanbiologie, Pharmakologie und Botanik und angrenzender Na-turwissenschaften einerseits und den Kultur- und Gesellschaftswissenschaften andererseits, insbesondere der Ethnologie, Kulturanthropologie, Soziologie, Psychologie und Volkskunde mit dem Ziel, das Studium der Volksmedizin, aber auch der Humanökologie und Medizin-Soziologie zu intensivieren. Insbesondere soll sie als Herausgeber einer ethnomedizini-schen Zeitschrift dieses Ziel fördern, sowie durch regelmäßige Fachtagungen und durch die Sammlung themenbezogenen Schrifttums die wissenschaftliche Diskussionsebene verbreitern. (Auszug der Satzung von 1970)
Curare 36(2013)1+2
Hinweise für AutorenSprachen: deutsch und englisch.Manuskripte: Curare veröffentlicht Originalbeiträge. Bitte liefern Sie mit dem Manuskript (unformatiert im Flattersatz) eine Zusammen-fassung (ca. 250 Wörter, Titel und ca. 5 Schlagwörter) in Deutsch, Englisch und Französisch. Fußnoten sollten vermieden werden. Danksagungen sind in der ersten Fußnote unterzubringen. Alle Fuß-noten sollten gleich als Anmerkung am Ende des Textes vor die Li-teraturhinweise.Zitate: Direkte und indirekte Zitate bitte direkt im Text aufführen, Quellenangabe im Text: (autor Jahreszahl: Seiten). Im Manuskript können anstatt der Kapitälchen bei den Autoren diese auch normal geschrieben und dann unterstrichen werden.Literaturangaben in alphabetischer Reihenfolge am Ende des Textes:
Instruction to AuthorsLanguage: German or English.Manuscripts: Original manuscripts only will be accepted. Please provide additionally to the manuscript (unformated ragged type) an abstract (appr. 250 words, appr. 5 keywords, and the title) in English, French, and German language. Footnotes should be avoided. Ac-knowledgements should be in the first footnote. All footnotes become endnotes after text and before the bibliography.References: Please quote in-text citations in the following form: (au-thor year: pages). If small capitals are not possible to handle, normal writing and underlining of the name.Literature in alphabetical order at the end of the mansuscript.The form for listing of references is as follows:
Stand/Status: Oktober 2012
Hinweise für Autoren / Instructions to Authors U3
Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin – www.agem-ethnomedizin.de – AGEM, editor of Curare, Zeitschrift für Medizinethnologie • Curare, Journal of Medical Anthropology, founded 1978.Former title (1978–2007): Curare. Zeitschrift für Ethnomedizin und Transkulturelle Psychiatrie
AGEM, the Working Group “Ethnomedizin”/Medical Anthropology, registered association with legal capacity seated in Hamburg/Ger-many, is an association of scientists and academics as well as persons and institutions promoting science, serving exclusively and directly non-profit purposes. It pursues the promotion of interdisciplinary co-operation between medicine, including history of medicine, human biology, pharmacology, and botany and adjacent natural sciences, on the one hand, and cultural studies and social sciences, especially eth-nology, cultural and social anthropology, sociology, psychology and the sociology of medicine. With view to this goal, and also to diffuse widely the scientific discourse, it acts in particular as publisher of a journal in the field of medical anthropology/“Ethnomedizin”, organises specialist conferences on a regular basis, and collects and make accessible relevant literature. (Extract of rules of 1970)
• Zeitschriften / Journals:Stein C. 2003. „Beruf PsychotherapeutIn“: Zwischen Größenphantasien und Versagensängsten. Imagination 25,3: 52–69.FainzanG S. 1996. Alcoholism, a Contagious Disease. A Contribution towards an Anthropological Definition of Contagion. Culture, Medicine and Psychiatry 20,4: 473–487.
Bei Zeitschriften mit Namensdoppelungen, z.B. Africa das Herkunftsland in Klammern dazu setzen. / Journals which occur with the same name, e.g. Africa put in brackets the country of origin.
• Bei speziellen Themenheften mit Herausgeber(n) oder Gastherausgeber(n) / In case of an issue on a special theme and with editor(s) or guest editor(s):Maier B. 1992. Nutzerperspektiven in der Evaluierung. In bichMann W. (Hg). Querbezüge und Bedeutung der Ethnomedizin in einem holistischen
Gesundheitsverständnis. Festschrift zum 60. Geburtstag von Hans-Jochen Diesfeld. (Themenheft/Special theme). Curare 15,1+2: 59–68.
• Rezensierter Autor, der im laufenden Text (Schüttler nach FiScher-harriehauSen 1971: 311) zitiert wird:Schüttler G. 1971. Die letzten tibetischen Orakelpriester. Psychiatrisch-neurologische Aspekte. Wiesbaden: Steiner. Rezension von FiScher-
harriehauSen H. 1971. Ethnomedizin I,2: 311–313.
• Autor einer Buchbesprechung / Reviewer:PFeiFFer W. 1988. Rezension von / Bookreview from Peltzer K. 1987. Some Contributions of Traditional Healing Practices towards Psychosocial
Health Care in Malawi. Eschborn: Fachbuchhandlung für Psychologie, Verlagsabt. Curare 11,3: 211–212.
• Bücher und Monographien / Books and Monographs:PFleiderer B., GreiFeld K., bichMann W. 1995. Ritual und Heilung. Eine Einführung in die Ethnomedizin. Zweite, vollständig überarbeitete und
erweiterte Neuauflage des Werkes „Krankheit und Kultur“ (1985). Berlin: Dietrich Reimer.Janzen J.M. 1978. The Quest for Therapy in Lower Zaire. (Comparative Studies in Health Systems and Medical Care 1.) Berkeley and L.A., CA:
University of California Press.
• Sammelband / Collection of essays (papers) (name all authors):SchieFenhövel W., Schuler J., PöSchl r. (Hg) 1986. Traditionelle Heilkundige – Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich der Kulturen und medi-
zinischen Systeme. Beitr. u. Nachtr. zur 6. Intern. Fachkonferenz Ethnomedizin in Erlangen, 30.9.–3.10.1982. (Curare-Sonderband/Curare Special Volume 5). Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg.
blackinG J. (Ed) 1977. The Anthropology of the Body. (A.S.A. Monograph 15). London: Academic Press.
• Artikel aus einem Sammelband / Article in a collection of papers:Schuler J. 1986. Teilannotierte Bibliographie zum Thema „Traditionelle Heilkundige – Ärztliche Persönlichkeiten im Vergleich der Kulturen
und medizinischen Systeme“. In SchieFenhövel W. et al. (Hg), a.a.O.: 413–453. (wenn das Werk mehrfach zitiert wird, sonst komplett nach obiger Anweisung zitieren, Seitenzahlen am Schluss, … Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg: 413–453)
loudon J.B. 1977. On Body Products. In blackinG J. (Ed), op. cit.: 161-178 (if the vol. is cited more than one time, otherwise citation of referen-ces as above, pages at the end, … London: Academic Press: 161–17)
Vornamen vollständig, wenn es einheitlich bei allen Autoren ist / Prenames can be used if all authors are also cited with prenamesCurare-Sonderbände sind Bücher und werden nicht als Zeitschrift zitiert, sondern als Sammelband mit Herausgeber(n) / Curare Special Volumes are books and are not cited as a journal but as collection of essays with editor(s).
1Inhalt
Curare 36(2013)1+2 • www.agem-ethnomedizin.de
Zeitschrift für MedizinethnologieJournal of Medical Anthropology
hrsg. von/ed. by Arbeitsgemeinschaft Ethnomedizin (AGEM)
Inhalt / ContentsVol. 36 (2013) 1+2
Medizinethnologische Diskurse um Körpermodifikationen im interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologie und Medizin
herausgegeben von / edited by:EkkEhard SchrödEr
Die Autorinnen und Autoren in Curare 36(2013)1+2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
EkkEhard SchrödEr: Editorial: Medizinethnologische Blicke auf Körpermodifikationen . . . . . 4
Artikel
Ausgewählte medizinethnologische Aspekte zum Thema Körpermodifikation
dEbora LEa FrommELd: „Fit statt fett“: Der Body-Mass-Index als biopolitisches Instrument . . . 5
JuLian hörnEr: Wellness: Unhinterfragter Teil medizinischen Handelns? . . . . . . . . . . . . . 17
WoLFgang krahL: Körperbildner – Anabolika bei Drogenabhängigen im Maßregelvollzug . . . . . . 27
ingrid kLEJna: Zwischen Leid und Dankbarkeit – eine medizinanthropologische Studie zu den alltäglichen Krankheitserfahrungen von Dialyse-PatientInnen in zwei österreichischen Krankenhäusern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Body Modifikation: Die Sprache der Tattoos
igor EbErhard: „Unserer heutigen Welt ist es fremd geworden“. Zur theoretischen Konzeption von Tätowierungen am Beispiel der Darstellung Tätowierter bei Walther Schönfeld . . . . . . . . 46
chriStina braun: Zwischen Ästhetik und Identität: Zur kulturwissenschaftlichen Bedeutung von Tätowierungen in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
JoSEp martí: Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers am Beispiel von Äquatorialguinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
VaLšík J. a. & FaWzia haLmy huSSiEn: Popular Medicine and Traditional Mutilations in Egyptian Nubia. Part I and II (Reprint 1973), with annex (short communication): A Case of Tattooing for Treatment (Reprint 1971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
2 Contents
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung • www.vwb-verlag.com
Forum: Diskurse um FGC/FGM
FaWzia haLmy huSSiEn: Genital Mutilation of Women in Egyptian Nubia. (Reprint 1973) . . . . . . . 90
aLFonS hubEr: Genitalverletzungen afrikanischer Mädchen durch rituelle Eingriffe. Zur Problematik der weiblichen Beschneidung (Reprint 1971) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
kLauS FLEiSchEr: Uvula-Exzision in Afrika. Ein traditioneller Brauch – auch heute noch lebendig (Reprint 1978) mit redaktineller Ergänzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Samia aL azharia Jahn: Zur Frage des zähen Fortlebens der Beschneidung der Frauen mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse im Sudan (Reprint 1980), redaktionell ergänzt und mit Anhang: Einige Bemerkungen zum Aufsatz … (D. H. FriESSEm, Reprint 1980) . . . . . . . . . . . . . 101
michEL ErLich: Infibulation und Phallizisierung der Vulva (Reprint 1984) redaktionnell ergänzt . . 109
EkkEhard SchrödEr: Beschneidung von Mädchen und Jungen. Vom Diskurs zur Aktion . . . . . . . . 114
aSSia maria harWazinSki: Beschneidung kontra körperliche Unversehrtheit. Eine interdisziplinäre Debatte um Religionsfreiheit kontra Menschenrecht berührt interkulturelles Medizinrecht . . . . . . 119
thomaS Sukopp: Weibliche Genitalverstümmelung. Schädliche Praxis, kulturrelativistisch legitimiert, medizinisch sinnlos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Konferenzberichte / Conference Reports• Bericht zur 2nd International and Interdisciplinary Conference on Health, Culture and the Human Body. Epidemiology, Ethics and History of Medicine, Perspectives from Turkey and Central Europe, 13–15 September 2012, Istanbul/Turkey (Frank krESSing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134• Die Frau im Zentrum. Bericht zur FIDE Jahrestagung, Würzburg, 22.–24.11.2012. (EVa kantELhardt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136• Final Conference of the Research Project “Mental Health and Migration” (Volkswagen- foundation), October 13–14, 2012, Berlin. (azra Vardar, mikE möSko, SimonE pEnka) . . . . . . . . 138• WPA International Congress, Prague, October 17–20, 2012. (hanS rohLoF) . . . . . . . . . . . . . . . . 140• First International Conference on Cultural Psychiatry in Mediterranean Countries, Tel Aviv, 5–7 November, 2012. (hanS rohLoF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142• 4th International Symposium Mental Health in Developing Countries—Global Mental Health. 10th November 2012 in Munich (WoLFgang krahL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144• The International Migrants Day 2012. A Report, 18th Dec., Hannover. (daVid brinkmann) . . . . . 148
Buchbesprechungen / Book Reviews• Literaturhinweise zur Frage der weiblichen Beschneidung. Reprint aus Curare 5(1982). (EkkEhard SchrödEr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152• anna köLLing 2008. Weibliche Genitalverstümmelung im Diskurs. Berlin (katarina grEiFELd) 153• JürgEn WackEr 2011. Isaaks Schwestern. Westkreuz-Verlag GmbH Berlin/Bonn 2011 (marion huLVErSchEidt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153• Janna graF 2012. Weibliche Genitalverstümmelung aus Sicht der Medizinethik. Göttingen. (EkkEhard SchrödEr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154• hErbErt StEinböck (Hg) 2011. Forensische Psychiatrie als Randkultur – zwischen interkultureller Spannung und multikultureller Integration. Lengerich. (Eckhardt koch) . . . . . . . 155• carStEn kLöpFEr 2012. Aids und Religion – Der psychologische Beitrag von Buddhismus und Christentum zu Präventionsstrategien gegen die psychosozialen Folgen von HIV/Aids. Göttingen. (aLExandra kraatz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Résumés des articles de Curare 36(2013)1+2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3Inhalt
Curare 36(2013)1+2
Die Autorinnen und Autoren dieses Heftes
• ChristinaBraun, M. A., Volkskunde (Bamberg) [email protected] – S. 64 • daVid brinkmann*, M. A., Ethnologe (Bonn) [email protected] – S. 148 • igor EbErhard, M. A., Ethnologe (Wien) [email protected] – S. 46 • dEbora LEa FrommELd, M. A., Soziologin (Ulm) [email protected] – S. 5 • katarina grEiFELd* Dr. phil, Medizinethnologin (Frankfurt) [email protected] – S. 153 • aSSia maria harWazinSki, Dr. phil, Islamwissenschaftlerin (Tübingen) [email protected] – S. 119 • JuLian hörnEr, M. A., Volkskundler (München) [email protected] – S. 17 • marion huLVErSchEidt, PD Dr. med, Medizinhistorikerin (Berlin) [email protected] – S. 153 • EVa kantELhardt, Dr. med, Gynäkologin (Halle) [email protected] – S. 136 • ingrid kLEJna, M. A., Ethnologin (Wien) [email protected] – S. 36 • Eckhardt koch*, Dr. med, Psychiater (Marburg) [email protected] – S. 155 • aLExandra kraatz, Dr. phil, Ethnologin (Bonn) [email protected] – S. 156 • WoLFgang krahL*, Dr. med., Psychiater, Psychologe (München) [email protected] – S. 27, 144 • Frank krESSing*, Dr. hum. biol., Ethnologe (Ulm) [email protected] – S. 134 • JoSEp martí, Dr. phil, Ethnologe (Barcelona) [email protected] – S. 76 • mikE möSko, Dr. phil, Psychologe (Hamburg) [email protected] – S. 138 • SimonE pEnka, M. A., Ethnologin (Berlin) [email protected] – S. 138 • hanS rohLoF, Drs. med, Psychiater (Amsterdam) [email protected] – S. 140, 142 • EkkEhard SchrödEr*, Psych iater, Ethnologe (Potsdam) [email protected] – S. 4, 114, 152, 154 • thomaS Sukopp, Dr. phil, Philosoph (Siegen) [email protected] – S. 122 • azra Vardar, M. A., Ethnologin (Berlin) [email protected] – S. 138
Autoren der Reprints
• michEL ErLich, Dr., Psychiater u. Ethnologe (Paris) – S. 109 • kLauS FLEiSchEr, Prof. Dr. med., Tropenmediziner (Würzburg) [email protected] – S. 97• diEtEr h. FriESSEm*, Dr. med, Psychiater (Stuttgart) – S. 108• FaWzia haLmy huSSiEn, Prof. Dr. emer., Physical and Archeological Anthropology (Kairo) – S. 86, 90 • (†) aLFonS hubEr*, Prof. Dr. med, Gynäkologe u. Tropenmediziner (Innsbruck) – S. 92 • (†) Samia aL azharia Jahn*, Dr. med., medizinische Forschung, GTZ, Märchenforschung – S. 101 • (†) J. a. VaLšík*, Prof. Dr., Physische Anthropologie und Humangenetik (Bratislava) – S. 86
* Mitglieder der AGEM
Zum Titelbild & Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U2Hinweise für Autoren/Instructions to Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U3
Redaktionsschluss: 12.04.2013, Redaktion und Endlektorat EkkEhard SchrödErDie Artikel der Curare werden einem Reviewprozess unterzogen / The journal Curare is a peer-reviewed journal
Josep Martí74
Curare 36(2013)1+2: 74–85 VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
1. Tätowierungs- und Skarifizierungstraditionen in Äquatorialguinea1
Wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, haben die verschiedenen ethnischen Gruppen, die Äquato-rialguinea bevölkern, eine reiche Tradition was Tä-towierung und Skarifizierungen betrifft. Äquatorial-guinea ist dazu ein sehr symptomatisches Beispiel für den Wandel, den traditionelle Körperveränderungs-praktiken wie Tätowierung und Skarifizierungen in der ganzen Welt, besonders im Laufe des 20. Jahr-hunderts, erfahren haben. Der Funktionalitätsverlust aufgrund von Modernisierungs- oder Akkulturations-prozessen2, der Widerwille von Behörden und Missi-onaren in kolonisierten Ländern oder einfach die Dy-namik der Modetrends, insbesondere innerhalb der gegenwärtigen mächtigen Globalisierungsprozesse,
sind wichtige Ursachen für das Verschwinden von traditionellen Tätowierungs- oder Skarifizierungs-praktiken in Afrika (martí 2010b: 3).
Bubi und Fang, zwei der wichtigsten Ethnien in Äquatorialguinea3, hatten sehr charakteristische Traditionen in Bezug auf diese Art von Körper-veränderungen. Die Bubi, die in der Bioko Insel ansässig sind, waren bekannt für die Skarifizierun-gen, die sie bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts in das Gesicht ihrer Kinder eingravierten. Es han-delte sich dabei um tiefe Einschnitte in der Form von parallelen Linien. Wir finden schon in einem im Jahre 1848 veröffentlichten Buch Berichte über diese Skarifizierungen: “The face is cut and disfig-ured with transverse stripes, which, to come up to their standard of beauty, ought to be as much raised and corrugated as possible, which is only attained
Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers am Beispiel von Äquatorialguinea*
JoSEp martí
Zusammenfassung In diesem Artikel beschreibe ich im ersten Teil einige traditionelle Praktiken der Körpermo-difikationen in der ehemaligen spanischen Kolonie Äquatorialguinea. Hauptziel des Artikels ist es aber, Angaben über die heutige soziale Relevanz und Perzeption dieser Praktiken aufzuzeigen. Während einige solcher Praktiken gegenwärtig praktisch verschwunden sind, wie die alten Tätowierungen der Fang oder die Gesichts-Skarifizie-rungen der Bubi, fungieren andere Praktiken wie die Skarifizierungen der Annobonesen heutzutage als starkes Identitätszeichen und sind immer noch sehr aktuell. Im zweiten Teil des Artikels ordne ich diese Daten innerhalb des kulturanthropologischen Ansatzes der sozialen Präsentation des Körpers ein. Der Inhalt des Artikels basiert auf Feldforschungen, die ich seit dem Jahr 2006 regelmäßig in diesem afrikanischen Land durchführe. Schlagwörter Körpermodifikationen – Tätowierung – Skarifizierung – Narbentätowierung – soziale Präsentation des Körpers – sêsê – Fang – Bubi – Äquatorialguinea
The Social Presentation of the Body through Body Modification. The Case of Equatorial Guinea Abstract In this article I describe in its first part some traditional body modification practices in the former Span-ish colony of Equatorial Guinea. The main goal of the article is to present data about the current social relevance and perception of these practices. While some of these practices have already vanished, as for instance the old Fang Tattoos or the Bubi facial scarifications, other traditions such as the Annobonese’ scarifications, which today are an important identity sign, are still very usual. In the second part of the article I frame the presented data within the cultural anthropological approach of the social presentation of the body. This article is based on field work which I am carrying out since the year 2006 in this African country.Keywords body modification – tattoo – scarification – social presentation of the body – Africa – sêsê – Equatorial Guinea
* Überarbeiteter Vortrag auf der „25. Fachkonferenz Ethnomedizin: Diskurse um Körpermodifikationen im interdisziplinären Arbeitsfeld Ethnologie und Medizin. Heidelberg, 8.–10. Juni 2012“.
75Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers
Curare 36(2013)1+2
by a tedious process in cicatrizing the wounds” (aLLEn & thomSon 1848: 192–193). Und im Jahre 1888 schrieb der österreichische Geograph Oskar Baumann folgendes über diese Tradition der Bubi: „Ausser in der nächsten Umgebung Sta. Isabels ist es bei allen Bube Sitte, sich das Gesicht durch Schnitte zu verunstalten. Dieselben verlaufen radiär von der Nasenwurzel über die Wange und werden quer über die Stirne gezogen. Die bilden flache Narben und werden im fünften oder sechsten Jahre durch den Zauberdoctor angebracht“ (baumann 1888: 82).
Nachdem die Einschnitte gemacht waren, wurden die Wunden so behandelt, dass große Narben daraus entstanden. Dies vergab den Bubi laut den Europä-ern “a very horrible appearance“ (hutchinSon 1858: 187), ein „äußerst hässliches Gesicht“ (martínEz 1859: 15). Der spanischer Priester Antonio Aymemí, der Anfang des 20. Jh. einige Artikel über diese ethnische Gruppe verfasste, beschrieb die Bubi in Bezug auf diese Narben als „schrecklich hässlich, missgestaltet und scheußlich“ ( aymEmí 1942: 25). Es handelt sich um Ansichten, die wir oft in der Ko-lonialliteratur finden, und die uns erlauben, nicht nur von kolonisierten Ländern sondern auch von „kolo-nisierten Körpern“ zu sprechen (martí 2012a). Nach Ansicht der Missionare, war der Zweck von diesen Skarifizierungen, dass die Bubi sich im Falle von Verbannung oder Sklaverei wiedererkennen könnten (coLL 1889: 13; aymEmí 1942: 25). Es handelt sich aber um eine Behauptung, die wir oft für diese Art von Körperveränderungen auch für andere Völker Afrikas finden und die nicht selten mehr mit den Vorstellungen der Europäer als mit der Wirklichkeit zu tun hat. Auf jeden Fall wurde diese Ansicht vom deutschen Ethnologen Günter Tessmann, der bei den Bubi forschte, nicht geteilt (tESSmann 1923: 40)4. Wir wissen nicht, ob diese Körperveränderungen am Anfang aus Glauben oder aus ästhetischen Gründen gemacht wurden (martín 1993: 438), aber Tatsache ist, dass sie als Identitätszeichen fungiert haben, et-was, dass heute von älteren Leuten bestätigt wird, die diese Skarifizierungen noch im Gesicht tragen (mobaJaLE 2002: 13). Diese Sitte wurde von den spanischen Missionaren sehr stark bekämpft5.
Bei den Fang im kontinentalen Teil Äquatorial-guineas bestand laut Günter Tessmann, der im Jah-re 1913 ein wichtiges Werk über diese ethnische Gruppe veröffentlichte, die traditionelle Art und Weise der Körperverzierung aus Tätowierungen, durch Schneiden und auch durch Brennen erzeugte
Skarifizierungen und Körperbemalung – im letzten Fall aus zeremoniellen Gründen (tESSmann 1913: 196, Bd. 1). Tessmann schätzte, dass der Brauch der Tätowierung bei dieser ethnischen Gruppe frü-hestens Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sei (ebd.: 198), aber die Reisenden Paul du Chaillu (du chaiLLu 1861: 104–105) und R. F. Burton (burton 1863: 45) beobachteten schon viel früher bei den in Äquatorialafrika lebenden Fang solche Tätowierun-gen: “This personage [ein Häuptling der Fang] was a ferocious-looking fellow, whose body, naked with exception of the usual cloth about the middle, made of the bark of a tree, was painted red, and whose face, chest, stomach, and back were tattooed in a rude but very effective manner” (du chaiLLu 1861: 104). Der spanische Arzt Amado Ossorio schrieb in einem 1886 veröffentlichten Artikel über die Fang aus Äquatorialguinea folgendes: “El pámue y el bu-heba […] son muy aficionados á marcarse el vientre, la espalda y los brazos con dibujos verdaderamente artísticos que practican con la punta de cuchillos bien afilados; esta operación, que debe ser en extremo do-lorosa, tiene lugar durante la infancia y los dibujos permanecen indelebles para toda la vida” (oSSorio 1886: 299)6.
Und ein Jahr danach sprach der baskische Afri-kaforscher Manuel Iradier von den kapriziösen Mo-tiven, welche die Fang sich in Bauch, Arme und Rü-cken markieren ließen (iradiEr 1887: 391). Die Fang behielten den Brauch, den Körper zu tätowieren, bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts bei. Die Tä-towierungen wurden an verschiedenen Teilen des Körpers angebracht: Gesicht (Stirn und Wangen), Hals, Arme, Brust, Rücken und Beine. Aber auf-grund der Tatsache, dass die Kolonialverwaltung die Kleidungssitten veränderte und der Körper mehr und mehr bedeckt wurde, wurde die tätowierte Fläche des Körpers schrittweise auf die sichtbaren Teile des Körpers reduziert. Wir haben einige Beschreibungen von diesen Tätowierungen und deswegen wissen wir, dass sie eine sehr reiche Vielfalt von figurati-ven sowie symbolischen Motive enthielten7. Täto-wiert und skarifiziert wurde meist aus ästhetischen Gründen, aber die Markierungen dienten auch im direktem Zusammenhang mit der Gruppenidentität und fanden sich gelegentlich auch bei Übergangsri-ten, insbesondere dem sô genannten Initiationsritual (aLExandrE und binEt 1958: 99, houSEman 1992, LaburthE-toLrá 1985: 277–326, manguE 1962).
76 Josep Martí
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
2. Und was ist heute von der Tätowierungstradition übriggeblieben?
In der Stadt Bata, die zweitgrößte Stadt des Landes, ist es heutzutage sehr schwierig, Leute mit alten Tä-towierungen zu finden, und in den seltenen im Rah-men meiner Feldforschung gefundenen Fällen waren es immer sehr alte Menschen, die im Innern des Lan-des geboren waren. Dennoch wussten die Erwachse-nen von der Existenz dieser alten Tätowierungen. In meinen Interviews erinnerten sie sich generell, bei einigen Gelegenheiten Tätowierungen gesehen zu haben. Die jungen Menschen jedoch hatten wenig Kenntnis über die alten Tattoos und Skarifizierun-gen. Sie wussten aber, dass es Körpermarkierungen gab, die sehr konkrete Dinge bedeuteten, wie z. B. Zugehörigkeit zu einem bestimmtem Dorf oder im Falle der Frauen, um darauf hinzuweisen, dass sie verheiratet waren. Sie haben es immer erstaunlich gefunden, dass Menschen solche Tätowierungen im Gesicht haben konnten. Heutzutage würde kein junger Mensch wagen, dies zu tun. In einem meiner Interviews sagte eine dreißigjährige Fang zu mir: „Ein junger Mensch würde sich mit einer Tätowie-rung im Gesicht nicht schön finden. Früher machten die Alten dies, weil es Tradition war. Sie mussten diese Tätowierungen im Gesicht haben, damit die verschiedenen Stämme [„tribu“ im Original] sich voneinander unterscheiden konnten. Normalerweise bedeuteten diese Tätowierungen etwas. „Die älteren Leute haben Tattoos mit dem Mond, den Sternen … sie machten dies wegen des Stammes. Aber wir
machen dies [Tätowierung], weil wir jung sind. Sie taten es wegen der Tradition; wir wegen der Mode, wir wollen es wie die Amerikaner machen.“
Die Leute mit traditionellen Tätowierungen, die ich im Lauf meiner Feldforschung interviewen konnte, waren meistens Frauen, da sie normalerwei-se eine höhere Lebenserwartung als Männer haben. Die erste Antwort auf meine Frage nach den Grün-den ihrer Tätowierungen war immer, dass sie dies aus ästhetischen Gründen machten. Gemäß meinen Informanten ließen sich Männer und Frauen be-sonders vor der Hochzeit tätowieren, weil sie auf diese Weise eleganter erschienen: „In Zeiten unse-rer Großeltern machte man sich lustig, wenn eine Person diese Tätowierung nicht hatte. Dies war so wie heute mit den Ohrringen, Armbändern, Uhren und Ketten, die wir tragen. Man schimpfte damals auf die, die keine Tätowierung hatten, weil sie das Gesicht ‚sauber‘ [ohne Markierungen] hatten. Das war ihre Art und Weise, jung zu sein, genauso wie ich jetzt meine Kette trage oder Lippenstift benutze, entsprechend unserer heutigen Tradition.“
Wenn ich jedoch ein bisschen tiefer in die Grup-pendiskussion einstieg, stelle sich heraus, dass Tä-towierungen auch die Funktion hatten, Gruppenzu-gehörigkeit zu zeigen, z. B. Familie, Clan, Stamm oder Wohnsitz. Der Sohn einer tätowierten Frau aus Ebinayón sagte zu mir: „Da es zu jenen Zeiten kei-ne Reisepässe gab, bedienten sie sich der Tätowie-rung.“ Und nicht selten konnte ich Aussagen hören
Abb. 1 u. 2: Traditionelle Fang Tätowierungen nach den Aufzeichnungen von J. Sabatér aus den 1950er Jahren (Sabater & Sabater 1992).
77Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers
Curare 36(2013)1+2
wie: „Wenn ich diese Tätowierung sehe, dann weiß ich, dass er/sie zu meiner Familie gehört.“
Möglicherweise ist diese Art der Bedeutungszu-schreibung der Tätowierungen als Zugehörigkeit in einigen abgelegenen Dörfern des Landes noch nicht völlig in Vergessenheit geraten. Gemäß der Auskunft, die ich von Guadalupe Digna, einer 22 Jahre alten Frau aus Ebebiyin, eine ganz in der Nähe von Kame-run und Gabun gelegene Ortschaft im Nordwesten des Landes, erhielt, macht ihre Großmutter einfache und diskrete Tätowierungen auf den Gesichtern ihrer Enkel, wenn sie noch sehr jung sind. Sie markiert die Haut mit einer einzigen, ein paar Zentimeter lan-gen Linie auf der Wange bzw. der Schläfe oder sie zeichnet einen Punkt auf die Stirn und auf andere Teile des Körpers. Im konkreten Fall meiner jungen Informantin hatte sie einen Punkt auf der Stirn und eine Reihe von zwölf Punkten auf ihrem linken Un-terarm. Die Frau berichtet: „Es gibt Tätowierungen, die dazu dienen, die Familie, der du angehörst, zu kennzeichnen. Jetzt werden sie nicht mehr gemacht, meine Großmutter aber hat mir davon erzählt. Sie hat diese Markierung auf der Stirn, sie sieht aus wie eine Blume, und sie sagte, dass diese Markierung nur in ihrem Essató-Stamm gemacht wurde. Ihr Va-ter machte dies immer bei seinen Kindern.“
Die Großmutter meiner Informantin verzichtete darauf, die traditionellen Tattoos in ihrer alten Form weiterzumachen; traditionsbewusst gab sie sich aber damit zufrieden, sehr einfache Motive auf die Haut ih-rer Enkelkinder zu zeichnen. Meine Informantin ver-stand diese Motive als ein „Familienzeichen“ (“señal
de la familia”), und berichtete, dass die Großmutter, wenn sie in die Haut für eine Tätowierung schnitt, gleichzeitig einige Substanzen mit dem Ziel hinein-gab, ihr Enkelkind gegen Hexerei zu schützen8.
Wenn in der Tradition der Fang die Tätowie-rungen nur aus ästhetischen Gründen durchgeführt wurden, konnte jede Person das Motiv auswählen: „Jeder wählte nach eigenem Geschmack die ge-wünschte Markierung aus.“ Da diese Tätowierun-gen keinen rituellen Wert hatten, waren sie mit kei-nerlei Feiern verbunden9: „Nachdem der Spezialist seine Arbeit geleistet hatte, mit dem Schmerz, den wir dabei erlitten hatten, wollten wir nur noch ins Bett gehen“, sagte eine tätowierte alte Frau zu mir. Im Allgemeinen waren Männer die Spezialisten, die diese Arbeit verrichteten. Sie verwendeten dafür von der lokalen Bevölkerung selbstgemachte Klin-gen, Messer oder andere Schneidobjekte wie Glas einer zerbrochenen Flasche. Die Pigmente hierzu wurden mit dem Ruß einer Öllampe oder vom Bo-den eines Topfes in Wasser verrührt oder durch das Verbrennen von Samen oder aus dem Saft bestimm-ter Bäume wie „Okoume“ (Aucoumea klaineana) oder „Atanga“ (Pachylobus edulis) gewonnen. Die christlichen Missionare bekämpften diese Tätowie-rungen nicht so stark wie die Skarifizierungen der Bubi, aber ihr fortschreitendes Aussterben erfolgte vor allem wegen der Veränderung des Modetrends, wegen der progressiven Assimilation der negativen Bewertung, die die Kolonialherren in Bezug auf diese Praktiken zeigten und – wie bereits gesagt – wegen der Übernahme neuer Kleidungssitten, die den Körper viel mehr als vorher bedeckten.
Die Tätowierungen nicht weniger junger Men-schen heute haben nichts mit den traditionellen Praktiken zu tun, sondern viel mehr mit den gegen-wärtigen Trends der Globalisierung. Sie werden vor allem als Mode und aus ästhetischen Gründen getragen. Sie stehen jedoch auch in engem Zusam-menhang mit der Identitätsbildung, in diesem Fall aber nicht mit kollektiver Identität wie in früheren Zeiten, sondern mit individueller Identität, etwas, das mit den jetzigen Modernisierungsprozessen im Einklang steht. Man hat als Tattoo-Motive seinen eigenen Namen, den Namen der geliebten Person, das eigene Horoskopzeichen oder andere einfache Motive wie das Herz mit dem Pfeil (vgl. martí 2010b: 6f). Meistens werden diese Tätowierungen amateurhaft angebracht oder es sind Tätowierungen von Experten im Ausland gemacht. Als ich meine
Abb. 3: Einfache Tätowierung als „Familienzei-chen“ bei Guadalupe, einem Fang-Mädchen aus Ebebiyin (Bata 2008. Foto: J. Martí).
78 Josep Martí
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
Feldforschung im Jahre 2006 begann, gab es in Bata kein Tattoo-Studio für professionelle Tätowierun-gen. Heute aber bieten einige chinesische Läden, die im Fotobereich tätig sind, ein paar Tage in der Woche die Möglichkeit, sich bei einem Spezialisten tätowieren zu lassen.
Wenn die Tätowierungen nicht von Spezialisten gemacht werden, ist das Verfahren ziemlich einfach.
Zuerst wird das gewünschte Muster mit einem ganz normalen Kugelschreiber auf die Haut gezeichnet, und danach wird die Haut mit Hilfe von drei zu-sammengebundenen Nadeln punktiert. Als Pigment wird mit Wasser gemischter Lampenruß verwendet. In den ersten Stunden nach der Tätowierung wird darauf geachtet, dass die Wunde nicht nass wird,
Abb. 4 u. 5: Nicolás und Lorenza: Tätowierungen als individuelle Identität (Bata 2006. Foto: J. Martí).
Abb. 6 u. 7: Neue Tätowierungen: Sternzeichen (links) und Tattoo gemäß dem globalisierten Modetrend (rechts). Dieses Tattoo wurde aber von einem Spezialisten während eines kurzen Aufenthalts der Frau in Spanien gemacht (Bata 2006. Foto: J. Martí).
79Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers
Curare 36(2013)1+2
aber es wird kein zusätzliches antiseptisches Ver-fahren angewendet, um sie zu behandeln.
Nicht jeder sieht die gegenwärtigen Tätowierun-gen in Äquatorialguinea wohlwollend, mit „guten“ Augen. Laut meinen Informanten kann ein sehr tä-towierter Mann als “bandido“ (Bandit) oder “delin-cuente“ (Krimineller) angesehen werden, und sehr tätowierte Frauen können unter Verdacht fallen, “mujeres de calle“ (Prostituierte) zu sein. In diesen Fällen reproduziert man das gleiche Denkschema, das wir auch in Europa finden (oder fanden) und das ebenfalls die spanischen Kolonialverwalter in Äqua-torialguinea teilten. Aber diese negative Einstellung bezieht sich nur auf die modernen Tätowierungen. In Bezug auf die traditionellen Tätowierungen hatte man keine negative Meinung über diese Art von kör-perlicher Veränderung; höchstens konnten sie als alt-modisch angesehen werden, als etwas, das innerhalb der Narrative der Dichotomie ‚Tradition/Modernität‘ als rückständig bezeichnet werden könnte.
3. Traditionelle Skarifizierungen auf Annobon: das sêsê.
Während die alte Fang-Tätowierung praktisch ver-schwunden ist, sind die traditionellen Skarifizie-rungen bei der Bevölkerung aus Annobon, einer kleinen ganz in der Nähe von São Tomé gelegenen Insel, immer noch aktuell. Die Annobonesen bil-den mit nicht mehr als 10 000 Menschen eine sehr kleine ethnische Gruppe in Äquatorialguinea. Sie sind besonders bekannt für ihre eigene Sprache Fá d’Ambô, eine portugiesisch-basierte Kreolsprache, und auch, weil die Mehrheit der Männer und Frauen die Tradition bewahrt hat, sehr feine Einschnitte auf dem Körper anzubringen, eine Tradition, die sêsê10 genannt wird. Beim sêsê handelt es sich um keine Tätowierung, sondern um einfache und nicht sehr tiefe Schnitte, die mit einem scharfen Gegenstand gemacht werden. Heute wird dafür eine Rasier-klinge verwendet, die vorher mit Feuer desinfiziert wird. Früher wurde ein bisturí genanntes Messer verwendet. Die Einschnitte können bis zu 10 cm lang sein und werden auf Arme, Schenkel, Beine, Kopf (Schläfen), Rücken und Brust gemacht. Tra-ditionsgemäß werden immer drei parallele Schnit-te gemacht. Es ist auch üblich, auf der Brust, zwei kleine Kreuze von ca. 3 cm zu markieren. Nachdem all diese verschiedenen Einschnitte am Körper an-gebracht wurden, werden sie mit Zitronensaft (oder einer anderen Zitrusfrucht), „Ndong“ (aframomum
meleguet, eine Art Paprika, das als Küchengewürz verwendet wird) und mit Kohle eingerieben. In den Tagen nach dem Eingriff werden die Wunden mit Urin und Palmöl behandelt.
Bei den Kindern werden im Lauf der ersten sie-ben Lebensjahre die Einschnitte von spezialisierten Frauen und Männern vorgenommenen. Alle Ein-schnitte werden in einer Sitzung und sehr schnell vollzogen. Früher erhielten die Spezialisten Natu-ralien wie Bananen, Brennholz usw. als Zahlung; in einigen Traditionen bekamen sie ein Huhn, wenn es ein Mann war, oder ein Hähnchen, wenn es sich um eine Frau handelte. Heute wird meistens mit Geld
Abb. 8: Sêsê. Die Markierungen dieser jungen Frau, Rosalinda Sagunto, wurden vor kurzem gemacht, deswegen sind sie sichtbarer als üblich. Sie liess sich das sêsê aus Identitätsgründen erst als Erwachsene machen, weil ihre Familie, die längst nicht mehr in Annobon, sondern in der Haupstadt des Landes wohnt, diese Tradition nicht pflegte (Malabo 2012. Foto: J. Martí).
80 Josep Martí
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
bezahlt. Das Schneiden erfolgt ohne spezielle Ze-remonie, und danach findet auch keine Feier mehr statt. Der Eingriff wird generell in den frühen Mor-genstunden durchgeführt, aber auch am Abend, je nachdem, wann der Spezialist verfügbar ist. Auf je-den Fall werden die Sonnenstunden vermieden, weil man sagt, dass mit der Sonnenhitze die Schmerzen stärker seien. Diese Einschnitte haben faktisch keine ästhetische Funktion, und man schreibt ihnen eine allgemeine „mystische“ Schutzfunktion zu. Aber da das sêsê nur bei den Annobonesen praktiziert wird, fungieren diese Skarifizierungen auch als Identi-tätszeichen. Man ist sich dieser Bedeutung sehr be-wusst11. Andere ethnische Gruppen Äquatorialgui-neas mokieren sich manchmal über diese Tradition und bezeichnen dementsprechend die Annobonesen als “maven dje” (diejenigen, die Wunden tragen), „die Adidas“, oder auch die „111“ (die Hundertel-fer), in den zwei letzten Fällen in deutlicher Anspie-lung auf das Drei-Schnitte-Muster. Obwohl heute noch die meisten Erwachsenen das sêsê zeigen, beginnt auch diese Tradition zu verschwinden, da es schon Annobonesen gibt, die darauf verzichten, ihre Kinder auf diese Weise zu markieren, beson-ders jene, die nicht mehr auf der Insel, sondern in anderen Teilen des Landes oder im Ausland leben. Ein Annobonese, der zwei kleine Töchter hat, sagte mir: „Es ist nicht nötig, dass meine Töchter überall ankündigen, dass sie Annobonesen sind. Außerdem verunstaltet das sêsê den Körper”12.
4. Die Zeit der alten Körpermarkierungen ist vorbei.
Die Tradition des sêsê befindet sich in einer Situa-tion, die wir bezüglich der Körpermodifikationen auch in vielen anderen Milieus beobachten können. Bei den in der Stadt lebenden nigerianischen Hausa zum Beispiel ist der gleiche Trend auch zu beobach-ten. Die Erwachsenen zeigen immer noch Skarifizie-rungen im Gesicht als Gruppenidentitätszeichen, sie werden aber bei den Neugeborenen immer weniger durchgeführt. Manchmal werden bei sehr traditions-bewussten Gruppen die Motive der bereits verloren gegangenen traditionellen Tätowierungs- und Skari-fizierungspraktiken in irgendeiner Form aufrechter-halten. Dies geschieht zum Beispiel, wenn typische Muster der Tätowierung oder Skarifizierung nicht mehr auf der Haut eingraviert werden, sondern als dekorative Motive in der handwerklichen Produk-tion Verwendung finden. Dies ist der Fall bei den
Ga‘, eine Ethnie im Nordosten Nigerias, wo die Ska-rifizierung im Jahre 1978 offiziell verboten wurde (bErnS 1988: 57–76). In Benin war die Tätowierung als soziale Praxis sehr wichtig, aber heutzutage ist sie, wie in Äquatorialguinea, generell nur bei sehr alten Menschen vorzufinden. Trotzdem wird die tra-ditionelle Tätowierung, die den Namen „Iwu“ trägt, heute als dekoratives Motiv in Kleidungen als Sym-bol der ethnischen Identität reproduziert. Auf diese Art und Weise gehen der Wert und die Identitäts-funktion dieser alten Motive nicht verloren und be-halten ihre soziale Gültigkeit bei, mit dem einzigen Unterschied, dass sie statt auf der Haut eingraviert, auf der Kleidung getragen werden (nEVadomSky & aiSiEn 1995: 72). In anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in Polynesien, überleben innerhalb der Folklorismus-Praktiken alte Tätowierungsmotive nicht mehr als echte Körpermodifikation sondern als einfache Körperbemalung.
Im Fall von Äquatorialguinea, wo die Erinnerung an die alten Tätowierungen oder Skarifizierungen ziemlich vage ist, gibt es auf jeden Fall bis jetzt kei-ne Zeichnen oder Andeutungen, dass man die ehe-mals reiche Körpermodifikationstradition wiederzu-beleben versucht. Die Tradition spielt im heutigen Alltagsleben keine Rolle mehr. In meiner Feldfor-schung über die alten Fang-Tätowierungen konnte ich im Allgemeinen einen gewissen Stolz auf die alten Markierungen bei denen wahrnehmen, die sie noch hatten. Sie waren sich sehr bewusst, dass diese Tätowierungen etwas aus der Vergangenheit waren, “señal de los tiempos remotos“ („Zeichen aus ural-ten Zeiten“). Aber sie machten sich auch keine Sorge um das Verschwinden dieser Tradition, weil sie als etwas angesehen werden, das nur die älteren Gene-rationen betrifft. „Die junge Leute tun heute andere Dinge“, wurde mir sehr oft gesagt. „Manchmal ma-chen sich die Jungen über diese Tätowierungen lus-tig, aber sie müssen sich ja auch an die neuen Tech-nologien [sic] anpassen.“ In allen meinen Interviews sagten mir die traditionell tätowierten Menschen im-mer, dass sie eigentlich gar nicht wollten, dass ihre Enkel die gleichen Tätowierungen tragen. Die Zeit dieser Tätowierungen sei bereits vorbei.
5. Körpermodifikationen und die soziale Präsentation des Körpers
Die Tätowierungen, wie Körpermodifikationen im Allgemeinen, stehen in direktem Bezug zum Kon-zept der sozialen Präsentation des Körpers (martí
81Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers
Curare 36(2013)1+2
2010a), in engem Zusammenhang also mit all dem, was man durch die einfache Tatsache, den Körper in einem Raum der sozialen Interaktion vorzustel-len, kommunizieren will. Daher steht dies auch in Bezug mit der Idee der persönlichen Fassade oder personal front von Erving Goffman (goFFman 1956: 14). Auch wenn der Begriff „Fassade“ uns die Vorstellung von etwas Äußerlichem gibt, sollten wir nicht den Irrtum begehen und die soziale Präsenta-tion des Körpers als eine bloße Maske ansehen, die wir uns leicht aufsetzen und wieder abnehmen kön-nen. In der Tat sind das Selbst und seine öffentliche Präsentation nicht nur verbunden, sondern sie sind eng miteinander verschmolzen, wie der soziale In-teraktionismus uns lehrt (StonE 1962, zit. nach tur-nEr 2008: 97). Wir sprechen dann nicht nur von der öffentlichen Sphäre, in der das Individuum handelt, sondern auch von der privaten und sogar von der Intimsphäre. Und die Tätowierungen erlauben uns, mit diesen verschiedenen Sphären zu spielen. Der Bereich des Körpers, an dem wir die Tätowierung eingravieren lassen, ist sehr bezeichnend für die Sphäre, der wir die Tätowierung zuschreiben.
Die traditionellen Fang-Tätowierungen auf der Stirn oder die Skarifizierungen im Gesicht der Bubi sind diesbezüglich explizite Beispiele: sie gehör-ten ohne Zweifel in die Sphäre der Öffentlichkeit. Das gleiche kann man vom sêsê der Annobonesen behaupten. Aber während diese Körpermodifikati-onen einem bestimmten Kode angehören, der von der Gemeinschaft sehr gut verstanden wird, können andere Tätowierungen auf Armen oder Brust auch sehr gut der privaten Sphäre zugeschrieben wer-den, obwohl sie sich auf sehr sichtbaren Teilen des Körpers befinden. Dies ist zum Beispiel in Äquato-rialguinea bei vielen der modernen Tätowierungen der Fall, die auf affektive Beziehungen anspielen, wenn man nur die Namensinitialen der geliebten Person eingraviert, oder andere, die als magischer Schutz verstanden werden.13 Alle diese Tätowierun-gen können nur vom eigenen Träger oder von einer sehr begrenzten Anzahl von Menschen dekodifiziert werden. Und selbst die traditionellen Tätowierun-gen, die in der Vergangenheit der Öffentlichkeit angehörten, traten im Laufe der Zeit schrittweise in die private und intime Sphäre des Individuums, während ihre soziale Gültigkeit allmählich verlo-ren ging. Ich empfand dies sehr deutlich in einigen meiner Interviews mit alten tätowierten Guineern. Wenn ich nach der Bedeutung dieser Motive, die
mit der faltigen Haut verschmolzen waren, fragte, gab es Menschen, die nicht so gerne bereit waren, mir sehr konkrete Antworten zu geben.
Der Grund dafür war vielleicht, dass alles, was diese Tätowierungen bedeuteten, in Vergessenheit geraten war. Die Zeit, in der man sich diese Mar-kierungen eingravieren liess, lag schon weit zurück. Aber vielleicht auch, weil es zu den persönlichen Er-innerungen gehört, und diese Erinnerungen dürfen nicht so einfach einer Person, die keine Beziehung zu dieser Realität hat, enthüllt werden. Auf diese Weise gehört nun das, was zuvor in die Öffentlich-keit gehörte, jetzt in die private Sphäre. Selbst die jungen Menschen aus Äquatorialguinea, mit denen ich sprach, haben sich oft darüber beklagt, dass die alten Leute ihnen nichts von den alten Traditionen erzählen wollen. Für diese alten Leute gehören die traditionellen Tätowierungen der Vergangenheit an, einer Zeit, die nichts mit dem jetzigen Leben zu tun hat. Ich finde es interessant zu konstatieren, dass eine Tätowierung, obwohl sie konzipiert worden sein kann, um in der öffentlichen Sphäre zu wirken, im Laufe der Zeit und vor allem wegen des sozia-len Wandels am Ende als etwas wahrgenommen
Abb. 9: Tätowierung als Schutz: Marcelo ließ sich dieses Tattoo als Schutz gegen Spinnen eingravieren (Bata 2006. Foto: J. Martí).
82 Josep Martí
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
wird, dass nun eher in die private Sphäre gehören soll. Und dies kann auch trotz ihrer Sichtbarkeit ge-schehen, wie dies bei den Gesichtstätowierungen der Fang der Fall ist.
Körpermodifikationen im Allgemeinen müssen innerhalb der Dynamik der sozialen Präsentation des Körpers verstanden werden. Und diese Dynamik lässt sich vor allem durch folgende drei Parameter erklären, die dem Menschen als soziale Wesen inhä-rent sind: Identität, soziale Ordnung (einschließlich Hierarchie) und Austausch-Bedürfnis. Jedes Indivi-duum hat seine Identität, die ihm seine Einzigartig-keit gibt und es somit von anderen unterscheidet; diese wird innerhalb bestimmter sozialer Strukturen verstanden, und es ist gleichzeitig gezwungen, in einem ständigen Austausch mit anderen Menschen zu handeln, da sonst das Überleben unmöglich sein würde. Und in unseren sozialen Interaktionen ver-langt die soziale Logik des menschlichen Zusam-menlebens immer, zu wissen, wer wir innerhalb der Gemeinschaft sind, welchen Platz wir einnehmen und was und mit wem wir uns austauschen. Und all dies wird durch die Art und Weise signalisiert, in der wir den Anderen unseren Körper präsentieren. Innerhalb dieser drei Parameter der sozialen Logik wird der symbolische Wert des Körpers relevant. Sein symbolischer Wert wird durch die Handlungen ausgedrückt, die wir mit dem Körper ausführen, wie zum Beispiel der Art der Gestik und aller Körper-techniken – worüber der französische Ethnologe Marcel Mauss als erster schrieb (mauSS 1936) –, so-wie über das Bild, das wir von unserem Körper zei-gen wollen, also der Präsentation des Körpers. Und zu diesem letzten Aspekt gehören die Körpermo-difikationen, etwas, das in allen Gesellschaften zu finden ist, d. h., alle diese Techniken, wodurch ohne therapeutische Absicht dauernde Veränderungen am Körper vorgenommen werden. Darunter fallen na-türlich auch die Tätowierungen oder Skarifizierun-gen, von denen in diesem Artikel die Rede ist.
Sowohl kollektive als auch individuelle Identität ist das, was uns innerhalb einer bestimmten Gemein-schaft oder eines Kollektivs definiert und von den anderen abgrenzt. Ein großer Teil der traditionellen Fang-Tätowierungen gehört zu diesem Parameter. Körperliche Veränderungen wie jene Skarifizierun-gen der Bubi oder die Einschnitte der Annobonesen am Körper vornehmen sind heute wahre ethnische Symbole geworden, obwohl sie ursprünglich nicht als Identitätsmarkierungen konzipiert worden wa-
ren. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass es heute junge Annobonesen gibt, die stolz auf diese Skarifizierungen sind und vor allem darauf, dass die Bevölkerung Äquatorialguineas diese Insula-ner automatisch an diesen Einschnitten im Körper identifiziert. Bei den Bubi-Skarifizierungen ist es etwas anders, da es heute schwierig wäre jemanden zu finden, der sein Gesicht gerne mit solch tiefen Schnitten kennzeichnen wollte. Aber trotz alledem fungieren die alten Bubi-Skarifizierungen heutzuta-ge als Vergangenheitszeichen für eine Bevölkerung, die sich gerne von der im Lande herrschenden Eth-nie, den Fang, unterscheiden möchte.14
Die Tatsache, dass Menschen soziale Wesen sind, impliziert Organisation, und ein Aspekt davon ist die soziale Ordnung, das, was wir als formelle Strukturierung der sozialen Beziehungen verstehen, eine Gesamtwerk von Regeln und Vorschriften, die die Beziehungen zwischen den Menschen und den verschiedenen Schichten einer konkreten Ge-sellschaft regeln. Und diese soziale Ordnung wird deutlich sichtbar durch die soziale Präsentation des Körpers ausgedrückt. Die Präsentation des Körpers sagt uns, wie die Person innerhalb des sozialen Sys-tems verstanden wird.
Angesichts der Bedeutung, die die soziale Prä-sentation des Körpers hat, ist es kein Wunder, dass alle Gesellschaften sehr konkrete Vorschriften über die äußere Erscheinung ihrer Mitglieder besitzen. Hier müssen wir von einer „Politik der Präsenz“ sprechen. Diese steht in enger Beziehung zu dem Begriff der öffentlichen Sphäre und ist unter ande-rem für die Regulierung des körperlichen Erschei-nungsbildes zuständig (moorS 2006: 115–131). Dies erklärt die damalige Abneigung der Kolonialherren in Afrika einschließlich der Religionsvertreter, die sie begleiteten, gegen solche sozialen Präsentatio-nen des Körpers in der Öffentlichkeit, insbesondere, wenn sie gegen die westlichen Kriterien der Präsen-tation verstießen, so Nacktheit, Tätowierung, Ska-rifizierung und Körperveränderungen im Allgemei-nen (martí 2012a). Und im heutigen Westen sind die Spannungen, die solche sozialen Präsentationen des Körpers bewirken, in unserer postkolonialen Welt Wirklichkeit. Man braucht dabei nur an die Diskurse über Kleidungspraktiken von moslemi-schen Frauen in Europa oder die tiefe Abneigung gegen Genitalverstümmelungen bei Mädchen und Frauen zu denken (martí 2012a: 334–340).
83Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers
Curare 36(2013)1+2
Jede Form von Körperveränderung, Tätowie-rungen, Skarifizierung, Piercings, Verformung oder Amputation, die über das geht, was als „normal“ angesehen wird, stellt ein Attentat gegen die so-ziale Ordnung dar: „Der Körper symbolisiert den Kampf zwischen Ordnung und Unordnung in allen Gesellschaften“ (SokoLoW 1983: 25). Dies wird insbesondere durch seine soziale Präsentation in der Öffentlichkeit eindeutig. Auch Körper, die be-reits von Geburt an als anormal betrachtet werden, sind sehr oft verdächtig. Wir brauchen nur an die Probleme zu denken, die die Albinos in vielen afri-kanischen Ländern haben. Auch bei den Äquatorial-guineischen Ndowé zum Beispiel glaubt man, dass Kinder, die mit einer Fehlbildung geboren werden, Zaubermacht besitzen.15
Wenn soziale Ordnung und Hierarchie logische Konsequenzen der sozialen Natur des Menschen darstellen, gehört auch das Austauschbedürfnis zur sozialen Logik. Die Einzelpersonen können nur überleben, wenn sie die Austauschbeziehungen mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft auf angemes-sene Weise artikulieren. Diese Beziehungen werden über das, was wir „Soziabilität“ nennen, hergestellt, und deren Hauptgrund die absolute Unentbehr-lichkeit der Interaktion zwischen den verschiede-nen Mitgliedern der Gesellschaft ist. Durch unsere Körper-Präsentation sagen wir den anderen in allen Situationen, welche Art der Interaktion, welche Art von Kontakt, welche Art vom Austausch wir mit den Menschen wollen, mit denen wir von Angesicht zu Angesicht konfrontiert sind. Aus diesem Grund war es zum Beispiel früher sinnvoll, durch Tätowierun-gen zu zeigen, ob eine Person verheiratet war oder nicht, wie dies der Fall bei den alten Fang-Tätowie-rungen war, oder Gruppenzugehörigkeit zu zeigen, da logischerweise die Art vom sozial anerkanntem Austausch zwischen zwei Individuen von diesen Umständen abhängt.
In Bezug auf die soziale Präsentation des Körpers sind innerhalb der westlichen Gesellschaftslogik - ei-ner Logik, die durch die gesamten Globalisierungs-prozesse, zum Teil auch für andere Gesellschaften der Welt gültig ist – das Gesicht, der Hals und die Hände die einzigen Körperteile, die im Allgemeinen nicht bedeckt werden.16 Dies ist der Grund, warum nur sehr selten Tätowierungen auf diesen Teilen des Körpers zu sehen sind. Tätowierungen geben immer irgendwelche Informationen über die eigene Person17 und zu bestimmten Gelegenheiten wird es strategisch
besser sein, die Tätowierung nicht zu zeigen. Es ist zwar richtig, dass heute im Westen viele Tätowie-rungen auf dem Rücken, den Armen, Beinen oder sogar auf dem Bauch leicht zu sehen sind, wenn die klimatischen Bedingungen es erlauben. Aber bei Be-darf können diese Teile des Körpers auch leicht wie-der mit Kleidung bedeckt werden. Die traditionellen Fang-Tätowierungen, die man im Gesicht oder am Hals hat, sind selbstverständlich immer sichtbar. Man kann sie zwar auch heute nicht verbergen, aber man kann die soziale Bedeutung verschweigen, die sie hatten, als sie eben sozial relevant waren. Dies geschah manchmal, wenn ich meine Feldforschung mit älteren tätowierten Individuen führte. Die Leu-te, die ich interviewte, hatten Tätowierungen, die eindeutig Gruppenzugehörigkeit implizierten. Auf meine Frage nach ihrer Bedeutung sagten die alten tätowierten Guineer mir aber, dass sie nur aus ästhe-tischen Gründen, die der damaligen Zeit entsprachen, gemacht wurden. Nicht selten aber, da ich oft diese Interviews in Anwesenheit von verschiedenen Mit-gliedern der Familie führte, korrigierte man dies, und erinnerte uns daran, dass jene Tätowierungen nicht nur Schönheit implizieren sollten, sondern vor allem Familien- oder Stammes-Zugehörigkeit zeigten. Es waren Tätowierungen, die zwar ursprünglich für die Öffentlichkeit gedacht waren, im Lauf der Zeit aber allmählich auf die private Sphäre beschränkt wurden. Deswegen hält es nicht jeder für angebracht, ihre ur-sprüngliche Bedeutung dem erstbesten Fremden zu offenbaren, der neugierig danach fragt.
Tätowierungen sind der Ausdruck von sehr konkreten Weltanschauungen, und wenn sich diese ändern, müssen sich auch diese Körpermodifika-tionen in irgendeiner Weise ändern. Da die Täto-wierungen oder Skarifizierungen in der Haut der Menschen eingraviert sind, können sie nicht leicht verschwinden, aber was geändert werden kann, ist ihre soziale Wahrnehmung. In den traditionellen Fang-Tätowierungen wird der Signifikant, das alte Tätowierungsmotiv, beibehalten, was jedoch geän-dert wird, ist ihr Signifikat. Indem man sagt, dass sie nur für ästhetische Zwecke gemacht wurden, indem man die anderen sozialen Bedeutungen und Funkti-onen „vergisst“, die die Tätowierungen auch gehabt haben könnten, zeigen die Menschen sehr deutlich, welchen Stellenwert diese alten traditionellen Tä-towierungen in der heutigen Öffentlichkeit haben, denselben Stellenwert nämlich, der modernen Täto-wierungen zugeschrieben wird, und der vor allem als
84 Josep Martí
VWB – Verlag für Wissenschaft und Bildung
Mode verstanden wird. Die Gültigkeit aller anderen Bedeutungen, die die traditionellen Tätowierungen auch haben können, wird nur im privaten Bereich beibehalten.
Es ist klar, dass nicht alle Manifestationen des kulturellen Erbes gepflegt werden müssen. Tätowie-rungen und körperliche Veränderungen im allgemein sind Ausdruck von konkreten Weltanschauungen und wenn sich diese ändern, macht es keinen Sinn, auf den Erhalt aller kulturellen Praktiken, die mit ihnen verbunden sind, zu bestehen. Aber dies muss nicht bedeuten, dass alle diese Aspekte unseres Kulturerbes nicht unsere Aufmerksamkeit verdienen. Sie gehören zur Geschichte dieser Kulturen, die jetzt so große Veränderungen erleben, und sie gehören nun auch zur Geschichte der Menschheit im Allgemeinen.
Anmerkungen1. Der Inhalt des Artikels basiert auf Feldforschungen, die ich seit
2006 jährlich in Äquatorialguinea im Rahmen des Projektes Körper und Modernisierungsprozesse in Afrika am Beispiel von Äquatorialguinea (CSO2011-23718) durchführe. Die For-schungsaufenthalte mit der durchschnittlichen Dauer je eines Monates fanden im Sommer oder Herbst statt. Die Daten habe ich mittels Interviews und teilnehmender Beobachtung vor al-lem im kontinentalen Teil des Landes – Bata und alle inneren Regionen – aber gelegentlich auch in Bioko (Malabo) gesam-melt.
2. Wenn ich in diesem Text von „Modernität” und ihren Deriva-ten spreche, meine ich “that cultural space, a regime of social expérience” (FriEdman 2002: 289), und dass sich diese durch die Existenz von Ideen, Praktiken und Werten auszeichnet, die eng mit dem Markt und der Informationsgesellschaft in einem globalisierten Kontext verbunden sind. Die innerhalb der mächtigen Globalisierung stattfindenden Strömungen von Modernisierung bringen logischerweise einen Prozess des Kulturwandels mit sich, der als Akkulturation bezeichnet wird. Modernität kann als der Prozess der verschiedenen Erschei-nungsformen der globalen Kräfte verstanden werden, die auf die lokalen Welten einwirken (EngLund 1996: 258) und ist des-halb tatsächlich in verschiedenen Formen zu erfahren. Die Idee der „Moderne” impliziert den Begriff des Wandels sowohl in Bezug auf das, was als Tradition verstanden wird, als auch auf eine Umstrukturierung der Beziehungen zwischen Individuum und Gesellschaft. Auch wenn der Begriff der Modernität kom-plex und sogar umstritten ist und wenn “a good part of the key problems that nowadays affect Africa can be conceptualized in terms of Africa’s relation to, experience of, and engagement with modernity” (táíWò 2010: 3) wahr sein sollte, ist die Frage der Modernität unausweichlich, und dies trotz aller Probleme, die bei der Verwendung dieses Begriffes entstehen (gESchiErE, mEyEr & pELS 2008: 1; dazu siehe auch martí 2012b).
3. Die ehemalige spanische Kolonie Äquatorialguinea ist ein sehr kleines Land, das aus einem kontinentalen Teil und verschiede-nen Insel besteht. Die Hauptstadt Malabo liegt auf Bioko, der größten Insel des Landes. Quantitativ gesehen sind die Fang die wichtigste ethnische Gruppe. Außerdem gibt es die Bubi, die alteingesessene Bevölkerung der Insel Bioko, die Ndowe, Bu-jedba, Annobonesen von der Insel Annobon, sowie die Nach-kommen englischsprachiger Kreolen (Fernandinos) auf Bioko.
4. Tessmann war außerdem ziemlich kritisch gegenüber der stark negativen Einstellung der Missionare gegenüber diesen Kör-
permodifikationen, die er weder für besonders hässlich noch für grausam hielt (tESSmann 1923: 40).
5. Es muss vermutet werden, dass die spanische Verwaltung die Bubi-Skarifizierungen verbot, wie man z. B. aus Fontán (1943) entnehmen kann. Dennoch habe ich unter den erlassenen Ge-setzen bis jetzt keinen eindeutigen Beweis dafür finden können. Im Gegensatz dazu wurden Gesetze über die Notwendigkeit erlassen, dass die ansässige Bevölkerung in der Öffentlichkeit nicht nackt sein durfte und „anständig“ gekleidet sein musste (siehe z. B. den Boletín Oficial de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea vom 1.8.1924, in miranda 1945: 795).
6. „Der Panwe [Fang] und der Buheba […] markieren sehr gerne den Bauch, Rücken und die Arme mit echten künstlerischen Zeichnungen, die sie mit der Spitze von scharfen Messern aus-führen; diese Operation, die äußerst schmerzhaft sein muss, erfolgt während der Kindheit, und die Zeichnungen bleiben unauslöschbar für das ganze Leben.” (Meine Übersetzung).
7. Die Ethnologen haben den Fang-Tätowierungen kaum Auf-merksamkeit geschenkt. Der Ethologe Jordi Sabatér veröffent-lichte aber im Jahre 1992 eine Studie über dieses Thema nach Aufzeichnungen, die er in den 50er Jahren über Fang-Tätowie-rungen sammelte, einer Zeit, in der es immer noch leicht war, tätowierte Körper bei den Fang zu beobachten (SabatEr & Sa-batEr 1992).
8. Es handelt sich dabei um eine sehr verbreitete Prozedur in Zentralafrika gegen bestimmte Krankheiten, aber vor allem als Schutzmaßnahme gegen Hexerei. In diesen Fällen wird aber keine Pigmentierung vorgenommen.
9. Alle meine Informanten waren sich in dieser Hinsicht einig. Auch Albert Bennett schrieb in einem Artikel über die Fang, der 1899 veröffentlicht wurde, dass keinerlei Zeremonie mit den Tätowierungen verbunden war (bEnnEtt 1899: 74).
10. Oft verwendet man dafür auch das Wort cutâ, auch wenn tat-sächlich cutâ eine allgemeine Bezeichnung für Skarifizierun-gen mit heilender Absicht ist.
11. Einmal sprach ich mit einer 19-jährigen Frau, die – obwohl Annobonesin – in Malabo wohnte und sehr stolz auf diese Ska-rifizierungen war. Sie hatte sogar die Absicht, die bisherigen Schnitte mit einem neuen Eingriff zu verstärken, weil die Nar-ben im Lauf der Jahre an Sichtbarkeit eingebüßt hatten.
12. Man muss hier hinzufügen, dass der Annobonese Gaudencio Morgades Adventisten-Pastor ist und sich deswegen von vie-len traditionellen Einstellungen distanziert, wie z. B. von der Schutzfunktion des sêsê.
13. Ab und zu habe ich junge Guineer getroffen, die Tätowierun-gen hatten, denen eine Schutzfunktion zugeschrieben wur-de. Manchmal handelte es sich um ein einfaches christliches Kreuz, andere Male aber waren es Symbole und Buchstaben, deren Bedeutung geheim bleiben sollte (martí 2010b: 6).
14. Über die ethnischen Konflikte in Äquatorialguinea siehe buaLE borikó 1988, muakuku 2006, SEpa 2011.
15. Diese Kinder werden enongui wato genannt; dies bedeutet „die, die verhexen können“ (FonS 2004: 128).
16. Wir brauchen nur an die tiefe Abneigung zu denken, die man oft im Westen gegen die Sitte des Tragens verschiedener Schleier-formen bei moslemischen Frauen empfindet, einer Abneigung, die sogar in einigen europäischen Ländern zum Erlass von Ge-setzen geführt hat, um diese zu unterbinden.
17. Nicht nur wegen der konkreten eingravierten Motive, sondern auch wegen der bloßen Tatsache, das Gesicht tätowiert zu ha-ben, etwas, dass in der Regel in der westlichen Gesellschaft nicht so gut angesehen wird.
LiteraturaLExandrE p. & binEt J. 1958. Le groupe dit pahouin (fang – bou-
lou – beti). Paris: Presses Universitaires de France.
85Körperveränderungen und die soziale Präsentation des Körpers
Curare 36(2013)1+2
aLLEn W. & thomSon t. r. h. 1848. A Narrative of the expedition sent by her Majesty‘s government to the river Niger in 1841. London: Bentley, 2nd Vol.
aymEmí A. 1942. Los bubis en Fernando Poo. Madrid: Galo Sáez.baumann O. 1888. Fernando Póo und die Bube, dargestellt auf
Grund einer Reise im Auftrage der K. K. Geographischen Ge-sellschaft in Wien. Wien: E. Hölzel.
bEnnEtt A. L. 1889. Ethnographical Notes on the Fang. The Jour-nal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ire-land. 29,1/2: 66–98.
bErnS M. C. 1988. Ga’anda Scarification: A Model for Art and Identity. In rubin a. (eds). Marks of Civilization. Los Angeles: Museum of Cultural History, University of California: 57–76.
buaLE borikó, E. 1988. Guinea Ecuatorial. Las aspiraciones bubis al autogobierno. Madrid: IEPALA.
burton R. F. 1863. A Day Amongst the Fans. Anthropological Re-view 1: 43–54.
du chaiLLu P. B. 1861. Explorations and adventures in Equatorial Africa, New York: Harper & Brothers.
coLL A. 1899. Segunda memoria de las misiones de Fernando Póo y sus dependencias. Madrid: imprenta de San Francisco de Sales.
EngLund, h. 1996. Witchcraft, Modernity and the Person: The mo-rality of accumulation in Central Malawi. Critique of Anthro-pology 16: 257–279.
FonS V. 2004. Entre dos aguas. Etnomedicina, procreación y salud entre los ndowé de Guinea Ecuatorial. Vic: Ceiba.
Fontán y Lobé J. 1943. La etnología y la política indígena (Vor-trag). http://www.asodegue.org/hcdf1d.430626.htm. [letzter Zugang: 28.8. 2012].
FriEdman J. 2002. Modernity and Other Traditions. In B. M. Knauft (Hrsg.) Critically Modern: Alternatives, Alterities, Anthropo-logies. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press: 287–314.
gESchiErE p, pELS p. & mEyEr b. (eds) 2008. Readings in Moder-nity in Africa. London: London International African Institute, School of Oriental and African Studies.
goFFman E. 1956. The Presentation of Self in the Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh.
houSEman m. 1992. La iniciación masculina So o los artificios de la lógica iniciática. In Mallart L. (ed). Ser hombre, ser alguien. Ritos e iniciaciones en el sur del Camerún. Barcelona: UAB: 39–67.
hutchinSon t. J. 1858. Impressions of Western Africa. London: Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts.
iradiEr m. 1887. Africa,viajes y trabajos, Asoc. Euskara La Ex-ploradora Vol. II.
LaburthE-toLrá p. 1985. Initiations et sociétés secrètes au Came-roun. Essai sur la religion beti. Paris: Karthala.
manguE c. 1962. La ceremonia del so. La Guinea Española 1560: 272–274.
martí J. 2010a. La presentación social del cuerpo: Apuntes teóricos y propuestas de análisis. In martí J. & aixELà y. (eds). Des-velando el Cuerpo. Perspectivas desde las ciencias sociales y humanas. Madrid: CSIC: 107–122.
––––– 2010b. Tattoo, Cultural Heritage and Globalization. The Sci-entific Journal of Humanistic Studies 3: 1–9.
––––– 2012. África: Cuerpos colonizados, cuerpos como identidades. Revista de Dialectología y Tradiciones Populares LXVII, 1: 319–346.
martín dEL moLino, a. 1993. Los bubis. Ritos y creencias. Madrid: Labrys.
martínEz y Sanz m. dE 1859. Breves apuntes sobre la Isla de Fern-ando Po en el Golfo de Guinea. Madrid: Impr. de H. Reneses.
mauSS m. 1936. Les techniques du corps. Journal de Psychologie XXXII, 3–4. Reprint 1950. Sociologie et anthropologie. Paris: PUF.
miranda Junco a. 1945. Leyes coloniales, Dirección General de Plazas y Provincias Africanas. Madrid: Sucesores de Rivade-neyra.
mobaJaLE b. et al. 2002. Los últimos escarificados de la isla de Bioko. Madrid: Centros culturales españoles en Guinea Ecu-atorial.
Moors A. 2006. Representing Family Law Debates in Palestine: Gender and
the Politics of Presence. In mEyEr b. & moorS a. (eds). Media, Religion and the Public Sphere. Bloomington: Indiana Uni-versity Press: 115-131.
muakuku rondo igambo F. 2006. Conflictos étnicos y gobernabili-dad: Guinea Ecuatorial. Barcelona: Ediciones Carena.
nEVadomSky J. & aiSiEn E. 1995. The Clothing of Political Identity: Costume and Scarification in the Benin Kingdom. African Arts 28,1: 62–100.
oSSorio a. 1886. Fernando Póo y el Golfo de Guinea, apuntes de un viaje. Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid: La Sociedad, t. 15.
SabatEr J. & SabatEr J. o. 1992. Els tatuatges dels Fang de l‘Àfri-ca Occidental. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
SEpa E. 2011. España en la isla de Fernando Poo (1843–1968). Colonización y fragmentación de la sociedad Bubi. Barcelona: Icaria.
SokoLoW J. 1983. Eros and Modernization. London and Toronto: Associated Universities Press.
StonE g. 1962. Appearance and the self. In roSE A. (ed). Human Behavior and Social Processes: An Interactionist Approach. London: Nimkoff: 86–118.
táíWò o. 2010. How colonialism preempted modernity in Africa. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.
tESSmann g. 1913. Die Pangwe. Völkerkundliche Monographie ei-nes Westafrikanischen Negerstammes. Berlin: Ernst Wasmut.
–––––1923. Die Bubi auf Fernando Poo. Hagen und Darmstadt: Folkwang-Verlag.
turnEr B. 2008. Body and Society. Explorations in Social Theory. London: Sage [3rd ed.]
Manuskript eingegangen: 02.12.2012Manuskript angenommen: 16.03.2013
Josep Martí promovierte nach dem Studium der Kulturanthropologie (Barcelona und Göttingen) 1985 un-ter der Leitung von Prof. Rolf W. Brednich an der Philipps-Universität Marburg. Seit 1989 arbeitet er als Kulturanthropologe und Titularforscher am CSIF (http://www.imf.csic.es/). Er hat Feldforschung in Spani-en, Italien, Japan und in der letzten Jahren in Äquatorial-Guinea betrieben. Schwerpunkte u.a.: soziale Be-deutung des immateriellen Kulturerbes, kollektive Identitäten und Kultur (Ethnizität, Multikulturalismus), Anthropologie des Glaubens und Anthropologie des Körpers. Als Gastprofessor gibt er regelmäßig Kurse an verschiedenen Universitäten vor allem in Spanien, aber auch in anderen Ländern.
Dpt. Arqueologia i AntropologiaInstitució Milà i Fontanals (CSIC)C/ Egipcíaques 1508001 Barcelonae-mail: [email protected]



















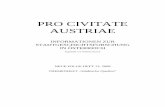














![Innere und Äussere Peripherie am Beispiel Tschechiens [Inner and outer periphery: Example of Czechia]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6319f9e220bd5bb1740c13b4/innere-und-aeussere-peripherie-am-beispiel-tschechiens-inner-and-outer-periphery.jpg)



