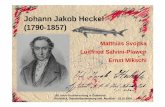TEXTE UND KONZEPTE DES NEUHUMBOLDTIANISMUS IN DER MODERNEN DEUTSCHEN...
Transcript of TEXTE UND KONZEPTE DES NEUHUMBOLDTIANISMUS IN DER MODERNEN DEUTSCHEN...
Radtschenko Oleg A.
TEXTE UND KONZEPTE DES
NEUHUMBOLDTIANISMUS IN DER MODERNEN
DEUTSCHEN
SPRACHWISSENSCHAFTSGESCHICHTSSCHREI
BUNG (am Beispiel Johann Leo
Weisgerber)
The article is an attempt to apply
the principle of historiographic
correctness to the Neo-Humboldtian
school in modern language
philosophy, represented maynly by
J.L. Weisgerber (1899-1985), J.
Trier (1894-1970), W. Porzig (1895-
1960), H. Brinkmann (1901-2000)
etc. Into modern language
philosophy, they introduced the
very first language relativity
theory considering every language
as a system of unique concepts and
as a special way of cognition, a
permanent process of reconstructing
reality by original means of the
given language community. Very
special results of their research
were (among others) a content-
oriented grammar of German, an
ergologic etymology, and a field
approach to lexical resources of
language. In spite of their strong
influence upon every field of
Germanic studies in European
linguistics, the Neo-Humboldtians
have been attacked since the 1950s
in Germany and outside for having
presumably collaborated with the
Nazi regime. This opinion can be
found in various German linguistic
publications by G. Simon, R. Römer,
U. Maas, H. Ivo etc., as well as in
Chr. M. Hutton’s opus newly
published in USA on linguistics
during the Nazi period. In this
article I try to uncover various
critical “techniques” used in the
recent papers on Weisgerber’s
activities in the Nazi time and to
demonstrate an opposite view of
this case, especially using archive
materials from J.L. Weisgerber’s
Rostock University file.
Dieser Beitrag versteht sich als
eine metakritische Studie und eine
Fortsetzung der Debatte um Leo
Weisgerber, die vor zwei Jahren auf
der Konferenz in Münster anlässlich
seines 100. Geburtstages begann.
Mehr als zehn Jahre dauert dagegen
die Auswertung des
wissenschaftlichen Nachlasses des
deutschen Neuhumboldtianismus im
Rahmen des von mir geleiteten
wissenschaftlichen Projektes
„Geschichte der Sprachwissenschaft
Deutschlands im XX. Jahrhundert“ an
der Moskauer Städtischen
Pädagogischen Universität. Von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
dieses Projektes werden u.a. in
Promotions- und
Habilitationsschriften Bahn
brechende sprachphilosophische
Aspekte und deskriptive Verfahren
des Neuhumboldtianismus untersucht,
mit Bezug auf die wissenschaftliche
Tätigkeit von J.L. Weisgerber
(1899-1985), J. Trier (1894-1970),
W. Porzig (1895-1960), H. Brinkmann
(1901-2000) und anderen Vertretern
dieser Richtung.
Bei der Bewältigung dieser Aufgabe
war es nicht möglich, an einem
solchen Problem achtlos
vorbeizukommen, wie der Tätigkeit
der Neuhumboldtianer in der NS-
Zeit, obwohl dieses Problem eher am
Rande unseres Interesses steht.
Diese Frage kann aber zu einem
Stolperstein für Historiographen
der deutschen Sprachwissenschaft
werden, weil sie einen angesichts
der vielen eindeutig anklagenden
Beurteilungen dieser Wissenschftler
gerade im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit in der NS-Zeit stutzen
lässt. Diese negative Beurteilung
ist m.E. bereits zu einer
Pflichtstelle in modernen
historiographischen Werken in
Deutschland geworden, was nicht
zulezt auf die vielen kritischen
Schriften von G. Simon (1982, 1984,
1985) und seinen Mitstreiterinnen
und Mitstreitern zurückzuführen
ist.
Es ist aber nicht diese
Forschergruppe, die zum ersten Mal
die Neuhumboldtianer unter Beschuss
nimmt. Da sie in vielerlei
Hinsichten neue Wege in der
modernen Sprachbeschreibung
bahnten, gerieten sie ständig in
einen Clinch mit Vertretern der
jeweils vorherrschenden
Konzeptionen und wurden von denen
jedes Mal nicht weniger heftig
angegriffen, als in den 80-90er
Jahren von G. Simon, R. Römer
(1985), U. Maas (1986, 1988a,
1988b), H. Ivo (1990, 1994) u.a. Es
lassen sich folgende Beispiele
nennen: 1) Diskussionen zwischen
Neuhumboldtianern und Anhängern der
traditionellen Bedeutungslehre
(z.B. zwischen J.L. Weisgerber und
L. Spitzer) in den 20er Jahren; 2)
Angriffe seitens der NS-
Rassenlinguistik in den 30-40er
Jahren (B. von Bazan, Ed. Glässer),
wo der gesamten
Sprachinhaltsforschung damals die
Titel ‚Sprachwissenschaft auf
Schleichwegen‘ und ‚volksfeindliche
Sprachphilosophie‘ verliehen
wurden; 3) ideologisch fundierte
Kritik seitens der
Sprachphilosophen in der DDR und in
der UdSSR; zu erwähnen wären hier
E. Albrecht (1991: 126-142; aber
auch früher), zum Teil auch G.
Helbig, aber auch M. Guchmann, L.
Jermolajewa und viele andere in der
Zeitspanne 50-90er Jahre (s.
Radcenko 1993); 4) Kostproben des
„entlarvenden“ Journalismus in
Deutschland in den 50-60er Jahren
(W. Boehlichs Insinuationen in
Bezug auf Weisgerbers angebliches
Engagement für das Nazi-Regime im
WDR und im „Merkur“). Es ist im
Rahmen dieses Beitrages natürlich
nicht möglich, allen Argumenten
aller Kritikersparten nachzugehen.
Das Thema ‚Nationalsozialismus und
Linguistik‘ sehe ich aber als eine
Art Prüfstein für die Objektivität
der modernen
Sprachwissenschaftsgeschichtsschrei
bung in Deutschland an und wende
mich deswegen den Arbeiten der 80-
90er Jahre zum Thema „Leo
Weisgerber und das Dritte Reich“
zu, um dort wenigstens Spuren der
‚historiographischen Korrektheit'
zu entdecken.
Warum ist dieses Thema, das
äußerlich als ein interner
deutscher Versuch der
Vergangenheitsbewältigung im
konkreten Bereich
(Sprachwissenschaft) aussieht, für
ausländische Forscherinnen und
Forscher so wichtig? Die
Vergangenheitsbewältigung ist ein
Bestandteil jeder nationalen
Historiographie, sie ist überdies
eine nicht wegzudenkende Stufe der
Geschichte jeder
Geisteswissenschaft, ein mehr oder
weniger freiwillig, mehr oder
weniger aufrichtig unternommener
Versuch auf die bereits
zurückgelegten Meilen der
Anverwandlung jeweiliger geistigen
Sphäre eine kritische
Asphaltschicht aufzuschütten, sei
es, um diese Meilen für Anfänger
begehbar zu machen oder sie dadurch
zu anderen, womöglich persönlichen
Zwecken verwendbar zu gestalten.
Meine eigene Einstellung zur
landesinternen
Vergangenheitsbewältigung lässt
sich hoffentlich nicht überhören,
weil ich in der Tat kaum glaube,
dass ein inländischer Forscher
absolut unvoreingenommen brenzliche
Themen der modernen und modernsten
Entwicklungen in seiner hauseigenen
Wissenschaft analysieren kann. Es
ist natürlich nicht (oder zumindest
nicht immer) die Frage der
Kompetenz oder der
wissenschaftlichen Ausbildung. Es
ist die Frage des
Selbstbewusstseins eines Forschers
als eines Teils der bestimmten
wissenschaftlichen Elite, die Frage
seiner Zugehörigkeit zu bestimmten
Schulen oder Forschungskreisen, die
Frage seiner Gläubigkeit in Bezug
auf die Einstellungen, die er von
seinen Mentoren erbt. In
Deutschland hat dies aber noch eine
besondere Bewandtnis, und zwar im
Zusammenhang mit der deutschen
Bewältigung der Nazi-Vergangenheit,
die jedem Zeitgenossen von damals
offensichlich nur eine der zwei
Rollen zuschreiben lässt: Nazi-
Mitläufer(in) oder
Antifaschist(in). Ich wage es zu
behaupten, dass diese
Rollenzuweisung, zumindest in der
Sprachwissenschaft, oberflächlich
ist.
Ich plädiere somit für den
stärkeren Engriff der ausländischen
Forscher in diese Problematik und
berufe mich auf ähnliche
Situiation, die um die interne
Bewältigung der sowjetischen
Linguistik in Russland entstanden
ist, u.a. auf den Versuch V.
Alpatovs die Linguistik der
Stalinzeit einer kritischen Analyse
zu unterziehen, der bei weitem
nicht nur Applaus geerntet hat
(Alpatov 1991).
Wie polemisch solche Meinung auch
klingen mag, stützt sie sich doch
auf meine Versuche aus der
deutschen Bewältigung der NS-Zeit
am Beispiel Sprachphilosophie
objektive Kriterien dieser
Bewältigung herauszusondern. Als
Ausgangsbasis dienten mir folgende
Vorstellungen, wie diese
Objektivität, diese
‚historiographische Korrektheit‘
erreicht werden könnte: a) dass man
z.B. den jeweiligen Verfasser mit
seinem ganzen wissenschaftlichen
Werk sprechen hört, bevor man zu
einem kritischen Urteil desselben
gelangt; man würde also
gewissermaßen narrativ, und nicht ad
hoc vorgehen; b) dass man den
Autorendiskurs sehr weit fasst und
nicht nur Veröffentlichungen,
sondern auch eventuell Skizzen,
Manuskripte, Archivalien, Briefe,
sogar Personalakten der Linguisten
dareinschließt, soweit dies alles
verfügbar ist; c) dass man den
Nachlass eines Wissenschaftlers
streng chronologisch und umfassend
kennen lernt und analysiert, damit
die ganze kreative
Begriffsgeschichte sichtbar wird,
so dass man zum Beispiel den
„begrifflichen Schatz“ des
Verfassers wiederherstellen und
somit in gewisser Weise seinen
Gedanken folgen könnte; d) dass man
auch die Bibliothek“ des Verfassers
rekonstruiert und den
wissenschaftlichen und
gegebenenfalls politischen Kontext
seiner Arbeit berücksichtigt, e)
dass man im besoders glücklichen
Fall mit den Augenzeugen des
wissenschaftlichen Wachstums dieses
Autors ins Gespräch kommt.
Im Ergebnis könnte man zu einem
möglichst widerspruchslosen
‚mentalen Porträt‘ des
Sprachwissenschaftlers kommen und
von diesem Standpunkt aus einen
oder anderen Schritt desselben
beurteilen. Dabei wäre
wahrscheinlich sehr vorteilhaft für
die Nüchternheit der Analyse den
möglichst hohen Grad der
Emotionslosigkeit in Bezug auf
wissenschaftliche Gegebenheiten zu
erreichen, um dem Leser und der
Leserin den Autor so zu
präsentieren, dass sie diesen sehen
und hören und selbständig dessen
Verdienste oder Fehlgriffe
beurteilen können. Das habe ich mit
meiner Habilitationsschrift über
J.L. Weisgerber versucht, der eine
Veröffentlichung einiger Schriften
von Weisgerber in meiner
Übersetzung vorausging und die auf
die Analyse von über 2000 Artikeln,
Schriften, Briefen, Archivalien,
dem gesamten sprachphilosophischen
Nachlass von Weisgerber, auf der
Durchforstung von wichtigen
Veröffentlichungsquellen aus den
20-90er Jahren, sowie auf
zahlreichen Gesprächen mit seinen
Kollegen und Schülern aufgebaut war
(Radcenko 1997; cf. Sciarini-
Guryanova 2001).
Die Erforschung der Periode seines
Schaffens, die in die NS-Zeit
fällt, war mit großen Problemen
verbunden, die sich aus dem Verlust
zahlreicher Publikationsquellen im
Krieg ergeben. Andererseits habe
ich im Universitätsarchiv Rostock
die Pesonalakte Weisgerbers
(Pesonalakte 1926-1937) studieren
dürfen und somit war ich
gewissermaßen gewappnet, um zu
sehen, wie die Bewältigung des
Problems ‚Neuhumboldtianer im 3.
Reich‘ im heutigen Deutschland
aussieht.
Diese besteht offensichtlich
lediglich im Bestreben, die These
von der bedingungslosen Mitschuld
und Kolloboration der
Neuhumboldtianer mit verschiedenen
Mitteln zu beweisen. Die Techniken
und Besonderheiten der Weisgerber-
‚Forschung‘ ließen sich
folgendermaßen skizzieren:
1.Markante Phraseologie, die vor allem
G. Simon eigen ist und die der
Leserschaft die wirkliche
Einstellung des Kritikers zum
Objekt seiner Kritik von vorne
herein signalisiert, z.B.
‚Weisgerbers Unverstand und
Hilflosigkeit‘, er präsentiere ‚die
Sprachinhaltsforschung in einer
jämmerlichen Gestalt‘, er behandle
etwas ‚törichterweise‘ usw. (Simon
1982: 30), ‚Weisgerbers
Sprachphetischismus‘ (Simon 1982:
41). Diese Ausdrucksweise erinnert
einen so sehr an den Sprachgebrauch
der stalinistischen Hofkritiker und
des „Vaters der Völker“ selber (cf.
Alpatov 1991).
2.Heranziehen von speziell herausgepfückten
und kombinierten Zitaten. Das betreibt
z.B. G. Boveland, indem sie
Weisgerbers Definition der
Sprachgemeinschaft näherzukommen
versucht und diese von ihr
zusammengebastelten Bruchstücke
seiner Werke nicht etwa mit den
Ansichten von F. Tönnies (1855-
1936), A. Vierkandt (1867-1953)
oder W. Sombart (1863-1941)
vergleicht, die für Weisgerber
wirklich von Bedeutung waren,
sondern nur mit O. Spann (1878-
1956) (Boveland 1994: 142; cf.
Radcenko 1995). Sie greift ferner
einen Artikel von Weisgerber aus
den 40er Jahren auf und glaubt
daraus die ganze Konzeption der
Sprachgemeinschaft von Weisgerber
überhaupt gewonnen zu haben
(Boveland 1994: 147). Sie schreibt
Weisgerber einen absurden Gedanken
zu und kann dagegen sehr gemütlich
argumentieren, z.B.:
Sowie das Signifikat, das
Primat der „Natur einer
Volksgemeinschaft“ auf seine
Repräsentation angewiesen ist und
selbst ohne Anschauung bleibt,
erhält die Sprache und die
„arteigene Sprachlehre“ eine
„volkische“ (sic!) Bedeutung
(Boveland 1994: 147).
Weder ‚arteigene Sprachlehre‘, noch
‚völkisch‘ (also bevorzugt von den
NS-Sprachphilosophen gebrauchte
Termini) gehörten zum
Begriffsbestand von Leo Weisgerber.
Überdies erfindet die Kritikerin
Termini, die Weisgerber nie
gebraucht hat: Er sprach
bekanntlich von ‚volklichen‘, nicht
von ‚volkischen‘ Aspekten der
Sprachtheorie. Weisgerber stand
jeglicher rassebezogenen
Terminologie fern, was ein Artikel
von Menhardt aus dem Jahre 1943
direkt bestätigt: In den
Veröffentlchungen Weisgerbers sei
das Wort Rasse streng vermieden!
H. Ivo erachtet es für ausreichend,
Unterschiede zwischen Weisgerber
und W. von Humboldt (1767-1835)
anhand eines Aufsatzes von Weisgerber
aus dem Jahre 1930 aufzuzeigen (Ivo
1994: 196). Seine Unzufriedenheit
mit Weisgerbers Interpretation der
Humboldtischen Werke ergibt sich,
wenn man den Erörtetungen von H.
Ivo genau folgt, aus der Tatsache,
dass Ivos Interpretation doch die
richtige ist und die
Weisgerbersche davon gewaltig
abweicht.
3.Emotionell geladene, dennoch nicht
stichhaltige Argumentation. G. Simon
verurteilt den Zugriff Weisgerbers
auf den Gedanken des Organismus in
Bezug auf die Sprache und meint
sogar, wie so oft bei ihm vorkommt,
ohne jegliche Argumentation,
dass dieser Organismusgedanke
nach dem 1. Weltkrieg schon einmal
„wiederbelebt“ wurde und überhaupt
erst im Dritten Reich seine
Blütezeit erlebte und den damaligen
Machthabern ein willkommenes
Argument lieferte, in Nachbarländer
einzufallen (Simon 1982: 31).
Dieselbe Art des „Argimentierens“
demonstriert übrigens auch R.
Römer; wenn sie ethymologische
Recherchen J. Triers kritisiert und
dies mit folgendem Ausruf
bekräftigt:
Als Jost Trier seinen Artikel
in völliger und freiwilliger
Affirmation mit dem Kastengeist der
altindischen Arier und dem
Rassismus der Nationalsozialisten
schrieb, waren schon an die fünf
Millionen dieser Anaryah von den
Deutschen ermordet worden (Römer
1985, 67).
Diese Meinung, die eine recht
bizarre Verbindung zwischen einer
wissenschaftlichen Arbeit und einem
globalen Schuldgefühl für die
Verbrechen eines Staates herstellt,
verwundert nicht, wenn wir noch
eine andere Stelle aus R. Römer
zitieren, die eine interessante
‚Würdigung‘ von W. von Humboldt
selbst enthält:
Eine auf Unterschiede zwischen
den Völkern versessene Ideologie
hat Humboldt benutzt, zum Teil
umgedeutet, aber man kann nicht
sagen, dass sein Werk nichts von
dem enthalte, was man aus ihm
herausgelesen hat (sic!). Humboldt
ist ein Eröffner des Weges zur
rassenbezogenen Sprachendeutung,
auch wenn dies seinen Intentionen
zuwiderlief. Der Fall liegt ähnlich
wie bei Herder (Römer 1985: 138).
Anscheinend ist R. Römer die
Tatsache nicht bekannt, dass die
100. Wiederkehr von Humboldts Tod
im Nazideutschland offiziell
ignoriert wurde, weil Humboldt
wegen seiner ‚projüdischen
Äußerungen‘ in manchen Schriften
als besonders verdächtig galt. Zu
den rassistischen
Sprachwissenschaftlern zählt R.
Römer markanterweise auch K.
Vossler (1872-1949) und E. Lerch
(Römer 1985: 167, 179), was jedem
Kenner der einschlägigen
Veröffentlichungen absurd
erscheint.
4. Unterstellungen. R. Römer (1985:
163) schreibt, Weisgerber
übertreibe die
gemeinschaftsbildende Rolle der
Sprache, die immer als
Muttersprache oder Nationalsprache
gedacht ist, wobei der letztere
Begriff bei Weisgerber nirgendwo zu
finden ist und aus seinem Werk
nicht rekonstruierbar ist. G. Simon
schreibt Weisgerber das Verständnis
der Sprache als eines ‚manipulativ
wirkenden Machtapparats, der sich
nicht kontrollieren lässt, dem man
nur vertrauen kann‘ und beruft sich
auf folgende Stelle aus Weisgerbers
„Volkhaften Kräften der Deutschen
Sprache“:
Wir müssen uns der
Muttersprache blind anvertrauen,
wir können nicht auswählen, sondern
müssen sie als Ganzes übernehmen,
wir können ihre Richtigkeit nicht
nachprüfen, sondern müssen den
Willen haben, uns von ihr führen
und formen zu lassen (Weisgerber
1939: 66).
Das, was Simon als ein Beweis der
totalitären Ansichten Weisgerbers
vorschwebt, ist in der Tat die
grundsätzliche Überzeugung
Weisgerbers, dass Kinder nach ihrer
Geburt ihre Muttersprache nicht
wählen können, dass sie die
Begrifflichkeit dieser Sprache bei
ihrer Aneignung nicht hinterfragen
können. Z.B. nicht Fragen können,
ob der deutsche Begriff ‚Hand‘
richtiger ist, als der russische
‚ruka‘ und wer bei der
Versprachlichung der Welt folglich
Recht hatte. Dass Weisgerber diese
vorzügliche Abhängigkeit von der
Muttersprache, also von einer
geistigen Größe, in der Nazizeit,
vor dem Hintergrund des
Vorherrschens der Rassenideologie,
verteidigte, ist alles andere als
ein Zeugnis der totalitären
Gesinnung. Das kann man aber erst
dann begreifen, wenn die oben
erwähnten Faktoren der
Objektivierung wirklich in die
Analyse einbezogen werden. Statt
dessen vermitteln die Kritiker dem
Leser beiläufig falsche
Informationen als eine Art
Gegebenheit und suggerieren ihm die
von ihnen erwünschte Einstellung
zum Autor.
So spricht G. Simon (1982: 36) von
Weisgerbers ‚Engagement für das
damalige Regime‘, was die von mir
erwänhten Archivmaterialien aus
Rostock überzeugend widerlegen.
Dort geht es u.a. um einige
Situationen, die während der Arbeit
von Weisgerber in Rostock
entstanden sind: seinen Einsatz vor
Gericht für Pfarrer Leffers, der
wegen der ‚Beleidigung des Führers‘
verurteilt werden sollte, seine
Weigerung, die Kinder in eine
staatliche (d.h. NS-) Schule statt
der kirchlich betreuten, zu
schicken. Sehr eindeutig sind auch
Stellungnahmen zur Person
Weisgerbers im Zusammenhang mit
seiner Berufung nach Marburg (mit
dem Vermerk „Streng vertraulich“)
(s. Anhang).
5.Somit kann man noch ein sehr wählerisches
Heranziehen von Archivalien als einen
markanten Zug der Kritiker nennen. G.
Simon, der eine überaus
umfangreiche Archivalienrecherche
im Fall G. Schmidt-Rohr durchgefüht
hat, konnte sich im Fall Weisgerber
weniger kundig äußern. Auch
Weisgerbers Lehrer R. Thurneysen
wird von G. Simon einer
‚politischen, spezifisch
nationalistischen
Grundüberzeugungen‘ überführt.
Dabei weiß G.Simon offentlichtlich
nichts von den Gestapo-Vernehmungen
von Thurneysen wegen der Jours
fixes, die er für seine Schüler
veranstaltete und wo politisch
verdächtige Gespräche geführt
worden seien.
6.Ein besonderer Fall sind die von
Weisgerber in seinen Artikeln der 30-40er Jahre
angeführten Zitate aus den Dokumenten
des Reichsministeriums für
Volksaufklärung und sogar aus den
Reden des ‚Führers‘. Diejenigen,
die in einem totalitären Regime
aufgewachsen sind, wird es nicht
Wunder nehmen, dass ein
Wissenschaftler am Anfang oder am
Ende eines Beitrags Worte des
Diktators anführt, denn das waren
ganz übliche und vorgeschriebene
Praktiken, die eine
Veröffentlichung überhaupt
ermöglichten. Dies ist auch mit
Weisgerber der Fall, und m.E.
keinesfalls der Beweis dafür, dass
Weisgerber den
nationalsozialistischen Diskurs
durch solche Zitate unterstütze und
sogar die nationalsozialistische
Volksauffassung mit seinen Werken
vorbereitete, wie G. Boveland
(1994: 150) in ihrem
Anklageschreiben behauptet.
7.Das „bretonische Thema“. Im zweiten
Weltkrieg wurde Weisgerber
eingezogen und musste in der
Bretagne als Sonderführer und
Beauftragter für die bretonische
Minderheit arbeiten, u.a. einen
bretonischen Sender betreuen und
die Prinzipien der neuen Schreibung
für das Bretonische entwickeln.
Natürlich konnte man bei einem
solchen Einsatz keinen
Unparteiischen spielen und
womöglich direkte Befehle
ignorieren, die die Unterstützung
einer sprachlichen Minderheit als
einen Teil des ‚geistigen Kampfes‘
gegen das ‚Franzosentum‘
beinhalteten. Der von G. Simon sehr
beinflusste US-Forscher Chr. M.
Hutton hat in diesem Zusammenhang
sogar den Rang Weisgerbers in der
Bretagne (Sonderführer)
ausdrücklich ins Gespräch gebracht,
um sein besonderes Engagement für
die Nazis zu untermauern (Hutton
1999), obwohl dieser Rang mit der
SS-Struktur überhaupt nichts
Gemeinsames hat. Jedem Forscher,
der sich mit der NS-Zeit
beschäftigt, sind die vielen
‚Führer‘- und ‚Führerinnen‘titel
bekannt, die in jedem Bereich des
Lebens, Feuerwehr und Arbeitsfront
inklusive, damals existierten.
Solche ‚Argumente‘ zeugen noch von
einem Problem der Kritiker:
8.Ignorieren der externen Rahmenbedingungen
der sprachwissenschaftlichen Tätigkeit unter
den Nazis, anders gesagt, Kritik unter
dem Motto „Wir hätten uns damals
nicht so verhalten“. Nur so kann
man den Vorwurf von R. Römer
verstehen, in seinen Schriften der
Nazizeit weise Weisgerber nicht
nachdrücklich den rassistischen
Faktor zurück (Römer 1985: 163).
Die Situation in Deutschland wird
von ihr und weiteren Kritikern zu
geradelinig aufgefasst, so dass man
selbst U. Maas Recht geben muss,
wenn er zur Abstempelung von W.
Wüst, der bekanntlich Leiter des
„Ahnenerbes“ war, Folgendes
schreibt:
Wenn Römer gegen den Rassismus
den Strukturalismus in der
Nachfolge de Saussures als
hygienische Massnahme empfiehlt...,
so ist daran zu erinnern, dass es
nicht zuletzt auch Wüst zu
verdanken ist, dass de Saussure in
Deutschland rezipiert wurde, etwa
im Verlag Winter eine Sammlung
seiner Werke erschien, ... dass
Wüst im „Ahnenerbe“ und auch auf
den verschiedensten Kanälen der
Wissenschaftspolitik gegen
dilettantische Rassisten anging,
dass der Indologe Wüst dafür
sorgte, dass die Forschung zu den
arischen Zigeunersprachen
weiterging (Maas 1986: 324).
Mit anderen Worten, ‚die Kollision
bei der Reproduktion des
faschistischen Herrschaftssystems
und bei dem rassistischen Diskurs
verläuft komplexer‘, und ‚ohne die
Rekonstruktion der
Binnenperspektive der Akteure ist
hier sicherlich kein Weiterkommen‘
(Maas 1986: 324). Dies gilt in noch
größerem Maße für die
Wissenschaftler, die unter der
Naziherrschaft gelebt und
gearbeitet haben, ohne sich in
dieses System integrieren zu
wollen. Es ist daher einfach nicht
zu verstehen, wie eine moderne
Sprachhistorikerin, die die
Tätigkeit der deutschen
Wissenschaftler im Dritten Reich
unter die ruhige Lupe nimmt, in
Bezug auf diese eine solche Frage
aufwirft:
Drohten alle diese Übel
wirklich jenen Männern? War ein
Universitätsprofessor, war ein
Assistent ernstlich bedroht, wenn
er sich auf das hethitische Passiv,
auf Nürnberger Ratsurkunden, auf
die Namen der Libelle warf und die
NS Zeit zu überbrücken suchte, von
der doch nach kurzer Zeit abzusehen
war, wie sie enden würde? (Römer
1985: 180).
Wenn solche Fragen bei einer
ebensolchen Forscherin immer noch
auftauchen, dann ist die von
solchen Forschern betriebene
Historiographie der Linguistik von
einem mehr oder weniger objektiven
Bild von der NZ-Zeit meilenweit
entfernt.
9.Herausbildung von Quasi-“Traditionen” in der
Beurteilung der Tätigkeit von
Sprachwissenschaftlern im Dritten Reich. So
beruft sich U. Maas bei seinen
Anschuldugungen gegenüber
Weisgerber auf die Recherchen von
G. Simon. (Maas 1988: 278). G.
Simons Sichtweise wird indirekt
auch im neuen Buch von W. Hutton
“Linguistics and the 3rd Reich” in
den USA weiterverbreitet usw. Es
ist schon bezeichnend, dass neun
Jahre nach dem Tod Leo Weisgerbers
wieder eine kritische Monographie
erschien, die einen Schatten auf
seine Verdienste in der Didaktik,
Germanistik, Sprachphilosophie und
vielen anderen Bereichen werfen
wollte (Ivo 1994). Dies ist ein
Zeichen dafür, dass Weisgerbers
Ideen und Forschungsverfahren in
der Sprachwissenschaft und
Sprachdidaktik Deutschlands immer
noch wirksam sind.
Vielleicht ist es doch an der Zeit,
unvereingenommene Forscherinnen und
Forscher zur Lösung dieses Problems
heranzuziehen, damit die ‚gefärbten
Brillen‘ der einhemischen
Vergangenheitsbewältiger die
Positionen der deutschen
Sprachwissenschaft zu solchen
Fragen nicht weiter allein
bestimmen. Die Wiederherstellung
des guten Rufes von Johann Leo
Weisgerber ist in Russland perfekt.
Ich schließe diesen Beitrag mit der
Hoffnung, dass wir in diesem
Rehabilitationsprozess nicht allein
bleiben.
Anhang
Materialien aus der Personalakte Johann Leo
Weisgerber (Universitätsarchiv Rostock, RVIII
D200).
Seite 63:
Der Rektor der Georg-August-
Universität. Fernsprecher Nr. 3941
u. 4325
Göttingen, den 7. Januar 1936
An Seine Magnifizenz den Herrn
Rektor der Universität Professor
Dr. Schulze
Rostock
Sehr verehrter Herr Kollege!
Wir haben im Laufe des
nächsten Jahres eine Professur für
indogermanische und allgemeine
Sprachwissenschaft zu besetzen. In
diesem Zusammenhang wird auch
Professor Leo Weisgerber genannt.
Ich bitte Sie, mir ein Urteil
abzugeben, wie Sie Professor
Weisgerber nach seiner persönlichen
Haltung und nach seiner
Lehrtätigkeit einschätzen. Ich
bitte zugleich mir möglichst auch
ein Urteil der Dozentenschaft und
Studentenschaft zu vermitteln. Ich
wäre Ihnen sehr dankbar, wenn ich
Ihr Gutachten schon in den nächsten
Tagen haben könnte.
Mit den besten Wünschen und Heil
Hitler!
Unterschrift: Freimann
Seite 64:
Die Dozentenschaft der Universität
Rostock
Br.I/406.
Rostock, den 9.1.1936.
Maßmannstr. 35.
An S. Magnifizenz den Herrn Rektor
der Universität Rostock
Betr.: Gutachten Prof. Weisgerber,
Philosophische Fakultät
Prof. Weisgerber ist ein
kritischer, wissenschaftlicher
Arbeiter. Seine wissenschaftliche
Tätigkeit hat allgemein Anerkennung
gefunden. Seine Forschungen düften
für die Jetztzeit von besonderer
Bedeutung sein. Sein Kolleg
versteht er interessant zu
gestalten, sein Vortrag ist gut.
Prof. Weisgerber ist an allen
Fragen der Hochschule
außerordentlich interessiert und
hat sich immer wieder bemüht auch
über sein Fach hinaus sich für die
Hochschule einzusetzen.
Bei seiner charakterlichen und
politischen Beurteilung ist zu
berücksichtigen, dass Prof.
Weisgerber als Mensch des
katholischen Glaubens fest mit
seiner Kirche verwurzelt ist. Trotz
seines gezeigten Einsatzwillens für
den heitigen Staat wird es meiner
Ansicht nach ihm nie ganz möglich
sein, auf Grund seiner
weltanschaulichen Bindung ein
wirklicher Nationalsozialist und
vor allen Dingen aber ein aktiver
Kämpfer für den Nationalsozialismus
zu werden. Trotzdem glaube ich,
dass Prof. Weisgerber, in einer
geeigneten Umgebung eingesetzt,
stets Positives für die Hochschule
leisten wird.
Heil Hitler!
Leiter der Dozentenschaft
Seiten 65-66:
Studentenschaft der Universität
Rostock.
Amt: Studentenschaftsführer
Rostock, am 10. Jan. 1936
Schwaansche Str. 2
Streng vertraulich!
Betr.: Beurteilung über Prof.
Weisgerber, Rostock
Prof. Dr. Weisgerber kann
keinesfalls als politisch
zuverlässig gelten. Er ist
katholisch und allem Anschein nach
ein Beauftragter der katholischen
Aktion. Bekannt ist die Rolle, die
er im April 1935 im Leffers-Prozess
gespielt hat, wo er – nach der
Meinung der Studendenschaft:
unbefugt – als belastender
Leumundszeuge gegen cand. phil.
Schinke auftrat, der
Hauptbelastungszeuge gegen Leffers
war.
Nach der Verurteilung Leffers
setzte er sich nach unserer
Kenntnis weiterhin für Leffers ein
und fungierte als Betreuer der nun
„verwaisten“ katholischen Gemeinde
Rostocks.
Wie ich von Herrn Prof. Bacher
erfuhr, drängt Weisgerber im
Reichs- und Preussischen
Ministerium für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung immer
wieder auf seine Versetzung an die
Universität Bonn, anscheinend
deshalb, weil er sich hier in
Rostock kaltgestellt fühlt und
seine Tätigkeit in einer
erzkatholischen Gegend fortzusetzen
wünscht.
Im persönlichen Verkehr
verhällt (sic!) sich Professor Dr.
Weisgerber stets sehr zurückhaltend
und undurchsichtig. Zweifellos
steht er aber der
nationalsozialistischen Bewegung
und ihrer Weltanschauung völlig
wesensfremd und gegnerisch
gegenüber.
Führer der Studentenschaft der
Universität Rostock
Seite 67
13. Januar 1936
Betr.: Gutachten Prof. Weisgerber
Dem Gutachten des Leiters der
Dozentenschaft kann ich mich
durchaus anschließen.
Ich kenne Prof. Weisgerber
seit Jahren; immer wieder habe ich
mich gefreut über die hohe
Auffassung, die er von den
Pflichten eines Forschers und
Universitätslehrers besonders
seinem Volke gegenüber hat. Er hat
sich auch als Dekan unter meinem
zweiten Rektorat im Jahre 1934 sehr
bewährt. Ich halte ihn für einen
zuverlässigen und ehrlichen
Menschen. Ich habe auch offen seine
Stellung zum Katholizismus mit ihm
besprochen; er hat mir immer wieder
glaubhaft versichert, dass er sich
niemals im Sinne des politischen
Katholizismus betätigt hat. In
Parteikreisen und bei der Führung
der Studentenschaft hat es viel
böses Blut gemacht, dass er in dem
Prozess gegen den Praelaten Leffers
wegen Beleidigung des Führers
günstig für Leffers ausgesagt hat.
(Der Praelat hat seine schwerkranke
Schwiegermutter längere Zeit
betreut). Weisgerber war aber
nicht; wie man zunächst als
selbstverständlich annahm, von der
Verteidigung, sondern vom Gericht
als Leumundzeuge geladen worden. Er
leidet schwer unter dem Misstrauen,
das ihm als Katholiken
entgegengebracht wird. An eine
Universität in einer nicht
erzkatholischen Gegend kann ich ihn
durchaus empfehlen und ich bin
überzeugt, dass W. eine sehr
wertvolle Bereicherung Ihres
Lehrkörpers darstellen würde.
Der Rektor
Literatur
1. Albrecht, Erhard. 1991.
Sprachphilosophie. Berlin: Deutscher
Verlag der Wissenschaften.
2. Alpatov Viktor M. 1991. Istorija
odnogo mifa: Marr i marrism. Moskva:
Nauka.
3. Boveland, Gudrun & Strassheim,
Isabel. 1994.
„Sprachgemeinschaft und
Volksgemeinschaft. Ein
ideologisch motiviertes und
mythisch strukturiertes
Verhältnis im Denken Leo
Weisgerbers“. Ivo 1994. 139-
155.
4. Hutton Chr. M. 1999. Linguistics and
the Third Reich. Mother-Tongue Fascism,
Race and the Science of Language.
London, New York: Routledge.
5. Ivo, Hubert, ed. 1994. Leo
Weisgerber: Engagement und Reflexion.
Kritik einer didaktisch orientierten
Sprachwissenschaft. Frankfurt,
Berlin, Bern, NY, Paris, Wien:
Peter Lang.
6. Ivo, Hubert. 1994. „Leo
Weisgerbers Sprachdenken: Kein
Denken im Geist oder Buchstaben
Humboldts“. Ivo 1994. 195-270.
7. Ivo, Hubert. 1990. „Volkssprache
und Sprachnation“. Diskussion
Deutsch 14. 343-368.
8. Maas, Utz. 1988a. „Die
Entwicklung der
deutschsprachigen
Sprachwissenschaft von 1900 bis
1950. Zwischen
Professionalisierung und
Politisierung“. Zeitschrift für
Germanistische Linguistik 16. 253-290.
9. Maas, Utz. 1986. „Rezension z.
Römer R. Sprachwissenschaft und
Rassenideologie in Deutschland“.
Wirkendes Wort 4. 321-325.
10. Maas, Utz. 1988b.
„Sprachwissenschaft und
Nationalsozialismus“. Semiotische
Berichte 12. 249-269.
11. Personalakte Johann Leo
Weisgerber. Universitätsarchiv
Rostock, RVIII, D200 (1926-1937)
12. Römer, Ruth. 1985.
Sprachwissenschaft und Rassenideologie in
Deutschland. München: Fink.
13. Radcenko Oleg A. 1995. „Das
Aufkommen der neuhumboldtischen
Sprachsoziologie um die
Jahrhundertwende (Idee der
Sprachgemeinschaft)“. History and
Rationality ed. By Klaus D. Dutz,
K.A. Forsgren. Münster: Nodus.
237-262.
14. Radcenko, Oleg A. 1997. Jazyk
kak mirosozidanie. Lingvofilosofskaja
koncepcija neogumbol‘dtianstva. Moskva:
Metatekst. Vol.1-2.
15. Radcenko Oleg A. 1993.
„Weisgerberiana sovetica (1957-
1990). Versuch einer Metakritik
des Neuhumboldtianismus bzw. der
Sprachinhaltsforschung“. Beiträge
zur Geschichte der Sprachwissenschaft 2.
16. Sciarini-Guryanova Natalia.
2001. „Rev. of Radchenko O.A.
Language and Creation of World.
Linguistic Philosophy of
Neohumboldtianism“. Henry Sweet
Society Bulletin 36. 37-40.
17. Simon, Gerd. 1984. „Die
Sprachsoziologische Abteilung
der SS“. Sprachtheorie, Pragmatik,
Interdisziplinäres. Akten des 19.
Linguistischen Kolloquiums in Vechta, 1984.
Tübingen: Kürschner, Tübingen,
Bd. 2. 375-396.
18. Simon, Gerd. 1985.
„Sprachwissenschaft im 3. Reich.
Ein erster Überblick“. Politische
Sprachwissenschaft ed. By V. F.
Januscher. Opladen. 97-141.
19. Simon, Gerd. 1982. „Zündschnur
zum Sprengstoff. Leo Weisgerbers
keltologische Forschungen und
seine Tätigkeit als
Zensuroffizier in Rennes während
des 2. Weltkriegs“. Linguistische
Berichte 79. 30-52.
20. Weisgerber Johann Leo. 1939.
„Die volkhaften Kräfte der
deutschen Sprache“. Beiträge zum
neuen Deutschunterricht. Ed. By A.
Huhnhäuser, Pudelko, Jacoby.
Frankfurt am Main: Diesterweg.
21-100.





































































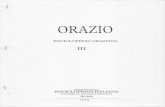



![Zur Gewaltdebatte in der klassischen und modernen Koranexegese [in Das Gewaltpotenzial der Religionen. Stuttgart: Kohlhammer, 2015, S. 57-74]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63319fa2b6829c19b80b952e/zur-gewaltdebatte-in-der-klassischen-und-modernen-koranexegese-in-das-gewaltpotenzial.jpg)