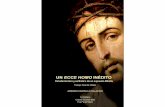geometry, vibrational, nbo, mep and homo-lumo analysis of ...
Differenzierte Interessenslandschaften. Homo oeconomicus und die Anfänge der modernen Stadtplanung
Transcript of Differenzierte Interessenslandschaften. Homo oeconomicus und die Anfänge der modernen Stadtplanung
Städte waren immer in irgendeiner Form sozial und baulich differenziert. Architek-turen, Straßen und Plätze erzählen von sozialen Ordnungen und setzen sie in Bilder und Handlungsanweisungen um. Sie tun dies jedoch in historisch unterschiedlicher Weise. Mit Beginn der modernen Planung Ende des 19. Jahrhunderts entsteht ein neues Modell von Stadt, das das Verhältnis von städtischem Raum, Individuen und sozialer Ordnung neu justiert. Es ist nun nicht mehr eine stabile ständische Ordnung, die in Architektur und Stadtgrundriss einen ästhetischen Ausdruck findet – die Stadt und ihre Sozialtopografie wird dynamischer, sie begleitet den sozialen Auf- und Abstieg ihrer Bewohner und Bewohnerinnen und wird, so könnte man thesenhaft formulieren, zu einem räumlichen Dispositiv, das Individuen analysiert, bewertet und effizient zu organisieren versucht.
Die moderne Stadtplanung, die sich gerade erst als Disziplin erfindet, denkt die Stadt als differenzierte Interessenslandschaft. Wesentliche Voraussetzungen dieser Vorstellung sind die um 1800 beginnende Liberalisierung der Arbeits- und Eigentumsverhältnisse so-wie die technische Mobilisierung, die Prozesse der De- und Reterritorialisierung in einem zuvor unbekannten Maßstab in Gang setzen. Sie führen ab Mitte des 19. Jahrhunderts zum raschen Wachstum der Städte und gleichzeitig zu deren innerer Differenzierung. Diese soziale und funktionale Differenzierung des städtischen Raumes folgt nicht einfach zwangsläufig der sozialen und ökonomischen Entwicklung. Sie wird bewusst gestaltet und die Stadtplanung trägt ihren Teil dazu bei. In Reinhard Baumeisters Handbuch von 1876, das zu den ersten Grundlagenwerken der modernen Stadtplanung zählt,1 setzt sich gleich das eröffnende Kapitel mit der „Gruppirung verschiedenartiger Stadttheile“� auseinander. „Ein umfassender Plan allein“, so Baumeister, „ermöglicht nun auch, die Woh-nungsbedürfnisse aller Schichten der Bevölkerung in das richtige Verhältnis zu bringen, Gruppen zu bilden, welche sich einzeln ausbauen können, ohne sich gegenseitig zu stören. Neue Stadttheile werden nicht für lauter neue Einwanderer hergestellt, sondern auch von
1 Vgl. Gerd Albers, Zur Entwicklung der Stadtplanung in Europa. Begegnungen, Einflüsse, Verflechtungen, Braunschweig/Wiesbaden 1997.
� Reinhard Baumeister, Stadt-Erweiterungen in technischer, baupolizeilicher und wirthschaftlicher Beziehung, Berlin 1876, S. 91.
Christa Kamleithner
Differenzierte Interessenslandschaften
Homo oeconomicus und die Anfänge der modernen Stadtplanung
�54 Christa Kamleithner
den Bewohnern der älteren Stadttheile aufgesucht. Dieses Verschieben der Bevölkerung findet naturgemäß so Statt, daß Leute, welche durch ihren Beruf nicht an eine bestimmte Gegend (…) gebunden sind, Platz machen für solche, welche eben hier die Bedingungen ihres wirthschaftlichen Fortkommens finden. Letztere zahlen mehr, erstern wollen nicht mehr, und wechseln demnach die Wohnung. Bei diesem Vorgang frägt sich nun, für welche Klassen der Bevölkerung neue Stadttheile zu projectiren sind?“� Baumeister hat die in der modernen Großstadt stattfindenden Verdrängungsprozesse klar im Blick. Sie stellen für ihn nichts dar, gegen das anzukämpfen wäre, im Gegenteil scheinen sie zu einer ‚natürlichen‘ städtischen Ordnung zu führen. Diese ‚Natur‘ wird als beobachtbar verstanden und soll als Grundlage der Stadtplanung dienen. Dennoch ist diese ‚Natur‘ nicht einfach da – ihr muss erst gegen die Künstlichkeit eines veralteten Städtebaus zum Durchbruch verholfen werden. Diese neue Vorstellung von Stadt und Planung, die auch mit einem neuen Menschenbild verbunden ist, soll im Folgenden skizziert werden. Nachdem die deutsche Städtebaudiskussion maßgeblich an der Gründung der Disziplin mitgewirkt hat,4 sind es Texte deutscher Autoren, die dafür herangezogen werden. Das Interessante dieser frühen Texte ist ihre Nähe zu heutigen Diskussionen – dieser wird am Schluss, in aller Kürze, nachgegangen. Zu Beginn sollen aber einige wissenschaftliche und politische Voraussetzungen des modernen Planungswissens umrissen werden.
Die Natur der Interessen – Interessen als Regierungstechnik
Das Neue der sich als Disziplin herausbildenden Stadtplanung ist ihr wissenschaftliches Selbstverständnis. Der bereits erwähnte Städtebauexperte Baumeister etwa fordert dazu auf, städtebauliche Entwürfe auf „sorgfältige Beobachtungen“ zu stützen und ihnen eine „rechnungsmäßige Grundlage“ zu verschaffen. Planung wird von ihm als Antwort auf bestehende Marktverhältnisse verstanden – daher seien Statistiken über die Zusammensetzung der städtischen Bevölkerung, das Wohnungsangebot und die Verkehrsflüsse eine notwendige Voraussetzung.5 Seine zentralen Referenzen sind Schriften von Statistikern und Volkswirten, und damit von Vertretern sich etablierender Wissenschaften, die den Anspruch erheben, objektive Aussagen über die soziale Wirk-lichkeit zu machen. Diese wird von der modernen Planung als eigenständige Sphäre angesehen, die erforscht und in ihrer Eigendynamik beachtet werden soll. Darin liegt eine neue Liberalität: Baumeister und die Literatur, auf die er sich bezieht,6 machen deutlich, dass wissenschaftliche Planung bedeutet, nicht zu viel und nicht zu wenig zu
� Baumeister (wie Anm. �), S. 79.4 Vgl. Anthony Sutcliffe, Towards the Planned City. Germany, Britain, the United States and France 1780–1914,
Oxford 1981.5 Baumeister (wie Anm. �), S. 49–54ff.6 Wie: Julius Faucher, Die Bewegung für Wohnungsreform, in: Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturge-
schichte 4, 1865, S. 1�7–199; Emil Sax, Der Neubau Wien’s im Zusammenhang mit der Donau-Regulierung, Wien 1869; Ernst Bruch, Berlin’s bauliche Zukunft und der Bebauungsplan, Berlin 1870, sowie Ernst Engel und Hermann Schwabe mit ihren Beiträgen im statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin.
Differenzierte Interessenslandschaften �55
planen. Stadtplanung soll nicht mehr obrigkeitlich verordnet werden, sondern der freie Markt, der die bestehenden Interessen am besten kennt, soll ordnend wirksam werden. Nichtsdestoweniger bedarf es einer Planung, die diesen Markt zu organisieren weiß – denn der Bodenmarkt ist aufgrund der beschränkten Mobilität der Bewohnerschaft alles andere als ein idealer Markt.7
Diese Auffassung von Stadtplanung kann in ein modernes Regierungsdenken eingeordnet werden, das seinen Beginn im 17. Jahrhundert hat und ab 1800 zur Umsetzung gelangt: ein Regierungsdenken, das die Gesellschaft als eigenständigen Wirkungszusammenhang entdeckt, den jedes politische Handeln berücksichtigen muss. Gleichzeitig zeichnet sich die Entstehung eines neuartigen Wissens ab: Die aus der Moral- und Rechtsphilosophie hervorgehenden und sich davon absetzenden Sozialwissenschaften, zu deren wichtigsten Gründungsvätern Adam Smith zu zählen ist,8 versuchen, den Menschen zu entdecken, „wie er wirklich ist“.9 Diese Wirklichkeit entdecken sie in seinen Leidenschaften und Interessen, die als erforschbare Größen begriffen werden. Aber nicht nur das Wissen darüber, sondern auch das Objekt ist neu: Es geht um die neue Wirklichkeit der civil oder commercial society, einer sich sozial und ökonomisch vernetzenden Gesellschaft, die in umso größere Abhängigkeitsverhältnisse tritt, je beweglicher sie wird. Daraus resultiert auch ein neues Menschenbild: Im Gegen-satz zu einem unabhängigen aristokratischen Verhalten sind die Ziele des modernen Menschen übersichtlich. Ihre Beständigkeit macht die Interessen der wissenschaftlichen Beschreibung zugänglich und dieses Wissen für jede Regierung interessant.10 Michel Foucault beschreibt diesen neuen Typus des homo oeconomicus als „Mensch(en), der seinem Interesse gehorcht“ und sein „Interesse“ als eines, das „spontan mit dem Inter-esse der anderen (...) konvergiert“.11 Seinem Interesse zu folgen heißt nicht, spontanen Neigungen nachzugeben, sondern seine Möglichkeiten zu kennen und sich kalkulierend in den gesellschaftlichen Zusammenhang einzureihen, dies jedoch, einem „desire of bettering our condition“ folgend, mit Blick in eine bessere Zukunft. In diesem Begehren sieht Smith eine Natur des Menschen – man kann darin aber vielmehr einen spezifisch modernen Zug entdecken sowie ein disziplinierendes Moment dieses Interesses, das den homo oeconomicus zum geeigneten Gegenüber einer liberalen Regierung macht.
Der Liberalismus, dessen Programm gerne auf ein schlichtes Laissez-faire reduziert wird, ist nicht in Opposition zu jeder Art von Regierung zu sehen, er reformuliert lediglich
7 Diese Betonung des liberalen Charakters der sich anbahnenden modernen Planung modifiziert die übliche Ge-schichtsschreibung. 1870 gilt gemeinhin als jener Einschnitt, in dem ein ungezügeltes Laissez-faire durch neue Sozialgesetzgebungen eingedämmt wird. Die Lektüre der Schriften zur Wohn- und Städtereform zeigt aber, dass es viele Kontinuitäten gibt � so sind etwa die Argumente Engels, der dem Verein für Socialpolitik angehört, von denen des Freihändlers Fauchers nicht weit entfernt.
8 Hans Medick, Naturzustand und Naturgeschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Die Ursprünge der bürgerlichen Sozialtheorie als Geschichtsphilosophie und Sozialwissenschaft bei Samuel Pufendorf, John Locke und Adam Smith, Göttingen 197�, S. 144f.
9 Albert O. Hirschman, Leidenschaften und Interessen. Politische Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg, Frankfurt a. M. 1980, S. �0ff.
10 Hirschman (wie Anm. 9), S. 111f., 57ff.11 Michel Foucault, Geschichte der Gouvernementalität II: Die Geburt der Biopolitik. Vorlesungen am Collège
de France 1978–1979, hg. von Michel Senellart. Frankfurt a. M. �004, �71f.
�56 Christa Kamleithner
Regierungsvorstellungen und -techniken.1� So lässt sich zeigen, dass es zu Beginn des 19. Jahrhunderts einer Vielzahl an Eingriffen bedurfte, um eine liberale Gesellschaft herzustellen und diese – wie das Problem des Pauperismus sichtbar werden ließ – zu stabilisieren. Für den preußischen Raum wäre hier etwa an jene Reformen zu denken, die Freizügigkeit und Gewerbefreiheit per Verordnung durchsetzten und damit gezielt die alte Ständegesellschaft in eine moderne Leistungsgesellschaft transformierten. Die Vorstellung von mobilen, ihren Interessen folgenden Individuen ist keinesfalls eine natürliche, wie es die Schriften Smiths suggerieren. Dies zeigt sich in einer eigen-tümlichen Doppelung seines Gesellschaftsbildes, das, wie Mary Poovey bemerkt hat, sowohl auf empirischen Beobachtungen wie auf einer theoretisch abgeleiteten Natur des Menschen basiert. Es erhebt einerseits den Anspruch einer Beschreibung der so-zialen Wirklichkeit, andererseits muss dem „System der natürlichen Freiheit“ erst zum Durchbruch verholfen werden.1� Wenn aus an alten Gewohnheiten haftenden Bauern und Stadtbewohnern ‚industriöse‘, also fleißige und nach Verbesserung strebende Indi-viduen werden sollen, dann bedarf es der Anreize und disziplinären Maßnahmen.14 Die neue Ordnung der sich frei verwirklichenden Interessen muss erst hergestellt werden. Freier Markt und Wettbewerb sind, wie Foucault festgestellt hat, „ein geschichtliches Ziel der Regierungskunst und keine Naturgegebenheit“.15
Die Stadt als differenzierte Interessenslandschaft
Die Vorstellung einer liberalen Regierung lässt sich in den planungstheoretischen Schriften um 1870 und auch danach noch entdecken.16 Auch wenn diese – in verschie-denem Ausmaß – für staatliche oder kommunale Eingriffe plädieren und Auswüchsen des spekulativen Wohnungsmarktes entgegenwirken wollen, sehen die Planer und Volkswirte dieser Zeit in der Spekulation „eine unentbehrliche sozial-ökonomische Ordnungskraft“17. Der Markt ist, wie Foucault dies formuliert hat, zu einem unhinter-gehbaren „Ort der Wahrheitsbildung“18 geworden. Er scheint besser als die Planer über die beste Verteilung der Güter – und das heißt hier der Gebäude und Nutzungen – Bescheid zu wissen, und daher muss sich die Planung über die Marktverhältnisse informieren. Es ist genau das Fehlen dieses Wissens, das James Hobrecht und seinem Erweiterungsplan für Berlin von 186� vorgeworfen wird: jener Plan, der angeblich
1� vgl. z. B. Matthias Bohlender, Herrschen, Regieren, Regulieren. Zur liberalen politischen Rationalität von Adam Smith, in: Richard Faber (Hg.), Liberalismus in Geschichte und Gegenwart, Würzburg �000.
1� Mary Poovey, A History of the Modern Fact. Problems of Knowledge in the Sciences of Wealth and Society, Chica-go/London 1998, S. �4�ff.
14 Vgl. Matthias Bohlender, Metamorphosen des liberalen Regierungsdenkens. Politische Ökonomie, Polizei und Pau-perismus, Weilerswist �007.
15 Foucault (wie Anm. 11), S. 17�f.16 Vgl. Anm. 7.17 Adolf Weber, Über Bodenrente und Bodenspekulation in der modernen Stadt, Leipzig 1904, S. 17�, den Volkswirt
Albert Schäffle mit einer Schrift von 1867 zitierend.18 Foucault (wie Anm. 11), S. 5�
Differenzierte Interessenslandschaften �57
die dichte Mietskasernenverbauung Berlins und ihre Wohnungsmisere verursacht hat und der zu einem der Hauptangriffspunkte der modernen Planung wurde. An ihm konnten sich die neuen Ideen profilieren.19 Hobrecht plant, vom Gesichtspunkt einer statistisch und ökonomisch informierten Planung aus, zu viel wie zu wenig. Er definiert ein klar begrenztes Erweiterungsgebiet und legt ein flächendeckendes Straßenraster an; Bauhöhen und Dichten werden jedoch kaum reguliert. Der Hobrechtplan ist ein reiner Straßenfluchtlinienplan: zwischen verschiedenen Nutzungen wird nicht un-terschieden, allen Bodeneigentümern sollen die gleichen Rechte zukommen. Seine Kritiker werfen ihm vor, dass er weder die sich differenzierende Nutzungsstruktur berücksichtige noch mit dem Bodenmarkt richtig umzugehen wisse. Seine weit in die Zukunft greifende Planung fördere die Bodenspekulation; die kompakte Planung führe zu einem Bodenmonopol und treibe mit den Grundstückspreisen die Bebauung in die Höhe. Entgegengesetzt wird ihm zum einen das Wissen des Statistischen Bureaus in Berlin, dessen Mitarbeiter Ernst Bruch als erster Kritiker des Hobrechtplans auftritt. Als Kenner der Verkehrs- und Bevölkerungsentwicklung bemerkt er, dass sich trotz der
19 Verdichtet hat sich dieser Topos in Werner Hegemanns Historiografie der noch jungen Disziplin. Er beruft sich dabei auf Julius Faucher, Ernst Bruch und Emil Sax, die auch für Baumeister die wichtigsten Bezugspunkte waren – vgl. Werner Hegemann, Der Städtebau, 1. Teil, Berlin 1911.
Abb. 1 Bebauungs-Plan Berlin mit nächster Umgebung, James Hobrecht, 186�
�58 Christa Kamleithner
homogenen Bebauung eine städtische Arbeitsteilung einstellt, die ihm zufolge aber keinen adäquaten baulichen Ausdruck findet.�0 Die Berliner Statistiken zeigen aber insbesondere eine Fehlentwicklung: Viele Häuser weisen höchste Belegungsziffern auf. Insofern wird der Berliner Planung zum anderen die Kenntnis anderer Städte, insbesondere Londons, gegenübergestellt, dessen Stadtentwicklung von Volkswirten wie Julius Faucher und Emil Sax als ‚natürlich‘ angesehen wird, da sie ökonomischen Idealmodellen weitgehend entspricht.�1
Als ‚natürliche‘ Form der Stadt erscheint der modernen Planung die ,flache Kegel-form‘��, mit hohen Preisen und Bebauungen im Zentrum und weitläufiger niedriger Bebauung in den Außenzonen. Dieses Modell geht auf das Grundrentenmodell von Thünen zurück, das dieser 18�6 in Bezug auf eine landwirtschaftliche Nutzung des Bodens entwickelt hat.�� Dieses mag auf Beobachtungen fußen, vor allem aber ist es ein abstraktes Modell, das zu einer ökonomisch effizienten Bodennutzung anweisen soll. Eine solche ist in Berlin noch nicht zu finden, wohl aber im fortschrittlichen Lon-don, das sich bereits früh funktional und sozial differenziert hat. Für Baumeister, der Fauchers Berichte über London kennt, ist London ein Leitbild, er sieht in der ,Sonderung‘ städtischer Nutzungen eine unausweichliche Tendenz, auf die ,jede große Zukunftstadt von vorn herein (…) einzurichten‘ sei. Entsprechend sieht er wie auch Bruch für künftige Plangestaltungen folgende Differenzierungen vor: Gebiete für die Industrie an den Rändern der Stadt, wo billige Grundstücke zur Verfügung stehen, eine Geschäftsstadt gebündelt im Zentrum und Wohnquartiere, die die sozialen Gruppen nicht völlig tren-nen, aber den ,Bedürfnissen‘ Rechnung tragen sollen, d. h. Arbeiterbezirke in der Nähe der Industrien, Wohnungen für Handwerker und Geschäftsleute in der inneren Stadt und Villenbezirke in landschaftlich begünstigten Gegenden.�4 Diese in London bereits zu beobachtende Differenzierung beruht auf Voraussetzungen, die in Berlin noch nicht gegeben sind. Die Londoner Bevölkerung ist ausgesprochen mobil. Sozialer Aufstieg wird von einem Umzug in jeweils bessere Wohnquartiere am Rand der Stadt beglei-tet. Die städtische Struktur hat sich weiträumig entfaltet und das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsplatz ist zur täglichen Notwendigkeit geworden. Das innerstädtische Verkehrsnetz ist dementsprechend auch wie kaum eines sonst in Europa ausgebaut. Das nicht durch einen Plan begrenzte Bauen vor der Stadt steigert, so Faucher, das Angebot und hält die Bodenpreise niedrig. Dadurch bleibe die Wohnform des Hauses für eine Familie auch in der Großstadt erhalten � und dies erscheint aus Sicht der deut-schen Städtebaudiskussion als großer Vorteil. Ganz selbstverständlich scheint dieser Vorteil allerdings nicht zu sein, und so kritisiert Faucher den Berliner ,Schlendrian‘, Traditionsgebundenheit und Unbeweglichkeit, die erst gebrochen werden müssen,
�0 Bruch (wie Anm. 6), S. �, 15.�1 Faucher (wie Anm. 6); Sax (wie Anm. 6).�� Bruch (wie Anm. 6), S. 15. Auch bei Faucher und Sax ist dieses Bild deutlich erkennbar.�� Vgl. Gerhard Fehl, Berlin wird Weltstadt: Wohnungsnot und Villenkolonien. Eine Begegnung mit Julius Faucher,
seinem Filter-Modell und seiner Wohnungsreformbewegung um 1866, in: Juan Rodriguez-Lores/Gerhard Fehl (Hg.), Städtebaureform 1865–1900, Teil 1, Hamburg 1985, S. 101–15�.
�4 Baumeister (wie Anm. �), S. 80ff.; Bruch (wie Anm. 6), S. �0f., Ernst Bruch, Wohnungsnoth und Hülfe, in: Berlin und seine Entwicklung. Städtisches Jahrbuch für Volkswirthschaft und Statistik, 6. Jg., 187�, S. 14–85.
Differenzierte Interessenslandschaften �59
um das Londoner System zu ermöglichen.�5 Der Londoner Alltag erfordert ein höheres Maß an Organisation und zeitlicher Taktung – dieses schnellere und geordnetere Leben muss erst gelernt werden.
Dieses Vorbild kann nicht einfach auf Berlin übertragen werden, und so ist selbst Faucher, der ein wichtiger Exponent der deutschen Freihändlerszene ist, davon über-zeugt, dass staatliche oder kommunale Interventionen notwendig sind, um einen beweglichen Wohnungsmarkt und so die geschätzte Londoner Struktur zu erzeugen. Bruch und Baumeister äußern sich zwar kritisch zur Haltung des Laissez-faire, doch auch sie vertreten eine weitgehend liberale Haltung: Die ‚Staatshilfe‘ soll nur da eingreifen, wo die ‚Selbsthilfe‘ zu kurz greift, insbesondere aber soll sie dieser auf die Beine helfen.�6 Den neuen Planungsansätzen geht es zwar um eine Beobachtung von Bedürfnissen und Marktverhältnissen – diese erscheinen aber als gestaltbar. Und so will Faucher explizit die Nachfrage reformieren: Durch öffentliche Meinung und Erziehung soll der Sinn für ein besseres Wohnen geweckt werden. Die Förderung von Selbsthilfegruppen und Wohnbaugesellschaften mit Vorbildcharakter ist ein wichtiges Thema in den Diskussionen des „Kongresses deutscher Volkswirthe“ und die Erziehung und Verbürgerlichung der arbeitenden Bevölkerung insgesamt ein wesentliches Mittel einer liberalen Regierung.�7 Neben der Verbesserung der Nachfrage soll durch pla-nerische Interventionen eine Vermehrung des Angebots erreicht werden. Angeregt
�5 Faucher (wie Anm. 6); Julius Faucher, Die Bewegung für Wohnungsreform (Zweite Hälfte), in: Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte 3, 1866, S. 86–151.
�6 Baumeister (wie Anm. �); Bruch (wie Anm. ��), S. 77f.�7 Vgl. Faucher (wie Anm. 5), S. 197f., sowie die Berichte über die Verhandlungen des 7., 8., 9. und 14. Kongresses
deutscher Volkswirthe, Berlin 1864, 1865, 1867, 187�.
Abb. � Die Schnellbahnnetze von Berlin und London im Vergleich, Gustav Kemmann. Auch 1910, als die Berliner Städtebau-Ausstellung stattfand und Berlin bereits über einige Schnellbahnen verfügte, diente London immer noch als Vorbild.
�60 Christa Kamleithner
durch Fauchers These, dass die hohen Bodenpreise durch ein Bodenmonopol bedingt sind, setzt sich die Idee durch, dass die Förderung des Verkehrswesens Baugründe vermehrt und insofern ein zentrales Mittel zur Beseitigung der Wohnungsnot ist.�8 Ein ausgebautes Verkehrssystem gilt der Städtebaudiskussion dieser Zeit als zentrale Voraussetzung, um eine moderne städtische Struktur, also eine aufgelockerte Bebauung aus Villenquartieren und Arbeitersiedlungen, zu ermöglichen und damit die Auflösung der kompakten Großstadt in ein Gebilde, ,in dem die Planeten ihre eigene Existenz bewahren, einen eigenen Gravitationspunkt bilden und sich mit ihren Trabanten dem grossen, lockerer und leichter zusammengefügten Ganzen zwanglos einfügen‘�9. Diese Vorstellung Bruchs nimmt die Konzepte der Planung des �0. Jahrhunderts um Jahrzehnte vorweg – im Unterschied zu ihnen soll die aufgelockerte Stadt aber nicht durch einen fixen Plan, sondern durch eine Regulierung des Spiels von Angebot und Nachfrage erfolgen.
Das konkrete Planungsverfahren, das Bruch und Baumeister vorschlagen, verbindet vorausschauende Planung und Eigentätigkeit des Marktes: Ein flächendeckender Plan für die Stadtentwicklung der nächsten Jahrzehnte soll nicht mehr erstellt werden, denn die künftigen Bedürfnisse könnten von der Planung nicht entsprechend antizipiert wer-den. Jedoch soll ein zusammenhängendes Straßen- und Schienennetz vorgesehen und von der öffentlichen Hand errichtet werden; die Flächen dazwischen sollen der privaten Unternehmung überlassen werden. Nachdem nur die Hauptverkehrszüge vorgesehen werden, bleibt es offen, welche Straßenbreiten und Blocktiefen, und damit welche Nutzungen, in privater Initiative geplant werden. Dies ermöglicht eine gegenüber dem homogenen Hobrechtplan größere Vielfalt, die sich zugleich dadurch reguliert, dass die Investoren auf vorhandene Lagequalitäten reagieren und sich auf eine bestimmte Nutzung spezialisieren.�0 Dieser Vorschlag einer zweistufigen und offenen Planung erfährt im Folgenden eine Fixierung. Was in den frühen Schriften noch der Markt re-geln sollte, die Einteilung des Stadtgrundrisses in Zonen verschiedener Nutzung und Bauweise, wird ab etwa 1900 in Form von Zonenplanungen festgelegt. Die Planung verfolgt damit zwar auch wohlfahrtsstaatliche Ziele, etwa die Absonderung der Industrie – sie richtet sich jedoch insbesondere auf ein ökonomisches Ziel: die Absicherung der verschiedenen Teilmärkte, die durch eine Vermischung von Fabriken, Mietskasernen und Villenbebauung gefährdet wären.�1 Die sozial und funktional differenzierte Stadt entsteht demnach in einem komplexen Entwicklungsprozess: Sie wird vorgezeichnet
�8 Faucher (wie Anm. 6); Julius Faucher, Ueber Häuserbau-Unternehmung im Geiste der Zeit, in: Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte 2, 1869, S. 48–74; Bruch (wie Anm. ��), S. 60ff., 70ff.; Baumeister (wie Anm. �), S. 59. Schon 1871 ist diese Auffassung im Berliner Magistrat angelangt, vgl. Hermann Schwabe, Berliner Südwestbahn und Centralbahn. Beleuchtet vom Standpunkt der Wohnungsfrage und der industriellen Gesellschaft, Berlin 187�, S. 6f.
�9 Bruch (wie Anm. 6), S. 54.�0 Bruch (wie Anm. 6), S. 97; Baumeister (wie Anm. �), S. 86ff.�1 Vgl. insb. Andreas Weiland, Die Frankfurter Zonenbauordnung von 1891 – eine ‚fortschrittliche‘ Bauordnung?,
in: Juan Rodriguez-Lores/Gerhard Fehl (Hg.), Städtebaureform 1865�1900. Teil �. Hamburg 1985, S. �4���88; allgemein: Gerhard Fehl/Juan Rodriguez-Lores, Aufstieg und Fall der Zonenplanung. Städtebauliches Instrumenta-rium und stadträumliche Ordnungsvorstellungen zwischen 1870 und 1905, in: Stadtbauwelt 73, 198�, S. 45–5�; Brian Ladd, Urban Planning and Civic Order in Germany 1860–1914, Cambridge, Mass./London 1990.
Differenzierte Interessenslandschaften �61
durch die Gesetze des Marktes, die von der Planung wissenschaftlich erforscht, natura-lisiert und dann in bereinigter Form umgesetzt werden – und in eben diesem Akt der Naturalisierung kann sich die moderne Stadtplanung als Wissenschaft konstituieren.�� Das Paradoxe der modernen Planung ist, dass sie im Grunde das herzustellen sucht, was sie als existierend voraussetzt – das aber macht, wie Foucault gezeigt hat, insgesamt das Projekt des Liberalismus aus.��
Ein Ausblick
An den Anfängen des modernen Stadtplanungsdiskurses lässt sich prototypisch zeigen, wie individualisierende und totalisierende Momente eines liberalen Regierungsdenkens ineinandergreifen. Subjektivierende und objektivierende Praktiken sind, Foucault zufol-
�� Giorgio Piccinato, Städtebau in Deutschland 1871�1914: Genese einer wissenschaftlichen Disziplin, Braunschweig/Wiesbaden 198�, S. �9, �5f.
�� Michel Foucault, Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Vorlesungen am Collège de France 1977�1978, hg. von Michel Senellart, Frankfurt a. M. �004, S. 77.
Abb. � Bebauungs-Plan Frankfurt am Main, 1891. Dieser Plan zählt zu den ersten Zonenplanungen im deutsch-sprachigen Raum.
�6� Christa Kamleithner
ge, zwar immer in irgendeiner Form miteinander verknüpft, gerade aber die Moderne hat diese Verknüpfung in einer zuvor unbekannten Weise kompliziert.�4 So denkt die moderne Planung die Stadt als ein organisches Ganzes, das durch die Eigenaktivität der Individuen konstituiert wird. Diese sind in technischer und sozialer Hinsicht mobil geworden; die Klassengesellschaft gestaltet die sozialen Grenzen durchlässig und ge-rade diese Offenheit wirkt leistungssteigernd und erzeugt eine neue Ordnung. Dabei wird ein Prozess der Selbsterkenntnis in Gang gesetzt und die Individuen werden einem Test ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten unterzogen. Der städtische Raum bietet dafür ein Testfeld: Die Situierung in ihm hat immer schon eine Aussage darüber gemacht, wer jemand ist, nun erfolgt diese Situierung aber in einem mehr oder weniger offenen Wettbewerb. Dieser wird von der Planung nicht nur begleitet, sie schafft zuallererst die Voraussetzungen dafür.
Mehr noch als für die moderne Planung in ihren Anfängen treffen diese Sätze auf die gegenwärtige Planung zu. Zunächst sind Bebauungs- und Flächennutzungspläne, für die um 1900 die Grundlagen geschaffen wurden, immer noch ein zentraler Teil der Planungspraxis; das Hauptaugenmerk hat sich aber vom Raum auf die Prozesse, die Raum konstitutieren, verschoben:�5 Heute geht es in der Planung darum, die Bevölke-rung eines Quartiers, einer Stadt oder einer Region durch Projekte zu aktivieren, einzelne Akteure zu vernetzen, Kommunikation und Kooperation zu fördern, Identität zu stiften und zu innovativem Handeln anzuleiten.�6 Mehr noch als die moderne Zonenplanung geht die heutige Projektewelt von einer differenzierten Interessenslandschaft aus, die als natürlich verstanden wird und die es zu entziffern gilt. Diese scheint aber einer gewis-sen Unterstützung zu bedürfen, um sich entfalten zu können: Sah es die Zonenplanung als ihre Aufgabe an, über statistische Erhebungen Zugang zu den individuellen und gesellschaftlichen Interessen zu finden und diesen einen stabilen Rahmen zu bieten, versucht die heutige Planung, Individuen und Orte auf ihre Potenziale hinzuweisen und diese zu stärken � durch Praktiken des Markierens, Sortierens und Ordnens wie durch offensives Marketing. Die Wirklichkeitsauffassung der Planung ist komplexer geworden und auch die durch sie hergestellte Differenzierung des Raumes. Diese basiert nicht mehr auf einem einfachen gesellschaftlichen Schichtenmodell, sondern sie arbeitet mit sozialem Kapital, gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und der Eigendynamik kommu-nikativer Prozesse. Schon im Hintergrund der Zonenplanung steht die Idee störungs-freier Nachbarschaften sowie die Vorstellung einer dynamischen Stadtbevölkerung, durch deren Wanderungsprozesse räumliche Differenzierungen erst möglich werden – im Unterschied dazu ist die Planung aktiver geworden und der Entstehungsprozess sozialer Räume hat sich weiter dynamisiert. Die Planung schreibt nicht mehr eine bestimmte Differenzierung vor, sondern sie versucht in pädagogisch-therapeutischer
�4 Michel Foucault, Warum ich die Macht untersuche: Die Frage des Subjekts, in: Michel Foucault, Walter Seitter, Das Spektrum der Genealogie, Bodenheim 1996, S. 14–�8.
�5 Vgl. Gerd Albers, Über den Wandel im Planungsverständnis, in: RaumPlanung 61, 199�, S. 97–10�; Klaus Selle, Was ist bloß mit der Planung los? Erkundungen auf dem Weg zum kooperativen Handeln, Dortmund 1994, S. �6ff.
�6 Vgl. Christa Kamleithner, „Regieren durch Community“: Neoliberale Formen der Stadtplanung, in: Matthias Drilling/Olaf Schnur (Hg.), Governance der Quartiersentwicklung. Theoretische und praktische Zugänge zu neuen Steuerungsformen, Wiesbaden �009, S. �9–47.
Differenzierte Interessenslandschaften �6�
Absicht, Individuen und Städte oder Regionen zur Selbsterkenntnis anzuleiten. Diese Selbstfindungsprozesse werden unter einen Imperativ der Optimierung gestellt:�7 Sie finden unter dem Eindruck eines sich verschärfenden Städtewettbewerbs statt, der von der Planung nicht nur zwangsläufig zur Kenntnis genommen wird, sondern der zu einer ihrer wichtigsten Techniken geworden ist. Gegenüber der modernen Planung in ihren Anfängen haben sich die Mittel vervielfältigt – die Künstlichkeit des Planungseinsatzes ist deutlicher geworden.
Bildnachweise
Abb. 1: Werner Hegemann, Der Städtebau, 1. Teil, Berlin 1911, Abb. �Abb. �: Werner Hegemann, Der Städtebau, 1. Teil, Berlin 1911, Abb. 46 und 47Abb. �: Juan Rodriguez-Lores/Gerhard Fehl (Hg.), Städtebaureform 1865–1900. Teil �. Hamburg 1985, S. �17
�7 Vgl. Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer Subjektivierungsform, Frankfurt a. M. �007.