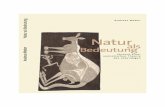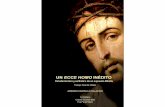Homo empathicus - Versuch einer Evolutionären Anthropologie der Empathie
Transcript of Homo empathicus - Versuch einer Evolutionären Anthropologie der Empathie
UNIVERSITÄTSFORSCHUNGENZUR PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
Aus dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität zu KölnSFB 806 ´Our Way to Europe´
Band 239
Homo empathicusVersuch einer Evolutionären Anthropologie
der Empathie
von
Shumon T. Hussain
V E R L A G D R. R U D O L F H A B E L T G M B H, B O N N
2013
170.000
150.000
000.
031
110.000
90.000
70.000
50.000
30.00
0 10.0
00
www.sfb806.de
Homo empathicus
Versuch einer Evolutionären Anthropologie der Empathie
Implikationen für die anthropologische Bestimmung des modernen Menschenund das Verschwinden letzter Neandertaler
von
Shumon T. Hussain
2013
Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn
shumon t. Hussain
dem vorliegenden buch liegt eine unter meiner betreuunggefertigte bachelorarbeit zu grunde, die unter dem titel„Homo empathicus“, Versuch einer evolutionären anthro-pologie der empathie 2011 an der eberhard Karls univer-sität tübingen zum abschluss gebracht wurde. Meineswissens ist es an unserer universität noch nie vorgekom-men, dass eine bachelorarbeit unmittelbar in eine mono-graphische Publikation gemündet wäre. bereits aus dieserbeobachtung sollte das außerordentliche talent von shu-mon t. Hussain deutlich werden. auch wenn in der ur-und Frühgeschichtslandschaft sehr unterschiedliche ta-lente zu erfolgreichen Karrieren führen können, so zähltshumon t. Hussain ohne Zweifel zu den begabtesten stu-denten, die ich in meiner Zeit in tübingen bislang be-treuen durfte. seit seinem wechsel an die universität zuKöln hält unsere fruchtbare Kooperation an, und darüberbin ich sehr froh.
seit langem bemüht sich die Forschung um die definitionvon Kriterien, nach denen sich im weiteren sinne Men-schen von sonstigen Lebewesen unterscheiden und im en-geren sinne die anatomisch modernen Menschen, also wir,von vorherigen Menschenformen, wie etwa den Neander-talern. Nach vielen Jahrzehnten der diskreditierung wares nur normal, dass die Forschung eine berechtigte reha-bilitierung dieser Vorläufer des modernen Menschen un-ternahm. allerdings hat man heute den eindruck, dassdiese bemühungen zuweilen zu weit gehen. so suggeriertdas ein oder andere in letzter Zeit veröffentlichte Paper, alshabe sich der Neandertaler in nichts von anatomisch mo-dernen Menschen unterschieden und als sei der Übergangvom Mittel- zum Jungpaläolithikum, mit anderen wortengrob der Übergang der von diesen beiden Menschenfor-men getragenen chronologischen Komplexe in europa,nur ein x-beliebiger Moment der Menschheitsgeschichte.
Vorwort VoN HaraLd FLoss
eine der spannendsten Fragen der Menschheitsgeschichte istbis heute ungeklärt und beschäftigt die aktuelle Forschungs-diskussion: das Verschwinden des Neandertalers und dasÜberleben des modernen Menschen. was befähigte unsereVorfahren der spezies Homo sapiens sapiens, ihr ursprungs-gebiet im osten oder süden afrikas vor etwa 200.000 Jahrenzu verlassen und den ganzen Kontinent zu besiedeln, danneurasien und australien und schließlich auch die Neue welt?
der Prozess des ursprunges und der ausbreitung des mo-dernen Menschen wird immer deutlicher sichtbar, genetischeanalysen, verbesserte datierungsmethoden sowie archäolo-gische und anthropologische Neufunde verdichten denmenschheitsgeschichtlichen Plot zunehmend.
Im sonderforschungsbereich 806 der deutsche Forschungs-gemeinschaft „our way to europe. Culture-environmentInteraction and Human Mobility in the Late Quaternary“der universitäten Köln, bonn und aachen steht vor allemder Zusammenhang zwischen naturräumlicher umgebungund kultureller adaptation beim frühen modernen Men-schen im Vordergrund.
Für den realitätsgehalt der szenarien, die in unserer Pro-jektgruppe erarbeitet werden, ist es entscheidend, die humaneHandlungsoption („human agency“), die hinter – oder ei-gentlich eher über – dem adaptationsbegriff steht, möglichst
umfassend zu diskutieren. eine umweltgeschichtlich vorge-gebene realität war durch die prähistorischen Menschen –wesentlich kulturell – zu interpretieren. Hierbei sind die na-türlichen Parameter nicht ursächlich von den sozialen undkulturellen zu trennen, die elemente desselben adaptations-systemes sind.
die zugleich geowissenschaftliche und kulturwissen-schaftliche Perspektive sFb 806 ist in den nächsten Jahren(zweite Forschungsphase des sFb 806 in den Jahren2013–2017) durch eine anthropologische Perspektive zu er-weitern. die in tübingen als b.a.-arbeit entstandene undvom Verfasser in Köln noch überarbeitete studie leistet einengrundlegenden beitrag zu einer evolutionären anthropolo-gie der empathie, die eine wesentliche essenz der mensch-lichen sozialität bildet. wir haben sie deshalb gerne in diePubliksationsreihe unseres sFb aufgenommen.
dank gilt dr. ursula tegtmeier für die redaktion und LutzHermsdorf-Knauth für die bildbearbeitung, aber auch Pro-fessor dr. Harald Floss, dem tübinger Mentor dieser arbeit,und den zahlreichen Inhabern der bildrechte für ihre groß-zügigkeit, den abdruck in unserer reihe zu gestatten.
Jürgen richter Köln, 15.6.2013
Vorwort des Herausgebers
dies ist natürlich falsch, jeder kenntnisreiche und intuitivveranlagte archäologe spürt unmittelbar, dass die welt deseuropäischen Mittelpaläolithiums eine andere war als diedes darauf folgenden Jungpaläolithikums und dass diesegesellschaften unterschiedlich funktionierten. Nicht vonungefähr treten seither bedeutende beispiele der eiszeit-kunst auf, man denke nur an die grotte Chauvet-Pontd’arc in Frankreich oder die elfenbeinskulpturen von derschwäbischen alb. diese offensichtlichen unterschiede imkünstlerischen schaffen wurden somit nicht von ungefährschon früh als conditio humana angesehen, wie es arnoldgehlen formulierte. Hans Jonas prägte in diesem Zusam-menhang vor 50 Jahren den begriff des Homo pictor, ernstCassirer sprach vom Homo symbolicus. diverse andere, sichin verschiedenen Homo-epitheta niederschlagende defini-tionen wurden als differentia des Menschen (nach HansJonas) proklamiert, man denke hier nur an den Homo fabereines Max scheler, der auf das handwerkliche geschick derwerkzeugherstellung des Menschen abzielt, oder an denHomo ludens eines Johan Huizinga, nach dem der Menschseine spezifischen Fähigkeiten vor allem über das spiel ent-wickelt. all diese definitionen sind aber nicht frei von Kri-tik geblieben, und selbst der von Carl von Linné ins Lebengerufene Homo sapiens ist heute nomenklatorisch zwarnicht bedroht, erfährt allerdings durch die Frage der Zu-gehörigkeit der Neandertaler zu dieser art eine unerwarteteIdentitätskrise. Mit diesem szenario als background hatsich shumon t. Hussain aufgemacht, seine eigene defini-tion dessen zu entwickeln, was uns anatomisch moderneMenschen auszeichnet, und dies ist die empathie. Hus-sains Hauptthese liegt in der aussage, dass es die empathiesei, die die modernen Menschen entscheidend von sonsti-gen Lebewesen bis hin zu den Neandertalern unterscheide.er bewegt sich damit in einem Forschungsfeld, das sowohlmit der sozialen wie kognitiven entwicklung des Men-schen zu tun hat und von Hussain vereinigend „sozialeKognition“ genannt wird, wobei offen bleibt, ob hier das-selbe gemeint ist, wie in Fiskes und taylors grundlegenderarbeit „social Cognition“ von 1991. Hussain korreliert
das Maß an empathie mit der spezifischen Life-Historydes Menschen und im besonderen mit den spezifika desMutter-Kind-Verhältnisses, des Imitierens und der spiele-rischen erfahrung. und in diesem sektor, wie generell inder entwicklung kollektiven Handelns, sozialer einheitenund Netzwerke sieht er das spezifikum des Menschen.
bleibt die Frage, wie der Nachweis dafür im archäolo-gischen Kontext gelingen kann. Hier dienen dem autorzunächst die durch lithische rohmaterialien und schmu-ckelemente belegten Fernverbindungen als erstes Indiz fürverstärkten Kontakt und austausch im Jungpaläolithikum,mit der grundidee des gabentauschs als akt der empa-thie. dem Neandertaler billigt der autor dieses Maß anempathie explizit nicht zu. Interessant ist schließlich dievon Hussain gezogene Verbindung zwischen empathieund der eiszeitlichen Höhlenkunst, die er nicht nur imzwischenmenschlichen aspekt sieht, sondern auch mit ani-mistischer Landschaftswahrnehmung korreliert sowie demsich einfühlen in die an sich unbelebte Fels- und Höhlen-landschaft der umgebenden Natur. durch das sich-Hi-neinfühlen in die Höhlenmorphologie, ein spezifikum dereizeitkunst, wird das bereits Vorhandene ästhetisch her-vorgehoben. Höhlen wie altamira, Lascaux oder die grotteChauvet sind somit ausdruck einer „empathisierten“ Le-benswelt, die sich mit beginn des Jungpaläolithikums ent-wickelt hat.
Hussain schließt seine bachelorarbeit mit folgendemstatement: „[...], dass empathie, Mitleid und nicht zuletzteinfühlung aber als ganz wesentliche bestandteile einesspektrums von anpassungen gelten müssen, die den Men-schen so überaus erfolgreich gemacht haben. die Mensch-heitsgeschichte avanciert damit zu einem guten anteil zurempathiegeschichte. einer geschichte, vor deren enthül-lung wir gerade erst stehen. der Mensch ist und warimmer zuallererst empath: Homo empathicus.“
dem wollen wir nichts hinzufügen.
Harald Floss tübingen, im Mai 2013
shumon t. Hussain
die vorliegende arbeit ist die originalfassung meiner 2011an der Philosophischen Fakultät der eberhard Karls uni-versität tübingen eingereichten b.a.-arbeit im Fach ur-und Frühgeschichte. Ich habe bewusst darauf verzichtetneuere bibliographische angaben zu ergänzen, die die imtext vertretenen esen unterfüttern oder problematisie-ren; im angesicht einer Vielzahl von Neuerscheinungen,die jährlich auf den teilgebieten der Primatologie, Paläo-anthropologie, Neurowissenschaft, Kulturanthropologie,Philosophie und archäologie zu verzeichnen sind und po-tenzielle relevanz für die hier verhandelten sachverhaltehaben, hätte dies mit einer grundlegenden Überarbeitungund anreicherung des argumentationsgangs einhergehenmüssen. ergänzt wurden lediglich einige abbildungensowie eine kurze Zusammenfassung der einzelnen Kapitelin englischer sprache.
Ich bin mir sehr wohl darüber im Klaren, dass die arbeit ihre kritischen schwächen hat – insbesondere einezuversichtliche Perspektive auf die archäologische Nach-weisbarkeit von „echten“ silex-tauschnetzen im frühenJungpaläolithikum ist an dieser stelle beispielhaft zu nen-nen – ich glaube jedoch, dass die eigentliche wichtigkeitder arbeit im Versuch eines ersten integrativen gesamt-entwurfs der langen und wechselvollen evolutionsge-schichte des empathischen Vermögens in der menschlichenLinie begründet liegt. dieser entwurf – mit all seinen stär-ken und schwächen – kann auch zwei Jahre nach seinementstehen fruchtbarer ausgangspunkt für die diskussionum eine empathisch katalysierte sozialevolution sein, wieauch erneuter anstoßpunkt in der auseinandersetzung mitder Frage nach dem spezifisch Menschlichen und seinemgewordensein. Letztlich versuche ich zu zeigen, wiefruchtbar eine explizite interdisziplinäre Öffnung für diepaläolithische archäologie und ihren inhärenten Fragen-korpus sein kann. eine Perspektive, die heute so aktuellund dringend wie nie ist. Ich hoffe, dass zumindest einigeder vorliegenden Ideen und Überlegungen diese diskus-sionen inspirieren können.
Zu guter Letzt sei darauf hingewiesen, dass das vorliegendebuch ganz entscheidend durch jene abarbeitung an denMotiven empathie und Mitleid inspiriert worden ist, dergerade in der internationalen Literatur immer wieder zu be-gegnen ist. Insbesondere in abstrakten oder zeitinvariantenFiktionsräumen, in denen traditionell immer thematisiertwird, was den Menschen eigentlich menschlich macht, spieltdas empathische eine erhebliche rolle. Man denke etwa anJ. J. r. tolkiens „der Herr der ringe“. eine Lesart diesesMeisterwerks der fantastischen Literatur legt den schlussnahe, dass Mittelerde letztlich nur deshalb gerettet und der„eine ring“ zerstört werden kann, weil bilbo beutlin etlicheJahre zuvor Mitleid mit gollum hat und ihn deshalb ver-schont. auch in gene roddenberrys sci-Fi-schöpfung „startrek“ hat das empathische eine wichtige Funktion inne.Nicht zuletzt, wenn es darum geht, den Menschen vom an-droiden – oder allgemeiner von artifiziellen Lebensformenund Intelligenzen – abzugrenzen, tritt die Fähigkeit des emo-tionalen teilhaftigwerdens anderer Individuen an die stelledes sine qua non von Humanität. besonders deutlich wirddas auch an den betazoiden, die als außerirdische spezieseine besonders wichtige eigenheit des Menschen spiegelnund dem rezipienten auf diese weise immer wieder voraugen führen. die Frage nach dem status des empathischeninnerhalb des anthropos war also schon immer eine regulativeIdee der medialen auf bereitung. oft ist sie indes in kontra-faktische (fantastische oder zukunftsentwerfende) Kontexteausgelagert und erst dort explizit verhandelt worden. Meinearbeit versteht sich in letzter Konsequenz als Fortsetzungdieses diskurses innerhalb der wissenschaft mit den Mittelnjener disziplinen, die seit jeher darum bemüht sind, die„Natur des Menschen“ aus seiner Vergangenheit abzuleiten.Mit den die einzelnen textabschnitte einleitenden Zitaten,die in enger inhaltlicher beziehung zu den textaussagen ste-hen, soll deshalb angedeutet werden, wie das Motiv desHomo empathicus nicht nur Zukunft und Vergangenheit,sondern auch Fiktion und wissenschaft fruchtbar zu inte-grieren vermag.
Köln, 16.4.2013
geLeItwort des autors
Für alle, die mit mir empathisieren
For everyone who is empathizing with me
Pour tous ceux qui empathisent avec moi
shumon t. Hussain
INHaLt
danksagung ........................................................................................................................................................... 12
einleitung evolutionäre anthropologie der empathie .................................................................................. 13
teil I warum Menschen empathische wesen sind .................................................................................. 14 I.1 empathie, eory of Mind und soziales erkennen ................................................................ 14 was ist empathie? ................................................................................................................. 14 das empathische und die eorie mentaler gehalte ............................................................. 15
I.2 Life-History, evolution und soziale Kognition ....................................................................... 15 die kooperative Natur menschlicher brutpflege .................................................................... 15 die empathischen erfordernisse menschlicher brutpflege ...................................................... 18 Paläoanthropologische belege für die evolution der menschlichen Life-History .................... 23 Neurologische Implikationen einer verlängerten Präadoleszenz .............................................. 26
I.3 spiegelneurone, soziales Lernen, Mimetik und empathie ...................................................... 28 die Pädagogik der empathie ................................................................................................. 28 die mimetischen Voraussetzungen des sozialen Lernens ........................................................ 28 die neuronalen grundlagen des verstehenden Lernens .......................................................... 30 die empathischen Implikationen spielerischer erfahrung ...................................................... 30
I.4 Kommunale Kultur und die evolution kultureller Kapazität .................................................. 34 die evolutionäre entwicklung menschlicher Kulturfähigkeit ................................................. 34 der empathische aspekt geteilter Intentionalität ................................................................... 39 die ontogenetischen wurzeln geteilter Intentionalität ........................................................... 40 die anthropologische bedeutung kollektiver Intentionalität .................................................. 42 Identität als sublimat des kulturellen gedächtnisses .............................................................. 45
I.5 empathische Positionalität, austauschnetze und die wurzeln der Zivilisation ....................... 54 wo der Mensch in der welt zu verorten ist ............................................................................ 54 die implizite reziprozität empathischer Verfasstheit .............................................................. 55 die anthropologische bedeutung der gabe ........................................................................... 56 die empathische genese transregionaler austauschnetze ....................................................... 58 summary Part I why humans are empathetic beings ............................................................................................. 63 I.1 empathy, theory of mind and social epistemology ................................................................. 63 I.2 Life-history, evolution and social cognition ........................................................................... 63 I.3 Mirror neurons, social learning, mimesis and empathy .......................................................... 64 I.4 Communal culture and the evolution of cultural capacity ..................................................... 64 I.5 empathic positionality, exchange networks and the roots of civilization ................................ 65
teil II warum der Neandertaler anders ist ...................................................................................... 67 II.1 empathie, aggression und gruppenorganisation ......................................................... 67 die empathische Komponente der Neandertalersozialität ............................................ 67 die bedeutung der aggression als sozialer antagonist ................................................. 70
II.2 autismus, soziale Fragmentierung und positive selektion ............................................ 73 der autist im Neandertaler? ........................................................................................ 73 was beim Neandertaler fehlt ....................................................................................... 75 warum der Neandertaler ausgestorben sein könnte ..................................................... 77 summary Part II why Neanderthals are different ........................................................................................... 80 II.1 empathy, aggression and group organization ............................................................... 80 II.2 autism, social fragmentation and positive selection ..................................................... 80
teil III was es mit Kunst und Ästhetik auf sich hat ......................................................................... 81 III.1 Kunst, Ästhetik und empathische Verfasstheit ............................................................. 81 der empathische aspekt ästhetischer erfahrung .......................................................... 81 der spiegelmechanismus als ästhetischer Mittler? ........................................................ 83 der animismus als destillat holistischer empathieerfahrung ...................................... 84
III.2 Narration, Mythologie und Zeit .................................................................................. 88 die künstlerische Hervorhebung von Vorhandenem ................................................... 88 Narrative einbettung als empathiesymptom ............................................................... 95 das empathische Motiv der Handnegative .................................................................. 97 das Paradigma des Palimpsests .................................................................................. 100 summary Part III and what about art and aesthetics? .................................................................................... 104 III.1 art, aesthetics and empathic constitution .................................................................. 104 III.2 Narration, mythology and time ................................................................................. 104
Zusammenfassung Menschheitsgeschichte als empathiegeschichte .................................................................. 107 summary Mankind’s history as history of empathy ............................................................................ 109 résumé L’Histoire de l’humanité – l’histoire de l’empathie ............................................................. 111
bibliographie .......................................................................................................................................................... 114
12 shumon t. Hussain
bedanken möchte ich mich insbesondere bei meinen eltern,ohne die dieses buch zweifelsohne nicht zustande gekom-men wäre. Mein dank gilt außerdem meinen langjährigenFörderern sven-ulrich Lippert, dr. Joachim rossbroichsowie Helga Müller und dem leider bereits verstorbenenHans-Jürgen Müller, ebenso der Mariposa-stiftung. auchProf. dr. ulrich Veit sei hier für seine unterstützung ge-dankt. dr. Michael rohe ist schon allein deshalb zu nennen,weil er sich unermüdlich eingesetzt und als Korrekturleserbewährt hat. des weiteren möchte ich Prof. jun. dr. Johan-nes Krause für einen wichtigen Hinweis ebenso wie Prof.dr. Michael Franz, Prof. dr. Catrin Misselhorn und dr.Niels weidtmann für stets inspirierende anregungen undfruchtbare diskussionen danken. als außer ordentlich wich-tig für die inhaltliche entwicklung der diesem buch zugrun-deliegenden gedanken hat sich Pd dr. Miriam Haidle er-wiesen, die einige entscheidende anmerkungen undKritikpunkte beigesteuert hat und damit zum positiven ge-lingen des buches einen nicht unerheblichen beitrag geleis-tet hat. Mein größter dank gilt jedoch Prof. dr. HaraldFloss, dem betreuer dieser arbeit. er hat sich als überaus ge-duldiger und vertrauensvoller akademischer Lehrer einesProjektvorhabens erwiesen, welches sich gelegentlich auf vielzu dünnem eis bewegt. das an dieser stelle in mich gesetzteVertrauen sowie die nötige Freiheitsgewährung zur umset-zung eines inhaltlich wie konzeptionell nicht unumstritte-nen Vorhabens kann gar nicht überbewertet werden. Nicht
zuletzt möchte ich mich bei Jacob börold bedanken, derdiese arbeit stets freundschaftlich abzufedern wusste (auchwenn ihm das möglicherweise selbst nicht immer ganz be-wusst war) und damit ganz erheblich zum zeitnahen gelin-gen dieses buches beigetragen hat. Mein dank gebührt au-ßerdem der studienstiftung des deutschen Volkes ebensowie dem eve-Förderpreiskomitee und dr. omas d’souzafür die Förderung und finanzielle unterstützung dieses Pro-jekts. alle, die indirekt und direkt am gelingen dieser arbeitbeteiligt waren, die aber hier nicht genannt werden konnten,sei meine tiefste entschuldigung ausgesprochen.
Für die Möglichkeit zur Veröffentlichung in der Kölnerreihe „universitätsforschungen zur Prähistorischen archäo-logie“ zum sFb 806, die stete bereitschaft, über unkonven-tionelle emen anregend zu diskutieren, und die Motiva-tion, dieses Projekt auch nach knapp zwei Jahren zu einemgelungenen abschluss zu bringen, sei insbesondere Prof. dr.Jürgen richter gedankt. darüber hinaus stammen alle eigensfür diese Publikation angefertigten umzeichnungen aus sei-ner Feder. wesentlich zum gelingen der Zusammenfassun-gen in englischer sprache hat allison Casaly beigetragen.die französische Zusammenfassung hat freundlicherweiseHallvard bruvoll dirigiert. einige abbildungen wurden vonKiron J. Hussain publikationstauglich gemacht. außerdemsei allen gedankt, die mir Fotos und grafiken sowie derenNutzungsrechte zur Verfügung gestellt haben.
daNKsaguNg
13
das vorliegende buch widmet sich der Frage nach demMenschlichen im Menschen. es artikuliert den Versuch, diealte Kant’sche Frage „was ist der Mensch“ ins 21. Jahrhun-dert zu tragen und im Lichte neuer wissenschaftlicher er-gebnisse wieder zu problematisieren. es muss klar sein, dassdie Kernfrage der Philosophie wohl kaum in einer kurzenabhandlung dergestalt wie sie hier vorliegt erschöpfend be-handelt werden kann. Ich widme mich daher etwas beschei-dener der Frage nach der bedeutung der empathie für dasMenschsein. Mein Hauptanliegen kann dabei als bestrebeneiner interdisziplinären Integration verschiedener einsichtenzu dem empathischen und um das empathische in einenevolutionärem rahmen charakterisiert werden. betont wer-den soll vor allem die erkenntnistheoretische schlüsselstel-lung der Prähistorischen archäologie, wenn es darum geht,das herauszupräparieren, was den Menschen wirklich aus-macht. dieses buch ist explizit unter der annahme geschrie-ben, dass sich die wesentlichen Charakterisitka des Men-schen, die eine derartige Kennzeichnung legitimieren, imLaufe der Menschwerdung, d. h. bereits ganz am anfang derwechselvollen geschichte des modernen Menschen, heraus-gebildet haben. Jene archaismen umreißen noch heute das,was wir meinen, wenn vom Menschlichen die rede ist. Imevolutionären Milieu unserer entstehung sollten also jeneQualitäten zu finden sein, welche den modernen Menschenqua Mensch auszeichnen und ihn von walen, schmetter-lingen, Menschenaffen, aber auch von seinen nächsten Ver-wandten und ausgestorbenen Vorfahren unterscheiden. die-ses buch ist als Versuch zu lesen, jene bestimmendenatavismen in der anthropogenese aufzuspüren.
Jedenfalls ist unmittelbar einleuchtend, dass aus dem re-levanten Zeitfenster nur noch archäologische Quellen erhal-ten geblieben sind. aus diesem grund müssen alle datenüber den Menschen, seien es human- oder naturwissen-schaftliche, in einen archäologischen eorierahmen inte-griert werden, insofern der Frage nach dem was des Men-schen adäquat begegnet werden soll. was ist der Mensch?wie ist er geworden? was sind die fundamentalen trieb-kräfte jener entwicklung, die uns zu dem gemacht haben,was wir Menschen sind? Heute wissen wir, dass es mehr alsnur wahrscheinlich ist, dass die Quintessenz des Menschenirgendwo zwischen sozialität und Kognition verborgen liegt.dieses buch ist der Versuch einer rekonstruktiven Model-lierung der sozialen Kognition des modernen Menschen ineinem koevolutiven szenario. empathie soll dabei in den
Fokus der betrachtung gerückt werden, weil ich glaube, dassgerade im empathischen die spezifische eigenheit dermenschlichen sozialität zutage tritt.
empathie bietet sich auch schon allein deshalb als Fall-studie an, weil dieses Vermögen bis dato systematisch, wieich glaube, unterschätzt worden ist. es ist an der Zeit, dieszu ändern und das empathische im Menschlichen zu reha-bilitieren. der Versuch einer evolutionären anthropologieist genau ein solcher rehabiltierungsversuch. es ist der Ver-such, den modernen Menschen und seine stellung in derwelt als empathisch zu bestimmen. Menschsein bedeutetempathsein. das ist die zentrale ese dieses buches. eineevolutionäre anthropologie der empathie unternimmtsomit den Versuch, die bedeutungs- und wirkungsge-schichte des empathischen Vermögens für das Menschseinnachzuzeichnen. die alleinstellung des Menschen muss we-sentlich als empathisch begriffen werden. Menschen sind exnegativo durch eine elaborierte empathiebegabung, die sonstkein Korrelat findet, von allen anderen Lebewesen abgrenz-bar. es ist Inhalt dieses buches, diese ese zu verteidigenund mit, zugegebenermaßen indirekten, empirischen be -legen zu illustrieren. es kann nur nochmals unterstrichenwerden, dass der hier präsentierte Versuch einer evolutionä-ren anthropologie der empathie im strengen sinne als ‘Ver-such’ gelesen werden muss. als ein unterfangen, das in ermangelung in diese richtung unternommener schrittenatürlicherweise viele Leerstellen aufweist und entsprechendnicht immer sauber an allen Knotenpunkten der diversenargumentations- und evidenzlinien in ein kohärentes gan-zes aufgelöst werden kann.
dieses buch handelt von lebendiger wissenschaft undeinem Verständnis dieser, welches vor dem spekulativen undgewagten nicht zurückschreckt. es liegt deshalb auf derHand, dass vieles von dem, was angerissen wird, einer kriti-schen Prüfung noch wird standhalten müssen. Jedenfalls istdie arbeit vor allem als Perspektivenöffnung jener interdis-ziplinären debatte um das Menschsein gedacht, die denMenschen selbst zum gegenstand der Forschung erhebtsowie zugleich antirelativistisch ist und den Menschen zwarals eingelassen in die Natur, aber trotzdem als etwas beson-deres begreift. und zwar nicht im normativen sinne. es istund war seit jeher d i e Kernkompetenz der anthropologie,dieses Humanspezifikum freizulegen. das buch ist dieseraufgabe, einer aufgabe, die auf den ersten blick zum schei-tern verdammt, gewidmet.
eINLeItuNgeVoLutIoNÄre aNtHroPoLogIe der eMPatHIe
e past is part of you, no matter how hard you try to reject it.Kopolak zum jungen Chakotay.
star trek Voyager, „tatoo“
I.1 eMPatHIe, tHeory oF MINd uNd soZIa-Les erKeNNeN
was ist empathie?
Did you hear him joke about compassion? Above all else a ‘god’ needs compassion!
Kirk zu dr. elizabeth dehner über gary Mitchell und seine neu gefundenen Kräfte.
star trek tos, „where No Man Has gone before“
der begriff der empathie hat in jüngster Vergangenheit wie-der an Popularität gewonnen. sowohl in den Naturwissen-schaften als auch in den Humanwissenschaften ist er wiederins Zentrum der debatten um den Menschen gerückt. wasaber ist gemeint, wenn von empathie die rede ist undwarum ist diese so wichtig für das Menschsein? empathiemeint zunächst allgemein das sich-Hineinversetzen in einenanderen. es ist jenes Moment, indem wir in die schuhe desanderen schlüpfen, uns jedoch gleichzeitig darüber im Kla-ren sind, dass das erfahrene nicht das eigene ist. empathieist also nicht die vollständige Identifikation mit dem ande-ren. empathisierung bedeutet nicht ein aufgehen im ande-ren, sondern wahrt die differenz zwischen ego und alter.es ist die erfahrung, unmittelbar der gefühlslage oder auchder Intention einer anderen Person teilhaftig zu werden undsie auf diese weise zu verstehen.
erst durch empathie ist ein einfühlen, d. h. ein emo-tionales und kognitives Verständnis anderer möglich. erstim phänomenalen Miterleben nichteigener bewusstseinszu-stände artikuliert sich ein empathisches erleben.1 das em-pathische beinhaltet gefühlsansteckung, also das Mitgeris-senwerden von emotionen anderer sozialer akteure.empathisierung ist das Lesen der mentalen Zustände einesNicht-Ichs, das Nachvollziehen von dessen absichten undMotivationen, ohne dabei auf ein rationalisiertes Kalkül zu-rückzugreifen, und ist so durch unmittelbarkeit gekenn-zeichnet.
empathie geht mit einer selbstobjektivierung einher,indem das Ich aus sich selbst heraustreten muss, um sich fürdas alteritäre zu öffnen. es involviert eine selbstdistanzie-rung. Jene erst ist die bedingung der Möglichkeit empathi-schen Zugangs.2 Kennzeichnend für jede dergestaltige Men-talisierung ist ihre implizite Kontextgebundenheit. empathieist stets situationsvermittelt, kann also nur erfolgreich sein,wenn die gesamte situation, in die ein jedes Individuen ein-gebettet ist, miteinbezogen wird. allein aus dem ausdrucks-verhalten kann nur ein begrenztes Verständnis des anderen
entwickelt werden. ausdrucksverhalten ist der Hauptmotorgrundständiger empathie, wohingegen höhere empathiestets als abkürzende Verarbeitungsleistung von Überkom-plexität des relevanten Kontexts ausgezeichnet ist.3 als prä-reflexiver aspekt der sozialen Kognition ist das empathischeVermögen durch eine perspektivische offenheit gekenn-zeichnet. der empath ist gleichsam dazu in die Lage ver-setzt, seine eigene Perspektive zu transzendieren und die desempathisierten zu übernehmen. entsprechend schließt em-pathische disponiertheit eine befähigung zur rollenüber-nahme mit ein. Jede höhere empathieleistung zeichnet sichdurch die Fähigkeit aus, multiple Perspektiven synchron ein-zunehmen, und je nach Notwendigkeit zwischen ihnen hinund herzuspringen.4 empathie baut die brücke zum ande-ren und ermöglicht intersubjektives Verstehen.5 sie ist des-halb ein wichtiger sozialer Motivationsfaktor und führt zueiner disposition für prosoziales Verhalten. so beruht bei-spielsweise Kooperation zu einem wesentlichen anteil aufempathie, genauer gesagt auf einer Form empathischerIdentifikation. erst die teilhabe an den absichten des an-deren, im Idealfall an den absichten vieler alteritäten, er-möglicht ein koordinatives Zusammenwirken. empathie istein Mittel, die konvergierenden Ziele der anderen zu erken-nen und diese erkenntnis in Motivationskraft für prosozialeHandlungen umzusetzen. das empathische ist daher gleich-wohl eine Form des sozialen erkennens. es erlaubt einblickein andere soziale akteure und deren mentale Zustände undist damit eine grundkategorie des sozialen. dennoch istempathie kein normativer begriff. ob empathie in einerprosozialen Handlung mündet, hängt in der regel von Zu-satzvariablen ab. einfühlung resultiert nicht immer in Mit-gefühl oder Mitleid, sondern kann auch die Quelle vonschadenfreude oder aggression sein. auch eine sadistischeHandlung kann von der tatsache motiviert werden, empathiemit der misshandelten Person zu empfinden, diese miterleb-ten gefühle der Peinigung aber als subjektiv befriedigend zuerleben. ob das empathische in Prosozialität umschlägt istalso keinesfalls a priori gegeben. empathie ist ein neutralerbegriff, der zunächst lediglich die Öffnung der Mentalitätenanderer für das Ich meint.
Jedenfalls involviert höhere empathie rekursivität undist damit ein derivat höherer sozialität. bereits Paul grice
14 shumon t. Hussain
teIL IwaruM MeNsCHeN eMPatHIsCHe weseN sINd
1 vgl. grundlegend bIsCHoF-KÖHLer 2009.2 bIsCHoF-KÖHLer 2009, 312f.3 bIsCHoF-KÖHLer 2009, 314.4 vgl. auch stueber 2006, 19ff.5 vgl. bIsCHoF-KÖHLer 2009, 315.
hat die rekursive struktur menschlicher Interaktion heraus-gestellt.6 er meint damit das mehrfache sich-beziehen aufdie Intentionen anderer sozialer akteure. es handelt sichum eine wechselseitige und mehrstufig verschachtelte be-zugnahme auf die Intentionen anderer. Höhere empathieist rekursives Mind-reading und erlaubt auf diese weisedas Verständnis komplexer Motivations- und Handlungs-zusammenhänge. daher ist das empathische im Menschenein nicht zu unterschätzender baustein seines Menschlich-seins, nicht zuletzt ein wichtiges Fundament seiner oft zitier-ten ultrasozialität.
das empathische und die eorie mentaler gehalte
You read me well enough to sense how I feel about you andwhat you do on this ship, but I just want to say the words.
ank you. Well done.
Picard zu troi.star trek tNg, „Loud as a whisper“
eine eory of Mind zu haben bedeutet wörtlich, eine eo-rie der mentalen Zustände von anderen zu besitzen. dieseeorie ist mehr als das bloße Zuschreiben von Intentiona-lität. wie ist es aber um die Propositionalität dieser mentalengehalte bestellt? beinhaltet eine eory of Mind (toM) be-reits die inhaltliche anreicherung einer Mentalisierung?oder handelt es sich nur um die Vorkonzeptualisierung vonsozialen akteuren als intentionale akteure? es herrscht weit-gehend unklarheit. während tomasello und andere sichdazu im Kern nicht dezidiert äußern, aber wohl eine Posi-tion, die weitgehend noch ohne gehalt auskommt, vertre-ten, versammelt sich der großteil um die ansicht einer ein-heit von empathie um toM.7 die letztere Position betont,dass es sich auch bei der toM um eine Kompetenz zum so-zialen Verstehen anderer akteure handelt, ein solches Ver-ständnis allerdings nicht ohne inhaltliche anreicherung undKonkretisierung des Mentalen denkbar ist. Ist empathie derMechanismus, der das leistet? auch das ist prima facie allesandere als klar. ein Verständnis anderer akteure kann überverschiedene wege und Methoden erreicht werden. es istindes sehr wahrscheinlich, dass der präreflexive Zugang zuemotionen und Intentionen anderer über empathie einwichtiger baustein der menschlichen eory of Mind ist.
das empathische ist weder notwendige bedingung einertoM, noch geht diese in der empathisierung auf. Viel na-
heliegender ist die annahme, dass die einsicht, andere auchals intentionelle akteure zu verstehen, evolutionär vom Pro-blem der adäquanz mentaler Zuschreibung begleitet wurde.empathie könnte eine spezifische domäne der sozialen Ko-gnition sein, die genau zur begegnung dieser Problematik se-lektiert wurde. aber auch das ist ein anderes ema. emaeines anderen buches. Für den hier verhandelten sachverhaltist lediglich auf die disartikulierung von empathie undeory of Mind aufmerksam zu machen. beide gehen zwareinher, sind aber nicht parallelisiert. es handelt sich um einasymmetrisches Verhältnis. basale toM geht zwar häufig mitbasaler empathiebegabung einher (einer begabung, die kaummessbar ist), das ist jedoch längst nicht immer so. empathieimpliziert bestimmte toM-Kapazitäten, wohingegen dasumgekehrte nicht gilt. daraus ergibt sich die konservativeannahme, dass das empathische Vermögen einer eory ofMind evolutionär nachgeschaltet ist. ein toM-Nachweis istkein empathienachweis. Insofern ist das empathische diesehr viel interessantere kognitive Kompetenz, die sich inner-halb der anthropogenese entfaltet. es ist die menschlicheKernkompetenz des sozialen erkennens.
wenn in diesem buch von eory of Mind die rede ist,so ist stets nur ein erkennen anderer als intentional gemeint,wohingegen empathie immer schon mehr ist. Über empathiezu verfügen bedeutet immer bereits ein zumindest rudimen-täres Verständnis anderer sozialer akteure zu besitzen. ein Ver-ständnis, das unmittelbar authentisch ist, weil es auf emotio-nalität und Intentionalität des anderen zugreift. Zunächstsollen daher einige allgemeine entwicklungstrends im evolu-tionären Milieu unserer ahnen skizziert werden, die Implika-tionen für die evolution der empathie haben. empathiebe-gabung, das soll gezeigt werden, hat ihren ausgangspunkt imsozialen. sie bedient sich nicht nur einer rationalen und aus-schließlich aposteriorischen, inferierenden einholung von al-teritäten, sondern betont und überkonezptualisiert das emo-tionale im anderen im Prozess des sozialen erkennens.
I.2 LIFe-HIstory, eVoLutIoN uNd soZIaLe KogNItIoN
die kooperative Natur menschlicher brutpflege
Just help her realize she’s not alone. And be there to nurture her when she needs love and attention.
dr. beverly Crusher zu data über Lal.star trek tNg, „e offspring“
die aufzucht und Pflege des Nachwuchses spielten für jedeart, seien es nun wale, delphine, ameisen oder Primaten,eine zentrale rolle. die art und weise, wie die Nachkom-men umsorgt werden, ist aus unmittelbar nachvollziehbaren
warum Menschen empathische wesen sind 15
6 vgl. etwa grICe 1976; aber auch grICe 1975.7 vgl. exemplarisch toMaseLLo 2002; 2010; baroN-CoHeN1995; bosaCKI & astINgtoN 1999; VogeLey et al. 2001; undvor allem LesLIe et al. 2004.
gründen direkt an die wahrscheinlichkeit des Überlebensdieser Individuen – und damit eben auch an die wahrschein-lichkeit der gesicherten genweitergabe – gekoppelt. trotz-dem kann es keine objektivierbar optimale brutpflege undFortpflanzungsstrategie geben, und so haben sich im Laufeder evolution ganz unterschiedliche mating und reproductivestrategies herausgebildet. welche sich dabei jeweils als evolu-tionär erfolgreich erweisen – welche in der terminologie derevolutionären spieltheorie eine „evolutionär stabile strategie“(ess) repräsentieren –, hängt dabei von unterschiedlichen,meist ökologischen umweltfaktoren ab. Mit Chisholm kön-nen dabei zunächst zwei evolutionäre, idealtypische Problem-lösungen der reproduktion und Nachwuchsinvestition beigleichzeitig begrenzten energetischen ressourcen unterschie-den werden. das theoretische strategiekontinuum umspanntdabei einen Möglichkeitsraum, der markiert wird zum einenvon der Investition der verfügbaren ressourcen in eine ma-ximierte anzahl an Nachkommen, sodass die Überlebens-wahrscheinlichkeit zumindest eines Individuums als stochas-tisch gesichert gelten kann, und zum anderen der Investitionder ressourcen in eine minimierte anzahl an Nachkommen(in der regel lediglich ein Individuum) bei gleichzeitiger Ma-ximierung der Pflege- und schutzaufwendung.8 die selek-tierte strategie hat dabei wesentliche auswirkungen auf diegestalt des Life-History-Profils, d. h. auf die sequenz der ver-schiedenen entwicklungsstadien und deren Länge im Le-benszyklus einzelner Individuen. Im Falle der maximalen In-vestition in eine maximale anzahl an Nachkommen müssendie einzelnen Individuen deutlich schneller unabhängig sein(in der Praxis sind sie auch deutlich schneller geschlechtsreif)als im Fall einer maximierten Investition in lediglich ein In-dividuum, weil die verfügbare energie, d. h. Zeit, Nahrung,aufmerksamkeit usw., im ersteren Fall auf viel mehr Indivi-duen verteilt werden, d. h. in der Qualität notwendigerweiseauch abnehmen muss. daher droht die reproduktionskettenach nur einer generation abzubrechen, wenn der Nach-wuchs nicht schneller heranwächst und die geschlechtsreifeerreicht.
das innerhalb der Life-History deutlich zerdehnte Profildes postnatalen entwicklungsstadiums deutet damit auf dierealisierung einer qualitativen brutpflege hin. eine solcheKoppelung von reproduktionsstrategie und Life-Historykann bei den meisten säugern beobachtet werden, wobeidie Primaten eine sonderstellung einnehmen. alle höherenPrimaten sind durch eine ausgedehnte Kindheit und Jugendgekennzeichnet, sprich durch eine signifikante Verlängerungder unselbstständigen und hochabhängigen Phase der ent-wicklung, in der die geschlechtsreife noch nicht erreicht ist.9
der evolutionäre trend, der beim Menschen in der radika-lisierung dieser ausdehnung manifest wird, hat offensicht-lich bei unseren Vorfahren zu erheblichen Problemen ge-führt, an die sie sich adäquat anpassen mussten. Kritisch istdabei vor allem die minimale reproduktionsrate, die not-
wendig ist, um zumindest die stabilität einer sozialen ein-heit über die generationen hinweg zu gewährleisten. Ist diereproduktionsrate der weibchen nämlich aufgrund derhohen Investition (hier ist vor allem die Zeitinvestition ent-scheidend) minimiert – u. a. auch deshalb, weil bei eineraufzucht nur durch die Mutter in der regel eine längere re-generative Phase ohne Nachwuchs notwendig wird –, kannes dazu kommen, dass die kritische anzahl an Nachkommenunterschritten wird. die meisten heute noch lebendenarten, vor allem Vögel und säugetiere, haben auf diesestrukturelle Limitierung mit dem sozialen Mechanismus derkooperativen aufzucht reagiert. entscheidend ist dabei, dasscooperative breeding ganz unterschiedliche Formen anneh-men kann und beim Menschen am stärksten ausgeprägt ist,auch wenn einige Menschenaffen diesbezüglich bereits ru-dimentäre strukturen aufzeigen.
16 shumon t. Hussain
Mak
aken G
ibbo
ns Sch
impa
nsen
Men
sche
n
KindheitJugendlichkeitErwachsenheit
Weibliche Reproduktionsphase
24 30 34 38Tragewochen
Geburt
70
60
50
40
30
20
10
5Ja
hre
Postnatalperiode
Pränatalperiode
gegenüberstellung der Life-History-Profile des Menschen undausgewählter nichtmenschlicher Primaten. das schema zeigtdeutlich die Zerdehnung der ontogenetischen stadien beim Men-schen. Von besonderer bedeutung sind vor allem die erheblichgesteigerte bedeutung der postnatalen entwicklungsphase unddie gesteigerte Lebenserwartung nach dem reproduktiven sta-dium. (umgezeichnet nach: HawKes et al. 1998, Fig. 1)
8 CHIsHoLM 1993; aber auch CHarNoV 1993.9 Hrdy 2009, 97ff.
diese Form der indirekten reziprozität, die auch eineschwache Form des altruismus ist, scheint auf den erstenblick einer kontraevolutionären Logik zu entsprechen, dakooperative aufzucht in der regel das Konzept der ‘alloel-tern’ involviert, d. h. ausgewachsene Individuen (im engerensinne handelt es sich meist um weibchen), die sich ebenfallsum den Nachwuchs einer Mutter kümmern und dabei ihreeigene reproduktivität temporär unterdrücken. auf der In-dividualebene ist damit also keinesfalls eine optimierungder gentransferierung in die nächste generation realisiert.In den letzten Jahren hat sich aber im rahmen der Paradig-maverschiebung hin zu einer multilevel selection10 gezeigt,dass es bis dato unterschätzte triebkräfte der evolution gibt,die eine solche entwicklung nicht nur plausibel, sondernauch wahrscheinlich machen. wenn die gruppe groß genugist, kann kooperative aufzucht die inklusive Fitness erhöhen,obwohl sie die individuelle Fitness einzelner reduziert. dabeispielen vor allem Prozesse der kin selection, aber auch dieimmer wieder unterschätzten dynamiken sozialer einheiteneine rolle, die die kooperative aufzucht als strategie unterbestimmten bedingungen evolutionär stabil machen.11 Ko-operative aufzucht und Pflege des Nachwuchses ist eine evo-lutionäre errungenschaft, die durch qualitative reproduk-tion und ver längerte Life-History12 ebenso wie durch dentrend einer Vergrößerung des Hirnvolumens innerhalb dermenschlichen Linie ermöglicht wurde.13 Ihre bedeutungfür das Menschsein kann gar nicht überschätzt werden.
Verschiedenste untersuchungen zeigen nämlich, dass co-operative breeding beim Menschen über die generationeneine gestalt angenommen hat, die einzigartig im tierreichist. auch wenn insbesondere einige höhere Primaten, vorallem die Neuweltaffenarten der tamarine und Marmoset-ten, bereits über alloparentale aufzuchthelfer verfügen, er-reicht die gemeinsame Pflege der Kinder erst beim Men-schen eine neue Qualität. der Mensch zeichnet sich durcheine Form der gemeinsamen aufzucht aus, die von denmeisten nichtmenschlichen Primatenmüttern verweigertwird, nämlich des regelmäßigen und sehr häufigen tragensder Kleinkinder durch alloeltern.14 Nur die menschlicheMutter erlaubt es artgenossen, in einem hohen Maße mitdem eigenen Nachwuchs körperlichen Kontakt zu pflegen.schimpansen- und bonobomütter sind da weitaus intole-ranter und weigern sich kategorisch, von ihren Jungen ab-stand zu nehmen. bei etwa der Hälfte aller lebenden Prima-ten halten die leiblichen Mütter in den ersten Lebenswochenund -monaten ständigen Körperkontakt mit ihren Neuge-borenen. Insbesondere orang-utans sind dabei besondersstark auf eine mütterliche bindung fixiert. diese Primatengeben den intensiven Körperkontakt in der regel nicht auf,bis der Nachwuchs zumindest fünf oder sechs Monate altist, und stillen ihn noch bis zum alter von etwa sieben Jah-ren. diese wechselseitige Fixierung ist dabei so stark, dassnichtmenschliche Primatenmütter immer wieder dabei
warum Menschen empathische wesen sind 17
Kooperative aufzucht und spontane Prosozialität bei Primaten. oben: Familiengemeinschaft gemeinsam ‘brütender’ und ‘aufzie-hender’ goldener Löwenäffchen (Leontopithecus rosalia). dieweibchen gebären meist zweimal im Jahr. der hohe energieauf-wand kann bewältigt werden, weil die Jungtiere getragen undnach der entwöhnung von allen gruppenmitgliedern versorgtwerden – vor allem von den Vätern und den nahen Verwandten(Zeichnung: sarah Landry, verändert). unten: spontane Prosozialität variiert sowohl in Intensität (Qua-lität) und reichweite (spektrum der betroffenen) stark unter Pri-maten. Im unterschied zu anderen Primaten besitzen Menscheneine zusätzliche Klasse von möglichen Prosozialitätsempfängern:es handelt sich um explizit nicht-verwandte und häufig sogarganz und gar fremde soziale akteure, die zwar zur überregionalengemeinschaft gehören, nicht aber teil der lokalen gruppe sind.(Verändert nach: burKart et al. 2009, Fig. 1)
Inte
nsitä
t der
Pro
sozi
alitä
t
Reichweite der Prosozialität
nahe Verwandte
nahestehende Nicht-Verwandte
bekannteGruppenmitglieder
unbekannteGruppenmitglieder
echteFremde
Homo sapiensCallitrichidaeCebusPan
10 vgl. exemplarisch wILsoN 2002, 10ff.11 KoKKo et al. 2001.12 vgl. PeNN & weIssINg 2000, 2411–2418.13 damit wird der ese ausdruck verliehen, dass Life-History,kooperative aufzucht und gruppengröße wechselseitig von -einander abhängen. die von dunbar und anderen vertretene socialbrain hypothesis unterstellt diesbezüglich einen evolutionären druckinnerhalb der menschlichen abstammungslinie, der auf zuneh-mende soziale Komplexität mit zunehmender Hirnkapazität rea-giert haben soll (vgl. exemplarisch duNbar & sHuLtZ 2007).14 Hrdy 2009, 125ff.
beobachtet werden, wie sie die bereits der Verwesung an-heimfallenden Kadaver ihrer verstorbenen Jungen noch ta-gelang mit sich herumtragen.15 aufgrund ihrer signifikantausgedehnten, postnatalen entwicklungsphase – kein nicht-menschlicher Primat weist eine derartige betonung auf –und der extremen Verzögerung der einsetzenden Fruchtbar-keit bei zugleich sehr hoher Kindersterblichkeit, wie sie fürdas Jäger- und sammlerdasein im Pleistozän angenommenwerden muss, sind menschliche Mütter dazu gezwungen,unverhältnismäßig schnell auf einanderfolgend Nachwuchszu bekommen. das ist nur möglich, wenn der alloparentaleanteil bei der aufzucht und Pflege der Nachkommen denvon nichtmenschlichen Primaten deutlich übertrifft.16 beimMenschen ist die transformation der indirekten brutpflegezur direkten brutpflege durch alloeltern – eine art der na-türlichen Kinderbetreuung – zu beobachten.
die empathischen erfordernisse menschlicher brutpflege
My attachment to my children cannot be described as an emotion. ey are part of my identity,
and I am ... incomplete without them.
tuvok zu elani. star trek Voyager, „Innocence“
die urszene menschlicher sozialität ist damit als ein szena-rio sozialer Koordination zum Zweck kooperativer Nach-wuchspflege zu charakterisieren. Menschen wachsen ineinem komplexen gruppennetzwerk auf, in dem das Zu-sammenspiel verschiedenster sozialer akteure über das Über-leben der Kleinkinder entscheidet. obwohl studien die be-deutung der Mutter als primäre bindungsperson undletztlich ausschlaggebende Instanz für die erfolgreiche brut-pflege auch beim Menschen untermauern konnten,17 ver-schiebt sich im Laufe der Life-History das bild zusehends,und die alloeltern (dabei spielt es für mein allgemeines ar-gument keine rolle, ob dies nun hauptsächlich der Vater ist,ausschließlich verwandte Frauen oder eine Kombinationbeider geschlechter) spielen eine immer tragendere rolle.18
Für Neugeborene und auch Heranwachsende bedeutet diesgleichermaßen sozialen stress und perspektivische unsicher-heit, da diese prima facie niemals wirklich sicher sein kön-nen, ob der jeweilige gegenüber – der ja potenziell ständig
18 shumon t. Hussain
wechselt – die jeweils aktuellen bedürfnisse kennt und/oderdas Verhalten der Nachkommen richtig zu deuten weiß. esist für das Überleben also insbesondere kritisch, einen Me-chanismus bereitzustellen, der außerhalb der unmittelbarenFace-to-Face-‘erfahrung’ operiert, wie dies noch bei einereinseitigen maternalen aufzucht möglich war, und gleich-zeitig befürfnisbefriedigungssicherheit gewährleisten kann.ein solcher Mechanismus findet sich in der ungewöhnlichhochentwickelten Fähigkeit moderner Menschen, sozialenakteuren, die ihnen ähnlich sind, mentale Zustände undabsichten zuzuschreiben.
die Interpretation des emotionalen Zustands der Nach-kommen über physisch manifest werdende Mimik, gestikund Handlung in Kombination mit verschiedenen Lautäu-ßerungen verweist direkt auf ein bestimmtes mit diesemZustand assoziiertes bedürfnis oder eine Konfigurationmultipler bedürfnisse. sichere Kenntnis ist auch hier derschlüssel für eine erfolgreiche aufzucht durch basale be-dürfnisbefriedigung. offensichtlich ist die reziproke Fähig-keit, die gedanken und wünsche des anderen zu lesenoder zumindest zu erahnen, eine grundvoraussetzung fürkooperative aufzucht in der Qualität, wie sie menschlichegruppen zu praktizieren pflegen. Nicht nur muss dasKleinkind sensibel auf die bemühungen und anforderun-gen der elterlichen Handlungen reagieren können, die el-tern müssen auch umgekehrt auf die bedürfnisse und emo-tionen des Nachwuchses eingehen. diese wechselseitigesensibilisierung für den jeweils anderen kann als eine art‘koordinative einpendelung’ optimaler reiz-reaktions-schemata für höhere mentale Inhalte verstanden werden.das Kind muss wissen, dass der andere weiß, was es weiß,d. h. momentan benötigt.
eine solche bipolare Konstellation gegenseitigen Verste-hens ist in rudimentären anlagen schon im reich der nicht-menschlichen Primaten zu finden, d. h. auch diese verfügenbereits über eine basale eory of Mind mit entsprechenderMentalisierungsfähigkeit. diesem befund liegt eine einfacheexperimentelle beobachtung bei schimpansen zugrunde, diesich mittlerweile durch zahlreiche Versuche bestätigt hat.wenn zwei der höheren Primaten auf eine wiese gesetztwerden, in der zwei überaus begehrenswerte Früchte ver-steckt sind, nur einer der beiden schimpansen aber beideFrüchte direkt erblicken kann, weil die sicht des anderenauf die zweite Frucht durch eine sichtblockade versperrt ist,dann rennt der erste mit signifikant höherer wahrschein-lichkeit zu genau der Frucht, die beide sehen können.19 einähnlicher Versuch wurde kürzlich von schmelz et al. durch-geführt, der sogar noch etwas weiter geht. die wissenschaft-ler platzierten zwei undurchsichtige bretter auf einem tisch,wobei das eine flach auf den tisch gelegt und das andereleicht schräg positioniert wurde. schimpansen wurden imVorfeld darauf konditioniert, nach einem einzigen Futter-stück zu suchen. Nicht weiter überraschend entschieden sich
15 Hrdy 2009, 100ff.16 vgl. Hrdy 2000 und Hrdy 2002.17 vgl. u. a. wINKINg et al. 2011.18 vgl. exemplarisch sear & MaCe 2008; sear et al. 2002 undsear et al. 2000.19 brÄuer et al. 2007.
warum Menschen empathische wesen sind 19
die tiere in der einfachen Form des experiments nahezuimmer für das schräge brett, weil sie offensichtlich antizi-pierten, dass unter dem flach aufliegenden unmöglich etwasessbares versteckt sein konnte. Interessanterweise ändert sichdiese Präferenz, wenn die situation sich verändert. wird derVersuch mit zwei schimpansen wiederholt, wobei der zweitelediglich sehen kann, dass der erste den Versuchsraum be-tritt, sonst aber durch einen sichtschutz daran gehindertwird, das geschehen im raum zu verfolgen, ändert sich dasVerhalten des ersten schimpansen nicht. auch er präferiertweiterhin das schräg aufliegende brett. der zweite Primatändert seine Präferenzordnung jedoch radikal. schmelz etal. konnten zeigen, dass sich die tiere innerhalb des verän-derten Kontextes hoher Kompetitivität signifikant häufigerfür das flache brett entschieden, was darauf hindeutet, dassschimpansen das wahrscheinlichste Verhalten von artge-nossen in ihre entscheidungsfindung mit einfließen lassen.Mit anderen worten inferieren diese tiere das nahelie-gendste Verhalten von anderen und modifizieren entspre-chend ihre eigene strategie.20,21
Überaschenderweise haben unterschiedlichste Versucheaber mittlerweile überzeugend darlegen können, dass höherenichtmenschliche Primaten, insbesondere schimpansen undbonobos, zwar durchaus über eine höhere soziale Kognitionverfügen, die mit basalen Mind-reading-Fähigkeiten ein-hergeht, diese scheint sich aber ausschließlich auf Kontextezu beschränken, in denen Konkurrenz die ausschlaggebendeentscheidungsfindungsinstanz ist.22,23 dennoch könnte inder „machiavellistischen Intelligenz“ der Menschenaffen –einer art instrumenteller Vernunft zum strategischen Han-deln in Konkurrenzsituationen, die eine minimale eorieder mentalen Zustände anderer voraussetzt,24 – der evolu-tionäre ursprung der komplexeren Formen sozialer Kogni-tion begründet liegen, die den Menschen und seine bezie-hung zum sozial anderen charakterisiert.25 Manipulationist auch in der beziehung von Mutter und Kind eine Moti-vation, die dem Nachwuchs letztlich dazu verhilft, an Nah-rung und Zuwendung zu gelangen. empathie und der Zu-gang zum mental anderen sind – obwohl sie auf Verständnisfußen – immer hochgradig manipulative strategien, auchwenn sie in dem Versuch, den anderen zu manipulieren,sich oftmals selbst manipulieren. Nicht zuletzt darin liegt je-doch die reziprozität der empathie begründet. etwas zuge-spitzt ließe sich empathie damit als ‘Koordination reziprokerManipulation’ fassen.
Im Kontext von Nahrungskonkurrenz haben sich schimpansenin verschiedenen experimenten als außerordentlich raffiniert er-wiesen und sind teils zu ganz erheblichen Mentalleistungen imstande. wenn ihnen bei der suche nach einem einzelnen Nah-rungsmittel ein opakes brett, das flach auf dem boden liegt, undeines, das schief aufgestellt worden ist, präsentiert wird, wählensie signifikant häufiger das schräggestellte, offenbar weil sie schlie-ßen, dass unter dem flachen brett kein Nahrungsstück liegenkann. sCHMeLZ et al. (2011) konnten zeigen, dass schimpansenwissen, dass andere schimpansen das gleiche tun und deshalb insituationen, in denen sie erst nach einem anderen artgenossenauf die suche geschickt worden sind, das flache brett wählen.oben: schematischer aufbau der testsituation. testsubjekt s undsein gegenspieler C befinden sich unerreichbar auf der gegenüber-liegenden seite der Versuchsanordnung. auf einer Plattform zwi-schen beiden befinden sich die beiden bretter 1 und 2, die jeweilseinen Nahrungsmittelgewinn verbergen, und zwar unter dem fla-chen brett in einem Loch liegend. Nachdem C in den raum ge-lassen wird, ist die sicht von s unmittelbar auf die beiden bretterblockiert. C kann im unterschied zu s nicht sehen, dass unterjedem brett ein objekt seiner begierde gelegt wird.unten: die grafik zeigt das primäre ergebnis der studie, in derbei schimpansen eine generelle tendenz dazu besteht, das schräg-gestellte brett zu wählen und („nicht-sozial“-bedingung: „wähltzuletzt“ meint hier lediglich, dass die bretter in die richtung einesmöglichen Konkurrenten gestoßen wurden); wenn ein Konkur-rent deutlich in erscheinung tritt, treffen schimpansen offenbareine klare unterscheidung zwischen „zuerst wählen“ und „als letz-ter wählen“ („sozial“-bedingung). das zeigt, dass schimpansenbereits – zumindest rudimentäre – Mentalisierungsfähigkeiten be-sitzen müssen. (Verändert nach: sCHMeLZ et al. 2011, Figs. 1; 2)
S1
2
C
60
80
100
% w
ähle
n sc
hief
gest
ellte
s B
rett
2
Subjekt wählt zuers
nicht sozial„0
20
40
60
% w
ähle
n sc
hief
gest
ellte
s B
rett
Subjekt wählt zuletzttSubjekt wählt zuers
estbedingungTTestbedingung“sozial„“nicht sozial
20 sCHMeLZ et al. 2011.21 vgl. ergänzend Hare et al. 2000 und CaLL et al. 2004, 488f.22 vgl. byrNe & wHIteN 1988.23 vgl. auch Hare & toMaseLLo 2004.24 vgl. byrNe 1998.25 vgl. dazu graVrILet & Vose 2006.
eines ist jedoch klar. wenn die empathische disponiertheitdes Menschen als eine zweistellige Funktion sozialer Inter-aktion gefasst wird, die ihre wurzeln in der Mutter-Kind-beziehung hat, wie sie schon frühe bindungstheoretiker umbowlby konzeptualisiert haben, thematisiert das einen zen-tralen aspekt der menschlichen Mentalisierung, vermutlichaber nur den basalsten, der vor allem die basisemotionenund -bedürfnisse zu deuten und adäquat genug zu setzenvermag.26 Fraglich bleibt jedoch, wie attachment – so derschlüsselbegriff der entwicklungspsychologie – die komple-xeren Formen der empathie zu erhellen vermag, die bei-spielsweise Fiktion, Imagination und Narration einschlie-ßen. dennoch ist die attachment theory, die mittlerweilebeispielsweise von weingarten und Chisholm weiterentwi-ckelt worden ist,27 der bis dato schlüssigste Versuch, aus derschon sehr früh bei säugetieren evolvierten bindungsbezie-hung zwischen Fürsorger und besorgtem bzw. umsorgtemweitgehende kognitive entwicklungen abzuleiten.
Insbesondere soziale Kognition, so die ese, ist ein Pro-dukt der Notwendigkeiten, die sich aus der engen abhän-gigkeit von Mutter und Kind und deren körperlicher undgeistiger bindung ableiten. deshalb führt sichere bindungzwischen Heranwachsenden und ihren bindungsfoki in derregel ohne Komplikationen zu einer normalen kognitivenund emotionalen entwicklung, wohingegen eine gestörtebindungsrelation häufig auch mit schwerwiegenden men-talen störungen einhergeht. die Kompetenz funktionalersozialkognition wird zu einem wesentlichen anteil imHafen der gesicherten und stressfreien bindungsbeziehun-gen erworben. emotionale Verbundenheit ist für die Nach-wuchsentwicklung ein essentieller Faktor und stellt die basiseiner jeden kognitiven entfaltung dar. Ferner wird schondurch eine intakte empathisierungsrelation in der frühenKindheit der grundstein für sichere soziale beziehungen imerwachsenenalter gelegt.28 daher ist die Zerdehnung derpostnatalen Phase beim modernen Menschen – aber auchschon bei den nichtmenschlichen Primaten – ein Indiz fürdie Intensivierung dieser beziehung, weil aus der Verlänge-rung der Hilflosigkeit bei menschlichen Kleinkindern aucheine stärkere physische und mentale bindung zwischenihnen und ihren Fürsorgern folgt.
diese koevolutionäre Kopplung von Life-History undsozialer Kognition macht deutlich, dass eine rudimentäreeory of Mind vermutlich älter ist als die abstammungs-linie des Menschen selbst. empathie in ihrer basalsten Formist gleichsam ein sehr altes Merkmal innerhalb der Mensch-heitsgeschichte. entscheidend ist jedoch die sukzessive ela-borierung der Mind-Reading-Fähigkeiten, die durch denLife-History-trend einerseits und den trend sozialer orga-nisation andererseits in der menschlichen Lineage ersichtlichwird.29 beim Menschen ist die qualitative auseinanderset-zung der Mutter und einer ganzen reihe von potentiellenalloeltern mit dem Nachwuchs unabdingbar für dessen
20 shumon t. Hussain
Überleben. dabei ist festzuhalten, dass nicht nur eine Kor-relation zwischen der anzahl real verfügbarer alloparentalerunterstützung und erfolgreicher sowie positiver Kindheits-entwicklung festzustellen ist, sondern ebenso zwischen derMöglichkeit einer hohen sensibilisierung der jeweiligen Für-sorger durch psychobiologisch verankerte Mechanismenund einer solchen entwicklung. anzeichen dafür ist die stei-gerung der sensibilität in der Interaktion mit Kleinkindernbei nichtmütterlichen Helfern, beispielsweise bei Vätern,durch hormonelle Veränderungen, die eine art „empathi-schen boost“ leisten und somit die intersubjektive Lückezwischen dem Heranwachsenden und den anderen veren-gen. am häufigsten ist bis dato ein deutlicher rückgang imtestos teronspiegel männlicher alloeltern beobachtet wor-den, der dann auftritt, wenn diese Individuen entweder sehreng mit Müttern zusammenleben oder sich häufig in un-mittelbarer umgebung zu Neugeborenen und Kleinkindernaufhalten.30
die Notwendigkeit einer mentalen Kontaktaufnahmeund Interaktion mit dem Nachwuchs schlägt sich beimMenschen nicht nur in der architektur seines kognitivenapparats, sondern auch in seiner biochemischen Infrastruk-tur nieder. Ich halte es nicht zuletzt deshalb für überauswahrscheinlich, dass sich diese Merkmale evolutionär wech-selseitig verstärkt und herausgebildet haben. was den Men-schen zusammen mit einigen wenigen Neuweltaffen vonden meisten anderen, noch lebenden tieren unterscheidetist also der grad, in dem die soziale einheit, d. h. andere
26 vgl. bowLby 1969; 21982 und bowLby 1984.27 weINgarteN & CHIsHoLM 2009.28 vgl. grIeser & KuHL 1998; eVaNs 2001; JaFFe et al. 2001;greeNsPaN & sHaNKer 2004; FaLK 2005; ParKINsoN et al.2005; gross 2006; aber auch goLeMaN 2006. 29 an dieser stelle gehe ich von einem sukzessiven ausdehnungs-trend der postnatalen Phase von den australopithecinen bis hinzum anatomisch modernen Menschen aus, wie er durch osteolo-gische Funde aus archäologischen Kontexten nahegelegt wird. dieannahme sozialer Komplexitätszunahme beruht auf der social brainHypothese, die eine Korrelation von gehirnvolumen und grup-pengröße postuliert. endocasts, d. h. zerebrale ausgüsse, also Hirn-negative homininer schädelfragmente, zeigen diesbezüglich einenklaren trend der Hirnvergrößerung in der menschlichen Lineageauf. Höhere Mentalisierungsfähigkeiten, so die Hypothese, habensich nicht nur entwickelt, weil das gehirn irgendwann in dermenschlichen evolution die notwendige neuronale Voraussetzungdafür bereitgestellt hat (die Überlegung ist hier schlicht, dass diesmit zunehmendem Volumen wahrscheinlicher ist, wobei insbeson-dere der Neocortex wohl eine besondere rolle spielt), sondern vorallem, weil umgekehrt soziale Parameter wie brutpflege bestimmtekognitive Fähigkeiten triggerten, die wiederum zu einem evolutio-nären druck für die Vergrößerung des Neocortex geführt haben.dieser Pfad resultierte dann entsprechend in sozialer Komplexi-tätszunahme und so weiter. offensichtlich liegt hier eine zirkuläre,koevolutionäre Kopplung vor (s. weiter unten).30 gray et al. 2002.
gruppenzugehörige Individuen in die aufzucht und Versor-gung der Nachkommen eingebunden sind. diese veränder-ten Vorzeichen stellen Neugeborene vor die Herausforde-rung, zu unterschiedlichsten Zeiten an unterschiedlichstenorten mit den unterschiedlichsten Individuen Kontakt auf-zunehmen oder – etwas konkreter formuliert – deren auf-
warum Menschen empathische wesen sind 21
merksamkeit auf sich zu ziehen. deshalb sind menschlicheNeugeborene geradezu experten der Herausforderung vonsituationen geteilter aufmerksamkeit, in dem sie augen-kontakt herstellen und den blicken anderer folgen. wie dieForschergruppe um Michael tomasello in einer reihe vonuntersuchungen überzeugend darlegen konnte, scheint die
die Mutter-Kind-beziehung ist der urkeimdes empathischen, weil sie anforderungenstellt an ein wechselseitiges sich-aufeinan-der-einstellen, die Harmoni sierungs mecha -nismen einfordert und selektiert. In dieserdyadischen beziehung ist die Notwendig-keit eines wechselseitigen emotionalen Ver-stehens evolutionär angelegt. etwa bei derHälfte aller arten aus der ordnung der Pri-maten halten die Muttertiere während derersten Lebensmonate der neugeborenenJungtiere engen Körperkontakt zu diesenund lassen sie kaum aus den augen. beiorang-utans ist die Intimität und Intensi-tät dieser beziehung besonders stark; dieMutter wird das Neugeborene etwa fünf bissechs Monate direkt bei sich am Körper tra-gen und noch bis zu einem alter von etwasieben Jahren an die brust nehmen. (Foto:Kjersti Jørgensen)
beim modernen Menschen ist die aufzucht des Nachwuchses immer eine soziale angelegenheit und betrifft den gesamten gruppen -verband. Mütter sind bei der ‘Kinderbetreuung’ nur in ausnahmefällen ganz auf sich allein gestellt und werden in der regel von ‘alloeltern’unterstützt. die abbildung zeigt eltern der san mit ihren Kindern im Norden Namibias. Zur rolle von Kindern in den gemeinschaftenrezenter Jäger und sammler ist in jüngerer Vergangenheit viel geschrieben worden. schon HewLett (1991) verweist dabei auf die au-ßerordentlich hohe Interaktionsqualität zwischen Vätern und ihren Kleinkindern in diesen gruppen. (Foto: ǂakhoe Hai//om Projekt[http://dobes.mpi.nl/projects/akhoe], mit freundlicher genehmigung)
Fähigkeit der Herstellung von Momenten kollektiver auf-merksamkeit lediglich beim Menschen besonders ausgeprägtzu sein.31 Menschenaffen und nichtmenschliche Primatenim allgemeinen sind vor allem deshalb als autistisch ver-schrien, weil der blickwechsel – auch zwischen Mutter undKind – eine wahre rarität bleibt. weil nichtmenschliche Pri-matenmütter ihren Nachwuchs ohnehin nahezu ununter-brochen am Körper tragen, muss geteilte aufmerksamkeit –insbesondere weil es sich hier um eine bilaterale relation han-delt – nicht erst erzeugt werden. anders verhält es sich na-türlich, wenn potentiell sehr viele bindungspersonen unter-schiedlicher stufen auftreten. soziale Interaktion – das ist diezentrale erkenntnis der letzten Jahrzehnte – ist dabei nichtnur immens wichtig, um die Kohäsionskräfte innerhalb einergruppe zu entfalten und zu erhalten, sondern insbesondereauch für die qualitative aufzucht von Nachkommen, dienoch in hohem Maße hilflos und abhängig sind.
es kristallisiert sich zusehends heraus, dass auch sozialeMechanismen wie Imitation, die vorwiegend andere Funk-tionen erfüllen, dieser Form der Interaktion entlehnt werdenkönnen. das mimetische Nachahmen von vornehmlich aus-gewachsenen Individuen ist bei menschlichen Kleinkindernein integraler bestandteil ihres bemühens um geteilte auf-merksamkeit,32 die eine grundvoraussetzung bestimmterFormen des empathischen Zugangs ist. Menschen achten beiverbaler Kommunikation nicht umsonst stets auch auf dieaugen ihres gesprächspartners. In den augen, so heißt es,„spiegelt sich die menschliche seele“. die spiegelmetapherist dabei erstaunlich präzise, illustriert sie doch treffend dentatbestand eines Fixpunkts der empathisierung über in denaugen manifest werdende emotionen und einstellungen. InKontexten geteilter aufmerksamkeit, die multiple soziale ak-teure umfassen – wie sie also für die menschliche brutpflegeparadigmatisch sind –, gesellt sich zudem die Intentionalität,also die differierenden absichten und Ziele der einzelnen ak-teure, als wichtiger und zur aufrechterhaltung der situationnotwendiger Faktor hinzu. dieser Punkt ist vor allem im be-deutungszusammenhang um die spielerische erfahrung fürdas Menschsein, auf die noch einzugehen sein wird, von be-sonderem Interesse. Hier genügt zunächst die Feststellung,dass komplexe situationen mit mehr als zwei beteiligten ak-teuren, d. h. archetypisch eine dreistellige relation, diegrundfigur jener kooperativen aufzucht sind, die derMensch sich im Laufe seiner evolution zu eigen gemacht hat.
Hrdy nimmt deshalb zu recht an, dass die daraus resul-tierende Integration multipler bindungsfiguren beim moder-nen Menschen notwendig mit der adaptation multipler Per-spektiven und der kognitiven Kapazität, zwischen jenenverschiedenen Perspektiven hin- und herzuspringen, einher-geht.33 dadurch – das ist auch meine ese – gewinnt diekognitive Zuschreibung mentaler Zustände bei anderen eineneue Qualität, weil nicht mehr nur der andere als zunächstIsolierter auftritt, sondern das Moment der differenz stärker
22 shumon t. Hussain
hervorstößt. die berücksichtigung unterschiedlicher Per-spektiven gleicht einer rollenübernahme, in welcher dermögliche Horizont des Mentalisierten als ganzes von bedeu-tung sein kann, nicht mehr nur der jeweils ad hoc zu lesendeemotionale oder mimische ausdruck basaler mentaler ge-halte. die empathische Perspektivenübernahme ist daherstärker von der eigentlichen erfahrung entkoppelt; sie um-geht das regulativ der erfahrung für die erschließung desmental anderen, die noch die auf bilateralen relationen be-ruhende empathie stützt. wie schon breithaupt ganz richtiggesehen hat, ist die Integrationsleistung (sollte dieser Vorgangdamit überhaupt adäquat umschrieben sein) streng genom-men nachgeordnet (insofern ist Hrdy also nicht ganz zuzu-stimmen). entscheidend ist die in ihrer grundverfasstheitdreistellige archeszene der empathie, in der sich ego zwi-schen zwei differierenden Perspektiven entscheiden mussoder, neutraler gesagt, zwischen diesen zu unterscheiden ler-nen muss.34 der Mensch muss in seiner entwicklung unterVerhältnissen der kooperativen aufzucht eine ‘perspektivischeoffenheit’ entwickeln, die es ihm ermöglicht, funktional Par-tei zu ergreifen, um in die rolle des jeweils anderen schlüp-fen zu können.
die transzendierung der eigenen Perspektive ist eng andie Notwendigkeit einer Koordination von absichten, Inte-ressen und bedürfnissen im Milieu hoch kooperativer brut-pflege gekoppelt und ist trotzdem zugleich die wurzel dermenschlichen ultrasozialität, wie ich in den folgenden Kapi-teln plausibel machen möchte. etwas weniger kontrovers ge-sagt, lässt sich beim Menschen eine einzigartige eigendynamikder wechselwirkung zwischen sozialer Kognition und sozia-lität im engeren sinne fassen, die sich gleich einer spirale ge-meinsam nach oben schrauben. wie schon burkart et al. ver-muten, wird in der evolution des menschlichen brutpflege-verhaltens die Vorbedingung der kognitiven evolutiongreifbar, die den Menschen so sehr zum Menschen macht.35
erst das ‘Verstehen’ des sozialen umfelds konstituiert dieForm von ultrasozialität, oder – etwas vorsichtiger formuliert– das soziale Verstehen ist die bedingung der Möglichkeitkomplexer sozialer Verbände mit einer hohen Frequenz per-sonaler Interaktion, welche weit über die Fission-and-Fusion-struktur höherer nichtmenschlicher Primaten, insbesonderevon schimpansen, hinausreicht.36 offensichtlich sind die ur-sprünge der umfassenden empathiefähigkeit des Menschennicht zuletzt in den sich evolutionär verändernden Vorzeichender Nachwuchspflege zu verorten.
31 vgl. u. a. toMaseLLo 2010.32 vgl. exemplarisch HauN & CaLL 2008.33 Hrdy 2009, 184ff.34 breItHauPt 2009.35 burKart et al. 2009.36 vgl. etwas kontrovers gaMbLe et al. 2011.
Paläoanthropologische belege für die evolution der mensch-lichen Life-History
ere comes a time in a man’s life that you cannot know ...when he looks down at the first smile of his baby girl and
realizes he must change the world for her ... for all children.
alidar Jarok zu Picard.star trek tNg, „e defector“
warum Menschen empathische wesen sind 23
die kognitive evolution des Menschen, die zu jenen höhe-ren mentalen Fähigkeiten führen sollte, die uns noch heuteam meisten von anderen lebenden organismen unterschei-det, scheint – wie wir gesehen haben – vor allem an drei Fak-toren evolviert zu sein: (1) kooperativer brutpflege, (2) en-zephalisation und soziale Komplexitätszunahme sowie (3)einer expansion des postnatalen entwicklungsstadiums in-nerhalb der Life-History. die bis dato am besten auflösen-den daten sind für die evolution der Life-History innerhalb
Hirnvolumen ausgestorbener Hominiden (extrapoliert aus der Kapazität des endokraniums) aufgetragen gegen den Zeitpunkt des erstenauftretens der einzelnen taxonomischen ordnungen innerhalb der menschlichen Linie. deutlich wird vor allem der progressive trendzu Vergrößerung des gehirnvolumens während der Homindenevolution. es ist festzuhalten, dass die Qualität dieser expansion starkvon der ‘Klassifikationskörnigkeit’ abhängt. oben: trend bei fein ausdifferenzierter taxonklassifkation, wie sie typisch für kladistische ansätze ist. unten: trend der gehirnexpansion bei grob zusammengefassten taxa. (umgezeichnet nach: robsoN & wood 2008, Figs. 6; 7)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
A
B
C
D
E
F
G
HI
J
K
M
O? R?S? T
L
N?Q?
0 1 2 3 4 5 6 7
Kra
nial
kapa
zitä
t (cm
3 )
Erstauftreten der taxonomischen Ordnung (Mio. Jahre)
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
0 1 2 3 4 5 6
Kra
nial
kapa
zitä
t (cm
3 )
Erstauftreten der taxonomischen Ordnung (Mio. Jahre)
A
B
C
D
E
F G
H
A H. sapiens sapiens n = 66B H. neanderthalensis n = 23C H. heidelbergensis n = 17D H. antecessor n = 1E H. erectus s.s. n = 37F H. rudolfensis n = 3G H. ergaster n = 6H H. robustus n = 2I H. boisei s.s. n = 10J H. habilis s.s. n = 6K P. aethiopicus n = 1L Au. garhi n = 1M Au. africanus n = 8N Au. bahrelghazali O K. platyops P Au. afarensis s.s. n = 4Q Au. anamensis R Ar. ramidus s.s. S O. tugenensis T S. tchadensis n = 1
A H. sapiens s.l. n = 108B H. erectus s.l. n = 43C P. robustus n = 2D H. habilis s.l. n = 9E P. boisei s.l. n = 12F Au. africanus n = 8G Au. afarensis s.l. n = 4H Ar. ramidus s.l. n = 1
der gattung Homo verfügbar. dennoch scheint das szenarioinsgesamt überaus vielschichtig zu sein, und jede eindimen-sionale beschreibung muss simplifizierend bleiben. robsonund wood konnten zeigen, dass in der menschlichen Li-neage ein klarer trend hin zu einer verzögerten Life-Historyzu beobachten ist.37 schon die Life-History-Parameter vonHomo erectus weisen zwar auf eine einsetzende Zerdehnungder postnatalen entwicklungsphase hin, zeigen aber nochkein mit anatomisch modernen Menschen vergleichbaresMuster auf. erst mit dem taxonomischen Komplex umHomo heidelbergensis erreichen menschliche Vorfahren einProfil, das mit dem des modernen Menschen zu vergleichenist. obwohl das Feld von teils kontroversen debatten überdie auslegung und Interpretation – dabei geht es vor allemum Fragen der Variabilität der vorliegenden daten innerhalbder spätpleistozänen Klasse um Homo heidelbergensis, Homoneanderthalensis und Homo sapiens – geprägt ist,38 deutetsich zusehens an, dass auch dort wichtige entwicklungen zubeobachten sind. die evolution der Life-History und diedamit assoziierten sozialen einschnitte sind also nicht schonbei prämodernen Menschen vollständig abgeschlossen. Ichwerde mich hier vor allem mit den – aus meiner sicht be-deutenden – entwicklungsdifferenzen zwischen Neanderta-lern und modernen Menschen auseinandersetzen.
Für eine möglichst fein auflösende rekonstruktion vonLife-History-Profilen an fossilen resten hat sich vor allemdie analyse prähistorischer Zähne verdient gemacht. an-hand von Zahnschmelzuntersuchungen ist es mittlerweilemöglich, einzelne wachstumsschübe zu identifizieren unddamit auf die wahrscheinliche wachstumsgeschwindigkeitzu schließen. dabei treten grundlegende unterschiede inder gestalt des alterns im Vergleich zwischen Neandertalerund modernem Menschen auf, die nicht ausschließlich aufIntraklassenvariation zurückgeführt werden können. die er-gebnisse legen jedenfalls ein beschleunigtes Zahnwachstumnahe, welches auf eine im Vergleich zum modernen Men-schen beschleunigte Überbrückung der postnatalen ent-wicklungsphase verweist.39 obwohl der Neandertaler bereitsüber eine stark verzögerte Life-History verfügt, scheint er imdirekten gegenüber moderner Menschen noch auf einschnelleres erreichen der geschlechtsreife angewiesen zusein. smith et al. konnten in einem Vergleich mittelpaläoli-thischer reste juveniler Neandertaler und juveniler sapien-ten einen signifikant früheren eintritt ersterer in die repro-duktionsreife nachweisen. die dentale Mikrostruktur weisezwar insgesamt ebenfalls auf eine ausdehnung der entwick-lungsphase hin, diese sei jedoch nicht mit der anatomischmoderner Menschen vergleichbar.40 dieses resultat ist so-wohl mit den befunden zur Morphologie des geburtska-nals41 als auch mit denen zur Hirnentwicklung konsistent,und so gesehen verhältnismäßig robust.
da Neandertaler über ein insgesamt größeres gehirn-volumen verfügten, anhand der gestalt des geburtskanals
24 shumon t. Hussain
aber deutlich wird, dass diese mit vergleichbaren Voluminawie anatomisch moderne Menschen gleicher Zeithorizontegeboren wurden, ist auch ein erhöhtes Investment in die ge-hirnentwicklung von Nöten. Ponce de Léon gelang auf dergrundlage der Neandertalerüberreste eines neonaten Indi-viduums aus der Mezmaiskaya-Höhle in russland undzweier juveniler Individuen aus der derderiyeh-Höhle in sy-rien der Nachweis einer schnelleren ausbildung des rest-hirnvolumens als bei modernen Menschen.42 obwohl dieserbefund noch als ambivalent einzuordnen ist, zeigten auchgunz et al. durch die virtuelle rekonstruktion der schädel-morphologie beider Menschenformen mit statistischen Ver-fahren, dass grundsätzlich andere entwicklungspfade bei derHirnentwicklung zugrundliegen. während Neandertalerauch in der entwicklung des gehirns eine längliche, elon-gierte Formausbildung betonen, ist bei Homo sapiens eine„globularisierungsphase“ zu beobachten, die beim Nean-dertaler vollständig fehlt.43 dieser wichtige entwicklungs-schritt führt beim modernen Menschen zur ausbildung dercharakteristischen, globusartigen schädelform, die wohl vorallem deshalb mit mehr Investment und damit einer länge-ren ausbildungsdauer verbunden ist, weil in diesem stadiumhauptsächlich parietale und frontale bereich der zerebralenLappen entwickelt werden. die expansion dieser bereichedes Neokortex ist offenbar mit einem signifikant höherenenergieaufwand verbunden. es kommt nicht von ungefähr,dass gerade diese Hirnareale mit höheren kognitiven Funk-tionen assoziiert sind – darauf wird später noch einzugehensein. Hervorzuheben ist an dieser stelle die Kopplung vonLife-History und Enzephalisation, die offenbar ein graduellesMaß sozialer organisation ist. sozialität scheint dabei die ent-scheidende triebkraft hinter der Vergrößerung der Hirnvolu-mina zu sein.44 Freilich ist die Zerdehnung der postnatalen
37 robsoN & wood 2008.38 vgl. exemplarisch guateLLI-steINberg 2009.39 vgl. raMIreZ-roZZI & berMudeZ de Castro 2004; sMItHet al. 2007.40 sMItH et al. 2010.41 weaver und Hublin konnten mit der virtuellen rekonstruk-tion des geburtskanals eines weiblichen Neandertalers aus tabunzeigen, dass Neandertaler zwar ebenfalls über einen kompliziertengeburtsvorgang verfügten, deren geburtskanalmorphologie aberals deutlich archaischer zu bewerten ist. damit erhärtet sich dieese, dass Neandertaler und anatomisch moderne Menschenauch in der evolution der geburtsphase unterschiedliche Pfadeeingeschlagen haben. diese divergenz vollzog sich offensichtlicherst sehr spät in der menschlichen entwicklungslinie und stütztdamit Überlegungen, die einen signifikanten einschnitt in derInteraktion mit dem Nachwuchs erst beim modernen Menschennahelegen (weaVer & HubLIN 2009).42 PoNCe de LéoN et al. 2008.43 guNZ et al. 2010.44 sHuLtZ & duNbar 2010.
warum Menschen empathische wesen sind 25
die Hirnschale von anatomisch modernen Menschen weist eine entscheidende gestaltvariation im Vergleich zu Neandertalern, Homi-niden und nichtmenschlichen Primaten auf: sie ist globular und nicht langgezogen. bis vor kurzem war unklar, wann genau in der ontogenese sich diese spezifische Morphologie manifestiert und welche kognitiven Implikationen sich damit verbinden. guNZ et al.(2012) konnten jüngst zeigen, dass sich diese Veränderungen vermutlich bereits in einem sehr frühen stadium der ontogenese vollziehenund zu einer erheblichen reorganisation von temporalem und parietalem Lappen beim modernen Menschen führen.
oben: Hauptkomponentenanalyse der verwende-ten Individuen (adult: rote Fläche; juvenil/neu -geboren: rot umrandete blasen). der gepunkteteblaue Pfeil zeigt die erwarte Position eines neu -geborenen Neandertalerkinds, wenn angenommenwird, dass das entwicklungsmuster mit anatomischmodernen Menschen übereinstimmt. Keiner derneugeborenen Neandertaler (insbesondere LeMoustier 2 und Mezmaiskaya) liegt in diesem be-reich. unten: Hauptkomponentenanalyse der Hirnscha-len von schimpansen (grün), Neandertalern (rot)und modernen Menschen (blau) im gestalt-raum.die entwicklungsmuster der drei Klassen fallendeutlich auseinander. obwohl die neugeborenenNeandertaler sehr nahe bei denen von anatomischmodernen Menschen liegen, finden sich die adul-ten Individuen deutlich außerhalb der adulten sapienten. guNZ et al. (2012) interpretieren diesebeobachtung als Konsequenz einer schnellerenHirnontogenese beim Neandertaler, dem die fürden modernen Menschen charakteristische Ver -zögerung der Hirnentwicklung in der sog. globu-larisierungsphase fehlt.(Verändert nach: guNZ et al. 2012, Figs. 7; 8)
RdM = Roc de Marsal
LeM = Le Moustier
Mez = Mezmaiskaya
Phase, die so kennzeichnend für Homo sapiens ist, eine un-mittelbare Folge dieses evolutionären trends innerhalb dergattung Homo. wenn sich die gehirnkapazität erweitert,muss sich auch der geburtskanal entsprechend anpassen– bis zu einer bestimmten strukturell festgelegten Limitie-rung. wenn diese erreicht ist, kann das gehirn nicht mehrim Mutterleib mehr oder weniger vollständig ausgebildetwerden, seine entwicklung muss vielmehr externalisiertwerden. die ‘externalisierung der gehirnausbildung’ istsomit eine unmittelbare Folge sozialer elaborierung undwird in der Infrastruktur der Life-History, d. h. in der ex-pansion des präadulten entwicklungsstadiums manifest.soziale elaborierung lässt sich damit heuristisch über Life-History-Verschiebungen erschließen. weil sich enzephali-sation im Laufe der menschlichen evolution über die prä-modernen Menschen hinweg beschleunigt,45 zugleich abereine rasante ‘entschleunigung’ des alterns zu konstatierenist, wird eine neue Qualität der sozialität beim modernenMenschen ersichtlich. diese ultrasozialität erfordert – wiebereits deutlich wurde – bestimmte psychokognitive Vor-bedingungen und/oder geht mit einer kognitiven elabo-rierung einher. auch wenn diese kognitive elaborierungprinzipiell als Kontinuum zu verstehen ist, d. h. als sukzes-sive entwicklung von den ersten Frühmenschen, den aust-ralopithecinen, über den Neandertaler bis hin zum anato-misch modernen Menschen, erreicht diese bei letzteremeine neue ebene, die die kognitive Kapazität in nie dage-wesener weise beflügeln sollte.
Irgendwann zwischen etwa 150 000 und 50 000 bPschlugen erste anatomisch moderne Menschen einen evo-lutionären Pfad ein, der über bis dato nicht zu beobach-tende sozialstrategien zu einer ausbildung außergewöhn-licher Mentalfähigkeiten führen sollte, die qualitativeinzigartig sind und damit als differentia specifica Kriteriumtaugen. Neokortikale Funktionen, vor allem komplexereFormen des Lesens mentaler Zustände anderer – empathiein elaborierter Form – treten dabei in den Fokus der ent-wicklungen. Zwar konnten noch keine ‘Nachweise’ ausneuropaläoanthropologischen analysen für diese ese er-bracht werden, aber es liegen einige schlagende Indizienvor, die mit ihr nicht nur konsistent sind, sondern dieese von der emergenz einer empathiefähigkeit neuerQualität überzeugend stützen.
26 shumon t. Hussain
Neurologische Implikationen einer verlängerten Präado-leszenz
It’s a funny thing about being a parent. ere aren’t any tech manuals, no quick read-outs
to get you through the next set of variables. You’ve just got to wing it from day to day ... .
Kyle river zu will riker.star trek tNg, „e Icarus Factor“
bildgebende Verfahren weisen zur Zeit darauf hin, dass hö-here Mentalisierungsfähigkeiten, d. h. solche, die gemein-hin mit Mind-reading assoziiert werden, im vorderen be-reich des menschlichen gehirns zu verorten sind. Vor allemder Neokortex und die präfrontalen regionen des gehirnswerden bei diesen höheren Funktionen offensichtlich akti-viert.46 daher ist stark anzunehmen, dass die ausbildung die-ser areale im Verlauf der menschlichen evolution mit einerelaborierung empathischer Fähigkeiten zu korrelieren ist. Fos-sile Hinterlassenschaften dokumentieren jedenfalls, dass dieVergrößerung des vorderen gehirnbereichs, insbesondere derNeokortex steht dabei im Zentrum der neuronalen Verän-derungen, eine verhältnismäßig späte erscheinung ist, d. h.erst sehr spät in der menschlichen entwicklungsgeschichteauftritt.47 aber auch hier ist Vorsicht geboten. die relativegröße zerebraler regionen mag zwar einen Hinweis aufprozessuale Vorgänge geben, kann jedoch nicht hinreichen-des argument für die existenz oder Nicht-existenz be-stimmter neuronaler Strukturen sein. was jeweils im gehirnvorgeht, ist immer noch primär eine Funktion der innerenVerschaltung und Interaktion, und nicht so sehr eine Funk-tion der Morphologie.48 daher ist umso bemerkenswerter,dass gunz et al. kürzlich zeigen konnten, dass nicht nurunterschiedliche entwicklungsgeschwindigkeiten bei derHirnausbildung von modernen Menschen und Neander-talern vorliegen, sondern dass diese offensichtlich auch miteiner völlig andersgestaltigen Neuronalstruktur einher-geht.49 es konnte dargelegt werden, dass Neandertaler eineim Vergleich zum anatomisch modernen Menschen deut-lich beschleunigte gehirnentwicklung aufweisen, welcheals starkes Indiz für eine verkürzte präadulte Lebensphasegelten muss. die Verschiebung der Life-History, vor allemdie Verlängerung des hochabhängigen Lebensabschnitts biszur geschlechtsreife, beim modernen Menschen resultiertin einer anreicherung der parietalen gehirnregionen, inder sog. globu larisierung. diese Veränderungen im Parie-tallappen deuten neurologisch auf eine prozessuale diffe-renz der beiden Menschenformen hin. Im Vergleich zumNeandertaler weist Homo sapiens scheinbar ein Fast-Speed-Processing auf, d. h. eine deutlich verbesserte Verarbeitungs-geschwindigkeit, die auf eine Verdichtung im neuronalenNetz hindeutet.
45 vgl. exemplarisch bruNer et al. 2003; rIgHtMIre 2004;tartareLLI 2006.46 vgl. exemplarisch sINger & LaMM 2009 und deCety &JaCKsoN 2004.47 vgl. exemplarisch aIeLLo & duNbar 1993, 188; JerIsoN2007; bruNer et al. 2003.48 vgl. u. a. westerMaNN et al. 2007.49 guNZ et al. 2010.
das menschliche gehirn – und das ist wohl eine der zen-tralsten erkenntnisse der Kognitionswissenschaft – ist einehochkomplexe struktur mit einer Vielzahl emergenter ei-genschaften, welche nicht reduktiv auf einzelne neuronaleKomponenten und deren Zusammenwirken zurückgeführtwerden können, sondern vielmehr in komplexen interakti-ven wechselwirkungen und Feed-back-schleifen als ‘neue’eigenschaften entfaltet werden. dementsprechend ist eineVeränderung in der Neurostruktur immer qualitativ zu wer-ten, sprich als Veränderung der ‘gesamten’ struktur undihrer eigenschaften und Charakteristika (dabei spielt es dannkeine rolle wie „klein“ die Veränderung ist). diese einsich-ten führen zu einem kognitiven szenario, das auf der tatsa-che der Interkonnektivität von Parietal- und Frontallappensowie auf der elaborierung der frontoparietalen Verknüp-fung fußt und in der Herausbildung höherer gehirnfunk-tionen resultiert. unterschiedliche entwicklungsprofile desgehirns bei Neandertaler und anatomisch modernemMensch haben offensichtlich neuronale Konsequenzen, dienicht zu unterschätzen sind. Vieles deutet darauf hin, dassdie evolutionäre elaborierung der frontoparietalen gehirn-regionen bei Homo sapiens zur elaborierung der in diesenbereichen verortbaren gehirnfunktionen geführt hat. dieseFunktionen sind – das zeigen unzählige studien – vor allemmit Mentalisierung und sozialisierung verknüpft. In derLife-History-Verschiebung wird damit sehr wahrscheinlichauch eine Veränderung, vielleicht gar eine reorganisation inder ‘architektur der empathie’ manifest.
Interessant ist auch hier die tatsache, dass die expan-sion der neokortikalen Hirnareale evolutionär gesehenebenfalls hauptsächlich durch soziale Faktoren getriggertwird.50 diese annahme geht auf beobachtungen bei nicht-menschlichen Primaten zurück, bei denen unterschiedeim sozialverhalten mit unterschieden im Neokortex kor-reliert werden konnten. es zeigte sich, dass diese bereichedes gehirns insbesondere dann besonders stark ausgebildetsind, wenn die tiere mit komplexeren sozialen Herausfor-derungen konfrontiert sind, d. h. über einen größerengruppenumfang, der stärkere Kohäsionskräfte wie inten-siviertes Grooming erfordert,51 und elaboriertere Fortpflan-zungssysteme52 ebenso verfügen wie über erhöhte Intra-gruppenkonkurrenzraten. diese Herausforderungen sind,wie erwähnt, vor allem bei schimpansen und bonobos anstrategien der sozialen Manipulation gekoppelt.53 byrneund Corp konnten diesbezüglich nachweisen, dass insbe-sondere der grad „machiavellistischer Intelligenz“ beinichtmenschlichen Primaten ein ausgezeichneter Prädiktorfür die größe des Neokortex relativ zur Körpergröße ist.54
auch dort offenbart sich also eine koevolutive Kopplungvon sozialen Variablen und neokortikaler entwicklung, diemit höheren mentalen Fähigkeiten, insbesondere mit ela-borierter toM-Kapazität und empathiebegabung, einher-geht.
warum Menschen empathische wesen sind 27
dunbar’s Hypothese des „social brain“ erklärt die Zunahme des ge-hirnvolumens, insbesondere der Neokortexgröße, im Verlauf der Ho-minidenevolution mit einer Komplexwerdung sozialer gruppen undden daraus resultierenden Notwendigkeiten, soziale relationen zuregulieren und zu initiieren, um die gruppenkohäsion zu garantie-ren. die gute Korrelation beider Parameter verleiht dem argumenterhebliches gewicht. evolutionär scheint die ausdifferenzierung dessozialen demnach an eine elaborierung der Mentalisierungs- undManipulations fertigkeiten gekoppelt zu sein. oben: gruppengrößenvorhersage ausgestorbener Hominidenund moderner Menschen nach der social-brain-Hypothese gegendie Zeit.unten: erreichbarer Level der Intentionalität von Hominiden -populationen gegen die Zeit. die untere horizontale Linie markierteine rudimentäre Mentalisierungskapazität, wie sie typisch fürschimpansen ist, wohingegen die obere Horizontale elaborierteund komplexe Mentalisierung anzeigt (Intentionalität 4. stufe).als Proxy dient vor allem die größe des frontalen Lappens, in demdiese Hirnfunktionen lokalisiert werden können. (Verändert nach: duNbar 2003, Fig. 2 auf der datenbasis von aIeLLo & duNbar 1993 und duNbar 2003, Fig. 4)
Bandbreite modernerMenschen
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Gru
ppen
größ
e (A
nzah
l Ind
ivid
uen)
0,5 1,5 2,5 3,5
Millionen Jahre
Bandbreite modernerMenschen
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Err
eich
bare
s In
tent
iona
lität
slev
el
Millionen Jahre0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
Homo sapiensHomo neanderthalensis
Homo erectus s.l.„Archaic“ sapiens
Australopithecus s.l.Homo habilis s.l.
50 vgl. u. a. tartareLLI 2006, 323f.51 duNbar 1992; 1993; 1995; 1998.52 sawaguCHI & Kudo 1990.53 byrNe & wHIteN 1992.54 byrNe & CorP 2004.
I.3 sPIegeLNeuroNe, soZIaLes LerNeN, MIMetIK uNd eMPatHIe
die Pädagogik der empathie
ose ’best qualities of humanity’ you talked about aren’t a simple matter of genetics. Love ... conscience ...
compassion ... they’re attributes that mankind has developed over centuries, values that have passed from
one generation to the next, taught by parents to their children.Creating a new kind of Q is a noble idea.
But it will take more than impregnating someone and walk-ing away. If you want your offspring to embrace your ideals,
you’re going to have to teach them yourself.
Janeway zu Q.star trek Voyager, „e Q and the grey“
In den letzten Jahrzehnten ist die bedeutung von Lernprozes-sen und deren soziale dimension verstärkt in den blickpunktder anthropologie geraten. es ist zusehends erkannt worden,welche zentrale rolle das Lernen in der Formung der mensch-lichen ontogenese, der individuellen entwicklungsgeschichte,spielt und wie wichtig die spezifische typologie menschlichenLernens für die Frage nach dem was des Menschseins ist –nicht zuletzt für das Verständnis der menschlichen Kogni-tion.55 bereits die arbeiten von stern über die bedeutung vonempathie in der Kindheit betonen die rolle von ‘empathi-schem attunement’ in frühem Lernen, emotionaler entwick-lung und sozialisation. In seiner attunement theory formuliertstern die Notwendigkeit einer synchronisierung von Mutterund Kind als grundvoraussetzung einer positiven entwick-lung der Heranwachsenden.56 die Harmonisierung der dya-dischen Mutter-Kind-beziehung ist, wie schon an andererstelle angedeutet, notwendig, um der Mutter oder allgemeinerdem Fürsorger zu ermöglichen, sich auf den Nachwuchs ein-zustellen, da der sich nur über Laute, bewegungen undMimik ausdrücken kann. Mütter und Fürsorger, die ein sen-sibles empathisches attunement entwickeln, können sich be-sonders gut in die Nachkommen einfühlen und ihre bedürf-nisse erspüren, woraufhin diese mit Zufriedenheit antworten.In diesem sinne schließt sich der Kreis, weil sowohl Fürsorgerals auch umsorgter wechselseitig bedürfnisbefriedigung er-fahren: das Kind durch die befriedigung seiner realen physi-schen und emotionalen bedürfnisse, die Mutter durch ihr in-ternalisiertes bedürfnis, emotionale genugtuung zu erfahren.ein tatbestand, der insbesondere durch den attachment-Me-chanismus sichergestellt wird. empathisches attunment sorgtalso dafür, dass die Mutter und/oder die alloeltern gut aufden Nachwuchs eingestellt werden, dass beide als eine art so-ziale einheit funktional wirksam sind.
eine ganze reihe von entwicklungspsychologischen stu-dien offenbart das spezifische bedürfnis von menschlichen
28 shumon t. Hussain
Kindern, die geradezu darauf programmiert zu sein scheinen,in Interaktion mit anderen und der umwelt, insbesondereder sozialen umwelt, zu treten.57 die art und weise, in derdie emotionen und Handlungen der Nachkommen von an-deren reflektiert und gespiegelt werden, wirkt sich auf die artund weise aus, wie mentale gehalte der emotionalität vonHeranwachsenden internalisiert werden. stern hat das Milieuder menschlichen ontogenese, das wesentlich durch Lernvor-gänge geformt wird, deshalb als „domain of intersubjectiverelatedness“ bezeichnet.58 repacholi und Meltzoff gelang erstkürzlich der Nachweis, dass menschliche Nachkommen ins-besondere durch „emotionale abhöraktionen“ lernen unddass deren Verhalten danach stark von der einstellung der In-dividuen, welche die träger dieser emotionen waren,abhängt.59
empathie in diesem sinne ist als sozialkitt, als sozialerKlebstoff, zu verstehen, der sich vor allem im Milieu hochko-operativer aufzucht des Nachwuchses entfaltet und das Ver-halten der einzelnen sozialen akteure aufeinander abstimmt,d. h. letztlich reguliert. empathie hat eine gar nicht hochgenug einzuschätzende pädagogische Funktion. Lernen ist vorallem in den Kontexten besonders erfolgreich, in denen dieLehrenden mit den Lernenden eine emotionale und empa-thische beziehung eingehen. der positive Zusammenhangvon kindlichem Lernerfolg und der Qualität der Lehrer-Kind-relation stützt diese annahme.60 die Qualität dieser bezie-hung und ein intaktes soziales umfeld werden nicht zuletztdurch eine empathische sensibilisierung der einzelnen sozialenakteure gewährleistet. empathie stellt einen kognitiven Me-chanismus bereit, der soziale Lernprozesse nicht nur erleich-tert, sondern in ihrer effizienz gleichsam maximiert. dieserFaktor spielt, wie noch gezeigt werden wird, eine nicht unter-geordnete rolle in der anthropogenese, insbesondere in dereigentümlichen dynamik menschlicher Kulturentwicklung.
die mimetischen Voraussetzungen des sozialen Lernens
A mother shapes her child in ways she doesn’t even realize.Sometimes just by listening.
guinan zu dr. beverly Crusher.star trek tNg, „evolution“
Menschliche Nachkommen sind in einer weise kognitiv anihre soziale umwelt angepasst und/oder entwickeln im Laufeihrer ontogenese soziale Fertigkeiten, die es ihnen erlauben,sich in dieser umwelt überhaupt zurechtzufinden, wie es bisdato im reich der nichtmenschlichen tiere noch nicht beob-achtet wurde.61 Menschen werden jedoch nicht mit einer artanthropologischem Paket oder ähnlichem geboren, sonderneignen sich die meisten ihrer Kernkompetenzen im Laufe ihrerindividuierten ontogenese erst an. der Mensch ist, wie schon
von gehlen formuliert, das „nichtfestgestellte“ tier. einwesen, welches nach der geburt noch ganz entscheidend ge-formt wird.62 streng genommen endet diese individuelle For-mung erst mit dem tod, ist jedoch im postnatalen entwick-lungsstadium bis zur geschlechtsreife am prägendsten. diePlastizität des Menschseins ist und war schon immer die ei-gentliche wurzel der enormen Variabilität menschlichen Han-delns und denkens. Lernen ist die grundlegende Kategorie,durch die diese Plastizität formatiert wird. als elementarsteForm des lernenden In-der-welt-seins muss das schlussfolgernaus unmittelbaren erfahrungen gelten, welches einem ex posttry-and-error-Lernen evolutionärer Prägung am nächstenkommt. Jene Kategorie innerhalb einer typologie des Lernensaber, die für Homo sapiens seit jeher die zentralste war, ist dasLernen durch soziale stimuli, das angeleitete oder zumindestindirekt angeleitete Lernen durch soziale akteure – kurz: dassoziale Lernen. soziales Lernen ist zwar ebenfalls erfahrungs-lernen, aber eines, das nicht lediglich als kontingenter Vorgangvon Versuch und Fehlervermeidung beschrieben werden kann,sondern einen Mechanismus beinhaltet, der direkt aus den be-obachtungen in der sozialen umwelt Handlungsanweisungenableitet und in das eigene Verhalten integriert. soziales Lernenist auf den Mechanismus des Nachahmens angewiesen.
Lange Zeit wurde in der debatte um die soziale trans-mission von Information über die generationen hinweg Imi-tationslernen und emulationslernen unterschieden. Manglaubte, anhand dieser differenzierung im Lernverhalten sig-nifikante unterschiede zwischen Menschen und Menschen-affen aufzudecken. wohingegen schimpansen und andere hö-here nichtmenschliche Primaten über ein zielorientiertes Lern-konzept verfügen sollten, eines, das vom ergebnis einerbeobachteten Handlung motiviert wird und dieses ergebnisohne explizite bzw. notwendige bezugnahme auf den zu-grundliegenden Lösungsweg zu replizieren versucht, solltebeim menschlichen Lernen auch ein Kopieren der Modalitä-ten des Zum-Ziel-Kommens vorliegen.63 auf diese weise, sodie Hypothese, sind Menschen zu prinzipiell komplexeremLernen in der Lage, weil der schlüssel zur aneignung vonkomplizierteren Vorgängen sehr viel schneller durch stupidereplikation des g e s amten Vorgangs erreicht wird als durchden Versuch einer replikation des resultats mit eigenen stra-tegien. es hat sich gezeigt, dass diese dichotome differenzdem tatbestand nur unzureichend gerecht wird. wie so oftist auch hier stets ein Kontinuum zwischen Imitation undemulation anzunehmen. whiten et al. konnten nicht zuletztanhand sog. ghost-experimente – experimente, in denenzwar bewegungen, die zu bestimmten motivierenden ergeb-nissen führen, beobachtet, aber keinem akteur zugeschriebenwerden können – nachweisen, dass auch schimpansen letzt-lich auf einen Minimalanteil an Imitation innerhalb des Lern-prozesses angewiesen sind.64 die Primaten scheiterten ent-sprechend beim Versuch einer reproduktion einfacher auf-gaben, wenn kein ausführender sichtbar war. dennoch
warum Menschen empathische wesen sind 29
konnte auch gezeigt werden, dass nichtmenschliche Primatenim unterschied zu menschlichen Kleinkindern selektiv aufemulation zurückgreifen, wohingegen letztere zur Über-Imi-tation neigen. ebenso wie der anteil mimetischen Lernensbei nichtmenschlichen Primaten bis dato offensichtlich un-terschätzt worden ist, trifft dies für die Intensität und dengrad des Imitationslernens bei Kleinkindern zu. die mime-tische Kapazität menschlicher Nachkommen ist jedenfallsnach wie vor als qualitatives Merkmal einzustufen. sozialesLernen, das in der spielart einer Über-Mimetik nur beimMenschen vorkommt, ist immer eine intersubjektive undtransindividuelle angelegenheit. die Plastizität und Nicht-Festgestelltheit menschlicher Nachkommen wird deshalb ganzentscheidend von der imitierenden Interaktion mit anderenIndividuen innerhalb der sozialen einheit überformt.
welcher Mechanismus aber erlaubt diese Form der Über-Imitation? ganz offensichtlich ist es nämlich nahezu unmög-lich, in der regel fehlerfrei nachzuahmen, ohne über entspre-chende, automatisierte anlagen zu verfügen; der Nachah-mungsvorgang verschiebt sich deshalb oft ganz natürlich hinzum emulationsvorgang. soziales Lernen – das ist die Hypo-these, die sich aus dem bisher erörterten sachverhalt ableitet– ist beim Menschen ein über-imitatives, weil Homo sapiensim Verlauf der anthropogenese sowohl bis dato nicht dage-wesene neuronale Imitationsgrundlagen evolviert hat, als auchmit einem sozialen Milieu fertig werden musste, das für eineerfolgreiche Nachwuchsaufzucht nicht nur die Notwendigkeiteines reziproken, empathischen aufeinander-einstellens be-deutete, sondern auch die Herstellung von situationen geteil-ter aufmerksamkeit erforderte. Mimesis ist nicht zuletzt einetechnik, diese szenarien geteilter aufmerksamkeit zu initiie-ren. Imitationslernen hat also auch eine soziale Funktion, dieein stück weit von dessen inhaltlichen errungenschaften ent-koppelt ist.65 Imitation spielt zudem eine wichtige rolle inder Herstellung von gruppenhomogenität, ist jedoch auchein grundlegender baustein in der autonomwerdung unddiskretwerdung von sozialen einheiten.66 Ich werde auf die-sen sachverhalt an anderer stelle nochmals zurückkommen.
55 vgl. exemplarisch toMaseLLo 2002 und boesCH & toMa-seLLo 1998.56 vgl. sterN 1985; 1997.57 vgl. zusammenfassend arNoLd 2005.58 sterN 1985, 27.59 rePaCHoLI & MeLtZoFF 2007.60 vgl. o’CoNNor & MCCartNey 2007.61 vgl. HerrMaNN et al. 2007.62 vgl. geHLeN 1997.63 vgl. exemplarisch toMaseLLo et al. 1987.64 wHIteN et al. 2009a.65 vgl. exemplarisch uZgIrIs 1981.66 vgl. CarPeNter 2006.
die neuronalen grundlagen des verstehenden Lernens
... It is always good to understand one’s adversary in any negotiation.
anthwara zu Picard.tar trek tNg, „Journey’s end“
der Mensch verfügt über einen hochkomplexen neuronalenapparat zur erfassung und Verarbeitung sozialer Vorgängebei anderen – das spiegelneuronensystem.67 spiegelneuroneoperieren auf der basis der menschlichen sensomotorik,d. h. zunächst einmal auf der grundlegenden Fähigkeit,Handlungen, die in motorische Prozesse eingebettet sind,sensual zu beobachten – hier spielt vor allem die ‘visuelle’beobachtung die entscheidende rolle. das spiegelneuro-nensystem involviert einen Mechanismus, der in der Lageist, den beobachteten akt mitzuvollziehen. genau genom-men handelt es sich um einen präreflexiven ‘Nach’ -vollzug des beobachteten akts, und zwar indem ein sehrähnlicher neuronaler Zustand erzeugt wird wie er bei dem-jenigen vorliegt, der visuell beobachtet wird. dadurch wirdes möglich, die Handlungen des anderen zu ‘verstehen’.68
Letztlich wird alterität durch die replikation mentaler Zu-stände, die nicht in ego selbst verortet sind, zugänglich ge-macht. der mimetische Mechanismus, der diesem Vorgangzugrundeliegt, kann daher als ‘neuronale Imitation’ beschrie-ben werden.69 Nicht nur Handlungen können auf dieseweise nachvollzogen und damit einem Verständnis näher-geführt werden, sondern offensichtlich ebenso emotionen.70
das spiegelneuronensystem ist, etwas überspitzt formuliert,das neuronale Korrelat der menschlichen Imitationsfähig-keit.71 Zumindest jedoch dessen Voraussetzung. Möglicher-weise ist aber, und das soll hier als Hypothese vorgeschlagenwerden, weit mehr anzunehmen. das system spiegelneuro-naler replikation ist phylogenetisch wohl sehr alt und trittspätestens bei den Primaten auf – am besten untersucht istes bei Makaken. trotzdem sind, rein neuronal gesehen, er-hebliche unterschiede festzustellen. der menschliche spie-gelmechanismus scheint evolutionär sehr viel weiter entwi-ckelt und an sehr viel komplexere aufgaben angepasst zusein als dies noch bei nichtmenschlichen Primaten der Fallist. de waal und Preston haben deshalb ein stufenmodellder empathie vorgeschlagen, welchem die elaborierungjener bereiche des Neokortex zugrundliegt, in denen auchdie spiegelneurone zu verorten sind.72 die ausbildung die-ser bereiche des gehirns ist, wie bereits deutlich gemachtwurde, menschheitsgeschichtlich möglicherweise sehr jungund zudem mit Verschiebungen innerhalb der Life-Historyebenso wie dem auftreten des anatomisch modernen Men-schen, Homo sapiens, in einem Zeitraum zwischen 150 000und 50 000 bP zu korrelieren. gepaart mit der Fähigkeit,mentale Zustände nicht nur adäquat zuzuschreiben, sondern
30 shumon t. Hussain
zugrundeliegende emotionen und Handlungen auch zu ver-stehen und deren implizite Intentionalität zu erkennen,könnte die Zerdehnung der postnatalen entwicklungsphase,die mit einem hohen grad an Plastizität einhergeht, und dieNotwendigkeit, nicht zuletzt auch durch Imitation geteilteaufmerksamkeit herzustellen, mit einer neuen Qualität so-zialen Lernens einhergehen. die im paläoanthropologischenbefund zu erkennende Life-History-Zäsur kommt einemeinschnitt in der evolution des sozialen Lernens gleich.
das verstehende Imitationslernen ermöglicht nicht nurdie einfache Kopierung des zu imitierenden Handlungsab-laufs, sondern das gleichzeitige, sich im Nachvollzug einstel-lende Verstehen dieser Handlung. Komplexe Handlungsab-folgen, die zur Herstellung hochgradig komplexer kulturellerartefakte notwendig sind, können auf diese weise auchdurch häufige Iteration problemlos gelernt werden. Für denLernprozess ist es nicht mehr unbedingt notwendig, dass diezu vermittelnde Handlungsabfolge als ‘ganzes’ imitiert unddamit gelernt wird. Vielmehr genügt das ‘sequentielle’ sichannähern an das gewünschte ergebnis, weil in jedem Ver-such bereits ein Mitverstehen impliziert ist. die antizipationvon Intentionen ist als nicht zu unterschätzender Lernver-stärker einzuordnen. empathisch mediiertes Lernen profi-tiert, das ist meine ese, gegenüber einfacheren Formendes Lernens von einer art social learning boost. dieser Push-up-effekt hat letztlich nicht nur auswirkungen auf instru-mentelles Lernen, d. h. auf solches, das auf die erzeugungvon artefakten ausgerichtet ist, sondern ebenso auf das ‘er-lernen sozialer Interaktion’. In diesem sinne unterfüttert sichdas soziale Lernen beim modernen Menschen selbst, indemes den Mechanismus der Informationsweitergabe in dienächste generation verbessert. empathie oder auch verste-hendes Lernen haben das soziale Lernen von Homo sapiensmaßgeblich revolutioniert. Lernvorgänge werden erleichtert,sind stärker intersubjektiv eingebunden und in ihrer effi-zienz deutlich gesteigert.
die empathischen Implikationen spielerischer erfahrung
e more complex the mind, the greater the need for the simplicity of play.
Kirk zu Lieutenant sulu.star trek tos, „shore Leave“
die Verlängerung der entwicklungsphase beim modernenMenschen bedeutet gleichzeitig die ausdehnung der kriti-schen aufnahmephase von Informationen durch Lernpro-zesse. aber auch dies ist nur ein aspekt der späten Life-History-Verschiebung in der Hominisation. Mit derexpansion des nicht-festgestellten biographischen ab-schnitts im gehlen’schen sinne eröffnet sich ein in dieser
Qualität nicht dagewesener Möglichkeitsraum spielerischerMimetik. Neben angeleiteten Lernvorgängen (darunter fal-len sowohl durch soziale akteure direkt vermittelte als auchvon diesen indirekt vermittelte) gewinnen selbstgeleiteteLernprozesse eine entscheidende bedeutung. es ist die an-thropologische abschattungsdimension Huizinga’scherPrägung, der Mensch als Homo ludens, welche letztlich indiesem frei gewordenen Potenzialitätsraum zutage tritt.73
die spielerische Qualität der menschlichen existenz istevolutionär als einer der entscheidenden bausteine jeneskumulativen Lernprozesses zu verstehen, der die Linearitäteiner schlichten iterativen replikation der kulturell wei-terzugebenden Informationseinheit auf die Nachfolgege-neration, mit dawkins sprechen wir vom Mem, durch-bricht und die spielerische entdeckung von Neuemerlaubt. das Motiv des spiels umreißt jenen aspekt desLernens, der durch spielerische aktivitäten erworben wird.die spielerische aneignung neuer Fähigkeiten kann schonim reich der tiere beobachtet werden, findet jedoch erstbeim Menschen seine deutlichste ausprägung. wie schonsloterdijk betont hat, ist der Mensch ein übender spieler.74
Im spiel lernt er selbstgeleitet einen nicht zu unterschät-zenden anteil seiner Fähigkeiten und erkundet neue Mög-lichkeiten. das spiel ist gewissermaßen ein simulations-raum des Lebens. Mit dem spielerischen Fertigkeitserwerbwird der grad, mit dem kulturell Verfestigtes potenzielldurchbrochen werden kann und dann durch empathischkanalisiertes Imitationslernen für die soziale einheit erhal-ten bleibt – und nicht idiosynkratisch im sumpf des Indi-vidualismus versinkt, d. h. wie bei nichtmenschlichen Pri-maten oft beobachtet, keine sozialisation erfährt – deutlicherhöht. der spielraum (im wörtlichen sinne) dieser Formdes sozialen Lernens wird durch die ontogenetische ori-entierungsphase, in der die welt und insbesondere die so-ziale umwelt erforscht und erspielt werden muss, d. h.durch die präsexuelle Phase eines jeden Individuums, vor-gegeben. dehnt sich diese im Verlauf der evolution aus,wie es bei Homo sapiens deutlich zu beobachten ist, dannvergrößert sich entsprechend der ‘spielraum’. die Mor-phogenese des menschlichen spielraums wird daher in derHerausbildung einer verzögerten Life-History im Kno-chenmaterial unserer ahnenreihe manifest.
Insbesondere in einem Kontext hoher sozialer Interak-tion, der durch die besondere stellung von szenarien ge-teilter aufmerksamkeit geprägt ist, scheint die spielerischeabarbeitung am Fremden, d. h. an den anderen sozialenakteuren ebenso wie an der umwelt im allgemeinen, einezunehmend zentrale rolle einzunehmen. die Notwendig-keit von Interaktionen geteilter aufmerksamkeit ist im ge-meinsamen spiel besonders gut realisierbar, sprich: einesolche Notwendigkeit (und diese besteht ganz offensicht-lich beim menschlichen Nachwuchs) schafft eine Infra-struktur spielerischer entfaltung. auch hier tritt ein em-
warum Menschen empathische wesen sind 31
pathisches Moment hinzu. empathie kann in diesem so-zialen Milieu spielerisch erprobt und ausgetestet werden.das spiel ist ein simulationsraum empathischer Potenzia-lität, in dem empathie als Koordinationskraft in der spie-lerischen Interaktion nicht nur notwendig vorausgesetztwird, sondern sich auch entfalten kann. erst im ‘spieleri-schen attunement’, so die Hypothese, entfaltet sich jenesozialdynamik, die grundvoraussetzung empathischerreifung ist. Homo empathicus und Homo ludens greifen re-gelrecht ineinander. anthropologisch liegen die wurzelndes spielerischen Menschen jedoch weit tiefer in der Ver-gangenheit begraben, als so mancher vielleicht vermutenmag. auch spielerische Mimetik und spielerische erpro-bung entfalten sich im Verlauf der anthropogenese gradu-ell, erst eine spezifisch interaktionistische sozialeinbettunghoher Frequenz erlaubt deren potenzierte ausprägung. dieKategorie Homo ludens entzieht sich damit einerseits einereinpassung in eine taxonomische Klassifizierung, anderer-seits einer direktdatierung über paläoanthropologischeund archäologische befunde.
erste Lichtungen des spielerischen Menschen öffnensich bereits vor etwa 300 000 bP und treten in einer erstenerkennung von besonderen Formen oder auch in der Form-überarbeitung natürlicher objekte zutage (häufig in derÜberprägung von geofakten). diesen ersten idiosynkrati-schen Äußerungen spielerischer Übung liegt eine architek-tur der Ähnlichkeit zugrunde. besondere Formen werdenerkannt und ausselektiert, weil sie Ähnlichkeit mit bekann-tem aufweisen. es liegt nahe, dass anthropomorphismusdeshalb ein solcher selektiver Faktor ist.75 archäologisch be-stätigt sich diese annahme zumindest. als idiosynkratischeProdukte spielerischer erprobung können vor allem die zwi-schen 200 000 und 300 000 Jahre alten Pseudoplastiken ausbérékhat ram in Israel und tan-tan in Marokko gelten, dieaus vulkanischem tuff formüberprägt sind,76 ebenso wie ei-nige der überaus kontrovers diskutierten Pseudoartefakte desgleichen Zeithorizonts.77 Mit ausnahme der Protofigurine
67 vgl. grundlegend rIZZoLattI & sINIgagLIa 2008 und rIZ-ZoLattI & CraIgHero 2004.68 vgl. gaLLese et al. 2009; gaLLese 2009; Keysers et al. 2003;KoHLer et al. 2002.69 vgl. rIZZoLattI et al. 2001.70 gaLLese et al. 2004.71 vgl. IaCoboNI et al. 1999.72 vgl. PrestoN & de waaL 2002.73 vgl. HuIZINga 1994.74 sLoterdIJK 2009.75 bereits guthrie hat in seiner eorie der wahrnehmung zuzeigen versucht, dass Menschen einen perzeptiven anthropomor-phismusbias haben (vgl. gutHrIe 1980 und 1993).76 d’errICo & NoweLL 2000.77 vgl. zusammenfassend LorbLaNCHet 1999.
von bérékhat ram ist bei diesen stücken bis heute keines-falls zweifelsfrei geklärt, ob es sich dabei wirklich um ar-tefakte, d. h. auf menschliches Handeln und menschlicheIntentionalität ursächlich zurückzuführende Produkte han-delt. wesentlich bleibt aber, dass diese Lichtungen desspiels über gewaltige Zeiträume hinweg immer isoliertbleiben und damit am ende nur ein sich schleichend ent-wickelndes Potenzial spielerischer Kreativität andeuten,welches sich bis dato, so scheint es, nicht entfalten kann.auf basis der bisherigen Überlegungen ist anzunehmen,dass vor allem soziale Hemmstoffe für diesen sachverhaltverantwortlich gemacht werden können.
dieses bild ändert sich jedoch irgendwann zwischen150 00 und 80 00 bP dramatisch. In diesem Zeithorizontkönnen zum ersten Mal in der menschlichen entwick-lungsgeschichte Formvariationen im artefaktbestand nach-
32 shumon t. Hussain
gewiesen werden, die eine spielerische entdeckung und er-probung von Neuem nicht nur andeuten, sondern durchdie explizite traditionsverankerung dieser Formen, diedurch eine habituelle Kontinuität über lange Zeitspannengreifbar ist, sehr wahrscheinlich machen.78 die realisierteMöglichkeit der sozialisierung dieser stücke durch derenIntegration in den Vorgang des sozialen Lernens und dersozialen Informationsweitergabe zeigt eine Verdrängungder Idiosynkratie spielerischer Übung durch eine soziali-satorik spielerischer Mimetik. offensichtlich ist spieleri-sches In-der-welt-sein schon mit Homo erectus vor-ange-legt und hat sich in der menschlichen Lineage bis zumNeandertaler erhalten, aber nicht wesentlich verändert. sogesehen ist das spielerische im Menschen ein archaischeserbe, das seinen Potenzialitätsraum erst mit dem auftretenvon Homo sapiens voll auszuschöpfen vermag. erst das
auswahl aus einer Vielzahl von intentionell gravierten ockerobjekten aus der blombos-Höhle, südafrika. (Zusammengestellt aus: HeNsHILwood et al. 2009; Figs. 3; 4; 17; 18; 20, mit freundlicher genehmigung Christopher Henshilwoodund Francesco d’errico) M. 1:1.
kombinatorische Zusammenwirken von empathie, spielund sozialem Lernen resultieren in dem, was donald als„mimetic dimension of culture“ bezeichnet hat, ein Mo-ment, das vor allem durch perzeptuelle Ähnlichkeit getrig-gert wird und als triebfeder von Innovation und Kreativi-tät in der anthropogenese gelten kann.79
wie die Zusammenschau der vorliegenden evidenzliniendeutlich macht, ist die evolution der empathie beim Men-schen nur durch eine multifaktorielle beschreibung hin-reichend zu charakterisieren. empathisches Vermögen, dasüber weitreichende Möglichkeiten der verstehenden anti-zipation, simulation und Perspektivübernahme verfügtund nicht primär auf dem Moment der gefühlsansteckungberuht, entfaltet sich wohl erst mit der genese des anato-misch modernen Menschen, weil erst dessen architekturder empathie wie auf einem Nährboden frei gedeihenkann, d. h. keinerlei soziokulturelle einschränkung undFormatierung erfährt, sondern ganz im gegenteil erst in-nerhalb dieses Milieus sozialer organisation, das wesent-lich auf der besonderen Form menschlicher brutpflegefußt, unterfütterung erfährt. Provokant könnte dieser Vor-gang analog zum seinem kulturellen Pendant ‘empathi-scher wagenhebereffekt’ getauft werden. erst in Folge derIntensivierung der individuellen Formung durch die ver-längerte abhängigkeit einerseits sowie empathische Kana-lisierung des sozialen ebenso wie des spielerischen Lernens
warum Menschen empathische wesen sind 33
andererseits wird jene Kulturleistung möglich, die denMenschen noch heute so einzigartig erscheinen lässt.80
Hier wurzelt nicht zuletzt das, was anthropologen als „kul-turelle Modernität“ bezeichnen.81 wie bereits schiller esauszudrücken pflegte „ist [der Mensch] nur da ganzMensch, wo er spielt“.82
Vereinfachte evolutionslogik aus-differenzierter und elaborierter em-pathiebegabung. beim modernenMenschen ist die radikalisierungder progressiven trends innerhalbder Hominiden- und Primatenevo-lution, immer qualitativere Life-History-Profile zu realisieren undimmer größere und ‘globularisier-tere’ gehirne auszubilden, als ent-scheidender Faktor für soziale undkulturelle Komplexwerdung zu be-greifen. diese wirkt als positiver‘Feedbackloop’ auf biologische ent-wicklungsprozesse zurück – inso-fern zeigt die grafik die interneLogik der kulturellen einnischungdes modernen Menschen als pfad-abhängigen Prozess. empathie wirdals Mechanismus verstanden, dersowohl Mutter-Kind-beziehungenreguliert und harmonisiert als auchentscheidendes Instrument einerKulturtechnik ist, die wesentlich auf Lehren, Lernen und spielen beruht – Imitation, simulation und reziprokes Verstehen sind diesäulen einer solchen empathischen anthropotechnik. Mit der Intensivierung der abhängigkeit der Kleinkinder von mütterlicher Ver-sorgung und kultureller Integration elaboriert sich auch das empathische Vermögen. die Notwendigkeit von kooperativer Nachwuchs-aufzucht und -pflege verankert das hochflexible ad-hoc-Verstehen von anderen sozialen akteuren sozialisatorisch im evolutionären Milieudes Menschen.
expansive Entwicklung der Lebensgeschichte (Life-History)
Expansion der Lehr- und Lernphase
Öffnung und Vergrößerung eines Raums spielerischer Übung
Elaborierung derEmpathiekapazität
kritische Intensivierung der Nachwuchsabhängigkeit
expansive Hirnentwicklung
kooperative Aufzucht
zunehmende Sozialkomplexität
zune
hmen
deK
ultu
rkom
plex
itätLebensgeschichte (Life-History)
expansive Hirnentwicklung
expansive Entwicklung der Lebensgeschichte (Life-History)
expansive Hirnentwicklung
Lehr- und Lernphase
Raums spielerischer Übungfnung und Vergrößerung eines fnung und Vergrößerung eines fnung und Vfnung und VÖfÖffnung und V
Expansion der expansive Entwicklung der
Kul
turk
ompl
exitä
tLehr- und Lernphase
Raums spielerischer Übung
zune
hmen
de
ergrößerung eines ergrößerung eines Raums spielerischer Übung
Nachwuchsabhängigkeit
zunehmende Sozialkomplexität
kritische Intensivierung der EmpathiekapazitätNachwuchsabhängigkeit
zunehmende Sozialkomplexität
kooperative Aufzucht
kritische Intensivierung der Elaborierung derEmpathiekapazitätElaborierung der
78 vgl. grundlegend MCbrearty & brooKs 2000; aber auchd’errICo 2003; HeNsHILwood & MareaN 2003; konkretHeNsHILwood et al. 2002; HeNsHILwood et al. 2004; d’errICoet al. 2005; VaNHaereN et al. 2006; HeNsHILwood 2009.79 doNaLd 1991; 1998; 2009.80 vgl. u. a. HILL et al. 2009.81 der begriff ist stark umstritten, meint aber eine ganze reihevon Verhaltensmerkmalen, die unmittelbar in der materiellenKultur ersichtlich werden und nur beim anatomisch modernenMenschen nachweisbar sein sollen, d. h. seine Modernität mar-kieren. Insbesondere bezieht er sich auf den symbolhaften Cha-rakter dieser ‘modernen’ Inventare (vgl. grundlegend wadLey2001). In den letzten Jahren hat sich aber zusehends gezeigt, dassdieses bild zu simplifizierend und kein solch kategorialer ein-schnitt in der menschlichen Kulturfähigkeit zu identifizieren ist,der als modernitätsstiftendes kulturelles Paket gefasst werdenkann. das Konzept ‘kultureller Modernität’ ist hier deshalb alsweitgehend auf seine heuristische Funktion beschränkt gemeintund bezeichnet lediglich den materiellen ausdruck der kogniti-ven alleinstellungskriterien moderner Menschen (vgl. kritischsHea 2011).82 vgl. sCHILLer 2009.
I.4 KoMMuNaLe KuLtur uNd dIe eVoLu-tIoN KuLtureLLer KaPaZItÄt
die evolutionäre entwicklung menschlicher Kulturfähigkeit
A single act of compassion can put you in touch with your own humanity.
Janeway zu seven of Nine.star trek Voyager, „Prey
34 shumon t. Hussain
wie wirken sich diese im vorigen Kapitel dargelegten ver-änderten kognitiven Vorzeichen beim modernen Men-schen auf dessen Kulturtechnik und soziale organisationaus? und inwiefern stützen die archäologischen archiveunserer ahnen aus dem Pleistozän die annahme einer sig-nifikanten sozialen Zäsur, welche die Kulturlandschaft derletzten eiszeit transformiert haben soll? um sich dieserwichtigen Frage zu nähern, ist es notwendig die Perspektivezu erweitern und zunächst den allgemeinen evolutionärenentwicklungstrends in der kulturellen domäne nachzuge-
um unklarheiten zu vermeiden, sind die Verhaltensweisen im englischen original wiedergegeben: 1a: „pestle-pound“; 1b: „wood-stone“; 1C: „fluid dip“; 1d: „leaf napkin“; 1e: „rain dance“; 2a: „stone-stone“; 2b: „wood-other“; 2C: „lever“; 2d: „leaf groom“; 2e:„termite fish-M“; 3a: „ant-dip“; 3b: „seat-veg“; 3C: „expel/stir“; 3d: „leaf clip-M“; 3e: „termite fish-s“; 4a: „aimed throw“; 4b: „marrowpick“; 4d: „knuck-knock“; 4e: „leaf strip“; 5a: „bee probe“; 5b: „pound-wood“; 5d: „ant fish“; 5e: „leaf dab“; 6a: „index hit“; 6b:„pound-other“; 6C: „self tickle“; 6d: „hand clasp“; 6e: „fly-whisk“; 7a: „stone-wood“; 7b: „club“; 7C: „clip-finger“; 7d: „shrub-bend“;7e: „leaf-inspect“; 8a: „wood-wood“; 8b: „ant-wipe“; 8C: „leaf squash“; 8d: „pull-through“; 8e: „branch slap“.
übliches Verhaltens-merkmal
gebräuchliches Verhal-tensmerkmal
e Fehlen kann durch ökologische Para metererklärt werden
? Fehlen unklar
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C D E
BossouGuinea
E E
E E
E
E
E
E
E
E
KibaleUganda
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
E E
E E
E
E
E
E
BudongoUganda
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
E
E
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C D E
TaïElfenbeinküste
E
E
E ?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C D E
GombeTansania
1
2
3
4
5
6
7
8
A B C D E
MahaleTansania
EDCBA
3
E1
E
E
E
DCBA
E
E
4
E
E
E
DCBA
GuineaGuineaGuineaGuinea
8
6
Bossou
7
UgandaKibale
6
8
7
UgandaBudongo
ansania
5
77
4
3
Neuerdings wird auch dem schimpansen eine elaborierte Kulturtechnik mit regional divergierenden tra ditions linien zugebilligt. Primato -logische studien zeigen zunehmend, dass insbesondere werkzeuggebrauch und soziale umgangsformen kein alleinstellungsmerkmal desMenschen sind, sondern auch bei höheren nichtmenschlichen Primaten vorkommen. sich regional unterscheidende ‘Kulturpakete’ lassensich vor allem anhand der schimpansen populationen von Malahe, gombe, Kibale, budongo, bossou und taï deutlich machen. entschei-dend ist dabei, dass diese lokalen traditionen nicht allein durch ökologische Faktoren erklärt werden können. beobachtete Verhaltensweisenje Population sind in einer Matrix symbolisch markiert. (umgezeichnet nach: wHIteN et al. 1999, Fig. 1)
hen. alvard folgend soll Kultur dabei zunächst als adaptiverMechanismus verstanden werden, als ein Kontinuum, dasim Verlauf der evolution morphologischen gestalt -veränderungen unterliegt.83 der Kulturbegriff ist äußerstvielschichtig und hat sich schon seit geraumer Zeit als nichtmehr geeignet erwiesen, eine spezifisch menschliche eigen-heit zu umreißen. auch tiere haben Kultur. das trifft nichtnur auf höhere nichtmenschliche Primaten zu, die sowohlmit eigentümlichen Kulturtechniken wie termiten‘fischen’oder Nussknacken brillieren als auch über kulturgeographi-sche Variabilität verfügen,84 sondern ebenso auf Honigbie-nen und deren schwänzeltanz sowie auf etliche weitere tie-rische Vertreter wie Krähen, ratten und Fische.85 Ähnlichwie gamble et al. gehe ich von graduellen kulturellen ent-wicklungsschritten aus, die von kognitiven Potenzialen ge-tragen werden und sich in Verhaltensrepertoireverschiebun-gen ihrer träger erkennen lassen.86
die basalste kulturelle Kapazität ist die soziale transmis-sion von Informationen. diese kommunikative struktur istnoch auf den kurzfristigen austausch relevanter daten be-schränkt, der sich nicht wesentlich auf das Verhalten dergruppe auswirkt und meist der unmittelbaren bedürfnis-befriedigung wie der beschaffung von Nahrung dient. dieseForm sozialer Kommunikation findet sich bei allen sozialenLebewesen, sprich bei solchen, die in größeren gruppenleben, und involviert noch keine kulturellen Merkmale imengeren sinne. Manche tierarten entwickeln regelrechtetraditionslinien, indem sie die sozial vermittelten Informa-tionen durch zielgerichtetes emulationslernen adaptierenund in ihren Verhaltenskanon integrieren. erst mit demauftreten eines gewissen grades an Variabilität der sozialverankerten traditionen sowie dem Vorhandensein einer ge-wissen Planungstiefe bei der Herstellung der in diesen tra-ditionen stehenden artefakte kann mit Haidle et al. von ru-dimentärer Kultur, von basic culture gesprochen werden.87
schimpansen, bonobos, orang-utans und andere nicht-menschliche Primaten verfügen über diesen grad kulturellerKapazität. Menschheitsgeschichtlich ist die unterfamilie deraustralopithecinen, die vor etwa 3 Mio. Jahren die savannenafrikas durchstreifte, vermutlich in diese Kategorie verort-bar.88 weil offensichtlich nur menschliche Vorfahren sowohlihre kognitiven grundlagen als auch ihre kulturelle Kapazi-tät elaboriert haben, vollzieht sich die kulturelle evolutionab diesem Punkt wohl exklusiv innerhalb der anthropoge-nese. das erscheinen der ersten steinwerkzeuge vor 2,5 bis3 Mio. Jahren geht mit einer ausdehnung der Problem-Lö-sungs-distanz einher, d. h. der Möglichkeit adaptive oderunmittelbar praktische Probleme zunächst in viele unterge-ordnete Probleme zu zerlegen und mit einem zeitlichen Ver-zug zu lösen. damit zerdehnt sich nicht nur der Möglich-keitsraum denkbarer Lösungswege, sondern auch derspielraum kultureller antworten, die nicht mehr unbedingtdas Korsett der ökologischen Formatierung tragen müssen.
warum Menschen empathische wesen sind 35
Vereinfachtes schema der kulturellen evolution von einfachstenKulturtechniken bei bienen und delfinen bis hin zu komplexenund ausdifferenzierten Kulturleistungen wie die des Menschenund seinem Versuch einer technologischen unterwerfung derwelt. abgetragen ist das qualitative und quantitative spektrumder realisierungsmöglichkeit verschiedener Kulturtechniken.wo bei bienen noch lediglich einfache sozialrelevante Informa-tion in der sozialen einheit mit bestimmten techniken übermit-telt wird, tritt spätestens mit dem schimpansen eine ernstzuneh-mende traditionsverankerung kultureller Leistungen auf;Menschenaffen und Hominiden beginnen mit der Verwendungund Herstellung von werkzeugen, und der moderne Menschschließlich ist durch eine Kulturalität gekennzeichnet, die expli-zit das kulturell eigene vom kulturell Fremden abgrenzt und mitverschiedenen Zeichen und symbolen markiert. das schema istkein stufenmodell kultureller evolution, eine ‘höhere’ stufe im-pliziert nicht unbedingt eine ‘niedrigere’, sondern soll lediglichdie Klassifikation von kultureller Kapazität in einem evolutio-nären Kontext erleichtern. (Verändert nach: HaIdLe & CoNard 2011, Fig. 5)
83 aLVard 2003.84 vgl. wHIteN & VaN sCHaIK 2007 und boesCH & boesCH1990.85 vgl. exemplarisch detraIN et al. 1999; aber auch gaLeF2004.86 vgl. gaMbLe et al. 2011.87 vgl. grundlegend HaIdLe & CoNard 2011; HaIdLe et al.,in Vorb.88 vgl. u. a. wHIteN et al. 1999; reNdeLL & wHIteHead2001; VaN sCHaIK et al. 2003; wHIteN et al. 2009b.
Mit Haidle et al. ist dieser schritt in der evolution kulturel-ler Kapazität als intermediate culture zu bezeichnen.89,90 erstvor etwa 300 000 bP vollzieht sich jene transformation derkulturellen Landschaft, die bis dato immer als alleinstel-lungsmerkmal menschlicher Kulturtechnik galt.
spätestens im afrikanischen acheuléen deuten sich so-ziale Lernprozesse an, die auf Imitation und intentionellemVerstehen beruhen.91 Prozessorientiertes Lernen ermöglichtnicht zuletzt die etablierung elaborierterer traditionen derartefaktherstellung. es ermöglicht aber auch das kumulativeLernen, wodurch Fortschritte über die Zeit hinweg kulmi-nieren. Probleme müssen nicht länger immer wieder vongrund auf einer Problem-Lösung zugeführt werden, son-dern können mit bereits bekannten Lösungswegen konfron-tiert werden, welche dann lediglich angepasst werden müs-sen. tomasello und andere haben immer wieder betont, dassin diesem kulturellen wagenheber effekt die wurzel der ein-zigartigen Kulturfähigkeit des modernen Menschen greifbarist.92 wenn das archiv unserer ahnen eines zu zeigen ver-mag, dann aber, dass die cumulative culture sehr viel älter istals der moderne Mensch selbst.93 das Kriterium ist damitals Marker für den Menschen als Metakategorie möglicher-weise zwar noch tauglich, d. h. wenn der Mensch und seineVorformen inklusiv gedacht werden, verliert aber seineKraft, das entscheidende alleinstellungsmerkmal von Homosapiens zu erhellen. Kumulative Kultur ist spätestens mitHomo heidelbergensis vollständig ausgeprägt. wenn die so-ziokulturelle eigenart des modernen Menschen herausge-stellt werden soll, muss der Fokus stärker auf den Zeitraumseiner entstehung gerichtet werden. tatsächlich, so dieese, ist in diesem Zeitfenster eine weitere nicht zu unter-schätzende gestaltveränderung der kulturellen Landschaftzu beobachten.
der bis dato finale schritt in der evolution kulturellerKapazität vollzieht sich um etwa 100 000 bP in der afrika-nischen Heimat der noch auf dem südkontinent lebendenersten anatomisch modernen Menschen. Zum ersten Mal inder Menschheitsgeschichte sind identitätsformende Mo-mente fassbar. Kultur wird nicht nur praktiziert, sondernauch als träger von Identität konzeptualisiert. die communalculture zeichnet sich durch ihre implizite betonung des diffe-renten bei gleichzeitiger Herausbildung eines gruppen-be-wusstseins aus.94 Kollektive Intentionalität und Fremdab-grenzung sind ihre säulen. Kommunale Kultur bedeutet dieelaborierung der sozialen Interaktion durch kulturspezifischeMarker. aber auch die Inszenierung der eigenen tradition inritualen und Narration. In seiner bedeutung ist diese ent-wicklung gar nicht zu überschätzen, weil sie mit der Heraus-bildung extrasomatischer trägermedien kultureller Informa-tion und deren sicherer Kodierung in Notationssystemeneinhergeht. die Logik kommunaler Kultur führt zu einemLeben im schatten des Cassirer’schen Menschen, dem animalsymbolicum.95 semiotik und symbolismus sind die symp-
36 shumon t. Hussain
tome neuartiger sozialer und kultureller organisationspräfe-renzen. was mit „kultureller Modernität“ eigentlich gemeintist, lässt sich erst im Kontext der evolutionären entwicklungs-trends kultureller Kapazität hin zu einem kommunalen Ver-ständnis von Kultur hinreichend beschreiben. Im archäolo-gischen Niederschlag finden sich nicht nur die erstenNachweise inszenierter bestattungen, sondern auch Hinweiseauf umfangreiche soziale Kohäsions- und Identitätspraktikenwie Musik und ritual, die von nun an die alltagspraxis be-stimmen, ebenso wie erste künstlerische Äußerungen undbedeutungstragende objekte.96 Kommunale Kultur bildetsich mit Homo sapiens zwischen 150 000 und 80 000 bP zu-nächst auf dem afrikanischen Kontinent heraus und erreichtmit diesem die tore europas um 50 000 bP.97
die Kapazität einer kulturellen Infrastruktur geteilterIntentionalität im engeren sinne, das ist die eigentlicheKrux, entwickelt sich beim Neandertaler hingegen nie voll-ständig. eine deutliche signatur kultureller diversifizierungund Fragmentierung tritt erst beim modernen Menschenklar hervor und prägt dessen soziokulturelle Landschaft wiekaum ein anderer Faktor. Vanhaeren und d’errico konntenfür das europäische aurignacien nachweisen, dass Formund Herstellungstechnik von schmuck elementen ein guterPrädiktor für kulturelle Zugehörigkeit ist.98 diese soziale
89 die rolle der Feuernutzung innerhalb des ‘Kulturalisierungs-prozesses’ in der menschlichen Lineage wird noch diskutiert. Kri-tisch ist vor allem die datierung und Identifizierung intentionel-ler Feuerbeherrschung. die lange Chronologie geht von einerFeuernutzung seit mindestens 1,6 Mio. Jahren aus, wohingegendie kurze Chronologie mit einem Zeitraum zwischen 300 000und 400 000 bP rechnet (vgl. wraNgHaM & CarMody 2010;kritisch dagegen roebroeKs & VILLa 2011).90 vgl. roCHe et al. 1999; daVIdsoN & MCgrew 2005; de-LagNes & roCHe 2005; wHIteN et al. 2009b; HaIdLe 2010;MCPHerroN et al. 2010; goreN-INbar 2011; aber auch sHa-roN et al. 2011.91 vgl. zusammenfassend sHIPtoN 2010.92 vgl. exemplarisch toMaseLLo 1999a; 1999b; aber auchMarsHaLL-PesCINI & wHIteN 2008.93 vgl. teNNIe et al. 2009; HaIdLe 2009; aber auch HaIdLe2010.94 vgl. exemplarisch sHeNNaN 2001; wadLey 2001; VaNHae-reN & d’errICo 2006; CoNard 2010; aber auch NoweLL 2010.95 vgl. u. a. CassIrer 2007.96 vgl. beispielsweise CoNard 2010; zu ersten bestattungen vgl.PettItt 2011a, 57ff.97 deutlich wird ebenso, dass sich zwischen der eigentlichen ent-stehung des anatomisch modernen Menschen, der in einen Zeit-raum zwischen 250 000 und 200 000 bP verortet wird, und deremergenz der für ihn eigentümlichen Kulturtechnik ein temporalerspalt öffnet, welcher nochmal unterstreicht, dass diese kulturelleKapazität über bestimmten sich erst entfaltenden kognitiven Po-tenzialen evolviert ist und nicht a priori gegeben war (vgl. zur Ho-minisation etwa tattersaLL & sCHwartZ 2009, 82ff.).98 VaNHaereN & d‘errICo 2006.
warum Menschen empathische wesen sind 37
auswahl typischer steinartefakte und organischer artefakte aus dem mittel- und westeuropäischen Jungpaläolithikum, das traditionelldem anatomisch modernen Menschen zugeordnet wird. oben: Charakteristische artefakte aus dem aurignacien von el Castillo und el Pendo. erwähnenswert sind vor allem die typischen Kno-chenspitzen mit gespaltener basis, die als Leitform des frühen Jungpaläolithikums gelten, sowie die bereits zahlreich auftretenden durch-lochten Zähne, die als anhänger gedeutet werden. unten: artefaktsprektrum des späten Jungpaläolithikums. das ensemble aus dem Magdalénien von el Juyo weist bereits eine ganz er-hebliche Komponente organischer artefakte auf, von denen eine ganze reihe verziert ist. (Zusammengestellt aus: KLeIN 2009, Figs. 7.8; 7.11)
Kielkratzer
perforierte Zähne
Kratzer an Aurignacienklingen
Spitzen mit gespaltener BasisMehrfachstichel
Aurignacien (Fundplätze El Castillo und El Pendo)
Magdalénien (Fundplatz El Juyo)
Nadel
perforierte Schneckenhäuser
StichelBohrer
Hirschzahn anhänger
Geweih pfriem
Geweih spitzen
VogelknochenröhreLamellen
5 cm0
5 cm0
differenzierung drückt sich mit anderen worten in derVerbreiterung des Formenspektrums ebenso wie desFertigungs spektrums aus und wird in regional abge-grenzten, diskreten einheiten fassbar. die annahme, diesich aus den vorliegenden daten zur Life-History, zurevolution der kooperativen aufzucht und der sozialen
38 shumon t. Hussain
Kognition bei Homo sapiens unmittelbar ableitet, bestä-tigt sich im archäologischen archiv unserer Vergangen-heit. die anthropogenese resultiert in einem signifikan-ten einschnitt in der sozialen Landschaft und stütztdamit letztlich die Hypothese einer Veränderung in derarchitektur der empathie.
die ersten Nachweise für Zirkulationsareale für schmuckobjekte kommen vom afrikanischen Kontinent, ebenso erste Nachweise fürnon-utilitaristische dekortraditionen. traditionell werden diese objekte als belege für eine sich sukzessiv entfaltende ‘kulturelle Moder-nität’ ihrer schöpfer aufgefasst; im hier verhandelten Zusammenhang sollen sie jedoch lediglich als erstes Indiz einer sich elaborierendenKulturtechnik im afrikanischen Middle stone age (Msa) verstanden werden. 1 gravierte straußeneifragmente aus den Howiesons-Poort-schichten von diepkloof, western Cape, südafrika. bis auf das exemplarlinks oben gehören alle zu einer stratigraphischen einheit. die gravuren sind zweifelsfrei intentioneller Natur und können nicht übertaphonomische agenten erklärt werden. M. 2:3.2 auswahl der durchlochten Nassarius kraussianus Perlen aus den Msa-schichten der blombos-Höhle, die eindeutig belegen, dass per-sönliche schmuckobjekte spätestens seit 75 000 Jahren in südafrika zum integralen bestandteil der Kulturalität avancieren. M. 2:3.3 das berühmte ockerobjekt M1-6 aus der blombos-Höhle, das zu den ersten zweifelsfrei intentionell verzierten stücken der Mensch-heitsgeschichte gehört. M. 2:3.(umgezeichnet von Jürgen richter nach: texIer et al. 2010, Fig. 1; HeNsHILwood et al. 2004, Fig. 1; 2009, Fig. 8)
1
32
der empathische aspekt geteilter Intentionalität
e sum of the parts cannot be greater than the whole.spock to McCoy.
star trek tos, „e galileo seven“
das Konzept kommunaler Kultur führt auf direktem wegemitten ins Herz einer der wichtigsten debatten jüngster Zeitum die grundlagen des sozialen überhaupt. was genau istunter einem wir-bewusstsein zu verstehen? und wie ist esüberhaupt denkbar, sozialen einheiten mentale Zustände zu-zuschreiben, die aber streng genommen ausschließlich Indi-viduen vorbehalten sind? diese Fragen, die auf die Infrastruk-tur sozialen Handelns auf der gruppenebene zielen, werdenunter dem stichwort „kollektive Intentionalität“ verhandelt.99
die kontroverse debatte oszilliert um die Vorstellung, auchsoziale einheiten als intentionale akteure eigener Logik zuverstehen. das ist keinesfalls trivial. die wissenschaftlicheLandschaft der westlichen welt war und ist schon seit langemdurch einen methodologischen Individualismus gekenn-zeichnet. Handeln ist immer ein Handeln von Individuen,niemals ein Handeln von durch Individuen konstituierte en-titäten. es hat sich aber gezeigt, dass die Vorstellung, hinrei-chende Mikroerklärungen für die dynamiken der sozialenwelt zu finden, etwas naiv anmutet. Vielmehr ist davon aus-zugehen, dass viele der komplexeren erscheinungen nurdurch das wechselseitige einwirken von Mikro- und Makro-determinationskräften gleichermaßen erklärt werden kön-nen. das Postulat einer Makroebene der adäquaten erklä-rung ist alles andere als obsolet und insbesondere in sozialenFragen eine ernstzunehmende alternative zu herkömmli-chen, oft ‘rostenden’ Modellen. Prominent vertreten wird diePosition, soziale einheiten als de facto intentional und damitauch kausal wirkende entitäten zu verstehen, insbesonderevon gilbert.100 Nach gilbert sind gruppen nicht nur dieträger von kollektiver Intentionalität, sondern gleichsam dieträger von beobachtbaren eigenschaften, die nicht auf diesumme oder eine bestimmte zu spezifizierende teilmengeder sie konstituierenden Individuen reduktiv zurückzuführensind. gruppen haben ‘absichten’, die sich von denen ihrerMitglieder durchaus unterscheiden können. wenn eine or-ganisation einen teil ihrer belegschaft austauscht, dann ist inder regel trotzdem keine signifikante Veränderung in derweise festzustellen, wie diese operiert und qua organisationentscheidungen trifft. ebenso minimale Kursänderungen,die nicht ohnehin schon in der operationslogik dieser ein-heiten angelegt sind, lassen sich beobachten, wenn sich dieKonstellation des Vorstands und/oder Managements ändert.das Verhalten dieser sozialen entitäten hängt offenbar we-niger von den Intentionen ihrer einzelnen Mitglieder ab, als vielmehr von der geteilten Intention, ‘Mitglied dieser entitätzu sein und sich in deren sinne zu verhalten’ – was auchimmer das genau heißt. Kollektive Intentionalität ist, wenn
warum Menschen empathische wesen sind 39
man so will, eine mögliche Lösung von allgemeinen Koordi-nationsproblemen. es herrscht mittlerweile weitgehenderKonsens, dass das Phänomen kollektiver Intentionalität alserscheinung ernstzunehmen ist und einer erklärung bedarf,d. h. nicht einfach reduktiv zu individuieren oder zu elimi-nieren ist. Kollektive Intentionalität beschreibt einen sach-verhalt in der welt.
außerdem sind intentional agierende sozialeinheitennicht ohne deren Konstituenten denkbar. Kollektive Inten-tionalität setzt eine Mikrofundierung voraus. searle, brat-man und tuomela haben deshalb in ihren ansätzen die be-deutung des Individuums für ein Verständnis kollektiverabsichten hervorgehoben und deutlich gemacht, dass jedebeschreibung einer auf gruppenebene zu verortenden In-tentionalität nicht ohne eine individuelle oder interindivi-duelle basis auskommen kann.101 gilberts berühmt gewor-denes beispiel zweier Personen, die ‘gemeinsam’ einen wegentlang gehen, illustriert diesen Punkt. die Frage ist nachwie vor, was es bedeutet, dass sie gemeinsam gehen, insoferndas „gemeinsam“ wörtlich zu verstehen ist. die beiden Per-sonen, das ist die konsensuale ese, laufen nicht etwa zu-fällig nebeneinander her und haben je eigene Intentionen;nein: sie teilen vielmehr die ‘gleiche’ Intention, nämlich dasgemeinsame gehen des weges. wie ist das möglich? wiekönnen die Personen überhaupt wissen, was der jeweils an-dere beabsichtigt, und sich auf eine gemeinsame absicht ko-ordinieren? Kurz: gesucht wird nach einer intersubjektivenbasis als bedingung der Möglichkeit für geteilte Intentiona-lität.102 Ich möchte an dieser stelle aufzeigen, dass der in-tersubjektive Mechanismus des empathischen Zugriffs fürdiese basisfundierung in Frage kommt. empathie, so dieese, stellt ein Vermögen bereit, welches durch reziprokesVerstehen individuierte Intentionalität zu koordinieren ver-mag. Kollektive Intentionalität ist dann emergenztheoretischaus einer empathischen struktur intersubjektiver Verbun-denheit zu verstehen.103
99 vgl. exemplarisch sCHMId & sCHweIKHard 2009, 11ff.100 gILbert 1989.101 vgl. searLe 1990; 1995; bratMaN 1993; 1999; tuoMeLa1992; 1995.102 auch wenn das Verhältnis zwischen geteilter und kollektiverIntentionalität nicht abschließend geklärt ist, sind beide begriffeoffensichtlich unterschiedlich stark und deshalb in verschiedenenKontexten anwendbar. Kollektive Intentionalität beschreibt dieabsichten einer gruppe, ohne vorauszusetzen, dass alle Mitgliederdieser gruppe diese absichten auch teilen, wohingegen geteilte In-tentionalität die absichten von einigen wenigen Individuen be-schreibt, die diese tatsächlich teilen. geteilte Intentionalität ist einestärkere Koordinationsleistung und setzt mehr voraus. trotzdemist sie entwicklungsgeschichtlich von zentraler bedeutung, insbe-sondere im Zusammenhang von als-ob-spielen (s. u.).103 vgl. einführend in die debatte um emergente erklärungs-modelle greVe & sCHNabeL 2011, 9ff.
bereits die Husserlschülerin walther formuliert eine solchePosition in ihrer analyse des gemeinschaftserlebens, das sieauch „wir-erleben“ nennt.104 um geteiltes erleben einesobjekts durch zwei Individuen a und b zu realisieren, ist esnach walther notwendig, dass (1) sowohl a als auch b dasobjekt erleben, (2) a und b sich beide in das erleben des je-weils anderen ‘einfühlen’, (3) das eingefühlte erleben mitdem je eigenen erleben identifizieren und (4) dieser identi-fikatorische Vorgang nochmal ‘einfühlend vergegenwärtigt’wird. analog kann der Vorgang des „wir-beabsichtigens“rekonstruiert werden. auch wenn die intersubjektiven Pro-zesse hier zu verkopft erscheinen – die kognitive Überkom-plexität dieser rekonstruktion sticht schon ins auge –, wirdeines doch deutlich: Intentionale Koordination auf ein ge-meinsames Ziel hin, das in einer geteilten absicht kulmi-niert, ist nur über wechselseitiges Verstehen denkbar. dieIntentionen des anderen zumindest zu erahnen, kann alsgrundvoraussetzung für ‘gemeinsames Handeln’ im stren-gen sinne gelten, welches nicht nur Handlungsparallelismusist. auch tomasello betont, dass empathie und rekursivesMind-reading eine notwendige bedingung für geteilte In-tentionalität ist.105 geteilt werden können Intentionen nurdann, wenn sie bis zu einem bestimmten grad explizit ge-macht werden. dieses explizitmachen hat sich beim moder-nen Menschen über seine empathische disponiertheit letzt-lich internalisiert. empathie, die mehr leistet als lediglich fürgrundbedürfnisse des jeweils anderen und für dessen emo-tionale Verfasstheit zu sensibilisieren, sondern zu intentio-nalem Verstehen befähigt, ist eine entscheidende bedingungfür geteilte und kollektive Intentionalität.
die ontogenetischen wurzeln geteilter Intentionalität
To all mankind: May we never find space so vast, planets so cold,
heart and mind so empty that we cannot fill them with love and warmth ... .
dr. tristan adams zu Kirk und dr. Helen Noel.star trek tNg, „dagger of the Mind“
Menschliche Nachkommen sind ungemein geschickt darin,szenarien geteilter aufmerksamkeit zu instanziieren. offen-sichtlich handelt es sich dabei, wie bereits erwähnt, um einbasales grundbedürfnis. Menschen beginnen schon sehr frühin der ontogenese, die dyadischen oder bipolaren bezie-hungsstrukturen zwischen Mutter und Kind zu durchbre-chen und in die welt dreistelliger, d. h. triadischer Interak-tionen einzutauchen.106 Im alter von etwa neun bis zwölfMonaten, man spricht von der Neunmonatsrevolution, be-ginnen Kinder ihre aufmerksamkeit nicht mehr nur aus-schließlich auf Personen oder objekte zu richten, sondern
40 shumon t. Hussain
andere soziale akteure dazu zu motivieren und aufzufordern,in ein gemeinsames aufmerksamkeitsverhältnis zu einemdritten objekt einzutreten. In der regel geschieht dies durchZeigegestik oder blickführung.107 In diesem alter verfügenmenschliche Kleinkinder bereits über die Fähigkeit, den bli-cken anderer zu folgen und diese als soziale bezugspunkte zunutzen, ganz allgemein also über die Fähigkeit, sich auf dieaufmerksamkeit und das Verhalten anderer, genau wie diesees auch tun, gegenüber externen entitäten einzustellen. Mitder Zeigegeste wird ein kommunikatives Mittel zur Herbei-führung geteilter aufmerksamkeit manifest, das bei nicht-menschlichen Primaten offenbar nahezu vollständig fehlt.108
Kleinkinder erüben ontogenetisch bereits sehr früh das ge-meinsame richten der aufmerksamkeit auf etwas drittes.das Moment des gerichtetseins tritt strukturell nah an dasintentionelle gerichtetsein einer absicht, an deren Zielge-richtetsein heran. Nichtmenschliche Primaten sind prinzipiellzwar durchaus in der Lage, die geste des Zeigens als signalzu erlernen, wie sich gezeigt hat, tun sie dies aber erstens nurfür Menschen und zweitens nur wenn sie etwas haben wol-len, und nicht schlichtweg, um aufmerksamkeit zu teilen.109
die selbszweckdienlichkeit geteilter aufmerksamkeitwird nochmal im gemeinsamen spielverhalten menschlicherNachkommen deutlich. Kleinkinder sind sich offenbar be-wusst, dass das gemeinsame spielen ein gemeinsames ist.spielt eine Person nämlich mit einem Kleinkind gemeinsam– und damit sind explizit nichtkompetitive spiele gemeint –,diese aktivität aber ohne erkennbaren grund unterbrichtund sich entfernt, spielen menschliche Kinder nicht einfachsolipsistisch weiter wie schimpansenkinder es beispielsweisetun, sondern warten bis der Mitspieler zurückkehrt und set-zen ihre spielerische aktivität erst dann wieder fort. Mensch-liche Nachkommen im alter von zwei Jahren sind offenbardisponiert, mit anderen auf der basis geteilter aufmerksam-keit zu kooperieren, wie dies bei unseren nächsten Verwand-ten nicht beobachtet werden kann.110 Insbesondere involviertdiese Form der Kooperation geteilte Ziele und zumindesteine rudimentäre selbstverpflichtung für die gemeinsame ak-tivität. entsprechend warten menschliche Kinder im obenskizzierten szenario nicht nur auf ihre spielpartner, sondernversuchen diese auch aktiv wieder zum Mitspielen zu moti-vieren und wieder ins gesehen einzubinden.111 erstaunli-cherweise beschränkt sich diese beobachtung nicht nur auf
104 waLtHer 1923.105 vgl. toMaseLLo 2008, 178.106 vgl. exemplarisch toMaseLLo & raKoCZy 2003.107 toMaseLLo 1995; LIsZKowsKI et al. 2004.108 vgl. für eine Zusammenschau des gestischen repertoiresvon Primaten PIKa et al. 2005 und CaLL & toMaseLLo 2007.109 vgl. toMaseLLo & CaMaIoNI 1997.110 toMaseLLo et al. 2005.111 vgl. warNeKeN et al. 2006.
situationen, in denen ein spielerfolg aus strukturellen grün-den auf sich allein gestellt eher unwahrscheinlich ist, sonderntritt ebenso in Kontexten auf, in denen sich die beteiligtenKinder ohne Zweifel darüber bewusst sind, dass sie die auf-gabe auch problemlos alleine bewältigen könnten.112 spiele-rische und empathische disponiertheit sind die eckpfeilerdieses Verhaltensrepertoires. das spiel als Motiv tritt gleichin doppelter gestalt zutage. Zunächst fungiert es als Platt-form zur erübung geteilter aktivitäten, die geteilte Intentio-nalität voraussetzen. Zweitens ist das spiel ein simulations-raum, in dem sachverhalte spielerisch fingiert und ausgehan-delt werden können. entscheidend ist, dass menschlicheNachkommen ganz von selbst beginnen, solche simulations-räume kontrafaktischen Charakters zu instanziieren. die ent-wicklungspsychologie fasst jene erscheinung mit den sog.als-ob-spielen. als-ob-spiele folgen der struktur ‘x gilt iny als Z’. sie sind insofern kontrafaktisch, als diese geltungs-funktion letztlich völlig entkoppelt von den natürlichen ei-genschaften der betroffenen objekte, deren Funktion oderbeschaffenheit ebenso wie von natürlichen tatsachen ist. be-reits im alter von zwei Jahren beginnen Kleinkinder, spiele-risch sachverhalte hervorzubringen, die einen als-ob-Cha-rakter haben.113 diese szenarien der geteilten Fingierung in-volvieren beispielsweise spielklötze, die dann als Äpfelgelten.114 die Zuschreibung einer bestimmten statusfunk-tion ist arbiträr. dennoch, und das ist das entscheidende, hatdie deklaration ‘x gilt in y als Z’ nur dann eine reale wirk-kraft, wenn diese sich als geteilte oder kollektive Intentionentfaltet. Nur wenn alle in diesem Kontext y bereit sind, yals Z gelten zu lassen und dies als präskriptiv, d. h. letztlichnormativ bindend zu verstehen, ist eine statusdeklarationdieser gestalt überhaupt denkbar.
offensichtlich entwickelt der menschliche Nachwuchsbereits sehr früh in seiner Life-History nicht nur spielerischdie Fähigkeit, soziale tatsachen kurzzeitig in simulationsräu-men zu konstituieren, sondern diese auch als solche zu ver-stehen. wird diesen Kindern im gleichen Kontext y einekonfligierende geltung ihres mit einer statusfunktion beleg-ten objektes präsentiert – beispielsweise einen stift, der imKontext y als Zahnbürste gilt, wieder als schreibwerkzeugeinzusetzen –, reagieren diese empört und irritiert. wymanet al. konnten in einer raffinierten Versuchsanordnung nach-
warum Menschen empathische wesen sind 41
weisen, dass schon dreijährige Kleinkinder die Indexikalitätvon statusfunktionen verstehen.115 die Kinder wurden inverschiedenen Kontexten auf bestimmte objekte und derenstatusfunktion geprimt, die Funktionen derselben objektevariierte jedoch durch die Kontexte. auch wenn die Kinderdazu gezwungen wurden, häufig zwischen den verschiedenenKontexten hin und her zuspringen, konnten sie der Kontext-spezifität gerecht werden und zeigten dort ihre empörung,wenn diese verletzt wurde. Insofern tritt das Moment der im-pliziten Normativität sozialer statuszuschreibungen zutage,eine art Verpflichtung, die derjenige, der an der sozialenKonventionalisierung von sachverhalten und Handlungsvor-schriften teilhaben will, eingehen muss. geteilte Intentiona-lität hat nicht nur die Macht, soziale tatsachen zu schaffen,sondern diese auch mit einer bindenden Kraft zu versehen.rakoczy und tomasello haben vorgeschlagen, die spielerischeFingierung kontrafaktischer sachverhalte impliziter Norma-tivität als entwicklungsgeschichtliche wiege des menschli-chen Verstehens sozialer Konventionen zu begreifen.116 dieKoordination individuierter Intentionen, die über empathi-sche Kanalisierung von geteilter Intentionalität zu kollektiverIntentionalität führt, markiert eine ganz entscheidende wei-chenstellung in der sozialen evolution des Menschen. dieserPunkt wird jedoch an anderer stelle verhandelt. wichtig andieser stelle ist zunächst, dass die gestalt der gemeinsamenPartizipation an aktivitäten, erst spielerisch fiktiv, dann sozialreal, beim Menschen bereits ontogenetisch eine Form dergeteiltheit von Intentionen nahelegt, wie sie bei nicht-menschlichen tieren bisher nicht beobachtet werden konnte.
Natürlich koordinieren auch schimpansen, bonobos undLöwinnen ihre aktionen, wenn sie gemeinsam auf die Jagdgehen. die beste erklärung für diese Form der kooperativenInteraktion ist jedoch, dieses Verhaltensmuster analog zurbrutpflegeevolution als eine selektierte Verhaltensstrategie zubeschreiben, die wohl am einfachsten mit der Parallelisierungvon absichten umschrieben werden kann.117 Nicht jedeForm der kooperativen Interaktion impliziert automatischgeteilte Intentionalität. Mit tomasello lässt sich festhalten,dass die strukturdifferenz in der Koordinationsleistung vonMenschen und nichtmenschlichen Primaten vor allem darinbegründet ist, dass sich die soziale Kognition nichtmensch-licher Primaten auf das erschließen der relevanten alteritäts-informationen für das erreichen individualistischer Ziele be-schränkt.118 Nirgendwo anders im tierreich konnte bis datoirgendeine Form sozial anerkannter, symbolischer oder nor-mativer regelordnungen beobachtet werden.119 auch wenndie Kulturtechniken und traditionen von nichtmenschlichenPrimaten zweifelsfrei beeindruckend sind, ist keine von ihnenim engeren sinne konventionalisiert.120 das Leben in grup-pen impliziert automatisch eine soziale Koordination vonHandlungen, beispielsweise zur Konfliktminimierung, nichtaber eine, die erst durch Konventionen im rahmen von ak-tivitäten geteilter Intentionalität konstituiert wird.121
112 vgl. grÄFeNHaIN et al. 2009.113 HaIgHt & MILLar 1992.114 vgl. raKoCZy 2006 und 2007.115 vgl. wyMaNN et al. 2009.116 vgl. raKoCZy & toMaseLLo 2007.117 wyMaN & raKoCZy 2011, 132.118 vgl. toMaseLLo 2008, 190f.119 vgl. u. a. HILL et al. 2009.120 vgl. exemplarisch wyMaN & raKoCZy 2011.121 vgl. exemplarisch LewIs 1969.
die anthropologische bedeutung kollektiver Intentionalität
I am curious. Have the Q always had an absence of manners?
Or is it the result of some natural evolutionary process that comes with omnipotence?
tuvok zu Quinn.star trek Voyager, „death wish“
Kollektive Intentionalität ist als kultureller evolutionsfaktorgar nicht hoch genug einzuschätzen. wie schon searle be-tont hat, ist kollektive Intentionalität das gerüst jeglichersozialität, deren ordnungsprinzipien nicht lediglich ein wi-derhall ökologischer rahmung sind.122 erst mit der geteilt-heit von absichten auf der ebene sozialer einheiten stellensich soziale Tatsachen ein, welche gruppenspezifisch sind. dasklassische beispiel dafür ist geld. erst durch seinen Kontext,und nur durch diesen, hat geld seine status funktion als gül-tiges Zahlungsmittel inne. geld ist im Kontext der erde imJahr 2013 ein sozialer Fakt, hervorgebracht von der geteiltenIntentionalität der diese bewohnenden Menschen. die Kon-textabhängigkeit sozialer tatsachen wird schon allein da-durch deutlich, dass extraterrestrische und intelligente Le-bewesen offensichtlich nicht mit geld bezahlbar sind,zumindest nicht mit dem Papiergeld der erde. die präskrip-tive Logik impliziter Normativität entfaltet, wie wir gesehenhaben, eine interindividuelle Verpflichtungsdimension aufdie durch geteilte Intentionalität hervorgebrachten sozialenFakten. diese sind letztlich nicht determiniert, sondern viel-mehr kontextspezifisch. das hat weitreichende Konsequen-zen. soziale einheiten, die auf der basis kollektiver Intentio-nalität als autonome einheiten agieren können, instanziierenihre jeweils eigene, je gruppenspezifische soziale realität. weiljede gruppe dabei prinzipiell aus dem vollen Inventar mög-licher sozialer welten schöpfen kann (es kommen wohl nochökologische Faktoren hinzu, die diesen Möglichkeitsraumbegrenzen, was aber vermutlich zu vernachlässigen ist), re-sultiert das in evolutionären Zeitdimensionen in einer phä-notypischen diversifizierung der sozialen gruppen. sozialeKonventionen führen zu einer Maximierung der Hand-lungskonformität ‘innerhalb’ der grup pe bei deren gleich-zeitiger Minimierung ‘zwischen’ den einzelnen gruppen.das ergebnis ist soziale und kulturelle gruppenindividuie-rung. Jede soziale einheit prägt eine charakteristische, habi-tuelle eigenheit aus, die sich letztlich in soziokulturellenIdentitäten manifestiert. die kulturelle diversität, die denMenschen und seine Kulturtechnik so wesentlich auszeich-net, findet ihre grundlage in der empathisch vermitteltenKoordination durch kollektive Intentionalität (hinzu trittnoch ein Fremdabgrenzungsmoment, das an anderer stelleerörtert wird). gruppen operieren sehr viel deutlicher alszuvor nach ihrer eigenen, inhärenten Logik. Kultur entkop-
42 shumon t. Hussain
pelt sich von seiner ökologischen Fundierung, seiner bio-kulturellen Nische, wie der ‘spaceshuttle von seiner träger-rakete’.
Menschheitsgeschichtlich sind diese entwicklungen re-lativ spät festzumachen. erst mit der Herausbildung kom-munaler Kulturkapazität vor knapp 100 000 Jahren ist einedergestaltige eigendynamik soziokultureller Prägung zuidentifizieren. erst dann sind soziokulturelle Identitäten fass-bar. die weitgehend homogene Kulturlandschaft, die dasPleistozän geprägt hat, wandelt sich in eine heterogene,deren Paradigma die kulturelle Fragmentierung ist.123 dieKonventionalisierung der alltagspraxis schlägt sich archäo-logisch in einer Fülle nichtfunktionaler objekte nieder, wel-che die soziale Morphologie dieser gesellschaften, deren so-ziale tatsachen, spiegeln. entsprechend sind jene artefakteauch kaum mehr dekodierbar, sie können nur im abgleichder sozialen tatsachen gelesen werden, die sie einst motiviertund hervorgebracht haben. Zum ersten Mal in der evoluti-onsgeschichte des Menschen wird die domestikation desraums spürbar. Menschen folgen Konventionen, die tabuund Muss abstecken; doch dazu später mehr. eines scheintklar zu sein. Mit tomasello und rakoczy lässt sich offenbarin der tat sagen, dass kollektive Intentionalität in dermenschlichen Lineage erst mit Homo sapiens auf den Plantritt und dessen Kulturtechnik in der gestalt kommunalerKultur von derjenigen aller anderen Hominiden und Pri-maten unterscheidet.124 Möglicherweise reicht die Implika-tion jedoch noch weiter. gilbert und anderen folgend lässtsich konstatieren, dass soziale einheiten nur dann als auto-nom agierende entitäten fungieren können, wenn sie aufder grundlage kollektiver absichten operieren. das hatKonsequenzen für die dynamik kultureller evolutionspro-zesse. es ist gut möglich, dass die bedeutung der kulturellenevolution in der anthropogenese bis dato weitgehend über-schätzt worden ist.125 Für kulturelle selektion auf der grup-penebene ist nämlich erstens kulturelle Variabilität und zwei-tens kulturelle autonomie notwendig. beides ist erst mit deremergenz kommunaler Kultur zu erwarten.126 Kulturelle
122 vgl. neuerdings searLe 2010.123 vgl. exemplarisch gaMbLe 1999; und vor allem gaMbLe2007.124 vgl. grundlegend zu dieser Hypothese toMaseLLo & ra-KoCZy 2003.125 vgl. zur kulturellen evolution grundlegend rICHersoN &boyd 2005; und neuerdings sCHurZ, 2011, 189ff.126 die bedeutung der autonomie in der evolution wird aktuellverschiedentlich diskutiert. deutlich wird dabei zusehends, dassautonomiezunahme eine wichtige triebkraft der evolution, einwichtiger Motor evolutionärer entwicklungen ist. offen ist dem-gegenüber, inwiefern evolution in einer autonomiezunahme re-sultiert, inwiefern Flexibilität eine entscheidende evolutionäreschwellenfunktion ist (vgl. exemplarisch VareLa 1979; rossLeN-broICH 2007; streFFer 2009 sowie jüngst rossLeNbroICH 2009).
warum Menschen empathische wesen sind 43
schematische darstellung der Kultur-geographie im afrikanischen Middlestone age (Msa), welche die Frag-mentierung der kulturellen Land-schaft in dieser Phase der Mensch-heitsgeschichte deutlich werden lässt.Funktional überdeterminierte unddamit eindeutig stilistisch gemeinteProjektilspitzen aus lithischem Mate-rial sind spezifisch für bestimmte re-gionen und technokomplexe undkönnten die ersten ‘echten’ diskretensoziokulturellen einheiten, die sichbereits nach außen hin abgrenzen, an-zeigen.
a atérien; b Prä-aurignacien; c Nubisches Msa; d Äthiopisches Msa; e Kenia-grabenbruch Msa;f Mumba-Industrie; g bambatan/ Pietersburg; h Howiesons Poort; i still bay; k Msa I-IV; l Lupemban; m Katanda Msa. (Verändert nach: MCbrearty 2007,Fig. 12.2)
schematische darstellung des Zerfallens der kulturellen Landschaft im frühen Jungpaläolithikum in einzelne distinkte ‘traditionsareale’(schraffiert), die sich durch ein einzigartiges Herstellungs- und Formengepräge im schmuckkanon auszeichnen (a–f ). diese räumekönnen als resultat von soziokulturell getragener Mnemotechnik gedeutet und entsprechend als Identitätsräume begriffen werden. (Zusammengestellt aus: VaNHaereN & d’errICo 2006, Figs. 1; 5)
44 shumon t. Hussain
die abbildung zeigt die bis heute ältesten belege für hölzerne Jagdwaffen, die modernen speeren schon sehr nahe kommen. alle exemplareentstammen der knapp 300 000 Jahre alten altsteinzeitlichen Fundstelle von schöningen bei Helmstedt, die sich unter speziellen ab -lagerungsbedingungen exzellent erhalten haben. 1 schöninger speere 1 und 2, die unmittelbar am ufer eines Paläosees neben zahlreichen Pferdeüberresten gefunden wurden. 2 angekohlter Fichtenholzstab aus schöningen 13 II-4 in situ. 3 unvollständiger speer 7 aus Fichte, ebenfalls in situ. 4 Holzobjekt aus schöningen 12 b, Fundschicht 1, das als Klemmschaft gedeutet wird M. 1:3. (Zusammengestellt aus: KLeIN 2009, Fig. 5.60; seraNgeLI et al. 2012, abb. 13 [© Niedersächsisches Landesamt für denkmalpflege,Foto: P. Pfarr & w. Mertens]; seraNgeLI et al. 2012, abb. 10 [Foto: Ch. s. Fuchs]; seraNgeLI et al. 2012, abb. 14 [© NiedersächsischesLandesamt für denkmalpflege, Foto: P. Pfarr & w. Mertens], mit freundlicher genehmigung utz böhner)
1
2
43
evolution wird damit cum grano salis erst dann in ernstzu-nehmendem Maße möglich, wenn soziale einheiten quakollektiver Intentionalität als autonome entitäten agierenkönnen. so gesehen ist der kulturelle evolutionsfaktor einverhältnismäßig junger, der erst mit dem modernen Men-schen so richtig an Fahrt aufnimmt.
Kooperative Jagd wie sie verschiedentlich und promi-nent unter anderem in schöningen in Mitteldeutschlandim Kontext weitaus älterer Zeithorizonte innerhalb derHumanevolution diagnostiziert worden ist, erscheintdamit in einem neuen Licht. Zumindest aber ist schönin-gen mit seinen etwa 300 000 Jahre alten und hervorragend erhaltenen Jagdspeeren aus Koniferenholz mit dieser Per-spektive konsistent.127 Frühmenschen haben ohne jedenZweifel schon sehr viel früher gemeinsam gejagt und so-ziale aktivitäten ausgeübt. aber, und das ist hier meinestarke ese, eben in einem koordinativen stil, d. h. nichtunter dem schirm kollektiver Intentionalität, sondern ähn-lich den höheren nichtmenschlichen Primaten unter demschirm einer Parallelisierung ihrer je individuellen absich-ten in der Form herausselektierter und damit sistierter Ver-haltensstrategien. entgegen den Vertretern der Positioneines makrofundierten Humanspezifikums in der Formkollektiver Intentionalität bin ich davon überzeugt, dasssich ein solches auch unter dem Paradigma des methodi-schen Individualismus finden lässt. Kollektive Intentiona-lität versteht sich unter diesem blickwinkel als abgeleiteteFunktion empathischer disponiertheit. empathie, so lässtsich vielleicht sagen, ist die basisfundierung des menschli-chen Makrospezifikums. die empathisch mediierte Inter-subjektivität des Menschen ist die kognitive grundlage sei-ner einzigartigen Kulturtechnik.
Identität als sublimat des kulturellen gedächtnisses
ese are our stories. ey tell us who we are.
worf zu toq über die klingonische Mythologie.star trek tNg, „birthright, Part II”
soziokulturelle Identität ist das entscheidende Moment, wel-ches sich unmittelbar im anschluss an die speziation desanatomisch modernen Menschen entfaltet und von da anseinen siegeszug um die ganze welt begleiten sollte. Ichwerde an dieser stelle dafür argumentieren, dass die Heraus-bildung und Konsolidierung kollektiver Identitäten, welchein jenem Zeitfenster archäologisch zutage treten, mit einerschärfung der kulturellen Mnemotechnik einhergeht. sta-bile Identitäten dieser art sind auf eine iterative aktualisie-rung ihrer Konstituenten angewiesen, an ein kollektivessich-erinnern-Können. das Fundament kollektiver Identi-tät transzendiert damit die grundlagen individueller Iden-
warum Menschen empathische wesen sind 45
titätsbildung, die noch weitgehend über persönliche erfah-rung entwickelt wird, ist also in einem extraindividuellenMechanismus zu verorten. soziale einheiten sind gezwun-gen, sich selbst erinnerungsräume zu stiften, in denen diejeweils identitätsstiftenden gehalte immer wieder abgerufenwerden können. assmann hat dieses Medium gemeinsamenerinnerungsvollzugs als „kulturelles gedächtnis“ bezeich -net.128 In vorschriftlichen gemeinschaften mit diskreterIdentität wird dieser raum des kollektiven erinnerns durcheine verschärfte ritualisierung der alltagspraxis geöffnet.diese sozialen einheiten zeichnen sich durch rituelle Kohä-renz aus.129 auf der basis rituell geordneter Mnemotechnikbilden diese entitäten eine „konnektive struktur“ aus, dieverbindet und verknüpfend wirkt,130 und zwar in zwei di-mensionen: in der sozialdimension und in der Zeitdimen-sion. auf diese weise wird kulturelle Kontinuität gestiftet,das gemeinsame In-einer-tradition-stehen. dieses ist dieprimäre ableitungsfunktion gruppenspezifischer Identitä-ten, die sich durch Konservativität und tendenzielle Zeitin-varianz auszeichnen. Insofern ist die Konnektivität sozialereinheiten eine beachtliche Kohäsionskraft, eine Kraft, diesoziale einheit gewährleistet. das kulturelle gedächtnis un-terfüttert das auseinanderdriften einzelner gruppen inihrem habituellen gepräge.
eines ist jedenfalls ganz klar: der objektivierende undzeitinvariante Korpus eines solchen extraindividuellen ge-dächtnisses erfordert eine Kodierung seines gehalts, der un-abhängig vom Individuum, aber abhängig vom soziokul-turellen umfeld verstanden werden kann. Möglicherweiseist das der tiefere grund, der die augenscheinliche semio-tisierung der kulturellen Landschaft beim modernen Men-schen begleitet. was sich im boden der Zeit erhalten hat,sind genau jene artefakte, die den Charakter extrasomati-scher trägermedien einer gewissen Zeichenhaftigkeit haben.Zeichen, die nur in ihrem Kontext, in ihrer jeweiligen kon-nektiven struktur dekodiert und gelesen werden können.artefakte dieses typs treten spätestens vor 80 000 Jahrenauf. In der südafrikanischen blombos-Höhle konnte eineganze Kollektion gravierter ockerstücke, insgesamt mehrals achttausend objekte, von denen mindestens neun gra-vuren zu tragen scheinen, identifiziert werden. es handeltsich um geometrische Linien, die ein abstraktes Muster bil-den (s. abb. s. 32). Ähnliche Zeichen finden sich im süd-afrikanischen diepkloof.131 es ist eine Fundstelle untereinem Felsvorsprung, in der zweihundertsiebzig intentionell
127 vgl. zu schöningen grundlegend tHIeMe 1997 und 2007.128 vgl. grundlegend assMaNN 1992; aber auch assMaNN 2000.129 assMaNN 1992, 18f.130 assMaNN 1992, 16ff.131 vgl. HeNsHILwood et al. 2002.
markierte straußeneifragmente geborgen wurden. die stü-cke datieren mit etwa 60 000 bP in die Phase des südafri-kanischen Howieson’s Poort.132 beindruckend ist an diesenobjekten nicht nur die tatsache, dass sie selbst nach einerso langen Zeit im sediment noch unterschiedlichste Farb-spuren aufweisen, sondern auch über einen geschlossenenstratigraphischen abschnitt der archäologischen sequenzstreuen (s. abb. s. 38). die analyse der gravierungstech-nik, aber ebenso das geometrische grundkonzept der Ver-zierungen selbst verweisen damit auf eine traditionsliniesemiotischer Prägung, die bereits im Middle stone age, inder mittleren altsteinzeit des afrikanischen Festlands auf-tritt.133 auch wenn sich schon jetzt dergestaltige Hinweisein afrika, der wiege der Menschheit, mehren, ist im an-gesicht einer sich dort erst langsam intensivierenden For-schungsarbeit noch vieles zu erwarten.
anders verhält es sich auf dem europäischen Konti-nent. dort kann die archäologie auf eine lange und viel-schichtige auseinandersetzung mit den paläolithischenHinterlassenschaften zurückblicken. In europa ist diesinn- und Zeichenhaftigkeit archäologischer artefakte vorallem im Kontext der kontrovers geführten debatte umden Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum disku-tiert worden. auf dem Kontinent zeichnet sich wohl erstmit dem initialen Jungpaläolithikum, dem aurignacien,dessen träger der anatomisch moderne Mensch ist, eineetablierung kohärenter und extrasomatischer sinnsystemeab.134 erst kürzlich konnte Porr erneut unter streichen, dassdas als ‘Kunst’ gelabelte artefaktspektrum aurignacienzeit-licher Kontexte einer gewissen ordnung unterliegt, sprich:trotz dessen individualisiertem Charakter und lokalenFluktuationen scheint es nicht etwa arbiträre oder zumin-dest je individuierte sinneinheiten abzubilden, sondern esmuss vielmehr davon ausgegangen werden, dass jene ge-genstände in einen sinnhaften Kanon kultureller semantikeingelassen waren.135 Mit Porr kann zumindest im Falleder südwestdeutschen regionalausprägung des aurigna-cien von einer erinnerungskultur gesprochen werden.Kontinuität und Kohärenz werden durch ein verfestigtesrepertoire kultureller Zeichen gestiftet, die materiell, d. h.extrinsisch gespeichert und damit bewahrt werden. dieseMnemotechnik, die die gestalt jener kulturellen erschei-nung auf der einen seite diskret macht, auf der anderenseite aber auch erst mit Inhalt füllt und damit eine Iden-tität verleiht, kann mit recht als das symptom einer schär-fung kultureller gedächtnisleistungen verstanden wer-den.136 In europa verdichten sich offensichtlich erst mitdem erscheinen des modernen Menschen zwischen 30 000und 40 000 bP die anzeichen für erste weitgehend auto-nome erinnerungsräume, die auf kultureller gedächtnis-bildung beruhen. ausgehend von der beobachtung (diefür viele bereiche paläolithischer Kunst, insbesondere aberfür die jüngere Höhlenkunst ebenfalls gilt), dass die Klein-
46 shumon t. Hussain
kunstwerke weder als einfache spiegelung der herrschen-den ökonomischen Verhältnisse oder der bedeutung derdargestellten tiere für die subsistenz noch als repräsenta-tive abbildung der jeweils erfahrbaren Fauna gelten kön-nen, kommt Porr ähnlich wie schon Hahn zum befundeiner bewussten, intentionellen wahl bei der Konfigura-tion und Form der einzelnen statuetten.137 Ferner glaubtPorr eine art mythologischer ordnung extrapolieren zukönnen, die durch gegensatzpaare, durch eine binärestruktur gekennzeichnet ist. die semantik sei von der bi-nären differenz von männlich-weiblich, karnivor-herbivor,aktiv-statisch, schnell-langsam und offen-geschlossendurchsetzt.138 das ergebnis erinnert nicht nur an dieHahn‘sche Pionierdeutung paläolithischer Kunst nach denPrinzipien von „Kraft und aggression“, sondern auch anjene von Leroi-gourhan. dessen untersuchung der west-europäischen Höhlenkunst des aurignacien, gravettien,solutréen und Magdalénien offenbart eine räumliche ord-nung der Zeichen im Höhlenkörper. so liegen die einfa-chen, abstrakten Zeichen in den kleineren durchgängen,während die tierdarstellungen in den größeren Höhlen-abschnitten verortet werden können.139 auch Leroi-gour-han sistiert in seiner analyse eine semantische dichotomiezwischen weiblichem und männlichem Zeichenkorpus.140
Jedenfalls beruht diese ausdeutung auf kulturanthropolo-gischen und ethnolinguistischen ansätzen, die eine Not-wendigkeit der dualistischen Konzeptualisierung der weltstrukturell sowohl in sprache als auch in Mythologie an-gelegt sehen. anthropologen haben immer wieder daraufhingewiesen, dass semantische Pole die eckpfeiler jeglichermythologischen repräsentation der welt darstellen.141
unabhängig davon, ob diese inhaltlichen anreicherungenletztlich zu überzeugen vermögen oder nicht, zeigt sichdoch ein gewisses, insgesamt konsistentes Muster in denZeichenkollektionen der jungpaläolithischen Kunst euro -pas. dieses Muster verweist auf eine inhärente und ver-mutlich symbolische ordnung, die einer kulturellen eigenlogik verpflichtet ist, einer sozialen Identität.
132 vgl. texIer et al. 2010.133 texIer et al. 2010.134 vgl. grundlegend zum aurignacien FLoss & rouQueroL2007; insbesondere FLoss 2007 und CoNard 2007.135 vgl. Porr 2010.136 Porr 2010.137 Porr 2010, 97f.; HaHN 1986, 136–138.138 Porr 2010, 100.139 vgl. LeroI-gourHaN 1971, 461–483.140 vgl. LeroI-gourHaN 1976, 108f.141 vgl. raPPaPort 1999.
warum Menschen empathische wesen sind 47
auswahl persönlicher schmuckelemente aus den jungpaläolithischen Höhlen der schwäbischen alb, die einen guten eindruck über diediversität und Qualität der portablen objekte aus dem ‘Kunstsektor’ des Jungpaläolithikums vermitteln: 1–15 Vogelherd (Nrn. 5–7sind holozän); 16–34 Hohle Fels; 35 sirgenstein.(Foto: wieland binczik, © universität tübingen, mit freundlicher genehmigung sibylle wolf )
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35
Nicht zuletzt abgegrenzte ‘stilprovinzen’ verweisen überdas gesamte Jungpaläolithikum hinweg immer wieder aufabgegrenzte Kultur- und Identitätsareale. unterschiedlicheModi des kulturellen gedächtnisses prägen diese Phase dermenschlichen Vorgeschichte. so etabliert sich im frankok-antabrischen raum eine tradition, die auf offenbar räum-
48 shumon t. Hussain
lich fixierter Identitätsstiftung fußt, auf sozialen aggrega-tionsräumen, die so als soziale erinnerungsräume fungie-ren.142 die vielgestaltige Höhlenkunst dieser region istihr Vermächtnis. anders jedoch in Mitteleuropa.
auswahl der mobilen Kleinkunst aus dem aurignacien der schwäbischen alb (alle Vogelherd): 1 Mammut aus Mammutelfenbein;2 Pferd aus elfenbein; 3 unbestimmtes tier aus elfenbein; 4 Feline aus elfenbein; 5 Mammut aus elfenbein; 6 bär aus elfenbein;7 Mammut aus Knochen; 8 gravierte Knochenscheibe; 9 bison aus elfenbein; 10 Feline aus elfenbein; 11 anthropomorphe skulpturaus elfenbein; 12 mögliche Mammutfigur aus sandstein; 13 Löwenkopf aus elfenbein; 14.15 elfenbeinfragment; 16 unbestimmtes tieraus elfenbein; 17 Mammut aus elfenbein. darstellung nicht maßstäblich.(Fotos: Hilde Jensen, © universität tübingen sowie Peter Frankenstein und Hendrik Zwietasch, © Landesmuseum württemberg, stutt-gart, mit freundlicher genehmigung Harald Floss)
1
5
2 3
4 6 7
8 9 10 11
12 13 14
15 16 17
142 vgl. exemplarisch CoNKey et al. 1980 und baHN 1982.
warum Menschen empathische wesen sind 49
ausgewählte beispiele nordspanischer Höhlenkunst, die die außergewöhnliche Qualität des ‘Kunstschaffens’ dieser pleistozänen Jäger undsammler deutlich werden lässt. oben: die berühmte polychrome decke im ‘sala de las picturas’ von altamira. die schwarzroten bisondarstellungen, die diesen bereichder Höhle dominieren, gehören zu den kräftigsten ihrer art in der gesamten eiszeitlichen wandkunst. besonders eindrücklich ist die im-plizite Plastizität der darstellungen, die zum teil genau in natürliche Felsauswölbungen eingepasst sind. (Foto: Heinrich wendel, © wendelCollection, Neanderthal Museum) unten: die schwarzfigurigen Cerviden aus der ‘galeria IV’ von Las Chimeneas. eindrücklich ist vor allem der linke Hirsch mit extremabstrahiertem Kopf, der sich um den Fels regelrecht herumschlingt. (Foto: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)
50 shumon t. Hussain
ausgewählte beispiele westfranzösischer wandkunst aus dem Kernverbreitungsgebiet. oben: der Fries der fünf Mammuts aus rouffignac. Interessant ist vor allem die räumliche Position der gravierten Mammutmotive, diesich linear direkt unter einem prominenten horizontalen Feuersteineinschluss aufreihen, welcher zugleich parallele und geometrische Li-niengravuren im oberen bereich der Höhlenwand von den figuralen gravuren weiter unten abgrenzt. (Foto: Heinrich wendel, © wendelCollection, Neanderthal Museum) unten: das berühmte rote Pferd aus der ‘galerie Jammes’ von Le Portel. das tier ist genau in ein Felssegment eingepasst und eines dereher seltenen beispiele für vollständig flächig ausgemalte bilder. (Foto: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)
warum Menschen empathische wesen sind 51
auswahl der für das europäische gravéttien symptomatischen ‘Venusfigurinen’. das von gerhard bosinski als „Frauenfigurinenhorizont“titulierte Phänomen umspannt räumlich von Iberien im westen bis in die äußersten grenzen sibiriens im osten ganz europa und zeigtdie Präsenz einer vereinenden Idee im Mittleren Jungpaläolithikum an. 1 detailliert gearbeitete Frauenstatuette aus Kostienki 1, die im bestattungskontext gefunden wurde. die Frau hat einen gebeugten Kopf,scheint in spätem stadium schwanger zu sein und weist einige details bei Hals- und Haarschmuck auf. M. 1:2.2 Miniaturfigurine aus Mammutelfenbein, ebenfalls aus Kostienki 1. die schwangere Frau ist im gesichts- und Haarbereich, aber auchwas schmuckelemente betrifft elaboriert gearbeitet. M. 1:1.3 Neun von insgesamt über 30 menschlichen Figurinen aus Mal’ta im südlichen Zentralsibirien. Ähnliche Figuren finden sich in benach-barten Fundstellen und wurden vermutlich im Zeitraum zwischen 25 000 und 21 000 Jahren vor heute gefertigt. etliche von ihnen habenstark weibliche Züge. M. 1:3.4 Zwei weitere Frauenfigurinen aus Mammutelfenbein aus dem erheblichen statuettenrepertoire von Kostienki 1. die mit diesen Figurenassoziierten artefakte gehören ins östliche gravéttien, das in russland und der ukraine etwa auf 24 000–21 000 bP datiert. M. 1:3.(umgezeichnet von Jürgen richter nach: CooK 2013, Figs. 27; 28; 3.4 aus: KLeIN 2009, Figs. 7.29; 7.26)
1
2
4
3
die vergleichsweise hochmobile und flexible Lebensweiseder Jäger und sammler dieser breiten hat dazu geführt, dasssich dort eine andere Form der kulturellen erinnerungspra-xis herausgebildet hat. eine, die mit dieser Lebensweisekompatibel ist.143 demgemäß finden sich vor allem Klein-kunstwerke aus elfenbein. die traditionslinie, die sich übersolch mobiler Kunst entfaltet, mündet in Mitteleuropa nurwenige Jahrtausende später in einem nahezu den ganzenKontinent umspannenden Phänomen. Im gravéttien, zwi-schen etwa 30 000 und 25 000 bP ist dieser raum durchdas auftreten einer Vielzahl kleiner Venusfigurinen ge-kennzeichnet.144 Jener „Frauenstatuettenhorizont“, dersich von westeuropa bis an die ausläufer des urals er-streckt, markiert eine beeindruckende Kulturlandschaft,die jene geteilte Identität nicht nur durch gemeinsame Zei-chennutzung, sondern auch durch eine erstaunlich homo-gene Lebensweise internalisiert hat.145 Nach der entde-ckung der bis dato ältesten Frauenplastik aus demPaläolithikum im südwestlichen deutschland, die ins ba-sale aurignacien datiert und bereits über alle Merkmaleverfügt, die die gravettienzeitlichen Figurinen auszeichnen,wird wieder verstärkt ein gemeinsames erbe dieser beidentraditionsgewebe in erwägung gezogen.146 die „Venusvom Hohle Fels“ gesellt sich mit einem erstaunlichen altervon knapp 40 000 Jahren zu jenen weiblichen berühmt-heiten von willendorf, stratzing und brassempouy undscheint eine entwicklung vorwegzunehmen oder zumin-dest vorzubereiten und anzudeuten, die europa über vieleJahrtausende hinweg prägen wird und in unser aller kol-lektives gedächtnis übergehen sollte.147 die semiotisie-rung der Landschaft selbst (wie spätestens mit den bebil-derten Höhlen Frankreichs und Nordspaniens deutlichwird) ebenso wie die der in sie eingelassenen artefakte tritterst im europäischen Jungpaläolithikum verschärft zutage.damit öffnet sich eine nicht zu unterschätzende differenzzum vorangegangen Mittelpaläolithikum und dessen trä-ger, dem Neandertaler. erst mit dem ausruf „Homo sa-piens ante portam“ verbindet sich für europa ein grund-legender wandel in Kultur- und soziallandschaft. erst mitdem erscheinen des modernen Menschen an den Pfortendes balkans beginnt die europäische geschichte. Identitäterst ermöglicht die Historizität der eigenen Kultur und ver-knüpft nicht nur Menschen über viele generationen hin-weg, sondern auch ganze gemeinschaften mit einer Land-schaft. Vor 40 000 bis 45 000 Jahren erst, so lässt sichpoetisch möglicherweise sagen, erwacht der europäischegeist aus seinem pleistozänen winterschlaf. der Konti-nent sollte sein gesicht für immer verändern. wie keineandere entwicklung hat der evolutionäre entwicklungs-pfad, der in afrika seinen anfang nahm und über die ela-borierung der empathischen Kapazitäten, die Herausbil-dung kollektiver Intentionalität beim modernen Menschenbis zur schärfung der kulturellen erinnerungsleistung und
52 shumon t. Hussain
der etablierung von sozialen Identitäten geführt hat, nichtnur europa, sondern die ganze welt gewandelt. es ist jeneserbe, das den Menschen wie kein anderes zum Menschenmacht. ein erbe, in welchem sein weltgestaltendes Na-turell begründet liegt.
das Moment, in dem dieser trend gleich einer Lich-tung verschärft zutage tritt, verbindet sich mit dem reich-haltigen artefaktkorpus des initialen russischen Jungpaläo-lithikums ebenso wie der des Pavlovian der sibirischenebene.148 Nicht zuletzt in sungir tritt direkt mit dem ana-tomisch modernen Menschen eine ganze Palette semioti-scher objekte auf, die einen Identifikationscharakter habenund diese regionalgruppe von anderen Nachbargruppenabgrenzen.149 bekannt geworden ist vor allem die Homo-Sapiens-bestattung aus sungir, die allein mit mehr als drei-tausendfünfhundert elfenbeinperlen assoziiert ist.150 diesePerlen sind mit anderen teils plastischen schmuckelemen-ten wie Pferdeanhängern konstitutiv für jenen Identitäts-raum. diskreter Habitus grenzt nach außen ab und ist aus-druck einer kulturellen Identität.151 Jedenfalls ist diediversifizierung im Jungpaläolithikum ein definitorischesMerkmal, welches mehr als deutlich im materiellen be-stand dieser epoche widerhall findet.152 Identitätsbildungfällt damit nicht zufällig mit der evolutionären emergenzder kollektiven Intentionalität in sozialen einheiten zu-sammen. Nach tomasello ist das teilen von emotionenund mentalen einstellungen eine Funktion jener grup-penidentität. außer der sprache stellt nicht zuletzt die em-pathische Verfügbarmachung und synchronisierung diesermentalen gehalte einen grundständigen Mechanismusdieser art bereit.153 empathie ist ein bedingendes Momentübergeordneter Identitätsbildung.
143 vgl. Porr 2010, 97.144 vgl. grundlegend deLPorte 1993; aber auch soFFer et al.2000 und sCHLesIer 2001.145 vgl. soFFer et al. 2000.146 vgl. Porr 2010, 103 und CoNard 2009.147 vgl. CoNard 2009; zur Venus von willendorf vgl. sZoM-batHy 1910–1911; FeLgeNHauer 1956–1959 und aNtL-weI-ser 2008; zur Venus von stratzing vgl. Neugebauer-MaresCH1989; zur Venus von brassempouy vgl. deLPorte 1993; 1995.148 vgl. u. a. abraMoVa 1995 und FarbsteIN 2011.149 vgl. grundlegend bader 1978.150 vgl. u. a. KuZMIN et al. 2004.151 vgl. etwa FLoss 2009.152 vgl. etwa CHase 2003; stINer 2002; strINger & gaMbLe1993; vgl. für das kontemporäre afrika aber auch dICKsoN &gaNg 2002.153 vgl. toMaseLLo 2008, 211f.
warum Menschen empathische wesen sind 53
reiche einzel- und doppelbestattung aus dem einsetzenden Jungpaläolithikum der russischen steppe. die in sungir niedergelegten In-dividuen werden von etlichen tausend elfenbeinperlen begleitet. außerdem fanden sich durchlochte röhren und tierzähne, teilweiseverzierte tierplastiken, radähnliche objekte und ein „bâton de commandement“.(Zusammengestellt aus: abraMoVa 1995, Figs. 50; 51 sowie bader & bader 2000, Figs. 1.4; 1.6)
I.5 eMPatHIsCHe PosItIoNaLItÄt, aus -tausCH NetZe uNd dIe wurZeLN der ZIVILIsatIoN
wo der Mensch in der welt zu verorten ist
I realize it may be difficult for you to help save this creature’s life ... but part of becoming human
is learning to have compassion for those who are suffering ...even when they’re your bitter enemies.
Janeway zu seven of Nine über ein Mitglied von spezies 8472.star trek Voyager, „Prey”
Homo empathicus. die anthropologische gestalt des empa-thischen Menschen ist, wie deutlich geworden sein sollte,eine bisher signifikant unterschätzte dimension desMenschlichseins in der welt. schon Plessner hat herausge-arbeitet, dass die menschliche Lebensform wie die aller or-ganismen durch ein Verhältnis zu ihrer umwelt gekenn-zeichnet ist. dieses Verhältnis ist zu spezifizieren. die Fragenach dem wo des Menschen in der welt ist also immer dieFrage nach seiner eingelassenheit in einen relationalistischgedachten weltzusammenhang. Menschsein ist deshalb vorallem durch eine gestelltheit in der welt bestimmt, letztlichdurch eine Position im Netz des differenten, in der Vielheitder einheit. die Verortbarkeit menschlichen seins entzün-det sich an der Frage nach der Positionalität.154 Mit blickauf die archaische grundstruktur des menschlichen sich-ins-Verhältnis zum anderen setzen und in anlehnung andie Plessner’sche Fassung des anthropos möchte ich vorschla-gen, die stellung des Menschen in der welt durch seine ‘em-pathische Positionalität’ zu begreifen. es ist das dialektischeVerhältnis zwischen ego und alter, oder anders ausgedrücktjene in der wahrnehmung eingelassene differenz, die gleich-sam die Voraussetzung eines ‘aus-sich-Heraustretens’ ebensowie die eines ‘sich-Hineinversetzens’ ist. empathische dis-poniertheit ist eine grundvoraussetzung der alteritären er-fahrbarkeit.155 erst wechselseitige abarbeitung von bewusst-seinssubjekt und anderen entitäten – wobei zunächst sozialeakteure im Mittelpunkt stehen – in der Form eines empa-thischen bewusstseins konstituiert und charakterisiert jeneForm der menschlichen Interrelationalität und Interkonnek-tivität, die so augenscheinlich ist. erst jene in der empathi-schen Verfasstheit eingelassene grunddifferenz ermöglicht,um es in begriffen der Phänomenologie auszudrücken, eineart Horizontannäherung, die Verringerung jener distanzzweier sich epistemisch nicht zugänglicher akteure. auchwenn man mit rombach versucht ist, im Hinblick auf em-pathie von einer Inkarnierung in fremde wahrnehmungs-felder zu sprechen, wird das dem sachverhalt nicht wirklichgerecht.156 die empathische brücke der Intersubjektivitätkann zwar unbestritten als anreicherung der eigenen wahr-
54 shumon t. Hussain
nehmung, als ausdehnung des Horizonts verstanden wer-den. die Integration fremder wahrnehmungsfelder gelingtjedoch nur unter Vorbehalt. sie kann auch nur unter Vor-behalt gelingen, weil sonst die differenz der einzelnen ak-teure wieder verschwimmen würde. Nähe impliziert immerdie gefährdung des eigenen durch das aufgehen im Nahen.Insofern kann die Horizontverschmelzung zwar als phäno-menologische Metapher für den empathischen Vollzugfruchtbar gemacht werden, aber jeweils nur unter der Vo-raussetzung, dass es sich um eine regulierte, um eine die dif-ferenzen erhaltende Verschmelzung handelt; eine, die Iden-tität unterbindet. empathische Positionalität ist, wenigerproblematisch gesagt, mit dem erkennen neuer wahrneh-mungsfelder verbunden. empathie ist so gesehen die Koor-dinationsleistung des kognitiven apparats im angesichteiner sich als äußerst komplex erweisenden mentalen um-welt. empathie ist die interpretative, deutende, zuschrei-bende und damit auch aktive Interaktion mit der welt desMentalen, die so völlig anders sein kann und oft auch ist alsdie jeweils eigene.
Mit der genese und elaborierung empathischer Verfasst-heit ist deshalb auch eine reorganisation des menschlichenwahrnehmungsapparats verbunden. Jene reorganisation hatihre transzendentale bedingung in der selbstdistanzierungdes wahrnehmungssubjekts, in der Möglichkeit, zu sichselbst in ein reflexives Verhältnis zu treten und sich damitgleichwohl selbst zu transzendieren. empathie ist eine (wennauch eine sehr schwache) Form der selbsttranszendenz, dieauf die unmittelbare umwelt gerichtet ist. die grammatikempathischer erfahrung rückt empathiegeschichte nahe andie Menschheitsgeschichte heran, auch wenn die letzterenicht ganz in ersterer aufgeht. empathische Positionalitätspiegelt so die synthese von biologischen anlagen und so-ziokulturellem entwicklungspotenzial, welche in der einzig-artigen Konfiguration menschlicher sozialleistungen ersicht-lich wird. bevor ich mich einem konkreten beispiel für einesolche sozialleistung, die sich wesentlich aus dem Momentdes Verbindenden speist, zuwenden werde, müssen einigetheoretische aspekte der empathie diskutiert werden. Mittomasello ist festzuhalten, dass das erkennen von anderenals intentionelle akteure eine zentrale Voraussetzung für denfür Menschen spezifischen weltzugang schafft.157 da ichhier die Hypothese vertrete, dass dieser Zugang entschei-dend von empathie kanalisiert und bestimmt wird, tretenzwei Momente auf den Plan, die im Hinblick auf empathiestets mitgedacht werden müssen: apräsentation und antizi-pation. durch empathischen Zugriff auf den jeweils ande-
154 vgl. PLessNer 1929.155 vgl. dazu auch breItHauPt 2009, 54ff.156 vgl. roMbaCH 1980, 171ff.157 vgl. exemplarisch toMaseLLo 2002, 80ff.
ren, auf dessen Figuration, wird das Vor-Verstehen einerseitsermöglicht, andererseits auch vorausgesetzt. Paradoxerweisemuss alter bereits vor der empathisierung zu einem gewissengrad bekannt sein, um als empathieobjekt zu taugen. Hierwurzelt möglicherweise die Notwendigkeit einer Vorurteils-bildung.158 das öffnet den raum für handlungs- und ko-gnitionsbezogene antizipation. Handlungs- und Kogniti-onsmuster werden gleichsam apräsentiert, d. h. noch bevorsie realisiert werden, mental als möglich verarbeitet. antizi-pation und apräsentation formen einen Komplex, der mitder Herausbildung von empathie einhergeht, und bildendie eckpfeiler jener sozialen Interaktion, die so sehr auf Ko-ordination in sozialen einheiten fußt. beide sind insofern‘erübte’ Formen der empathie, als dass sie in der alltagspra-xis nur dann orientierung stiften, wenn sie quasi-affektivabgerufen werden können. beide sind symptome der Mo-dellierung möglicher Handlungs- und Kognitionsräume.empathie ist unter diesem gesichtspunkt auch als Funktioneiner synchronisation der nicht-eigenen Möglichkeitsräumesowie als deren Vor-Kalkulation zu verstehen. empathie in-volviert also eine ganze reihe hochsozialer Mechanismen,die zusammengenommen eine beachtliche wirkkraft im be-reich der sozialen Interaktion und der organisation sozialereinheiten entfalten können. Ich werde daher nun der kriti-schen Hypothese einer elaborierung der sozialen systemeim für uns relevanten Zeitraum, in afrika zwischen 150 000und 80 000 bP und in europa zwischen 45 000 und 20 000bP, nachgehen.
die implizite reziprozität empathischer Verfasstheit
We’re creating a society here – one that’s based on tolerance, shared responsibility, and mutual respect
that people like you and I were raised to believe in. We’re not about to give it up just because it’s difficult.
riley Frazer zu Chakotay.star trek Voyager, „unity“
Nachdem zunächst auf den soziokulturellen einschnittzwischen 80 000 und 40 000 bP, der von einer kommuna-len Kulturkapazität markiert wird, aufmerksam gemachtwurde, ist es nun an der Zeit, den blick auf kleinteiligeregestaltveränderungen der sozialen Landschaft zu richten,die ebenfalls in diesen Zeitraum fallen. bevor dies gesche-hen kann, ist jedoch noch einmal auf die reziprozität empathischer Positionalität einzugehen. wenn das empa-thische als Lösung sozialer Koordinationsprobleme ver-standen wird, ist es schon insofern wechselseitig, als dassKoordination eben darin besteht, das Verhalten und dieerwartungen des anderen zu antizipieren und sein eigenesVerhalten und erwarten danach auszurichten, und zwar in
warum Menschen empathische wesen sind 55
beide richtungen. In einer zweistelligen empathierelationzwischen sozialen akteuren stimmt sich a auf b ab, aber bstellt sich eben auch auf a ein. wie schon breithaupt er-kannt hat, ist diese Form der reziprozität indes nicht dieeinzige, die im rahmen der empathie auf den Plan tritt.159
empathie ist immer schon eine Leistung. das temporäreausstreichen seiner selbst kann ego durchaus in die Lageversetzen, etwas von alter zu erwarten. durch die beseiti-gung des widerstands, durch die Perspektivübernahmehilft ego alter nach dieser Logik bereits. Implizit ist alsoimmer eine Forderung im akt des empathisierens ange-legt, die auf erwiderung pocht.160 gefordert wird alsoschon im Vollzug des empathischen bewusstseins rezipro-zität. Ähnlich ist das beim geben und Nehmen. wer eingeschenk macht, erwartet eine gegengabe. die Mutationdes schenkens führt zu Forderungen, genauso wie einsei-tige dienstleistungen. anders als im Falle der gabe ist beider empathie aber keine zeitliche Verzögerung der erwi-derung festzustellen. reziprozität hat sich gewissermaßeninternalisiert. der Punkt ist hier nicht, dass empathie zukooperativem Verhalten führt, sondern eher, dass dieses einabgeleitetes Produkt derselben sein kann.161 wie schonCrawford zeigen konnte, wird das von beobachtungen beihöheren nichtmenschlichen Primaten durchaus getra-gen.162 wenn sich zwei nichtmenschliche Primaten in ne-beneinanderliegenden Käfigen befinden, in denen sie sichzwar sehen, hören und betasten, aber den Käfig nichtwechseln können, und dann mit der situation konfrontiertwerden, nur an Nahrung zu kommen, wenn beide koope-rieren und gemeinsam an den für sie jeweils erreichbarengriffen an einem brett ziehen, lernen sie diese zielgerich-tete Koordinations- und Kooperationsleistung sehr schnell.Hier ist aber vorausgesetzt, dass beide tiere etwas von demFutter abbekommen. was passiert, wenn nur auf einerseite des bretts essbares angeboten wird, trotzdem aberbeide Menschenaffen ziehen müssen? Überraschenderweisezeigen sich zumindest Kapuzineräffchen auch unter dieserbedingung kooperationsfreudig. de waal und anderehaben diese befunde unter dem gesichtspunkt einer zeit-verschobenen reziprozität gedeutet.163 reziprokes Verhal-ten, welches auf eine quantitativ unbestimmte entgegnung
158 Hier rücken empathisches Verstehen und Hermeneutik nahaneinander. aufgrund der zahlreichen Probleme und Verwirrun-gen, die in der auseinandersetzung mit den beiden begriffe nichtzuletzt auch wissenschaftsgeschichtlich zu verbuchen sind, werdeich an dieser stelle aber nicht näher auf diese ematik eingehen(vgl. zur Hermeneutik grundlegend gadaMer 1960).159 vgl. breItHauPt 2009, 109ff.160 breItHauPt 2009, 110.161 breItHauPt 2009, 111.162 vgl. grundlegend CrawFord 1937.163 vgl. etwa de waaL & brosNaN 2006.
spekuliert, ist insofern auch im tierreich verbreitet. Insge-samt ist das aber umstritten. was lernen wir daraus? Mitbreithaupt dürfte verzögerte reziprozität erstens auch beimMenschen ein äußerst seltenes Phänomen sein, ist aber zwei-tens trotzdem nicht unwahrscheinlich und wenn, dann amehesten in der soziokulturellen domäne menschlichen Ver-haltens zu erwarten.
empathie ist der ausgangspunkt einer ganzen soziologiedes genötigten erwiderns. empathie ist so gesehen mögli-cherweise sogar die biologische basis des gebens und Neh-mens. die empathische Positionalität unterläuft das sozial-verhalten des Menschen, sie erst stiftet etwas Verbindendes.es steht außer Frage, dass die wechselseitige rücksicht-nahme einen enormen Vorteil bietet und zu ganz und garungewöhnlichen Formen der sozialität führen kann. auchHrdy und andere gehen daher mittlerweile davon aus, dasssich im reziproken Verstehen eine entscheidende grundlagefür die evolution kooperativer Verhaltensmuster findet.164
diese Formen des sozialen müssen aber nicht als vollständigan eine empathische gestelltheit gekoppelt gedacht werden.eher erfährt sozialität einen empathischen schub, es kommtzu abgeleiteter Kooperation, die in ihrer elaboriertheit weitüber das hinausgeht, was noch über positive selektionskräftezu eruieren wäre. genau dieser Fall, so meine Hypothese,ist beim Menschen zu konstatieren. empathie erst legt dasFundament einer sozialität des gebens und Nehmens. em-pathische Positionalität kann damit als ‘substrat jedwederMenschlichkeit’ gelten. Ich werde mich der Überprüfungdieser annahme zunächst über den exkurs in die anthro-pologie der gabe nähern.
die anthropologische bedeutung der gabe
‘We do not stand alone ... we are in the arms of family. Father... mother ... sister ... brother ... father’s father ... father’s
mother ... father’s brother ... mother’s father ...’ Suffice to say,the list is extensive. ‘We gather on this day
to extol the warmth and joy of those unshakable bonds. With-out them, we could not call ourselves complete.
On this day, we are thankful to be together. We do not stand alone.’
tuvok zur Crew, der Voyager die traditionellen wilkommensworte der talaxianischen Prixin-Zeremonie rezitierend.
star trek Voyager, „Mortal Coil“
Nach allem, was wir heute über unsere eiszeitlichen ahnenwissen (und das ist noch sehr wenig), muss davon ausgegan-gen werden, dass die erde über das nahezu gesamte Pleisto-zän hinweg von Populationen begangen wurde, die als Jägerund sammler klassifiziert werden können. es handelt sichum wildbeuter einer aneignenden wirtschaftsweise, die im
56 shumon t. Hussain
Kern von der Hand in den Mund leben und in hochmobilerLebensweise über das antlitz der erde ziehen. was aber cha-rakterisiert den sozialen raum dieser einfachen gesellschaf-ten? erstens muss im Hinblick auf die beobachtungen derKulturanthropologie von kaum stratifizierten, noch egalitä-ren einheiten ausgegangen werden, die auf dem Prinzip desteilens aufgebaut sind. teilen ist dabei nahezu verabsolu-tiert. es ist sozialkitt und Überlebensgarant zugleich. Keinanderes tier hat eine so ausgeprägte Veranlagung zum be-reitwilligen teilen. beim Menschen hat sich im Laufe seinerentwicklungsgeschichte gar ein biologischer Mechanismusherausgebildet, der wohl als direkte reaktion auf die Not-wendigkeit zum teilen in der eiszeit evolviert ist. dasmenschliche gehirn reagiert auf hochsoziale Handlungenwie großzügigem Verhalten mit einer dopaminausschüttung(über).165 dieser belohnungsmechanismus ist also als inter-nalisierte soziale Verhaltensdisposition zu begreifen, die sichüber biokulturelle wechselwirkung in einem koevolutivenszenario herausgebildet und diese sozialstrategie sehr robustgemacht hat (beispielsweise gegenüber sozialschmarotzern).Verschiedene untersuchungen von Nahrungsbedarf und realerbeuteter und gesammelter Nahrung sowie der saisonalenund kontingenten schwankung dieser rate bei heutigenJäger und sammlern haben gezeigt, wie sensibel und instabildiese sind, wenn das geringe einkommen an essbarem nichtohne Kompromiss aufgeteilt wird.166 teilen ist das Funda-ment des Überlebens von Jägern und sammlern, gleichsamderen Überlebensversicherung. Möglicherweise gar der ersteumfassende sozialvertrag, den unsere ahnen zum wohle dergemeinschaft geschlossen haben. sein Kern ist eine Logikder risikoumverteilung, letztlich der risikozerdehnungdurch auslagerung. Jedenfalls ist der gedanke eines sozialenNetzes, welches jegliche unsicherheit, jegliche Fluktuationin der subsistenz abfedert, der wirklich zentrale. das sozi-alnetz des teilens repräsentiert in diesem sinne lediglich diebasalste ebene einer viel umfassenderen organisationspraxisvon wildbeutergruppen. der französische anthropologeMauss hat als erster die herausragende bedeutung von so-zialen Netzwerken für einfache gesellschaften erkannt. Inseinem epochalen werk „essai sur le don“ (dt. „die gabe“)skizziert Mauss, wie sozialität in diesen einheiten vor allemdurch gabentausch gestiftet und reproduziert wird.167 deraustausch von objekten bindet Menschen aneinander undist sozialer Kitt. der Mensch hat in nahezu allen bekanntenKulturen teils äußerst elaborierte und ausgefeilte technikender darbietung, Inszenierung und des tauschs von gütern
164 vgl. etwa Hrdy 2009, 25ff.165 vgl. etwa rILLINg et al. 2004; aber auch rILLINg et al. 2002.166 vgl. exemplarisch KaPLaN et al. 1990; CasHdaN 1990;HawKes 2001; vor allem aber sMItH 2003, tab. 4.167 vgl. grundlegend Mauss 1990.
ersonnen. all dies deutet auf die elementare bedeutung desaustauschs in menschlichen sozialverbänden. ein berühm-tes beispiel aus dem bunten repertoire kultureller Vielfaltsind die sich über teils gewaltige distanzen erstreckendengeschenktauschsysteme in ozeanien, genauer auf der me-lanesischen Inselgruppe im Pazifik. bereits Malinowski warbei seinen Feldarbeiten auf den trobriandinseln fasziniertob den alle rationalität sprengenden Zirkulationsräumendieser Kulturregion.168 der „Kula-ring“ konstituiert einenaustauschkreislauf nichtfunktionaler objekte (offensichlichist ihre Funktion das ausgetauschtwerden), welche aus-schließlich dazu dienen, soziale bindungen, soziale bezie-hungen zu stiften und den eigenen sozialstatus zu sichern.der tausch geht einher mit ansehen und Prestige, denwichtigsten ressourcen sozialer allianzen und bündnisse.die Zirkulation jener objekte schafft eine extrasomatischeVerbindung zwischen verschiedenen, teils über viele hundertKilometer verstreut lebenden, Individuen und gruppen. In-sofern sind die Zirkulationsobjekte dieser region auch als In-strument der Vergegenwärtigung und erinnerung sozialerVerpflichtung und eigebundenheit zu verstehen. dergestal-tige systeme des wechselseitigen austauschs, innerhalb dererdie sozialen akteure mit dem Kanu viele hunderte seemeilenzurücklegen, nur um jene wertgegenstände in umlauf zubringen, erstrecken sich über den gesamten Pazifikraum undfinden sich auch in Neuseeland und samoa. auf Neukale-donien etwa werden riesige yamswurzeln in „Pilu-Pilu-Ze-remonien“ öffentlich zur schau getragen, während in denkomplexeren gemeinschaften der Kwakiutl, der Haida oderder tsimshian, die allesamt an den ressourcenreichen Küs-tengebieten des nordwestlichen Nordamerikas beheimatetsind, ebenso wie bei den Korjaken und tschuktschen in si-birien objekte dieser art in den bekannten „Potlatch-Fei-ern“ zunächst orgiastisch geteilt und dann öffentlich der Ver-nichtung preis gegeben werden.169 die eliminierung vonwert dient nur einem einzigen Zweck: der aktualisierungund aushandlung sozialer beziehungen über sozialen status.die komplexen Jäger und sammler des nordamerikanischenKontinents haben diesen sozialen akt rituell eingebettet undzu ‘dem’ Höhepunkt ihres gemeinschaftlichen Lebens erho-ben. diese Feierlichkeiten präsentieren sich als soziale ag-gregationspunkte. In der sozialen bindung wird jene Ko-
warum Menschen empathische wesen sind 57
operationsstrategie des Menschen ersichtlich, die risikomi-nimierende Netzwerke konstituiert. Jene sozialen Netzwerkemaximieren den Kreis der unmittelbar Verbündeten, zu na-türlichen Verwandten treten soziale Verwandte, als-ob-Ver-wandte, hinzu.170 auch hier ist zu bedenken, dass die jewei-lige Verpflichtungsdimension des reziproken Helfens übersoziale Kategorien gestiftet wird. diese Kategorien sind kei-nesfalls carved in the world, sondern zu einem wesentlichenteil sozial konstruiert. deshalb entfalten soziale beziehun-gen eine ungemeine wirkkraft als adern regionaler undüberregionaler bündnisse.
die anthropologin wiessner konnte bei den Ju/‘hoansi,einer nomadisch lebenden Jäger- und sammlergruppe derzentralafrikanischen steppe, auf beeindruckende weise zei-gen, wie stark einfache gemeinschaften häufig von derge-staltigen tauschrelationen durchwoben sind und so gesehenüberhaupt nicht einfach sind.171 die austauschnetzte derJu/‘hoansi heißen „Hxaro“. Ihre bedeutung für das Lebendieser wildbeuter wird vor allem durch ihre allgegenwärtigePräsenz im alltag deutlich. Fast siebzig Prozent aller gegen-stände, die ein männlicher !Kung san gewöhnlich benutzte,waren nur vorübergehender besitz (insofern gibt es bei denJu/‘hoansi nahezu keinen besitzanspruch in unserem sinne).die gegenstände wurden in einem ständigen tauschprozessinnerhalb der gruppe weitergegeben und zirkulieren aufdiese weise im sozialen raum. das geschenk des einen Jah-res wurde im nächsten weitergereicht. Nach wiessner gehtdas bei den Ju/‘hoansi so weit, dass ein mögliches Nichtwei-tergeben mit einem sozialen tabu belegt ist, d. h. in der Pra-xis sanktioniert und geahndet wird. Jener immerwährendeKreislauf des gabentauschs trägt die botschaft zu jedem ein-zelnen sozialen akteur, dass diese sich „gegenseitig in ihrenHerzen tragen“.172 das geben und Nehmen ist keinesfallsals realisierte Möglichkeit der Kohäsion zu denken, sondernals soziale tatsache obligatorischer Kraft. es ist verpflichtend,sich im Netz der Zirkulation einzufinden und entsprechendzu handeln. Verstoß wird bestraft und kann zu exklusionaus der gruppe führen. diese implizite Normativität, diebereits im Kontext kollektiver Intentionalität angedeutetwurde, ist ein ganz entscheidendes Moment innerhalb desgabentauschs einfacher wildbeuter. bereits boyd und ri-cherson haben auf die schlüsselfunktion sozialer sanktionbei der stabilisierung von gruppen einerseits, und daherauch in der kulturellen evolution andererseits hingewie-sen.173 dieser tatbestand ist erst kürzlich von sääksvuori etal. in seiner bedeutung untermauert worden.174 austausch-systeme tragen eine normative Komponente und können alssozial normiert gelten. entsprechend differieren sie auch vonsozialer einheit zu sozialer einheit und sind wesentlich kul-turell überprägt. auch diese gehören zum Identitätsschatzautonomer kultureller gebilde, im unterschied zum ge-dächtnisapparat jedoch im Hier und Jetzt. es kommt nichtvon ungefähr, dass ich später versuchen werde aufzuzeigen,
168 vgl. grundlegend MaLINowsKI 1920; 1922; aber auchLeaCH & LeaCH 1983.169 vgl. grundlegend etwa boas 1909 oder boas 1902.170 vgl. Hrdy 2009, 26ff.171 vgl. wIessNer 1977; 1996; 2002.172 Persönl. Mitt. von P. wiessner an s.b. Hrdy vom 5.3.2007(aus: Hrdy 2009, 29).173 vgl. grundlegend boyd & rICHersoN 1992 und neuerdingsboyd & rICHersoN 2006.174 vgl. sÄÄKsVuorI et al. 2011.
dass eine zeitlogische Verknüpfung von kommunaler Kul-turleistung und dem sichtbarwerden solcher räume desaustauschs besteht. aber dazu wie gesagt später. wichtig isthier, dass die gabe zwar auf freiwilliger basis gegeben wird,trotzdem soziale Verpflichtung involviert. reziprozität ent-faltet sich im gabentausch obligatorisch. In der menschli-chen austauschpraxis spiegelt sich eine anthropologischeKonstante zur regulation und reproduktion sozialer bezie-hungen. reziprozität ist das wesentliche soziozept (sozialeKonzept), das sich in der gestalt einer gabenpraxis zeigt.Mauss hat versucht, dies mit dem terminus „system der to-talen Leistungen“ deutlich zu machen. Zumindest für ein-fache wildbeuter und komplexere Jäger und sammler sindgabentausch und soziale beziehung identisch. gabentauschist sozialrelation. In der reziprozität der güterzirkulationist die trennung zwischen Person und ding noch nicht voll-zogen. das erst erklärt ihre inhärente eigenlogik, aus dersich auch ihr obligatorisches Moment nachvollziehen lässt.Im unterschied zu veräußerlichen gütern ist die gabe alssolche ein genuin unveräußerliches gut – wie schon Maussimmer wieder betont hat.175 dinge sind gleichsam wie Per-sonen, letztlich besteht eine unveräußerliche beziehung zwi-schen ihnen, die jener Verpflichtungserklärung erst denboden bereitet. Mit der gabe gibt der gebende ein unver-äußerliches gut, nämlich ganz wörtlich einen teil von sichselbst. bildlich gesprochen überträgt sich im akt des gebensetwas vom gebenden auf die gabe. das materielle objektwird gleichsam beseelt und deshalb sozial signifikant. es istdamit auch ein Zeichen, das auf soziale akteure verweist.Nach der eigenlogik solcher tauschsysteme muss dieser as-pekt des gebenden irgendwann zu ihm zurückgelangen.das wird im Prozess der Zirkulation realisiert. die gabemuss ihren ‘rechten Platz’ wiedergewinnen.
wie bereits am beispiel der pazifischen Inselbewohnerdeutlich wurde, beschränkt sich die bedeutung des aus-tauschs bedeutender objekte nicht auf Intragruppenkon-texte. därmann folgend lässt sich mit recht konstatieren,dass gesellschaft nur möglich ist „zwischen gesellschaf-ten“.176 schon Mauss hat die eigentümliche Funktion desgabentauschs darin gesehen, eine beziehung ‘zwischen’ einander zunächst fremden akteuren zu stiften, wobei eseben keinerlei rolle spielt, ob es sich dabei um Personen undIndividuen oder um ganze gesellschaften handelt. die gabeist die Praxis des getrennten Zusammenlebens. die Frage istnun, inwiefern sich archäologisch Hinweise auf eine solcheVerfasstheit der sozialität des Menschen finden lassen. wiealt ist der gabentausch? Mein Vorschlag ist es, die dargeleg-ten eckpunkte einer anthropologie der gabe wie sie aus ak-tualistischen beobachtungen der sozialwissenschaften gutbekannt sind als interpretativen rahmen zu nutzen. wassich in der entwicklungsgeschichte des Menschen materiellzeigt, lässt sich unter diesem gesichtspunkt erstaunlich gutdeuten. reziprozität des gebens und Nehmens ist außerdem
58 shumon t. Hussain
ein indirekter Hinweis auf empathische Positionalität, wiewir gesehen haben. Insofern verdichten sich die anzeicheneines ‘empathischen erwachens’ moderner Menschen, wennsich erhärten sollte, dass die ausbildung von austauschnet-zen in genau den Zeitraum fällt, der für die hier relevanteFrage so kritisch ist.
die empathische genese transregionaler austauschnetze
Families, societies, cultures – wouldn’t have evolved without compassion and tolerance –
they would have fallen apart without it.
Kes zum holografischen doktor.star trek Voyager, „darkling”
die Frage nach dem alter einer sozialen Praxis des schen-kens ist vermutlich sehr alt. Methodisch gesehen ist es heuteunmöglich, die genese eines solchen Mauss‘schen systems„totaler Leistungen“ rekonstruktiv nachzuvollziehen, ge-schweige denn, den Versuch zu unternehmen dieses archäo-logisch zu datieren. wie wir gesehen haben werden nahezualle materiellen artefakte menschlichen schaffens in denKreislauf des gebens und Nehmens eingespeist. es ist inso-fern für uns heute unmöglich, zwischen objekten des ga-bentauschs und solchen, die nicht dessen bestandteil zu seinscheinen, sinnvoll zu differenzieren. sozialität des Menschenist eben schon von anfang an eine, die durch totalen aus-tausch fundiert ist. die Frage „wie alt ist der gabentausch?“muss also modifiziert, vielmehr präzisiert werden. Zu fragenist nicht nach den wurzeln dieser Praxis sozialer Interaktion,sondern nach einem signifikanten einschnitt in deren aus-übung, nach einer weitreichenden Veränderung in der Land-schaft des tauschens. Meine Hypothese lautet, dass der aus-tausch von gütern über lange Zeit in der menschlichenabstammungslinie sozialer Kohäsion und kooperativem Zu-sammenhalt diente und sich damit auf Intragruppenkon-texte beschränkte. Nachzuweisen ist dies aus offensichtlichengründen nicht. erst mit der elaborierung prosozialer, ko-gnitiver Fähigkeiten im evolutionären ast des modernenMenschen gewinnt diese Praxis, beflügelt durch die dyna-mik kollektiver Intentionalität und Identitätsbildung, eineneue Qualität. die Morphologie sozialer austauschsystemeerfährt einen entscheidenden einschnitt. die Praxis des ge-bens und Nehmens expandiert über die grenzen sozialereinheiten hinweg und etabliert transsoziale und deshalbauch transregionale austauschnetze, die teils gewaltige weg-strecken umspannen. bevor wir uns den archäologischen be-funden widmen, die diese Hypothese stützen, möchte ichzunächst auf einige theoretische rahmenbedingungen ein-gehen, die im Kontext der sozialen evolution der rezipro-zität zu bedenken sind.
soziale gruppen müssen unter dem evolutionären gesichts-punkt stets das social-Freerider-Problem der Kooperationmeistern, weil das ausnutzen der Kooperationsbereitschafteinzelner immer dazu führt, dass diese akteure im Vergleichzu allen anderen prosozialen akteuren bessergestellt sind.Kooperation ist erst dann möglich, wenn diese gefahr durchsoziale Mechanismen unterminiert wird. sanktionen sindein beispiel dafür. auch der gabentausch übernimmt einesolche Funktion. soviel also zu nutzenkalkulierenden ge-sichtspunkten. Mit der entwicklungsgeschichtlichen Inter-nalisierung einer Motivationskraft für prosoziales Verhaltenin der gestalt ausdiffe renzierter empathischer Verfasstheitbeim modernen Menschen ändert sich jedoch die Pay-off-Matrix grundlegend. rational gesehen sichert die strategiedes sozialen trittbrettfahrens sich zwar nach wie vor die Füh-rungsposition in der handlungsleitenden Präferenzordnung.empathisch gesehen aber nicht. empathie internalisiert dieemotionalen Konsequenzen des eigenen Verhaltens bei an-deren gleichsam. elaborierte Mentalisierungsfähigkeitenführen zu einer tendenz geteilten Nutzens ebenso wie ge-teilten Leids. dem rationalen Menschen der handlungstheo-retischen Modellierung tritt der emotionale Mensch, Homoemotionale, als alternative beschreibungsform entgegen. In-tuitiv ist unmittelbar einleuchtend, dass emotionen einesehr viel stärkere Motivationskraft haben als noch von deneinfachen Pay-off-Matrizen der Handlungstheorie zuge-
warum Menschen empathische wesen sind 59
standen wird. Für unsere belange genügt aber schlicht dieFeststellung, dass die empathische Verfasstheit des Menschenein wichtiger Impulsgeber für prosoziales Verhalten im all-gemeinen ist und auf der anderen seite ebenso als Korrektivfür ausnutzende strategien verstanden werden kann. Höhereempathiebegabung entfaltet eine eigentümliche dynamikkooperativer Verhaltensevolution.
Kommunalte Kultur ist ein aggregatzustand dieser ver-änderten Vorzeichen. Nettle und dunbar konnten zeigen,dass eine prosoziale Verhaltensdisposition zu neuen sozialenProblemen führt. das social-Freerider-Problem verschiebtsich gleichsam von der Intragruppen- auf die Inter grup -penebene, und zwar vor allem deshalb, weil verstärkt Inter-aktionen auf den Plan treten, in denen sich die beteiligtenIndividuen nicht mehr iterativ, d. h. immer wieder, in Face-to-Face-szenarien begegnen, sondern aufgrund der räumli-chen distanzen häufig nur noch singulär. soziale Markerebenso wie gruppenindividuierung sind eine Möglichkeit,diesem Problem effektiv entgegenzutreten.177 Insofern kanndie kommunale Kulturkapazität als unmittelbarer ausdruckeiner sich verschärfenden prosozialen Verhaltensdisposition
Veränderung der Inter-gruppen-sozialität am Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithikum in Mitteleuropa. Nach gamble ist die ver-gleichsweise abrupte Zunahme an Indizien für Fernkontakte im archäologischen befund des frühen Jungpaläolithikums als Hinweis aufeine profunde Veränderung in der architektur des sozialen raums zu lesen. Idealtypisch ist das Mittelpaläolithikum nach dieser Lesartals sozial fragmentiert und schwach vernetzt zu verstehen, wohingegen mit dem aurignacien und spätestens mit dem gravéttien einequalitative und nahezu globale Vernetzung von sozialen einheiten zu beobachten ist. gamble korreliert dieses Phänomen mit dem Über-gang von lokalen Netzwerken bei den Hominiden (LHN) zu überregionalen sozialen Netzwerken (sHN), wie sie auch für rezente Jägerund sammler charakteristisch sind. Letztere münden in einer sozialen Landschaft, die sich erst mit der ankunft des modernen Menschenzwischen 50 000 und 40 000 Jahren vor heute im europäischen Fundgut zeigt. (Nach: gaMbLe 1996)
Mittelpaläolithikum JungpaläolithikumMoustérien Aurignacien Gravéttien Solutréen Magdalénien
SHN
LHN
10–15 km
> 500 km
Zeit
Inte
nsitä
t und
Qua
lität
von
Aus
taus
chgü
tern
175 vgl. Mauss 1990.176 vgl. dÄrMaNN 2010, 24ff.177 vgl. NettLe & duNbar 1997.
bei Homo sapiens verstanden werden. doch damit nichtgenug. unter dem Paradigma einer anthropologie der gabewird unmittelbar ersichtlich, dass diese disposition tatsäch-lich mit einer ausbildung überregionaler, sich zwischen densozialen einheiten aufspannenden austausch- und Zirkula-tionsräumen einhergeht. trifft dieser sachverhalt zu, mussdas als starkes Indiz für die gestaltverändernde Kraft der Pro-sozialität von empathie gelten. die soziale Landschaft er-fährt einen Epochae-einschnitt. Mit gamble kann in europaüberhaupt erst mit dem sich entfaltenden Jungpaläolithikumund dessen träger, dem anatomisch modernen Menschen,von einer ‘sozialen Landschaft’ gesprochen werden.178 ImMittelpunkt dieser analyse steht die beobachtung, dass be-sondere objekte bis dato stets nur über begrenzte distanzen,maximal über wenige hundert Kilometer, transportiert wur-den, wohingegen erst ab dem Jungpaläolithikum artefakteauftauchen, die über wegstrecken von bis zu tausend Kilo-metern transportiert wurden. Mit gamble konstituieren erstdiese objekte etwas, das man als soziale Landschaft beschrei-ben könnte. weil es sich aufgrund der zu großen distanzen,die jene artefakte hinter sich gelassen haben, nicht mehr umMobilifakte handeln kann, sprich um die Produkte mensch-licher wanderbewegungen und Migrationen, muss davonausgegangen werden, dass jene objekte über austauschnetzeverhandelt wurden und auf diese weise diese strecken über-brücken konnten. Jene objekte sind als gaben zu verstehen,die soziale beziehungen ‘zwischen’ einzelnen, disparatenJäger- und sammlergruppen stiften. Insofern kann zu rechterst mit dieser Konfiguration sozialer einheiten von einerzuammenstehenden sozialen Landschaft gesprochen werden.Im europäischen Jungpaläolithikum diversifiziert sich diePraxis des reziproken gebens und Nehmens. gabentauschist nicht mehr nur eine angelegenheit innerhalb sozialereinheiten, sondern auch zwischen diesen. Überregionalergabentausch stiftet überregionale allianzen und rückt diezuvor isoliert lebenden wildbeutergruppen der letzen eiszeitnäher zusammen; er stiftet regelrecht transregionale ge-meinschaften, die im Magdalénien und gravéttien den hal-ben Kontinent umspannen. In europa lassen sich diesetransregionalen austauschnetze, die ganz unmissverständlichein engeres Zusammenstehen unserer Vorfahren signalisie-ren, vor allem über besondere rohmaterialen, die nur an be-stimmten orten vorkommen und häufig darüber hinausüber besondere ästhetische Qualitäten verfügen,179 ebensowie über gleichermaßen besondere Mollusken nachweisen.Viele der schnecken kommen nur in einzigartigen bioto-pen, in spezifischen biologischen Nischen, vor und könnendeshalb gut verortet werden. Mollusken markieren einzugs-gebiete, die sich vom atlantik auf einer west-ost-achse bisnach Mitteleuropa und in die ausläufer osteuropas erstre-cken, aber auch vom Mittelmeer über den rhône-rhein-Korridor bis nach Zentraleuropa, und vereinzelt darüber hi-naus.180 dieser befund intensiviert sich ernstzunehmend erst
60 shumon t. Hussain
mit dem sich entfaltenden aurignacien und erreicht seinenHöhepunkt im Magdalénien.
Jedenfalls ist Foley und gamble prinzipiell zuzustimmen,wenn diese gerade in der sich elaborierenden sozialität desMenschen, in deren ausdifferenzierung und Multiebenen-charakter das Fundament unserer stellung in der welt zu iso-lieren suchen.181 wo Féblot-augustins noch konstatierenkonnte, dass rohmaterialdistanzen über 100 km auf dem eu-ropäischen Kontinent vor dem Jungpaläolithikum äußerstselten in erscheinung treten und weitgehend die ausnahmebleiben (zu erwähnen ist beispielsweise die Fundstelle Champgrand in Frankreich, wo die ausgräber mindestens 250 kmweit transportiertes rohmaterial vorfanden182), ist das inafrika etwas anders. dort bilden sich offensichtlich schonmit dem Middle stone age (Msa) weitreichende austau-schnetze aus, die zur gleichen Zeit in europa noch fehlen.Mcbrearty und brooks notieren unter anderem den trans-port von obsidian über 240 km.183 In afrika setzt die aus-differenzierung des gebens und Nehmens scheinbar weitausfrüher ein. Vor allem in ostafrika ist der austausch von be-sonderen rohmaterialien, insbesondere von obsidian, gutdokumentiert.184 trotzdem ist auch dort kein plötzlichesauftreten eines die gruppengrenzen transzendierenden aus-tauschs festzustellen.185 ein weiterer Hinweis für dergestaltigesoziale Netzwerke findet sich in der im Vergleich zu europadeutlich früher einsetzenden regionalen Kulturdifferenzie-rung afrikas im entwickelten Msa. anders als auf dem Kon-tinent ist der entscheidende soziale einschnitt dort im schlei-chenden Übergang vom esa (early stone age) zum Msa(und nicht im Übergang vom Mittel- zum Jungpaläolithi-kum wie in europa) zu verorten.186 dieser geht mit einersukzessiven standardisierung bei gleichzeitiger raumzeitlicherVariation im artefaktbestand einher, genauer gesagt in einemVariationsraum von Projektilformen. die wahl arbiträrerFormen, die vollständig von der Funktion dieser objekte ent-koppelt sind, können ähnlich wie auf anderen Kontinentenim Pleistozän als soziokulturelle Marker, als denotierendeZeichen, gedeutet werden.187 ausdruck dieser Fragmentie-
178 vgl. u. a. gaMbLe 1996.179 vgl. für rohmaterialdistanzen FLoss 1994; 2000; 2002; Fé-bLot-augustINs 1997; burKert & FLoss 2005.180 vgl. grundlegend FébLot-augustINs 2009; aber auch ÁL-VareZ-FerNaNdeZ 2009.181 vgl. FoLey & gaMbLe 2009.182 sLIMaK & gIraud 2007.183 MCbrearty & brooKs 2000.184 vgl. MeHLMaN 1977; 1979; MCbrearty 1981; 1986; 1988;MeHLMaN 1989; 1991.185 vgl. etwa MINICHILLo 2006.186 vgl. exemplarisch MCbrearty 2007, 136ff.187 vgl. grundlegend byers 1994; 1999; aber auch deaCoN &wurZ 2001.
rung der kulturellen Landschaft, die wohl mit einer ausdeh-nung der austauschpraktiken über die gruppe hinaus ein-hergeht, manifestiert sich in den diskreten traditionskom-plexen des Msa: still bay, Howieson’s Poort, bambatan, Katanda Msa, Mumba-Industrie, Kenia rift Msa, Nubi-sches Msa, Äthiopisches Msa, Lupemban und sog. atérien(s. abb. s. 43, oben).188 ebenso wie auf dem nordamerika-nischen Kontinent ist diese Variation auf makroregional dif-ferierende stile zurückzuführen, die dann eben Kontakt-räume, in der sprache einer anthropologie der gabeZirkulationsräume, denotieren. als grober Proxy für die zeit-liche Lokalisierung jener Komplexe kann ein Zeitraum um80 000 bP angegeben werden. Mumba-Industrien ebensowie das Katanda-Msa in südwestafrika datieren auf etwa
warum Menschen empathische wesen sind 61
75 000 bP, wobei letzteres noch ein bisschen älter zu seinscheint.189 Kommunale Kulturkapazität und ausgedehntesoziale Landschaften koevolvieren offensichtlich. Mit Mar-wick lässt sich unterstreichen, dass sich die einzugsgebietevon rohmaterialien und beson deren objekten in dermenschlichen Lineage über eine Million Jahre auf einemMaximalradius von 100 km stabilisierten, was gut mit denzu erwartenden Mobilitätsdistanzen dieser gruppen zusam-menläuft.190 selbst mit den ambivalenten daten der euro-päischen Übergangsindustrien lässt sich jedenfalls konsta-tieren, dass die ausbildung transregionaler austauschnetzeim engeren sinne, also solcher, die distanzen von zwei bisdreihundert Kilometern überbrücken, nur mit dem moder-nen Menschen assoziiert ist.191 Ich plädiere deshalb dafür,die Konstituierung der sozialen Landschaft durch ausge-dehnte Netze sozialen austauschs, durch gabentausch ingroßem stil, mit gamble als ein Charakteristikum vonHomo sapiens zu begreifen. soziale Landschaften bilden sicherstmals leicht verzögert zur speziation des anatomisch mo-dernen Menschen zwischen 100 000 und 80 000 bP auf
evolution der rohmaterialtransferdistan-zen vom altpaläolithikum bis ins Jung-paläolithikum Mittel europas auf derbasis exotischer rohmaterialen, derenQuelle sicher lokalisiert werden kann.erst mit dem Jungpaläolithikum werdentransferdistanzen erreicht, die nur nochunter erheblichen Problemen mit derMobilität von einzelnen Individuen undgruppen erklärt werden können. Vorallem jene Materialien am extremenrand der distanzskala können als Pro-dukt von ausgedehnten austauschnetzengelten. oben: rohmaterialtransferdistanzen von57 europäischen Fundstellen oderschichtzusammenhängen vom altpaläo-lithikum (N = 76) bis ins frühe Mittelpa-läolithikum (N = 79). die grafik deckt inetwa den Zeitraum von 500 000 bis70 000 Jahren vor heute ab. unten: transferdistanzen aus dem spätenMittelpaläolithikum (24 Fundstellenoder schichten; N = 82) und dem frühenJungpaläolithikum (55 Fundstellen oderschichten; N = 233) inklusive transiti-onsindustrien Mittel europas. (Verändert nach: MarwICK 2003, Figs.6; 8, mit freundlicher genehmigung benMarwick)
Rohmaterialtransferdistanzenim Früh- und Mittelpleistozän
Anz
ahl a
n R
ohm
ater
iale
inhe
iten
25
20
15
10
5
0
Distanz (in km) von der Rohmaterialquelle0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Altpaläolithikum frühes Mittelpaläolithikum
Rohmaterialtransferdistanzenim Spätpleistozän
Anz
ahl a
n R
ohm
ater
iale
inhe
iten
60
50
40
30
20
10
0
Distanz (in km) von der Rohmaterialquelle0 50 100 150 200 250 300 350 400
spätes Mittelpaläolithikum frühes Jungpaläolithikum + Transitionsindustrien
188 MCbrearty 2007, Fig. 12.2; aber auch MCbrearty &brooKs 2000, Fig. 5.189 vgl. yeLLeN et al. 1995; aber auch yeLLeN 1998.190 vgl. MarwICK 2003.191 MarwICK 2003; aber auch gaMbLe 1996.
dem afrikanischen Kontinent aus und gelangen mittels out-of-africa-bewegungen unserer Vorfahren bis nach europa,wo sich das Phänomen zwischen 50 000 und 30 000 bP ein-stellt. empathische Positionalität kann als einer der entschei-denden bausteine dieser entwicklung gelten. die genesetransregionaler austauschsysteme ist eng an die elaborierungder empathie gekoppelt. weitgespannte soziale Netzwerkeebenso wie kommunale Kulturtechnik, das ist die scharfeHypothese dieses Kapitels, sind empathieartefakte. schonder soziologe elias verstand unter dem Prozess der Zivilisa-tion eine Veränderung des menschlichen Verhaltens undempfindens, die als nichtintendierte Folge eines fundamen-talen wandels der wechselseitigen Verflechtung von Men-
62 shumon t. Hussain
schen, welche von ihm „Figurationen“ genannt werden,auftritt. die grundidee der elias’schen Figurationssoziolo-gie kondensiert in der allgemeinen ese, dass dem ‘wan-del im aufbau von menschlichen beziehungen ein wandelim aufbau des physischen Habitus’ entspricht.192 es ist er-staunlich, wie stark dieser befund den Kern dessen trifft,was ich versucht habe, deutlich zu machen. der signifikanteeinschnitt in sozialer und kultureller Landschaft, welcher –wie wir gesehen haben – in der tat mit einem wandelmenschlicher beziehungen einhergeht, ist ein evolvat wech-selseitiger befruchtung von zugrundeliegenden kognitivenund soziokulturellen Kapazitäten, kurz von empathie undKultursozialität.
Marwicks schema einer schrittweisen Vernet-zung von Individuen und gruppen im Verlaufder Hominidenevolution, wie sie sich an trans-portdistanzen nicht-lokaler rohmaterialien ab-lesen lässt. Marwick unterscheidet drei großetypen von Vernetzungskonzepten: Primatenund spätpliozäne Hominiden besitzen lediglichKommunikationswissen über ihre noch stark li-mitierten schweifgebiete; das Individuum ist aufdas wissen über die Landschaft, das es selbst er-worben hat, zurückgeworfen. rohmaterial wirdlokal gewonnen und nur über begrenzte distan-zen transportiert. Vor etwa 1 000 000 Jahren be-ginnen Frühmenschen erste Kommunikations-netze zu installieren, die über das wissen unddie räumlichkeit eines einzelnen Individuumshinausgeht, wissen wird über rudimentäreKommunikationsmechanismen gepoolt und ka-nalisiert. die bienenwaben repräsentieren den finalen schritt in der evolution der Vernetztheitder sozialen Landschaft in der Hominidenge-schichte und entsprechen den ausgedehntenaustauschnetzen rezenter Jäger- und sammler -gemeinschaften: wissen und rohmaterial wirdüber multiple gruppen weitergegeben, und dietransportdistanzen vergrößern sich erheblich. (Verändert nach: MarwICK 2003, Fig. 5, mitfreundlicher genehmigung ben Marwick)
vor ca. 1 Mio. Jahre
Schweifgebiete und Rohmaterial-bezugsareale von nicht-mensch-lichen Primaten und von pliozänen Hominiden. Schweifgebiete und Rohmaterialbezugs-
areale von nicht-modernen Hominiden.
vor ca. 130000 Jahren
Ausschnitt des Rohmaterial-bezugsareals von modernen Menschen, das auf einen Fluss von Gütern durch mehrere Gruppen hindeutet.
192 vgl. eLIas 1976.
63
I.1 eMPatHy, tHeory oF MINd aNd soCIaLePIsteMoLogy
In the first part of the present work, I discuss the notion ofempathy and its social implication. In the light of currentresearch, especially in the neurosciences, empathy is widelydiscussed as a means of negotiating interpersonal relation-ships, serving most importantly as the central tool, for grasp-ing and understanding the mental states and emotions thatstand behind the expressions, actions and general behaviourof others. we should therefore suspect that the ability to takethe perspective of others by putting oneself in somebodyelse’s “shoes” is a crucial part of our social epistemology andthus plays an important role in social coordination and theavoidance of conflicts. rough empathy, human beings areable to adapt to other social players and take their mentaland emotional states into consideration. erefore, a closeevolutionary link should be expected between the evolutionand emergence of elaborated empathic capabilities and theincreasing complexity of social groups. e social environ-ment is considerably shaped by agents reciprocally referringto each other. From this perspective, empathy has a long re-search tradition not only in the hard sciences, but in the hu-manities as well, especially in philosophy. Many scholarshave emphasized the critical role of empathy as an instru-ment for enhancing our skill in social understanding, but atthe same time warned of misinterpreting this social compe-tence as a merely pro-social capacity. empathy can also beused, for example, in a Machiavellian way to manipulateothers or simply as an internal motivation to torture othersby empathically sharing their pain, which some people seemto enjoy. e latter is a perversion of an empathic intercon-nectedness of two social actors, but sharing is the importantconcept here. as a default, we should assume that sharingpain causes pain in the one who is forced to share it withanother, which is not something people normally appreciate– by means of being a negative emotion humans tend toavoid this by anticipating ways to achieve a different out-come. From this perspective, empathy carries a latent dis-positional motivation towards pro-sociality.
I.2 LIFe-HIstory, eVoLutIoN aNd soCIaLCogNItIoN
is chapter attempts to outline the main evolutionary tra-jectory leading to an amplification of mind-reading abilitiesin some nonhuman primates and, most pronounced, inmodern humans: the social embeddedness of breeding and
raising offspring. I make a case for the important role of aqualitative reproduction strategy (K-strategists), docu-mented already in higher primates, for the evolution of bothsocial emotions and internal tools to understand and processthem. In contrast to most species in the animal realm, mostmammals, especially certain primates, invest a lot of timeand energy in a strongly limited number of offspring. isresults in an overstretched life-history profile marked by aprolonged developmental stage between birth and sexualmaturity. e most radical example is given by orangutanmothers, which care for their babies – in most cases for onlyone at the same time – for about nine years. an expansionof the postnatal stage in life-history thus crucially intensifiesmother-child dependency. I suggest capturing empathy asone evolved mechanism to handle this high-risk endeavour.reducing risk and ensuring reciprocal understanding, em-pathy can be invoked as a regulatory and synchronizingforce coordinating the two agents in question. attachmentby experience is not sufficient to adapt both strongly enoughto each other, so attachment by reciprocal emotional andnon-verbal understanding is offered to close this gap.
Mind-reading abilities become more and more pivotalwhen the social environment and changing social personaconfigurations play an important role in raising children.is is the case for modern humans and some New worldapes which exercise cooperative breeding as a post-reproduc-tion strategy. because human groups need to ensure theirviability by producing enough offspring while at the sametime investing a lot of time in a low number of children, adilemma emerges. Viability can only be secured if womenhave more than one heavily dependent child at the sametime. e time consuming and emotional investment in-tensive nature of this task has led to the evolution of off-spring caring on the group level: alloparents support themother. From an evolutionary perspective, this is why co-operative breeding is the bedrock of higher mind-readingcapacities – alloparents and children must synchronize aswell in order to communicate and understand their needs(especially the needs of the child). is could be the archescene of highly flexible empathic abilities which enable hu-mans to grasp different social players simultaneously andregularly switch between them – a mode of empathizingwhich is fully disarticulated from understanding by experi-ence and “knowing someone well”.
Life-history profiles therefore offer a first proxy for em-pathy in the context of cooperative breeding within thehuman lineage. Phylogenetically, these ontogenetic charac-teristics are not at all stable within the evolutionary branchof Homo. differentiated life-history profiles with divergent
suMMary Part I wHy HuMaNs are eMPatHetIC beINgs
64 shumon t. Hussain
social cognition implications can be detected by comparingdifferent taxonomic units or chronospecies of the homininclade. evidence from various paleoanthropological fieldspoints to a notable difference in the quality of the postnatalstage between Neanderthals and modern humans originat-ing in late Pleistocene Homo sapiens populations. recentanalysis of birth canal shape in adult individuals and of en-docast volume and shape in newborns show that we can ex-pect modern humans to have stronger developed brain plas-ticity while displaying significantly slower ontogeneticencephalization rates. altogether, this points to a markeddifference in mental architecture, very likely located in therealm of social cognition, between Neanderthals and latePleistocene anatomically modern humans.
I.3 MIrror NeuroNs, soCIaL LearNINg, MIMesIs aNd eMPatHy
e chapter theorizes the conceptual link between sociallearning and empathic capacities and offers some perspec-tives on how to use this insight to improve our understand-ing of the evolution of material culture as manifested in thearchaeological record. First, the expansion of the postnatalontogenetic stage leads not only to a range of evolved basiccare tools to ensure immediate offspring survival, but alsoto a dependency on learning. a longer maturation phasegoes hand in hand with a significant intensification of form-ative inputs from the social world, i. e. recipes for how tobehave in certain situations and how to do certain things.is is why social learning is very important to humans, andmuch of human cultural performance is explainable by aunique and distinct trajectory of social learning.
e prolongation of the life-history profile’s first seg-ment, together with cooperative breeding, leads to a situa-tion in which much space is available to teach and learn.empathy is not least a means of pedagogy and ensures a highquality of teacher-student relationships. It is well knownfrom psychology as well as from educational science that em-pathy is an important factor on the way to successful teach-ing. on the other hand, the student, the one who must learnhow to act in the world, must copy observed things accu-rately. even today, people learn primarily from imitatingothers – of course often enhanced by spoken descriptions.Nevertheless, social learning is always in part a process ofmimesis, in which information is passed over by replicatingthe action or action-chain in question.
over the past several years, it has become clear thatmimetic replication in humans seems to be underlied by amental simulation of the observed action(s). Humans andhigher nonhuman primates have a special neuronal systemin the prefrontal cortex to execute this task: the mirror neu-ron system. Mirror neurons mentally imitate actions by
building up their neuronal correlate. It has been proposedthat exactly this internal copying process allows modern manto understand the intentions underlying another’s action. Inthis respect, social learning is crucially boosted by the em-pathy mediated mirror neuron mechanism, which enableshumans’ capacity for guided imitation by isolating the in-tentional goal and the necessary procedure to achieving it.In contrast, higher primates seem to learn by emulationwithout isolating the intentional pathway leading to an end.e result is that they try to replicate only what they candocument as outcome – a situation in which a lot of infor-mation gets lost and individuals lose themselves in endlessiterations of trial and error. I therefore propose a correlationbetween the underlying cognitive learning mechanisms inmodern humans and the pronounced frequency of innova-tive phenomena in the archaeological record, beginning withdevelopments in the consolidated african Msa somewherearound 150 000 bP.
I.4 CoMMuNaL CuLture aNd tHe eVoLu-tIoN oF CuLturaL CaPaCIty
e chapter constitutes the key element of the presentwork. It attempts to formulate the theoretical key conceptsto bridging interdisciplinarily informed cognitive theoryand empirical archaeology. e starting point is the insightthat culture in the wider sense is not exclusive to humans,but also shared, e. g., by bees, dolphins and great apes, es-pecially chimpanzees.
e second premise, following the pertinent literatureand general trend in evolutionary anthropology, states thatculture is not a basically static and only contingentlychanging entity, but is subjected to evolutionary change aswell. Cultural evolution is thus a gradual process and con-tinues to advance. I argue that over the millennia, culturehas passed some significant thresholds which articulate theevolution of cultural capacity in the human branch of theprimate clade.
granting traditions and weak transmission of social in-formation the status of culture, chimpanzees and other cul-ture-having animals are grouped under the label of basicculture. since bonobos and orangutans have basic culturein this sense, this cultural capacity dates back much furtherthan the Pleistocene boundary and is therefore widespreadin the animal kingdom. e emergence of formalized stonetools some 2.5 million years ago, which mirrors a pro-nounced problem-solution-distance between allocation,production and use of lithic blanks, e. g. by transportationof raw material over considerable distances, marks the nextstep in the evolution of cultural capacity: intermediate cul-ture. It is debatable if this cultural performance is restrictedto hominins or shared at least by chimpanzees. only as late
summary Part I – why humans are empathetic beings 65
as around 300 000 bP can the first developments be docu-mented which seem to be human exclusive: cumulative cul-ture. is type of cultural capacity is characterized by cu-mulative learning processes which allow for building uponalready achieved solutions derived from other problems.e combination of these subsolutions, their recombina-tion, sets free a crucial innovation potential, resulting in thecultural “jack-effect”. It is likely that this transformation ofthe cultural performance of hominins is coupled with thesuccessive emergence of the Middle Palaeolithic and thegradual speciation of Neanderthals. Finally, roughly around100 000 bP, our ancestors passed the threshold to commu-nal culture; a performance which is designated by identitybuilding of archaeological entities and the emergence of a“we”-awareness manifested in the broad and varied array ofpersonal ornaments and art. I argue here that the qualitativestep toward communal culture is only taken by anatomicalmodern human populations.
I suggest that the phenotypical appearance of this ar-chaeological finding is best explainable by invoking theevolutionary emergence of collective intentionality. evi-dence from primatology and developmental psychology al-ready points to collective intentionality as a trait on thegroup level which is likely unique to modern humans. Itresults in groups as acting agents, in which the intention-ality of the social unit is not reducible to the sum of indi-vidual intentions present in it. In this sense, it is an emer-gent phenomenon characterizing the special ontologicalfabric of the social group as a whole. recently, research indevelopmental psychology has indicated that human in-fants are crucially sensitive to shared attention and the es-tablishment of contra factual realities in collective play.is finding is seen as mirroring the evolutionary founda-tion of social norms and rule sets because infants are ableto coordinate on the same virtual rule codex – a codexwhich has no direct counterpart in reality. because virtu-ality is an important part of complex empathic capacitiesand allows for inter-personal rule convergence, this shouldbe considered as an argument for the empathic micro-foundation of collective intentionality.
From an evolutionary anthropological point of view, twosociocultural by-products of this development can be docu-mented: (1) social entities are becoming discrete and areclearly separated from each other by the display of an indi-vidualized material culture profile; archaeologists are thusable to identify a qualitative transformation of the culturallandscape which mirrors a high degree of internal fragmen-tation and segregation, and (2) collective intentionality isthe bedrock of social facts which owe their existence to thefactor that people collectively believe in them. as a conse-quence, sociocultural norms and values shape the materialand intellectual outline of social entities – they begin tobuild up social identities and form a cultural memory which
passes on cultural information over generations. such a shiftwithin the cultural landscape of the Palaeolithic is only vis-ible in the african Msa and with the onset of the earlyupper Palaeolithic in Central and western europe. It is ex-pressed by a number of different contemporaneous techno-complexes organized around different and highly overdeter-mined projectile heads as well as regional traditions ofpersonal ornaments and mobile art.
I.5 eMPatHIC PosItIoNaLIty, exCHaNgeNetworKs aNd tHe roots oF CIVILIZa-tIoN
e chapter attempts to conceptualize being human as hav-ing an empathic positionality, a world access which is glob-ally channeled and in part constituted by empathy. one ofthe corner stones of this mode of being-in-the-world is theimplicit reciprocity of an empathic disposition. e antic-ipation of beliefs and expectations that others might haveis coupled with the expectation that others anticipate thosethat oneself has. e logic being applied can be describedwith the metaphor of “empathy as a gift”. to empathizewith others implies the expectation that others empathizewith oneself as well and is crucially dependent on it. In acertain sense, this reciprocity is a structural precondition ofthe empathy relation between different social players. Froman evolutionary anthropological perspective, this is the nu-cleus of social exchange, particularly of giving and taking.reciprocity as implied by empathization is one of the evo-lutionary forces that gave rise to complex cooperative be-haviour.
Cultural anthropology encapsulates this phenomenonwith the notion of “gift exchange”, a concept which is con-sidered one of the fundamental structural ingredients ofhuman sociality. In this view, social units are constituted bythe iterated circulation of goods in space, passed on fromone person to the other and back again. alliances are “do-nated” by the constant exchange of objects which are be-lieved to carry a part of the giver’s “soul” or “essence”. bypassing on an integral part of oneself to another, trustwor-thiness and commitment are communicated. is logic en-tails that gifts carry an implicit obligation, a need to giveback an object in return. In this sense, empathy and gift ex-change practices are structurally and likely cognitively re-lated. an empathic landscape is thus manifested in the socialinterconnectedness of that landscape, which builds up a so-cial space of overlapping social networks of considerable ex-tension. I argue that such a social space with networkingagents evolved only in the african Msa and in Late Pleis-tocene europe. In africa, this is initially restricted to circu-lating beads and mollusk shells, accompanied by long rangeobsidian displacement, constituting spaces of circulation.
66 shumon t. Hussain
e early upper Palaeolithic in Central and western europedisplays a similar signature with mollusk transportation overconsiderable distances and personal ornament circulationareas. It is debatable if a significant shift in raw material al-location distances between the Middle and upper Palae-olithic can be accounted for by the same phenomenon. In
sum, what Mauss called the foundation of civilization, ofbasically every form of human sociality, emerges in a time-frame around 150 000 and 80 000 bP and reaches the gatesof europe via “out of africa” around 40 000 bP – a time-frame in which other empathy proxies indicate an elabora-tion of these capacities as well.
67
II.1 eMPatHIe, aggressIoN uNd gruPPeN-orgaNIsatIoN
die empathische Komponente der Neandertalersozialität
We raise them, we care for them, we suffer for them, we keep them from harm their whole lives ...
now eventually, it’s their turn to take care of us.
Lwaxana troi zu timcin über die Verantwortung von Kindern zu ihren alternden eltern.
star trek tNg, „Half a Life“
auch wenn ich hier nicht die gesamte entwicklungsge-schichte der empathie im Verlauf der menschlichen evolu-tion zu skizzieren vermag, brennt doch eine Frage geradezuauf der Zunge. wie genau unterscheidet sich das empathi-sche Vermögen des modernen Menschen von dem unserertaxonomischen Verwandten? was konkret kennzeichnet diehumanspezifische empathieleistung? Ziel dieses Kapitels istes, entsprechend Licht in das dunkel der Frage nach der dif-ferentia specifica in der empathiebegabung des modernenMenschen zu bringen. Ich habe mich dazu entschieden, die-sen sachverhalt in einer exemplarischen Fallstudie unserernächsten Verwandten, den europäischen Neandertalern, zubeleuchten. Konkret bedeutet das also, dass sich die Fragenach der besonderheit der empathischen architektur vonHomo sapiens an der Frage nach dem kleinen aber feinenunterschied zum Neandertaler entzündet. Lässt sich dieese einer qualitativen differenz im spiegel der archäolo-gie unserer oft als archaisch verschrienen Verwandten halten?Ich werde zu zeigen versuchen, dass dies der Fall ist. dreh-und angelpunkt dieser Überlegungen wird ähnlich wiebeim anatomisch modernen Menschen die sozialität undderen empathischer einschlag sein. dabei ist klar (um esnochmals deutlich zu machen), dass unter dem koevolutio-nistischen Paradigma kognitiver entwicklung davon ausge-gangen werden muss, dass empathie als diskretes mentalesVermögen schon sehr früh evolviert ist und sich dement-sprechend auch beim Neandertaler zeigt. das evolutionäreMilieu der empathiegenese ist in kleinen gruppen zu ver-
orten, die eine Notwendigkeit zu engen und starken sozialenbindungen entfalten. Jedenfalls kann es nicht darum gehenzu zeigen, dass empathie für den modernen Menschen ex-klusiv ist, sondern lediglich, dass Neandertaler nicht überwichtige aspekte höherer empathie verfügten. anders aus-gedrückt, dass es unseren Verwandten letztlich an einer ganzzentralen Komplexitätsebene sozialer Kognition mangelte.welche archäologischen Hinweise sprechen nun für dieseese? d’errico und andere haben immer wieder dafür plä-diert, die gemeinsamkeiten von Neandertalern und moder-nen Menschen zu betonen, auf die Ähnlichkeiten zu rekur-rieren und erstere deshalb als „gar nicht so verschieden“ vonuns zu begreifen.193 das ist aber nur die halbe geschichte.wie bereits deutlich gemacht wurde, treten beim Neander-taler kleinere, aber durchaus weitreichende differenzen imLife-History-Profil und der damit einhergehenden Hirnent-wicklung auf. wenn in dieser arbeit vom Neandertaler alsetwas Indifferentem und einheitlichem die rede ist, dannist immer zu bedenken, dass diese terminologie stets nurheuristischen wert hat, keinesfalls soll damit auf etwas es-sentialistisches rekurriert werden. dennoch wird gleich demmodernen Menschen und anderen homininen taxa davonausgegangen, dass diese entscheidendes gemein haben. undzwar fernab von ausschließlich morphometrischen Parame-tern. der Neandertaler wird als träger kumulativer Kulturverstanden, der vor allem in seiner spätphase, dem finalenMittelpaläolithikum, über sich klar abzeichnende, regionalvariierende Kulturtraditionen verfügte.194
es bietet sich an, die spur der empathie in der anthro-pogenetischen entwicklungslinie unserer Verwandten beieinem in den letzten Jahren intensiv diskutierten Phänomenaufzunehmen: den ältesten, wohl intentionellen bestattun-gen der Menschheitsgeschichte. Hauptstreitpunkt ist dieFrage, ob es sich überhaupt um bestattungen im strengensinne handelt, oder lediglich um räumlich isolierte Nieder-legungen, um den toten schutz zu gewähren. einige stim-men zweifeln gar an, dass Neandertaler ihre toten an spe-ziellen orten niedergelegt haben und ver suchen, dietatsache der teils außergewöhnlichen skelett erhaltung mitdifferentiellen postdepositionellen und taphonomischenProzessen zu erklären.195 die meisten Fachwissenschaftlerstimmen jedoch darin überein, dass zumindest einige Ne-andertalergruppen ihre toten intentionell niedergelegthaben.196 ob im Lichte von de facto existenten eintiefungenvon bestattungen gesprochen werden darf, bleibt jedenfallseine offene Frage. Ich werde deshalb im Folgenden nurnoch von intentionellen Niederlegungen sprechen. einesist dabei stets im Hinterkopf zu behalten. Neandertaler-
teIL IIwaruM der NeaNdertaLer aNders Ist
193 vgl. grundlegend etwa d’errICo et al. 1998; aber auchd’errICo 2003; dagegen etwa MeLLars 2005.194 vgl. exemplarisch LaNgLey et al. 2008; aber auch daVIes &uNderdowN 2006.195 vgl. etwa gargett 1989; 1999.196 vgl. neuerdings PettItt 2011a, 79ff.
68 shumon t. Hussain
überreste stellen das bei weitem umfangreichste Hypodigmaaller Hominiden, einschließlich des modernen Menschenvor dem Holozän. allein schon dieser sachverhalt, gepaartmit nahezu vollständig erhaltenen Körperteilen im anato-mischen Verband (auch von Kindern), deutet auf eine be-wusste Niederlegung einzelner Individuen in geschütztenbereichen, die die Körper dem Zugriff der Karnivoren ent-zogen. die meisten der überzeugendsten Fälle von Nieder-legungen finden sich entsprechend unter Felsvorsprüngenoder in Höhlen. erst anfang des letzten Jahrhunderts wurdemehr und mehr deutlich, dass der Neandertaler durchauszu sozialleistungen imstande war, die man bis dato für ex-klusivkompetenzen unserer art hielt. als Impulsgeber diesesParadigmenwechsels kann wohl die entdeckung der Nean-dertalerüberreste von La Chapelle-aux-saints in Frankreichgelten.197 der befund im südwestlichen Frankreich verweisteindeutig auf eine intentionelle Niederlegung, weil diestrukturierung und Inszenierung des männlichen Individu-ums eine natürliche Kausalverursachung mehr als nur un-wahrscheinlich macht.198 das nahezu vollständige skeletteines erwachsenen konnte aus einer rechteckigen grube vonetwa 30 cm tiefe geborgen werden, die sich im bereich desHöhleneingangs befand. der Kopf lag gegen die Höhlen-wand gelehnt und war mit einigen steinblöcken verkeilt. Inder Nähe des schädels konnte zudem eine ganze reihe anFeuerstein- und Quarzartefakten geborgen werden. ob essich dabei um ordinäre beigaben des Verstorbenen handelt,muss hier offenbleiben (und ist ohnehin eine debatte fürsich). alter und Zustand des männlichen Individuums sindim hier verhandelten Kontext von herausragendem Inte-resse. Nähere untersuchungen der skelettierten Überrestelegen nämlich ein alter von ende dreißig, d. h. nahezu vier-zig Jahren, nahe. das ist äußerst erstaunlich. trinkaus undompson konnten in einer einschlägigen untersuchungauf der basis multivariater Parameter nachweisen, dass dieLebenserwartung eines durchschnittlichen Neandertalerssehr kurz gewesen sein muss, sprich, dass gerade einmal etwaneun Prozent aller Individuen hoffen konnten, mehr alsfünfunddreißig Jahre alt zu werden.199 trinkaus konnte die-ses ergebnis in einer näheren analyse der Überreste vonmehr als zweihundert Neandertalern aus europa und demVorderen orient bestätigen. diese ergebnisse legen zudemeinen hohen grad an adaptivem stress nahe, der das Lebenunserer Verwandten geprägt und deren Lebenserwartung li-mitiert hat.200 weil das niedergelegte Individuum von LaChapelle-aux-saints zudem ausgeprägte arthritische Verän-derungen aufweist, die es ihm wahrscheinlich unmöglich ge-macht haben, an körperlich fordernden aktivitäten der un-mittelbaren subsistenzsicherung (zu nennen ist vor allemdie Jagd) zu partizipieren, lassen sich indirekte aussagenüber einige grundzüge der Neandertalersozialität treffen.da dem älteren Mann außerdem noch etliche Zähne fehlen,was es ihm schwer gemacht haben dürfte, feste Nahrung zu
Intentionelle Niederlegungen beim Neandertaler, die eine engeund emotional unterlegte beziehung zwischen gruppenmitglie-dern anzeigen; häufig sind kritische, d. h. besonders sensible sta-dien der Life-History in diesen bestattungskontexten repräsen-tiert wie etwa Neugeborene und insbesondere alte. Letztereweisen oft etliche Lädierungen und verheilte Pathologien auf, diedarauf verweisen, dass diese Individuen trotz ihrer reduzierten‘Fitness’ weiterhin von der gruppe getragen wurden. oben: ‘empathische Niederlegung’ eines neugeborenen Nean-dertalerindividuums aus dederiyeh, syrien. M. 1:10. (aus: Pet-tItt 2011a, Fig. 5.7; Zeichnung: takeru akazawa) unten: bestattung eines alten und teils zahnlosen sowie an ar-thritis leidenden Individuums aus La-Chapelle-aux-saints, Frank-reich. o.M. (aus: Pettitt 2011a, Fig. 5.8, umgezeichnet nachbouyssoNIe et al. 1908)
197 vgl. bouyssoNIe et al. 1908; roCHe 1976.198 vgl. Kommentar d.w. Frayer & a. Montet-white zu gar-gett 1989 (s. 180–181).199 vgl. trINKaus & tHoMPsoN 1987.200 vgl. trINKaus 1995.
warum der Neandertaler anders ist 69
sich zu nehmen, liegt es nahe anzunehmen, dass dieses In-dividuum jene einschränkungen (die nicht todesursächlichsind, sondern prae mortem aufgetreten sein müssen) nur mitder Hilfe anderer um einige Jahre überlebt hat.201 Zumin-dest einige Neandertalergruppen verfügten offenbar über eininternes soziales Netz, das diejenigen, die nicht mehr voll-ständig für sich selbst sorgen konnten, abfederte und nichtdem tod preisgab. die sozialfürsorge von älteren Indivi-duen, die bereits über viele Jahre ein fester bestandteil dergruppe waren, ist ein aspekt jener Intragruppenkoopera-tion. Jene, die seit jeher einen beitrag für das Überleben dersozialen einheit geleistet hatten, repräsentierten offenbareinen sozialen wert sui generis und konnten nicht einfachaufgegeben werden. Prämortale Pathologien, die erheblichekörperliche einschränkungen nach sich ziehen, bilden einallgemeines Muster im Korpus intentioneller Neandertaler-niederlegungen. Ähnlich krankhafte erscheinungen treteninsbesondere bei den weitgehend als gesichert geltendenNiederlegungen von shanidar IV, VI, VII und VIII im kur-dischen Irak der shkaft Mazin shanidar Höhle auf.202 dieIndividuen klustern auf engem raum und sind möglicher-weise mit steinsetzungen nach oben gesichert worden. dieÜberreste, die zwischen 40 000 und 50 000 bP datiert wer-den, weisen etliche Knochenveränderungen, brüche undVerletzungen auf wie sie auch bei den Niederlegungen vonLa Ferrassie II in Frankreich und tabun I in Israel beobach-tet werden konnten.203
beachtlich ist der befund von La grotte du régourdouin der französischen dordogne. dort wird das bedürfnis,den toten zu schützen, ihn vor schaden zu bewahren, be-sonders deutlich. das erhaltene Neandertalerskelett dieserHöhle wurde unter einem steintumulus erheblicher Mäch-tigkeit geborgen, der nicht natürlicherweise an jenen ortgelangt sein kann und intentionell über dem Verstorbenenplatziert wurde.204 In régourdou handelt es sich vielleichtum das älteste grab unserer evolutionären Vergangenheit.wie sind diese intentionellen Niederlegungen zu erklären?Letztlich ist die Frage kritisch, ob die bis dato vorgeschlage-nen Möglichkeiten das Phänomen erschöpfend zu erhellenmögen. sind die zwischen dreißig und vierzig gesicherteneinbettungen unserer nächsten Verwandten bereits hinrei-chend erklärt, wenn lediglich auf den Zusammenhalt dergruppe und einer sich daraus ableitenden sozialen wertset-zung rekurriert wird? Ich bin davon überzeugt, dass dieseraspekt angesichts sporadischer Hinweise auf eine rituelleeinbettung dieser Niederlegungen zwar durchaus von be-deutung ist, sich bei genauerer betrachtung aber lediglichals symptom einer grundlegenderen gestaltveränderung inder sozialität später Neandertaler entpuppt.205 Harrold vo-tiert dafür, den akt des schützens und abschottens dertoten als unmittelbare Manifestation starker sozialer undemotionaler bindungen innerhalb sozialer Neandertalerein-heiten zu verstehen.206 emotionalität könnte tatsächlich
eine beachtliche rolle spielen. bereits Pettitt weist daraufhin, dass die raue Lebensweise von Neandertalern, die sichim pathologisierten befund dieser taxonomischen ordnungspiegelt, eine starke auseinandersetzung mit dem Körpernach sich ziehen könnte.207 dies würde erklären, warumNiederlegungen bei Neandertalern stets auf den Niederge-legten selbst fokussiert sind und keine beigaben dergestaltbeinhalten, wie sie etwa bei den weitgehend kontemporärenbestattungen moderner Menschen nachweisbar sind. unsereVerwandten lebten offensichtlich in kleinen gruppen miteinem hohen grad an Face-to-Face-Interaktionen, in denendie auseinandersetzung mit anderen gruppenmitgliedernim Vordergrund stand und zudem notwendig für die Ko-häsion des sozialverbands war.208 davies und underdownkonstatieren, dass starke emotionale und soziale bindungs-kräfte zwischen sozialen akteuren dazu führen, dass der todeines Individuums ein soziales ebenso wie emotionales Va-kuum hinterlässt, das die Hinterbliebenen emotional er-schüttert und dazu motiviert, den Verstorbenen vor weiterengefahren zu schützen.209 Ich stimme dem zu, gehe jedochnoch einen schritt weiter. Ich schlage vor, die intentionellenNiederlegungen beim Neandertaler als Niederschlag vonempathie zu begreifen. soziale beziehungen, die durch em-pathie unterfüttert werden, entfalten gleichsam eine emo-tionale dimension, die eine enorme Motivationskraft (auchzu augenscheinlich ressourcenverschwendendem Verhalten)sein kann. wird eine starke empathische beziehung durchden tod eines Individuums abrupt unterbrochen, wird diesals starker persönlicher Verlust empfunden, als absterbeneines teils des selbst. weil bindungen durch empathie anIntensivität und Intimität gewinnen, ist es nicht weit her-geholt, vom beschützenden Niederlegen als empathischenakt zu sprechen. dies gilt insbesondere deshalb, weil nichtnur mit dem gestorbenen quasi-mitempfunden wird, son-dern vor allem mit den anderen gruppenmitgliedern, dieeinen wichtigen bestandteil ihres sozialen beziehungsnetzesverloren haben. weil jeder mentalisierend annimmt, dassder andere durch den Verlust per se emotional getroffen wird(eine empathische beziehung ist, solange sie reziprok wirk-
201 vgl. CoNstabLe 1977, 104f.202 vgl. PettItt 2011a, 122ff.203 vgl. CoNstabLe 1977, 105.204 vgl. etwa boNIFay 1964; 2008; VaNderMeersCH 1965; aberauch MadeLaINe et al. 2008.205 vgl. etwa dIbbLe & CHase 1993; tattersaLL 2004; dage-gen Patou-MatHIs 2000; arsuga 2003.206 vgl. HarroLd 1980; neuerdings auch sPIKINs et al. 2010.207 vgl. PettItt 2000; aber auch PettItt 2011b.208 vgl. etwa daVIes & uNderdowN 2006, 156; aber auch uN-derdowN 2004, 198.209 vgl. daVIes & uNderdowN 2006, 156.
70 shumon t. Hussain
sam ist, in der regel von positivem emotionalem Feedbackbegleitet, der nun wegfällt und damit eine negative emotio-nale reaktion hinterlässt), stellt sich eine implizite wertset-zung ein, die emotional legitimiert ist. diesem sozialen wertmuss die soziale einheit mit adäquatem Verhalten gerechtwerden. der Verstorbene (zumindest sein Körper) wirdnoch einmal gewürdigt. empathie ist die entscheidende Ver-mittlungsinstanz, die eine letzte dem Verschiedenen gemäßeHandlung fordert und stimuliert (was das im einzelnen ist,scheint über die soziokulturellen Milieus zu variieren).
Ich schlage vor, intentionelle Niederlegungen oder be-stattungen beim Neandertaler als empathic bedding zu ver-stehen und damit als ausdruck einer basalen, auf emotio-nalität fußenden sozialen Kognition. die tatsache, dassnahezu ausschließlich präadulte und postadulte, d. h. ent-weder sehr junge oder sehr alte Individuen, diese behand-lung erfahren haben, könnte ein wichtiger Hinweis in dieserichtung sein. Neandertalerniederlegungen sind so unterdem gesichtspunkt einer emotionalen anreicherung undQualitätssteigerung sozialer beziehungen zu betrachten. erstdas empathische Miteinander stiftet einen sozialen wert mitdergestaltiger Motivationskraft, die nicht nur optional, son-dern obligatorisch ist. eine empathisch geartete sozialitätkönnte plausibel machen, warum solche Niederlegungentrotz allem vermutlich die ausnahme in der Praxis der to-tenbehandlung darstellen.210 es ist denkbar, dass jene Nie-derlegungen ein epiphänomen im Verhaltensrepertoire un-serer Verwandten markieren, dass diese nur in bestimmtensituation, unter bestimmten Vorbedingungen und in au-ßergewöhnlichen Fällen (etwa nur bei herausragenden Per-sönlichkeiten) in den uns heute so bedeutsam erscheinendenQuasi-bestattungen resultierten. eine solche Kontextabhän-gigkeit passt sehr gut zu einem empathischen Verständnisdieser Praktiken. Mit Mithen lässt sich festhalten, dass es imLichte ihrer großen gehirne, ihrer komplexen materiellenKultur und den herausfordernden klimatischen bedingun-gen, in denen sie lebten, wahrscheinlich ist, dass Neander-taler in sozialen einheiten mit starken bindungskräften leb-ten, um Kooperation und damit Überleben innerhalb dergruppe zu sichern. Mithen betont zu recht, dass dies, ge-meinsam mit den aktuell zur Verfügung stehenden datenzur sterblichkeit, das bild fragmentierter Populationen er-gibt, die kaum oder gerade so langfristig überlebensfähigsind. Neandertalergruppen scheinen nach allem, was wirwissen, minimalstabil gewesen zu sein. Jeder tote, so Mit-hen, bedeutet daher einen beachtlichen Verlust.211 so gese-
hen ist auch hier eine empathische Kanalisierung und In-ternalisierung denkbar. entscheidend ist letztlich aber, dassempathische Momente sich in der materiellen Kultur desNeandertalers kaum zeigen. Lediglich im Kontext der na-türlichen eliminierung sozialer beziehungen tritt ein solchesvorsichtig zutage. empathie, so die Hypothese dieses ab-schnitts, ist bei unseren Verwandten deutlich limitiert. Ne-andertaler verfügten zwar über ein basales Vermögen sozialerKognition, können aber keinesfalls mit der höheren empa-thiefähigkeit moderner Menschen konkurrieren. auch wenndie mutmaßliche Neandertalerbestattung von tabun I miteinem alter zwischen 110 000 und 150 000 bP, vermutlichetwas älter ist als die erste ordinäre bestattung früher mo-derner Menschen in Qafzeh,212 zeichnet sich das bild einerevolutionären Kongruenzbewegung in der Herausbildunghöherer kognitiver Fähigkeiten in unterschiedlichen Ästender menschlichen Lineage ab. der große Korpus eines Ver-haltens im sinne von empathic bedding datiert zwischen80 000 und 40 000 bP und fällt damit in jenen Zeitraum,in dem sich beim modernen Menschen erste Momente einerempathischen Positionalität andeuten.213 es liegt nahe an-zunehmen, dass die sich in ihrer dynamik scheinbar deut-lich unterscheidenden entwicklungspfade der kognitivenevolution bei Neandertaler und modernem Menschen vorallem aufgrund ihres rückwirkenden sozialen substrats diffe-rieren könnten. wir haben gesehen, wie eng sozialität undkognitive entwicklung gekoppelt sind. die ultimaten ur-sachen für diese differenz könnten daher zu einem wesent-lichen teil soziokulturell begründet sein.
die bedeutung der aggression als sozialer antagonist
Do you know that you’re one of the few predator species that preys even on itself ?
trelane zu Kirk.star trek tos, „e squire of gothos“
um die wechselseitige Verschränktheit von sozialität undempathie, d. h. negative sowie positive rückkoppelungsef-fekte, angemessen theoretisch zu reflektieren sowie in ein koe-volutives szenario zu integrieren und davon ausgehendzudem noch mit fundierter spekulation in die menschlicheVergangenheit vorzudringen, wäre Inhalt eines ganzen bu-ches. eines anderen buches. Hier will ich lediglich aufzeigen,dass diese gegenseitige eingelassenheit schlicht eine tatsacheist und in jeder evolutionstheoretischen Modellierung kogni-tiver Vermögen berücksichtigt werden muss. Insbesondere inder auseinandersetzung mit empathie. Ich schlage vor, sichder Komplexität dieses sachverhalts über die Kategorie deraggression zu nähern. aggressives Verhalten hat sowohl einebiologische als auch eine soziologische Komponente. außer-
210 vgl. PettItt 2011a, 137.211 vgl. MItHeN 2009.212 vgl. bar-yoseF & CaLLaNder 1999.213 vgl. zur datierung der Neandertaler-Niederlegungen zusam-menfassend PettItt 2011a, 81ff.
warum der Neandertaler anders ist 71
dem findet es sich nahezu überall in der belebten Natur, je-doch stets in unterschiedlicher gestalt. den aggressionssti-mulus in der anthropogenese aufzuschlüsseln, könnte alsovielversprechend sein. und zwar nicht zuletzt deshalb, weilauch aggression (genau wie empathie) zwischenmenschlichebeziehungen und soziale Interaktionen strukturiert. empa-thie und aggression könnten sich sowohl gegenseitig impli-zieren als auch sozialdynamisch überlagern und abschwä-chen. wie ist es bei Neandertalern um aggressivität bestellt?um diese zentrale Frage angemessen zu beantworten, ist eszunächst notwendig, sich der allgemeinen evolutionsbiologieder aggression zu widmen. Illies notiert, dass die anlage zuraggression ebenso relevant ist wie jene zur Kooperation.214
Mit aggressionsverhalten ist jenes Verhalten gemeint, dasdurch inner- und außerartliche antagonistische Interaktionengekennzeichnet ist. Im Falle von Menschen bezieht es sichvor allem auf den Handlungsantagonismus, den Menschenmit anderen Menschen haben. ein solches Verhaltensreper-toire reicht von sozialer Konkurrenz bis hin zu körperlichenauseinandersetzungen, die ernste Verletzungen und sogarden tod nach sich ziehen können. die evolutionsbiologiesieht in der kontextbezogenen disposition für aggressioneine sinnvolle anpassung bei tieren und beim Menschen.215
Jene einsicht geht unter anderem auf Lorenz zurück, der sichin seinem buch „das sogenannte böse“ mit dem ema be-schäftigt hat;216 sie hat sich aber auch in soziobiologie undevolutionärer Psychologie nicht grundlegend geändert.wenn aggression kontextbezogene anpassung ist, wo trittsie dann bei Menschen zutage? diskutiert werden einigegrundsituationen. die im hier verhandelten Zusammen-hang wichtigsten sind wohl aggression bei Nahrungsmittel-konkurrenz oder allgemein bei Konkurrenz um besitz oderterritorialen raum, in Verteidigungssituationen (vor allembei Übergriffen gegen die eigenen Nachkommen), bei riva-litäten um sexuelle Partner, und nicht zuletzt aggression als Mittel zurerlangung und sicherung von status in sozialen rangord-nungen. Hinzu kommt eine disposition für aggressives Ver-halten gegen Fremde, d. h. gegen soziale akteure, die nichtder eigenen gruppe angehören.217 diese Ingroup- versus Out-group-Konflikte sind für eine rekonstruktion der sozialstra-tegien verschiedener sozialer einheiten unserer Verwandtenein wichtiger baustein. Fremdabgrenzung und der ausschlussvon Fremden aus der eigenen gruppe können in offenen undfeindseligen Verhaltensweisen münden. der umgang mitdem anderen kennzeichnet die sozialstruktur zwischen ein-zelnen gruppen, in der (wie deutlich gemacht wurde) ent-scheidende unterschiede zwischen Neandertalern und mo-dernen Menschen zu erwarten sind.
aggression zwischen den gruppen kann ein wichtigesregulativ der ordnung zwischen den sozialen entitätensein. besonders prominent ist das bei schimpansen zu be-obachten. die gruppenkonflikte dieser Primaten spitzen
sich gelegentlich derart zu, dass mit gewissem recht von of-fenen Kriegshandlungen gesprochen werden kann. dietiere gehen dabei mit einer teils schockierenden brutalitätvor und zerfleischen ihre opfer gar.218 Jedenfalls stehennichtmenschliche Primaten damit nicht allein im tierreich. aggression spielt seit jeher eine zentrale rolle in der Koor-dination einzelner sozialverbände. und zwar nicht zuletztdeshalb, weil soziale einheiten unter kulturevolutionärengesichtspunkten in unmittelbarer Konkurrenz zueinander-stehen. derzeit spricht einiges dafür, dass aggressives Verhal-ten ein wichtiger Mechanismus zur regulation und aus-handlung sozialer rangordnungen ist, welchen wiederumeine schlüsselstellung für die weitergabe der eigenen anla-gen zukommt. das erklärt auch, warum aggression gegen-über Nicht-Verwandten stets stärker ausgeprägt ist als ge-genüber Verwandten.219 solche Verhaltensmuster könnenvon lebensbedrohlichen auseinandersetzungen bis hin zu ri-tualisierten ersatzhandlungen reichen. Immer ist dabei diebewahrung der distanz zum Fremden ein wichtiges Mo-ment, weil der Fremde, der nicht zur eigenen gruppe gehört, meist auch der genetisch Fremde ist, von dem einereproduktive gefahr und Konkurrenz ausgeht. weil wild-beutergruppen durch einen hohen Verwandtschaftsgrad ge-kennzeichnet sind (diese legitimieren und identifizieren sichhäufig gar über deszendenzordnungen) und dieser über diegruppengrenzen hinweg abnimmt, ist Intergruppenaggres-sion eine übliche erscheinung. Über einen solchen Mecha-nismus wird zudem eine Verhaltensangleichung innerhalbder sozialen einheit realisiert, die mit einer Minimierungsozialer Konfliktpotenziale einhergeht.220 Menschen kon-kurrieren wie andere tiere als gruppen um sozialen raum,aber auch um natürlich knappe ressourcen, was eine posi-tive selektion aggressiver Verhaltensmuster fördert.
Meine Hypothese besagt, dass insgesamt viel für eineausgeprägte disposition zur aggression beim Neandertalerspricht. diese Menschenform scheint sehr viel stärker alsmoderne Populationen durch eine soziale Isolationsstrategiegekennzeichnet zu sein, die den harschen bedingungen deseiszeitlichen eurasiens weitgehend auf sich allein gestellt ent-gegentritt. bisher sind weder soziale aggregationsräume nochandere orte bekannt, die auf intensive Kontakte zwischeneinzelnen gruppen hindeuten. die sozialverbände der Ne-andertaler waren allem anschein nach anders als die des mo-dernen Menschen nicht in weitspannenden austauschnetze
214 vgl. ILLIes 2006, 134.215 ILLIes 2006, 134f.216 vgl. grundlegend LoreNZ 1963.217 vgl. dazu HaMburg 1971; eIbL-eIbesFeLd 1973, 94; vorallem buss 2004, 280ff.218 vgl. dazu goodaLL 1986.219 vgl. VoLaNd 1999, 595f.220 vgl. ILLIes 2006, 137f.
72 shumon t. Hussain
integriert und damit sowohl im subsistenzverhalten als auchin Krisenzeiten wohl weitgehend auf sich allein gestellt. die-ser umstand ist vielleicht ein artefakt ihrer eigentümlichensubsistenzstrategie, die, wie wir anhand von Isotopenunter-suchungen wissen, vor allem auf der ausbeutung der step-penbewohnenden großfauna eurasiens beruhte.221 der Ne-andertaler war wohl der erste und extremste großwildjägerder Menschheitsgeschichte. die gefahren und Herausfor-derungen der Jagd auf teils sehr aggressive tiere wie Mam-muts oder das große wollnashorn haben deutliche spurenhinterlassen. die sterblichen Überreste der meisten unsheute noch erhalten geblieben Neandertalergebeine sind vonphysischen stressmarkern geradezu überzogen. Verletzun-gen, Pathologien und spuren eines extremen Lebens unterständigem risiko zeichnen die skelette. das Leben bei denwildtieren zeigt sich in einem belastungsmuster, das demmoderner rodeoreiter gleicht.222 Jedenfalls spricht auch dieintensive Interaktion mit der großfauna, ebenso wie der Le-bensstil, der mit einer solchen subsistenzstrategie einher-geht, für eine Förderung ohnehin schon angelegter aggres-siver Verhaltensweisen.
Ferner lassen sich vermutlich auch ritualisierte ersatz-handlungen einer solchen aggressionsdisposition beim
Neandertaler nachweisen. anthropologen kennen heuteunzählige beispiele für postmortale Modifikationen an Ne-andertalerüberresten, die intentionellen ursprungs sind.anders als von skeptikern lange vermutet, können dieseHinweise nicht länger wegdiskutiert werden. Jüngst ist diedebatte um kannibalistische Handlungen unserer Vorfah-ren von defleur et al. wieder ins rollen gebracht worden.223
das team um den französischen archäologen konnte inMoula-guercy im tal der ardèche eine ganze reihe disar-tikulierter und mit schnittspuren überzogener Neanderta-lerreste nachweisen, die in ihrer Formalisierung und Inten-sität eine verzweifelte Überlebenshandlung unwahrschein-lich machen und nach anderen deutungen schreien. Mitdefleur et al. muss dort in der tat von kannibalismusana-logen tätigkeiten gesprochen werden. In einem Milieuhoher Intergruppenkonkurrenz, knapper ressourcen undeinem ausgeprägten aggressionspotenzial deutet dies aufein ritualisiertes Handlungsmuster zur aushandlung dersozialbeziehungen hin. Kulturanthropologisch ist weicherKannibalismus, sprich ein solcher, bei dem nicht die ak-quirierung wichtiger Nahrungsquellen, sondern die rituelleregulierung von rechten und Normen zwischen sozialeneinheiten im Mittelpunkt steht, häufig zu beobachten. be-sonders prominent wird er in den schriftchroniken der mit-telamerikanischen andenvölker erwähnt, die teils ganze Po-pulationen an den rand der auslöschung trieben. und diesstets nur, um dem ritual und den durch den ritus verehr-ten Mächten gerecht zu werden.224 Kannibalismussignatu-ren sind meist in einen ritualkontext eingebettet.225 auchritualisiertes Head-Hunting ist in diesem Kontext ethno-graphisch gut belegt.226
221 vgl. boCHereNs 2009.222 vgl. berger & trINKaus 1995.223 vgl. deFLeur et al. 1999.224 vgl. exemplarisch webster 2000.225 vgl. etwa reNFrew 2009, 54.226 vgl. exemplarisch tuNg & KNudsoN 2008.
die Kopagd ist ein verbreitetesPhänomen bei rezenten Jäger-und sammlerpopulationen undfungiert häufig als strategischesMittel, um Intergruppenbezie-hungen zu regulieren und zumediieren. die darstellung zeigtMänner der Marind anim mitschädeln aus rituellen ‘Kopf-jagdzeremonien’, westküste vonNiederländisch-Neuguinea um1910. (Foto: Missionaries of the sa-cred Heart, tilburg, the Nether-lands, mit freundlicher geneh-migung raymond Corbey)
warum der Neandertaler anders ist 73
die etwa 100 000 Jahre alten reste der sechs Neandertaleraus dem tal der ardèche ebenso wie die gut untersuchtenÜberreste aus Krapina in Kroatien weisen auf intensive ent-fleischungspraktiken hin.227 detaillierte analysen am Kno-chen und artefaktbestand konnten zeigen, dass auch einigeschädeldecken geöffnet wurden, möglicherweise um das ge-hirn zu entnehmen. schnittspuren, die auf ähnliche aktivi-täten verweisen, finden sich beispielsweise im belgischenengis, aber auch in Marillac und Combe grenal in Frank-reich.228 das bild, das sich ergibt, bestätigt unsere annah-men. aggression kann als wichtiges Paradigma sozialer re-lationen beim Neandertaler gelten.
was aber hat das mit empathie zu tun? wie wir gesehenhaben, kann empathie ein sehr komplexes Vermögen sein,das sich auf verschiedenen ebenen vollzieht und unterschied-lich sozial unterfüttert und eingebettet sein kann. die Hypo-these, die ich hier stark machen will, behauptet, dass die Ne-andertalersozialität in ihrer grundverfasstheit aggressivausgerichtet war. das soziale substrat, das sich archäologischvor allem auf der Interaktionsebene sozialer einheiten zeigt,ließ so nur wenig raum für empathische entfaltung. ganzeinfach deshalb, weil empathie und aggression auf einer alsKontinuum verstandenen skala sozialer beziehungen gegen-läufig gedacht werden müssen. beide schließen sich gegen-seitig zwar nicht aus, sind aber insofern antagonisten, als diedominanz eines Pols den anderen in seinem entwicklungs-raum ganz entscheidend einschränkt und limitiert. die for-cierte selektion aggressionsregulierter Verhaltensstrategien imevolutionären ast des Neandertalers schuf einen Nährboden,der empathie nur in sehr begrenztem Maße zuließ. die ko-gnitive evolution unserer Verwandten verlief nicht zuletztdeshalb in ganz anderen bahnen als die unsrige. die entwick-lung, die beim Neandertaler zu einer verstärkten Verankerungaggressiver Handlungen geführt hat, wirkt als Hemmstoff derelaborierung einer empathischen Verfasstheit entgegen. so-ziale Kognition ist nicht entscheidend, weil soziale beziehun-gen durch übergeordnete strategien ermittelt werden, die dasVerstehen und adäquate erkennen des anderen nicht unmit-telbar voraussetzen. empathische Qualitäten entwickeln sichquasi ausschließlich als Nebenprodukt einer sich mit dem all-gemeinen evolutionären trend einstellenden Komplexitäts-zunahme sozialer einheiten (anstieg der gruppengröße),229
entfalten also keine eigene koevolutive entwicklungsdyna-mik, weil die soziale Infrastruktur einer solchen diametral ent-gegenläuft. Mit Voland und söling ist man versucht zu kon-statieren, dass das frappierende Fehlen einer umfassendenritualisierung der alltagspraxis (zumindest einer, die archäo-logisch sichtbar wäre) die ese erhärtet, dass keine sozialenregulative den aggressionsimpetus des Neandertalers effektivzu zähmen vermochten und sich deshalb kaum raum fürempathische stimuli öffnete. rituale haben nach Voland undsöling nämlich auch den evolutionären Nutzen (neben dertatsache Kooperationsmotor durch teure signale zu sein),
Kohäsion zu fördern, was zu einer Intensivierung der sozialenbindungen führt, zu einem Näher-aneinanderrücken, undso aggressionspotenziale einzudämmen vermag.230 aggres-sion unterwandert das sich im Verlauf der anthropogeneseherausbildende empathiepotenzial. dem Neandertaler fehlendeshalb etliche jener empathieartefakte, die den evolutionä-ren Pfad bereiten sollten, der in höherer Kulturtechnik undultrasozialität mündet. ein Verhaltensbündel, das sich als äu-ßerst flexibel und anpassungsfähig erwies. es muss wohl nichtbetont werden, dass die einzelnen Charakteristika dieses re-pertoires an Handlungs- und Verhaltensmerkmalen nichtvollständig in einer empathischen Fundierung aufgehen.Nichtsdestotrotz ist die empathische Positionalität eine not-wendige bedingung für deren ausbildung, eine bedingungder Möglichkeit ihrer realisierung.
II.2 autIsMus, soZIaLe FragMeNtIeruNguNd PosItIVe seLeKtIoN
der autist im Neandertaler ?
Being the only Klingon ever to serve in Starfleet ... gave you a singular distinction. But I felt
that what was unique about you was your ... humanity. Compassion ... generosity ... fairness ... You took
the best qualities of humanity and made them part of you. e result ... was a man
who I was proud to call one of my officers.
Picard zu worf.star trek tNg, „redemption“
auch wenn wir niemals darauf hoffen können, die kogniti-ven Kapazitäten ausgestorbener Hominiden (ebenso wie diedes archaischen Homo sapiens) vollständig oder auch nurhinreichend zu entschlüsseln, können auch kleine Hinweisedabei helfen, das Feld zumindest in groben Zügen abzuste-cken. Ich habe mit den wenigen zur Verfügung stehendendaten versucht, deutlich zu machen, dass Neandertalerwahrscheinlich ein anders geartetes soziales Miteinanderpflegten als moderne Menschen. die soziale Infrastrukturihrer fragmentierten gruppen basierte nicht darauf, diementalen Zustände des anderen in Face-to-Face-Interakti-onsszenarien präzise zu lesen und andere in ihrem Hand-lungs- und Kognitionsraum zu verstehen. die zentraleFrage, die deshalb nach wie vor im raum steht, muss sich
227 vgl. CoNstabLe 1977, 104.228 vgl. PettItt 2002, 12.229 vgl. etwa steeLe & sHeNNaN 1996.230 vgl. VoLaNd & sÖLINg 2004.
74 shumon t. Hussain
damit auseinandersetzen, ob sich unabhängige Hinweise an-führen lassen, die diese ese unterfüttern. Hatte der Ne-andertaler eine soziale dysfunktion oder eine einschrän-kung in prosozialen Mind-reading-Fertigkeiten, welche sichnoch nachweisen lassen? Ist die unterfunktion sozialer Ko-gnition, die sich mindestens in einem empathiedefizit nie-derschlägt, tatsächlich evident? evidenz ist hier ohne jedenZweifel ein viel zu starker terminus. trotzdem sind einigeIndizien verfügbar. die debatte kreist um den vermutetennegativen Zusammenhang von eory of Mind und autis-mus, wobei autistische disponiertheit gemeint ist, die‘weich’ ist und nicht sozialen solipsismus nach sich zieht,wie dies in der autistischen extremausprägung der Fall seinkann. eine beeinträchtigung in der Fähigkeit zur Mentali-sierung führt zu autistischen Merkmalen, d. h. zur beein-trächtigung in der Fähigkeit zur sozialen Interaktion mit an-deren akteuren. autismus ist eine einschränkung sozialerKognitionsleistungen. autisten sind meist nicht dazu in derLage, eine brücke zwischen sich und anderen zu schlagenund sind nicht im stande, diese zu verstehen und einzu-schätzen. Jedenfalls schneiden die betroffenen in False-be-lief-aufgaben ebenfalls sehr schlecht ab.231 weil das sozialeerkennen ein empathisches ist, geht autismus mit der Li-mitierung der empathiekapazitäten einher. der autist istmeist nicht in der Lage, zu sich selbst abstand zu gewinnenund bleibt damit in sich gefangen. es handelt sich mit an-deren worten auch um eine störung des sich-Hineinver-setzens in andere akteure. autistische Kinder folgen deshalbhäufig nicht dem blick ihrer bezugspersonen, instanziierenseltener szenarien gemeinsamer aufmerksamkeit undschneiden schlechter bei Nachahmungsaufgaben ab.232
es herrscht zwar nach wie vor einigermaßen Verwirrungdarüber, wie genau autismus zu verstehen ist. Handelt essich sensu stricto um eine diskrete erscheinung oder sinddamit lediglich zusammenfallende Nebenerscheinungen an-derer psychologischer Funktionen gemeint? wie genauhängt eine autistische dysfunktion mit dem mentalen er-schließen sozialer alteritäten zusammen? Insbesondere dieletzte Frage ist in den vergangenen Jahrzehnten intensiv dis-kutiert worden. gestritten wird um die Vorgänge, die ent-scheidend sind oder entscheidend gestört sind, wenn eineautismusspielart diagnostiziert wird. baron-Cohen und an-dere haben versucht, autismus in einer inhärenten ein-schränkung der menschlichen eory of Mind zu verorten,233 wohingegen von Currie und ravenscroft, aberjüngst auch von goldman, wieder stark gemacht worden ist,autismus als störung der simulationseigenschaften desmentalen apparats zu verstehen.234 die simulationstheore-tische Position erfährt dabei zusehends rückenwind aus derFraktion jener Forscher, welche eine Verbindung zwischendem menschlichen spiegelneuronensystem und Mentalisie-rungsprozessen vermuten.235 Nicht zuletzt auch, weil sichdamit die Mimikryeinschränkung autistischer akteure viel-
versprechend erklären lässt, scheint dieser ansatz der bis datovielversprechendere zu sein. Jedenfalls haben beide ihre Pro-bleme. eines ist indes klar. Mentalisierung, wie auch immersie letztlich kleinteilig realisiert wird, ist das regulativ fürdie ausprägung autistischer Merkmale. defizitäre sozialko-gnition öffnet einen raum autistischer entfaltung. was bedeutet das für die Problematik sozialer Kognition beimNeandertaler? die Implikationen sind zwar nicht durch-schlagend, aber durchaus einer Kenntnisnahme wert. dieentschlüsselung des Neandertalergenoms hat uns in dieserFrage vermutlich weiter gebracht als bis dato gedacht. greenet al. konnten einige gene identifizieren, die ätiologisch miteiner autistischen störung in Verbindung gebracht wurden(zu nennen sind beispielsweise CadPs2 und auts2).236
das bedeutet nicht, dass Neandertaler autisten waren, son-dern zunächst einmal nur, dass sich diese gene in der evo-lutionären Linie, die zum modernen Menschen führt, überdie letzten 300 000 Jahre stärker verändert haben als in derunserer Verwandten. Möglicherweise weil ein bestimmtergenkomplex evolutionärer drift oder sogar evolutionäremdruck ausgesetzt war. es ist beachtlich, dass gleichwohl jenegenetischen bausteine einer positiven selektion unterlagen,die negativ an bestimmte sozialkognitive Leistungen gekop-pelt zu sein scheinen. Für mich stützt das die Hypothese,dass sich auf dem evolutionspfad des modernen Menscheneine verschiedenartige Kapazität sozialer Kognition heraus-gebildet hat – eine, die offensichtlich leistungsfähiger ist.Hier müssen jedoch die ergebnisse der nächsten Jahre ab-gewartet werden.
bevor ich mich wieder stärker den archäologischen be-funden widmen kann, muss noch unterstrichen werden, dasseine weiche, autistische disponiertheit, wie ich sie unserenVerwandten unterstelle, keiner essentialistischen (dis-)Qualifizierung gleichkommt. autistische Merkmale werdenhier lediglich als symptomatisch für eine bestimmte Formder sozialität verstanden, nicht als gravierendes sozialdefizit.ohnehin ist fraglich, inwiefern der begriff autismus im art-vergleich als denotat für eine störung taugt. allein schon,weil wir es in evolutionären skalen stets mit graduellen un-terschieden zu tun haben, ist der begriff heuristisch gemeint.es ist alles andere als sicher, ob autistische anlagen in allenKontexten stets Nachteile implizieren. reser hat kürzlich zurecht betont, dass manche Formen autistischen Verhaltensdurchaus als adaptive Problemlösungen für spezifischeumweltkontexte verstanden werden können.237 weicherautismus kann als anpassung an eine Lebensweise gelten,welche weniger auf sozialer Kooperation als auf dem ei-genständigem aneignen von Nahrungsmitteln fußt. reserzeigt, dass weicher autismus durchaus adaptiv sein kann,koevolutiv mit spezifischen sozial- und subsistenzstrate-gien einhergeht und daher ein sehr wichtiger Hinweis fürdie anders geartete organisation sozialer einheiten beimNeandertaler des pleistozänen eurasiens sein könnte. au-
warum der Neandertaler anders ist 75
tismus wird heute nicht mehr einfach als kognitive störungoder dysfunktion abgehandelt, sondern als durchaus kom-plexe erscheinung, die sich in einem reichhaltigen spek-trum an Verhaltensweisen niederschlagen kann.238
eine Form dieses Verhaltenskontinuums ist das asper-ger-syndrom, das zwar durch eine klare differenz in dermentalen architektur gekennzeichnet ist, aber dennochnicht notwendigerweise mit sozialer exklusion oder unfä-higkeit zur sozialen Interkation einhergeht.239 Interessantfür die hier verhandelten belange sind die deutlichen Probleme, die asperger-betroffene mit adäquater empathi-sierung haben. Jene haben schwierigkeiten, angemessenemotional auf andere zu reagieren ebenso wie deren emo-tionalität zu deuten.240 diese Menschen nutzen andere Me-thoden, wie beispielsweise die rationale Inferierung überprobabilistische Kalküle, um das Verhalten anderer sozialerakteure zu verstehen, bedienen sich also nicht des emotio-nalen Verstehens.241 autisten sind zweifelsfrei keine beson-ders guten empathen und haben signifikante Probleme, dieemotionalen und mentalen Zustände anderer zu erfassen.242
Insofern spricht die Indizienverdichtung für Verhaltenswei-sen auf dem autistischen spektrum beim Neandertaler fürein empathiedefizit bei unserem Verwandten. autismus undempathie sind aber auch nur symptome einer sozialen Ver-fasstheit, die bestimmte kognitive Leistungen forciert oderunterdrückt. es ist deshalb letztlich nicht davon auszugehen,dass sich für die kognitive Infrastruktur des Neandertalersein rezentes Korrelat finden lässt.
was beim Neandertaler fehlt
It would seem that we are not completely dissimilar after all... in our hopes or in our fears ... .
romulanischer Captain zu Picard.star trek tNg, „e Chase“
es ist Zeit für ein kurzes resümee. was zeichnet den Ne-andertaler ex negativo aus? Neben einem anders geartetenreifungsprozess, der im unterschied zum modernen Men-schen ganz andere Life-History-Profile und enzephalisa-tionsraten nach sich zieht, ermangelt es dem Neandertaleran weitreichenden austauschnetzen, was für isolativeÜberlebensstrategien der meisten gruppen spricht. damiteinher geht ein autistischer Verhaltenseinschlag, der alsadaptive Justierung einer solchen sozial- und subsistenz-strategie gelten kann. außerdem spricht einiges für eineausgeprägte disposition zur aggression, welche die aus-differenzierung elaborierter, sozialer Kognition potenziellunterläuft. des weiteren ist die ermangelung kommunalerKulturtechnik zu nennen, ebenso wie deren Innovations-raum, der sich nicht zuletzt über spielräume öffnet und
mit der elaborierung des präfrontalen Kortex innerhalbder koevolutiven Herausbildung höherer Mind-reading-Fertigkeiten einhergeht, letztlich also auch an Life-His-tory-Pfade gekoppelt zu sein scheint. eine Manifestationdieses anders gearteten Innovationsraums, welcher nochauf der Logik kumulativer Kultur fußt, lässt sich vermut-lich im so oft beschriebenen Phänomen der ‘kulturellen
231 vgl. exemplarisch baroN-CoHeN 1995.232 vgl. dazu etwa CurrIe & raVeNsCroFt 2002; goLdMaN2006.233 vgl. exemplarisch baroN-CoHeN 1995 sowie CarrutHers& sMItH 1996 und botterILL & CarrutHers 1999.234 vgl. CurrIe & raVeNsCroFt 2002; aber auch goLdMaN2006.235 vgl. etwa gaLLese & goLdMaN 1998.236 vgl. grundlegend greeN et al. 2010.237 vgl. reser 2011.238 vgl. etwa baroN-CoHeN 2006a; baIrd et al. 2006; grIN-Ker 2007.239 vgl. etwa sPIKINs 2009.240 vgl. exemplarisch baroN-CoHeN & wHeeLwrIgHt 2004.241 vgl. etwa attwood 1998, 114; baroN-CoHeN 2006a;2006b; aber auch baroN-CoHeN & wHeeLwrIgHt 2004.242 vgl. sILaNI et al. 2007.
NeandertalerHomo neanderthalensis
moderner MenschHomo sapiens
Zerdehnung der Lebensgeschichte
stark sehr stark
global expansiv selektiv expansiv(Neokortex und Frontallappen
empathic bedding,begrenzte soziale Netzwerke,aggressiv, autistisch?
empathic bedding,extensives soziales„Netzwerken“
Evolutionäre Sozialstrategie
Hirnevolution
stark
Zerdehnung der Lebensgeschichte
Homo neanderthalensisNeandertaler
sehr stark
Zerdehnung der Lebensgeschichte
Homo sapiensmoderner Mensch
Hirnevolution
Evolutionäre Sozialstrategie
, autistisch?aggressivbegrenzte soziale Netzwerke,empathic bedding,
global expansiv
Hirnevolution
Evolutionäre Sozialstrategie
“Netzwerken„extensives sozialesempathic bedding,
(Neokortex und Frontallappenselektiv expansiv
schematische gegenüberstellung der wesentlichen Faktoren in denbereichen Life-History, Hirnentwicklung und sozialstrategie, dieeinen entscheidenden unterschied zwischen modernen Menschenund Neandertalern begründen. die ‘empathische Positionalität’ desMenschen, wie sie im text hergeleitet wird, muss als Funktion dieserdrei ‘evolutionären Pfadentwicklungen’ innerhalb der Hominide-nevolution gelten, die sich beim modernen Menschen radikalisierthaben. Insbesondere der bereich des sozialen und die betonungvon Netzwerken beim modernen Menschen haben archäologischerhebliche Kon sequenzen und münden nicht zuletzt in stilistischdiskreten Kommunikationsräumen, die durch spezifische Kunst-und schmuckelemente charakterisiert sind. diese räume sind miteiner ersten echten Herausbildung kollektiver Identitäten und ex-trasomatischer Informationsspeicherung verbunden.
76 shumon t. Hussain
Konservativität’ fassen. die materielle Kultur der Nean-dertaler erfährt über weite strecken ihres Verweilens aufdem eurasischen Festland kaum einschneidende Verände-rungen. Ihre kulturellen einheiten sind durch geringe Va-riabilität und ein insgesamt sehr homogenes gepräge ge-kennzeichnet. das verändert sich, wenn überhaupt, erst inder spätphase der eurasischen Neandertaler, also im Zeit-raum vor knapp 50 000 bis 60 000 Jahren.243 einzelnePhasen deuten immer wieder den innovativen Potenziali-tätsraum unserer Verwandten an, bevor wieder alte Verhal-tensmuster aufgenommen werden. es ist jedoch nicht aus-zuschließen, dass der artefaktbestand über wichtigeentwicklungen hinwegtäuscht. um 100 000 deutet sichim rheinland und in einigen NeandertalerfundstellenNordeuropas eine Klingenherstellung an. bei tönchesbergin der eifel wurden sogar mikrolithische artefakte gefun-den.244 beides zeigt, dass Neandertaler sehr wohl über dieMöglichkeiten verfügten, derartige artefakte herzustellen,die für spätere stadien des Jungpaläolithikums und für denmodernen Menschen typisch sind (natürlich ist zu be -denken, dass sich jungpaläolithische geräte unter techno-logischen gesichtspunkten immer noch deutlich von dentypologisch ähnlichen des Mittelpaläolithikums unter-scheiden). Kulturelle Faktoren, vielleicht auch pragmati-sche, scheinen dafür gesorgt zu haben, dass man stets aufbewährtes zurückgriff und kaum Neues wagte. Jedenfallsscheint in der architektur der Innovationsfähigkeit einwichtiger unterschied verortbar zu sein, der seinen aus-druck schon allein darin findet, dass Neandertaler nie indie welt der wir-Intentionalität mit all ihren materiellenbegleiterscheinungen übergingen.
das mag nicht zuletzt auch daran liegen, dass Nean-dertaler nie in einem sozialen raum lebten, der komplexekoordinative anforderungen stellte. wenn überhaupt,dann ist beim Neandertaler mit limitierten sozialen Net-zen zu rechnen. Fokus des Lebens war die eigene gruppeund deren Überleben. Nur wenn es unbedingt notwendigwar, nahm man das risiko auf sich, Kontakte mit Frem-den aufzunehmen. Konflikten sollte durch eine ausweich-strategie, die nicht auf Konfrontation ausgelegt war, be-gegnet werden. die Minimalstabilität der gruppen, dieschon trink aus und andere ermittelt haben, gebietet dieVermeidung jeglicher unnötiger risiken und energetischerKosten. evolutionär ergibt sich daraus die Verfestigunggeschlossener sozialsysteme, welche Permeabilität nurunter dem gesichtspunkt des überlebensnotwendigengenflusses kennen.
schon Lévi-strauss hat in seiner grundlegenden analyseder Verwandtschaftsstrukturen bei einfachen gesellschaftendeutlich gemacht, dass eine gewisse grundvariabilität im ge-netischen Pool sozialer einheiten immer gewährleistet seinmuss, damit diese vital und zeitresistent sind. Lévi-straussverweist auf den verbreiteten Frauentausch, indem er eine
Koordinationslösung dieser Problematik erblickt.245 es istäußerst erstaunlich, dass erst kürzlich beim Neandertalergenau für einen solchen Mechanismus genetische evidenzvorgelegt werden konnte. Lalueza-Fox et al. untersuchtendie gut erhaltenen Überreste von zwölf Neandertalern ausel sidrón im asturischen spanien auf deren mtdNa. In derschon seit geraumer Zeit bekannten Fundstelle verweisenarchäologische, paläontologische und geologische daten al-lesamt auf eine zeitgleiche ablagerung der Individuen, diewohl einer sozialen einheit angehörten. Nahezu alle skelet-treste weisen zudem disartikulations- und Modifikations-spuren auf. erstaunlicherweise offenbarte ein y-Chromoso-menabgleich zur bestimmung des geschlechts der toteneine maximale mtdNa-diversität bei den weiblichen Indi-viduen bei gleichzeitig minimaler mtdNa-diversität dermännlichen Individuen. Lalueza-Fox et al. legen dar, dassalle adulten Männer von der gleichen mtdNa-Lineage ab-stammen, wohingegen die adulten Frauen alle aus verschie-denen abstammungsverhältnissen kommen.246 dieser befund spricht sehr stark für meine ese, dass Neanderta-lergruppen sehr flache Verwandtschaftsgradienten aufwie-sen, sprich, dass alle Mitglieder einer gruppe nahe verwandtwaren; angewiesen auf andere gruppen war man vor allemdeshalb, weil dies den Zugriff auf Frauen ermöglichte. selbstwenn die zwölf Neandertaler aus el sidrón nur einen klei-neren ausschnitt einer sozialen einheit repräsentieren, zeigtsich doch, dass in erster Linie Neandertalerfrauen neue genein die gruppe einbrachten. Frauen, die aus anderen Verbän-den kamen. es ist insofern erstaunlich, dass in Neandertal-fundstellen nur selten exotische rohmaterialen oder objekteauftauchen. erstaunlich deshalb, weil es theoretisch sehrwahrscheinlich ist, dass der austausch von Frauen auch mitder Zirkulation von artefakten einherging. die Frauen wer-den wohl nicht nackt übergeben worden sein. Paraphernaliaeiner Mitgiftpraxis scheinen eine eher untergeordnete rollegespielt zu haben, oder diese Praktiken spielten sich in einemregionalen Kontext ab, wodurch die archäologische sicht-barkeit stark eingeschränkt wäre. Jedenfalls spricht auch dasfür ein Fehlen überregionaler Integrationssysteme, für einestrategie, die auf weitgehende soziale Isolation baut.
243 vgl. exemplarisch soressI 2004; aber auch LaNgLey et al.2008.244 vgl. CoNard 1992.245 vgl. grundlegend LéVI-strauss 1993.246 vgl. LaLueZa-Fox et al. 2011.247 vgl. CaNN et al. 1987; INgNaM et al. 2000; neuerdings auchHeNN et al. 2011; vor allem aber strINger 2002.248 vgl. exemplarisch CoNard & boLus 2003.249 vgl. etwa MeLLars 2006; grundlegend auch etwa KLeIN2008.
warum der Neandertaler anders ist 77
was geschah mit dem Neandertaler? es ist zwar nur schwerzu ermessen, wie viele Neandertaler zu diesem Zeitpunktnoch in eurasien lebten, aber letztlich kann die bevölke-rungsdichte – gemessen an der Zeit, in die moderne Men-schen weite Landstriche des Kontinents erschlossen – nichtbesonders hoch gewesen sein. der Neandertaler hatte sichzwar an die harschen und klimatisch wechselhaften bedin-gungen des pleistozänen europas hervorragend angepasst,seine bevölkerungszahlen aber eher konstant und stabil ge-halten, sodass moderne Menschen offene räume vorfanden,die weitgehend unbewohnt waren. diese Minimalstabilitätjener Neandertalergruppen sollte sich als großer Nachteil er-weisen. Jedenfalls lässt sich festhalten, dass die Hauptver-breitungsgebiete der Neandertaler sich bereits unmittelbarnach dem eintreffen des modernen Menschen in europaauf wenige refugiale räume, vornehmlich in südlichen Kli-maten, beschränkten. die vereinzelten und isolierten Nean-dertalergruppen scheinen nach und nach gen süden, wes-ten, osten und sogar gen Norden abgedrängt worden zusein. es bleibt zweifelhaft, ob dies ein aktiver Vorgang war.wahrscheinlicher ist, dass es sich um einen automatischen,dynamischen Prozess handelt, der von der sozialen aus-weichstrategie unserer Verwandten wohl beschleunigtwurde. gleichwohl etablieren sich zwischen 40 000 und30 000 bP Neandertalerrefugien auf der Krim, südlich deralpen im heutigen Italien, in spanien und sogar an den aus-läufern des altaimassivs.250 Insbesondere südlich der ebro-grenze scheinen sich noch bis 30 000 bP letzte Neandertaleraufgehalten zu haben. diese region blieb wohl verhältnis-mäßig lange von modernen Menschen unberührt. Nean-dertalerfundstellen finden sich dort beispielsweise in dergorham-Höhle und in Zafarraya an der südspitze der Ibe-rischen Halbinsel. die gorham-Höhle im heutigen Küsten-gebirge von gibraltar erbrachte ein sehr spätes Moustérien.die knapp hundert artefakte aus schicht IV konnten zwi-schen 33 000 und 24 000 bP 14C-datiert werden.251 selbstwenn dieses alter noch diskutiert wird, deutet sich an, dassNeandertalerrestpopulationen südlich des ebro vereinzeltzumindest bis etwa 30 000 bP überlebt haben könnten.252
doch auch in osteuropa öffnen sich einzelne Lichtungen,die von solchen restpopulationen besetzt wurden. auf derKrim und auch bei Vindija im heutigen Kroatien deutensich derartige refugien an. aus der Vindija-Höhle stammtdas bis dato jüngste skelett eines Neandertalers. die Über-reste datieren zwischen 33 000 und 32 000 bP.253 Neuer-dings gesellt sich zu diesen und anderen befunden einer, derviel weiter im Norden, nahe am fennoskandischen eisschildliegt. direkt am arktischen Kreis gelegen repräsentiert byzovaya die bisher nördlichste Präsenz des Neandertalers.slimak und sein team konnten zwar noch keine skelettiertenÜberreste entdecken, die eine Zuweisung der gefundenenInventare und Faunenreste zum Neandertaler zweifelsfrei be-legen würden, typotechnologische erwägungen machen das
warum der Neandertaler ausgestorben sein könnte
I don’t know about you, but my compassion for someone is not limited to my estimate of their intelligence.
dr. gillian taylor zu bob briggs.star trek IV, e Voyage Home
warum ist der Neandertaler ausgestorben? diese Frage beschäftigt die paläolithische Forschung schon seit Jahrzehn-ten. Ich maße mir nicht an, dieses Konundrum erschöpfendzu behandeln oder gar umfassend aufzulösen. Vielmehr gehtes darum die empathische Komponente, die in dieser Fragebisher wenig beachtung gefunden hat, etwas näher zu be-leuchten. wie andere vor mir, am prominentesten vermutlichgamble, glaube ich, dass wir unser augenmerk auf die so-zialisierung ganzer Landschaften richten müssen, die augen-scheinlich erst im späten Pleistozän mit dem auftreten desanatomisch modernen Menschen artikuliert wird. die dy-namiken sozialer raumnutzungsstrategien sind für die schlei-chende Zurückdrängung einzelner Populationen nicht zuunterschätzen. und genau das ist das szenario der umwäl-zungen am Übergang vom europäischen Mittel- zum Jung-paläolithikum. Heute ist davon auszugehen, dass Neander-taler und moderne Menschen in einigen regionen eurasiensnoch über viele Jahrtausende nebeneinander ihr dasein fris-teten, bevor erstere immer weiter an die Peripherie ihres Le-bensraums zurückgedrängt wurden, wo sie allmählich aus-starben. dieser Zeitraum erstreckt sich über mindestens10 000 Jahre, grob zwischen 45 000 und 30 000 bP. Proble-matisch in dieser Zeit sind nicht nur die häufig nicht feingenug auflösenden chronologischen Parameter, sondern auchdie attribuierung so mancher Inventare, die ohne menschli-che reste vergesellschaftet sind. Nichtsdestotrotz zeigt das ar-chäologische bild ein recht eindrückliches szenario. ModerneMenschen, die aus afrika oder asien kamen (das ist nichtganz klar, wobei die gründerpopulation, von der wir alle ab-stammen, sicher nach afrika zu verorten ist247), drangen ver-mutlich über den balkan nach Mitteleuropa vor, wobei siesich an großen Flussläufen orientierten. der donaukorridorwar dabei die vermutlich wichtigste einwanderungsschneiseins Herz eurasiens.248 die träger der Kulturkomplexe desinitialen aurignaciens ebenso wie des Protoaurignaciens (wel-ches sich offensichtlich über die mediterrane route ausbrei-tete) fassten auf dem Kontinent nach und nach Fuß und ex-pandierten rasch nach west- und osteuropa.249
250 vgl. exemplarisch seraNgeLI & boLus 2008.251 vgl. FINLaysoN et al. 2006.252 vgl. ZILHão & PettItt 2006 und bLoCKLey et al. 2008.253 vgl. HIgHaM et al. 2006.
aber mehr als wahrscheinlich. die intakte Fundschicht inbyzovaya konnte mit einer Kombination aus osL (opti-cally stimulated Luminescence) und 14C-Methode sicherauf ein alter zwischen 31 000 und 35 000 calbP datiert wer-den.254 gepaart mit den Neandertalernachweisen in teshiktash und okladnikov nahe dem altaigebirge belegen dieseentdeckungen, dass späte Neandertaler wohl viel weiternach osten ausgewichen sind als bisher angenommen.255
Vermutlich stets auf der suche nach unbewohnten refugi-alräumen. Insgesamt kann von einem bild räumlicher – unddamit auch sozialer – Fragmentierung gesprochen werden.
es entsteht der eindruck, dass der Neandertaler gleicheinem ‘Juggernaut’ von nach Mitteleuropa eindringendensapienten hinweggefegt wurde und sich an den ränderneurasiens wiederfand.256 Natürlich wird dieses szenario denohne Zweifel komplexen Vorgängen am wendepunkt dereurasischen geschichte, am Übergang zum Jungpaläolithi-kum kaum gerecht. dennoch hat es einen heuristischenwert. es illustriert nicht nur die Fragmentierung des Le-bensraums, sondern ebenso die Fragmentierung der sozialenKontakträume der Neandertaler. einzelne ohnehin isolierteeinheiten wurden endgültig getrennt und in refugialhabi-tate zersplittert. ermöglicht wurde diese disartikulation
78 shumon t. Hussain
trotz allem aufeinander angewiesener gruppen durch dasNicht-Vorhandensein starker sozialer bindungskräfte zwi-schen ihnen. Mit dem eintreffen konkurrierender gruppenzerfielen die sozialen einheiten der Neandertaler ganz vonallein in autonome und zerstreute gebilde. als lose Ver-bände im raum waren sie den überregionale Netzwerke aus-differenzierenden Menschen aus afrika nicht gewachsen.Mit der ausbildung sozialer Landschaften, in den jede so-ziale einheit moderner Menschen eingelassen war, unddamit gegenüber Krisen und gefahren besser gewappnet,verschob sich das Konkurrenzlevel fundamental. Neander-talergruppen konkurrierten nicht mehr mit ihresgleichenoder vergleichbaren gruppen, sondern sahen sich sozialeneinheiten gegenüber, die gleichzeitig das gesamte austau-schnetz repräsentierten. auf diese weise kooperierendegruppen haben gegenüber weitgehend auf sich allein ge-stellt operierenden Verbänden einen ganz entscheidendenVorteil, und zwar selbst dann, wenn letztere bereits überviele Jahrtausende in den betroffenen Habitaten leben undsich adaptiv darauf einstellen konnten. der Neandertalerscheint sich auf die Intensivierung des adaptiven drucks in-nerhalb so kurzer Zeit nicht hat einstellen können. es gelangihm vermutlich erst, als es bereits zu spät war, seine Popula-
schwarze Flächen – rückzugsräume später Neandertaler: a diskutierter rückzugsraum letzter Neandertaler in südiberien, insbesonderein gibraltar; b refugialraum später Neandertaler auf der Krim; c mögliche ausweichräume des Neandertaler am arktischen Kreis (dis-kutiert wird insbesondere die Fundstelle von byzovaya).schraffierte Fläche – ausbreitungstendenz moderner Menschen im frühsten Jungpaläolithikum.
Zersplitterung der kulturellen sphäre der Neandertaler in europa nach der einwanderung des modernen Menschen im Zuge von „outof africa“. die vergleichsweise losen und ohnehin nicht besonders stark vernetzten sozialgruppen werden durch das auftreten des ana-tomisch modernen Menschen isoliert und sukzessive in gunst- und refugialräume zurückgedrängt.
tionen zu weit über eurasien verteilt waren und nur noch inwenigen regionen viable soziale räume konstituieren konn-ten, sprich solche, in denen zumindest ein genfluss mit an-deren gruppen gewährleistet war. weitgehend isolierte Po-pulationen starben langsam aus, weil sie den erforderlichendemographischen ausgleich nicht erfuhren. wurden zu vieleFrauen geboren, verschärfte sich das subsistenzproblem, wur-den zu viele Männer geboren, verschärfte sich das reproduk-tionsproblem. ganz zu schweigen von den Nebenwirkungenintensiver Inzucht. es scheint so, als ob der ‘Juggernaut’ mo-derner Menschen das ohnehin zerbrechliche sozialgefüge ir-reversibel zerstörte und die über Jahrtausende eingependel-ten, instabilen Mechanismen zur regulation sozialerbeziehungen zwischen gruppen destabilisierte.257 damitwar der schleichende untergang des Neandertalers besiegelt.Jener hielt sich noch wenige Jahrtausende verzweifelt in denletzten verbliebenen biokulturellen Nischen, bevor er spätes-tens vor 28 000 Jahren für immer vom antlitz der erde ver-schwand. trinkaus spricht in diesem Zusammenhang voneinem „schleichenden tod“, einer langsamen assimilierungvon fragmentierten Neandertalerpopulationen, was sich auchim osteologischen befund festmachen lässt.258
dem anatomisch modernen Menschen kommt bei seinereinnistung in europa zudem das besondere Naturraumpo-tenzial des Kontinents zugute. Klar ist, dass jener die proso-ziale anlage, jene empathische Positionalität, die als dispo-sition zur ausbildung überregionaler Netze des sozialenaustauschs zu tage tritt, bereits mit sich führte, als er diePforten europas durchschritt. dort hat diese anlage jedochgünstige bedingungen vorgefunden. erst das biogeographi-sche Milieu des Kontinents ermöglichte eine volle entfaltungjener sozialstrategie, welche durch eine koevolutive Heraus-bildung sozialer Kognition fundiert wird. schon diamondhat klugerweise darauf hingewiesen, dass europa durch eineverhältnismäßig weiche Habitatdifferenzierung mit flachenKlimagradienten geprägt ist, insbesondere aber, und das istentscheidend, durch einschlägige Verkehrsachsen vorstruk-turiert ist.259 diese achsen werden von großen Flusssystemengespeist, die sich beinahe über den ganzen Kontinent erstre-cken. Zumindest das rhein-rhône-grabensystem und dasdonautal bilden wichtige Nord-süd- und ost-west-achsen,die eine Zirkulation von gegenständen erleichtern. dass ge-wässer häufig eine wichtige rolle innerhalb von austau-schnetzen spielen, ist aus dem kulturanthropologischen ar-chiv der erde gut bekannt.260 europa verfügt über einegünstige Infrastruktur für weitreichende beziehungen ent-lang dieser kardinalen Naturachsen. wie ich zuvor schondeutlich gemacht habe, umspannen die jungpaläolithischenZirkulationsräume genau jene regionen.
es kann festgehalten werden, dass zumindest von der in-direkten selektion jener sozialen strategie gesprochen wer-den muss, die auf einer offenen, permeablen struktur derreziprozität fußt. einer reziprozität, welche in der gestalt-
warum der Neandertaler anders ist 79
logik sozialer Interaktionen auf der Mikroebene bereits an-gelegt ist. Jene Prosozialität kulminiert beim modernenMenschen in der empathischen Positionalität, welche alsevolutionäres Produkt einer positiven selektion komplexerempathiefertigkeit und sozialkognition verstanden werdenkann. das empathische substrat sozialer organisation istder schlüssel zum Verständnis der schwellendynamiken zwi-schen 50 000 und 30 000 bP. die gestalt des austauschs istals wichtiger Faktor in der anthropogenese anzusehen. am-brose hat vorgeschlagen, die innovativen erscheinungen imafrikanischen Msa, sprich die Herausbildung von Howie-son’s Poort und still bay um 76 000 bP mit einer Zäsur imsozialen distributionssystem zu erklären. Nach ambrose sinddiese Komplexe als reaktion auf eine Krise zu verstehen, dievon der gewaltigen toba-eruption auf sumatra ausgelöstworden sein soll. diese resultierte in einem genetischen Fla-schenhals, welcher die selektion von Verhaltensmerkmalengefördert haben könnte, die den austausch von knappenressourcen begünstigt haben.261 erst vor kurzem ist der In-novationsschub um Howieson’s Poort und still bay an derKüste afrikas von Henshilwood und dubreuil mit dereinzig artigen präfrontalen exekutivfunktion des modernenmenschlichen gehirns in Verbindung gebracht worden.262
es geht nicht darum zu betonen, dass eine spezifische ar-chitektur der sozialkognition in einer bestimmten Morpho-logie von austauschnetzen resultiert, sondern eher darumzu unterstreichen, dass beide Momente zirkulär gekoppeltsind. empathie führt zu prosozialem Verhalten à la transre-gionaler distributionsstruktur genauso wie diese das empa-thische fördert und unterfüttert. auch Horan et al. betonen,dass subsidiäre Parameter allein das aussterben der letztenNeandertaler oder auch nur deren Zurückdrängung wohlkaum erklären können. wenn jedoch bestimmte distribu-tionsfähigkeiten mit einbezogen werden und mit ihnen dieMöglichkeit, ressourcen schneller und besser zu mobilisie-ren, dann wird die anpassungs- und Inklusivfitnessdistanzzwischen Neandertalern und modernen Menschen schoneher ersichtlich.263 all dies ist ein deutlicher Hinweis aufeine dieser erscheinung vorauslaufende Präadaptation in dersphäre des Kognitiven, welche für diesen unterschied ver-antwortlich gemacht werden kann.
254 vgl. sLIMaK et al. 2011.255 vgl. Krause et al. 2007.256 vgl. gaMbLe 1987, 95f.257 vgl. etwa CHase 1994.258 vgl. trINKaus 2007.259 vgl. dIaMoNd 2009.260 vgl. grundlegend Lee & daLy 1999; aber auch INgoLd2000, 192f.; vor allem aber bHaNu 1992.261 vgl. aMbrose 1998.262 vgl. HeNsHILwood & dubreuIL 2011.263 vgl. HoraN et al. 2005.
80 shumon t. Hussain
II.1 eMPatHy, aggressIoN aNd grouP or-gaNIZatIoN
In the second part of the present work, I attempt to outlinethe basic differences in empathic capacities that, in my view,differentiate Neanderthals and modern humans. e firstchapter is devoted to the question of what component ofempathy-related behaviour is visible in the material recordof our relatives. e most obvious remnant of an empathiccomponent of Neanderthal social systems manifests itself ina range of securely documented burials. Not only does themere presence of intentional depositions of the deceasedspeak in favour of an intense emotional bond between differ-ent group members, but the often high age of these individ-uals points to a situation in which elderly group memberswere cared for beyond simple functional reasoning ratherthan simply abandoned. is rationale invokes an emotion-ally strong link which is most plausibly explainable by basicempathic relationships in which emotion is fostered throughreciprocity. ese kinds of burial can therefore be interpretedas a result of empathic bedding. obviously, Neanderthalsstand in the phylogenetic footsteps of our common primateancestor and thus share developed but basal mind-readingand other-conceptualizing abilities. I argue that these capac-ities were potentially the same as our own, but couldn’t beevolutionarily elaborated because of the constraining powerof a social strategy which did not allow for massive inter-group networking. Neanderthals likely solved inter-groupcoordination problems by means of social aggression, result-ing in a profound set of injury-induced skeletons and signsof ritualized cannibalism-analogous behaviour. It is wellknown from cultural anthropology that these practices oftenserve as means of negotiating inter-group relations and con-flicts. In sum, this leads to an isolating social strategy withlittle inter-group exchange and a fragmentation of socialgroups.
II.2 autIsM, soCIaL FragMeNtatIoN aNdPosItIVe seLeCtIoN
e chapter posits a relationship between the fragmentationof Neanderthal social units, autistic dispositions possiblypresent in our relatives and the fact that their empathic ca-pacities differed markedly from ours. a social isolation strat-egy is followed by individuals who are thrown back to them-
selves and their kin. It seems likely that these individuals re-strict their focus of interest not only in the social world, butin a more general behavioural manner.
e recent decoding of the Neanderthal genome has re-vealed several genes within this branch of the human lineagewhich are altered more strongly than in the average modernhuman. In modern humans, these gene variants (CadPs2,auts2) are traditionally linked to autistic spectrum dys-function. Current work in the field of evolutionary geneticsand biology, however, emphasizes the important adaptivevalue of some forms of autism – not only due to their con-tribution to overall group fitness, but most importantly be-cause of their utility to scenarios in which the self-containingacquisition of nutrients and proteins was the prime directiverather than social cooperation. other environmental con-texts are also possible in which weak autism could be adap-tive within the Neanderthal ecocultural niche. Indication ofgenetic traits implying some form of weak autism need notconstitute a dysfunction, but rather a genetic expression offundamentally different ways of social interaction. Most im-portantly, autism in modern humans is in most cases asso-ciated with a strong impairment of mind-reading abilitiesand emotional understanding of others.
In this sense, these findings do not show that Nean-derthals were autists, but rather that they might have had acompletely different social structure than modern humans;a social space in which precise tools of social epistemologyweren’t of such importance. e lack of transregional ex-change systems coupled with an inter-group coordinationstrategy guided by aggression and isolation constitute an en-vironment in which the identified gene variants are explain-able without invoking malfunction. e spatial reaction ofNeanderthal groups after the penetration of europe by mod-ern humans supports this view: populations were frag-mented and pushed back to the periphery of europe’s fur-thest extremes and refugial zones without maintainingcontact. e most parsimonious interpretation is that theweak connection between Neanderthal regional groupscould easily and naturally be interrupted by incoming mod-ern man. e remaining Neanderthals must have retreatedback into peripheral, marginal or refugial zones where theywere doomed to become extinct – not least because theirpopulations were no longer viable in their fragmented na-ture. In this light, the arrival of modern humans in europeis reconstructable as a positive selection of higher empathiccapacities and their correlating social strategies.
suMMary Part II wHy NeaNdertHaLs are dIFFereNt
81
III.1 KuNst, ÄstHetIK uNd eMPatHIsCHeVerFasstHeIt
der empathische aspekt ästhetischer erfahrung
Yes, I think that most of us are attracted by beauty and repelled by ugliness. One of the last of our prejudices.
Kirk zu Marvick.star trek tos, „Is ere in truth No beauty ?“
Hängen Ästhetik und empathie zusammen? und wenn ja,wie genau? dies sind die Kernfragen, die im rahmen einer‘evolutionären anthropologie der empathie’ gestellt wer-den müssen. wer sich zum Menschsein und seinen Impli-kationen äußert, muss in irgendeiner Form zu dessenKunstschaffen stellung beziehen. dies gilt umso mehr, dainsbesondere die archäologischen und paläoanthropologi-schen wissenschaften immer wieder den Versuch unter-nommen haben, die Kunstgenese mit der anthropogenesezu korrelieren.264 Implizit schwingt in der debatte um dassine qua non des modernen Menschen immer die Hypo-these des Homo artisticus mit. was aber ist Kunst? Virulentund zwingend aktuell ist diese Frage auch nach über einemJahrhundert intensiver begriffsdebatte noch. und zwarschon allein deshalb, weil der begriff sich wissenschaftsge-schichtlich im Kontext der europäischen aufklärung kon-stituiert hat und ehemals dazu dienen sollte, allein die hö-heren Künste auszuzeichnen. Neben seinem inhärenteneurozentrismus trägt der Kunstbegriff im anschluss an re-naissance und Klassizismus die normative Hypothek einerÜberhebung der Kulturleistung der europäischen antikemit sich. das ist und kann nicht gemeint sein. wenn hiervon Kunst die rede ist (und die rede war), ist stets ein de-skriptives Moment künstlerischen schaffens gemeint, wel-ches prinzipiell kultur- und zeitübergreifende gültigkeitbeansprucht. auch wenn ich nicht auf die teils sehr elabo-riert und kontrovers geführte debatte und das „wesen derKunst“ einzugehen vermag, so soll doch kurz auf die Legi-timität der Verwendung des Kunstbegriffs in prähistori-schen, insbesondere in paläolithischen Kontexten einge-gangen werden. Kritik erfahren hat das sprechen überKunst in nichtwestlichen und vorindustriellen sozialitätenvor allem aus dem kulturanthropologischen Lager, welchesin den letzten Jahren zusehends auf einer partikularisti-schen Position beharrt. der besonderheit jeweils in denblick genommener Kulturen kann, so die grundlegendeauffassung, nur durch eine hinreichende adäquanz der be-griffe und Konzepte rechnung getragen werden. Konkret
heisst das, dass auf die historisch aufgeladene terminologieder westlichen welt weitgehend verzichtet werden sollteund stattdessen stärker auf die begriffe der jeweiligen Kul-turen rekurriert werden muss. etwas zugespitzt lässt sichdiese Position in etwa so auf den Punkt bringen: warumsollten wir das gleiche meinen wie andere Kulturen, wennwir über Kunst sprechen? Insbesondere dann, wenn dieseKulturen gar kein Konzept von Kunst besitzen? wenn esKunst in einer gesellschaft gibt (und nur dann ist es ge-rechtfertigt, von Kunst zu sprechen), dann müssen also zumindest einige Individuen in dieser gesellschaft einKonzept von Kunst haben. alles andere scheint lediglichdie Projektion unserer eigenen Konzepte zu sein. das istjedoch eine übersimplifizierende ese. McIver Lopeskonnte letztlich überzeugend darlegen, dass ein solcherKunstbegriff zu stark ist.265 wie ist dann der Übergangvon kunstfreien zu kunsttragenden sozietäten zu denken?Kann ein Individuum ohne Kunstkonzept also keinekünstlerischen gegenstände hervorbringen? McIver Lopesunterstreicht, dass das nicht notwendigerweise der Fall seinmuss. Ihm gelingt der überzeugende Nachweis, dass Kunstnicht intendierte Kunst sein muss. artefakte können Kunstqua unfall oder Zufall sein. ein artefakt birgt daherimmer schon die Möglichkeit künstlerischer und ästheti-scher Qualitäten, und es spielt letztlich keinerlei rolle, obdiese intentionell oder kontingenterweise realisiert werden.das zeigt, dass der Kunstbegriff schwächer sein muss. Fer-ner öffnet er sich einer anwendung in nahezu allen sozio-kulturellen Milieus. genau in einem solchen, schwachenund ausschließlich deskriptiven sinne ist der begriff ge-meint, wenn er im Verweis auf altsteinzeitliche oder allge-mein auf prähistorische gesellschaften gebraucht wird. sogesehen ist das also zunächst relativ unproblematisch.
Interessanter ist die rolle der Ästhetik. Kunst scheintphänomenologisch durch ein spezifisches Hervortreten,durch ein besonderes sich-Zeigen bestimmt zu sein. Kunstist durch die evokation ästhetischer erfahrung ausgezeich-net. es ist nicht zuletzt die ästhetische Qualität künstleri-scher Manifestationen, die diese gegenstände prima facie alsKunstwerke legitimiert. wer die Natur des Kunstschaffensevolutionär verstehen will, muss also nach den wurzeln,oder zumindest nach den ursächlichen Faktoren der ästhe-tischen erfahrung suchen. eine erfahrung, die universell ist.an dieser stelle kommt das Moment der empathie ins spiel.
teIL IIIwas es MIt KuNst uNd ÄstHetIK auF sICH Hat
264 vgl. exemplarisch MeLLars 1996; MItHeN 1996; aber auchsHIPMaN 2008.265 MCIVer LoPes 2007.
82 shumon t. Hussain
Ich glaube, dass genau jenes Moment ein solcher Faktor ist.Ästhetische erfahrung geht zwar nicht in empathisierungauf, letztere ist jedoch eine notwendige Perzeptionsbedin-gung angelegter ästhetischer Qualitäten. die Hypothese, dieich an dieser stelle verteidigen möchte, ist also, dass Kunstnur über ästhetische erfahrung hinreichend beschriebenwerden kann und empathie ein entscheidender aspekt die-ser erfahrung ist. es gilt also, das Verhältnis von empathieund Ästhetik zu erhellen. der gedanke ist jedenfalls nichtneu. bereits gegen ende des neunzehnten Jahrhunderts istempathie in der deutschen Ästhetikdebatte immer wiederthematisiert worden. Vischer war nach den empiristenHume, burke, smith und Herder, der erste, welcher ausge-hend von einer inneren Nachahmung der gefühle undHandlungen anderer die wichtigkeit der empathie auch fürästhetische belange herausstellte.266 Mit dem begriff dereinfühlung versuchte er, die körperlichen reaktionen auf somanche künstlerische schöpfung einzufangen. Nach Vischerevozieren bestimmte Formen bestimmte emotionale reak-tionen, und zwar wenn sie eine gleichförmigkeit mit derarchitektur und der Funktion des menschlichen Körpersaufweisen. Vischers grundidee wurde in den folgenden Jah-ren vor allem von wölfflin, aber auch von berenson aufge-griffen und weiterentwickelt.267 Nicht zuletzt warburg ver-trat eine anknüpfende Position. warburg war davonüberzeugt, dass die sichtbaren Formen der bewegung einesfigürlichen Kunstwerks auf die ‘inneren emotionen’ dieserFigur verweisen. der ästhetische genuss stellt sich erst dannein, wenn diese erschlossen und erfahren werden.268 derwohl bedeutendste Vertreter einer empathischen eorie derÄsthetik ist jedoch Lipps.269 dessen an der schwelle zumzwanzigsten Jahrhundert entwickelter ansatz stellt die ein-fühlung ins Zentrum jedes ästhetischen erkennens. FürLipps ist die ästhetische erfahrung gerade dadurch ausge-zeichnet, dass der betrachter sich in das Ästhetische einerentität hineinfühlt, sich dessen realität geradezu empa-thisch erschließt.270 die mit dem gegenstand (dieser istnicht immer materiell) verbundene Ästhetik muss erst frei-gelegt werden. dies ist nach Lipps nur mit einem empathi-
schen blick möglich. die ästhetische Qualität wird regel-recht nachempfunden, und zwar indem Form und gestalt,aber auch implizit angelegte regungen und gefühle nach-vollzogen werden. erst durch empathisierung kann dasKunstwerk zu authentischer emotionalität führen. erst imeinssein von betrachter und betrachtetem kann sich dessenästhetische Qualität entfalten.271
Ästhetische erfahrung geht so mit der belebung des un-belebten, wenn man so will mit der ‘beseelung’ von entitä-ten, einher.272 unattraktiv ist diese Position keinesfalls. sievermag unter anderem plausibel zu machen, warum jede äs-thetische erfahrung zwar von den angelegten und implizier-ten Merkmalen eines objekts abhängt, dennoch starken in-dividuellen schwankungen unterliegt. unterschiedlicheIndividuen machen unterschiedliche ästhetische erfahrun-gen. begründet liegt das in der Natur der empathisierung.Jene entität, die quasibelebt wird, wird gleichzeitig zumin-dest mit einem teil der betrachterpersönlichkeit aufgeladen.der empath findet sich im Kunstwerk wie in einem spiegelwieder.273 Ästhetik entfaltet sich über einem durch die Ver-weisstruktur des Kunstwerks, durch dessen Merkmale im-plizierten Möglichkeitsraum, der mit individuellen assozia-tionen angereichert wird. besonders intensiv, sei es nunemotional oder kontemplativ, ist ästhetische erfahrung vorallem deshalb, weil sie etwas authentisch mit uns teilt. etwas,was uns sonst verschlossen geblieben wäre. es ist jener Mo-ment, der empathie involviert. Jedenfalls erweitert Lippsden ausgangspunkt Vischers erheblich, der noch davon aus-ging, ästhetische erfahrung bestehe in der schlichten Pro-jektion des selbst in das objekt der schönheit.274 empathieist wesentlich mehr. Nicht nur einfache Projektion, sondernauch ein erkennen von außerindividuellem. die empathi-sche Positionalität des Menschen ist an dieser stelle, wennman so will, in ihrer totalität gedacht. sie beschränkt sicheben nicht nur auf soziales erkennen, sondern ist jeglicheserkennen. Ich werde diesen Punkt später noch einmal auf-greifen. Leider sind diese ansätze bis heute ohne nennens-werte wirkkraft geblieben und mussten mehr und mehr ko-gnitiven Zugängen zum Ästhetischen weichen. trotzdem istdie ematik nie ganz von der bildfläche verschwunden. ei-nige wenige autoren, die sich trotzdem auf einen vorkogni-tiven ansatz konzentriert haben, sind beispielsweise Mer-leau-Ponty und rosand.275
es gibt sicher vieles, das für einen empathischen Mo-ment in der ästhetischen erfahrung und damit auch in derwahrnehmung von Kunst spricht. ein starkes argument istjedoch ohne Zweifel, dass die empathiefähigkeit eines In-dividuums sehr stark vom empathisierten objekt abhängt.empathie gelingt nicht immer, wobei diese aussage nichtganz korrekt ist. da empathie ein erfolgsbegriff ist, kanndort, wo ein erkennen nicht gelingt, nicht von empathiegesprochen werden.276 Jedenfalls ist empathie sehr stark voneiner sensibilisierung für bestimmte gegenstandsbereiche
266 vgl. VIsCHer 1873.267 vgl. wÖLFFLIN 1886 und bereNsoN 1896.268 vgl. warburg 1999.269 vgl. LIPPs 1903.270 vgl. LIPPs 1900.271 LIPPs 1900, 415f.272 LIPPs 1900, 416.273 LIPPs 1900, 416f.274 vgl. dazu JaHoda 2005, 154.275 vgl. MerLeau-PoNty 1945 und rosaNd 2002.276 vgl. dazu HarroLd 2000.
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 83
abhängig, ebenso wie von der persönlichen einstellung hin-sichtlich dieser. Nicht jeder ist zu empathie mit eidechsen,Katzen oder wellensittichen imstande. das eröffnet eine ein-schlägige analogie. Nicht jeder hat demnach bei jedemKunstwerk gleichsam automatisch eine ästhetische erfah-rung. geschweige denn eine gleicher Intensität und Quali-tät. Vielmehr verhält es sich so, dass manche Kunst sich einerästhetischen erfahrung entzieht. das ist jener bereich, dergeschmack genannt wird. eine empathische erklärung ver-mag diesem sachverhalt mehr als nur gerecht zu werden.
der spiegelmechanismus als ästhetischer Mittler?
Compassion. at’s the one thing no machine ever had.Maybe it’s the one thing that keeps men ahead of them.
Care to debate that, Spock ?
McCoy zu spock.star trek tos, „e ultimate Computer“
auch wenn die Humanwissenschaften in den letzten Jahr-zehnten kaum etwas bedeutendes zum ema „empathieund Ästhetik“ beigetragen haben, hat sich eine völlig andere,überraschende Perspektive eröffnet. dieser Zulauf für em-pathische eorien ästhetischer erfahrung kommt aus demLager der Neurowissenschaften. genauer gesagt aus jenerjungen teildisziplin, die sich programmatisch Neuro ästhetiknennt. grob gesprochen versucht die Neuroästhetik, dieneuronalen grundlagen ästhetischer erfahrung zu erhellen.Mit der analyse der neuronalen Korrelate, die bei der be-trachtung ästhetischer gegenstände aktiviert werden, soll(das ist zumindest die Hoffnung) etwas über die Natur die-ser erfahrung beim Menschen gelernt werden. eine wichtigerolle spielt dabei die Freilegung der Mechanismen des ‘vi-suellen gehirns’.277 was passiert im gehirn, wenn Men-schen visuellen stimuli ästhetischer Qualität ausgesetzt sind?es sollte klar sein, dass mit den Methoden der Neuroästhetiknicht der anspruch erhoben werden kann, das wesen desschönen, das der Kunst oder das der ästhetischen erfahrungzu ergründen. Neuroästhetik ist nicht die aufhebung odergar die Überwindung der Kunstwissenschaften. Nichtsdes-totrotz vermag die Herauspräparierung der Vorgänge im vi-suellen gehirn dazu beitragen, ein umfassenderes Verständ-nis dieser Phänomene zu erlangen. Interessant für die hierdiskutierten belange ist vor allem die rolle der Motorneu-ronen innerhalb ästhetischer wahrnehmungsprozesse. daheute mehr oder weniger klar ist, dass Perzeption ein aktivesMoment beinhaltet, und keinesfalls das passive descart’scheaufnehmen von äußeren stimuli ist, überrascht es nicht wei-ter, dass das auch bei der betrachtung ästhetischer objektenicht anders ist. ausgehend von Freedbergs arbeiten zur äs-thetischen Kraft der empathischen reaktion auf Kunst, sind
einige vielversprechende ansätze inspiriert worden, welchedie ese vom empathischen in der Ästhetik beflügeln.278
erst kürzlich konnten Freedberg und gallese zeigen, welchePerspektiven sich aus einer Verbindung von empathisch ka-nalisierten emotionen und vormentaler simulation für dasVerständnis von ästhetischen erfahrungen ergeben.279 auchdiese betonen, dass eine wesentliche Komponente solchererfahrungen gerade darin besteht, die im bild oder objektrepräsentierten emotionen empathisch zu verstehen oder,sehr viel wichtiger, mit einer art innerer Nachahmung diebeobachteten aktionen anderer in bildern oder skulpturennachzuvollziehen.
offensichtlich kann oft konstatiert werden, dass ebengenau jene Körperbereiche einer physischen reaktion aus-gesetzt sind, die auch im bild betroffen sind, d. h. beispiels-weise Ziel von bedrohung, gewalt, berührung oder auchZärtlichkeit sind. Insofern führen künstlerische Manifesta-tionen auch dann zu körperlichen auswirkungen, wenn kei-nerlei emotionale Komponente direkt involviert ist. diesebeobachtungen eröffnen eine kritische Verbindung. Neuro-nal können für diese reaktionen bestimmte Motorneuro-nen, nämlich die schon an anderer stelle erwähnten spie-gelneuronen verantwortlich gemacht werden. es muss nichtnochmals erwähnt werden, dass diese Neuronen ebenfallseine zentrale rolle im Funktionsmechanismus der empathiespielen. diese sind auch dann aktiviert, wenn sich ein Indi-viduum mit Kunst konfrontiert sieht und körperlich ange-sprochen wird. spiegelneurone stehen für eine vorreflexiveImitationskomponente, die immer dann auf den Plant tritt,wenn versucht wird, aus visuellen stimuli sinn zu filtern,oder anders gesagt, diese zu verstehen. offensichtlich, unddas ist beeindruckend, sind diese nicht nur dann aktiv, wennetwas real Vorhandenes oder zumindest offensichtlich an-gelegtes im bild oder in der Plastik verstanden und damitnachgeahmt werden soll, sondern auch wenn es darum geht,indirekt Impliziertes und angedeutetes zu erschließen odergar die bewegungen vor augen zu führen, die in der ent-stehung des Kunstwerks von bedeutung waren. selbst diebetrachtung statischer bilder, die Handlungen abbilden,evoziert die simulation jener Handlungen im gehirn desbeobachters.280 bereits die beobachtung eines verfügbarengegenstands führt zu einer simulation der motorischenakte, die dieses objekt anbietet. In gewisser weise wird sogrob der Möglichkeitsraum zur Manipulation abgesteckt.spiegelneurone feuern jedenfalls auch dann, wenn eineHandlung nicht abgeschlossen wird. sollte eine beobachtete
277 vgl. grundlegend ZeKI 1999.278 vgl. dazu Freedberg 1989.279 vgl. grundlegend Freedberg & gaLLese 2007.280 vgl. exemplarisch urgesI et al. 2006 und JoHNsoN-Freyet al. 2003.
84 shumon t. Hussain
Handlung abgebrochen werden, so wird der implizierte fi-nale Handlungsvollzug trotzdem simuliert.281 Insgesamt istes mehr als nur sehr wahrscheinlich, dass der neuronale Me-chanismus einer motorischen simulation, gepaart mit jeneremotionalen resonanz, welche sie hervorruft, ein wichtigeraspekt des ästhetischen Zugangs zu entitäten ist. auch un-belebte und unbewegte (nicht einmal implizit bewegte) bil-der wie etwa stillleben werden so nach Lipps’scher Manierlebendig. Ferner konnten unterschiedliche studien aufzei-gen, dass die Machart eines Kunstwerks eine rolle in dessenerleben spielt.282 Knoblich et al. etwa gelang der Nachweis,dass die betrachtung eines statischen grafik-Zeichens eineMotorsimulation eben jener gestik hervorruft, die notwen-dig ist, um es zu produzieren.283
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Neuronalstruktur äs-thetischer erfahrungen sich analog zur der empathischer er-fahrungen verhält. eine solche Korrelation ist zwar nochkein eindeutiger Nachweis eines auch kausalen Zusammen-fallens, muss jedoch zweifelsfrei als starker Hinweis für dieKoppelung von empathie und ästhetischem erleben gelten.Internalisierte Motorsimulation, welche die in Kunst ange-legten Intentionen und emotionen verständlich macht, re-sultiert in jener erfahrungsqualität, die für das Ästhetischekennzeichnend ist. der empathische Zugang zu ästhetischenobjekten erst ist das qualifizierende Moment, welches dieseästhetisch auszeichnet. dieser Zusammenhang ist wesent-lich. erst mit dem empathischen eröffnet sich der wahr-nehmungsraum des Ästhetischen.
der animismus als destillat holistischer empathieerfahrung
Sometimes we must allow the surroundings to flow over us. Todwell on each separate part. How it feels.
To allow it to fill you.
Krieger/adonis zu troi.
star trek tNg, „Loud as a whisper“
allein schon die Kennzeichnung moderner Menschen an-hand empathischer Positionalität legt letztlich nahe, empa-thie als ein grundlegendes Paradigma der menschlichen exis-tenz zu begreifen. Höhere empathiebegabung geht mit einerverschärften sensibilisierung für umgebendes, für die diffe-renz zum selbst einher. damit wird ein raum geöffnet, derdie Möglichkeit empathisch mediierter relationen bereit-stellt. Jene Potenzialität durchbricht die grenzen der Ähn-lichkeit und erweitert ihren eigenen wirkungsbereich na-turgemäß verhältnismäßig schnell. empathie enthebt sichselbst aus einer ausschließlichkeit als Moment ausschließlichvon Mensch-Mensch-relationen und erhebt sich zur wich-tigen Komponente jeglicher relationalität. die empathischePositionalität des Menschen überprägt und überformt das
Verhältnis vom Menschen und seiner welt. und zwar nachder eigengesetzlichkeit wechselseitiger, vor allem emotiona-ler rückkopplungseffekte. wie am beispiel ästhetischer er-fahrung deutlich geworden ist, ist jene disposition empa-thischen Vermögens als ‘globalisierung der empathie’ zuumschreiben. dem empathischen Zugang bleiben keinerleitore mehr verschlossen. des Menschen empathische Posi-tionalität impliziert so einen in seiner Potenzialität globalenempathischen weltzugang. es gibt praktisch keinen gegen-standsbereich mehr, der sich einer empathisierung entzieht.einfach deshalb, weil empathie sich gleichwohl selbst dieeigene Voraussetzung schafft, und zwar durch empathischebelebung und beseelung. es klingt zwar paradox, aber em-pathie ist vor allem dadurch gekennzeichnet, den menschli-chen weltzugang nahezu vollständig zu durchdringen, ohnedabei jegliche soziokulturelle Vorkonzeptualisierung derwelt zu benötigen. es verhält sich vielmehr genau umge-kehrt. empathie in ihrer totalität fordert bestimmte welt-konzeptualisierung ein. der anlage zur „beseelung“ vonunbelebtem, wie sie vor allem für die ästhetische erfahrungkennzeichnend ist, kommt hier eine schlüsselstellung zu.daraus leitet sich, so meine Hypothese, unmittelbar ab, dassan die globalisierung des empathischen die umfassende be-seelung der Natur gebunden ist. der archetyp empathischertotalität findet sich im Animismus, welcher die welt als be-lebt, beseelt und von einer wirkkraft des Lebendigen durch-zogen denkt. animistische weltkonzepte durch ziehen dasextramenschliche mit Intentionalität. sie schreiben der welteine sinnhaftigkeit zu, die sich aus deren akteurhaftigkeitunmittelbar ergibt und umgekehrt. weltbilder in animisti-scher tradition sind gleichsam als Versuch zu verstehen, em-pathie als solche, d. h. ganzheitlich und damit umfassend zubegreifen. es ist gleichzeitig die geburtsstunde semiotischerwelten, ja, der welt im engeren sinne. ohne eine empathi-sche grunderfahrung, welche die seinssphäre des Menschendurchdringt, kann es keine welt geben, insofern welt alssinnzusammenhang immer schon transzendent auf etwasJenseitiges verweist, in dessen struktur ‘verstehen’ überhaupterst möglich wird. empathie ist so sprungbrett zum versteh-baren Jenseitigen.
es kann festgehalten werden, dass der moderne Mensch,sofern er sich wesentlich dadurch auszeichnet, dass er im ga-damer’schen sinne welt im gegensatz zu umwelt hat, unddaher immer schon in ein weltlichen dasein eingelassen ist,nur dort wirklich Mensch ist, wo seine wahrnehmung em-pathisch geformt ist. Möglicherweise zeichnen sich unserewahrnehmungsprozesse ganz allgemein dadurch aus, dass
281 vgl. etwa uMILtà et al. 2001.282 vgl. etwa HarI et al. 1998; LoNgCaMP et al. 2005; aber auchLoNgCaMP et al. 2006.283 vgl. KNobLICH et al. 2002.
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 85
sie empathisch verfasst sind, und somit in sinnformationeneingelassen sind, die ego in einen sich selbst transzendieren-den gesamtzusammenhang stellen. wenn relationalitätdurch empathie gestiftet wird, dann ist diese relationalitätstets empathisch. es ist wichtig zu unterstreichen, dass dieFrage nach dem Zuerst von empathisierung oder sozialisie-rung der Frage nach dem Zuerst von Henne oder ei gleicht.wohl eher ist beides wechselseitig gekoppelt. empathie istnotwendige bedingung für nichtmenschliche soziale bezie-hungen, genau wie diese notwendige bedingung für empa-thie sind. auch wenn tylor animismus noch aus einer eu-rozentristischen Perspektive als epistemisch fehlerhafteinstufte und damit normativ diskreditierte, ist dies keines-falls trivial.284 bird-david etwa betont, dass die starke Viel-falt sozialer Konzepte im Kulturvergleich auffällt.285 was je-weils als soziale Person, sozialer akteur usw. klassifiziert wird,unterscheidet sich frappierend. Prämoderne und prähistori-sche sozietäten zeichnen sich in der regel durch eine sub-stantivistische Konzeptualisierung der welt aus. die abtren-nung von dingen und Personen (geschweige denn vonIndividuen) ist ontologisch noch nicht vollzogen. Jäger undsammler sind nach bird-david durch eine relationale epis-temologie ausgezeichnet, die relationalität in den Mittel-punkt jeder Positionalität stellt. diese sozialen einheiten di-chotomisieren nicht (hierarchisch oder normativ) zwischenMenschen und anderen Lebewesen, da sie sich als ebenso indie welt eingelassen begreifen wie diese.286
es ist daher nicht ganz korrekt davon auszugehen, dass,wie tylor noch meinte, auch Nicht-Menschliches a priori alsPerson konzeptualisiert wird. erst die Lebensform, die kon-kreten und ökologisch spezifischen erfahrungen dieser Men-schen münden in einem Verständnis von eingelassenheit.erst dadurch entfaltet sich das Paradigma der relationalitätqua relation. aus der Perspektive einer totalen relationalitätwird die bedeutung einer empathischen Positionalität er-sichtlich. Jene erst stiftet die orientierungsinstanz einer sol-chen seinsweise. Festzuhalten ist letztlich, dass auch kultu-ralistische Positionen darin übereinstimmen, dass Menscheneine tendenz dazu haben, die welt um sie herum als durchund durch lebendig zu begreifen. Übereinstimmend mit derhier vertretenen Position konstatiert auch bird-david, dass
Menschen aufgrund ihres sozialen Kognitionsbiases stetsdazu neigen, andere objekte und Lebewesen als „beseelt“zu verstehen, und zwar nicht vor einer Konfrontation, son-dern auf eine Konfrontation folgend.287 empathie ist damiteine strategie, mit welteingelassenheit umzugehen. Insofernist das durchaus konsistent mit jüngeren eorien.
guthrie etwa beschreibt das belebende Moment des un-belebten – das für ihn zentral für jedwede animistische glau-benspraxis ist – als eine evolutionäre Fitnessmaximierungs-strategie. Finden sich Lebewesen (so auch Menschen) inszenarien der gefahr und unsicherheit wieder, ist es für siesinnvoll, jedweder auch nur indirekten spur des Lebendigendiese Lebendigkeit auch tatsächlich zuzuschreiben. die weltwimmelt dann zwar nur noch so von intentionellen akteu-ren, aber das hochsensibilisierte abtasten nach diesen ak-teuren ist überlebensfördernder als das Ignorieren jener sti-muli.288 wenn ein Mensch das rascheln eines busches alspotenzielle gefahr deutet, also einen intentionellen akteurinferiert, und folglich davonrennt, wird er im Zweifelsfalleher überleben als jemand, der das nicht tut. Hinter dembusch könnte sich ja tatsächlich ein Löwe verbergen. auchwenn die akteurssetzung also nicht immer epistemisch zu-trifft, so sind die Kosten bei Nichtsetzung doch deutlichhöher. In unserem beispiel würde das Individuum schlichtden tod finden. Nach guthrie und anderen erklärt alleindieser sachverhalt, warum eine solche strategie positiv se-lektioniert worden ist.289 beides schließt sich keinesfalls aus,sondern hat sich vermutlich vielmehr wechselseitig verstärkt.dass eine empathische Komponente nicht schlicht wegdis-kutiert werden kann, zeigt sich schon allein daran, dass dasvon guthrie und anderen entwickelte Modell nur unter derVoraussetzung von unsicherheit Plausibilität erfährt. dieMehrzahl der situationen, in denen animistisches Vokabularbenutzt wird und in denen auf animistische Konzepte zu-rückgegriffen wird, lässt ein solches Moment aber vermissen.Nämlich genau dann, wenn Menschen sich sehr stark mitetwas verbunden fühlen oder etwas sehr nahe stehen. sze-narien, in denen unsicherheit einfach kaum eine rollespielt.290 warum sich holistische empathieerfahrung letzt-lich evolutionär behaupten konnte, ist also eine Frage, diesich monokausal kaum beantworten lässt. es ist anzuneh-men, dass es sich um ein hochkomplexes, koevolutionäresMosaikszenario handelt.
In jedem Fall aber sollte die bedeutung von empathiein der anthropogenese deutlich geworden sein. eng an dieevolutionäre elaborierung des empathischen Vermögens istein holistisches weltbild gekoppelt. ein weltbild, wie es fürnahezu alle noch lebenden Jäger und sammler charakteris-tisch ist. empathie stimuliert die semiotisierung der Land-schaft, in der nicht nur die existenz gefristet wird, sondernin der sich das Individuum eingelassen und zugehörig fühlt.es findet sich in einer welt wieder, die durch und durchemotionale signifikanz hat. Landschaften können in der
284 vgl. grundlegend tyLor 1958.285 vgl. bIrd-daVId 1999.286 vgl. etwa bIrd-daVId 1992.287 vgl. bIrd-daVId 1999, 78.288 vgl. gutHrIe 1980; vor allem jedoch gutHrIe 1993.289 Neuerdings wird diese Position unter dem eorielabel eines„Hyper-agency-detection-device“ (Hadd-eorie) geführt.Menschen verfügen demnach über den atavismus einer übersen-siblen Mustererkennung: vgl. roCHat et al. 1997; boyer 2001;atraN 2002; zusammenfassend barrett 2007.290 vgl. bIrd-daVId 1999, 71.
86 shumon t. Hussain
Folge emotiv verstanden werden, sie werden zu bedeutsamenresonanzkörpern. die sozialen einheiten von Jägern undsammlern verfügen noch über jene totale sensibilität für dievon ihnen bewohnte Landschaft, die aus ihrer Lebensweiserührt und in verschiedenen geschichtlichen Milieus unter-schiedlich kulturell überprägt worden ist. empathie in ihrertotalitären weltzugangsform braucht, wie schon breithauptzutreffend herausgestellt hat, ab einem gewissen Punkt einkulturelles regulativ.291 Limitierungen, die lebensformadä-quat orientierung stiften. In zusehends unpersönlichen so-zietäten ist daher nicht zu erwarten, dass die empathischedisponiertheit des Menschen seiner starken Formatierungzu entfliehen vermag.
was können wir aus diesen Überlegungen lernen? welche Implikationen hat das für eine Modellierung derevolution des empathischen Vermögens? bereits bei der Ver-folgung der anderen evidenzlinien wurde zusehends ersicht-lich, dass sich zumindest an der schwelle vom Mittel- zumJungpaläolithikum in europa eine einschneidende transfor-mation der sozialen Landschaft vollzieht. es handelt sich aber
um weit mehr als das. Lewis-williams folgend, möchte ichdie Hypothese stark machen, nicht nur soziale einschnittein diesen Zeitraum zu verorten, sondern auch solche, die dieglaubenspraxis unserer ahnen betreffen.292 es ist die ro-mantik der eiszeit. ein Zeitraum, in der semiotisierung undempathisierung der Landschaft nicht nur zur Verarbeitungder beseelten welt in Kunst und Musik, sondern auch zueiner ganz anderen raumwahrnehmung führt, die ihren Hö-hepunkt in der künstlerischen ausgestaltung und Hervorhe-bung besonderer orte, insbesondere von Höhlen findet.diese bedeutsamen orte tragen fortan die Motive einerdurch und durch animistischen Vorstellungswelt, die ganzeikonographische ensembles der diese Menschen umgeben-den tierwelt abbilden.293 diese bilder, so wird später nochdeutlich werden, sind keinesfalls rein arbiträr in den Höhlen
intra-gruppenspezifisch
„empathic bedding“
soziale Fürsorge„seeing in“ Empathisierung
von Gestalt
soziale Akteure
Empathie natürlicheEntitäten
„beseelte“ Landschaft
Objekte
Empathie als Gabe
Wand-
und F
elsku
nst s
owie
Konze
ptuali
sierun
g der
Weltausgedehnte soziale Netzwerke
(mobile Kunst, Individualschmuck)
inter-gruppenspezifisch
gruppenspezifischintra-
soziale Fürsorge
„empathic bedding“ “seeing in„ von GestaltEmpathisierung
Akteure
gruppenspezifischinter-
(mobile Kunst, Individualschmuck)
ausgedehnte soziale Netzwerke
(mobile Kunst, Individualschmuck)
soziale
ausgedehnte soziale Netzwerke
Empathie
ausgedehnte soziale Netzwerke
(mobile Kunst, Individualschmuck)
ausgedehnte soziale Netzwerke
ausgedehnte soziale Netzwerke
(mobile Kunst, Individualschmuck)
Entitäten
elt
and-
und F
elsku
nst s
owie
Konze
ptuali
sierun
g der
W
and-
und F
elsku
nst s
owie
and-
und F
elsku
nst s
owie
and-
und F
elsku
nst s
owie
Konze
ptuali
sierun
g der
W
and-
und F
elsku
nst s
owie
elt
and-
und F
elsku
nst s
owie
Konze
ptuali
sierun
g der
Welt
Wand-
und F
elsku
nst s
owie
natürlicheEntitäten
Landschaft“beseelte„
natürliche
Objekte
(mobile Kunst, Individualschmuck)
ausgedehnte soziale Netzwerke
ausgedehnte soziale Netzwerke
(mobile Kunst, Individualschmuck)
Empathie als Gabe
Konze
ptuali
sierun
g der
W
and-
und F
elsku
nst s
owie
Konze
ptuali
sierun
g der
W
WKon
zeptu
alisie
rung d
er W
Wand-
und F
elsku
nst s
owie
Konze
ptuali
sierun
g der
W
Empathie als Gabe
die ‘empathische Positionalität’ des modernen Menschen geht mit einem globalisierten empathischen weltzugang einher – evolutionär sollder Prozess, der zu einem solchen weltzugang geführt hat, ‘globalisierung des empathischen Vermögens’ genannt sein. Im Verlauf diesesProzesses wird das empathische vom unmittelbaren Problemlösungszusammenhang seiner genese entkoppelt. empathie mediiert nichtmehr nur noch den umgang mit entitäten in der sozialen sphäre, sondern greift auf andere Lebensbereiche über: soziale akteure, unbelebteobjekte und natürliche Landschaftselemente erfahren eine empathisierung (die Kategorie sozialer akteure schließt hier auch als soziale ak-teure verstandene tiere nicht grundsätzlich aus). Im bereich des sozialen ist es vor allem die soziale Fürsorge, in der sich das empathischespiegelt, wohingegen sich im gabentausch und seinem Motiv der ‘empathie als gabe’ bereits der Übergang in die objektsphäre vollzieht.empathie mit der natürlichen Landschaft entfaltet sich über eine belebung der umwelt im animistischen Lebensvollzug, der bedeutungs-aufladung bestimmter Landschaftsformationen auf der basis ihrer natürlichen Charakteristiken und nicht zuletzt über eine Konzeptualisierungder welt, die in bestimmten regionen in der jungpaläolithischen Fels- und Höhlenkunsttradition ihren Niederschlag findet.
291 vgl. breItHauPt 2009, 7ff.292 vgl. exemplarisch LewIs-wILLIaMs & dowsoN 1988;LewIs-wILLIaMs 2002; 2004; 2009.293 vgl. gutHrIe 2005.
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 87
das tal der Côa ist eine bemerkenswerte jungpaläolithische Fundlandschaft mit einer Vielzahl gravierter Felsvorsprünge. sie sind einProdukt der geologischen geschichte des Flusstals, während derer sich die gesteinsmatrix aufgeschoben und dann senkrecht aufgestellthat. ab dem gravéttien hat der pleistozäne Mensch dieses naturräumliche szenario offenbar systematisch mit bildwerken dekoriert unddamit ‘inszeniert’. die gravurfelder von Foz Côa sind teil einer umfangreichen Felsbildlandschaft unter freiem Himmel, die charakte-ristisch und distinkt vor allem für den westlichen teil der Iberischen Halbinsel ist. sie dokumentiert den beginn der sozialisation desraums durch den Menschen, der die semiotisierung der Landschaft quasi-architektonisch markiert und damit bedeutungstragende orteschafft. eine solche ‘bebauung’ des Naturraums markiert den Übergang zu echten kulturellen räumen, die charakteristisch für diestellung des modernen Menschen in der welt sind. oben: blick auf die atemberaubende Landschaftsformation um das Côa-tal im nördlichen Portugal. (Foto: José Paulo ruas, mit freund-licher genehmigung)unten: beispiel eines gravierten Felsvorsprungs in Foz Côa, der den mächtigen Flusslauf flankiert. (Foto: João romba, mit freundlichergenehmigung)
88 shumon t. Hussain
des westfranzösischen und nordspanischen raums platziertworden, sondern sind indexikalisch gemeint, stehen also mitdem Charakter, mit den eigenheiten einer jeden Höhle inVerbindung.294 es ist jenes Moment, in dem die empathischeKomponente verschärft zutage tritt. Jene empathisierung derspätpleistozänen Landschaft geht mit deren Ästhetisierungeinher. erstmals in der langen geschichte des Menschensehen sich gruppen dazu motiviert, ihr ökologisches Milieuin einer Form zu manipulieren, die nicht unmittelbar ineinem Kalkül des Überlebens aufgeht. dort liegen die wur-zeln der aktiven raumgestaltung verborgen. es liegt auf derHand, dass dieser Impetus ebenfalls mit dem Moment derkulturellen Identitätsbildung, den wir etwa zeitgleich beob-achten können, in Verbindung steht. semiotik schafft einenIdentitätsraum. Ferner ermöglicht die Landschaft durch ihrePermanenz einen fixen bezugspunkt und ermöglicht Vergan-genheitsbezug, ein kritisches element jedweder traditions-bildung.
wie aber ist das Verhältnis von empathie und der frü-hen Höhlenkunst konkret zu denken? Ist eine derart starkeese wirklich gerechtfertigt? Ich werde mich im letzten Ka-pitel dieser Frage stellen und die künstlerischen Äußerungenmoderner Menschen in einem Zeitfenster zwischen 30 000und 15 000 bP genauer beleuchten. es liegt auf der Hand,dass eine solche exploration vorläufig und exemplarisch blei-ben muss. trotzdem können einige wichtige einsichten frei-gelegt werden.
III.2 NarratIoN, MytHoLogIe uNd ZeIt
die künstlerische Hervorhebung von Vorhandenem
To become a thing is to know a thing. To assume its form ... is to begin to understand its existence.
weiblicher wechselbalg zu odo.star trek ds9, „e search, Part II”
warum sind in unterschiedlichen Höhlen zu unterschiedli-chen Zeiten in unterschiedlichen regionen häufig ganz un-terschiedliche bildkonstellationen festztstellen? es handeltsich um eine Variabilität, die sicher auch stilistische und kul-turelle ursachen hat, welche aber auch andere, natürlicheregründe zu haben scheint. solche, die stärker auf allgemeineVeranlagungen des Menschen, insbesondere auf dessen spe-zifische Interaktion mit der umwelt rekurrieren. es ist diebesondere erkenntnisstruktur des modernen Menschen, diedabei von enormer bedeutung ist. In einem Milieu stetigerKonfrontation sowie intensivem Mit- und Nebeneinadermit den großen tieren der eiszeit, die sowohl Überleben alsauch gefahr bedeuten konnten, ist eine animistische Vor-stellungswelt nicht unbedingt überraschend. Für die pleis-
tozänen Jäger und sammler vieler regionen war es überle-benswichtig, ihr gegenüber richtig einzuschätzen. ob essich dabei um einen Menschen, einen Herbivoren odereinen Karnivoren handelt, spielt dabei nur eine untergeord-nete rolle. auch guthrie verweist auf den sachverhalt, dassJäger und sammler, die stark auf das erbeuten von großwildangewiesen sind, sehr geübt darin sind, dessen emotionenzu lesen, um das Verhalten der großen tiere besser vorher-sagen zu können.295 das kann in der auseinandersetzungmit der großfauna ein kritischer Überlebensfaktor sein. em-pathie war immer auch schon in der Verbundenheit zwi-schen Mensch und tier angelegt.
was sagt uns diese einsicht über die wurzeln der pa-läolithischen Kunst? Jedenfalls mehr als auf den ersten blickeinsichtig ist. Meine Hypothese ist nämlich, dass zumindestdie jungpaläolithische Höhlenkunst ein derivat der ästhe-tischen erfahrung ist, die auf einer besonderen Form desempathischen erkennens beruht. und zwar auf einer Formdes wieder-erkennens. dieses wieder-erkennen ist abernicht etwa eine spielart des erinnerns, sondern eine der em-pathischen erfahrung. ebenso wie mit empathie die welterfasst und als beseelt erkannt wird, können bereits be-kannte Formen des Lebens im unbelebten Fels (wieder-)er-kannt werden. diese erkenntnisleistung ist eine empathi-sche, weil der akteur sich in die gestalt des unbelebtenhineinfühlen muss. es ist indes nicht nur die gestalt, dieentscheidend ist. die gesamte Kulisse ist ausschlaggebend.Nicht zuletzt gerüche, geräusche und Lichtverhältnissekonstituieren ein emotionales Milieu, welches dazu veran-lasst, die gesamtsituation empathisch zu erfassen und unterdiesem Horizont visuelle stimuli zu deuten. Jeder ort istanders und deshalb einer jeweils eigenen empathisierungs-logik unterworfen. Menschen, die Höhlen betreten, habenoft das gefühl, sich in einer anderen welt wiederzufinden.das ist der empathische effekt. Harmlose geräusche wer-den als spuren der anwesenheit unbekannter verstanden,schatten als anzeichen von gefahr gedeutet. das sind nureinige wenige beispiele, doch sie vermögen plausibel zu ma-chen, dass es kein weiter schritt ist, die Höhle selbst als le-bendig zu begreifen. Mit der Höhle in ein empathischesVerhältnis zu treten bedeutet, deren natürliche Merkmaleals Zeichen des Lebendigen zu begreifen. Jener Moment,so meine ese, verbirgt eine wichtige triebkraft zur Ma-nipulation der Höhlenwände. eine Motivation, welche be-reits in der beschaffenheit dieser wände und der Höhle alsganzem angelegt ist, aber erst durch einen empathischenZugang erschlossen werden kann.
294 vgl. etwa bosINsKI 2009, 36ff.295 vgl. gutHrIe 2005, 227.
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 89
die jungpaläolithische Höhlenkunst Franko-Kantabriens besticht durch ihre eingebundenheit in die natürlichen Formen und Konturender Höhlenformationen, in denen sie vorkommt. Man gewinnt den eindruck, dass bestimmte wahrnehmungsszenarien sogar als kon-stitutiv für die anbringung eines ganz bestimmten Motivs an dieser stelle gelten können. oben: ausschnitt aus dem bildfeld des riesenhirschs in Cougnac. das tier schließt in seinem rumpf zwei stein böcke unterschiedlicherstilistik, aber vor allem eine anthropomorphe darstellung vom typ ‘verwundeter Mann’ ein. bemerkenswert ist die begrenzung desMotivs durch den sintervorhang am rechten bildrand und die Nutzung der Felskante als natürliche Konturlinie für den Halsbereich.(Foto: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)unten: Vollständig an der natürlichen Felskante ‘aufgehängte’ bisonzeichnung aus ekain. der konstitutive Charakter der Felsformation,das erkennen des tieres in der Form schon vor der Motiv anbringung, wird umso deutlicher, wenn man sich vor augen führt, dass dierückenlinie offensichtlich als definitorisches Moment betrachtet wurde: darstellungen sind oft um diese herum organisiert und wirkendeshalb ‘aufgehängt’ oder sind sogar nur auf die rückenlinie reduziert. (Foto: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Mu-seum)
90 shumon t. Hussain
das besondere Verhältnis von Mensch und Höhle spiegelt sich in den sog. Masken, die vor allem in Nordostspanien und dem Pyrenä-envorland auftreten. es handelt sich um natürliche Felsformationen, die an Köpfe oder gesichter erinnern und vom pleistozänen Men-schen mit wenigen strichen in solche überführt wurden. das ohnehin schon im Fels angelegte und erkennbare wurde auf diese weisehervorgehoben, sichtbar und signifikant gemacht. bei den meisten ‘Masken’ handelt es sich um schematische Fratzen von Menschen.oben und unten: Zwei ‘Masken’ aus den tiefen von altamira, dem sog. Cola de Caballo. (Fotos: Heinrich wendel, © wendel Collection,Neanderthal Museum)
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 91
blick auf das berühmte bildfeld der zwei gepunkteten Pferde aus Pech Merle. die tiere sind verhältnismäßig plastisch dargestellt, derKopf ist etwa flächig vom rest des Körpers abgehoben. Hinzu kommt die anreicherung des rumpfs mit schwarzen und roten Punkten;letztere diffundieren durch die bauchlinie nach unten. beide tiere werden von schwarzen Handnegativen flankiert. bemerkenswert istauch hier die einpassung des reduzierten Kopfes in den Felsvorsprung rechts, der ebenfalls an einen Pferdekopf erinnert. (Foto: Heinrichwendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)
Jungpaläolithische Höhlenkunst findet sich von den west-lichsten ausläufern europas bis an die grenzen des urals,und im Norden sogar bis nach großbritannien.296 auch inanderen teilen der welt sind Höhlenbilder aus dem Pleis-tozän nachgewiesen. wie ist es also um Hinweise auf eineempathische genese dieser werke bestellt? schon im auri-gnacien fällt bei der seltenen Parietalkunst auf, dass diedarstellungen sich inhaltlich oft sehr stark an den Kontu-ren und der Morphologie der Höhlenwände orientieren.die für das aurignacien der dordogne typischen Vulven-gravuren sind den natürlich vorgefundenen spuren im Felsnachempfunden. anders formuliert: die schöpfer jenerbildwerke erkannten im Höhlenkörper eine ihnen be-kannte sowie bedeutsame Form, die dann künstlerisch her-vorgehoben wurde. die Jäger und sammler jener epochewaren einem ästhetischen stimulus ausgesetzt, der sie dazumotivierte, kreativ tätig zu werden. und zwar, in dem sieeine empathische Verbindung mit der oberflächenkonturjener Felsvorsprünge und Höhlen eingingen. besondersdeutlich wird das im französischen La Ferrassie, wo nicht
nur die dreieckigen Vulven in den Fels eingraviert wurden,sondern auch die schon in der struktur dieser wände an-gelegten Konturen der zugehörigen Individuen. Mit woll-heim möchte ich dieses Formerkennen in ambivalentenVerweisungszusammenhängen (die wand verweist theore-tisch auf sehr vieles, man kann vieles in ihr erkennen) see-ing-in nennen.297 seeing-in meint das Zuweisen von Mus-tern, das erkennen von entitäten in strukturen, die mitdiesen entitäten a priori nichts zu tun haben, d. h. wederinhaltlich noch logisch mit ihnen verknüpft sind. empa-thie ist die regulative Idee eines solchen seeing-in. Insbe-sondere das Moment der Perspektivübernahme ist dabeikritisch. Im unbelebten substrat wird gleichwohl jene Per-spektive ausselektiert und empathisch zugänglich gemacht,die aus dem jeweiligen soziokulturellen Horizont her zu-gänglich ist. Hier spielt wohl jeweils die Lebensform des
296 vgl. sCeLINsKIJ & sIroKoV 1999 und baHN & PettItt 2009.297 vgl. woLLHeIM 1998.
92 shumon t. Hussain
die bilderhöhle von Les Fieux im Quercy beherbergt eines der bedeutendsten bildwerke der jungpaläolithischen wandkunst, wenn esum die rolle ‘impliziter Formen’ geht. der abgebildete gravierte steinbock ist mehr das werk natürlicher Prozesse als anthropogenereinflussnahme. Menschen haben die Ähnlichkeit der Felsformation lediglich erkannt und für ihre Zwecke inszeniert, indem sie die feh-lenden Linien summarisch ergänzten. oben: Zeichnerische rekonstruktion der Felswand mit dem steinbock, die gleich die doppelte einfassung von Formen durch die natür-liche Kontur erkennen lässt; zum einen eine Mammutdarstellung, die nur minimal explizit gemacht wurde, zum anderen das steinbock-motiv, das im rumpfbereich durch die Höhlenmorphologie eingefasst wird. unten: bild des steinbocks aus Les Fieux, das zeigt, dass außer der einbettung der gravur in den Höhlenkörper auch die rolle der Licht-kulisse bei der ‘gestaltannahme’ der darstellung eine nicht unerhebliche rolle spielt.(aus: LorbLaNCHet 2007, Fig. 7 und 2010, 316. Zeichnung und Foto: Michel Lorblanchet, mit freundlicher genehmigung)
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 93
die Halbreliefs der abrilandschaft des südwestlichen Frankreichs gehören zu den bedeutendsten erzeugnissen jungpaläolithischer ‘Künst-ler’. sie dokumentieren nicht nur ein bestreben nach Plastizität, Lebendigkeit und Naturalismus, sondern zeigen auch die intime Verbindung von Mensch und Höhle durch den akt des gravierens. so springen die Formen geradezu aus dem Höhlenkörper hervor,müssen jedoch zuerst herauspräpariert, sowie von der Höhle selbst freigegeben werden. oben: bisondarstellungen im Halbrelief aus Furneau-du-diable. stilistik und archäologischer Kontext sprechen für eine einordnungder Halbplastiken ins solutréen. (Foto: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)unten: ausschnitt des Pferdefrieses aus Cap blanc. die Pferde sind im Halbrelief gefertigt und nehmen einen erheblichen teil der abriwand ein. (Foto: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)
94 shumon t. Hussain
Menschen eine entscheidende rolle, wie er sich in der weltsituiert und was ihn beschäftigt, allgemein, was dessen seinjeweils auszeichnet. die empathisierung des raums tritt je-denfalls immer wieder zutage. die gravuren, Malereien,Zeichnungen und ritzungen der frankokantabrischen Höh-len sind nicht zuletzt durch das einbeziehen hervorstehenderund prominenter Felselemente gekennzeichnet, die (wennauch entfremdet) isomorph zu bestimmten tierischen Merk-malen wie Kopf, rückenpartie, beine oder augen sind. dieseÄhnlichkeitsrelation ist eine notwendige bedingung für dieempathisierung und belebung dieser unbelebten bereicheund deren einpassung in ein animistisches deutungsmuster.
das bekannteste beispiel dafür ist sicherlich das Pferde-duett aus Pech-Merle. die beiden Pferde stehen perspekti-visch hintereinander, sind einander abgewandt und von etlichen Punkten und Handnegativen umgeben. entschei-dend ist aber, dass der Kopf des rechten Pferdes miniaturisiertin den an dieser stelle an einen tierischen Kopf erinnerndenFelsvorsprung eingepasst ist.298 diese natürliche gestaltscheint bei den paläolithischen Menschen eine seeing-in-er-fahrung evoziert zu haben. die gesteinsformation erschienihnen lebendig, und zwar als hippoid. Ähnliches kann in LesFieux beobachtet werden, wo ein magdalénienzeitlichersteinbock auf einer amorphen auswölbung der Höhlenwandangebracht ist, in welcher morphologisch bereits die beiden
Hinterbeine angelegt sind.299 Les Fieux wartet noch miteinem anderen vergleichbaren Fall auf. der zentrale ge-steinsblock in der Höhle ähnelt in seiner oberflächenstrukturund Morphologie stark zwei nebeneinander herlaufendenMammuts (möglicherweise sogar Mutter und Nachwuchs).es ist unter der empathischen Perspektive nicht besonderserstaunlich, dass genau dieser bereich mit Mammutzeich-nungen, Konturen sowie sonstigen Zeichen ausgefülltwurde.300 auch dort orientiert sich die Motivik inhaltlich anden Vorgaben der natürlichen beschaffenheit der Höhlen-formation. die abbildungen spiegeln den Charakter des ge-steins. Insgesamt ist vor allem bei den plastischen elementender Höhlenkunst, sprich bei gravuren und ritzungen eineeinschlägige einheit mit dem natürlichen substrat der Höh-len zu konstatieren.301 es erscheint geradezu als wären dieheute zu bewundernden Formen direkt aus dem Fels freige-legt worden, wo sie bis dato ‘schlummerten’. das ist das Mo-ment der Hervorhebung von bereits Vorhandenem, d. h. des-sen künstlerische Verarbeitung.
ersichtlich wird diese Verknüpfung nicht zuletzt in denHalbreliefs von Comarque und Cap blanc in Frankreich. dieplastische ausarbeitung eines Pferdekopfes aus Comarque inder dordogne ist der natürlichen Linienführung des träger-mediums nachempfunden.302 ebenso verhält es sich bei demknapp acht Meter langen skulptierten Pferdefries aus Cap
die Lehmmodellierungen aus tuc d’audoubert zählen zu den wenigen aus jungpaläolithischen Höhlen bekannten bildwerken dieserart. die plastischen bisonskulpturen sind sorgfältig aus Höhlenlehm geformt worden, markieren aber nur den Höhepunkt aller tätig-keiten in tuc d’audoubert rund um die Manipulation der natürlichen Höhlensubstanz. es lassen sich etwa ‘Halbfabrikate’ von Model-lierungen und das ‘bewerfen’ der Höhlenwand mit Lehm dokumentieren. das spricht dafür, dass es sich bei der Manipulation des Höhlenlehms, ähnlich wie dem Freilegen von Halbreliefs aus der Felswand, um einen intimen akt handelt, der das Verhältnis von Menschund Höhle betrifft und dieses aushandelt. (aus: otte 2006, Fig. 36)
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 95
blanc.303 Magdalénien und solutréen warten gleichwohl miteiner brigade derartiger Kunstschöpfungen auf. auch in roc-aux-sorciers ist das Inein anderstehen von Kunstform undNaturform gut zu erkennen. dort finden sich zudem an dieaurignacienzeitlichen gravuren erinnernde darstellungenweiblicher Formen, die den ehemaligen betrachtern nahezuaus dem Fels gesprungen zu sein scheinen.304 ein empathi-sches erleben der Natur und deren eigenheiten kann in vie-len Fällen als überzeugende erklärung für die Position undden Inhalt einer darstellung angeführt werden. Zeugnisdafür legen auch die einzigartigen bisonvollplastiken von tucd’audoubert ab, die ebenfalls ins Magdalénien zu verortensind. dort wird geradezu transparent, wie die paläolithischenKünstler sich in das lebendige und formbare Material ein-fühlten, um die treffende, in ihm bereits angelegte Form zugewinnen. die vollständig modellierten bisondarstellungenbefinden sich am ende des Höhlenkomplexes und sinddurch deren exponierte Position gekennzeichnet, die nichtzufällig gewählt ist.305
Für einen empathischen ursprung vieler darstellungenspricht ferner der teils übertriebene detailgrad. guthrie zeigtletztlich überzeugend, dass viele der zoomorphen darstellun-gen vor allem deshalb so naturalistisch wirken, weil die klei-nen, aber feinen unterschiede zutage treten, d. h. bestimmteHaltungen und emotionale Zustände der tiere abgebildetwerden. die bilder zeugen von einer ungemeinen Kenntnisder tierwelt, welche nicht nur auf präzise beobachtungsgabe,sondern auch auf ein empathisches Verstehen zurückgeht.306
die meisten Motivationsfaktoren können nur erahnt werden,da wir heute weder genau nachvollziehen können, welcheneinfluss die besonderen Lichtverhältnisse in einzelnen Höh-len für die wahl der Position und Motive wirklich spielten,noch zu ermessen ist, welche heute durch taphonomie undVerwitterung verlorenen bestandteile der eiszeitlichen Fels-oberflächen eine wichtige rolle gespielt haben und warum.Übrig bleibt lediglich der befund eines einschlägigen Zusam-menhangs der gestalt der Höhle und der gestalt der Höh-lenkunst. Jene Verknüpfung ist am überzeugendsten mit em-pathie zu erklären.
Narrative einbettung als empathiesymptom
You’ve not experienced Shakespeare until you read him in the original Klingon.
gorkon zu spock.star trek VI, e undiscovered Country
Höhere empathie benötigt Narrativierung. erst durch eineerzählerische einbettung können die Lücken des Nicht-wis-sens geschlossen werden, der empathisierungsgegenstand ineinen sinnhaften Zusammenhang gestellt werden. Mit breit-haupt kann festgehalten werden, dass jene elaborierteren For-men der empathie, jene, die auf ein umfassendes Verständnisdes anderen zielen, von narrativer einbettung leben.307
wenn Narrativierung mit bestimmten Formen von empa-thie einhergeht, dann sind Hinweise auf narrative elementein der paläolithischen Höhlenkunst als Indikatoren für denempathischen aspekt dieser erscheinung zu verstehen. Nar-rative einbettung avanciert so zum empathiesymptom. wel-che narrativen elemente lassen sich im bildgefüge der euro-päischen Höhlenkunst finden? Ich möchte die esevertreten, dass schon allein in der bildkomposition so man-cher Höhlen eine erzählerische Vernetzung einzelner Motivezu erkennen ist, dass Narration in vielen Fällen sogar ein kon-stitutiver Faktor für die anordnung und wahl der Motivewar. bereits in den knapp 32 000 Jahre alten darstellungender grotte Chauvet im tal der ardèche wird die erzählerischedimension der jungpaläolithischen Höhlenkunst ersichtlich.die bilder sind nicht etwa isoliert und als prominente blick-fänger in den visuellen darstellungsraum gestellt, sondernorientieren sich in ausrichtung, größe und tierart, aber auchin ihrer gestischen Pose an anderen Motiven in ihrer umge-bung. die gesamtkonfiguration der bilder ist eine bildkom-position. deutlich wird das etwa an der darstellung zweierkämpfender wollnashörner, die eine eigentümliche dynamikentfalten.308 dynamik ist das richtige stichwort. was dieChauvet-Höhle so außergewöhnlich macht, ist das markantebewegungsmoment ihres bildkanons. Immer wieder tretenszenische Motivensembles auf, die gar nicht isoliert gedachtwerden können. szenik und implizite relationalität der ab-bildungen verweisen auf eine narrative einbettung. beson-ders deutlich tritt dieser erzählcharakter im Panneau derLöwen zutage. einzelne Löwen sind jeweils leicht versetztüber (oder unter) ihren Nachbarn angebracht, sodass der ein-druck einer jagenden Meute entsteht. Jedenfalls dominiertbewegung die bildszenerie. unmittelbar vor der Löwen-meute ist ein Mammutjunges angebracht, das offensichtlichzwischen die Fronten geraten ist. denn gleichzeitig ist eineim gleichen stil vor den Löwen davonrennende Herde vonwollnashörnern auf dieser seite platziert worden. bei denNashörnern wird die bewegungsdynamik insbesondere des-halb deutlich, weil die rückenkonturen ebenso wie die
298 vgl. exemplarisch LorbLaNCHet 2010, 38ff.299 LorbLaNCHet 2010, 316.300 LorbLaNCHet 2010, 321f.301 vgl. etwa otte 2006, 89ff.302 vgl. baHN & Vertut 1998, 99.303 baHN & Vertut 1998, 102.304 vgl. etwa aIrVaux 2001, 162.305 vgl. bégoueN et al. 2009, 296f.306 vgl. gutHrIe 2005.307 vgl. grundlegend breItHauPt 2009, 114ff.308 vgl. CLottes 2003, 110f.
Narrative elemente s.l. sind ein besonderes Charakteristikum der aurignacienzeitlichen Höhlenkunst von Chauvet, in der besonders bewegungund gruppierung in der wandkunst inszeniert werden. dynamik wird durch die gestaffelte aneinanderreihung multipler Motive des gleichentyps erreicht, während die Konzentrik der Linien an bestimmten kritischen stellen der tiere, etwa dem Hornbereich von Nashörnern, be-wegung suggeriert. Narrativ werden die Motivkonfigurationen vor allem durch das inhaltliche Ineinanderstehen der einzelnen bilder, die
96 shumon t. Hussain
Hornkonturen leicht versetzt immer wieder nachgezogenwurden.309 die einheit ist durch ineinander verschachteltegeschichten ausgezeichnet.
auch in den solutréenzeitlichen Höhlenmalereien vontête du Lion ist eine erzählerische Komposition der Mo-tive erkennbar. die auf etwa 22 000 bP datierten dar-stellungen nehmen wechselseitig auf sich bezug. In dergrotte de la tête du Lion dominiert das Motivpaar vonbovide und Cervide. diese sind gegenübergestellt undblicken sich antagonistisch an. der bovide wird von zweikleineren steinbockköpfen geleitet, die sich ebenfalls an-tagonistisch begegnen.310 beachtlich ist, dass in vielenHöhlen Frankokantabriens bestimmte Kombinationenvon Motiven regelhaft auftauchen, wohingegen andere
vollständig fehlen. Häufig ist eine Kombination vonPferde- und bisondarstellungen (die ebenfalls wechselsei-tig auf sich bezug nehmen). Fehlt nun etwa der bisonwie in aldène, Cougnac und baume-Latrone, dann istauch das Pferdemotiv nirgends zu finden.311 das sprichtnicht zuletzt für eine narrative Verknüpfungslogik zwi-schen den einzelnen Motiven.
auch für Lascaux ist die szenik der bildkonfigurationenbelegt. Jedenfalls ist zumindest die tötungsszene als erzähle-risch zu klassifizieren.312 die schwer zu deutende bildkom-position zeigt einen phallischen anthropomorphen, der voreinem bison niederfällt. Jener ist verwundet, ein teil seinergedärme quillt aus der aufgeschlitzten bauchdecke hervor.die weiteren details mögen hier außen vor bleiben. wichtigist lediglich, dass es sich um ein sinnhaftes gefüge handelt,das nur mit Narrativierung aufgeschlüsselt werden kann. esist insofern narrativ eingebettet. diese beispiele mögen ge-nügen, um deutlich zu machen, dass die Narrativierung einwichtiges Moment der künstlerischen Inszenierung in derHöhlenkunst ausmacht. weil zumindest in europa erst mitdem Jungpaläolithikum, welches gleichzeitig die ankunft des
309 CLottes 2003, 132ff.; aber auch CHauVet et al. 1995, 98ff.310 vgl. CoMbIer 1984.311 CoMbIer 1984, 598.312 vgl. exemplarisch LeroI-gourHaN & aLLaIN 1979, 348f.;CLottes 2008, 120.
modernen Menschen markiert, dergestaltige befunde ge-macht werden können, fällt die narrative einbettung der ma-teriellen Kultur mit den bereits diagnostizierten Zäsuren insozial- und Kulturleistung zusammen. da Narration immerauch ein Hinweis für narrative empathisierungkapazitätenist, erhärtet sich die ese einer elaborierung des empathi-schen Vermögens beim modernen Menschen in jenem Zeit-horizont.313
das empathische Motiv der Handnegative
For humans, touch can connect you to an object in a very personal way ... make it seem more real.
Picard zu data beim berühren der Phoenix.star trek VIII, First Contact
gibt es noch weitere Hinweise auf eine Manipulation derwandmorphologie im Höhlenkorpus des Jungpaläolithi-kums? und beinhalten auch diese ein empathisches Moment?
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 97
Neben allerlei riffelungen und groben einkerbungen, diewohl intentioneller Natur sind, stechen vor allem die Hand-negative und Handpositive der Höhlenkunst hervor. ohnehinist der menschliche Körper viel stärker indirekt repräsentiert,als es auf den ersten blick den anschein hat. etliche Punkt-wolken, die bis dato immer als abstrakte und graphische Zei-chen gedeutet wurden, haben sich bei genauerer betrachtungals Körperstempel herausgestellt. Punktierungen, insbesonderejene in Punktwolken, sind oft lediglich die Positive von Fin-gern oder Handballen, welche erst in Farbe, meist rotenocker, getunkt und dann auf die Höhlenwand gedrückt wor-den sind.314 auch bemalte Kalksteinfragmente aus demschwäbischen Jura sind wohl nicht bemalt, sondern bestem-pelt worden, und zwar von mit Farbe bestrichenen Finger-kuppen.315 der menschliche Körper ist also schon im Paläo-lithikum als wichtiges künstlerisches Mittel anzusehen.
einen erzählzusammenhang aufspannen. die darstellung zeigt im rechten teil das berühmte bildfeld der Löwen, in dem ein jagendes Lö-wenrudel abgebildet ist, das es offenbar auf das etwas schematisch dargestellte isolierte junge Mammut unmittelbar zu seiner linken abgesehenhat. Im linken teil sind Nashörner zu erkennen, deren bewegungskomponente im Hornbereich mehr als evident ist.(Motivauswahl und umzeichnung von Jürgen richter nach: CHauVet et al. 1995, taf. 81)
313 vgl. zu empathie und Narration etwa NeILL 1996; Har-roLd 2000; CoPLaN 2004; aber auch gaut 2010, 252ff.314 vgl. exemplarisch CLottes 2008, 164f.315 vgl. bedNarIK 2008, 176.
98 shumon t. Hussain
etliche jungpaläolithische, vor allem magdalénienzeitliche bildkonfigurationen haben einen impliziten narrativen Kontext. Intertextualitätim sinne eines semantischen gehalts, der sich nur über den bezug zwischen einzelnen Motiven erschließt, kann als ein integrales Momentjener wandkunst gelten. oben: die bekannten ‘schwimmenden Hirsche’ von Lascaux. bemerkenswert ist die teils individualisierte, aber doch normierte Kopf-haltung der tiere, die denen von schwimmenden Hirschen sehr nahe kommt. unterstützt wird diese deutung durch die reduzierungder Figuren auf Kopf und Hals und die einbettung der Figurenreihe in einen höhlenmorphologischen Kontext, der an einen Fluss -zusammenhang denken lässt: Zum einen verdunkelt sich die Felswand an der stelle, an der die Hirschhälse virtuell ins wasser tauchen,deutlich, und zum anderen wird eine art wasseroberfläche durch die natürliche Felskante unterhalb der Figuren angedeutet. (umgezeichnet von Jürgen richter nach: auJouLat 2004, Pl. 115) unten: berühmte schachtszene aus Lascaux. dargestellt ist ein detailliert gemalter bison, dessen attribute im hinteren bereich des rump-fes als ‘Verwundung durch einen speer mit herausquellenden gedärmen’ gelesen werden können. der ithyphallische anthropomorphewird offenbar von dem ungewöhnlich positionierten bisonkopf umgeworfen und verliert dabei seine utensilien, insbesondere seinenstab mit Vogelaufsatz. weil auch die menschenähnliche Figur ein schnabelartiges gesicht hat und Vögel, z. b. wasservögel, in schama-nistischen Kontexten eine nicht unerhebliche rolle spielen, wird die schachtszene oft als Narrativ eines schamanen verstanden. (umgezeichnet von Jürgen richter nach: auJouLat 2004, Pl. 129)
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 99
die zahlreichen Handnegative und -positive in spätpleistozänen bilderhöhlen westeuropas sind ebenfalls der ausdruck einer embodiedart, die eine performative Kontaktaufnahme von Mensch und Höhle beinhaltet. oben und unten: auswahl von roten und schwarzen Handnegativen aus gargas im Pyrenäenvorland, salle I. (Fotos: Heinrich wendel, © wendel Collection, Neanderthal Museum)
Handpositive sind aber verhältnismäßig selten. sie findensich beispielsweise in altamira, santián, La Pasiega und Fu-ente del salín, also vor allem im nordspanischen Verbrei-tungsgebiet der Höhlenkunst. Handnegative sind sehr vielhäufiger anzutreffen. sie sind eine nahezu omnipräsente er-scheinung, die unter anderem in gargas, Cougnac, Pech-Merle, Les Fieux, roucadour und Les Merveilles nachge-wiesen sind.316 auch in der grotte Chauvet treten sie bereitsauf.317 sie finden sich in mindestens sieben spanischen undzweiundzwanzig französischen Höhlen oder Felsvorsprün-gen, ein Fall ist in Italien nachgewiesen.318 doch damit nochnicht genug. Jene erscheinung beschränkt sich nicht auf denfrankokantabrischen raum oder eine spezifische Zeitstufe,sondern ist zumindest auch in australien, argentinien undIndonesien beobachtet worden.319 es handelt sich vermut-lich um ein sehr verbreitetes Phänomen. was das europäi-sche Paläolithikum betrifft, so findet sich vor allem im fran-zösischen gargas ein reicher Korpus an Handnegativen.320
was hat es mit diesen bildwerken auf sich? es wird sichwohl kaum um willkürliche graffiti handeln. dafür sind dieHandnegative zu stark in die bildkompositionen der Höh-len eingebunden (sie scheinen eben ihren Platz zu haben).außerdem befinden sich auch die Körperstempel und -ne-gative in der regel an nur schwer zugänglichen orten in-nerhalb der Höhle, sodass die unbeabsichtigte anbringungeher unwahrscheinlich ist. der schlüssel könnte im Körper-konzept jener Zeit verborgen liegen. Hände und Finger sindein bestandteil des belebten Körpers, sie sind dessen aus-läufer. Jene teile, die für die Kontaktaufnahme mit Neuem,mit dem anderen prädestiniert sind. die Hand ist der em-pathische Mittler zwischen dem Ich und dem anderen.durch berührung wird die empathische Verbindung nichtnur physisch etabliert, sondern zudem auch noch in ihrerIntensität verstärkt. die Höhle, sofern sie in einem animis-tischen sinne als aspekt des Lebendigen verstanden wird,soll auf diese weise ihre diskretion, ihre abgetrenntheit zumIndividuum verlieren. In einem solchen ‘Handauflegen’drückt sich der wunsch aus, Holismus zu erfahren, emo-tionen und gedanken mit dem lebendigen Höhlenkörperzu teilen. darin äußert sich das bestreben nach einheit mitdem Lebendigen. es ist die empathische Motivation, durchberührung einen Kanal zu öffnen, mit dessen Hilfe dasFremde aber doch so Nahe erfahrbar und damit verständlichzu machen. es ist der Versuch, sich in die umwelt einzu-fühlen. Insofern könnte man tatsächlich soweit gehen, hier
100 shumon t. Hussain
ein erstes aufflammen von spiritualität zu verorten. es istdas empathische, was die dafür unerlässliche brücke baut.das ist jedoch nur der eine aspekt. der andere ist mit kon-kreten akteuren verknüpft, mit Menschen aus Fleisch undblut. die meisten der großen bilderhöhlen waren wohl überviele generationen in Nutzung, teils umspannt ihre bege-hungsdauer viele Jahrzehntausende, wobei natürlich nichtsicher ist, wie oft die Höhlen tatsächlich aufgesucht wordensind und ob es sich stets um die gleichen traditionsgruppenhandelte. Für meinen deutungsvorschlag sind diese Fakto-ren ohnehin von untergeordneter bedeutung. Körperteile,welche performativ mit den Höhlenwänden in Verbindunggebracht wurden, sind, so meine Hypothese, als Kanäle derbezugnahme zu deuten. als Medien, mit denen nicht nureine Verbindung zum alles umgebenden liminalen raum,sondern auch zu jenen akteuren der Vergangenheit, die die-sen raum einst domestiziert, d.h. mit bedeutung aufgela-den haben, eingegangen werden sollte. eine Verbindung,welche die Zeitlichkeit transzendiert und ein einfühlen, eineinswerden mit dem Vergangenen, letztlich mit der eigenentraditionslinie ermöglicht. Handnegative sind als Momenteder artikulation eines ‘empathischen gedächtnisses’ zu deu-ten. sie ermöglichen das iterative rückbesinnen auf vergan-gene generationen. In ihnen wird die Vergangenheit zurgegenwart und kann immer wieder vor augen geführt wer-den. Handnegative, Handpositive und Fingerstempel sindalso vor allem als ausdruck von Performanz zu verstehen, indenen sich der wunsch nach teilhabe, sei es an der Vergan-genheit oder an der präsenten gegenwart, kundtut. sie sindnur dann wirklich zu verstehen, wenn ein holistisches bildvon Körperlichkeit ebenso wie eine umfassende sensibilitätfür alles Lebendige, auch wenn es sich aus unserer heutigensicht um unbelebtes handelt, zugrundegelegt wird. der ei-gentliche akt ist das bedeutungstragende. dort kann em-pathie ihre wirkkraft entfalten.
das Paradigma des Palimpsests
Timeline ... this is no time to argue about time ... we don’t have the time.
troi zu riker.star trek VIII, First Contact
der Palimpsest ist ein weiteres Motiv, das uns in der suchenach dem empathischen weiterzuhelfen vermag. dasHauptproblem einer jeden Identifizierung kognitiver anla-gen und dispositionen liegt naturgemäß in deren nicht un-mittelbarer Materialisierung. es ist daher geboten, nachjenen Momenten und aspekten zu suchen, die mit den je-weiligen Vermögen einhergehen, aber trotzdem in der ma-teriellen Kultur aufspürbar bleiben. ein indirekter beleg ist
316 vgl. CLottes 2008.317 vgl. dazu CHauVet et al. 1995; aber auch CLottes 2003.318 vgl. zusammenfassend etwa bedNarIK 2008, 176.319 vgl. etwa MCCartHy 1979, 54 und CHaZINe & Noury2006.320 vgl. barrIère 1984, 514ff.; aber auch FouCHer 2007.
immerhin besser als gar keiner. solches findet sich in derPraxis des Palimpsestierens. Palimpsest entsteht durch stän-diges wiederauftragen von Motiven und bildern auf bereitsbemalte, beritzte oder gravierte oberflächen. auf dieseweise bildet sich eine Überlagerung von strukturen heraus,die aus der jungpaläolithischen Kunst nur allzu gut bekanntist. Palimpseste sind der Niederschlag einer künstlerischenPerspektivübernahme, die das bisher Vorhandene manipu-lativ mit einbezieht. Häufig nehmen sie nicht nur direkt aufdas gegebene bezug, sondern werden durch dieses erst kon-stituiert. es ist jedenfalls klar, dass dergestaltige gravurenund Malereien ein empathisches Moment beinhalten, da siedem Künstler ebenso wie dem betrachter eine perspektivi-sche rollenübernahme abverlangen; beide müssen sich indie Form und gestalt der Linien und bildgegenstände ein-fühlen, um etwas vom abgebildeten verstehen zu können.erst empathie dekodiert die ambivalente Linienführungund Motivkonstellation und löst das graphische gewirr ineinem sinnhaften Verweisungszusammenhang auf. das em-
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 101
pathische im Palimpsest macht zudem die Kurzlebigkeit, dieMomenthaftigkeit des eigentlichen akts deutlich. es ist ebenim engeren sinne nur die Handlung des Palimpsestierens,die eine rolle spielt. es handelt sich auf gewisse weise umein erüben des empathischen.
das Metamotiv des Palimpsests taucht in der jungpa-läolithischen Kunst eurasiens schon sehr früh auf, spätes-tens mit dem gravettien ist es voll ausgeprägt, und hältsich von dort bis ins spätpleistozän. eine reiche Kollektionderartiger bildwerke findet sich in dem erst ende des letz-ten Jahrhunderts entdeckten tal der Côa, im NordostenPortugals.321 ausgedehnte survey-Maßnahmen konntenin den folgenden Jahren etliche gravuren und ritzungeneiner eindeutig paläolithischen signatur zutage fördern.322
die Felskunst unter freiem Himmel des Côa-tals ist vor allem für ihre multiplen Palimpseste bekannt: gravierte Figuren überlagern sichmehrfach und systematisch und ringen dem betrachter ein gewisses ‘einsehungsvermögen’ ab. Perspektivische Fokussierung von zusam-mengehörigen Linien ist eine mentale Leistung, die durch das Liniengewirr und die implizite bewegung herausgefordert wird. rechts und links: ausgewählte beispiele sich gegenseitig überlagernder Motive aus Foz Côa (gravierte Felspaneele aus Canado do Infernound Quinta da barca), Nordportugal. (Fotos: Pedro guimarâes, mit freundlicher genehmigung [http://www.pedroguimaraes.net/])
321 vgl. Jorge 1995 und rebaNda 1995.322 vgl. baPtIsta & goMes 1995; ZILHão 1997; aber auchbaPtIsta 1999.
die typologie der darstellungen, aber auch die wenigen ver-fügbaren direkten altersdaten der bildwerke legen einen ers-ten entstehungszeitraum im gravettien, zwischen etwa30 000 und 27 000 bP, und eine zweite ‘schöpfungsphase’im Magdalénien, zwischen 13 000 bis 10 000 bP, nahe.323
Insgesamt konnten bis dato mehr als zweihundertfünfzig ver-zierte Felstafeln aufgespürt werden.324 die besonderheit derCôa-Kunst liegt aber nicht nur in ihrem zahlenmäßigen um-fang begründet, sondern ergibt sich vor allem aus der tatsa-che, dass es sich in dem Flusstal um einen der ganz seltenenFälle von Freilandfelskunst handelt. einige wenige Farbrestedeuten an, dass diese Felsgravierungen nicht nur ins gesteingetrieben wurden, sondern vermutlich zu einem großteilauch bemalt waren.325 das wichtigste Merkmal im Côa-talist aber zweifelsfrei das Moment der iterativen Überlagerungbereits existenter darstellungen durch neue gravuren undritzungen.326 es handelt sich teils um ähnliche, teils um un-terschiedliche Motive, die auf diese weise zum bildkanonhinzugetreten sind. dass es sich um eine sukzessive anreiche-rung der bildkompositionen handelt, dass also gewisserma-ßen eine Mehrphasigkeit vorliegt, davon zeugt nicht zuletztdie Präsenz zweier unterschiedlicher ‘eingrabungstechniken’.die zoomorphen abbildungen entsprechen der zu erwarten-den bandbreite an naturalisierten tieren der pleistozänenFauna und sind teilweise von verschiedenen anderen Künst-lern wiederbenutzt oder erneuert worden.327 das ist ein kri-tischer Punkt. er zeigt, dass jenes Palimpsestieren keinesfallseinem arbiträren oder gar völlig willkürlichen Muster unter-liegt, sondern bestimmten Vorgaben folgte. Jene Parametersind in der bildkonfiguration ebenso wie in der gestalt derLandschaft, in die diese eingebettet sind, zu finden. die Über-lagerung und Nachzeichnung schon vorhandener bilder undbildkomplexe deutet an, welche bedeutung allein im akt derPalimpsestierens lag. allein der performative Zugriff auf be-reits sistiertes und dessen Überprägung und perspektivischediversifizierung standen wohl im Mittelpunkt der tätigkei-ten im tal der Côa. die ästhetische erfahrung jener bild-werke ist in der empathischen einfühlung und dem spiel mitder Perspektive zu suchen. einem seeing-in, das mit dem Hin-und Herspringen zwischen Formen und Motiven spielt undso eine eigentümliche wirkkraft entfaltet.
Vergleichbares findet sich schon im bildkanon der grotteChauvet im tal der ardèche.328 dort wird die vermeintlicheZeittiefe jedoch nicht nur anhand von Motivüberlagerungenersichtlich, sondern zeigt sich außerdem in der farblichenZweiphasigkeit der abbildungen, die mit einer chronologi-schen Zweiphasigkeit einhergeht.329 auch die teils nicht un-erhebliche datierungsstreuung legt einen höher frequentier-ten begehungsabschnitt und eine diachrone entstehung somancher bilder nahe.330 das eröffnet eine ähnliche Interpre-tationsmöglichkeit wie im Kontext der Körperstempel. diesebildkompositionen sind nur unter dem gesichtspunkt einerempathischen bezugnahme auf bereits Vorhandenes versteh-
102 shumon t. Hussain
bar. Jene rekurrierung manifestiert sich im akt des emotivenNachzeichnens. dieses Nachvollziehen von gegebenem istausdruck einer emotionalen Verbundenheit mit bild undbild erschaffer. Im Palimpsest schwingt so immer schon einempathisches rückbesinnen auf vergangene Zeithorizontemit. der Palimpsest ist das Motiv ritueller bezugnahme durchempathie. ein Moment, der noch heute auf eindrucksvolleweise bei den ureinwohnern des australischen Kontinentsbeobachtet werden kann. auch die aborigines fahren die Li-nien ihrer teils über 10 000 Jahre alten Felsbilder immer wie-der in einem rituellen akt nach, um sich auf diese weise ihrenahnen näher zu fühlen.331 es handelt sich um einen emo-tional hoch aufgeladenen akt, der nicht nur den eigenen ur-sprung vergegenwärtigt, sondern auch in den Prozess stetigerbestätigung von Identität und Kontinuität eingebunden ist.auch dort ist die empathische bezugnahme das konstitutiveLeitprinzip. Jedenfalls ist es keineswegs unwahrscheinlich,dass ein solcher Motivationszusammenhang auch für weiterzurückliegende Zeiträume eine wichtige rolle gespielt hat.Immerhin sind einige der Felsbilder australiens vermutlichsehr viel älter als 10 000 Jahre.332
In europa findet sich ähnliche Palimpsest-Kunst verstärktim späten und finalen Jungpaläolithikum, insbesondere imMagdalénien. das ist nicht sonderlich überraschend, ist dasMagdalénien doch vor allem durch einen ausgeprägten de-korationshabitus gekennzeichnet. Jene epoche wartet miteinem reichen dekorkorpus auf, der wohl daher rührt, dassim gegensatz zu frühen abschnitten des Jungpaläolithikumsauch objekte des alltags verziert wurden. eine regelrechtedekorationskultur tritt zutage. Palimpsestierungen sind sonahezu omnipräsent. sie finden sich im gesamten Verbrei-tungsgebiet des paneuropäischen Magdalénienkomplexes,von gönnersdorf bis nach Frankreich.333 abgesehen von al-lerlei gravierten schiefer platten aus dem rheinland sind bei-spielsweise die gerölle aus La Colombière zu nennen, dieebenfalls durch die iterative Überlagerung verschiedener Mo-tive gekennzeichnet sind.334 Jene mobile Kunst ist insofern
323 vgl. VaLLadas et al. 2001a.324 vgl. baPtIsta 2001.325 baPtIsta 2001, 238f.326 baPtIsta 2001, 239ff.327 baPtIsta 2001, 248.328 vgl. dazu CHauVet et al. 1995; aber auch CLottes 2003.329 vgl. exemplarisch aLCoLea goNZÁLeZ & de baLbíN beHr -MaNN 2007.330 vgl. VaLLadas et al. 2001b.331 vgl. exemplarisch erCKeNbreCHt 1998.332 vgl. für einen kurzen Überblick bruMM & Moore 2005.333 vgl. etwa sIeVeKINg 1987; aber auch bosINsKI et al. 2001.334 vgl. MoVIus & sHeLdoN 1956; vgl, aber auch CoMbIer2002.
perspektivisch, als dass erst die drehung einzelner gerölleein seeing-in ermöglicht. ein einsehen ist damit nicht nureinfach von einer einfühlung in diskrete Formen abhängig,sondern erfordert zudem einen räumlichen Perspektiv-wechsel.
spätestens mit dem entwickelten Magdalénien kann voneiner Palimpsest-Kunst gesprochen werden. darstellungenwerden nicht mehr einfach nur dort hinterlassen, wo diesempathisch angemessen erscheint. die bildwelten werdenabstrakter und entziehen sich zusehends der eindeutigkeit,einer visuellen wie inhaltlichen determiniertheit. Ihre ästhe-tische Kraft entwickelt sich aus dieser piktorialen ambivalenzheraus, welche das empathische im Ästhetischen noch ver-stärkt. erst die empathische selektion in der gestalt einerperspektivischen offenheit er möglicht die bedeutungsfilte-
was es mit der Kunst und Ästhetik auf sich hat 103
rung dieser künstlerischen Äußerungen. daher lässt sich kon-statieren, dass im künstlerischen Palimpsest des Jungpaläoli-thikums ein Moment des empathischen ausdruck findet.die eurasische Kunst dieser Zeit lässt sich als regelrechtespielwiese eines empathischen weltzugangs verstehen.
empathie ist vermutlich nicht allein konstitutiv für diegenese dieser einzigartigen werke menschlichen Kultur-schaffens. dennoch ist das empathische im Ästhetischennicht einfach wegzudiskutieren. empathie ist ein wesentli-cher Motivationsfaktor dieser künstlerischen Manifestationender letzten eiszeit. Insofern ist Kreativität ein abgeleitetes re-sultat der kognitiven evolution des modernen Menschen.diese evolution ist aber stets sozial rückgekoppelt. es mussaufgabe zukünftiger Überlegungen sein, diesen Zusammen-hang genauer ins Visier zu nehmen.
die Volp-Höhlen beheimaten ei-nige der bekanntesten und zugleichkomplexesten gravurfelder der gesam-ten westeuropäischen Höhlen kunst.auch diese bildkonfigurationen beste-chen durch ihren Palimpsest-Charakter:die einzelnen Motive überlagern sich aufvielfältige art und weise auf ganz unterschied-lichen ebenen. die Perspektivnahme ermög-licht einen je individuierten einblick in diebildkon figurationen, die erst dann zu ‘Figuratio-nen’ gerinnen. besonders eindrucksvoll ist dieser ef-fekt auf der linken seite des ‘Panneau du fond’ in dergroßen Höhle von Les trois-Frères dokumentiert. dasgesamtmotiv ist insgesamt 2,05 m hoch und kann aufzwei unterschiedlichen ebenen betrachtet werden: derbison, der links oben durch den gewaltigen Kopf und wei-ter unten (mittig links) durch einen Vorderhuf angedeu-tet ist, zerfällt in etliche kleinere tiermotive, die sichihrerseits wieder überlagern. diese individuiertenKleinmotive konstituieren wiederum das groß-motiv des bisons. Je nach visuellem Fokus istder betrachter gezwungen, zwischen bei-den ‘sinnhorizonten’ hin und her zuspringen.(aus: bégoueN & breuIL 1999,Fig. 43)
104 shumon t. Hussain
III.1 art, aestHetICs aNd eMPatHIC CoN-stItutIoN
e third part attempts to establish a fruitful perspective ondemonstrating the conceptual link between mentalizing andempathizing with the world and the nature of an aestheticexperience. Philosophy of art has ever emphasized the roleof empathy in aesthetically conceptualizing the world.standing in the tradition of Lipps, aesthetically appreciatingan object is in part considered as a process of empathizingwith that object, which evokes motion and emotion. “ein-fühlung” is the crucial tool to epistemologically grasping anobject as artwork by reenacting and comprehending itsshape and configuration.
Modern neuroscientific analysis supports such a view. Inthe last few years, evidence has accumulated that mirror neu-rons play a constitutive role in establishing an aesthetic ex-perience. People who claim to have such a mental state whileappreciating a target object display the activation of the mir-ror neuron system in their prefrontal cortex. Neuroaestheticinvestigation thus speaks in favour of a view which considershaving an aesthetic experience as an act of conceptualizingthe object in question by simulation and empathy. emotionsand implicit meaning represented in an artwork are accessi-ble in this way and can be understood by the observer. somescholars even suggest that mental imitation of the artist’soriginal gesture while producing a work of art is the hallmarkof the aesthetic experience constituted by this artwork. em-pathy can be considered as one of the mediating mentalmechanisms allowing humans to attribute aesthetic value tothings in the world on the basis of their properties.
art evocating aesthetic experience therefore documentsa globalization of empathy in humans. empathy is not onlyused to epistemologically grasp others in the social world,but also others in the non-social world – in a nutshell, inthe non-living world as well. In other words, by saying thatempathy is an important constituent of social relations, aglobalization of empathy in the sense of a domain generalworld access channeled by empathy leads to a concurrenceof world and social world. e entire world becomes sociallyconstructed – a plant and an animal is a possible social playeras well and may be granted the same social status as a groupmember. I argue that this must be considered the bedrockof animism – a worldview which is characterized by the con-ceptualization of the world as globally animated. From thisperspective, both animated landscapes and the pure exis-tence of art are indirect arguments for an empathic position-ality at work. My point in this chapter is simply that bothphenomena are a distinct characteristic of modern human
behaviour and, in europe, only emerge in the consolidatedupper Palaeolithic as mirrored in its varied personal orna-ment and mobile art spectrum as well as in its magnificentcave and rock art tradition. especially in Franco-Cantabria,one is able to document an entire interconnected cave artlandscape which can be almost securely attributed to an un-derlying entirely animated landscape. is is most obviousin the rock art landscapes of Foz-Côa and siega Verde inwestern Iberia, where the whole landscape is staged withhundreds of rock art sites. In this sense, I argue that thesephenomena reflect the construction of a social space whichcorresponds with the social relevance of space and all of itsingredients, especially animals, rocks and rivers. In sum, thewestern and Central european upper Palaeolithic’s materialrecord clearly demonstrates an elaborated empathic capacity.we should consider this finding as a terminus ante quem forhigher general domain mentalizing.
III.2 NarratIoN, MytHoLogy aNd tIMe
e final part of the present work attempts to specify the re-lationship between empathy and european upper Palae-olithic cave art by identifying specific modes of conceptual-izing the world which might have given rise to thisremarkable phenomenon and which are structurally relatedto an empathic positionality in modern humans. e firstpoint is that Franco-Cantabrian cave art displays a crucialcomponent of rock art embeddedness. especially in cases inwhich figures are only implied and people can grasp thatthey were meant, but not explicitly present and simply in-dicated with a few lines, one gets the impression that theseshapes or animals were recognized in the natural morphol-ogy of the rock walls – they were seen in these walls. is be-comes very clear when one considers the cases in which an-imals are only indicated by humans but completed bynatural rock formations, e. g. when the back line of a bisonis constituted by the shape of a rock which resembles it. eact of drawing or engraving in these cases appears to be sim-ply an act of highlighting already seen outlines. one of themost parsimonious examples comes from Cantabria, wherethe famous “masks” occur in upper Palaeolithic cave artsites. ese rock formations naturally resemble animal orhuman faces – humans only added a few lines, often eyes,nose and mouth to emphasize this link. upper Palaeolithiccave art is an art which is embedded into the natural rockmorphology; it can only be understood by taking into ac-count the constitutive relationship between these two actors:humans and caves. I argue that the transformation of caves
suMMary Part III aNd wHat about art aNd aestHetICs?
summary Part III - and what about art and aesthetics? 105
into social space has something to do with the human abilityto read and to animate surrounding non-living matter in ananimism-like cultural setting. e seeing-in of known out-lines under special light conditions in another sphere (darkcave) by empathically grasping shape similarity could be oneimportant motivational background. another example is theibex of Les Fieux which is perfectly adjusted to the rock wall:back line and legs are formed by the rock, only the head anda few body lines are added.
e second point is that there is now accumulating ev-idence from the humanities that higher empathic function-ing is characterized by narrative contextualization. under-standing of others is often achieved by simulation ofpossible scenarios which are constituted by a form of men-tal narration. I argue that narration plays a crucial role inhuman-cave interaction as well and points to a rock-read-ing process which is guided by empathic reasoning. aglimpse of the narrative content of some picture fields isvisible in the mutual relatedness of the individual motifs,demonstrating a propositional link – as already pointedout by Leroi-gourhan almost half a century ago. e mostprominent “scene” of this type is the shaft scene in Lascaux,showing a seemingly wounded bison and a human-like fig-ure with a beak loosing its utensils in facing the animal.scenic staging is further present in the art of grotte Chau-vet and its huge painted panels. dynamism is expressedthere by the grouping and interrelatedness of several ani-mals, often of the same type. technical finesse creates theillusion of motion and sets the figures into contextual ag-itation. e best example from Chauvet is the lion panelwhich seems to depict a chasing lion pack. e interestingpoint is that these “scenes” with proposed narrative contentare internally structured by natural wall segments whichtherefore constitute the background of the narration. InLascaux, the famous drawing of stags swimming throughwater belongs to this group of pictures. e water is repre-sented by a natural wall edge and perfectly fits the notionof sceneries constituted by elaborated cave rock reading.one of the most impressive products of the Chauvet artistsis a panel of horses which seem to rest and drink. ispanel, however, is arranged on a very special place in thecave which opens the possibility that there is an irreduciblelink between place or rock configuration and artistic con-tent. In particular, the horses are painted on a rock wallwhich is located next to a kind of fresh water source pen-etrating the cave at this point in space. I suggest explainingthis quality of embeddedness as a derivative of complexmind-reading capacities expanded to the reading of com-plex arrangements in space which serve as a basis of con-ceptualizing the spatial setting. From this perspective, someintriguing aspects of upper Palaeolithic cave art can beconsidered as an expression of accessing the world by nar-rative association.
e third point is somehow speculative, but hidden withinthe phenomenon of positive and negative handprints and -stencils of upper Palaeolithic cave art. ese methods groupwith other techniques to manipulate the inner walls ofpainted caves and express direct interaction of cave and man.Most of the pointed clouds or discs, often red in colour, arealso made by the human hand, e. g. by stamping the ball ofthe thumb on the rock. It is important to note that thehuman body is thus a crucial device for exercising engravingand painting. e body is not just the primary means bywhich gestures and artistic movements are carried out, withspecial tools such as brushes or burins in-between man andcave, but is also an instrument with which to grasp the“body of the cave”. Handprints and related phenomena aretherefore likely the manifestation of an embodied art, whichis characterized by a tendency to emphasize direct contactbetween “cave body” and “human body”. is is especiallyplausible if one takes into account the animated nature ofupper Palaeolithic cultural landscapes. e cave is conceivedas a social actor, as part of the social world in which peoplelive. ese motives mirror the establishment of “channels ofrelatedness”. ey should be considered as performative actsin which the distance between man and cave is reduced. em-pathy is not only at work on the motivational level as mech-anism to negotiate this relationship, but also on the temporallevel in which it helps to establish an empathic memory byreading and feeling the cave’s personality, its changing char-acter and past human activities carried out in it – possiblyas a general means of communicating with the surroundingworld and the ancestors from a special place.
e last point targets the moment of “palimpsest”which characterizes an enormous part of upper Palae-olithic art in general. I argue here that such commonpalimpsest engravings and paintings are the expression ofan artistic perspective-taking and the mental capacity toswitch swiftly between different visual foci. e channelingof visual perception to extract and to identify one individ-ual motif within a seemingly chaotic tangle of lines is oneof the underlying cognitive functions with which this typeof art is playing. e most prominent example of multiplepalimpsest layers in the upper Palaeolithic is the rock artof the Côa valley in northern Portugal. other examples arethe engraved pebbles of La Colombière, which bear an it-eration of superimposed lines and the famous slates ofgönnersdorf depicting female figures. It seems that thepalimpsest momentum of upper Palaeolithic artistic activ-ities experiences its climax in the Magdalenian period.However, flexible perspective-taking and “seeing the un-seen” is clearly present within the entire european upperPalaeolithic and demonstrates the influence of empathiccapacities in artistically conceptualizing the world in thisperiod. as an expression of elaborated and complex em-pathic functioning, this art is clearly testimony of the
106 shumon t. Hussain
tural and conceptual links between elaborated empathic ca-pacities and the modes of staging and producing the firstart. I do not argue that empathy fully explains human art-making; rather, the production and design of upper Palae-olithic art mirror some aspects of human mental architec-ture, namely higher empathic capabilities. In this sense, itrecords a new stage of human social cognitive evolution: thefully evolved Homo empathicus.
global experience and perception guiding role of empathyin the evolved upper Palaeolithic – and, again, might serveas a terminus ante quem for the presence of higher empathiccapacities.
In sum, I believe that empathy is inextricably bound tohuman artistic behaviour and possibly co-evolved with art-making. e entire upper Palaeolithic artistic repertoire ofmodern humans shows that there are motivational, struc-
107
was ist der Mensch? das war der ausgangspunkt der vor-liegenden arbeit. es sollte deutlich geworden sein, dassdiese Frage eine evolutionär-anthropologische ist. es ist dieFrage nach der wesentlichen triebfeder der Hominisation.wodurch unterscheidet sich die anthropogenese also vonanderen evolutionären entwicklungspfaden? die antwortfindet sich in der besonderen gestalt der wechselseitigenVerschränktheit von sozialität und Kognition, die zu einemspezifischen Vermögen ‘sozialer Kognition’ führt. einemVermögen, das einzigartig ist und den modernen Menschenvon anderen Lebewesen unterscheidet. Jene soziale Kogni-tion ist wesentlich durch das Moment des empathischenausgezeichnet. als Humanspezifikum erhebt empathie denMenschen zum modernen Menschen, und zwar eine Formder empathischen Verfasstheit, die sehr viel weiter entwi-ckelt und sehr viel elaborierter ist als die von nichtmensch-lichen Primaten, Neandertalern oder sonstigen Lebewesen,die die evolution im Laufe der erd geschichte hervorge-bracht hat. Höhere empathie in der gestalt rekursiverMind-reading-Fertigkeiten, das kompetente soziale erken-nen anderer erst, macht den Menschen modern. erst jenekognitive Modernität ist das substrat des Menschlichen.
Ich habe zunächst versucht, die entfaltungs- undHemmfaktoren sowie die dynamiken der soziokulturellenVerschränktheit der empathie in der menschlichen Liniezu verfolgen. Im Fokus stand dabei der kritische Zeitraumzwischen 150 000 und 20 000 bP, weil dieser zum einengrob mit der Herausbildung der taxonomischen ordnungHomo sapiens parallelisiert werden kann, zum anderen diewichtigen Übergangsprozesse mit einschließt, sei es nun dieschwelle vom Middle stone age (Msa) zum Late stoneage (Lsa) in afrika oder die vom Mittel- zum Jungpaläo-lithikum in europa. Ich habe letztlich im anschluss an diearbeiten von Mcbrearty und brooks dafür argumentiert,diese Übergänge als ausdrücke einer Intensifizierung gra-dueller tendenzen zu verstehen und keinesfalls als qualita-tive sprünge oder gar als revolutionen.335 auch die sozial-kognitive Kompetenz der empathie ist einem solchenentfaltungsprozess gradueller und evolutionärer art unter-worfen. es handelt sich um ein präadaptives Potenzial,streng genommen um ein sehr altes erbe der evolution,weitaus älter als die menschliche Linie selbst, welches sichaber erst im Nährboden menschlicher sozietäten richtigentfalten konnte. betont werden sollte die kognitive Kom-ponente der Hominisation, das Kognitive, was den Men-
schen zum Menschen macht. es sind nämlich keinesfallssubsidiäre oder ökologische Faktoren, die am ende als ent-scheidend menschmachend gelten können, sondern viel-mehr die eigentümlichen wechselwirkungen zwischen so-zialität und Kognition. empathie ist ein Kulminat dieserwechselseitigen eingelassenheit.336 empathie ist ein resul-tat der sozialen Komplexwerdung der gruppen modernerMenschen, aber gleichzeitig eine starke formgebende Kraftder sozialen evolution dieser einheiten. empathie entfaltetsich in einem koevolutiven szenario.
es hat sich gezeigt, dass empathie in vielen arbeitenimmer wieder schon implizit mitgedacht worden ist, abernie explizit würdigung fand. um dies deutlich zu machen,wurden zunächst die allgemeinen evolutionären driftten-denzen aufgezeigt, die die Menschwerdung kennzeichnenund zugleich eine empathische Komponente artikulieren.empathie ist zunächst als regulativ, als evolutionäre Pro-blem-Lösung der entwicklung hin zur kooperativen auf-zucht in der menschlichen Linie zu begreifen, die mit einemmarkanten Life-History-einschnitt, namentlich insbeson-dere mit der Zerdehnung der postnatalen entwicklungs-phase, einhergeht. dieser führt zu einer Verschärfung desabhängigkeitsverhältnisses von Kind und Mutter, aber auchvom Nachwuchs und den notwendig werdenden alloeltern.empathie ist die synchronisationskraft dieser urszene. dasempathische Vermögen elaboriert sich parallel zur Hirnver-größerung, die an eine solche Komplex werdung des sozia-len gekoppelt ist, weil die präfrontalen regionen des ge-hirns funktional daran gebunden sind. Neokortikaleexpansion ist eine notwendige reaktion auf komplexerwerdende sozialverhältnisse. gepaart mit einer verstärktenspielerischen Komponente des Mensch seins – ebenfalls einedirekte Folge jener Life-History-Zäsur –, ist das empathi-sche gleichzeitig als Motor verbesserter Lehr- und Lernvor-gänge innerhalb menschlicher gesellschaften zu verstehen.es offenbart sich im Über-Imitieren bei gleichzeitigem In-tentionsverstehen und hat damit weitgehende kulturtechni-sche Konsequenzen. Jedenfalls lassen sich jene allgemeinenParameter mit einer divergenzentwicklung innerhalb derLife-History zwischen Neander talern und anatomisch mo-dernen Menschen korrelieren, die sich ab einen Zeitfenster
ZusaMMeNFassuNgMeNsCHHeItsgesCHICHte aLs eMPatHIegesCHICHte
If we’re going to be damned, let’s be damned for what we really are.Picard zu riker über Q’s urteil über die menschliche rasse.
star strek tNg, „encounter at Farpoint“
335 vgl. MCbrearty & brooKs 2000, 513ff.336 vgl. zum Multi-ebenen-Charakter der kognitiven evolutionneuerdings FoLey 2010.
108 shumon t. Hussain
zwischen etwa 80 000 und 30 000 bP immer deutlicher ab-zeichnet.
worin aber mündet diese Pfaddivergenz? wo genauzeigt sich empathie? das empathische erbe unserer Vorfah-ren zeigt sich noch im empathic bedding, in der intentionel-len Niederlegung von Verstorbenen, die eine engere Verbun-denheit einzelner sozialer akteure ebenso wie eine emotionalunterfütterte sozialstruktur signalisieren. beim Neandertalerwird dieses präadaptive Potenzial aber noch von einem aus-geprägten aggressionsimpetus unterminiert, der zwischen-menschliche beziehungen, doch auch beziehungen zwi-schen einzelnen gruppen reguliert. anders beim modernenMenschen: dieser kann mit einer sozialstrategie aufwarten,die ganz wesentlich durch Netzwerkbildung gekennzeichnetist. Menschen rücken auf allen Interaktionsebenen näher zu-sammen. sozialität pulsiert im empathischen. das resultatsind soziale einheiten mit autonomer Intentionalität, miteinem wir-bewusstsein, welches darauf basiert, dass jederauf die absichten des anderen bezug nehmen kann und sichauf diese weise eine Intentionskoordination einzustellen ver-mag. Im archäologischen befund zeigt sich das in der dis-kretwerdung sozialer einheiten, die Identitätsräume mit spe-zifischen kulturellen Markern ausbilden. Jene Kulturleistungkulminiert in Kommunalität. Kommunale Kultur ist des-halb ein derivat der empathischen sozialzementierung. be-sonders eindrücklich zeigt sich dieses kommunale Momentjedoch in der ausbildung transregionaler austauschsysteme,welche paradigmatisch für die Netzwerkbildung der sozialenLandschaft stehen. empathie resultiert in einer empathischenLandschaft.
die totalität der empathischen erfahrung kondensiertin einem weltzugang, der in erster Linie durch empathiegekennzeichnet ist. das Motiv der einfühlung kann nichtnur als konstitutiv für animistische alltags- und glaubens-praxen gelten, sondern führt ebenso zu einer belebung von
unbelebtem, indem dieses empathisiert wird. Insofern rü-cken empathie und Ästhetik sehr nahe aneinander. eineempathische Positionalität – das ist eine der wichtigstenaussagen – mündet in einem empathischen erkennen, wel-ches die Jäger und sammler des eiszeitlichen eurasien dazumotiviert hat, ihnen als lebendig erscheinende Formen inFels und gestein, ganz allgemein in der sie umgebendenLandschaft, künstlerisch hervorzuheben. es handelt sichum die Hervorhebung von schon Vorhandenem, streng ge-nommen um ein wieder-erkennen. derartige Lichtungendes empathischen finden sich zahlreich in der jungpaläoli-thischen Höhlenkunst, wo die Formen häufig der natürli-che gestaltmorphologie und ihrem impliziten Verweisungs-zusammenhang nachempfunden sind. auch die berühmtenHandnegative ebenso wie die zahlreichen Palimpsestmotivedieser Periode zeugen von einem empathischen weltzu-gang. all dies sind beispiele für eine globale empathisie-rung der Landschaft, die in altamira in Kantabrien, in Las-caux im tal der Vézère und in der grotte Chauvet im talder ardèche ihren vorläufigen Höhepunkt findet. dieseHöhleninszenierungen zeugen nicht zuletzt durch die dortevidente narrative einbettung des bildkanons von einer ela-borierten empathiekapazität ihrer schöpfer. des MenschenKultur und sozialität sind zu allererst empathischer Natur.
Mit Hublin lässt sich mit einiger Vorsicht festhalten,dass die unterschiede zwischen Mensch und Nicht-Mensch zwar letztlich vermutlich gar nicht so groß sind,dass empathie, Mitleid und nicht zuletzt einfühlung aberals ganz wesentliche bestandteile eines spektrums von an-passungen gelten müssen, die den Menschen so überauserfolgreich gemacht haben.337 die Menschheitsgeschichteavanciert damit zu einem guten anteil zur empathiege-schichte. einer geschichte, vor deren enthüllung wir ge-rade erst stehen. der Mensch ist und war immer zuallererstempath: Homo empathicus.
337 vgl. HubLIN 2009.
109
what does it mean to be human? is key question formsthe starting point of the present work. It should have be-come clear over the course of the previous chapters thatthe question turns out to be an evolutionary anthropolog-ical one, characterized by the quest for the fundamentalmotor or mover in the process of hominisation. How canthe specific evolutionary pathway which led to the genesisof modern humans differentiated from other trajectories,especially those which led to the extinction of our evolu-tionary relatives such as Neanderthals? I argue here thatthe answer can be found in the unique entanglement ofsociality and cognition within our branch of the humanlineage – an entanglement which led to a particular capac-ity for social cognition which is unique and distinguishesmodern humans from other life forms, species or taxo-nomic units. e hallmark of this unique capability of so-cial cognition is a special way of empathizing with othersand with the world. I argue that this empathic dispositionis an integral part of the set of specific traits that makes ushuman. as modern humans, we are primarily empathicbeings. our empathic constitution is much more elabo-rated than in non-human primates, Neanderthals or otherbeings, which evolution has brought to life during thecourse of earth’s history. Higher empathy and its charac-teristic recursive mind reading abilities which enable us tocompetently understand and interpret others in their ac-tions, emotions and mental states, raises man to modernman. only this cognitive modernity is the primary threadin fabric of being human.
First, I attempted to outline the specific constraints andboost factors that are critical to the evolutionary unfoldingof a unique empathic disposition in modern humans, aswell as the particular sociocultural dynamics of an em-pathic entanglement within the human lineage that shapedit. e analysis focuses on the critical timeframe between150 000 and 20 000 bP, because on the one hand, it canroughly be paralleled with the emergence of Homo sapiensas a taxonomic unit, and on the other hand, it encapsulatesimportant transitional processes, such as the threshold be-tween the late Middle stone age (Msa) and the early Latestone age (Lsa) in africa or the Middle to upper Palae-olithic transition in europe. In the end, I argue in accor-dance with Mcbrearty and brooks that these transitionsmust be considered as an expression of a gradual intensifi-cation of general cultural evolutionary trends, but not as
saltatory or revolutionary processes. e social-cognitive ca-pacity of empathy is also subjected to such a gradual processof evolutionary unfolding. e pre-adaptive potential itself,which led to the special form of empathy observable todayin modern humans is a very old evolutionary heirloom,much older than the human lineage itself, but could befruitfully elaborated only in the matrix of modern humansocieties and their cultural context. I attempted to empha-size the social-cognitive component of hominisation and itscatalytic role in the process of becoming human. In the end,neither ecology nor subsistence factors can adequately ex-plain human uniqueness and its evolutionary roots, but thespecial interplay of sociality and cognition can. Human em-pathy is a culminant of this mutual embeddedness. empa-thy is thus a product of the growing complexity of socialgroups, but at the same time shapes the evolutionary tra-jectories of these entities. is is why empathy always un-folds itself in a co-evolutionary scenario.
It is evident that empathy has been implicitly thema-tized in many papers, but has never been explicitly appre-ciated for its own virtue. on the way to establishing a viewwhich takes into account the significance of empathy as adiscrete trait, the general evolutionary drift tendencieswhich characterize the trajectory of hominisation and ar-ticulate an empathic component must be revealed andcharacterized. Firstly, empathy must be understood as aregulative, as an evolutionary problem solving strategy onthe way to cooperative breeding within the human lineage,which is accompanied by a critical life-history break,namely by the pronounced expansion of the postnatal de-velopmental stage. is expansion leads to an accentuationof mother-child dependency, as well as necessitating thedependency of offspring and alloparents. elaborated andhighly flexible empathic capacities reflect a synchronizingforce in this arche scene. empathy elaborates itself in par-allel to the human brain expansion, which is linked to sucha sophistication of the social structure, because the pre-frontal areas of the brain are functionally tied to it. Neo-cortical expansion is thus a necessary response to the intensification of social complexity. Coupled with a pro-nounced importance of social play in human ontogeneticdevelopment, which is also a direct consequence of the cru-cial life-history break, empathy becomes an importantmotor of teaching and learning processes in human socialunits. is phenomenon is today reflected in the human
suMMaryMaNKINd’s HIstory as HIstory oF eMPatHy
If we’re going to be damned, let’s be damned for what we really are.Picard to riker on Q’s judgment of the human race.
star strek tNg, „encounter at Farpoint“
110 shumon t. Hussain
tendency to over-imitate together with intentional under-standing and has tremendous cultural technical implica-tions. Pivotally, these empathy tied parameters within evo-lutionary processes can be correlated with a divergentdevelopment between Neanderthals and anatomical modernhumans, which is clearly visible at least from a timeframebetween 80 000 and 20 000 bP in the fossil record.
but where does this divergent evolutionary pathwayconclude? where exactly is empathy manifested? Most im-portantly, the empathic heirloom of our ancestors is reflectedin the practice of empathic bedding, in the intentional burialof the deceased, which demonstrates a close attachment ofthe involved social actors to each other as well as a stronglyemotionally interspersed social fabric. In the Neanderthalcase, this pre-adaptive empathic potential to socialize is un-dermined by an impetus of social aggression regulating bothintra-group and inter-group relations. almost the oppositeis true for modern humans: Homo sapiens seems to be char-acterized by a social strategy in which social networking isan integral building block and social actors approach eachother on nearly every scale of the social world. sociality,therefore, is pulsing in the empathic. e outcome is the de-velopment of groups with an autonomous intentionality,with a “we”-awareness, based on social players who can relateand adapt to the intentions and purposes of others – a situ-ation which culminates in social coordination on the grouplevel. In the archaeological record, this phenomenon is man-ifested in social units becoming discrete which form an in-dividual identity space with specific cultural markers. iscultural performance culminates in communality. Commu-nal culture is thus a derivate of this type of empathic socialsolidification. Most impressively, such a communal momentof sociocultural entities is mirrored in the emergence of transregional exchange systems, which stand paradigmati-cally for the interconnectedness of the social landscape.erefore, empathy culminates in an empathic landscape.
e totality of empathic experience condenses into a worldaccess which is primarily channeled by empathy. e mo-tive of “einfühlung” is not only constitutive for an ani-mistic everyday practice and practice of faith, but also re-sults in the vitalization of previously dead matter throughempathizing. In this sense, empathy and aesthetics ap-proach each other very closely. one of the key messages ofthis book is the conclusion that an empathic positionalitygives rise to an empathic epistemology, which possibly mo-tivated Ice age hunter-gatherers of eurasia to artisticallybring the perceived animated landscape with its rocks andcaves into prominence. It is nothing less than the accentu-ation of already existing shapes in natural formations bypainting or engraving; it is a case of recognition. suchglades of the empathic can be found numerously in upperPalaeolithic cave art where motives often mirror the naturalmorphology of the rock surface and thus imitate their im-plicit referential context. but also the prominent hand neg-atives and the various palimpsest motives of this culturalphenomenon and its time testify to this global world ac-cess. ese are all examples of globally empathizing withthe landscape as a whole, which finds its tentative climaxin altamira in Cantabria, Lascaux in the Vézère valley, andthe grotte Chauvet in the ardèche valley. e evident nar-rative embeddedness of image stagings present in manypainted caves demonstrates the elaborate empathy capacityof their makers. Human culture and sociality are first ofall empathic.
with Hublin can be carefully retained that the differ-ences between human and non-human are after all not thathuge, but compassion and empathy need to be regardedas integral parts of a special adaptive kit explaining muchof modern human success. e history of humankind isthus promoted to a history of empathy whose exposure isonly to begin. Man is and has always been primarily em-pathetic: Homo empathicus.
111
Que signifie-t-il d’être humain ? Ceci est la question clé quimarque le point de départ de cet ouvrage. à travers les cha-pitres précédents nous voyons que cette question relève del’anthropologie évolutive, et qu’elle nous met sur la quêtedu moteur principal du processus de l’hominisation. Com-ment la voie évolutive spécifique, qui mena a la genèse del’Homme moderne se diffère-t-elle des autres trajectoires,et plus particulièrement de ceux qui menèrent à la dispa-rition des espèces qui nous furent les plus proches commeles Néandertaliens? dans le présent ouvrage je propose quela réponse puisse se trouver dans l’enchevêtrement uniquede la socialité et la cognition qui caractérise notre lignagehumain – un enchevêtrement qui mena à la capacité decognition sociale, une capacité unique et qui nous dis-tingue de toute autre espèce. Le marqueur de cette capacitéest notre manière d’éprouver de l’empathie pour autrui.J’argumente ici que cette aptitude d’empathie fait partieintégrale de l’ensemble de traits spécifiques qui nous ca-ractérisent en tant qu’humains. L’Homme moderne estdans son essence un être empathique, et notre aptituded’empathie est, de manière décisive, plus élaborée que cellede tous les primates non-humains qui ont existé, y comprisles Néandertaliens. L’empathie évoluée, qui nous permetde comprendre et d’interpréter les émotions, les états d’es-prit et les actions de l’autre, constitue la capacité qui dis-tingue l’Homme moderne de l’Homme tout court.
dans un premier temps, j’ai voulu esquisser les princi-paux facteurs de montée et de contrainte pour un tel essorévolutif de l’aptitude d’empathie chez l’Homme moderne,ainsi que les dynamismes socio-culturels impliqués. Monanalyse est concentrée sur un cadre chronologique limitéentre 150 000 et 20 000 ans bP. Ceci comprend un hori-zon temporel critique, correspondant grossièrement àl’émergence de l’Homo sapiens, ainsi qu’à d’importants pro-cessus transitoires tels les transitions Msa-Lsa en afriqueet Paléolithique moyen-supérieur en europe. Finalement,j’argumente en accord avec Mcbrearty et brooks que cestransitions doivent être considérées comme des généralisa-tions et consolidations graduelles de certains traits culturelsde manière évolutive, et non pas comme des sauts ou « ré-volutions ». ainsi, la capacité socio-culturelle d’empathiedoit également être vue comme le résultat d’un processusévolutif graduel. Le germe évolutif de l’empathie qui ca-ractérise l’Homme moderne est d’une ancienneté qui pré-cède de loin notre lignage même. Pourtant, il n’a pu être
élaboré fructueusement que dans l’ère des sociétés del’Homme moderne et dans leurs contexte culturel. Monbut a été de mettre l’accent sur le composant socio-cognitifde l’hominisation, et sur son rôle catalyseur dans le pro-cessus du devenir humain. en fin de compte, ni l’écologieni les facteurs de subsistance suffissent pour expliquer demanière intégrale le caractère unique de notre espèce et nosracines évolutives – mais l’étude de l'interaction de la so-cialité et de la cognition le peut. L’empathie humaine estle pinacle de cette interaction. étant à la fois le produit dela complexité toujours croissante des groupes sociaux, ainsiqu’un moteur de formation et de changement de ceux-ci,l’empathie doit être considérée dans le contexte d’un telscénario co-évolutif.
L’empathie a été traitée implicitement dans de nom-breux travaux scientifiques, mais elle n’a jamais fait l’objetmême de la problématique. Pour pouvoir établir une vuesur l’hominisation qui prend en compte l’importance del’empathie en tant que facteur distinct, il est nécessaire deretracer l’évolution de l’empathie et définir sa place dansla trajectoire évolutive de l’hominisation. d’abord, l’em-pathie doit être comprise comme un régulateur, une stra-tégie pour résoudre des défis et qui mène vers une plusgrande coopération dans la reproduction. Ceci s’accom-pagne d’une rupture décisive dans l’hominisation: la pro-longation prononcée du stade de développement post-natal. Cette prolongation entraîne à son tour uneaccentuation de la dépendance entre mère et enfant, ainsique de la dépendance de ces derniers aux autres parents etmembres du groupe familial. Les capacités d’empathie, dé-veloppées et très flexibles, représentent une force synchro-nisante dans cette évolution initiale de la famille. L’empa-thie s’est élaborée parallèlement à l’expansion du cerveauhumain; celle-ci est liée à une telle sophistication de lastructure sociale, étant donné que les zones pré-frontalesdu cerveau y sont fonctionnellement associées. ainsi, l’ex-pansion néo-corticale serait une réponse nécessaire à l’in-tensification de la complexité sociale. de plus, l’importanceprononcée du jeu social dans le développement ontogéné-tique humain – également une conséquence directe decette même rupture décisive dans l’hominisation – soulignedavantage comment l’empathie devient un moteur impor-tant pour les processus d’enseignement et d’apprentissagedans les sociétés. Ce phénomène se reflète aujourd’hui dansla tendance humaine de sur-imiter lors de l’apprentissage,
résuMéL’HIstoIre de L’HuMaNIté – L’HIstoIre de L’eMPatHIe
If we’re going to be damned, let’s be damned for what we really are.Picard à riker, sur le jugement de Q sur la race humaine.
star strek tNg, „encounter at Farpoint“
112 shumon t. Hussain
et ses implications culturelles et techniques sont considéra-bles. tous ces paramètres liés à l’empathie, considérés dansleur processus évolutif, peuvent être corrélés avec le dévelop-pement divergent entre les Néandertaliens et l’Homme mo-derne, clairement visible dans les vestiges fossiles du cadrechronologique entre 80 000 et 20 000 ans bP.
où cette voie évolutive divergente devient-elle déci-sive ? où l’empathie est-elle précisément manifestée ? L’hé-ritage empathique de nos ancêtres se retrouve surtout dansla pratique d’enterrement intentionnel du décédé, ce quifait preuve d’une relation proche entre les acteurs sociauxconcernés, ainsi que d’une forte liaison émotionnelle deceux-ci envers la société elle-même. dans le cas des Néan-dertaliens, leur potentiel empathique pré-adaptif de socia-liser semble avoir été retenu par leur penchant vers l’agres-sion sociale, régulant les relations à la fois entre lesdifférentes groupes ainsi qu’au sein du groupe même. Chezl’Homme moderne nous voyons presque le contraire:l’Homo sapiens semble être caractérisé par une stratégie so-ciale dans laquelle la construction de réseaux sociaux faitpartie intégrale. ainsi, la socialité se développe-t-elle del’empathie. Le résultat en est l’émergence de groupes ayantune intentionnalité autonome – une conscience du «nous»– qui est soutenue par des acteurs sociaux capables de sym-pathiser et de s’adapter aux intentions et besoins d’autrui.Ce développement culmine en la coordination sociale auniveau du groupe. dans les vestiges archéologiques, ce phé-nomène est manifesté par les unités sociales qui deviennentprogressivement plus discrètes, s’attachent à des territoiresrestreints et se caractérisent par des marqueurs culturelsspécifiques. La culture communale qui en surgit est doncaussi un dérivé de la consolidation sociale rendue possiblepar l’aptitude d’empathie chez l’Homme moderne. Vueque l’émergence des systèmes d’échange inter-régionauxdoit être considérée comme un résultat de cette sophisti-
cation des unités sociales, nous pouvons voir également leterritoire social comme un produit de l’empathie.
La somme de l’expérience empathique constitue uneperspective sur le monde où l’empathie fait la grille d’in-terprétation principale. Non seulement le « einfühlung »fait-il partie constitutive de toute pratique religieuse et ani-miste, mais il revitalise aussi le monde des morts par l’évo-cation empathique. de cette manière, l’empathie et l’es-thétique se rapprochent très fortement. L’une desprincipales conclusions du présent ouvrage est la vuequ’une prise de position guidée par l’empathie entraîne unevéritable épistémologie empathique: tels les chasseurs-cueilleurs préhistoriques de l’eurasie ont-ils pu avoir l’idéede valoriser artistiquement les formes animées qu’ils recon-naissaient sur les parois rocheux de leurs grottes et cavernes.Cette pratique ne fut rien d’autre qu’une mise en accent,par le biais de la peinture et de l’incision, des formes natu-relles, que l’on associait avec des formes imaginaires. L’artpariétal, manifesté sur de nombreux sites du Paléolithiquesupérieur, et qui culmine avec les grottes d’altamira, deLascaux et de Chauvet, fait preuve de la capacité d’empa-thiser avec l’environnement que possédaient leurs créa-teurs. La culture et la socialité humaines sont avant toutcaractérisées par l’empathie.
Hublin nous apprend qu’il n’y a peut-être pas de hiatusentre l’humain et le non-humain. Nous pouvons tout demême considérer que les capacités de compassion et d’em-pathie font partie intégrale de l’ensemble d’avantages adap-tifs qui a assuré le succès de notre espèce. L’histoire de l’hu-manité peut, dans cette perspective, être considérée commeune histoire de l’empathie, et dont l’envergure reste large-ment à déterminer. L’Homme est depuis toujours un êtreprincipalement empathique : Homo empathicus.
(traduit par Hallvard bruvoll)
Möge die welt eine empathischere werden ...
May the world be a more empathic one ...
Que le monde devienne plus empathique ...
114 shumon t. Hussain
abraMoVa 1995: Z.a. abramova, L’art paléolithiqued’europe orientale et de sibérie (grenoble 1995).
aIeLLo & duNbar 1993: L.C. aiello & r.I.M. dunbar,Neocortex size, group size, and the evolution ofLanguage. Current anthropology 2, 1993, 184–193.
aIrVaux 2001: J. airvaux, L’art Préhistorique du Poitou-Charente. sculptures et gravures des temps glaci -aires (Paris 2001).
aLCoLea goNZÁLeZ & de baLbíN beHrMaNN 2007: J.J.alcolea gonzález & r. de balbín behrmann, C14 etstyle: La chronologie de l’art pariétal à l’heureactuelle. L’anthropologie 111, 2007, 435–466.
aLVard 2003: M.s. alvard, e adaptive Nature of Cul-ture. evolutionary anthropology 12, 2003, 136–149.
ÁLVareZ-FerNaNdeZ 2009: e. Álvarez-Fernandez, Mag-dalenian personal ornaments on the Move: a re-view of the Current evidence in Central europe.Zephyrus LxII, 2009, 45–59.
aMbrose 1998: s.H. ambrose, Late Pleistocene humanpopulation, bottlenecks, volcanic winter, and differ-entiation of modern humans. Journal of Humanevolution 34, 1998, 623–651.
aNtL-weIser 2008: w. antl-weiser, die Venus von wil-lendorf, ihre Zeit und die geschichte(n) um ihreauffindung (wien 2008).
arNoLd 2005: r. arnold, empathic Intelligence: teach-ing, Learning, relating (sydney 2005).
arsuga 2003: J. arsuga, e Neanderthal Necklace: insearch of the first inkers (Chichester 2003).
assMaNN 1992: J. assmann, das kulturelle gedächtnis.schrift, erinnerung und politische Identität in frü -hen Hochkulturen (München 1992).
assMaNN 2000: J. assmann, religion und kulturelles ge -dächtnis. Zehn studien (München 2000).
atraN 2002: s. atran, In gods we trust. e evolution-ary Landscape of religion (oxford 2002).
attwood 1998: t. attwood, asperger’s syndrome: aguide for Parents and Professionals (London 1998).
auJouLat 2004: N. aujoulat, e splendour of Lascaux.rediscovering the greatest treasure of Prehistoric art(London 2004).
bader 1978: o.N. bader, sungir: site du Paléolithiquesupérieur (Moskau 1978).
bader & bader 2000: o.N. bader & N.o. bader, upperPaleolithic site sugir. In: t.I. alexeeva & N.o.bader (Hrsg.), Homo sungirensis. upper Paleolithicman: ecological and evolutionary aspects of the in-vestigation (Moskau 2000) 21–29.
baHN 1982: P.g. bahn, Inter-site and interregional linksduring the upper Paleolithic: the Pyrenean evi-dence. oxford Journal of archaeology 1, 1982,247–268.
baHN & PettItt 2009: P.g. bahn & P. Pettitt, britain’soldest art. e Ice age cave of Creswell Crags(swindon 2009).
baHN & Vertut 1998: P.g. bahn & J. Vertut, Images ofthe Ice age (London 1998).
baIrd et al. 2006: g. baird, e. simonoff & a. Pickles,Prevalence of disorders of the autistic spectrum in apopulation cohort of children in south ames: thespecial Needs and autism Project. e Lancet 368,2006, 210–215.
baPtIsta 1999: a.M. baptista, No tempo sem tempo. aarte dos cacadores paleoliticos do Vale do Côa (Lis -sabon 1999).
baPtIsta 2001: a.M. baptista, e Quaternary rock artof the Côa Valley (Portugal). In: J. Zilhão, t. aubry& a. Faustino de Carvalho (Hrsg.), Les premiershommes modernes de la Péninsule Ibérique (Lis -sabon 2001) 237–252.
baPtIsta & goMes 1995: a.M. baptista & M.V. gomes,art rupreste do vale do Côa. trabalhos de antro -pologia e etnologia 35, 1995, 234–385.
bar-yoseF & CaLLaNder 1999: o. bar-yosef & J. Callan-der, e woman from tabun: garrod’s doubts inhistorical perspective. Journal of Human evolution37, 1999, 879–885.
bIbLIograPHIe
bibliographie 115
baroN-CoHeN 1995: s. baron-Cohen, Mindblindness.an essay on autism and eory of Mind (Cam-bridge 1995).
baroN-CoHeN 2006a: s. baron-Cohen, two new theoriesof autism: hypersystemizing and assortative mating.archives of desease in Childhood 91, 2006, 2–5.
baroN-CoHeN 2006b: s. baron-Cohen, e hypersys-temizing, assortative mating theory of autism.Progress in Neuropsychopharmacology and biolog-ical Psychiatry 30, 2006, 865–872.
baroN-CoHeN & wHeeLwrIgHt 2004: s. baron-Cohen& s. wheelwright, e empathy quotient: an in-vestigation of adults with asperger syndrome orhigh functioning autism, and normal sex differ-ences. Journal of autism and developmental dis-orders 34, 2004, 163–175.
barrett 2007: J.L. barrett, Cognitive science of religion:what is it and why is it?. religion Compass 1,2007, 768–786.
barrIère 1984: C. barrière, grotte de gargas. In: Leroi-gourhan (Hrsg.), L’art des cavernes. atlas desgrottes ornées paléolithiques francaises (Paris 1984)514–518.
bedNarIK 2008: r.g. bednarik, Children as Pleistoceneartists. rock art research 25, 2008, 173-182.
bégoueN & breuIL 1999: H. bégouen & H. breuil, LesCavernes du Volp. trois Frères – tuc d’audoubert.american rock art research association occa-sional Paper 4 (tuscon 1999).
bégoueN et al. 2009: r. bégouen, C. Fritz, g. tosello, J.Clottes, a. Pastoors & F. Faist, Le sanctuaire secretdu bison (Paris 2009).
bereNsoN 1896: b. berenson, e Florentine Painters ofthe renaissance (New york 1896).
berger & trINKaus 1995: t.d. berger & e. trinkaus,Patterns of trauma among the Neanderthals. Jour-nal of archaeological science 22, 1995, 841–852.
bHaNu 1992: b.a. bhanu, boundaries, obligations andreciprocity: Levels of territoriality among theCholanaickan of south India. In: M. Casimir & a.rao (Hrsg.), Mobility and territoriality (oxford1992) 29–54.
bIrd-daVId 1992: N. bird-david, beyond ‘e originalaffluent society’: a culturalist reformulation. Cur-rent anthropology 33, 1992, 25–47.
bIrd-daVId 1999: N. bird-david, ‘animism‘ revisited.Personhood, environment, and relational episte-mology. Current anthropology 40, 1999, 67–91.
bIsCHoF-KÖHLer 2009: d. bischof-Köhler, empathie. In:e. bohlken & C. ies (Hrsg.), Handbuch anthro-pologie. der Mensch zwischen Natur, Kultur undtechnik (stuttgart 2009) 312–316.
boas 1902: F. boas, tsimshian texts (washington 1902).
boas 1909: F. boas, e Kwakiutl of Vancouver Island(New york 1909).
boCHereNs 2009: H. bocherens, Neanderthal dietaryHabits: review of the Isotopic evidence. In: J.-J.Hublin & M.P. richards (Hrsg.), e evolution ofHominin diets: Integrating approaches to thestudy of Paleolithic subsistence (Leipzig 2009)241–250.
bLoCKLey et al. 2008: s.P.e. blockley, C.b. ramsey &t.F.g. Higham, e Middle to upper Paleolithictransition: dating, stratigraphy and isochronousmarkers. Journal of Human evolution 55, 2008,764–771.
boesCH & boesCH 1990: C. boesch & H. boesch, tooluse and tool making in wild chimpanzees. Folia Pri-matologica 54, 1990, 86–99.
boesCH & toMaseLLo 1998: C. boesch & M. tomasello,Chimpanzee and Human Cultures. Current an-thropology 5, 1998, 591–614.
boNIFay 1964: e. bonifay, La grotte du régourdou(Montignac, dordogne): stratigraphie et industrielithique Moustérienne. anthropologie 68, 1964,49–94.
boNIFay 2008: e. bonifay, La site du régourdou (Monti-gnac-sur-Vézère, dordogne) et al problème de la sig-nification des sépultures Néanderthaliennes. bul-letin de la société d’études et de recherchesPréhistoriques des eyzies 57, 2008, 25–31.
bosaCKI & astINgtoN 1999: s. bosacki & J.w. asting-ton, eory of Mind in Preadolescence: relationsbetween social understanding and social Compe-tence. social development 8, 1999, 237–255.
116 shumon t. Hussain
bosINsKI 2009: g. bosinski, das bild in der altsteinzeit.In: K. sachs-Hombach (Hrsg.), bildtheorien. an-thropologische und kulturelle grundlagen des Vi-sualistic turn (Frankfurt/M. 2009) 31–73.
bosINsKI et al. 2001: g. bosinski, F. d’errico & P. schul -ler, die gravierten Frauendarstellungen von gön-nersdorf (stuttgart 2001).
botterILL & CarrutHers 1999: g. botterill & P. Car-ruthers, Philosophy of Psychology (Cambridge1999).
bouyssoNIe et al. 1908: a. bouyssonie, L. bouyssonie &L. badron, découverte d’un squelette humaineMoustérien à la bouffia de la Chapelle-aux-saints(Corrèze). anthropologie 19, 1908, 513–518.
bowLby 1969: J. bowlby, attachment and loss; vol. 1: at-tachment (New york 1969; 21982).
bowLby 1984: J. bowlby, Violence in the family as a dis-order of the attachment and caregiver systems.american Journal of Psychoanalysis 44, 1984, 9–27.
boyd & rICHersoN 1992: r. boyd & P. J. richerson,Punishment allows the evolution of cooperation (oranything else) in sizable groups. ethological socio-biology 13, 1992, 171–195.
boyd & rICHersoN 2006: r. boyd & P. J. richerson,Culture and the evolution of human social instincts:In: N.J. enfield & s.C. Levinson (Hrsg.), roots ofhuman sociality: culture, cognition, and interaction(oxford 2006) 453–477.
boyer 2001: P. boyer, religion explained: e evolution-ary origins of religious ought (New york 2001).
bratMaN 1993: M. bratman, shared Intention. ethics104, 1993, 97–113.
bratMaN 1999: M. bratman, Faces of Intention (Cam-bridge 1999).
brÄuer et al. 2007: J. bräuer, J. Call & M. tomasello,Chimpanzees really know what others can see in acompetitive situation. animal Cognition 10, 2007,439–448.
breItHauPt 2009: F. breithaupt, Kulturen der empathie(Frankfurt/M. 2009).
bruMM & Moore 2005: a. brumm & M.w. Moore,symbolic revolutions and the australian archaeo-logical record. Cambridge archaeological Journal15, 2005, 157–175.
bruNer et al. 2003: e. bruner, g. Manzi & J.L. arsuaga,encephalization and allometric trajectories in thegenus Homo: evidence from the Neanderthal andmodern lineages. Proceedings of the National acad-emy of sciences (PNas) 100, 2003, 15335–15340.
burKert & FLoss 2005: w. burkert & H. Floss, Lithicexploitation areas of the upper Paleolithic of westand southwest germany – a comperative study. In:stone age – Mining age. der anschnitt, beiheft 19(bochum 2005) 329–339.
burKart et al. 2009: J.M. burkart, s.b. Hrdy & C.P. Vanschaik, Cooperative breeding and Human Cogni-tive evolution. evolutionary anthropology 18,2009, 175–186.
buss 2004: d.M. buss, evolutionary Psychology (boston2004).
byers 1994: a.M. byers, symboling and the Middle-upper Paleolithic transition: a theoretical andmethodological critique. Current anthropology 35,1994, 369–400.
byers 1999: a.M. byers, Communication and materialculture. Pleistocene tolls as action cues. Cambridgearchaeological Journal 9, 1999, 23–41.
byrNe 1998: r.w. byrne, Machiavellian Intelligence. evo-lutionary anthropology 5, 1998, 172–180.
byrNe & CorP 2004: r.w. byrne & N. Corp, Neocortexsize predicts deception rate in primates. Proceedingsof the royal society of London 271, 2004,1693–1699.
byrNe & wHIteN 1988: r.w. byrne & a. whiten,Machiavellian Intelligence. social expertise and theevolution of Intellect in Monkeys, apes, and Hu-mans (oxford 1988).
byrNe & wHIteN 1992: r.w. byrne & a. whiten, Cog-nitive evolution in primates: evidence from tacticaldeception. Man 27, 1992, 609–627.
CaLL & toMaseLLo 2007: J. Call & M. tomasello, egestural communication of apes and monkeys (Newyork 2007).
bibliographie 117
CaLL et al. 2004: J. Call, b. Hare, M. Carpenter & M.tomasello, ‘unwilling’ versus ‘unable’: Chim-panzees’ understanding of Human Intentional ac-tion. developmental science 7, 2004, 488–498.
CaNN et al. 1987: r. Cann, M. stoneking & a.C. wilson,Mitochondrial dNa and human evolution. Nature325, 1987, 31–36.
CarPeNter 2006: M. Carpenter, Instrumental, social, andshared goals and intentions in imitation. In: s.J.rogers & J. williams (Hrsg.), Imitation and the de-velopment of the social Mind: Lessons from typicaldevelopment and autism (New york 2006) 48–70.
CarrutHers & sMItH 1996: P. Carruthers & P. smith,eories of eories of Mind (Cambridge 1996).
CasHdaN 1990: e. Cashdan, risk and unvertainty intribal and peasant economies (boulder 1990).
CassIrer 2007: e. Cassirer, Versuch über den Menschen.einführung in eine Philosophie der Kultur (Ham-burg 2007).
CHarNoV 1993: e.L. Charnov, Life History Invariants.some explorations of symmetry in evolutionaryecology (oxford 1993).
CHase 1994: P.g. Chase, on symbols in the Paleolithic.Current anthropology 35, 1994, 627–629.
CHase 2003: P.g. Chase, stone tool ‘style‘ and the evo-lutionary origins of symbolism. Präsentiert aufdem 9th Jahrestreffen der european archaeologistsassociation, 10.–14. september 2003.
CHauVet et al. 1995: J.-M. Chauvet, é. brunel de-schamps & Chr. Hillaire, grotte Chauvet. alt-steinzeitliche Höhlenkunst im tal der ardèche (sig-maringen 1995).
CHaZINe & Noury 2006: J.M. Chazine & a. Noury, sex-ual determination of hand stencils on the mainpanel of the gua Masri II Cave (east-Kali man tan/borneo – Indonesia). International Newsletter onrock art 44, 2006, 21–26.
CHIsHoLM 1993: J.s. Chisholm, death, Hope and sex.Life-History eory and the development of re-productive strategies. Current anthropology 34,1993, 1–24.
CLottes 2003: J. Clottes, return to Chauvet Cave: exca-vating the birthplace of art (London 2003).
CLottes 2008: J. Clottes, L’art des Cavernes (Paris 2008).
CoMbIer 1984: J. Combier, grotte de la tête-du-lion(grotte du bidon, grotte de la vache). In: a. Leroi-gourhan (Hrsg.), L’art des cavernes. atlas desgrottes ornées paléolithiques francaises (Paris 1984)595–599.
CoMbIer 2002: J. Combier, témoins artistique à solutré.In: J. Combier & a. Monet-white (Hrsg.), solutré1968–1998 (Paris 2002) 253–263.
CoNard 1992: N.J. Conard, tönchesberg and its Positionin the Paleolithic Prehistory of Northern europe.Monographien des römisch germanischen Zen-tralmuseums 20 (bonn 1992).
CoNard 2007: N.J. Conard, Neue elfenbeinskulpturen ausdem aurignacien der schwäbischen alb und dieentstehung der figürlichen Kunst. In: H. Floss & N.rouquerol (Hrsg.), Les chemins de l’art aurignacienen europe – das aurignacien und die anfänge derKunst in europa (aurignac 2007) 317–330.
CoNard 2009: N.J. Conard, a female figurine from thebasal aurignacian of Hohle Fels Cave in southwest-ern germany. Nature 459, 2009, 248–252.
CoNard 2010: N.J. Conard, Cultural modernity: consensusor conundrum? Proceedings of the National acad-emy of sciences (PNas) 107, 2010, 7621–7622.
CoNard & boLus 2003: N.J. Conard & M. bolus, ra-diocarbon dating the appearance of modern hu-mans and timing cultural innovations in europe:new results and challenges. Journal of Human evo-lution 44, 2003, 331–371.
CoNKey et al. 1980: M.w. Conkey, a. beltrán, g.a.Clark, J.g. echegaray, M.g. guenther, J. Hahn, b.Hayden, K. Paddayya, L.g. straus & K. Valoch,e Identification of Prehistoric Hunter-gathereraggregation sites: e Case of altamira. Currentanthropology 21 (1980) 609–630.
CoNstabLe 1977: g. Constable, e Neanderthals (Newyork 1977).
CooK 2013: J. Cook (Hrsg.), Ice age art. e arrival ofthe modern mind (London 2013).
CoPLaN 2004: a. Coplan, empathic engagement withNarrative Fictions. Journal of aesthetics and artCriticism 62, 2004, 141–152.
118 shumon t. Hussain
CrawFord 1937: M.P. Crawford, e Cooperative solvingof Problems by young Chimpanzees (baltimore 1937).
CurrIe & raVeNsCroFt 2002: g. Currie & I. raven-scroft, recreative Minds (oxford 2002).
dÄrMaNN 2010: I. därmann, eorien der gabe (Ham-burg 2010).
daVIdsoN & MCgrew 2005: I. davidson & w.C. Mc-grew, stone tools and the uniqueness of human cul-ture. Journal of the royal anthropological Institute11, 2005, 793–817.
daVIes & uNderdowN 2006: r. davies & s. under-down, e Neanderthals: a social synthesis. Cam-bridge archaeological Journal 16, 2006, 145–164.
d’errICo 2003: F. d’errico, e Invisible Frontier. a Mul-tiple species Model for the origin of behavioralModernity. evolutionary anthropology 12, 2003,188–202.
d’errICo & NoweLL 2000: F. d’errico & a. Nowell, aNew Look at the berekhat ram Figurine: Implica-tions for the origins of symbolism. Cambridge ar-chaeological Journal 10, 2000, 123–167.
d’errICo et al. 1998: F. d’errico, J. Zilhao, M. Julien, d.baffier & J. Pelegrin, Neanderthal acculturation inwestern europe? a Critical review of the evidenceand Its Interpretation. Current anthropology 39,1998, 1–44.
d’errICo et al. 2005: F. d’errico, C. Henshilwood, M.Vanhaeren & K. van Niekerk, Nassarius kraussianusshell beads from blombos Cave: evidence for sym-bolic behaviour in the Middle stone age. Journalof Human evolution 48, 2005, 3–24.
de waaL & brosNaN 2006: F.b.M. de waal & s.F. bros-nan, simple and complex reciprocity in primates.In: P. Kappeler & C.P. van schaik (Hrsg.), Cooper-ation in Primates and Humans. Mechanisms andevolution (Heidelberg und berlin 2006) 85–105.
deaCoN & wurZ 2001: H.J. deacon & s. wurz, MiddlePleistocene populations of southern africa and theemergence of modern behavior. In: L. barham & K.robson-brown (Hrsg.), Human roots: afirca andasia in the Middle Pleistocene (bristol 2001) 81–97.
deCety & JaCKsoN 2004: J. decety & P. L. Jackson, eFunctional architecture of Human empathy. be-havioral and Cognitive Neuroscience reviews 3,2004, 71–100.
deFLeur et al. 1999: a. defleur, t. white, P. Valensi, L.slimak & e. Crégut-bonnoure, Neanderthal canni-balism at Moula-guercy, ardèche, France. science286, 1999, 128–131.
deLagNes & roCHe 2005: a. delagnes & H. roche, LatePleistocene hominid knapping skills: the case ofLokalalei 2C, west turkana, Kenya. Journal ofHuman evolution 48, 2005, 435–472.
deLPorte 1993: H. delporte, L’image de la femme dansl’art préhistorique (Paris 1993).
deLPorte 1995: H. delporte (Hrsg.), La dame de bras -sempouy (Liège 1995).
detraIN et al. 1999: C. detrain, J.L. denebourg & J.M.Pasteels (Hrsg.), Information processing in social in-sects (basel 1999).
dIaMoNd 2009: J. diamond, arm und reich (Frank-furt/M. 2009).
dIbbLe & CHase 1993: H.L. dibble & P.g. Chase, onMousterian and Natufian burials in the Levant.Current anthropology 34, 1993, 170–175.
dICKsoN & gaNg 2002: d.b. dickson & g.y. gang, ev-idence for the emergence of ‘modern‘ behavior inthe Middle and Late stone age lithic assemblagesat shurmai rockshelter (gnJm2) and Kakwa Lelashrockshelter (gnJm2) in the Mukogodo Hills ofnorth-central Kenya. african archaeological review19, 2002, 1–26.
doNaLd 1991: M. donald, origins of the Modern Mind(Cambridge 1991).
doNaLd 1998: M. donald, Hominid enculturation andcognitive evolution. In: C. renfrew & C. scarre(Hrsg.), Cognition and Material Culture: the ar-chaeology of symbolic storage (Cambridge 1998)7–17.
doNaLd 2009: M. donald, e roots of art and religionin ancient material culture. In: C. renfrew & I.Morley (Hrsg.), becoming Human. Innovation inPrehistoric Material and spiritual Culture (Cam-bridge 2009) 95–103.
duNbar 1992: r.I.M. dunbar, Neocortex size as a con-straint on group size in primates. Journal of Humanevolution 20, 1992, 469–493.
bibliographie 119
duNbar 1993: r.I.M. dunbar, Coevolution of neocorti-cal size, group size and language in humans. behav-ioral brain science 16, 1993, 681–735.
duNbar 1995: r.I.M. dunbar, Neocortex size and groupsize in primates: a test of the hypothesis. Journal ofHuman evolution 28, 1995, 187–296.
duNbar 1998: r.I.M. dunbar, e social brain hypothe-sis. evolutionary anthropology 6, 1998, 178–190.
duNbar 2003: r.I.M. dunbar, e social brain: Mind,Language, and society in evolutionary Perspective.annual review of anthropology 32, 2003, 163–181.
duNbar & sHuLtZ 2007: r.I.M. dunbar & s. shultz,evolution in the social brain. science 317, 2007,1344–1347.
eIbL-eIbesFeLd 1973: I. eibl-eibesfeld, der vorprogram-mierte Mensch (wien 1973).
eLIas 1976: N. elias, Über den Prozess der Zivilisation.soziogenetische und psychogenetische untersu -chungen (Frankfurt/M. 1976).
erCKeNbreCHt 1998: C. erckenbrecht, traumzeit (Frei -burg 1998).
eVaNs 2001: d. evans, emotion: the science of sentiment(oxford 2001).
FaLK 2005: d. Falk, Prelinguistic evolution in early ho-minins: whence motherese? brain and behaviouralsciences 27, 2005, 491–503.
FarbsteIN 2011: r. Farbstein, technologies of art: a Crit-ical reassessment of Pavlovian art and society,using Chaîne opératoire Method and eory. Cur-rent anthropology 52, 2011, 401–432.
FébLot-augustINs 1997: J. Féblot-augustins, La circula-ton des matières premières au Paleolithique. syn-thèse des données, perspecitves comporementales(Liège 1997).
FébLot-augustINs 2009: J. Féblot-augustins, revisitingeuropean upper Paleolithic raw material transfers:the demise of the cultural ecological paradigm? In:b. adams & b.s. blades (Hrsg.), Lithic Materialsand Paleolithic societies (oxford 2009) 25–46.
FeLgeNHauer 1956–1959: F. Felgenhauer, willendorf inder wachau (wien 1956–1959).
FINLaysoN et al. 2006: C. Finlayson, F. giles Pacheco, J.rodríguez-Vidal, d.a. Fa, J.M. gutierrez López,a.s. Pérez, g. Finlayson, e. allue, J.b. Preysler, I.Cáceres, J.s. Carrión, y. Fernández Jalvo, C.P.gleed-owen, F.J. Jimenez espejo, P. López, J.a.López sáez, J.a. riquelme Cantal, a. sánchezMarco, F. giles guzman, K. brown, N. Fuentes,C.a. Valarino, a. Villalpando, C.b. stringer, F.Martinez ruiz & t. sakamoto, Late survival of Ne-anderthals at the southernmost extreme of europe.Nature 443, 2006, 850–853.
FLoss 1994: H. Floss, rohmaterialversorgung im Paläo -lithikum des Mittelrheingebietes (bonn 1994).
FLoss 2000: H. Floss, Le couloir rhin-saône-rhône – axede communication au tardiglaciaire? Les dernierschasseurs-cueilleurs d’europe occidentale (13000–5500 av. J.-C.). actes du Colloque de besançon,23–25. octobre 1998 (besançon 2000) 313–321.
FLoss 2002: H. Floss, Climate and raw material behavior:a case study form the late Pleistocene Hunter-gath-erers in the Middle rhine area of germany. In:L.e. Fisher & b.V. eriksen (Hrsg.), Lithic raw ma-terial economies in late glacial and early postglacialeurope. british archaeological reports (bar) In-ternational series 1093 (oxford 2002) 79–88.
FLoss 2007: H. Floss, die Kleinkunst des aurignacien aufder schwäbischen alb und ihre stellung in derpaläolithischen Kunst. In: H. Floss & N. rouquerol(Hrsg.), Les chemins de l’art aurignacien en europe– das aurignacien und die anfänge der Kunst ineuropa (aurignac 2007) 295–316.
FLoss 2009: H. Floss, Kunst schafft Identität – das auri-gnacien und die Zeit der ersten Kunst. eiszeit:Kunst und Kultur. begleitband zur großen Landes -ausstellung (stuttgart 2009) 248–257.
FLoss & rouQueroL 2007: H. Floss & N. rouquerol,Les chemins de l’art aurignacien en europe – dasaurignacien und die anfänge der Kunst in europa(aurignac 2007).
FoLey 2010: r.a. Foley, evolution and the Human Cog-nitive diversity: what should we expect? Interdis-ciplinary science reviews 35, 2010, 241–252.
FoLey & gaMbLe 2009: r.a. Foley & C. gamble, eecology of social transitions in human evolution.Philosophical transactions of the royal society 364,2009, 3267–3279.
120 shumon t. Hussain
FouCHer 2007: P. Foucher, La grotte de gargas. un sièclede découvertes édition spéciale de Centenaire(saint-Laurent-de-Neste 2007).
Freedberg 1989: d. Freedberg, e Power of Images.studies in the History and eory of response(Chicago 1989).
Freedberg & gaLLese 2007: d. Freedberg & V. gallese,Motion, emotion and empathy in esthetic experience.trends in Cognitive sciences 11, 2007, 197–203.
gadaMer 1960: H.-g. gadamer, wahrheit und Methode.grundzüge einer philosophischen Hermeneutik(tübingen 1960).
gaLeF 2004: b.g. galef, approaches to the study of tra-ditional behaviors in free-living animals. Learningand behavior 32, 2004, 53–61.
gaLLese 2009: V. gallese, Motor abstraction: a neurosci-entific account of how action goals and intentionsare mapped and understood. Psychological research73, 2009, 486–498.
gaLLese & goLdMaN 1998: V. gallese & a. goldman,Mirror neurons and the simulation theory of min-dreading. trends in Cognitive sciences 2, 1998,493–501.
gaLLese et al. 2004: V. gallese, C. Keysers & g. rizzo-latti, a unifying view of the basis of social cognition.trends in Cognitive science 8, 2004, 396–403.
gaLLese et al. 2009: V. gallese, M. rochat, g. Cossu &C. sinigaglia, Motor Cognition and Its role in Phy-logeny and ontogeny of action understanding.developmental Psychology 45, 2009, 103–113.
gaMbLe 1987: C. gamble, Man the shoveler. alternativeModels for Middle Pleistocene Colonization andoccupation in Northern Latitudes. In: o. soffer(Hrsg.), e Pleistocene old world. regional Per-specitves (New york & London 1987) 81–98.
gaMbLe 1996: C. gamble, Making tracks: hominid net-works and the evolution of the social landscape. In:J. steele & s. shennan (Hrsg.), e archaeology ofHuman ancestry (London & New york 1996)253–277.
gaMbLe 1999: C. gamble, e Paleolithic societies of europe (Cambridge 1999).
gaMbLe 2007: C. gamble, origins and revolutions:Human Identity in earliest Prehistory (Cambridge2007).
gaMbLe et al. 2011: C. gamble, J. gowlett & r.I.M.dunbar, e social brain and the shape of the Pa-leolithic. Cambridge archaeological Journal 21,2011, 115–135.
gargett 1989: r.H. gargett, grave shortcomings: the ev-idence for Neanderthal burials [with Comments andreply]. Current anthropology 30, 1989, 157–190.
gargett 1999: r.H. gargett, Middle Paleolithic burialis not a dead issue: the view from Qafzeh, saint-sézaire, Kebara, amud and dederiyeh. Journal ofHuman evolution 37, 1999, 27–90.
gaut 2010: b. gaut, a philosophy of cinematic art (Newyork 2010).
geHLeN 1997: a. gehlen, der Mensch. seine Natur undseine stellung in der welt (wiesbaden 1997).
gILbert 1989: M. gilbert, on social Facts (New york1989).
goLdMaN 2006: a. goldman, simulating Minds (Newyork und oxford 2006).
goLeMaN 2006: d. goleman, social Intelligence (Newyork 2006).
goodaLL 1986: J. goodall, e Chimpanzees of gombe.Patterns of behavior (Cambridge 1986).
goreN-INbar 2011: N. goren-Inbar, Culture and cogni-tion in the acheulian industry: a case study fromgesher benot ya’aqov. Philosophical transactions ofthe royal society 366, 2011, 1038–1049.
grÄFeNHaIN et al. 2009: M. gräfenhain, t. behne, M.Carpenter & M. tomasello, young children’s under-standing of joint commitments. developmentalPsychologie 45, 2009, 1430–1443.
graVrILet & Vose 2006: s. gravrilet & a. Vose, e dy-namics of Machiavellian intelligence. Proceedingsof the National academy of sciences (PNas) 103,2006, 16823–16828.
gray et al. 2002: P.b. gray, s.M. Kahlenberg, e.s. barret,s. Lipson & P. ellison, Marriage and fatherhood areassociated with lower testosterone in males. evolu-tion of Human behavior 23, 2002, 1–9.
bibliographie 121
greeN et al. 2010: r.e. green, J. Krause, a.w. briggs, t.Maricic, u. stenzel, M. Kirchner, N. Patterson, H.Li, w. Zhai, M.H.y. Fritz, N.F. Hansen, e.y. du-rand, a.s. Malaspinas, J.d. Jensen, t. Marques-bonet, C. alkan, K. Prüfer, M. Meyer, H.a. bur-bano, J.M. good, r. schultz, a. aximu-Petri, a.butthof, b. Höber, b. Höffner, M. siegemund, a.weihmann, C. Nusbaum, e.s. Lander, C. russ, N.Novod, J. affourtit, M. egholm, C. Verna, P. rudan,d. brajkovic, Z. Kucan, I. gušic, V.b. doronichev,L.V. golovanova, C. Lalueza-Fox, M. de la rasilla, J.Fortea, a. rosas, r.w. schmitz, P.L.F. Johnson, e.e.eichler, d. Falush, e. birney, J.C. Mullikin, M.slatkin, r. Nielsen, J. Kelso, M. Lachman, d. reich& s. Pääbo, a draft sequence of the Neandertalgenome. science 238, 2010, 710–722.
greeNsPaN & sHaNKer 2004: s.I. greenspan & s.g.shanker, e First Idea: How symbols, Language,and Intelligence evolved from our Primate ances-tors to Modern Humans (Cambridge 2004).
greVe & sCHNabeL 2011: J. greve & a. schnabel, emer-genz. Zur analyse und erklärung komplexer struk-turen (berlin 2011).
grICe 1975: H.P. grice, Logic and Conversation. In: P.Cole & J.L. Morgan (Hrsg.), syntax and semantics:speech acts (New york 1975) 43–58.
grICe 1976: H.P. grice, Meaning. Philosophical review64, 1976, 377–388.
grIeser & KuHL 1998: d.L. grieser & P. K. Kuhl, Ma-ternal speech to infants in a tonal language: supportfor prosodic features in motherese. developmentalPsychology 24, 1998, 14–20.
grINKer 2007: r.r. grinker, unstrange Minds: remap-ping the world of autism (New york 2007).
gross 2006: d. gross, e secret History of emotion(Chicago 2006).
guateLLI-steINberg 2009: d. guatelli-steinberg, recentstudies of dental development in Neanderthals:Implications for Neanderthal Life Histories. evolu-tionary anthropology 18, 2009, 9–20.
guNZ et al. 2010: P. gunz, s. Neubauer, b. Maureille &J.-J. Hublin, brain development after birth differsbetween Neanderthals and modern humans. Cur-rent biology 20, 2010, 921–922.
guNZ et al. 2012: P. gunz, s. Neubauer, L. golovanova,V. doronichev, b. Maureille & J.-J. Hublin, auniquely modern human pattern of endocranial de-velopment. Insights from a new cranial reconstruc-tion of the Neandertal newborn from Mezmaiskaya.Journal of Human evolution 62, 2012, 300–313.
gutHrIe 1980: s.e. guthrie, a Cognitive eory of re-ligion. Current anthropology 21, 1980, 181–194.
gutHrIe 1993: s.e. guthrie, Faces in the Clouds. a Neweory of religion (New york 1993).
gutHrIe 2005: r.d. guthrie, e Nature of Paleolithicart (Chicago 2005).
HaHN 1986: J. Hahn, Kraft und aggression: die botschaftder eiszeitkunst im aurignacien süddeutschlands.archaeologica Venatoria 7 (tübingen 1986).
HaIdLe 2009: M. Haidle, How to think a simple spear?In: s.a. de beaune, F.L. Coolidge & t. wynn(Hrsg.), Cognitive archaeology and human evolu-tion (New york 2009) 57–73.
HaIdLe 2010: M. Haidle, working memory capacity andthe evolution of modern cognitive capacities –impli-cations from animals and early human tooluse. Current anthropology 51, 2010, 149–166.
HaIdLe & CoNard 2011: M. Haidle & N. J. Conard, eNature of Culture. synthesis of an interdisciplinarysymposium held in tübingen, germany, 15–18June 2011. Mitteilungen der gesellschaft für urge -schichte 20, 2011, 65–78.
HaIdLe et al., in Vorb.: M. Haidle, N. J. Conard & M.bolus, e Nature of Culture: a Model for the ex-tension of Cultural Capacity. roCeeH symposiumvom 15. bis 18. Juni 2011 in tübingen, in Vorb.
HaIgHt & MILLar 1992: w. Haight & P. Millar, e de-velopment of everyday pretend: a longitudinal studyof mothers’ participation. Merrill Palmer Q 38,1992, 331–349.
HaMburg 1971: d.a. Hamburg, Psychological studies ofaggressive behaviour. Nature 230, 1971, 19–23.
Hare & toMaseLLo 2004: b. Hare & M. tomasello,Chimpanzees are more skilful in competitive thanin cooperative cognitive tasks. animal behavior 68,2004, 571–581.
122 shumon t. Hussain
Hare et al. 2000: b. Hare, J. Call, b. agnetta & M.tomasello, Chimpanzees Know what Conspecificsdo and do Not see. animal behavior 59, 2000,771–785.
HarI et al. 1998: r. Hari, N. Forss, s. avikainen, e.Kirveskari, s. salenius, & g. rizzolatti, activationof human primary motor cortex during action ob-servation: a neuromagnetic study. Proceedings of theNational academy of sciences (PNas) 95, 1998,15061–15065.
HarroLd 1980: F. Harrold, a comparative analysis ofeurasian Paleolithic burials. world archaeology 12,1980, 195–211.
HarroLd 2000: J. Harrold, empathy with Fictions.british Journal of aesthetics 40, 2000, 340–355.
HauN & CaLL 2008: d. Haun & J. Call, Imitation recog-nition in great apes. Current biology 7, 2008,288–289.
HawKes 2001: K. Hawkes, Hunting and nuclear families.Current anthropology 42, 2001, 681–709.
HawKes et al. 1998: K. Hawkes, J.F. o’Connell, N.g. blur-ton Jones, H. alvarez & e.L. Charnov, grandmoth-ering, menopause, and the evolution of human lifehistories. Proceedings of the National academy ofsciences (PNas) 95, 1998, 1336–1339.
HeNN et al. 2011: b.M. Henn, C.r. gignoux, M. Jobin,J.M. granka, J.M Macpherson, J.M. Kidd, L. ro-dríguez-botigúe, s. ramachandran, L. Hon, a. bris-bin, a.a. Lin, P.a. underhill, d. Comas, K.K. Kidd,P.J. Norman, P. Parham, C.d. bustamante, J.L.Mountain & M.w. Feldman, Hunter-gatherer ge-nomic diversity suggests a southern african origin formodern humans. Proceedings of the National acad-emy of sciences (PNas) early edition (2011) 1–9.
HeNsHILwood 2009: C.s. Henshilwood, e origins ofsymbolism, spirituality, and shamans: exploringMiddle stone age material culture in south africa.In: C. renfrew & I. Morley (Hrsg.), becomingHuman. Innovation in Prehistoric Material andspiritual Culture (Cambridge 2009) 29–49.
HeNsHILwood & dubreuIL 2011: C.s. Henshilwood &b. dubreuil, e still bay and Howiesons Poort,77–59 ka: symbolic Material Culture and the evo-lution of the mind during the african Middle stoneage. Current anthropology 52, 2011, 361–400.
HeNsHILwood & MareaN 2003: C.s. Henshilwood &C.w. Marean, e origin of Modern Human be-havior. Critique of the Models and eir test Impli-cations. Current anthropology 44, 2003, 627–651.
HeNsHILwood et al. 2002: C.s. Henshilwood, F. d’errico,r. yates, Z. Jacobs, C. tribolo, g.a.t. duller, N.Mercier, J.C. sealy, H. Valladas, I. watts & a.g.wintle, emergence of modern human behavior:Middle stone age engravings from south africa.science 295, 2002, 1278–1280.
HeNsHILwood et al. 2004: C.s. Henshilwood, F. d’errico,M. Vanhaeren, K. Van Niekerk & Z. Jacobs, Middlestone age shell beads from south africa. science304, 2004, 404.
HeNsHILwood et al. 2009: C.s. Henshilwood, F. d’errico& I. watts, engraved ochres from the Middle stoneage levels at blombos Cave, south africa. Journalof Human evolution 57, 2009, 27–47.
HerrMaNN et al. 2007: e. Herrmann, J. Call, M.V.Hernández-Lloreda, b. Hare & M. tomasello, Hu-mans Have evolved special skills of social Cogni-tion: e Cultural Intelligence Hypothesis. science317, 2007, 1360–1366.
HewLett 1991: b. Hewlett, Intimate Fathers. e Natureand Context of aka Pygmy Paternal Infant Care(ann arbor 1991).
HIgHaM et al. 2006: t.F.g. Higham, C.b. ramsey, I. Kar-avanic, F.H. smith & e. trinkaus, revised direct ra-diocarbon of the Vindija g1 upper Paleolithic Ne-anderthals. Proceedings of the National academy ofsciences (PNas) 103, 2006, 553–557.
HILL et al. 2009: K. Hill, M. barton & a.M. Hurtado,e emergence of Human uniqueness: Charactersunderlying behavioral Modernity. evolutionaryanthropology 18, 2009, 187–200.
HoraN et al. 2005: r.d. Horan, e. bulte & J.F. shogren,How trade saved humanity from biological exclu-sion: an economic theory of Neanderthal extinc-tion. Journal of economic behavior and organiza-tion 58, 2005, 1–29.
Hrdy 2000: s.b. Hrdy, Mutter Natur. die weibliche seiteder evolution (berlin 2000).
Hrdy 2002: s.b. Hrdy, e past, present, and future ofthe human family, Parts one and two. In: g.b. Pe-terson (Hrsg.), e tanner Lectures on Human Val-ues 23 (salt Lake City 2002) 57–110.
bibliographie 123
Hrdy 2009: s.b. Hrdy, Mütter und andere. wie die evo-lution uns zu sozialen wesen gemacht hat (berlin2009).
HubLIN 2009: J-.J. Hublin, e prehistory of compassion.Proceedings of the National academy of sciences(PNas) 106, 2009, 6429–6430.
HuIZINga 1994: J. Huizinga, Homo ludens. Vom ur-sprung der Kultur im spiel (Hamburg 1994).
IaCoboNI et al. 1999: M. Iacoboni, r. . woods, M. brass,H. bekkering, J.C. Mazziotta & g. rizzolatti, Cor-tical mechanisms of human imitation. science 286,1999, 2526–2528.
ILLIes 2006: C. Illies, Philosophische anthropologie im bi-ologischen Zeitalter. Zur Konvergenz von Moralund Natur (Frankfurt/M. 2006).
INgNaM et al. 2000: M. Ingnam, H. Kaesmann, s. Pääbo& u. gyllensten, Mitochondrial genome variationand the origin of modern humans. Nature 408,2000, 708–713.
INgoLd 2000: t. Ingold, Perception of the environment(London 2000).
JaFFe et al. 2001: J. Jaffe, b. beebe, s. Feldstein, C.L.Crown & d.M. Jasnow, rhythms of dialogue inInfancy (boston 2001).
JaHoda 2005: g. Jahoda, eodor Lipps and the shiftfrom ‘sympathy’ to ‘empathy’. Journal of the His-tory of the behavioral sciences 41, 2005, 151–163.
JerIsoN 2007: H. Jerison, what fossils tell us about theevolution of the neocortex. In: J.H. Kaas (Hrsg.),evolution of Nervous systems: a Comprehensivereview (New york 2007) 1–20.
JoHNsoN-Frey et al. 2003: s.H. Johnson-Frey, F.r. Ma -loof, r. Newman-Norlund, C. Farrer, s. Inati &s.t. grafton, actions or hand-object interactions?Human inferior cortex and action observation.Neuron 39, 2003, 1053–1058.
Jorge 1995: V.o. Jorge (Hrsg.), dossier Côa. separata es-pecial de trablahos de antropologia e etnologia 35(1995).
KaPLaN et al. 1990: H. Kaplan, K. Hill & a.M. Hurtado,risk, foraging and food sharing among the ache. In:e. Cashdan (Hrsg.), risk and uncertainty in tribaland peasant economies (boulder 1990) 107–144.
Keysers et al. 2003: C. Keysers, e. Kohler, M.a. umiltà,L. Nanetti, L. Fogassi & V. gallese, audiovisualmirror neurons and action recognition. experimen-tal brain research 153, 2003, 628–636.
KLeIN 2008: r.g. Klein, out of africa and the evolutionof Human behavior. evolutionary anthropology17, 2008, 267–281.
KLeIN 2009: r.g. Klein, e Human Career. Human bi-ological and Cultural origins (Chicago 2009).
KNobLICH et al. 2002: g. Knoblich, e. seigerschmidt, r.Flach & w. Prinz, authorship effects in the predic-tion of handwriting strokes: evidence for action sim-ulation during action perception. Quarterly Journalof experimental Psychology 55, 2002, 1027–1046.
KoHLer et al. 2002: e. Kohler, C. Keysers, M.a. umiltà,L. Fogassi, V. gallese & g. rizzolatti, Hearingsounds, understanding actions: action representa -tion in Mirror Neurons. science 297, 2002, 846–848.
KoKKo et al. 2001: H. Kokko, r.a. Johnstone & t.H.Clutton-brock, e evolution of cooperative breed-ing through group augmentation. Proceedings ofthe royal society 268, 2001, 187–196.
Krause et al. 2007: J. Krause, L. orlando, d. serre, b.Viola, K. Prüfer, M.P. richards, J.-J. Hublin, C.Hänni, a.P. derevianko & s. Pääbo, Neanderthals incentral asia and siberia. Nature 449, 2007, 902–904.
KuZMIN et al. 2004: y.V. Kuzmin, g.s. burr, a.J.t. Jull& L.d. sulerzhitsky, aMs 14C age of the upperPaleolithic skeletons from sungir site, Central russ-ian Plain. Nuclear Instruments and Methods inPhysics research 223–224, 2004, 731–734.
LaLueZa-Fox et al. 2011: C. Lalueza-Fox, a. rosas, a. es-talrrich, e. gigil, P.F. Campos, a. garcía-tabernero,s. garcía-Vargas, F. sánchez-Quinto, o. ramírez,s. Civit, M. bastir, r. Huguet, d. santamaría,M.t.P. gilbert, e. willerslev & M. de la rasilla, ge-netic evidence for patrilocal mating behavior amongNeandertal groups. Proceedings of the Nationalacademy of sciences (PNas) 108, 2011, 250–253.
LaNgLey et al. 2008: M.C. Langley, C. Clarkson & s.ulm, behavioral Complexity in eurasian Nean-derthal Populations: a Chronological examinationof the archaeological evidence. Cambridge archae-ological Journal 18, 2008, 289–307.
124 shumon t. Hussain
LeaCH & LeaCH 1983: J.w. Leach & e.r. Leach, eKula: New Perspectives on Massim exchange (Cam-bridge und New york 1983).
Lee & daLy 1999: r.b. Lee & r. daly, e Cambridgeencyclopedia of Hunters and gatherers (Cambridge1999).
LeroI-gourHaN 1971: a. Leroi-gourhan, PrähistorischeKunst. Préhistoire de l’art occidental (Paris 1971).
LeroI-gourHaN 1976: a. Leroi-gourhan, Les religionsde la Préhistoire (Paris 1976).
LeroI-gourHaN & aLLaIN 1979: a. Leroi-gourhan & J.allain, Lascaux inconnue (Paris 1979).
LesLIe et al. 2004: a.M. Leslie, o. Friedman & t. ger-man, Core mechanisms in ‘theory of mind’. trendsin Cognitive sciences 8, 2004, 528–533.
LéVI-strauss 1993: C. Lévi-strauss, die elementarenstrukturen der Verwandtschaft (Frankfurt/M. 1993).
LewIs 1969: d. Lewis, Convention: a philosophical study(Cambridge 1969).
LewIs-wILLIaMs 2002: J.d. Lewis-williams, e Mind inthe Cave: Consciousness and the origins of art(London 2002).
LewIs-wILLIaMs 2004: J.d. Lewis-williams, Neuropsy-chology and upper Paleolithic art: observations onthe progress of altered states of consciousness. Cam-bridge archaeological Journal 14, 2004, 107–111.
LewIs-wILLIaMs 2009: J.d. Lewis-williams, of peopleand pictures: the nexus of upper Paleolithic reli-gion, social discrimination, and art. In: C. renfrew& I. Morley (Hrsg.), becoming Human. Innovationin Prehistoric Material and spiritual Culture (Cam-bridge 2009) 135–158.
LewIs-wILLIaMs & dowsoN 1988: J.d. Lewis-william& t.a. dowson, e signs of all times: entopticphenomena in upper Paleolithic art. Current an-thropology 29, 1988, 201–245.
LIPPs 1900: t. Lipps, Ästhetische einfühlung. Zeitschriftfür Psychologie und Physiologie der sinnesorgane22, 1900, 415–450.
LIPPs 1903: t. Lipps, einfühlung, innere Nachahmung,und organ empfindungen. archiv für die gesamtePsychologie 1, 1903, 185–204.
LIsZKowsKI et al. 2004: u. Liszkowski, M. Carpenter, a.Henning, t. striano & M. tomasello, twelve-month-olds point to share attention and interest.developmental science 7, 2004, 297–307.
LoNgCaMP et al. 2005: M. Longcamp, J.L. anton, M.roth & J.L. Velay, Premotor activations in responseto visually presented single letter depend on thehand used to write: a study on lefthanders. Neu-ropsychologica 43, 2005, 1801–1809.
LoNgCaMP et al. 2006: M. Longcamp, t. tanskanen &r. Hari, e imprint of action: motor cortex in-volvement in visual perception of handwritten let-ters. Neuroimage 33, 2006, 681–688.
LorbLaNCHet 1999: M. Lorblanchet, La Naissance del’art. genèse de l’art Préhistorique (Paris 1999).
LorbLaNCHet 2010: M. Lorblanchet, art Pariétal. grottesornées du Quercy (rouergue 2010).
LoreNZ 1963: K. Lorenz, das sogenannte böse. ZurNaturgeschichte der aggression (wien 1963).
MadeLaINe et al. 2008: s. Madelaine, b. Maureille, N.Cavanhié, C. Couture-Veschambre, e. bonifay, d.armand, M.-F. bonifay, H. duday, P. Fosse & b.Vandermeersch, Nouveaux restes humains mousté-riens rapportés au squelette néandertalien de re-gourdou 1 (régourdou, commune de Montignac,dordogne, France). Paleo 20, 2008, 101–114.
MaLINowsKI 1920: b. Malinowski, Kula: the Circulatingexchange of Valuables in the archipelagoes of east-ern New guinea. Man 20, 1920, 97–105.
MaLINowsKI 1922: b. Malinowski, argonauts of thewestern Pacific: an account of Native enterpriseand adventure in the archipelagoes of MelanesianNew guinea (London 1922).
MarsHaLL-PesCINI & wHIteN 2008: s. Marshall-Pescini& a. whiten, Chimpanzees and the question of cu-mulative culture: an experimental approach. animalCognition 11, 2008, 449–456.
MarwICK 2003: b. Marwick, Pleistocene exchange Net-works as evidence for the evolution of Language.Cambridge archaeological Journal 13, 2003, 67–81.
Mauss 1990: M. Mauss, die gabe: Form und Funktiondes austauschs in archaischen gesellschaften (berlin1990).
bibliographie 125
MCbrearty 1981: s. Mcbrearty, songhor: a Middle stoneage site in western Kenya. Quarternaria 23, 1981,171–190.
MCbrearty 1986: s. Mcbrearty, e archaeology of theMuguruk site, western Kenya (Illinois 1986).
MCbrearty 1988: s. Mcbrearty, e sangoan – Lupem-ban and Middle stone age sequence the Muguruksite, western Kenya. world archaeology 19, 1988,379–420.
MCbrearty 2007: s. Mcbrearty, down with the revolu-tion. In: P. Mellars, K. boyle, o. bar-yosef & C.stringer (Hrsg.), rethinking the Human revolu-tion (Cambridge 2007) 133–151.
MCbrearty & brooKs 2000: s. Mcbrearty & a. brooks,e revolution that wasn’t: a new interpretation ofthe origin of modern human behavior. Journal ofHuman evolution 39, 2000, 453–563.
MCCartHy 1979: F.d. McCarthy, australian aboriginalrock art (sidney 1979).
MCIVer LoPes 2007: d. McIver Lopes, art without ‘art’.british Journal of aesthetics 47, 2007, 1–15.
MCPHerroN et al. 2010: s. McPherron, Z. alemseged,C.w. Marean, J.g. wynn, d. reed, d. geraads, r.bobe & H.a. béarat, evidence for stone-tool-as-sisted consumption of animal tissues before 3.39million years ago at dikika, ethiopia. Nature 466,2010, 857–860.
MeHLMaN 1977: M.J. Mehlman, excavations at Naserarock, tanzania. azania 12, 1977, 111–118.
MeHLMaN 1979: M.J. Mehlman, Mumba-Höhle revisited:the relevance of a forgotten excavation to some cur-rent issues in east african prehistory. world archae-ology 11, 1979, 80–94.
MeHLMaN 1989: M.J. Mehlman, Late Quarternary ar-chaeological sequences in northern tanzania (Illi-nois 1989).
MeHLMaN 1991: M.J. Mehlman, Context for the emer-gence of modern man in eastern africa: some newtanzanian evidence. In: J.d. Clark (Hrsg.), Culturalbeginnings: approaches to understanding earlyHominid Lifeways in the african savanna (bonn1991) 177–196.
MeLLars 1996: P. Mellars, e Neanderthal Legacy(Princeton 1996).
MeLLars 2005: P. Mellars, e Impossible Coincidence.a single species Model for the origins of ModernHuman behavior in europe. evolutionary anthro-pology 14, 2005, 12–27.
MeLLars 2006: P. Mellars, archaeology and the dispersalof Modern Humans in europe: deconstructing the‘aurignacian’. evolutionary anthropology 15, 2006,167–182.
MerLeau-PoNty 1945: M. Merleau-Ponty, Phéno mé -nologie de la Perception (gallimard 1945).
MINICHILLo 2006: t. Minichillo, raw material use andbehavioral modernity: Howiesons Poort lithic for-aging strategies. Journal of Human evolution 50,2006, 359–364.
MItHeN 1996: s. Mithen, e prehistory of the mind: insearch for the origins of art, religion, and science(London 1996).
MItHeN 2009: s. Mithen, out of the mind: material cul-ture and the supernatural. In: C. renfrew & I. Mor-ley (Hrsg.), becoming Human. Innovation in Pre-historic Material and spiritual Culture (Cambridge2009) 123–134.
MoVIus & sHeLdoN 1956: H.L. Movius & J. sheldon,e rock shelter of La Colombière. archaeologicaland geological Investigations of an upper Périgor-dian site near Poncin (ain) (Cambridge 1956).
NeILL 1996: a. Neill, empathy and (Film) Fiction. In: d.bordwell & N. Carroll (Hrsg.), Post-eory: recon-structing Film studies (wisconsin 1996) 175–194.
NettLe & duNbar 1997: d. Nettle & r.I.M. dunbar,social Markers and the evolution of reciprocal ex-change. Current anthropology 38, 1997, 93–99.
Neugebauer-MaresCH 1989: C. Neugebauer-Maresch,Zum Neufund einer weiblichen statuette and deraurignac-station stratzing/ Krems-rehberg, Nie -derösterreich. germania 67, 1989, 551–559.
NoweLL 2010: a. Nowell, defining behavioral Modernityin the Context of Neandertal and anatomicallyModern Human Populations. annual review ofanthropology 39, 2010, 437–452.
126 shumon t. Hussain
o’CoNNor & MCCartNey 2007: e. o’Connor & K.McCartney, examining teacher-child relationshipsand achievements as part of an ecological model ofdevelopment. american educational Journal 44,2007, 340–369.
otte 2006: M. otte, ars Préhistoriques. L‘articulation delangage (brüssel 2006).
ParKINsoN et al. 2005: b. Parkinson, a.H. Fischer &a.s.r. Manstead, emotions in social relations(New york 2005).
Patou-MatHIs 2000: M. Patou-Mathis, Neanderthal sub-sistence behaviours in europe. International Journalof osteoarchaeology 10, 2000, 244–254.
PeNN & weIssINg 2000: I. Penn & F. J. weissing, to-wards a unified theory of cooperative breeding: therole of ecology and life history reexamined. Proceed-ings of the royal society 267, 2000, 2411–2418.
PettItt 2000: P. Pettitt, Neanderthal lifecycles: develop-mental and social phases in the lives of the last ar-chaic. world archaeology 31, 2000, 351–366.
PettItt 2002: P. Pettitt, e Neanderthal dead: exploringmortuary variability in Middle Paleolithic eurasia.before Farming 1 (2002).
PettItt 2011a: P. Pettitt, e Paleolithic origins ofHuman burial (New york 2011).
PettItt 2011b: P. Pettitt, e living as symbols, the deadas symbols: problematising the scale and pace of hominin symbolic evolution. In: C.s. Henshilwood& F. d’errico (Hrsg.), Homo symbolicus: e dawnof language, imagination and spirituality (amster-dam 2011) 141–162.
PIKa et al. 2005: s. Pika, K. Liebal, J. Call & M. toma -sello, e gestural communication of apes. gesture5, 2005, 41–56.
PLessNer 1929: H. Plessner, die stufen des organischenund der Mensch. einleitung in die philosophischeanthropologie (berlin 1929).
PoNCe de LeóN et al. 2008: M.s. Ponce de Léon, L. golo-vanova, V. doronichev, g. romanova, t. akazawa,o. Kondo, H. Ishida & C.P.e. Zollikofer, Nean-derthal brain size at birth provides insights into theevolution of human life history. Proceedings of theNational academy of sciences (PNas) 105, 2008,13764–13768.
Porr 2010: M. Porr, Palaeolithic art as Cultural Memory:a Case study of the aurignacian art of southwestgermany. Cambridge archaeological Journal 20,2010, 87–108.
PrestoN & de waaL 2002: s. Preston & F.b.M. de waal,empathy. Its ultimate and proximate basis. behav-ioral and brain sciences 25, 2002, 1–72.
raKoCZy 2006: H. rakoczy, Pretend play and the devel-opment of collective intentionality. Cognitive sys-tem research 7, 2006, 113–127.
raKoCZy 2007: H. rakoczy, Play, games and the develop-ment of collective intentionality. New directions inChild and adolescent development 115, 2007,53–68.
raKoCZy & toMaseLLo 2007: H. rakoczy & M. toma -sello, e ontogeny of social ontology: steps toshared intentionality and status functions. In: s.L.tsohatzidis (Hrsg.), Intentional acts and institu-tional facts: essays on John searle’s social ontology(berlin 2007).
raMIreZ-roZZI & berMudeZ de Castro 2004: F.V.ramirez-rozzi & J.M. bermudez de Castro, sur-prisingly rapid growth in Neanderthals. Nature 428,2004, 936–939.
raPPaPort 1999: r.a. rappaport, ritual and religion inthe Making of Humanity (Cambridge 1999).
rebaNda 1995: N. rebanda, os trabalhos arqueológicos eo complexo de arte ruprestre do Côa (Lissabon1995).
reNdeLL & wHIteHead 2001: L. rendell & H. white-head, Culture in whales and dolphins. behavioralbrain sciences 24, 2001, 309–382.
reNFrew 2009: J.M. renfrew, Neanderthal symbolic be-havior? In: C. renfrew & I. Morley (Hrsg.), becom-ing Human. Innovation in Prehistoric Material andspiritual Culture (Cambridge 2009) 50–60.
rePaCHoLI & MeLtZoFF 2007: b.M. repacholi & a.N.Meltzoff, emotional eavesdropping: Infants selec-tively respond to indirect emotional signals. Childdevelopment 78, 2007, 503–521.
reser 2011: J.e. reser, Conceptualizing the autism spec-trum in terms of Natural selection and behavioralecology: e solitary Forager Hypothesis. evolu-tionary Psychology 9, 2011, 207–238.
bibliographie 127
rICHersoN & boyd 2005: P.J. richerson & r. boyd, Notby genes alone: how culture transformed humanevolution (Chicago 2005)
rIgHtMIre 2004: g.P. rightmire, brain size and en-cephalization in early to Mid-Pleistocene Homo.american Journal of Physical anthropology 124,2004, 109–123.
rILLINg et al. 2002: J.K. rilling, d.a. gutman, t.r. Zeh,g. Pagnoni, g.s. berns & C.d. Cilts, a neural basisfor social cooperation. Neuron 35, 2002, 395–405.
rILLINg et al. 2004: J.K. rilling, a.g. sanfey, J.a. aron-son, L.e. Nystrom & J.d. Cohen, e neural cor-relates of theory of mind within interpersonal inter-actions. Neuroimage 22, 2004, 1694–1703.
rIZZoLattI & CraIgHero 2004: g. rizzolatti & L.Craighero, e Mirror-Neuron system. annual re-view of Neuroscience 27, 2004, 169–192.
rIZZoLattI & sINIgagLIa 2008: g. rizzolatti & C. sini-gaglia, empathie und spiegelneurone. die biologi-sche basis des Mitgefühls (Frankfurt/M. 2008).
rIZZoLattI et al. 2001: g. rizzolatti, L. Fogassi & V.gallese, Neurophysiological mechanisms underly-ing the understanding and imitation of action. Na-ture reviews Neuroscience 2, 2001, 661–670.
robsoN & wood 2008: s.L. robson & b. wood, Ho-minin life history: reconstruction and evolution.Journal of anatomy 212, 2008, 394–425.
roCHat et al. 1997: P. rochat, r. Morgan & M. Carpen-ter, ‘young Infants‘ sensibility to Movement Infor-mation specifying social Causality. Cognitive de-velopment 12, 1997, 537–561.
roCHe et al. 1999: H. roche, a. delagnes, J.P. brugal, C.Feibel, M. Kibunjia, V. Mourre & P.-J. texier, earlyhominid stone tool production and technical skill2.34 Myr ago in west turkana, Kenya. Nature 399,1999, 57–60.
roCHe 1976: J. roche, La découverte de La Chapelle-aux-saints et son influence dans l’évolution des idéesconcernant le psychisme de néanderthaliens. In: b.Vandermeersch (Hrsg.), Les sépultures Néander -thaliennes (Nizza 1976) 12–23.
roebroeKs & VILLa 2011: w. roebroeks & P. Villa, onthe earliest evidence for habitual use of fire in europe. Proceedings of the National academy ofsciences (PNas) early edition (2011) 1–6.
roMbaCH 1980: H. rombach, Phänomenologie des gegen-wärtigen bewusstseins (Freiburg 1980).
rosaNd 2002: d. rosand, drawing acts. studies ingraphic expression and representation (Cam-bridge 2002).
rossLeNbroICH 2007: b. rosslenbroich, autonomiezu-nahme als Modus der Makroevolution (galunder2007).
rossLeNbroICH 2009: b. rosslenbroich, e theory of in-creasing autonomy in evolution: a proposal for un-derstanding macroevolutionary innovations. biol-ogy and Philosophy 24, 2009, 623–644.
sÄÄKsVuorI et al. 2011: L. sääksvuori, t. Mappes & M.Puurtinen, Costly punishment prevails in inter-group conflict. Proceedings of the royal societyearly online edition (2011) 1–9.
sawaguCHI & Kudo 1990: t. sawaguchi & H. Kudo,Neocortical development and social structure in pri-mates. Primates 31, 1990, 283–290.
sCeLINsKIJ & sIroKoV 1999: V.e. scelinskij & V.N. siro -kov, Höhlenmalerei im ural: Kapova und Ignatiev -ka. die altsteinzeitlichen bilderhöhlen im südlichenural (sigmaringen 1999).
sCHILLer 2009: K.L. berghahn (Hrsg.), Friedrich schiller,Über die ästhetische erziehung des Menschensuhrkamp studienbibliothek 16 (Frankfurt/M.2009).
sCHLesIer 2001: K.H. schlesier, More on the ‘Venus‘ Fig-urines. Current anthropology 42, 2001, 410–412
sCHMeLZ et al. 2011: M. schmelz, J. Call & M. toma -sello, Chimpanzees know that others make infer-ences. Proceedings of the National academy of sci-ences (PNas) 108, 2011, 3077–3079.
sCHMId & sCHweIKHard 2009: H.b. schmid & d.P.schweikhard (Hrsg.), Kollektive Intentionalität.eine debatte über die grundlagen des sozialen(Frankfurt/M. 2009).
sCHurZ 2011: g. schurz, evolution in Natur und Kultur.eine einführung in die verallgemeinerte evolution-stheorie (Heidelberg 2011).
sear & MaCe 2008: r. sear & r. Mace, who keeps chil-dren alive? a review of the effects of kin on childsurvival. evolution and Human behavior 29, 2008,1–18.
128 shumon t. Hussain
sear et al. 2000: r. sear, r. Mace & I.a. Mcgregor, Ma-ternal grandmothers improve the nutritional statusand survival of children in rural gambia. Proceed-ings of the royal society 267, 2000, 461–467.
sear et al. 2002: r. sear, F. steele, I.a. Mcgregor & r.Mace, e effects of kin on child mortality in ruralgambia. demography 39, 2002, 43–63.
searLe 1990: J.r. searle, Collective Intentions and ac-tions. In: P.r. Cohen, J. Morgan & M.e. Pollack(Hrsg.), Intentions in Communication (Cambridge1990) 401–415.
searLe 1995: J.r. searle, e Construction of social re-ality (New york 1995).
searLe 2010: J.r. searle, Making the social world. estructure of Human Civilization (oxford 2010).
seraNgeLI & boLus 2008: J. serangeli & M. bolus, outof europe – the dispersal of a successful europeanhominin form. Quartär 55, 2008, 83–98.
seraNgeLI et al. 2012: J. serangeli, u. böhner, H. Hass-mann & N.J. Conard, die pleistozänen Fundstellenvon schöningen – eine einführung. In: K.-e. behre(Hrsg.), die chronologische einordnung der paläo -lithischen Fundstellen von schöningen. Forschun-gen zur urgeschichte aus dem tagebau von schö -ningen 1 (Mainz 2012) 1–22.
sHaroN et al. 2011: g. sharon, N. alperson-afil & N.goren-Inbar, Cultural conservatism and variabilityin the acheulian sequence of gesher benot ya‘aqov.Journal of Human evolution 60, 2011, 387–397.
sHea 2011: J.J. shea, Homo sapiens Is as Homo sapiens was.behavioral Variability versus “behavioral Moder-nity” in Paleolithic archaeology. Current anthro-pology 52, 2011, 1–34.
sHeNNaN 2001: s. shennan, demography and cultural In-novation: a model and its implications for the emer-gence of modern human culture. Cambridge ar-chaeological Journal 11, 2001, 5–16.
sHIPMaN 2008: P. shipman, separating ‘us’ from ‘them’:Neanderthal and modern human behavior. Proceed-ings of the National academy of sciences (PNas)38, 2008, 14241–14242.
sHIPtoN 2010: C. shipton, Imitation and shared Inten-tionality in the acheulean. Cambridge archaeolog-ical Journal 20, 2010, 197–210.
sHuLtZ & duNbar 2010: s. shultz & r.I.M. dunbar,encephalization is not a universal macroevolution-ary phenomenon in mammals but is associated withsociality. Proceedings of the National academy ofsciences (PNas) 107, 2010, 21582–21586.
sIeVeKINg 1987: a. sieveking, engraved Magdalenian Pla-quettes – a regional and stylistic analysis of stone,bone and antler plaquettes from upper Paleolithicsites in France and Cantabric spain (oxford 1987).
sILaNI et al. 2007: r. silani, g. bird, r. brindley, t. singer,C. Firth & u. Firth, Levels of emotional awarenessand autism: an fMrI study. social Neuroscience 3,2007, 97–112
sINger & LaMM 2009: t. singer & C. Lamm, e socialNeuroscience of empathy. annuals of the New yorkacademy of science 1156, 2009, 81–96.
sLIMaK & gIraud 2007: L. slimak & y. giraud, Circula-tions sur plusieurs centaines de kilomètres durant lePaléolithique moyen. Contribution à la connais-sance des sociétés néanderthaliennes. Comptes ren-dus Paleovol 6, 2007, 359–368.
sLIMaK et al. 2011: L. slimak, J.I. svendsen, J. Mangerud,H. Plisson, H.P. Heggen, a. brugère & P.y. Pavlov,Late Mousterian persistence near the arctic Circle.science 332, 2011, 841–844.
sLoterdIJK 2009: P. sloterdijk, du musst dein Leben än-dern: Über anthropotechnik (Frankfurt/M. 2009).
sMItH 2003: e.a. smith, Human cooperation. Perspec-tives from behavioral ecology. In: P. Hammerstein(Hrsg.), genetic and cultural evolution of coopera-tion (Cambridge 2003) 401–427.
sMItH et al. 2007: t.M. smith, M. toussaint, d.J. reid,a.J. olejniczak & J.-J. Hublin, rapid dental devel-opment in a Middle Paleolithic belgian Nean-derthal. Proceedings of the National academy ofscience (PNas) 104, 2007, 20220–20225.
sMItH et al. 2010: t.M. smith, P. tafforeau, d.J. reid, J.Pouech, V. Lazzari, J.P. Zermeno, d. guatelli-stein-berg, a.J. olejniczak, a. Hoffmann, J. radovcic,M. Makaremi, M. toussaint, C. stringer & J.-J.Hublin, dental evidence for ontogenetic differencesbetween modern humans and Neanderthals. Pro-ceedings of the National academy of science(PNas) 107, 2010, 20923–20928.
bibliographie 129
soFFer et al. 2000: o. soffer, J.M. adovasio & d.C. Hy-land, e ‘Venus‘ Figurines. textiles, basketry, gender and status in the upper Paleolithic. Currentanthropology 41, 2000, 511–537.
soressI 2004: M. soressi, die steintechnologie des spät-moustérien. Ihre bedeutung für die entstehungs-geschwindigkeit modernen Verhaltens und diebeziehung zwischen modernem Verhalten und bio -logischer Modernität. Mitteilungen der gesell schaftfür urgeschichte 13, 2004, 7–26.
sPIKINs 2009: P. spikins, autism, the Integration of ‘dif-ference‘ and the origins of Modern Human behav-iour. Cambridge archaeological Journal 19, 2009,179–201.
sPIKINs et al. 2010: P. spikins, H. rutherford & a. Need-ham, From Hominity to Humanity: Compassionfrom the earliest archaics to Modern Humans.time & Mind, 2010, 303–325.
steeLe & sHeNNaN 1996: J. steele & s. shennan, Issuesin the reconstruction of hominid social systems. In:J. steele & s. shennan (Hrsg.), e archaeology ofHuman ancestry. Power, sex and tradition (Lon-don und New york 1996) 9–18.
sterN 1985: d. stern, e Interpersonal world of the In-fant (New york 1985).
sterN 1997: d. stern, e first relationship: Mother andInfant (Cambridge 1997).
stINer 2002: M. stiner, Carnivory, coevolution, and thegeographic spread of the genus Homo. Journal of ar-chaeological research 10, 2002, 1–63.
streFFer 2009: w. streffer, Klangsphären. Motive der au-tonomie im gesang der Vögel (stuttgart 2009).
strINger 2002: C. stringer, Modern human origins:progress and prospects. Philosophical transactionsof the royal society 357, 2002, 563–579.
strINger & gaMbLe 1993: C. stringer & C. gamble, Insearch of the Neanderthals: solving a Puzzle ofHuman origins (London 1993).
stueber 2006: K.r. stueber, rediscovering empathy.agency, Folk Psychology and the Human sciences(Cambridge 2006).
sZoMbatHy 1910–1911: J. szombathy, die Venus vonwillendorf (wien 1910–1911).
tartareLLI 2006: g. tartarelli, encephalizations and Cer-bral developments in genus Homo. Human evo-lution 21, 2006, 321–335.
tattersaLL 2004: I. tattersall, what happened in the originof human consciousness. e anatomical record(Part b: New anatomy) 276b, 2004, 19–26.
tattersaLL & sCHwartZ 2009: I. tattersall & J.H.schwartz, evolution of the genus Homo. e an-nual review of earth and Planetary sciences 37,2009, 67–92.
teNNIe et al. 2009. C. tennie, J. Call & M. tomasello,ratcheting up the ratchet: on the evolution of cu-mulative culture. Philosophical transactions of theroyal society 364, 2009, 2405–2415.
texIer et al. 2010: P.-J. texier, g. Porraz, J. Parkington,J.-P. rigaud, C. Poggenpoel, C. Miller, C. tribolo,C. Cartwright, a. Coudeneau, r. Klein, t. steele& C. Verna, a Howiesons Poort tradition of engrav-ing ostrich eggshell containers dated to 60,000 yearsago at diepkloof rock shelter, south africa. Pro-ceedings of the National academy of sciences(PNas) 107, 2010, 6180–6185.
tHIeMe 1997: H. ieme, Lower Paleolithic huntingspears from germany. Nature 385, 1997, 807–810.
tHIeMe 2007: H. ieme (Hrsg.), die schöninger speere.Mensch und Jagd vor 400000 Jahren (stuttgart 2007).
toMaseLLo 1995: M. tomasello, Joint attention as socialcognition. In: C. Moore & P.J. dunham (Hrsg.),Joint attention. Its origin and role in development(Hillsdale 1995) 103–130.
toMaseLLo 1999a: M. tomasello, e Cultural originsof Human Cognition (London 1999).
toMaseLLo 1999b: M. tomasello, e Human adapta-tion for Culture. annual review of anthropology28, 1999, 509–529.
toMaseLLo 2002: M. tomasello, die kulturelle entwicklungdes menschlichen denkens (Frankfurt/M. 2002).
toMaseLLo 2008: M. tomasello, e origins of HumanCommunication (Cambridge 2008).
toMaseLLo 2010: M. tomasello, warum wir kooperieren(berlin 2010).
toMaseLLo & CaMaIoNI 1997: M. tomasello & L. Ca-maioni, a comparison of the gestural communica-tion of apes and human infants. Human develop-ment 40, 1997, 7–24.
130 shumon t. Hussain
toMaseLLo & raKoCZy 2003: M. tomasello & H.rakoczy, what Makes Human Cognition unique?From Individual to shared to Collective Intention-ality. Mind and Language 18, 2003, 121–147.
toMaseLLo et al. 1987: M. tomasello, M. davies-dasilva,L. Camak & K. bard, observational learning of tooluse by young chimpanzees. Human evolution 2,1987, 175–183.
toMaseLLo et al. 2005: M. tomasello, M. Carpenter, J.Call, t. behne & H. Moll, understanding and shar-ing intentions: the origins of cultural cognition. be-havioral brain science 16, 2005, 675–735.
trINKaus 1995: e. trinkaus, Neanderthal Mortality Pat-terns. Journal of archaeological science 22, 1995,121–142.
trINKaus 2007: e. trinkaus, european early modern hu-mans and the fate of the Neanderthals. Proceedingsof the National academy of sciences (PNas) 104,2007, 7367–7372.
trINKaus & tHoMPsoN 1987: e. trinkaus & d.d.ompson, Femoral diaphyseal histomorphometricage determinations for the shanidar 3, 4, 5, 6 Neanderthals and Neanderthal longevity. americanJournal of Physical anthropology 72, 1987, 123–129.
tuNg & KNudsoN 2008: t.a. tung & K.J. Knudson, so-cial Identities and geographical origins of waritrophy Heads from Conchopata, Peru. Current an-thropology 49, 2008, 915–925.
tuoMeLa 1992: r. tuomela, group beliefs. synthese 91,1992, 285–318.
tuoMeLa 1995: r. tuomela, e Importance of us (stan-ford 1995).
tyLor 1958: e.b. tylor, Primitive culture. religion inprimitive culture (New york 1958).
uMILtà et al. 2001: M.a. umiltà, e. Kohler, V. gallese,L. Fogassi, C. Keysers & g. rizzolatti, I know whatyou are doing: a neurophysiological study. Neuron31, 2001, 155–165.
uNderdowN 2004: s. underdown, Freezing, fighting andfalling: an exploitation of trauma causality in theNeanderthals, Fuegians, eskimo and aleut. ameri-can Journal of Physical anthropology 123, 2004,123–198.
urgesI et al. 2006: C. urgesi, V. Moro, M. Candidi &s.M. aglioti, Mapping implied body actions in thehuman motor system. PLos biology 3, 2006,7942–7949.
uZgIrIs 1981: I.C. uzgiris, two functions of imitationduring infancy. International Journal of behavioraldevelopmental 4, 1981, 1–2.
VaLLadas et al. 2001a: H. Valladas, N. Mervier, L. Froget,J.L. Joron, J.L. reyss & t. aubry, tL dating theupper Paleolithic sites of the Côa Valley (Portugal).Quarternary science reviews 20, 2001, 939–943.
VaLLadas et al. 2001b: H. Valladas, N. tisnerat, M.arnold, J. evin & C. oberlin, Les dates fréquenta-tions. In: J. Clottes (Hrsg.), La grotte Chauvet. L’artdes origines (Paris 2001) 32–33.
VaN sCHaIK et al. 2003: C.P. Van schaik, M. ancrenaz,g. borgen, b. galdikas C.d. Knott, I. singleton,a. suzuki, s.s. utami & M. Merril, orangutan cul-tures and the evolution of material culture. science299, 2003, 102–105.
VaNderMeersCH 1965: b. Vandermeersch, Position strati-graphique et chronologique relative des restes hu-mains du Paléolithique du sud-oest de la France.annales de Paléontologie 51, 1965, 69–126.
VaNHaereN & d’errICo 2006: M. Vanhaeren & F. d’er-rico, aurignacian ethno-linguistic geography of eu-rope revealed by personal ornaments. Journal of ar-chaeological science 33, 2006, 1105–1128.
VaNHaereN et al. 2006: M. Vanhaeren, F. d’errico, C.stringer, s.L. James, J.a. todd & H.K. Mienis,Middle Paleolithic shell beads in Israel and algeria.science 312, 2006, 1785–1788.
VareLa 1979: F.J. Varela, Principles of biological auton-omy (New york 1979).
VIsCHer 1873: r. Vischer, Über das optische Formgefühl:ein beitrag zur Ästhetik (Leipzig 1873).
VogeLey et al. 2001: K. Vogeley, P. bussfeld, a. Newen,s. Herrmann, F. Happé, P. Falkai, w. Maier, N.J.shah, g.r. Fink & K. Zilles, Mind-reading: Neu-ral Mechanisms of eory of Mind and self-Per-spective. Neuroimage 14, 2001, 170–181.
VoLaNd 1999: e. Voland, das Verhalten des Menschen.Phänomen Mensch (Leipzig und München 1999).
bibliographie 131
VoLaNd & sÖLINg 2004: e. Voland & C. söling, die evo-lutionäre basis der religiosität in Instinkten –beiträge zu einer evolutionären religionstheorie. In:u. Lüke, J. schnakenberg & g. souvignier (Hrsg.),darwin und gott. das Verhältnis von evolutionund religion (darmstadt 2004) 53–60.
wadLey 2001: L. wadley, what is Cultural Modernity? ageneral View and a south african Perspective fromrose Cottage Cave. Cambridge archaeologicalJournal 11, 2001, 201–221.
weaVer & HubLIN 2009: t.d. weaver & J.-J. Hublin, Ne-andertal birth canal shape and the evolution of humanchild-birth. Proceedings of the National academy ofsciences (PNas) 106, 2009, 8151–8156.
waLtHer 1923: g. walther, Zur ontologie der sozialengemeinschaften. In: e. Husserl (Hrsg.), Jahrbuchfür Philosophie und phänomenologische Forschung(Halle 1923) 1–158.
warburg 1999: a. warburg, e renewal of Pagan an-tiquity (Los angeles 1999).
warNeKeN et al. 2006: F. warneken, F. Chen & M.tomasello, Cooperative activities in young childrenand chimpanzees. Child development 77, 2006,640–663.
webster 2000: d. webster, e Not so Peaceful Civiliza-tion: a review of Maya war. Journal of world Pre-history 14, 2000, 65–119.
weINgarteN & CHIsHoLM 2009: C.P. weingarten & J.s.Chisholm, attachment and Cooperation in reli-gious groups. an example of a Mechanism of Cul-tural group selection. Current anthropology 6,2009, 759–785.
westerMaNN et al. 2007: g. westermann, d. Mareschal,M.H. Johnson, s. sirois, M.w. spratling & M.s.C.omas, Neuroconstructivism. developmental sci-ence 10, 2007, 75–83.
wHIteN & VaN sCHaIK 2007: a. whiten & C.P. Vanschaik, e evolution of animal ‘cultures’ and socialintelligence. Philosophical transactions of the royalsociety 362, 2007, 603–620.
wHIteN et al. 1999: a. whiten, J. goodall, w.C. Mc-grew, t. Nishida, V. reynolds, y. sugiyama, C.e.g.tutin, r.w. wrangham & C. boesch, Cultures inChimpanzees. Nature 399, 1999, 682–685.
wHIteN et al. 2009a: a. whiten, N. Mcguigan, s. Mar-shall-Pescini & L.M. Hopper, emulation, imitation,over-imitation and the scope of culture for child andchimpanzee. Philosophical transactions of theroyal society 364, 2009, 2417–2428.
wHIteN et al. 2009b: a. whiten, K. schick & N. toth,e evolution and cultural transmission of percus-sive technology: integrating evidence from paleoan-thropology and primatology. Journal of Humanevolution 57, 2009, 420–435.
wIessNer 1977: P. wiessner, Hxaro: a regional systemof reciprocity for reducing risk among the !Kungsan (ann Habour 1977).
wIessNer 1996: P. wiessner, Leveling the hunter. Con-straints on the status quest in foraging societies. In:e. Leacock & r. Lee (Hrsg.), Politics and history inband societies (Cambridge 1996) 61–86.
wIessNer 2002: P. wiessner, Hunting, healing and hxaroexchange. a long-term perspective on !Kung(Ju/’hoansi) large-game hunting. evolution andHuman behavior 23, 2002, 407–436.
wILsoN 2002: d.s. wilson, darwin’s Cathedral (Chicago2002).
wINKINg et al. 2011: J. winking, M. gurven & H. Ka-plan, e Impact of Parents and self-selection onChild survival among the tsimane of bolivia. Cur-rent anthropology 52, 2011, 277–284.
wÖLFFLIN 1886: H. wölfflin, Prolegomena zu einer Psy-chologie der architektur (berlin 1886).
woLLHeIM 1998: r. wollheim, on Pictorial representa-tion. Journal of aesthetics and art Criticism 56,1998, 217–226.
wraNgHaM & CarMody 2010: r. wrangham & r. Car-mody, Human adaptation to the Control of Fire.evolutionary anthropology 19, 2010, 187–199.
wyMaN & raKoCZy 2011: e. wyman & H. rakoczy, so-cial Conventions, Institutions, and Human unique-ness: Lessons from Children and Chimpanzees. In:w. welsch, w. singer & a. wunder (Hrsg.), Inter-disciplinary anthropology (berlin 2011) 131–156.
wyMaN et al. 2009: e. wyman, H. rakoczy & M. toma -sello, young children understand multiple pretendidentities in their object play. british Journal of developmental Psychology 27, 2009, 385–404.
132 shumon t. Hussain
yeLLeN 1998: J.e. yellen, barbed bone points: traditionand continuity in saharan and sub-saharan africa.african archaeological review 15, 1998, 173–198.
yeLLeN et al. 1995: J.e. yellen, a.s. brooks, e. Cornelis-sen, M.J. Mehlmann & K. stewart, a Middle stoneage worked bone industry from Katanda, uppersemliki Valley, Zaire. science 268, 1995, 553–556.
ZeKI 1999: s. Zeki, Inner Vision: an exploration of artsand the brain (oxford 1999).
ZILHão 1997: J. Zilhão, arte rupreste e préhistoria do valedo Côa. trabalhos 1995–1996 (Lissabon 1997).
ZILHão & PettItt 2006: J. Zilhão & P. Pettitt, on the newdates for gorham’s Cave and the late survival of Iber-ian Neanderthals. before Farming 3 (2006) 1–9.