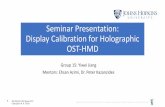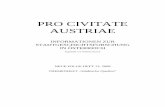Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West – Das Beispiel...
-
Upload
uni-freiburg -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West – Das Beispiel...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Sonderdruck aus
Bal�zs J. Nemes / Achim Rabus (Hg.)
Vermitteln – Übersetzen – Begegnen
Transferphänomene im europäischen Mittelalterund in der Frühen Neuzeit. InterdisziplinäreAnnäherungen
Mit 12 Abbildungen
V&R unipress
ISBN 978-3-89971-821-8
ISBN 978-3-86234-821-3 (E-Book)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Inhalt
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vermitteln
Johanna Kershaw»Der Vater anplicket dich also in der glas miner sel«: John and thetransfer of mystic union in the Puchlein des lebens und der offenbarungswester Elsbethen von Oye of Elsbeth von Oye . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ueli ZahndZwischen Verteidigung, Vermittlung und Adaptation.Sentenzenkommentare des späten Mittelalters und die Frage nach derWirksamkeit der Sakramente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Manuel LorenzBogomilen, Katharer und bosnische ›Christen‹. Der Transfer dualistischerHäresien zwischen Orient und Okzident (11. – 13. Jh.) . . . . . . . . . . . 87
Marion SorgByzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ostund West – Das Beispiel Granat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Übersetzen
Madlen DoerrTransfer einer ›Heiligen‹ vom 15. ins 17. Jahrhundert? Überlegungen zuzwei im 17. Jahrhundert tradierten Typen des Lebens der MagdalenaBeutlerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Werner SchäfkeDeutsche und nordische Zwerge: ein Kulturtransfer? . . . . . . . . . . . 191
David HeydeDie Geburt der Poesie aus dem Geiste der Übersetzung: FrühneuzeitlicheÜbersetzungstheorien und ihr Einfluss auf die Entwicklung desDeutschen als Literatursprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Clara FritzProphaner les Muses. Zum Problem des adäquaten Übersetzens vonDichtung am Beispiel des Orlando Furioso . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Begegnen
Achim RabusWie lateinisch ist das europäische Mittelalter? Ein Beitrag aus derPerspektive der Slavistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Andreas BihrerKonstellationen – Funktionalisierungen – Wirkungen. Ein Plädoyer füreine kommunikationsgeschichtliche Ausweitung desKulturtransferkonzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Inhalt6
Marion Sorg
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handelszwischen Ost und West – Das Beispiel Granat
1. Einleitung
Der vorliegende Aufsatz1 beleuchtet die weitreichenden Handelskontakte zwi-schen Ost und West – in diesem Fall Südasien und Mitteleuropa – und zeigt amBeispiel Granat die Rolle auf, die das Byzantinische Reich bei der Vermittlung,Weitergabe und Verarbeitung des Rohedelsteins und den daraus hergestelltenHalbfabrikaten im Frühmittelalter spielte. Die folgenden Ausführungen fassenden aktuellen Forschungsstand zusammen und beleuchten ihn kritisch.
Das Beispiel des roten Edelsteins Granat eignet sich aus Sicht der Archäologiebesonders gut für einen Beitrag zu »Byzanz« und »Transfer«, weil er Informa-tionen zu diesen Themen gleich auf zwei Ebenen bietet.
Einerseits wurde der Transfer im konkreten, materiellen Sinn, d. h. derHandel, über den ostmediterranen Raum abgewickelt. Der im ganzen mediter-ranen Raum beliebte Edelstein (Freeden 2000: 114) wurde von Indien und SriLanka über das Rote Meer und das östliche Mittelmeer in das Gebiet nördlich derAlpen verhandelt. Ein großer Teil dieser Route lag damals im Herrschaftsbereichdes Byzantinischen Reiches (Drauschke 2005: 40), das als Handelsdrehscheibefungierte.
Andererseits lässt die Stilistik der damit verzierten Objekte, wie beispiels-weise die im frühen Mittelalter beliebten Gewandschließen (Fibeln), auch ideelleTransferleistungen im Bereich des Kunsthandwerks erkennen. Das Byzantini-sche Reich übte einen starken stilistischen Einfluss auf die Gebiete nördlich derAlpen aus (Daim 2000: 80 f. ; Drauschke 2005: 35 ff. , 162 ff. ; Drauschke 2008:370 f.). Es liegen Hinweise auf Werkstätten für die Herstellung von Halbfabri-katen und Granatobjekten im byzantinisch beherrschten Mittelmeergebiet vor.
1 Der vorliegende Aufsatz basiert auf einem Vortrag gleichen Titels, der im Rahmen des Tan-demseminars »Byzanz – das andere Mittelalter« des Freiburger Promotionskollegs »Lern- undLebensräume im Mittelalter« am 4. Juli 2008 gehalten wurde. Er baut auf Ergebnissen auf, dieim Zusammenhang mit meiner Dissertation »Fibelausstattung und Lebensalter in der Me-rowingerzeit« erzielt wurden.
Immer wieder vermutete die archäologische Forschung, dass die qualitativhochwertigsten Schmuckgegenstände des nordalpinen Raumes mediterranenUrsprungs sind, die weniger qualitätvollen Objekte hingegen im Merowinger-reich selbst produziert wurden. Die Ausprägungen und die Intensität diesesWissenstransfers werden jedoch bis heute kontrovers diskutiert. Diesen The-menbereich werde ich im Folgenden aber nur am Rande erörtern.
Granat war nicht das einzige Fernhandelsgut, das seinen Weg über den ost-mediterranen Raum oder aus dem östlichen Mittelmeergebiet selbst in die Ge-biete nördlich der Alpen fand (Drauschke 2005: 39; Kessler 2001: 118 f.; Tomber2008: 54 f.). Auch Gewürze, Rohstoffe, Textilien, sowie exotische Lebensmittelund verschiedene andere Güter wurden ebenso verhandelt (Abb. 1).2 Allerdingsist über die genauen Modalitäten des Warenaustauschs im frühen Mittelalterbislang noch relativ wenig bekannt (Drauschke 2005: 292).Archäologische Belege für Handelsbeziehungen, d. h. den Transfer von Gütern,Menschen und Ideen, zwischen Ost und West gibt es in beide Richtungen.Beispielsweise fanden sich spätantike byzantinische Münzen des 4. bis 6. Jahr-hunderts auf dem indischen Subkontinent (Kessler 2001: 116, 124; Ptak 2007:103; Tomber 2008: 33 ff. ; Vielitz 2003: 19) und belegen somit den Kontaktzwischen dem Byzantinischen Reich und vorzugsweise Südindien und Sri Lankabis in diese Zeit hinein. Keramik verschiedenster Funktion und Herkunft wurdeüber den gesamten Indischen Ozean in alle Richtungen vertrieben (Tomber2008: 38 ff.). So finden sich spätrömische Amphoren auf Grabungen in Indienebenso wie indische Keramik in Ägypten. Aber auch mesopotamische, ostafri-kanische und südarabische Waren gelangten in die Gebiete rund um das Ara-bische Meer. Teilweise erstreckte sich das Handelsnetz weit über den byzanti-nisch beeinflussten Raum hinaus nach Norden. So bezeugen der zeitlich etwasspäter datierende berühmte Buddha von Helgö in Schweden (Gyllensvärd 2004:11, 23 f.; Holmqvist 1961: 112) (Abb. 2) und die in Nordeuropa gefundenenDirhems, arabische Silbermünzen des 9. bis 11. Jahrhunderts, einen regen undweitreichenden Austausch (Ilisch 2002: 326 f.).Vergleichsweise viel ist über den Handel mit Seide bekannt (Müller 2010:bes. 81). Schon in römischer Zeit wurden Seidenstoffe und -gewänder aus Chinanach Europa importiert. Die Handelsroute verlief einerseits über die Seiden-straße durch das Tarimbecken und Baktrien, andererseits über den Seewegdurch das Arabische und das Rote Meer (Tomber 2008: 57) (Abb. 3). Entlang derSeeroute überliefern die Schriftquellen sogar einzelne Häfen und Handelszen-
2 Einige archäologisch nachgewiesene Beispiele: Amethyst, Cypraeen (Tigermuscheln), El-fenbein, Glasperlen, Koptisches Bronzegeschirr, Millefioriperlen, Münzen, Nelken, Pfeffer,Quecksilber, Schwefel, Seide, Soda, Weihrauch, Zimt, wobei besonders Gewürze, Lebensmittelund Textilien aufgrund der Überlieferungsbedingungen schwer zu fassen sind.
Marion Sorg138
tren (Tomber 2008: 20 ff. , bes. 23), die sicherlich auch als Umschlagplätze fürandere Handelsgüter dienten. Der Handel erfolgte nach diesen Quellen inEtappen, chinesische Händler brachten die Ware bis nach Süd- oder Zentral-asien, wo sie von den dortigen Händlern übernommen und weiterverhandeltwurde (Höllmann 2004: 23).
Abb. 1: Häfen und Handelsprodukte nach Kosmas Indikopleustes (aus Roth 1980: 319)
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 139
2. Was ist Granat?
Wenn in der Archäologie auf die roten Steineinlagen der frühmittelalterlichenSchmuckstücke Bezug genommen wird, spricht man meist von Almandin (Ar-rhenius 1998: 583). Dieser ist jedoch eine Unterart von Granat, einer Gruppe vonSilikatmineralien, die sich in mehrere Varianten unterteilt (Fehr et al. 1995: 2;Zang 1995: 20). Je nach Elementzusammensetzung der sogenannten Endgruppehandelt es sich um Almandin, Pyrop, Spessartin, Grossular oder eine andereVarietät3, die optisch kaum voneinander zu unterscheiden sind (Zang 1995: 21).Die einzelnen Granatvarianten treten jedoch selten in Reinform auf, sondern alsMischkristalle unterschiedlicher Kombinationen miteinander. Die Benennungerfolgt anhand der am häufigsten enthaltenen Endgruppe (Calligaro 2007: 115 f. ;Greiff 1998, 605; Quast & Schüssler 2000: 77; Zang 1995: 20). Da im frühen
Abb. 2: Der Buddha von Helgö (aus Gyllensvärd 2004: 11)
3 Allen Varianten dieser Silikatmineralien liegt die chemische Formel [SiO4]3X zu Grunde. Jenach Variante unterscheidet sich die Endgruppe X. Beim eisenreichen Almandin handelt essich um Fe3Al2. Pyrop hingegen ist reich an Magnesium, seine chemische Formel lautetentsprechend Mg3Al2[SiO4]3 (Zang 1995: 20 f.).
Marion Sorg140
Abb. 3: Die Routen der Seidenstraße (aus Liu & Shaffer 2007: 20)
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 141
Mittelalter nicht nur die Varietät Almandin als Schmuckstein verwendet wurde,müsste man deshalb richtigerweise von Granat und nicht von Almandin spre-chen. Ganz korrekt wäre die Bezeichnung roter Granat, denn es kommen auchandere Farbvarietäten vor, die im Frühmittelalter aber nicht verwendet wurden.Granat ist ein auf der ganzen Welt vorkommendes Mineral (Fehr et al. 1995: 2),das aber in Edelsteinqualität selten ist (Quast & Schüssler 2000: 77; Zang 1995:41). Dies gilt besonders für den im Frühmittelalter verwendeten spaltbarenGranat (Arrhenius 1998: 584).
Den zeitgenössischen Schriftquellen zufolge beutete man in der Antike undSpätantike Lagerstätten in Ägypten, Äthiopien, Westanatolien, Indien, Pakistanund Sri Lanka aus (Cosmas Indikopleustes, Buch XI – Sur l’�le de Taprobane,Absatz 16; Isidorus Hispalensis, Buch XVI – Von Steinen und Metallen, KapitelXIV – Von den Feurigen; Plinius Secundus, Buch XXXVII – Steine: Edelsteine,Gemmen, Bernstein, Kapitel XXV; Theophrastus, Absatz 18). Plinius der Ältereüberlieferte (Plinius Secundus, Buch XXXVII – Steine: Edelsteine, Gemmen,Bernstein, Kapitel XXV), dass der Name Almandin (oder Alabandin) von derStadt Alabanda (Abb. 4), dem heutigen Araphisar in der türkischen ProvinzAydın (Greiff 1998: 601; Quast & Schüssler 2000: 76; Roth 1980: 318), herzuleitensei, in der man den Edelstein verarbeitet habe. Dies deutet auf eine besondereBedeutung des ostmediterranen Raumes für die Granatverarbeitung hin, dennAlabanda lag während der hier interessierenden Zeitspanne im byzantinischenMachtbereich.
Da die einzelnen antiken Autoren teilweise verschiedene Bezeichnungenverwendeten, stellt die Zuordnung der in den Quellen genannten Edelsteine einProblem dar, da sich die Begriffe nicht unbedingt auf Granat beziehen müssen.Möglicherweise bezeichnete man damit auch andere Edelsteine, die optischnicht von Granat zu unterscheiden sind. Ob es sich um synonym verwendeteBegriffe handelte, die sich ganz allgemein auf rote Edelsteine bezogen, oder obdamit eine Unterscheidung getroffen wurde, lässt sich heute nicht mehr klären.
So sprach Theophrast im 4. Jahrhundert vor Chr. von Anthrax oder An-thrakion (Theophrastus, Absatz 18). Die von ihm erwähnten Vorkommen ent-sprechen aber nur bedingt realen Abbaugebieten von Granat. Indien beispiels-weise wird bei ihm nicht erwähnt.
Plinius d. Ä. im ersten nachchristlichen Jahrhundert zitierte einige ältereAutoren wie Theophrast, bezeichnete den Edelstein aber als Carbunculus (Pli-nius Secundus, Buch XXXVII – Steine: Edelsteine, Gemmen, Bernstein, KapitelXXV) (Abb. 4). Er unterschied zwei Gruppen, den indischen und den gara-mantischen Carbunculus, der von den Griechen Carchedonia genannt werde.Zur zweiten Gruppe zähle auch der äthiopische und alabandische Granat, der inAlabanda verarbeitet werde, aber aus dem in der Nähe liegenden Orthosia
Marion Sorg142
stamme (Plinius Secundus, Buch XXXVII – Steine: Edelsteine, Gemmen,Bernstein, Kapitel XXV).
Kosmas Indikopleustes war um die Mitte des 6. Jahrhunderts ägyptischerHändler auf der Seeroute nach Indien und Sri Lanka (Pigulewskaja 1969: 111 ff.).Später trat er in Alexandria in ein Kloster ein und schrieb dort seinen Reise-bericht, die Christliche Topographie (Cosmas Indikopleustes, Buch XI – Sur l’�lede Taprobane, Absatz 16). In diesem Werk erwähnte er einzelne Handelszentrenin Indien und Sri Lanka und nannte die Güter, die von diesen Orten aus ver-handelt wurden. Der Export von Alabandenum erfolgte demnach von Kaber aus
Abb. 4: Fundorte des Granats nach Plinius (aus Roth 1980: 318)
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 143
(Cosmas Indikopleustes, Buch XI – Sur l’�le de Taprobane, Absatz 16), hierbeihandelt es sich um das im heutigen Bundesstaat Tamil Nadu gelegene südost-indische Kaveripattanam4 (Roth 1980: 318) (Abb. 1).
Isidor von Sevilla schrieb im 7. Jahrhundert in seiner Enzyklopädie unteranderem von Alabandina, das nach der Region Alabanda benannt sei (IsidorusHispalensis, Buch XVI – Von Steinen und Metallen, Kapitel XIV – Von denFeurigen). In seinem Kapitel »De ignitis« beschrieb er weitere Edelsteine, dieebenfalls als Granat angesprochen werden können. Er nannte sowohl die be-kannten Bezeichnungen Carbunculus, Anthrax und Carchedonia als auch neueBenennungen wie beispielsweise Sandasirus, der aus Indien stamme und in dem»goldene Tropfen« schimmerten (Isidorus Hispalensis, Buch XVI – Von Steinenund Metallen, Kapitel XIV – Von den Feurigen). Hierbei könnte es sich umSterngranat handeln, der sowohl in Indien und Sri Lanka aber auch in Tansaniavorkommt (Siehe hierzu Fehr et al. 1995: 16).
Insgesamt zeigt sich bei allen (spät)antiken Autoren eine unklare Zuordnungder verwendeten Begriffe Anthrax, Carbunculus und Alabandenum zu den heutedefinierten Mineralien. Wie bereits angedeutet, könnte es sich deshalb bei den inden Schriftquellen erwähnten Namen nicht nur um Granat handeln, sondernauch um Rubin, Achat und andere Edelsteine (Greiff 1995: 66; Greiff 1998: 600),die erst mit modernen naturwissenschaftlichen Methoden voneinander abzu-grenzen sind oder deren Unterscheidung in der Spätantike nicht von Bedeutungwar. Auch die erwähnten Vorkommen sind problematisch, denn es handelt sichdabei nur teilweise um tatsächliche Granatlagerstätten; oft sind mit den ge-nannten Orten auch die zentralen Seehandelsorte oder Steinbearbeitungszen-tren jener Zeit aufgeführt (Greiff 1995: 67; Greiff 1998: 601; Kory & Steiniger2001: 275).
Auch archäologische Quellen belegen den Handel mit Granat. So zeigennordindische Granate aus sri-lankischen Handelsstädten (Kessler 2001: 123 f. ;Schüssler et al. 2001: 240 f.), dass auch innerhalb des indischen Subkontinentsmit dem Edelstein gehandelt und der Vertrieb wohl über zentrale Orte abge-wickelt wurde (Kessler 2001: 124). Rohgranate bzw. Halbfabrikate fanden sichbeispielsweise in Paviken auf Gotland (Lundström 1973: 70), wo große Mengenin einem begrenzten Grabungsareal gefundener Rohgranate eine Werkstatt oderein Warenlager vermuten ließen (Lundström 1973: 76), in der Crypta Balbi inRom (Manacorda & Zanini 1989: 30; Ricci 2001: 338; Serlorenzi 2003: 207 f.),deren Funde Hinweise auf eine in der Nähe gelegene Werkstatt lieferten, und ineinem Hort aus Karthago, der als Handwerkerdepot angesprochen wurde(Haevernick 1973: 553). Der bekannte Karthago-Hort ist in seiner Ansprachejedoch unsicher. Einerseits ist nicht zu klären, ob Karthago mit seiner großen
4 Häufig auch Kaveripattinam geschrieben.
Marion Sorg144
Bedeutung für den Orienthandel (Pirenne 1987: 31) allein Handelsposten oderzusätzlich auch Verarbeitungsort des Granats war, wie Thea Elisabeth Haever-nick annimmt (Haevernick 1973: 553). Dies ist aber eher von nebensächlicherBedeutung, entscheidender ist die Frage nach der Geschlossenheit des Horts,denn manche Forscher gehen davon aus, dass nicht alle Stücke aus dem 5. und6. Jahrhundert stammen, sondern dass auch neuzeitliche Stücke darunter sind(Drauschke 2005: 45), wie Thomas Calligaro et al. jetzt nachweisen konnten(2009: 156 f. , 164). Zudem sind die Fundumstände des Hortes nicht überliefert,was eine Zusammengehörigkeit der Granatplättchen in Frage stellt (Haas-Gebhard & Looz 2009: 583). Sollten diese Kritikpunkte zutreffen, wäre der Hortaus Karthago nur noch eingeschränkt zur Rekonstruktion von Handelsroutenund möglichen Verarbeitungszentren von Granat im Frühmittelalter heranzu-ziehen.
3. Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Herkunfts-bestimmung des Granats
Um die Herkunft des Granats und die im Frühmittelalter ausgebeuteten La-gerstätten zu bestimmen und damit mehr über die Verarbeitung und den Handelmit dem Edelstein zu erfahren, führten mehrere Forschergruppen naturwis-senschaftliche Untersuchungen durch (Arrhenius 1985; Calligaro et al. 2007;Farges 1998; Gilg et al. 2010; Greiff 1998; Quast & Schüssler 2000; Roy & Van-haeke 1997). Hierbei ermittelte man mit verschiedenen Verfahren5 die einzelnenchemischen Elemente und Spurenelemente der Proben (Abb. 5). Zusätzlichspielten die Ergebnisse aus optischen, geologischen und mineralogischen Un-tersuchungen für die Lagerstättenbestimmung eine Rolle.
Bislang ist es nicht möglich, die einzelnen Varietäten anhand charakteristi-scher Elementzusammensetzungen bestimmten Lagerstätten zuzuordnen, eszeigen sich aber Schwerpunkte in der Verbreitung, die eine regionale Eingren-zung erlauben. Die Zuordnung erfolgt über Gemeinsamkeiten zwischen La-gerstätte und untersuchtem Granat in der Varianten-Verteilung der Mischkris-talle (Quast & Schüssler 2000: 77), der chemischen Zusammensetzung, denEinschlüssen (Calligaro et al. 2007: 116) sowie dem Alter der Muttergesteine undEinschlüsse (Calligaro et al. 2007: 123 ff.).
Anhand der chemischen Charakterisierung ließen sich bereits bei älteren
5 RFA (Röntgenfluoreszenzanalyse), PIXE (Partikel-induzierte Röntgenemission), XRD(Röntgendiffraktion), SEM-EDX (Energiedispersive Röntgenspektroskopie mithilfe einesRasterelektronenmikroskops). Eine gute Beschreibung der einzelnen Analyseverfahren findetsich bei Schreiner et al. (2000: 288 ff.).
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 145
Analysen zwei geographisch und zeitlich voneinander abgrenzbare Haupt-gruppen bilden, die von einigen Nebengruppen ergänzt werden. Eine derHauptgruppen wurde vor allem im 5. und 6. Jahrhundert verwendet und istidentisch mit Referenzproben aus Indien und Sri Lanka (Abb. 6). Die zweite, im7. und 8. Jahrhundert genutzte Gruppe entspricht der Zusammensetzung heuteabgebauter böhmischer Granatvorkommen (Calligaro et al. 2007: 128; Farges1998: 327 ff. ; Gilg et al. 2010: 97, 99 f. ; Greiff 1998: 614, 621, 624 f. ; Quast &Schüssler 2000: 83 – 87; Roy & Vanhaeke 1997: 131 f.).
Eine neuere Analyse des Mus�e d’Arch�ologie Nationale in Paris ermitteltezusätzlich anhand von Einschlüssen das Alter der Granate (Calligaro et al. 2007:123 ff.). Dieses konnte mit dem Alter der in Frage kommenden Muttergesteineverglichen werden und ermöglichte so eine genauere Eingrenzung und Auf-schlüsselung der möglichen Lagerstätten in fünf Gruppen (Calligaro et al. 2007:125 ff.) (Abb. 7). Weiterhin zeigte sich, dass Granate aus Südasien nie gemeinsammit böhmischen Granaten auf den gleichen Objekten anzutreffen sind (Calligaroet al. 2007: 127). Auch eine Herkunft der Granate aus afrikanischen Vorkommenwollten die Pariser Bearbeiter nicht ausschließen, da Ostafrika zur Entste-hungszeit der indischen Granate mit der Indischen Platte zusammenhing unddamit das gleiche Alter hat sowie ein sehr ähnliches geologisches und chemi-
Abb. 5: Die Scheibenfibeln der Arnegunde während der Analyse (aus Calligaro et al. 2007: 129)
Marion Sorg146
sches Profil besitzen müsste (Calligaro et al. 2007: 125). Eine Überprüfungscheiterte damals an den fehlenden Referenzproben aus Afrika, das aber schonPlinius als Herkunftsregion erwähnte (Plinius Secundus, Buch XXXVII – Steine:Edelsteine, Gemmen, Bernstein, Kapitel XXV) (Abb. 4).
Die aktuellsten Untersuchungen (Gilg et al. 2010) des Mus�e d’Arch�ologieNationale gemeinsam mit der Archäologischen Staatssammlung München amCentre de Recherche et de Restauration des Mus�es de France unter der Leitungvon Thomas Calligar�, Patrick P�rin und Brigitte Haas-Gebhard erbrachten
Abb. 6: Fundlokalitäten der Referenzgranate in Südasien (aus Greiff 1998: 612)
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 147
jüngst den Beleg, dass wohl auch aus Afrika, genauer gesagt Nigeria, Granate(Pyrop) während der Merowingerzeit nach Europa gelangten (Gilg et al. 2010:98). Möglich seien auch Pyrop-Vorkommen in Portugal, die zusammen mit dennigerianischen Lagerstätten mit den bei Plinius genannten lusitanischen undgaramantischen Granaten übereinstimmen könnten (Gilg et al 2010: 98). Zu denAlmandinlagerstätten im südlichen Indien, Sri Lanka, aber auch in Ostafrikaund Madagaskar konnten die gemessenen Proben noch nicht genauer zuge-ordnet werden, da noch nicht zu jeder Provenienz Referenzproben vorliegen(Gilg et al. 2010: 98). Auch in Rajasthan sind noch nicht alle Lagerstätten be-probt, dort scheint sich aber dennoch eine eigenständige Gruppe von den üb-rigen südasiatischen Vorkommen abzugrenzen (Gilg et al. 2010: 99).
Die im skandinavischen Raum verwendeten Granate stimmen nach Unter-suchungen von Johan Löfgren (1973: 83, 88) sowie Hans Albert Gilg et al. (2010:99) perfekt mit Lagerstätten in Sjönevad, Schweden überein. Diese Granatvor-kommen wurden offenbar nur in Schweden und Dänemark verwendet und nichtin andere Regionen exportiert. Ebenso importierte man keinen Granat aus an-deren Regionen nach Skandinavien.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der im 5. und 6. Jahrhundert inMitteleuropa verwendete Granat der Almandin-Gruppe überwiegend aus Indienund Sri Lanka kam, die im 7. Jahrhundert ausgebeuteten Vorkommen an Py-ropen dagegen hauptsächlich in Böhmen lagen (Abb. 7). Die Handelswege fürden südasiatischen Granat führten sehr wahrscheinlich auf dem Seeweg über die
Abb. 7: Die zeitliche Abfolge der Granattypen (aus Calligaro et al. 2007: 132).Typ I aus Rajasthan, Typ II von der Ostküste Indiens, Typ III aus Sri Lanka, Typ IV ist unklar(sicher nicht Böhmen, vielleicht Nordostindien), Typ V aus Böhmen.
Marion Sorg148
Arabische Halbinsel und das Rote Meer in den ostmediterranen Raum und dannweiter in das Gebiet nördlich der Alpen (Abb. 3).
4. Die Verarbeitung des Granats im Frühmittelalter
Aufgrund archäologischer bzw. literarischer Hinweise nimmt die Forschung fürmehrere Orte eine Weiterverarbeitung des Rohgranats oder eine Werkstatt zurHerstellung von granatverzierten Objekten an.
Zu den möglichen Verarbeitungsorten gehört das oben genannte Karthago,das beispielsweise Helmut Roth und Kathrin Vielitz (Roth 1980: 310, 323, 330;Vielitz 2003: 20) aufgrund des erwähnten Granat-Hortfundes als Verarbei-tungsplatz interpretieren. Einen sicheren Beleg für eine Weiterverarbeitung vonGranat in Karthago gibt es aber nicht, zudem ist der für die Ansprache ent-scheidende Hort unsicheren Ursprungs. Als eventuelles Verarbeitungszentrumdiskutiert man ferner die bereits erwähnten Fundorte Crypta Balbi, die einigeArchäologen als edelsteinverarbeitendes Atelier sehen (Drauschke 2005: 45;Manacorda & Zanini 1989: 30; Serlorenzi 2003: 207 f.; Ricci 2001: 331) undPaviken, das Per Lundström als Feinschmiedewerkstatt deutet (Lundström1973: 76 f.), eine Überlegung, der sich auch Vielitz anschließt (Vielitz 2003: 20).
Hinzu kommt das indische Kaveripattanam, bei dem es sich jedoch wahr-scheinlicher um einen Handelsplatz handelt (Tomber 2008: 138). Schon beiKosmas Indikopleustes ist es als Handels- und nicht als Verarbeitungszentrumerwähnt (Cosmas Indikopleustes, Buch XI – Sur l’�le de Taprobane, Absatz 16),worauf auch die für indische Hafenstädte typische Endung »-pattana« hinweist(Kessler 2001: 118, 120). Bisher erbrachten die Grabungen vor Ort keinenHinweis auf eine Weiterverarbeitung von Granat (Roth 1980: 318).
Das von Plinius erwähnte Alabanda (Plinius Secundus, Buch XXXVII –Steine: Edelsteine, Gemmen, Bernstein, Kapitel XXV) wird von ihm als Verar-beitungszentrum beschrieben, in dem die in Orthosia abgebauten Rohgranatevor dem Weitertransport in die gewünschten Formen geschliffen wurden (Kory& Steiniger 2001: 275). Allerdings gibt es bisher keinerlei archäologische Hin-weise auf eine granatverarbeitende Werkstatt in Alabanda.
Alle genannten Orte – die hier nur beispielhaft für eine größere Zahl mög-licher Verarbeitungsorte stehen – sind insofern mit gewissen Unsicherheitenbehaftet, da sie zwar in den Schriftquellen als Herstellungs- oder Verarbei-tungszentrum erwähnt wurden oder es Funde von Rohsteinen und Halbfabri-katen (Plättchen) von dort gibt; einen konkreten Hinweis auf eine granatver-arbeitende Werkstatt erbrachte aber keine dieser Fundstellen. Dies ist jedoch eingrundlegendes Problem, denn es ist nur unter äußerst günstigen Vorausset-zungen möglich, eine Werkstatt archäologisch so sicher nachzuweisen, dass man
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 149
sie als eindeutigen Beleg heranziehen könnte. Selbst von der Crypta Balbi mitihren vielen Werkzeugen, Herstellungsresten und Halbfabrikaten fehlt einkonkreter Nachweis, denn das bisher untersuchte Grabungsareal erfasste denAbfallbereich und nicht die eigentliche Werkstatt (Serlorenzi 2003: 207). Esbleibt also abzuwarten, ob in Zukunft ein sicherer Beleg für eine granatverar-beitende Werkstatt erbracht werden kann.
Wo genau die Granatplättchen geschliffen wurden – an oder in der Nähe derLagerstätte, im ostmediterranen Raum, der selbst ein großes Absatzgebietdarstellte oder in Europa –, lässt sich momentan nicht klären. Alle Möglichkeitensind durchaus plausibel, sichere Hinweise in die eine oder andere Richtung gibtes aber nicht. Für eine Herstellung der Plättchen bei den Lagerstätten spräche,dass damit weniger taubes Material transportiert werden müsste, da das un-brauchbare Rohmaterial schon vor Ort aussortiert würde. Das Schleifen vonGranat verlangt spezialisiertes Fachwissen, deshalb argumentieren einige Wis-senschaftler (Amrein & Binder 1997: 366; Arrhenius 1985: 124, 194; Drauschke2005: 45, 293; Haas-Gebhard & Looz 2009: 583; Koch 1987: 344; Quast &Schüssler 2000: 92; Steuer 1997: 395 ff. ; Steuer 1999: 550), dass dieses nur in denzentralen Orten Ostroms wie der Hauptstadt Konstantinopel verfügbar war. EineHerstellung von Granatplättchen sei somit nur an wenigen Orten im ostmedi-terranen Raum möglich gewesen. Dagegen spricht aber nach Ansicht von Vielitz(2003: 20) die häufig zu beobachtende hervorragende farbliche Übereinstim-mung und das lückenlose Zusammenpassen der Granatplättchen auf den ein-zelnen damit verzierten Objekten. Eine so gute optische und flächige Passung seinur dann zu erreichen, wenn die Plättchen direkt bei der Herstellung des Objektsentsprechend zusammengestellt und zugeschliffen worden wären. Dies sprechefür Werkstätten direkt im fränkischen Kernland (Vielitz 2000: 442), wobei injedem Fall nur wenige Handwerker das Wissen um die richtige Handhabung derGranate besaßen (Vielitz 2000: 442; Vielitz 2003: 20).
5. Die Verwendung von Granat in der Merowingerzeit– Cloisonné
Vom 5. bis ins 7. Jahrhundert hinein wurden im gesamten mittel- und osteu-ropäischen Raum Schmuckstücke, aber auch Gebrauchsgegenstände mit dersogenannten Cloisonn�-Technik verziert. Diese über das Merowingerreichhinaus für jene Zeit typische Verzierungstechnik bestand aus einem charakte-ristischen Zusammenspiel von Gold und roten Granatplättchen (Abb. 8).
Marion Sorg150
Hergestellt wurde das Cloisonn� (Arrhenius 1985: 14 ff. , 79 ff. ; Vielitz 2003:15 – 26), indem auf eine meist eiserne Grundplatte Stege aus Goldblech gelötetwurden. Die entstandenen Kästchen wurden mit einer Kittmasse aufgefüllt, diemit einer gewaffelten Goldfolie abgedeckt wurde, auf der wiederum die Gra-natplättchen zu liegen kamen. Abschließend wurden die Goldstege flachge-klopft, wodurch eine ebene Oberfläche entstand und das überstehende Materialder Stege für einen besseren Halt der Plättchen sorgte. Durch die Strukturierungder Goldfolie wurde das Licht stärker reflektiert, was den Glanz der Granateverstärkte (Abb. 9). Anhand der Zusammensetzung der Kittmasse versuchteBirgit Arrhenius Werkstattkreise abzugrenzen (Arrhenius 1985: 100 ff. , 127 ff. ,162 ff.). Diese Idee wurde aber von der nachfolgenden Forschung nicht weiteraufgegriffen. Vielitz (2003: 26) riet zur Vorsicht, da die Verbreitung der ver-schiedenen Kittvarianten ein zu unklares Bild ergebe und keine sicheren Aus-sagen möglich seien.Die Herkunft des Cloisonn�-Stils ist seit dem Beginn der Forschung im19. Jahrhundert umstritten, bis heute hat sich keine der vertretenen Ansichtendurchgesetzt. Es handelt sich bei diesem Thema um ein weites und sehr kon-troverses Feld, auf das ich in diesem Rahmen nicht weiter eingehen kann.Grundsätzlich geht es darum, ob das Cloisonn� eine spätrömische Technik ist,die sich aus spätantiken Formen entwickelte (Arrhenius 1969: 47; Drauschke2005: 36, 164; Greiff & Banerjee 1994: 198), in die aber auch weitere Einflüsse,vor allem aus den nordpontischen Gebieten oder dem Sassanidischen Reich,hineinspielen könnten (Adams 2000: 13 ff. , 49; Arrhenius 1984: 30; Arrhenius1985: 14; Gilg et al. 2010: 87 f. ; Greiff 1998: 599; Kazanski & P�rin: 2001, 81 ff. ;
Abb. 8: Granatscheibenfibel aus dem Gräberfeld von Beringen (aus Amrein & Binder 1997: 367)
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 151
Roth 1980: 315; Scukin & Bazan 1994: 244 f.; Scukin & Bazan 1995: 64, 67;Zasetskaya 1999: 344 f).
Alternativ wurde in der älteren Literatur (Koch 1987: 343) eine »barbarische«Entwicklung angenommen, bei der sich der Stil im Osten, konkret im Gebiet umdie Krim und damit ebenfalls im nordpontischen Raum, entwickelt habe und mitden Goten oder Hunnen nach Europa gelangt sei. Diese Ansicht findet sich inaktuelleren Werken zwar noch als eine Möglichkeit erwähnt, sie wird aber nichtmehr ernsthaft vertreten.
Festzuhalten bleibt, dass bei allen geäußerten Theorien der Raum um dasSchwarze Meer als Ursprungsgebiet eine Rolle spielt (Gilg et al. 2010: 87). DieUnterschiede liegen im Einfluss, der dem Oströmischen Reich bei der Ent-wicklung und Produktion des Cloisonn�s zugestanden wird, sowie in der ge-naueren Lokalisierung des Entstehungsgebietes und den stilistischen Traditio-nen, die zur Ausbildung des Cloisonn�-Stils beitrugen.
Grundlegendes Problem dieser teilweise emotional aufgeladenen Diskussionist die Fundverbreitung. Da im byzantinischen Kerngebiet den Toten üblicher-weise keine Beigaben mitgegeben wurden, finden sich dort nur vereinzelt Ob-jekte mit Cloisonn�. Dieser geringe Fundniederschlag steht im deutlichen Ge-gensatz zu Ost- und Mitteleuropa, von wo dank umfangreicher Grabausstat-tungen zahlreiche Objekte in Cloisonn�-Technik bekannt sind (Adams 2000:13 f. ; Drauschke 2005: 162, 169). Dieses Verbreitungsbild entspricht aber nichtdem tatsächlichen Vorkommen und den Verbreitungsschwerpunkten zur da-maligen Zeit, sondern spiegelt vor allem das Beigabenverhalten in den einzelnenRegionen wider (Drauschke 2008: 372, 374).
Für eine Herleitung aus dem byzantinischen Kulturraum und der Ansprachedes Cloisonn�s als ein spätrömisches Phänomen spräche einerseits das Fund-
Abb. 9: Schematischer Aufbau einer Cloisonn�fibel (aus Vielitz 2003: 16)
Marion Sorg152
vorkommen auf dem Balkan und in Italien, Regionen, die in jener Zeit zumByzantinischen Reich bzw. dessen unmittelbarem Einflussgebiet gehörten, sowieandererseits die langobardenzeitlichen Funde aus Pannonien, die sich – wie vieleandere Objekte dieser Zeit auch – nachweislich an ostmediterranen Vorbildernorientierten. Insgesamt zeige sich für cloisonnierte Fibeln eine formal einheit-liche Fundregion eines mediterranen Typs (Drauschke 2005: 164), der bis überdie Alpen nach Mitteleuropa vordrang. Die Verwendung christlicher Motivik aufherausragenden Stücken, wie den Scheibenfibeln der Zeit um 500 aus Unter-haching bei München, legt ebenfalls eine Verbindung in den mediterranenRaum nahe, der zu jener Zeit deutlich christlicher geprägt war als der Fundort(Haas-Gebhard 2010: 107 ff.). Für die Unterhachinger Stücke grenzt Haas-Gebhard die Herkunft sogar auf Ober- und Mittelitalien ein; am ehesten kämenaus stilistischen und handwerklichen Gründen Rom und Ravenna als Produk-tionsstätten in Frage (Haas-Gebhard 2010: 109).
6. Das Ende des Handels mit südasiatischen Granaten– das Ende des Cloisonné-Stils?
Für das Ende der Verwendung von südasiatischem Granat in Europa wurdemeist das Abschneiden der Handelswege als Ursache angenommen (Abb. 3). DerLandweg war zu allen Zeiten weniger beliebt als der Seeweg, da er teurer, längerund krisenanfälliger war. Zudem stand die Landverbindung zwischen Indienund dem Mittelmeerraum in jener Zeit in weiten Teilen unter der Herrschaft derSassaniden und später der Araber, die als die größten Widersacher der oströ-mischen Kaiser angesehen werden (Freeden 2000: 115; Kessler 2001: 123; Ptak2007: 105; Roth 1980: 324). Ein Handel des Granats auf diesem Weg wird von denmeisten Wissenschaftlern nicht angenommen.
Der Seeweg über das Rote Meer gilt ab dem späten 6. Jahrhundert ebenfalls alsdurch die Expansion der Sassaniden bzw. Araber beeinträchtigt. Diese Expan-sion über die Arabische Halbinsel hinweg auf den afrikanischen Kontinent unddamit der Wegfall einer längeren Passage byzantinisch kontrollierter Wegstreckezwischen dem Mittelmeer und Südasien sehen viele Forscher als Grund für dasAusbleiben südasiatischer Granate im Mittelmeerraum und in Europa an.
Schon 1937 argumentierte Herta Rupp (1937: 91 ff.) in diese Richtung, als siedie kriegerischen Auseinandersetzungen des Byzantinischen Reiches vor allemmit den Arabern Anfang des 7. Jahrhunderts als Grund für das Ende des Cloi-sonn�s wertete. Dadurch seien sowohl der Seeweg als auch die Karawanen-straßen unterbrochen worden. Des Weiteren wertete sie den Zusammenhangzwischen den Auseinandersetzungen und dem Ende des Cloisonn�s als Beleg für
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 153
die Herkunft der Granate aus Indien, die damals noch nicht mit naturwissen-schaftlichen Methoden nachgewiesen werden konnte.
Uta von Freeden interpretierte im Jahr 2000 (Freeden 2000: 117 f.) denMachtwechsel am Roten Meer vom Byzantinischen Reich zu den SassanidenEnde des 6. Jahrhunderts als Ursache für das Ausbleiben der Granate aus Indienund Sri Lanka (Ebenso: Drauschke 2005: 255; Quast & Schüssler 2000: 88). Eshabe sich um eine ökonomische Konsequenz der neuen Verhältnisse im RotenMeer gehandelt, die sich aber schon seit der Mitte des 6. Jahrhunderts wandelten(Freeden 2000: 119). Die drastische Verknappung der importierten Granat-mengen führte ihrer Meinung dazu, dass nach Ersatz für den Granat gesuchtwurde, indem man ab der Mitte des 6. Jahrhunderts auf andere Techniken wieFiligran und Niello oder engzellige Tauschierungen6 auswich (Freeden, 2000:113, 118 ff.). Modische Gründe für die Abkehr von Granateinlagen lehnte vonFreeden ab, da man für herausragende Fibeln des 7. Jahrhunderts weiterhinCloisonn� verwendet habe (Freeden 2000: 120).
Des Weiteren führt sie an, dass die Byzantiner auch vor den Auseinander-setzungen am Roten Meer im Indischen Ozean keine sonderlich große Rollespielten. Trotzdem sollen die Sassaniden aufgrund der Handelskonkurrenzversucht haben, durch die Eroberung der Arabischen Halbinsel auch den Zwi-schenhandel komplett zu kontrollieren (Freeden 2000: 117). Wenn die Sassa-niden aber den Handel im Indischen Ozean beherrschten, dessen westlicheAnlaufhäfen im Roten Meer und zum Teil an der Küste der Arabischen Halbinsellagen, bestand für sie wenig Anlass, dieses Gebiet zu erobern.
Der 1935 verstorbene Henri Pirenne (Pirenne 1963; Pirenne 1987) hingegenhatte das Ende des Cloisonn�s etwas anders erklärt. Seiner Meinung nach be-dingten die arabischen Eroberungen um die Mitte des 7. Jahrhunderts ein Endedes Mittelmeerraumes als einheitlichen Wirtschaftsraum, wodurch auch dieHandelsströme in den Orient abgebrochen seien (Pirenne 1963: 120, 139, 242;Pirenne 1987: 91 f.). Diese von starken Umbrüchen gekennzeichnete Zeit stelltefür ihn das eigentliche Ende der Antike dar, da diese Phase die seit Jahrhun-derten bestehende Einheit des Mittelmeeres zerstörte (Pirenne 1963: 139). Nichtdas Abschneiden der Handelsrouten durch das Rote Meer nach Südasien son-
6 Filigran: Verzierung durch feine Golddrähte, die auf die Oberfläche ebenfalls goldener Ob-jekte aufgelötet werden.Niello: Legierung aus Silber und Schwefel. Damit werden kleine gepunzte Vertiefungen insilbernen Objekten aufgefüllt, wodurch ein starker Farbkontrast zwischen dem schwarzenNiello und der hellen Farbe des Silbers entsteht. Meist wird durch zwei Reihen gegenständigerDreiecke der Eindruck eines Zick-Zack-Bandes bewirkt.Tauschierung: Findet sich meist bei Objekten aus Eisen. In Vertiefungen werden Messing-und/oder Silberdrähte eingehämmert, die auf dem dunkleren Hintergrund des Eisens einMuster ergeben. Häufig sind die Drähte so angeordnet, dass sich ein Zellen- oder Waben-muster ergibt.
Marion Sorg154
dern die Zersplitterung des Mittelmeeres in verschiedene Machtbereiche stelltefür Pirenne den entscheidenden Faktor für das Ende des Mittelmeerhandels unddamit des Cloisonn�s nördlich der Alpen dar.
Jörg Drauschke (2005: 255 f.) sah die Ursachen für den geringer werdendenAnteil orientalischer bzw. über den Orient verhandelter Waren eher in einerlängerfristigen Entwicklung im Sinne einer »Histoire du longue dur�e«, bei dernicht die Ereignis- oder Personengeschichte entscheidend war, sondern derlangsame Wandel grundlegender Strukturen, die sich zudem vielmehr in Europaund dem Byzantinischen Reich selbst abspielten. Der innere Zerfall des By-zantinischen Reiches könne eher für den Rückgang des Handels verantwortlichsein als die arabischen Eroberungen (Drauschke 2005: 300). Trotzdem sprecheseiner Ansicht nach das plötzliche Ausbleiben des südasiatischen Granats unddie Nutzung von Ersatzmaterialien eher gegen einen Modewandel als Ursache(Drauschke 2005: 255, 291). Denn trotz aller Krisen und Umwandlungen im7. Jahrhundert seien die ökonomischen Strukturen weitgehend intakt erhaltengeblieben, wie sich in den zwar verminderten aber fortdauernden Handelsbe-ziehungen zeige (Drauschke 2005: 300; Drauschke 2008: 415, 417; Roth 1980:324).
Völlig anders als Rupp und von Freeden argumentierte Calligaro 2007, derkeinen Abbruch des Handels zwischen dem Indischen Ozean und dem Mittel-meer am Ende des 6. Jahrhunderts feststellen konnte (Calligaro et al. 2007: 128).Von einem Abbrechen des Fernhandels oder Handelsengpässen durch die Er-oberungen rund um das Rote Meer hätten nicht nur die Granate betroffen seindürfen, sondern auch alle anderen Fernhandelsgüter, was aber nicht der Fall sei(Ebenso: Drauschke 2005: 300; Kessler 2001: 113; Lennartz 2001: 272, 278; Roth1980: 324). Weiterhin argumentierte er, dass die Sassaniden auch schon vor derEroberung Südarabiens den Seehandel mit Indien und Asien beherrschten(Ebenso: Drauschke 2005: 290 f.). Danach müsse sich deshalb nicht unbedingtviel im Fernhandel geändert haben. Die Eroberung Südarabiens habe für dieSassaniden nur einen weiteren tributpflichtigen Vasallen bedeutet, sie hättenkeine direkte Kontrolle über den Handel im Roten Meer ausgeübt (Ebenso:Lennartz 2001: 270). Ein Abbruch des sicher lukrativen Fernhandels sei sehrwahrscheinlich nicht in ihrem Interesse gewesen. Die Ursachen für das Aus-bleiben der südasiatischen Granate und den Wechsel zu böhmischen Granatenmüssten nach Ansicht Calligaros entsprechend woanders zu suchen sein, wobeinoch zu klären sei, ob es sich um geopolitische oder ökonomische Gründegehandelt habe (Calligaro et al. 2007: 112, 137; Gilg et al. 2010: 100). Nachdemdie Quelle für südasiatische Granate versiegt war und nur noch die für dasengzellige Cloisonn� unzureichend geeigneten böhmischen Granate zur Verfü-gung standen, musste zwangsläufig ein Ausweichen auf andere Verzierungs-techniken erfolgen (Calligaro et al. 2007: 112, 128, 137).
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 155
Ähnlich sieht es auch Annette Lennartz; ihrer Ansicht nach zeigen die ara-bischen Quellen zu den Ereignissen am Roten Meer Ende des 6. Jahrhunderts,dass das sassanidische Eingreifen dort nicht der Erlangung oder Festigung einerVormachtstellung und damit einem Schlag gegen den byzantinischen Handeldiente, sondern seine Ursache in den religiösen Konflikten der Region hatte(Lennartz 2001: 270 f.). Somit veranschauliche die Einflussnahme der Sassani-den deren Interesse an einem ungestörten Handel, was sich im weiterhinfriedlichen und guten Verhältnis zwischen Byzanz und Persien zeige (Lennartz2001: 271 f.).
Auch für das 7. Jahrhundert schloss sie eine Handelsunterbrechung aus(Lennartz 2001: 274 f. , 278). Die Kriegshandlungen im Bereich Ägyptens hättenmaximal kurzfristige Störungen und Engpässe verursacht, aber den Fernhandelnicht zum Erliegen gebracht (Lennartz 2001: 275, 278). Lennartz nannte ori-entalische Güter wie Amethyst und Elfenbein, die vermehrt gerade in der Zeitder Eroberungen am Roten Meer und in Ägypten in die Gräber nördlich derAlpen gelangten (Lennartz 2001: 275 f.). Mit einem Abbrechen des Fernhandelslasse sich dies nicht erklären. Sollte jedoch tatsächlich ein Rohstoffengpasshinter dem Lagerstättenwechsel vom indischen Subkontinent nach Böhmenstecken, sei dieser mit Pirennes These vom Abbruch des Mittelmeerhandelsplausibler zu erklären als mit den anderen Theorien (Lennartz 2001: 269). Al-lerdings sei der orientalische Granat durch einen intensiven Abbau in Böhmenrelativ gesehen teurer geworden, was auch ein Grund für den Wechsel gewesensein könne (Lennartz 2001: 277; Gilg et al. 2010: 100).
Unabhängig von einem möglichen Abbrechen des Fernhandels stelle sich lautLennartz die Frage, warum trotz der ab dem 7. Jahrhundert ausgebeutetenVorkommen in Böhmen ein Modewechsel stattfand. Dieser lasse sich durchMaterialmangel nicht schlüssig erklären, denn eine ökonomische Notwenigkeitfür »Ersatzverzierungen« habe nicht bestanden (Lennartz 2001: 270). Dieschlechtere Eignung der böhmischen Granate für engzelliges Cloisonn� scheintihr nicht bekannt gewesen zu sein, wodurch ihre Argumentation in diesemPunkt Schwachstellen aufweist.
Gegen einen Abbruch des Handels aufgrund der Ereignisse um das Rote Meerplädierte auch Roderich Ptak. Er erkannte zwar eine gewisse Konkurrenz zwi-schen dem Roten Meer und dem Persischen Golf an (Ptak 2007: 103, 107), die ab570 n. Chr. zu einer Verminderung des Handels im Roten Meer geführt habe.Abgesehen von dieser Verschiebung sah er jedoch keine Beeinträchtigung desHandels jener Zeit (Ptak 2007: 105). Sein Hauptargument war, dass das Sassa-nidenreich das gesamte Arabische Meer beherrschte und somit ein einheitlicherHandelsraum von Indien bis Afrika bestanden habe, der eine Stabilisierung desSeehandels bewirkte (Ptak 2007: 103 f.). Auch für das Mittelmeer führte er an,
Marion Sorg156
dass das im 7. und 8. Jahrhundert von Afghanistan bis Spanien reichendeHerrschaftsgebiet der Ummayaden eher förderlich als hinderlich für Handel indieser Region gewesen wäre (Ptak 2007: 141).
Auch Dietrich Claude argumentierte, dass für die Araber kein Grund bestand,den Mittelmeerhandel zu beeinträchtigen, sie profitierten im Gegenteil voneinem florierenden Handel (Claude 1985: 271, 280 f.). Der Rückgang des Mit-telmeerhandels sei vielmehr von außen bewirkt worden, wofür er aber eineplausible Erklärung schuldig blieb (Claude 1985: 294). Schon die Konfliktezwischen Byzanz und den Sassaniden hätten seiner Ansicht nach im 5. und6. Jahrhundert Auswirkungen auf den Fernhandel haben müssen (Claude 1985:266), sie kämen demnach ebenso wie die späteren Konflikte mit den Arabern nurbedingt als Auslöser für den abnehmenden Handel im 7. Jahrhundert in Frage.Das Verschwinden mediterraner Importe in Mitteleuropa könne auch durch einverändertes Beigabenverhalten nördlich der Alpen bedingt sein (Claude 1985:305).
Fasst man die Ergebnisse und Aussagen der oben genannten Thesen zu-sammen, lässt sich festhalten, dass die Gründe für das Ende des Cloisonn�s nichtunbedingt in der Ereignis- und Militärgeschichte liegen müssen. Vielmehr kannes sich ebenso um einen Stilwandel handeln, der sich aufgrund von verändertenModevorstellungen vollzog, wie von einigen Autoren diskutiert wurde (Claude1985: 305; Calligaro et al. 2007: 112, 128, 137; Drauschke 2005: 53; Drauschke2008: 415; Lennartz 2001: 270). Die Technik der flächigen Zelleneinlagen ausGranatplättchen hielt sich insgesamt sehr lange und ein Modewechsel nach gut200 Jahren wäre durchaus nicht weiter verwunderlich.
In diese Richtung weist auch eine Anmerkung von Freedens, auch wenn sieselbst völlig anders argumentierte. Sie sah die Tatsache, dass »Cloisonn�arbeitenim eigentlichen Sinn […] nach dem 8. Jahrhundert nur noch im Norden unddem byzantinischen Umkreis hergestellt« (Arrhenius 1984: 32 f.) wurden, alsBeleg dafür an, dass im Fränkischen Reich der Mangel an Rohmaterial und nichtein Modewandel Grund für das Ende des Cloisonn�s war. In Skandinavien und inByzanz habe man weiterhin über Granat verfügt und konnte die Verzierungs-technik weiterführen (Freeden 2000: 122). Diese Argumentation ist jedochmeines Erachtens viel eher ein Hinweis auf einen Modewandel. Denn warumsollte in Mitteleuropa der Nachschub an Granat wegbrechen, wenn im Mittel-meerraum und im Norden weiterhin mit Granat gearbeitet wurde und somitoffensichtlich kein Nachschubproblem bestand? Kontakte von Mitteleuropa inbeide Regionen mit einem regen Warenaustausch sind auch für diese Zeitnachzuweisen, weshalb es keinen plausiblen Grund gibt, der erklären würde,warum ausgerechnet Granat nicht mehr verhandelt wurde. Gegen von FreedensArgumentation spricht besonders der Abbau böhmischer Granate ab dem
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 157
7. Jahrhundert, von einem Mangel an Rohmaterial kann in Mitteleuropa alsonicht die Rede sein.
Sowohl für den Wechsel der Granatvorkommen als auch für das Ende desCloisonn�-Stils wäre auch eine Erklärung ausgehend von der internen Krise desByzantinischen Reiches im 7. Jahrhundert möglich, wodurch Ostrom für Mittel-und Westeuropa als kulturelles Zentrum stark an Bedeutung verlor (Daim 2000:80 f. ; Drauschke 2005: 35 f. , 299 f.; Drauschke 2008: 370). Diese Funktion hattees auch archäologisch nachgewiesen bis in diese Zeit inne, erst im Laufe derKarolingerzeit und danach schwand der Einfluss Byzanz’ auf den Westen nachund nach (Lilie 2005: 11, 60).
Prinzipiell stellt sich zudem die Frage, ob eher kurzfristige Veränderungenund Engpässe, wie sie für das Rote Meer zum Ende des 6. und beginnenden 7.Jahrhunderts aufgrund der Auseinandersetzungen zwischen Byzanz und denSassaniden bzw. Arabern angenommen wurden, überhaupt einen Niederschlagim archäologischen Material finden (Lennartz 2001: 278). In den archäologi-schen Befund spielen viele verschiedene Faktoren hinein, die temporäreSchwankungen in der verfügbaren Menge eines Rohstoffes ausgleichen; einkurzer Engpass ›verschwimmt‹ gewissermaßen im Befund und ist damit ar-chäologisch nicht fassbar.
Falls die Sassaniden oder Araber für den Abbruch des Granathandels ver-antwortlich waren, ließe sich dies archäologisch nicht auseinanderhalten, denndie entsprechenden Ereignisse liegen zu eng beieinander, als dass sie anhandarchäologischer Datierungen erfasst und unterschieden werden könnten. Ganzallgemein hinterfragte Drauschke (2005: 253), ob historische Ereignisse über-haupt in einem sinnvollen Rahmen mit dem Fundniederschlag der entspre-chenden Regionen zu parallelisieren sind und ob sie als Hintergrund für dasVorhandensein und die Intensität der Warenvermittlung herangezogen werdenkönnen.
Als eine bisher nicht berücksichtigte alternative Erklärung für das Ausbleibendes südasiatischen Granats in Mitteleuropa und eine Beeinträchtigung desFernhandels führt Ptak innerindische Konflikte an, die im 7. Jahrhundert in derGegend des heutigen Tamil Nadu ausbrachen (Ptak 2007: 133) (Abb. 6). In TamilNadu liegt auch Kaveripattanam, das bei Kosmas als einer der wichtigstenHandelsorte für Granat beschrieben wird. Ein Zusammenhang zwischen beidenEreignissen könnte durchaus bestehen. Auch der Zusammenbruch des Gupta-reiches in Nordwestindien in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts könnte lautPtak Auswirkungen auf den Granathandel gehabt haben (Ptak 2007: 138). Dasich die dortigen Verhältnisse erst im Laufe der ersten Hälfte des 7. Jahrhundertswieder stabilisierten, könnte die Menge an exportiertem Granat aus Rajasthan(Abb. 6), das zum Guptareich gehörte und als einer der Hauptlieferanten fürspaltbaren Granat gilt, drastisch zurückgegangen sein.
Marion Sorg158
Es kämen also durchaus verschiedene Ereignisse in Südasien selbst als Aus-löser für das Verschwinden des indischen und sri-lankischen Granats in Europain Frage.
7. Schluss
Auch wenn die genauen Mechanismen für das Ende des Cloisonn�s noch nichtsicher identifiziert wurden, können einige Punkte festgehalten werden.
In der Zeit um 600 wurden granatverzierte Fibeln in Mittel- und Westeuropaseltener (Drauschke 2005: 53), was mit dem allgemeinen Rückgang der Beiga-benmenge in Mitteleuropa im Laufe des 7. Jahrhunderts zusammenhängenkönnte (Lennartz 2001: 277). Zusätzlich fällt auf, dass im 7. Jahrhundert dieverwendete Menge Granat je Fibel ebenfalls zurückging (Drauschke 2005: 53),unabhängig von dessen Herkunft.
Gleichzeitig fand ab 600 der Wechsel von indischem und sri-lankischemGranat hin zu böhmischen Vorkommen statt (Calligaro et al. 2007: 128, 132).Südasiatischer Granat scheint nicht mehr beliebt, zu teuer oder nicht mehrverfügbar gewesen zu sein; die Ursache für sein Ausbleiben in Mitteleuropa istmomentan nicht eindeutig zu bestimmen. Der Rückgriff auf böhmischen Granatist aus technischen Gründen wenig nachvollziehbar, da die kleineren und nichtplattig spaltbaren böhmischen Granate für die Technik des klassischen engzel-ligen Cloisonn�s deutlich schlechter geeignet sind als die aus Südasien impor-tierten Steine (Calligaro et al 2007: 128). Das weniger gut geeignete Material, dasim 7. Jahrhundert zur Verfügung stand, könnte zu einer verminderten Ver-wendung des Cloisonn�s und einem Modewechsel beigetragen haben.
Hier scheinen mehrere Phänomene zusammenzuspielen; einerseits die ver-minderten Beigabenzahlen des 7. Jahrhunderts, die sich in weniger Granatob-jekten und weniger verwendetem Granat zeigen. Andererseits das bisher uner-klärte Ausweichen auf Granatvarietäten, die nicht die gewünschten Eigen-schaften besitzen und wohl zwangsläufig einen Wechsel auf andere Materialienund Techniken bedingten, was einen Modewandel noch verstärkte.
Die seltener werdenden importierten Funde in Mitteleuropa könnten nahe-legen, dass der Kontakt zum Mittelmeerraum und dem Byzantinischen Reichabbrach, jedoch handelt es sich nur um eine Verminderung der in den Bodengelangten Objekte. Sowohl die Schriftquellen als auch die einzelnen archäolo-gischen Fundgattungen belegen ein Weiterbestehen der Verbindungen (Drau-schke 2002: 154; Drauschke 2005: 255; Kessler 2001: 113; Roth 1980: 324), auchweit über das Mittelmeer hinaus in den Fernen Orient. Allerdings scheinen derOrienthandel und der Handel unter den Mittelmeeranrainern ab dem 7. Jahr-
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 159
hundert in geringerem Umfang stattgefunden zu haben, als es noch im 5. und6. Jahrhundert der Fall war (Drauschke 2002: 154).
Aus archäologischer Sicht kann folglich nicht so einseitig argumentiertwerden, wie es Pirenne oder von Freeden taten, denn wie beschrieben kamen dieHandelsströme auch im 7. Jahrhundert nicht völlig zum Erliegen (Drauschke2002: 154). Der Fernhandel nach Europa scheint in der Folgezeit jedoch nichtmehr ausschließlich über das Mittelmeer gelaufen zu sein, sondern verlagertesich zusätzlich auf die Ostsee und die osteuropäischen Flüsse (Lennartz 2001:277; Pirenne 1987: 91). Der Ostseeraum entwickelte sich ab dem 8. Jahrhundertzu einem neuen maritimen Wirtschaftszentrum (Pirenne 1963: 140; Pirenne1987: 91), über den in großem Umfang auch orientalische Waren transportiertwurden, wie beispielhaft die eingangs erwähnten arabischen Dirhems und dieBuddhafigur aus Helgö zeigen.
8. Ausblick
Zukünftige Forschungen sollten die Herkunft des Cloisonn�-Stils und in derFolge die stilistischen Zusammenhänge klären, damit aus dieser Richtung fun-dierte Argumente für die Diskussion des Themenfeldes Granat und Cloisonn�vorliegen. Momentan wirkt sich hier die für das byzantinische Kerngebietschlechtere Dokumentations- und Publikationslage noch einschränkend aus(Daim 2000: 80). Trotz des geringeren Fundniederschlags in diesem Gebiet, derdurch das damalige Beigabenverhalten bedingt ist, gibt es Vergleichsfunde ausdem östlichen Mittelmeerraum. Sie sind bislang rar und wenig publiziert, jedocheindeutig vorhanden (Drauschke 2005: 162 f. , 169).
Des Weiteren ist entscheidend, besonders die Granatschleifereien, aber auchdie Goldschmiedewerkstätten sicher zu lokalisieren, da diese ein wichtiger Be-standteil im Netz des Granathandels zwischen Ost und West waren.
Ebenso wichtig wäre es, zu klären, warum der Wechsel zu den böhmischenGranaten stattfand, die – wie erwähnt – für den engzelligen Cloisonn�-Stil des 5.und 6. Jahrhunderts nur sehr begrenzt geeignet sind. Im Normalfall sind dieKristalle der böhmischen Vorkommen zu klein für die Produktion von Plättchenund damit den Einsatz in engzelligem Cloisonn�.
Die Faktoren, die für das Ende des Cloisonn�s in Mitteleuropa eine Rollespielten, bedürfen ebenfalls einer Analyse. Die den besprochenen Thesen zuGrunde liegenden jeweils monokausalen Erklärungsmuster sind sicher nichtausreichend, um das komplexe Gebilde Granat und Cloisonn� umfassend zuerklären.
Marion Sorg160
Auch sollten in Zukunft die historischen und archäologischen Gegebenheitensowohl in den Ursprungsgebieten des Granats als auch entlang der gesamtenHandelsroute mit in die Überlegungen einbezogen werden.
Quellen
Cosmas <Indikopleustes> (1973): Topographie chr�tienne. Hrsg. von Wanda Wolska-Conus. Paris: Les �ditions du Cerf.
Isidorus <Hispalensis> (2008): Die Enzyklopädie des Isidor von Sevilla. Hrsg. von Le-nelotte Möller. Wiesbaden: Marixverlag.
Plinius<Secundus>C. [d. Ä.] (1994): Naturkunde. Hrsg. und übers. von Roderich König.Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Theophrastus (1956): On stones. Hrsg. und übers. von Earle R. Caley und John F. C.Richards. Columbus: The Ohio State University.
Literatur
Adams, No�l (2000): The development of early garnet inlaid ornaments. In: B�lint, Csan�d(Hrsg.): Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.–7. Jahrhundert (VariaArchaeologica Hungarica, Bd. 10). Budapest: Paulus-Publishing, S. 13 – 70.
Amrein, Heidi & Binder, Eugen (1997): Mit Hammer und Zange an Esse und Amboss.Metallgewinnung und Schmiedekunst im frühen Mittelalter. In: Fuchs, Karlheinz(Hrsg.): Die Alamannen. Stuttgart: Theiss, S. 359 – 370.
Arrhenius, Birgit (1969): Zum symbolischen Sinn des Almandin im früheren Mittelalter.In: Frühmittelalterliche Studien, 3, S. 47 – 59.
Arrhenius, Birgit (1973): s.v. Almandin und Almandinhandel. In: Hoops, Johannes(Hrsg.): Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 1. Berlin: de Gruyter,S. 174 – 181.
Arrhenius, Birgit (1984): s.v. Cloisonn�-Technik. In: Hoops, Johannes (Hrsg.): Reallexikonder Germanischen Altertumskunde. Bd. 5. Berlin: de Gruyter, S. 30 – 34.
Arrhenius, Birgit (1985): Merovingian garnet jewellery. Emergence and social implica-tions. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.
Arrhenius, Birgit (1998): s.v. Granat. In: Hoops, Johannes (Hrsg.): Reallexikon der Ger-manischen Altertumskunde. Bd. 12. Berlin: de Gruyter, S. 583 – 589.
Calligaro, Thomas; P�rin, Patrick; Vallet, FranÅoise & Poirot, Jean-Paul (2007): Contri-bution � l’�tude des grenats m�rovingiens (Basilique de Saint-Denis et autres collec-tions du Mus�e d’Arch�ologie nationale, diverses collections publiques et objets defouilles r�centes). Nouvelles analyses gemmologiques et g�ochimiques effectu�es auCentre de recherche et de restauration des Mus�es de France. In: Antiquit�s Nationales,38, S. 111 – 144.
Calligaro, Thomas; P�rin, Patrick & Sudres, Christel (2009): � propos du »tr�sor de
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 161
grenats de Carthage«, attribu� � l’�poque vandale. In: Antiquit�s Nationales, 40,S. 155 – 165.
Claude, Dietrich (Hrsg.): Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühge-schichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa. Teil 2 – Der Handel im westlichen Mit-telmeer während des Frühmittelalters (Abhandlungen der Akademie der Wissen-schaften Göttingen, Phil.-hist. Klasse, 3. Folge, Bd. 144). Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht.
Daim, Falko (2000): »Byzantinische« Gürtelgarnituren des 8. Jahrhunderts. In: Daim,Falko & Andr�si, Jffllia (Hrsg.): Die Awaren am Rand der byzantinischen Welt. Studienzu Diplomatie, Handel und Technologietransfer im Frühmittelalter (Monographien zurFrühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Bd. 7). Innsbruck: Wagner, S. 77 – 204.
Drauschke, Jörg (2002): Funde ostmediterraner/byzantinischer Herkunft im merowin-gerzeitlichen Südwestdeutschland. Magisterarbeit Freiburg 2000 (Prof. D. HeikoSteuer). In: Archäologische Informationen, 25(1/2), S. 151 – 156.
Drauschke, Jörg (2005): Zwischen Handel und Geschenk – Studien zur Distribution vonWaren im östlichen Merowingerreich des 6. und 7. Jahrhunderts anhand orientalischerund lokaler Produkte. Diss. Freiburg (unpubl.).
Drauschke, Jörg (2008): Zur Herkunft und Vermittlung »byzantinischer Importe« derMerowingerzeit in Nordwesteuropa. In: Brather, Sebastian (Hrsg.): Zwischen Spätan-tike und Frühmittelalter. Archäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im Westen (Ergän-zungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 57). Berlin: deGruyter, S. 367 – 423.
Farges, FranÅois (1998): Mineralogy of the Louvres merovingian garnet cloisonn� jewelry :Origins of the gems of the first kings of France. In: American Mineralogist, 83, S. 323 –330.
Fehr, Thomas; Glas, Maximilian & Zang, Joachim (1995): Das extraLapis-Granatwörter-buch. In: Weise, Christian (Hrsg.): Granat. Die Mineralien der Granat-Gruppe: Edel-steine, Schmuck und Laser (ExtraLapis, Bd. 9). München: Christian Weise Verlag, S. 2 –19.
Freeden, Uta von (2000): Das Ende engzelligen Cloisonn�s und die Eroberung Südarabiensdurch die Sassaniden. In: Germania, 78(1), S. 97 – 124.
Gilg, Hans Albert; Gast, Norbert & Calligaro, Thomas (2010): Vom Karfunkelstein. In:Wamser, Ludwig (Hrsg.): Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bayerns Frühzeit(Ausstellungskataloge der Archäologischen Staatssammlung, Bd. 37). Regensburg:Verlag Friedrich Pustet, S. 87 – 100.
Greiff, Susanne (1995): Der Edelstein der Merowinger. In: Weise, Christian (Hrsg.): Gra-nat. Die Mineralien der Granat-Gruppe: Edelsteine, Schmuck und Laser (ExtraLapis,Bd. 9). München: Christian Weise Verlag, S. 66 – 71.
Greiff, Susanne (1998): Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Frage der Rohstoff-quellen für frühmittelalterlichen Almandinschmuck rheinfränkischer Provenienz. In:Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 45(2), S. 599 – 646.
Greiff, Susanne & Banerjee, A. (1994): Zerstörungsfreie Untersuchung von Granat undGlas in frühmittelalterlichen Granatfibeln. Eine Anwendung der Infrarot-Reflexions-spektroskopie. In: Archäologisches Korrespondenzblatt, 24, S. 197 – 205.
Gyllensvärd, Bo (2004): The buddha found at Helgö. In: Clarke, Helen & Lamm, Kristina
Marion Sorg162
(Hrsg.): Excavations at Helgö, 16. Exotic and sacral finds from Helgö. Stockholm:Almqvist & Wiksell International, S. 11 – 27.
Haas-Gebhard, Brigitte (2010): Der Unterhaching-Code. Das Geheimnis der Sachen undBilder. In: Wamser, Ludwig (Hrsg.): Karfunkelstein und Seide. Neue Schätze aus Bay-erns Frühzeit (Ausstellungskataloge der Archäologischen Staatssammlung, Bd. 37).Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, S. 101 – 109.
Haas-Gebhard, Brigitte & Looz, Gabriele von (2009): Neue Beobachtungen an der Bü-gelfibel aus Altenerding Grab 512. In: Archäologisches Korrespondenzblatt, 39, S. 579 –588.
Haevernick, Thea E. (1973): Almandinplättchen. In: Germania, 51, S. 552 – 554.Höllmann, Thomas O. (2004): Die Seidenstraße. München: C. H. Beck.Holmqvist, Wilhelm (1961): Excavations at Helgö 1. Uppsala: Baktryckeri Aktiebolag.Ilisch, Lutz (2002): s.v. Münzwesen, islamisches. In: Hoops, Johannes (Hrsg.): Reallexikon
der Germanischen Altertumskunde. Bd. 20. Berlin: de Gruyter, S. 360 – 364.Kazanski, Michel & P�rin, Patrick (2001): Der polychrome Stil im 5. Jahrhundert. In:
Wieczorek, Alfried & P�rin, Patrick (Hrsg.): Das Gold der Barbarenfürsten. Schätze ausPrunkgräbern des 5. Jahrhunderts n. Chr. zwischen Kaukasus und Gallien. Stuttgart:Theiss, S. 80 – 84.
Kessler, Oliver (2001): Der spätantik-frühmittelalterliche Handel zwischen Europa undAsien und die Bedeutung des Almandins als Fernhandelsgut. In: Pohl, Ernst; Recker,Ude & Theune, Claudia (Hrsg.): Archäologisches Zellwerk. Festschrift für Helmut Roth(Internationale Archäologie: Studia honoraria, Bd. 16). Rahden/Westfalen: Leidorf,S. 113 – 128.
Koch, Ursula (1987): Die Glas- und Edelsteinfunde aus den Plangrabungen 1967 – 1983(Der Runde Berg bei Urach, Bd. 6). Heidelberg: Winter.
Kory, Raimar & Steiniger, Daniel (2001): Gedanken zur sassanidischen Binnen- undHochseeschiffahrt unter besonderer Berücksichtigung des maritimen Nah- undFernhandels. In: Büchner, Daniel & Schüle, Wilhelm (Hrsg.): Studien in memoriamWilhelm Schüle (Internationale Archäologie: Studia honoraria, Bd. 11). Rahden/Westf. : Leidorf, S. 253 – 280.
Lennartz, Annette (2001): Die Rolle Ägyptens im mediterranen Fernhandel vom Ende des6. Jh. bis zu seiner arabischen Eroberung. In: Pohl, Ernst; Recker, Ude & Theune,Claudia (Hrsg.): Archäologisches Zellwerk. Festschrift für Helmut Roth (InternationaleArchäologie: Studia honoraria, Bd. 16). Rahden/Westfalen: Leidorf, S. 267 – 280.
Lilie, Ralph-Johannes (2005): Byzanz. Geschichte des oströmischen Reiches 326 – 1453(Beck’sche Reihe). 4. Aufl. München: Beck.
Liu, Xinru & Shaffer, Lynda N. (2007): Connections across Eurasia. Transportation, com-munication, and cultural exchange on the silk roads. New York: McGraw-Hill.
Löfgren, Johan (1973): Die mineralogische Untersuchung der Granaten von Paviken aufGotland. In: Early Medieval Studies, 6, S. 78 – 96.
Lundström, Per (1973): Die Almandingranaten von Paviken. In: Early Medieval Studies, 6,S. 67 – 77.
Manacorda, Daniele & Zanini, Enrico (1989): The First Millennium A.D. in Rome: Fromthe Porticus Minucia to the Via delle Botteghe Oscure. In: Randsborg, Klavs (Hrsg.):The birth of Europe: archaeology and social development in the first millennium A.D.
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 163
(Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum, Bd. 16). Rom: L’Erma di Bret-schneider, S. 25 – 32.
Müller, Shing (2010): Die Wege der Seide. Der Ost-West-Seidenhandel vom 1. bis zum6. Jahrhundert. In: Wamser, Ludwig (Hrsg.): Karfunkelstein und Seide. Neue Schätzeaus Bayerns Frühzeit (Ausstellungskataloge der Archäologischen Staatssammlung,Bd. 37). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, S. 78 – 86.
Pigulewskaja, Nina (1969): Byzanz auf den Wegen nach Indien: aus der Geschichte desbyzantinischen Handels mit dem Orient vom 4. bis 6. Jahrhundert (Berliner Byzanti-nistische Arbeiten, Bd. 36). Berlin: Akademie-Verlag.
Pirenne, Henri (1963): Mahomet und Karl der Große. Untergang der Antike am Mittelmeerund Aufstieg des germanischen Mittelalters. Frankfurt/Main: Fischer.
Pirenne, Henri (1987): Mohammed und Karl der Große. Die Geburt des Abendlandes.Stuttgart: Belser.
Ptak, Roderich (2007): Die maritime Seidenstraße. Küstenräume, Seefahrt und Handel invorkolonialer Zeit. München: C. H. Beck.
Quast, Dieter & Schüssler, Ulrich (2000): Mineralogische Untersuchungen zur Herkunftder Granate merowingerzeitlicher Cloisonn�arbeiten. In: Germania, 78(1), S. 75 – 96.
Ricci, Marco (2001): Produzioni di lusso a Roma da Giustiniano I (527 – 565) a GiustinianoII (685 – 695): l’atelier della Crypta Balbi e i materiali delle collezioni storice. In: Arena,Maria S. & Museo Nazionale Romano (Hrsg.): Archeologia e storia nel Museo NazionaleRomano, Crypta Balbi (Roma dall’antichit� al medioevo, Bd. 1). Rom: Electra, S. 331 –443.
Roth, Helmut (1980): Almandinhandel und -verarbeitung im Bereich des Mittelmeeres.Zum archäologischen Befund und der schriftlichen Überlieferung in der Spätantikeund im frühen Mittelalter. In: Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Archäo-logie, 2, S. 309 – 335.
Roy, Staf van & Vanhaeke, Lisa (1997): L’origine des grenats � l’�poque m�rovingienne. In:Vie Archeologique, 48, S. 124 – 137.
Rupp, Herta (1937): Die Herkunft der Zelleinlagen und die Almandinscheibenfibeln imRheinland (Rheinische Forschungen zur Vorgeschichte, Bd. 2). Bonn: Ludwig Röhr-scheid Verlag.
Schreiner, Manfred; Schaffer, Andreas; Spindler, Peter ; Dolezel, Peter & Daim, Falko(2000): Materialanalytische Untersuchungen an Metallobjekten möglicher byzantini-scher Provenienz. In: Daim, Falko & Andr�si, Jffllia (Hrsg.): Die Awaren am Rand derbyzantinischen Welt. Studien zu Diplomatie, Handel und Technologietransfer imFrühmittelalter (Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie, Bd. 7).Innsbruck: Wagner, S. 283 – 303.
Schüssler, Ulrich; Rösch, Cordelia & Hock, Rainer (2001): Beads from ancient Sri Lanka –first results of a systematic material anaylsis. In: Weisshaar, Hans-Joachim; Roth,Helmut & Wijeyapala, W. (Hrsg.): Ancient Ruhuna. Sri Lankan-German archaeologicalproject in the southern Province. Volume 1 (Materialien zur Allgemeinen und Ver-gleichenden Archäologie, Bd. 58). Mainz: Philipp von Zabern, S. 227 – 242.
Scukin, Mark & Bazan, Igor (1994): The Cloisonn� Style: danubian, bosphorian, georgianor sassanian? In: Acta Archaeologica, 65, S. 233 – 248.
Scukin, Mark & Bazan, Igor (1995): L’origine du style cloisonn� de l’�poque des grandesmigrations. In: Vallet, FranÅoise & Kazanski, Michel (Hrsg.): La noblesse romaine et les
Marion Sorg164
chefs barbares du IIIe au VIIe si�cle (M�moire / Association FranÅaise d’Arch�ologieM�rovingienne, Bd. 9). Rouen: Association FranÅaise d’Arch�ologie M�rovingienne,S. 63 – 75.
Serlorenzi, Mirella (2003): s.v. Rom. In: Hoops, Johannes (Hrsg.): Reallexikon der Ger-manischen Altertumskunde. Bd. 25. Berlin: de Gruyter, S. 206 – 210.
Steuer, Heiko (1997): Handel und Fernbeziehungen. Tausch, Raub und Geschenk. In:Fuchs, Karlheinz (Hrsg.): Die Alamannen. Stuttgart: Theiss, S. 389 – 402.
Steuer, Heiko (1999): s.v. Handel, § 13. Merowingerzeit. In: Hoops, Johannes (Hrsg.):Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Bd. 13. Berlin: de Gruyter, S. 550 – 552.
Tomber, Roberta (2008): Indo-roman trade. From pots to pepper. London: Duckworth.Vielitz, Kathrin (2000): Die Granatscheibenfibeln der Merowingerzeit. In: Archäologisches
Nachrichtenblatt, 5(4), S. 421 – 423.Vielitz, Kathrin (2003): Die Granatscheibenfibeln der Merowingerzeit (Europe Medi�vale,
Bd. 3). Montagnac: Mergoil.Zang, Joachim (1995): Die Granat-Gruppe. Chemie, Struktur, Eigenschaften. In: Weise,
Christian (Hrsg.): Granat. Die Mineralien der Granat-Gruppe: Edelsteine, Schmuck undLaser (ExtraLapis, Bd. 9). München: Christian Weise Verlag, S. 20 – 47.
Zasetskaya, Irina (1999): Les steppes pontiques � l’�poque hunnique. In: Tejral, Jaroslav ;Pilet, Christian & Kazanski, Michel (Hrsg.): L’Occident romain et l’Europe centrale aud�but de l’�poque des Grandes Migrations (Spisy Archeologick�ho stavu AV CR Brno,Bd. 13). Brno: Archeologicky stav Akademie Ved Cesk� Republiky Brno, S. 341 – 356.
Byzanz als Drehscheibe des merowingerzeitlichen Handels zwischen Ost und West 165