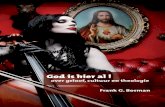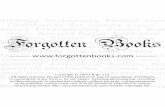Gott Nach Dem Kommunismus - Zur Theologie in Ost(Mittel)Europa - Traditionen und Impulse
Transcript of Gott Nach Dem Kommunismus - Zur Theologie in Ost(Mittel)Europa - Traditionen und Impulse
GOTT NACH DEM KOMMUNISMUS
András Máté-Tóth
Zur Theologie in Ost(Mittel)Europa
Traditionen und Impulse
Szeged
2002
VORTWORT
Als ich nach mehrjähriger Tätigkeit an der Universität Passau 1984 den Lehrstuhl für Pastoral-
theologie und Kerygmatik in Wien übernommen habe, lebten wir in einer Zeit, in der die Theolo-
gen aus der „Ersten Welt“ in die „Dritte Welt“ gefahren sind, um von dort für die Erneuerung
ihrer eigenen Theologie Inspirationen und Impulse zu bekommen. Wien aber hatte in Europa
traditionell eine vermittelnde Rolle gespielt zwischen den damaligen politischen Blöcken West
und Ost und wurde in dieser Zeit von der herausragenden Persönlichkeit des Wiener Erzbischofs
Kardinal Franz König konkretisiert wurde.
So beschloß ich, auch in meiner pastoraltheologischen Arbeit in Wien diese Tradition aufzugrei-
fen. Ich fuhr also – von Kontakten zur Prälatur Infanta auf den Philippinen abgesehen - nicht in
die „Dritte“, sondern in die „Zweite Welt“, um die Entwicklung der Kirche von erster Hand stu-
dieren und miterleben zu können. Aus diesen Reisen – besser gesagt, nicht selten abenteuerlichen
Exkursionen – mit StudentInnen entstanden viele Eindrücke, Kontakte und Einsichten. Die größ-
te Frucht dabei nach der Wende war die Gründung des Pastoralen Forums zur Förderung der
Kirchen in Ost(Mittel)Europa sowie die internationale Forschung AUFBRUCH©.
Die bereits publizierten Bände der neunbändigen Reihe „Gott nach dem Kommunismus“ infor-
mieren über die religiösen und kirchlichen Entwicklungen nach der politischen Wende von
1989/1991 zuerst allgemein zusammenfassend (Band 1-2), dann in Ländergruppen in Details.
Neben diesen Bänden zum quantitativen Studienteil sind schon zwei Bände zum qualitativen
Projekt über die pastoral(theologisch)e Grundsituation, sowie über die praktischen Zentralthemen
der Kirchenentwicklung in diesen Ländern erschienen.
Das Projekt AUFBRUCH© erbrachte aber nicht nur reiche Ergebnisse für die quantitativen und
qualitativen Forschungsteile, sondern schuf ein internationales Netzwerk von FachkollegInnen,
die ein neues Wissen in dieser Region vertreten und im Prozeß der Repositionierung der Kirche
in Ost(Mittel)Europa aus der Theologie her aktiv sind. Der Autor des nunmehr vorgelegten Ban-
des, András Máté-Tóth, verfertigte als Stipendiat des Pastoralen Forums seine Habilitation in
Wien (1996) und koordinierte danach den qualitativen Bereich der Forschung AUFBRUCH© von
seinem Lehrstuhl für Angewandte Religionswissenschaft in Szeged aus – ein Lehrstuhl, an des-
sen Gründung das Pastorale Forum beteiligt war. Ihm gelingt es, mit diesem theologischen Ent-
wurf eine Kairologie und eine Kriteriologie für die Theologie in Ost(Mittel)Europa zur Diskussi-
on zu stellen, die für eine Praxeologie theologische Sicherheit und einen befreienden Raum bie-
ten.
Wien 17.09.2013.
Paul M. Zulehner
3
INHALT
VORTWORT......................................................................................................2
INHALT ..............................................................................................................3
EINLEITUNG.....................................................................................................6
OST(MITTEL)EUROPA – KAIROS FÜR DIE THEOLOGIE ....... .............9
Quellen...........................................................................................................10
Retrospektiv: die theologische Erbe ...........................................................10
Prospektiv: die theologische Aufgabe .........................................................13
Hauptthemen.................................................................................................16
KALEIDOSKOP DER WENDE.....................................................................19
Wende ohne Ende.........................................................................................19
Neue Kultur...................................................................................................24
Wende in der Kirche ....................................................................................27
Theologische Berührungsängste..................................................................31
WENDE IM WESTEN.....................................................................................37
Eine Region voller Gespenster.....................................................................37
Nationalismus................................................................................................46
Nach der Wende ...........................................................................................50
Kirche für das neue Europa ........................................................................57
Theologische Appelle....................................................................................65
Fokusierungen...............................................................................................66
OST-ERFAHRUNG – OST-THEOLOGIE ...................................................69
ZUM BEGRIFF: „Zeichen der Zeit“..........................................................69
Die „Zeichen der Zeit“ in den Reformländern ..........................................82
Reformländer – eine Region? ......................................................................84
Aspekte einer Theologie aus Ost(Mittel)Europa .......................................96
Themen aus Erfahrung ..............................................................................115
4
Sprache und Macht ....................................................................................124
Theologische Herausforderungen .............................................................136
HISTORISCHE TRAUER – FALLBEISPIEL UNGARN........... ..............140
Geschichtliche Ortsbestimmung ...............................................................140
Entkirchlichung der Gesellschaft..............................................................146
Kirche unter dem Sozialismus...................................................................157
ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT ........................................................166
Auftakt.........................................................................................................166
Schatten der Vergangenheit ......................................................................168
Phasen und Arten der Diktatur.................................................................170
Spielräume ..................................................................................................177
Theologische Weiterführung .....................................................................186
Lapsi – ein Modell für heute......................................................................190
Kirche der Kirche der Reinen? .................................................................197
ZUR THEOLOGIE DER LAIEN.................................................................199
Laien nach dem Konzil ..............................................................................199
Diskussionspunkte ......................................................................................205
Problemfelder in Ost(Mittel)Europa ........................................................208
Pastoraltheologische Ermutigungen .........................................................220
SÄKULARE KULTUR IN OST(MITTEL)EUROPA............... .................227
Gottes NichtGlaube ....................................................................................227
(Un)Glaube an Gott....................................................................................230
Religiosität...................................................................................................232
Ausblicke .....................................................................................................236
OSTERWEITERUNG DER EU UND KIRCHE.........................................238
Wertegemeinschaft .....................................................................................239
Wertezukunft ..............................................................................................248
EU-Werte und die Kirche ..........................................................................250
5
LITERATUR ..................................................................................................257
LISTE DER TABELLEN UND ABBILDUNGEN................. .....................266
6
EINLEITUNG
Theologie und Erfahrung gehören zusammen, da es keine Menschen ohne Erfahrung und keine
Theologie ohne Menschen gibt. Die Theologie entsprang immer aus den Erfahrungen der jewei-
ligen Menschen – eingebettet in seiner Kultur, Geschichte und Gesellschaft, ebenso eingebettet in
seine Gotteserfahrungen. Die Menschen in Ost(Mittel)Europa erlebten etwas Gemeinsames: Die
Unterdrückung, die Verfolgung, die mehrmaligen bis zu den Wurzeln gehenden Mobilisierungen
im zwanzigsten Jahrhundert. Darin erlebten Sie aber auch eine eigenwillige neuartige Erfahrung
mit Gott.
In Europa findet seit über 10 Jahren ein ökonomischer, politischer und auch kultureller Paradig-
menwechsel, der eine Wissenschaft aus Erfahrung nicht unberührt lassen kann. Gott ist Ge-
schichte geworden, die Rede über diesen Gott ist auch eine Rede über die Geschichte und Gottes
Wirken in ihr.
In einem Kreis von gläubigen und nichtgläubigen Intellektuellen von Szeged, mit denen ich, seit
über ein Jahrzehnt monatlich einmal zusammenkomme, um über Bibelstellen zu diskutieren,
wurde vor etwa 5 Jahren die Stelle über Kain und Abel genommen. Plötzlich sagte ein Mathema-
tiker: am Mord an Abel ist eigentlich Gott schuldig, da er nicht gesagt hat, warum er das Opfer
Kains ablehnte. Willkürliche Macht produziert Mordfälle – führte er aus. In der Diskussion wur-
de uns an diesem Dienstagabend genug deutlich, dass diese Auslegungsidee auf Erfahrungen der
willkürlichen politischen Machtausübung in Ungarn hinweist. Dieses Gespräch wurde der sprin-
gende Punkt für eine Forschung nach Merkmalen des theologischen Denkens in Ost(Mittel)-
Europa.
In den letzten Jahren vermehrten sich die geschichtlichen, (religions-)soziologischen und (pasto-
ral)theologischen Forschungen über die sogenannten Reformländer Ost(Mittel)Europas. Sie tru-
gen und tragen vieles für eine seriöse, sachgerechte und redliche Wahrnehmung der Länder der
neugewonnenen Freiheit bei. Sie ermuntern aber zugleich zu theologischen Analysen und Refle-
xionen. Dieses Buch möchte einen bescheidenen Beitrag zu den theologischen Reflexionsversu-
chen leisten.
Die einzelnen Kapitel entstanden in den letzten 5 Jahren – teilweise als theologische Vorberei-
tungs- und Begleitungstexte zum Forschungsprojekt AUFBRUCH© und zu den Symposien des
Netzwerkes der osteuropäischen PastoraltheologInnen (PosT). Entwürfe und Teile von einigen
Kapitel sind schon erschienen, aber alle Abschnitte wurden überarbeitet. So gehören sie zu einem
eigenen theologischen Versuch, der danach fragt, ob und in wiefern es in dieser Region Ost-
(Mittel)Europa – früher auch „Zweite Welt“ genannt – eine spezielle Art von Theologie gibt:
eine Art „Theologie der Zweiten Welt“.
7
Es konnte hier eine solche Theologie samt ihren Inhalten und mit den – den klassischen theologi-
schen Traktaten ähnlichen Themen zu entfalten. Meine Absicht ist eher propädeutischer Art: zur
Entdeckung und Entwicklung solcher Themen zu ermutigen, vielleicht solche Arbeit zu provo-
zieren. Drei Werke sind mit diesem Buch für mein Verständnis verwandt, die ich zwar hier nicht
eigens zitiere oder gar bearbeite, die aber meine Ausführungen doch grundlegend mitprägen. Alle
drei Entwürfe entstanden voneinander vollkommen unabhängig und doch in engem zeitlichen
Nebeneinander: Robert J. Schreiter, Constructing local Theologies in 1985; Clodovis und Leo-
nardo Boff, Wie treibt man Theologie der Befreiung und Czesław Stanisław Bartnik, Formen der
politischen Theologie in Polen – die beiden letzten erschienen im Jahre 1986. Alle drei Werke
sind aus einem existentiellen Wunsch entstanden: eine Theologie explizit aus den kulturellen und
gesellschaftlichen Wurzeln einer Region her zu entwerfen.
Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Die ersten Kapitel versuchen allgemein die Möglichkeit
einer regionalen Theologie in Ost(Mittel)Europa zu prüfen. Im zweiten Teil werden dann die
Einsichten in vier Durchführungen über einige wichtigen regionalen Themen auf ihre Plausibili-
tät geprüft. Die bunte Vielfalt der Region ruft nach weiteren solchen Arbeiten, wodurch die theo-
logischen Traditionen je nach Land aufgedeckt werden. Die vielen Bezüge hier auf Ungarn, auf
meine Heimat, mögen dazu Ermutigung geben und dürften gar nicht als eine Art Vereinnahmung
verstanden werden. Viele Konsultationen mit Theologen aus dieser Region lagen es nahe, daß
trotz Unterschiede Ungarn als ein paradigmatischer Fallbeispiel betrachtet werden darf. Die nöti-
gen Differenzierungen werden die Kollegen aus diesen Ländern sicher machen, wenn sie diesen
Entwurf als einen Anlass für eine weitere Kontextualisieung für wertvoll halten.
Im Buch waltet eine Vielzahl für die Bezeichnung der Region. Aus einem politisch-
ökonomischen Aspekt her spricht die Fachliteratur meist über „Reformländer“, aus einem ge-
schichtlich-politischen Blickwinkel über „postkommunistische“, „postsozialistische“ oder „Ost-
Block-Länder“. Im Verhältnis zur Europäischen Union über Kandidatenländer. In der kirchlichen
und theologischen Literatur findet man die Bezeichnungen: Länder der neugewonnenen Freiheit,
Länder der schweigenden Kirche, Adalbertländer usw. In der Forschung AUFBRUCH© wurde
im Interesse einer möglichst wertfreien geographischen Benennung durchgängig „Ost(Mittel)-
Europa“ verwendet. Wo es in diesem Buch nicht um alle zehn erforschten Länder geht, sondern
nur um eine Untergruppe, dort wird die Bezeichnung Mittel-Europa verwendet. Mitteleuropa
meint die Nachfolgeländer der Österreich-ungarischen Monarchie einschließlich Polen. Eine
Vereinheitlichung dieser Bezeichnungen wäre irreführend und diese sprachlich so belassene
Vielfalt mag auch auf die unabgeschlossene Prozeßhaftigkeit der regionalen Identitätsbildung
hindeuten.
Die Adressaten des Buches sind vor allem Christen, Theologen und christliche Intellektuelle in
den Reformländern. Obwohl in diesen Ländern die slawischen Sprachen vorherrschen, bedient
8
sich die wissenschaftliche Zusammenarbeit vor allem der englischen und der deutschen Sprache.
Darum ist dieses Buch deutsch geschrieben. Ein Prüfstein des Buches wird sein, ob die Kollegen
in diesen Ländern darin ihre eigenen Gedanken und vor allem ihre eigenen Erfahrungen wieder-
erkennen. Adressaten sind aber auch die Kollegen in den deutschsprachigen Ländern, mit denen
unsere Geschichte und vor allem unsere theologischen Traditionen so tief verbunden sind.
Beim Abschluß des Manuskriptes bin ich von tiefem Dankbarkeitsgefühl erfüllt. Die breite inter-
nationale Gruppe der Pastoraltheologen von Ost(Mittel)Europa, die Kollegen in Szeged, Buda-
pest, Wien, Innsbruck, Berlin und Tübingen bilden das theologische Netz, in dem die Entwürfe
des Buches entstanden und diskutiert wurden. Ihnen allen gilt mein Dank für die Ermutigungen
und für die Freundschaften, die durch die Zusammenarbeit immer tiefer und tragfähiger wurden.
Zwei Personen aus diesen Kreisen sollen repräsentativ auch mit Namen erwähnt werden, die
diesen theologischen Versuch mit Kritik und weiterführenden Ideen begleitet und den vorliegen-
den Text auch eingehend mitgestaltet haben: Pavel Mikluščák und Paul M. Zulehner. Ihnen bin
ich besonders dankbar. Letztlich denke ich an meine Studentinnen und Stundenten in Wien, die
vor allem als StipendiatInnen des Pastoralen Forums, die bei mir Vorlesungen über diesen theo-
logischen Entwurf gehört haben. Vieles entwickelte und präzisierte sich durch die Arbeit mit
ihnen; ihr offenes Interesse bei den hermeneutischen und theologischen Reflexionen über ihre
eigenen persönlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen haben mich berührt und begeistert.
Ihnen sei daher dieses Buch gewidmet.
Szeged, am Fest des hl. Thomas von Aquin 2002
András Máté-Tóth
9
OST(MITTEL)EUROPA – KAIROS FÜR DIE THEOLOGIE
„Wenn wir – schreibt Günter Grass als ein Deutscher anlässlich des zehnten Jahrestages der deut-
schen Einheit – Zukunft planen, hat die Vergangenheit im angeblich jungfräulichen Gelände
bereits ihre Duftmarken hinterlassen und Wegweiser geflockt, die in abgelebte Zeiten zurückfüh-
ren.“1 Der Fall der Berliner Mauer ist ein Symbol für die Epochenwende in Europa und ein radi-
kaler Einschnitt in die Geschichte der Völker und Gesellschaften Ost(Mittel)Europas. Die Kon-
zentration auf diese Wende ruft nähere und weitere geschichtlichen Erinnerungen wach und
gleichzeitig provoziert ein Herbeizaubern der Zukunft. Die gesellschaftspolitische Situation mag
vor der Wende und nach der Wende ganz verschieden sein, aber die Menschen und die Kulturen,
die diese Wende miterlebt und mitgelitten haben, überbrücken diese Unterschiede. Im gesell-
schaftlichen Heute dieser Region trifft uns eine radikale Ungleichzeitigkeit. Es leben Elemente
der Politik, der Wirtschaft, der Mentalität nebeneinander, die ursprünglich zu ganz verschiedenen
Systemen und Kulturen gehörten. Man braucht für die Bürger dieser Gesellschaften keine Argu-
mente für eine solche Beobachtung aufzulisten, so eindeutig ist diese Grunderfahrung. Wo aber
wohl Argumente, und noch weiter Analysen, Forschungen und Visionen vonnöten sind, das ist
ein angemessener Umgang mit dieser komplexen Situation. Mit dieser Aufgabe sind Politiker,
Ökonomen, Juristen und Bürokraten gesegnet und/oder geplagt. Aber auch Literaten, Philoso-
phen und Theologen wollen dieser Herausforderungen nicht entfliehen, da es um die Grundlagen
und Grundvisionen ihrer Gesellschaft geht. Diese Zeit ist gerade für die letztere eine besondere
Zeit (Kairos), da heute nicht nach Erklärungen des Bestehenden, sondern nach Erahnen des noch
Ausstehenden gesucht wird.
Die Kirchen in diesen Ländern stehen vor eine klaren Alternative. Entweder werden sie dort an-
fangen wollen, wo sie von der kommunistischen Gewalt gezwungen wurden aufzuhören, also
etwa im Jahre 1948. Oder sie versuchen, das Originelle ihrer Erfahrungen wahrzunehmen und
theologisch zu verwerten. Wir plädieren für diesen zweiten Weg. In den nachstehenden Ab-
schnitten geht es um theoretische und praktische Rahmenbedingungen, unter denen eine originel-
le theologische Reflexion über die speziellen Erfahrungen der Gesellschaften Ost(Mittel)Europas
möglich ist.2
1 F.A.Z. 04. Oktober 2000. 64. 2 In diesem Beitrag wird auf den Rahmen solcher theologischer Arbeitsbedingungen näher eingegangen. Zur Proble-
matik der kulturellen und gesellschaftlichen Merkmale der Region die von Paul M. Zulehner, Miklós Tomka, Niko Toš herausgegebene Reihe „Gott nach dem Kommunismus“, Schwabenverlag, Ostfildern 1999-, bisher 7 Bände, sowie Máté-Tóth, The „second world“; Pastoraltheologie "Ost"; Ost-Erfahrung – Ost-Theologie; Ist eine Theologie "after Gulag" möglich?; Eine Theologie der Zweiten Welt?; Ungarns Kirche zwischen Ultramontanismus und krea-tiver Autonomie; Ecclesiogenese; Máté-Tóth/Mikluščák, Nicht wie Milch und Honig; Kirche im Aufbruch.
10
QUELLEN
Aufbruch
AUFBRUCH© ist Forschungsprojekt in 10 postsozialistischen Ländern Ost(Mittel)Europas hin-
sichtlich der religiösen und kirchlichen Lage vor und nach 1990. Diese Forschung war neben
anderen wichtigen Forschungen3 die umfangreichste. Sie hat die Selbstdefinition der betroffenen
Kirchen am meisten ermöglicht. Der Großteil ihrer Ergebnisse sind in den letzten Jahren beim
Schwabenverlag in Ostfildern in der eigens für diese Forschung errichteten Reihe „Gott nach
dem Kommunismus“ erschienen.4
PosT
PosT ist ein theologisches Projekt in Zusammenarbeit mit vielen Pastoraltheologen aus den oben
genannten Ländern. In einer Reihe von Symposien wurden Marksteine der Methodologie einer
Pastoraltheologie auf der Basis der regionalen Erfahrungen konzipiert. Die Ergebnisse sind in
drei im Eigenverlag gedruckten Bände erschienen. Systematisch wurden die Materialien und im
Buch, „Nicht wie Milch und Honig bearbeitet“, das ich mit Pavel Mikluščák geschrieben habe.
Wesentliche Unabgeschlossenheit
Durch die genannten Projekte eröffnete sich ein sehr weites Feld, das mehr Geheimnisse als Ent-
deckungen verspricht. Es sind daher noch weitere Projekte geplant, z.B. bezüglich der „Osterwei-
terung“ der Europäischen Union oder der Rolle der orthodoxen Kirchen im künftigen Europa. Im
Rahmen der universitären Lehre werden die gewonnenen Einsichten in Einzelstudien vertieft.
RETROSPEKTIV: DIE THEOLOGISCHE ERBE
These: Für eine angemessene theologische Betrachtung der
Region Ost(Mittel)Europas Zweiten Welt ist die intensive
Wahrnehmung und kritische Revitalisierung des beschädigten
theologischen Erbes aus der weiteren und früheren Vergan-
genheit unerlässlich.
3 Vgl. Gönner, Die Stunde der Wahrheit; Gatz, Kirche und Katholizismus; Spieker, Nach der Wende; Pollak, Religiö-ser Wandel. Es kann in den Rahmen dieses Buches nicht eigens auf diese große Untersuchungen eingegangen wer-den. Doch die hier gesagten werden weitgehend in den folgenden Ausführungen rezipiiert. Ich bedanke mich beson-ders bei den Kollegen Spieker und Pollak für die freundliche Hilfe bei der Beschaffung der einschlägigen Literatur.
4 Vgl. Home Page AUFBRUCH©: www.vallastudomany/aufbruch.hu
11
Dieses Erbe ist aus zwei Gründen beschädigt: Die vorkriegszeitliche theologische Werke und
Ansichten in dieser Region konnten in der Zeit der kommunistischen Diktatur nicht organisch
weiterentwickelt werden. In den „freien Staaten“ des Westens hat diese Entwicklung u.a. durch
die theologischen Ereignisse um das Zweite Vatikanisches Konzil herum stattgefunden. Die
Konzilszeit war aber eine Zeit des Schweigens in den unfreien Kirchen der roten Diktatur. In
dieser Epoche der Unterdrückung und Verfolgung konnte keine normale theologische Arbeit
geleistet werden – von einigen originellen Versuchen abgesehen. Der Kontext dieser Epoche
konnte theologisch nicht reflektiert und wissenschaftlich nicht öffentlich diskutiert werden. Eini-
ge strukturelle und inhaltliche Aspekte dieses Erbes sollen im Folgenden skizziert werden.
Strukturell
Strukturell betrachtet war auch in unserer Region die theologische Arbeit von dem Klerus ge-
macht worden. Der gesellschaftliche Status des Klerus war in den meisten Ländern herrschafts-
nah, „kyrial“. Die Theologie diente fast ausschließlich der Priesterausbildung. Nach den Fünfzi-
gerjahren gliederten die neuen Machthaber die Theologischen Fakultäten aus den staatlichen
Universitäten aus. Viele Professoren wurden in die Emigration gezwungen. Vor allem die Jesui-
ten, die oft eine prägende Rolle in der theologischen Fakultäten gespielt haben, fanden im westli-
chen Ausland ein neues Zuhause. Die neue Professorengeneration musste in den meisten Ländern
aus staatsloyalen Theologen zusammengestellt werden, wobei – den Lehrstuhlbesetzungen an
anderen Fakultäten ähnlich – die wissenschaftliche Qualität gegenüber der politischen Loyalität
eine untergeordnete Rolle spielte. In einigen Ländern wurde die öffentliche theologische Arbeit
voll vernichtet. Daher mussten die Theologen nahezu ganz mittellos, d.h. ohne Bibliothek, ohne
Diskussion, ohne jedweden wissenschaftlichen Apparat im Untergrund lehren, womit sie nicht
selten großes persönliches Risiko auf sich genommen haben.
Die aus den Sachzwängen herrührenden Kompromisse schufen nicht selten ein Milieu des Miss-
trauens. Da es keine öffentlich anerkannten politischen Strategien gab, waren alle Entscheidun-
gen irgendwie verdächtigt. Auch unter Theologen konnte niemand ganz sicher sein, wie weit sein
Kollege mit den Kommunisten kollaborierte. Die Archive der Staatsicherheitsdienste zeigen trau-
rige Geschichten über diese komische Kommunikation in dauernde Anwesenheit eines geheimen
Dritten.
Inhaltlich
Diese strukturellen Gegebenheiten erklären teilweise die inhaltlichen Eigenschaften des theologi-
schen Erbes dieser Region. Man kann darin eine durchgängige Linie beobachten, die von der Zeit
der Antimodernismus des 19. Jahrhunderts an bis zur heutigen Zeit reicht. Diese Linie ist von
12
einer apologetischen Grundhaltung geprägt: gegen Reformation, Modernismus, nationale Interes-
sen, gegen atheistischen Materialismus und heute gegen der westlichen Liberalismus und seine
Meinungsvielfalt. Diese Linie ist deutlich ultramontan gekennzeichnet. Die kontextuelle Proble-
matik der Region wurde durch einen ergebenen Blick nach Rom (über die Berge) „gelöst“, die
strukturelle und inhaltliche Rolle Roms wurde in dieser Zeit sehr verstärkt.
Man darf dennoch nicht vergessen, dass manche Bischöfe aus dieser Region am Ersten Vatikani-
schen Konzil zu der Minderheit gehörten, die (hauptsächlich nicht aus theologischen, sondern aus
monarchiepolitischen Gründen) gegen das Unfehlbarkeitsdogma votierten und später in ihrer
Diözesen die Verkündigung dieses Dogmas souverän unterbanden. Die Vorherrschaft der oben
genannten „geraden Linie“ wurde in der Zwischenkriegszeit eindeutig und bruchlos. Die Theolo-
gie diente der Befestigung und Restaurierung der kulturellen und politischen Stellung in der Zeit
einer unaufhaltsam voranschreitenden Marginalisierung der katholischen Kirche in der modernen
Gesellschaft.
Als diese Marginalisierung durch die kommunistische Machtübernahme bis zur fasttotalen Ver-
nichtung der Kirche brutal vollgestreckt wurde, hatte die Theologie dieser Region beinahe aus-
schließlich diese ultramontane Apologetik zur Verfügung, um dem Überleben der Kirche zu die-
nen und die apodiktische Unvereinbarkeit der kommunistischen Ideologie mit dem Glaube der
Kirche aufzudecken. Diese Theologie musste vorrangig die Einheit der Kirche in ihrer Bedräng-
nis untermauern, was eine überstarke Betonung der Unhinterfragbarkeit und Undiskutabilität der
kirchlichen Lehre mit sich gebracht hat. Die Theologie blieb eine ausschließlich priesterliche
Angelegenheit im Dienste der pragmatischen Priesterausbildung. Diese Priester sollten ihr Amt
in einer unerschütterlichen Glaubenssicherheit ausüben, was durch eine Theologie der klaren
Antworten gesichert werden sollte. Fragen über die Lehre oder Dialogbereitschaft mit der feind-
lichen Ideologie erschienen in diesem intellektuellen Konzept als gefährlich, als verratsanrüchig.
Neue theologische Impulse, Forschungen, originelle Entwürfe konnten in der Kirche des (wissen-
schaftlichen) Schweigens nicht aufkommen. Zumindest nicht auf der offiziellen Ebene.
Dieses düstere Bild kann dadurch etwas modifiziert werden, dass man die Versuche der Theolo-
gen wahrnimmt, ausländische Publikationen im Land zu veröffentlichen. Die wichtigste theologi-
sche Arbeit dieser Kollegen bestand vor allem darin, aus der unübersichtlichen Fülle der Publika-
tionen des „freien Westens“ jene Werke auszuwählen, die hinter dem eisernen Vorhang eine
kontextuelle Botschaft vermitteln und auch vor der strengen Zensur der atheistischen Behörden
akzeptiert werden könnten. Es kam in einigen Extremfällen sogar dazu, dass Bücher der westli-
chen Kollegen – mit diesen klar abgesprochen – unter der Autorenschaft östlicher Kollegen er-
schienen. In dieser Hinsicht spielten die Zeitschriften und Bücherdienste, die aus Westen Mate-
rialien nach Osten lieferten, eine beachtliche Rolle.
13
Eine sehr komplizierte Frage ist die theologische Leistung der Untergrundkirche, die in einigen
Ländern die tragende Kraft des christlichen Glaubens war. Nur in wenigen Fällen gab es echte
theologische Arbeit in dieser Untergrundkirche. Oft versuchten die dort wirkenden Theologen
das im Untergrund weiterzugeben, was sie früher vor der Kommunismus in der Öffentlichkeit
doziert haben. In einigen wenigen Fällen kam es zur originellen Ideen, die in der sehr bedrängten
Situation über den Stand eines Entwurf kaum hinausgelangten. Man kann zwei Beispiele nennen,
ohne sie ausführlich besprechen zu können: Dazu gehören die amttheologischen Aspekte von
Felix Davídek, der auch Frauen zur Priestern geweiht haben soll. Wichtig ist auch die moraltheo-
logisch geprägte Ekklesiologie von Oto Madr, die das Überleben der Kirche durch die persönli-
che Heiligkeit gesichert sah. Beide stammen aus Tschechien. Aus Ungarn wiederum ist die Neu-
interpretation der Jesusgestalt der Evangelien als Modell einer Kirche der Nachfolge durch
György Bulányi SP zu erwähnen.5
PROSPEKTIV: DIE THEOLOGISCHE AUFGABE
Dieses Erbe verpflichtet die heutige Theologie dieser Region. Des weiteren gibt es auch eine
große Nachfrage von Studierenden an die Theologie. Religion und religiöse Angelegenheiten
sind in der nachkommunistischen Öffentlichkeit sehr willkommen. Eine Art religiöser Markt hat
sich gebildet. Es ist nicht gleichgültig, wie sich die katholische Kirche auf diesem neuen Markt
der Religiosität behaupten kann. Für ein sicheres Auftreten sind viele Aufgaben zu erledigen.
These: Um den Aufgaben der heutigen Zeit entsprechen zu
können, ist eine regionale Theologie in Ost(Mittel)Europa nö-
tig, die ihre intellektuelle Lage wahrnimmt und alle wissen-
schaftlichen Bedingungen für eine kreative theologische Arbeit
sichert.
Evaluierung
Die Kirche hat sich in den letzten 50 Jahren tiefgreifend verändert. Und das nicht nur im freien
Europa, sondern auch hinter dem eisernen Vorhang. Die Änderungen fanden in den beiden politi-
schen Teilen Europas unter verschiedenen äußeren Bedingungen statt. In Ost(Mittel)Europa be-
5 Viele Werke aus dieser Zeit liegen nur in der einheimischen Sprachen vor. Es wäre daher eine wichtige Aufgabe, TheologiestudentInnen aus diesen Ländern dazu zu ermutigen, die verborgenen theologischen Perlen der internatio-nalen Fachöffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine Pionierrolle in diesem Aufgabenbereich spielt das Pastorale Forum in Wien, das jährlich mehrere Doktorats- und Habilitationsstipendien für solche jungen WissenschaftlerInnen vergibt. Es sind auch die deutschen, italienischen, belgischen und französischen Fakultäten zu erwähnen, wo Theo-logen aus dieser Region mit Materialien von zu Hause arbeiten können. Eine wichtige Stipendiumquelle ist die Ak-tion der deutschen Katholiken RENOVABIS, die seit zwei Jahren auch eine gute Zeitschrift unter dem Titel Dialog Ost-West herausgibt.
14
steht die Gefahr zu meinen, dass nach dem Fall des Kommunismus die Kirche sich automatisch
revitalisieren wird. Fällt der Druck weg, so meinte man, wird das Leben vital wiederkehren. Die
diesbezüglichen Erwartungen, die auch außerhalb unserer Region gleich nach 1990 gepflegt
wurden, entpuppten sich als Täuschungen. Die Theologie in Ost(Mittel)Europa muss sorgfältig
und in intellektueller Redlichkeit ihre neuen Verhältnisse evaluieren. Sie muss ihre Beziehungen
zu den Wissenschaften, zur Tradition, zur real existierenden Kirche neu wahrnehmen. Wie im
allgemeinen gesellschaftlichen Leben, so ist es auch in der Theologie unmöglich zu meinen, es
wäre heute die einzige Aufgabe, die kirchliche Lehre zu vermitteln. Die Kirche ist in sich pro-
blematisch geworden und die Selbstverständlichkeit in der Auffassung der Offenbarung ist ver-
schwunden. Die Theologie als Wissenschaft ist nicht mehr imstande zu behaupten dass sie die
mannigfaltigen Paradigmenwechsel in der Philosophie und die radikal anderen Kontexte hierzu-
lande nichts angingen, da die Offenbarung davon nicht betroffen werde. Eine regionale Theolo-
gie in Ost(Mittel)Europa kann sich keine hermeneutische Naivität leisten.
Wissenschaftlichkeit sichern
Die Theologie ist eine Wissenschaft wie alle andere Wissenschaften, was ihr intellektuelles Vor-
gehen betrifft. In diesem Sinne haben die Kirchen in der Region Ost(Mittel)Europa die struktu-
rellen Verhältnisse des Theologietreibens wesentlich nachzubessern. Diese Aufgabe ist zu um-
fangreich, als dass hier eine vollständige Aufgabeliste zusammengestellt werden könnte. Aber
einige Schwerpunkte lassen sich umzukreisen.
Höchste Aktualität hat die Erhöhung der Leistungsfähigkeit der theologischen Bibliotheken und
die Auffrischung ihres Bestandes. Es müssen weiter an den theologischen Hochschulen und Fa-
kultäten Lehrstühle und Institute entstehen, die auch wissenschaftliche Hilfskräfte beschäftigen
können. Die Auswahl der Professoren soll nach wissenschaftlichen Kriterien stattfinden, und erst
wenn die Wissenschaftlichkeit feststeht, sollen die nötigen kirchlichen Erlaubnisse eingeholt
werden. Eine umgekehrte Reihenfolge erinnert allzu sehr an die typische Personalpolitik der
ideologischen Systeme, wo Loyalität mehr gilt als Qualität.
Zu der strukturellen Erneuerung der Theologie in Ost(Mittel)Europa gehört die vieldiskutierte
Frage der theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten. Nach der politischen Wende
entstand die Möglichkeit für eine Wiedereingliederung der theologischen Fakultäten, die um
1950 herum aus dem Korpus der Universitäten entfernt wurden. In einigen Ländern fand die
Wiedereingliederung statt. In anderen Ländern will die örtliche Kirchenleitung diese Wiederein-
gliederung mit einer zweifachen Begründung nicht: das deutsche Modell sei erstens kirchen-
schädlich, und zweitens, der Staat dürfe nicht die Sagen über die Theologie haben. Wo aber Fa-
15
kultäten innerhalb der universitären Strukturen arbeiten, öffnen sich die Theologen immer mehr
für einen aufrichtigen Dialog mit allen anderen Wissenschaften – zumindest sollte es so sein.
Zur Verbessern der Wissenschaftlichkeit gehört nicht nur der Dialogswille mit anderen Wissen-
schaften, sondern auch eine ständige Diskussionsbereitschaft innerhalb der Theologie selbst.
Ohne wissenschaftliche Diskussion gibt es keine Wissenschaft. Dies gilt auch für die Theologie.
In den theologischen Publikationen Ost(Mittel)Europas fällt aber eine Debattelosigkeit auf. Eine
Erklärung dafür sei, dass in der Zeit der Bedrängnis innenkirchliche Diskussionen eine Schwäche
nach außen darstellten und die Diskussionspartner leicht von außen her politisch gegeneinander
ausgespielt werden konnten. Es gibt dafür genügende Beispiele. Manche Theologen unserer Län-
der meinen zudem, dass die Kirche weiterhin in Bedrängnis sei, allerdings nicht mehr durch den
Kommunismus, sondern durch den westlichen Liberalismus. Gräbt man aber tiefer, dann scheint
diese Diskussionslosigkeit eine spezielle Auffassung von Theologie selber darzustellen. Theolo-
gie gilt dann als eine kluge Darstellung der eindeutigen und indiskutablen Lehre der Kirche. Eine
Wiedereinübung des theologischen Disputs wird also auch Aufgaben hinsichtlich der Auffassung
von Theologie wahrnehmen müssen.
Erfahrungen reflektieren
In der gesamten Theologie und nicht nur in ihren praktischen Disziplinen wird den Erfahrungen
eine wachsende Bedeutung zugemessen. Die Erfahrungen der Menschen und auch der Gesell-
schaften Ost(Mittel)Europas theologisch aufzuarbeiten ist eine höchstrangige Aufgabe unserer
Theologie. Sollte eine Art „Theologie der Zweiten Welt“ in dieser Region entstehen, dann beruht
sie auf der Basis der kontextuellen Erfahrungen dieser Region. Diese Erfahrungen sind vor allem
denen nachvollziehbar und dechiffrierbar, die sie selber miterlebt haben.
Die Erfahrungen in sich sind immer persönliche Mysterien. Zugänglich werden sie erst durch die
vielfältigen Deutungen der Betroffenen selbst und auch anderer. Die Theologie hatte immer eine
deutende Funktion gehabt, die sie zu einer empfindsamen Zurückhaltung gegenüber den Erfah-
rungsmysterien verpflichtete, um deren Originalität in möglichst hohem Grad bewahren zu kön-
nen. Zu eindeutige und schnelle Deutungen machen das Hervortreten der Originalität unmöglich.
Darum sollte die originelle Theologie in Ost(Mittel)Europa, langsame und die Deutungsvielfalt
aushaltende Theologie sein. Sonst kann sie schwer der Gefahr widerstehen, durch traditionelle
Klischees die originellen Erfahrungen zu beschädigen.
16
HAUPTTHEMEN
Obzwar eine Theologie über die Zweite Welt nur eine Idee ist und kein ausgearbeitetes theologi-
sches Konzept, sind doch einige ihrer Hauptthemen inzwischen klar erkennbar. Sie entstammen
aus der zentralen Erfahrungen der Region Ost(Mittel)Europas, sind sozusagen kontextuell be-
stimmt.
Vergangenheit
Man braucht nicht extra begründen, dass die Vergangenheit und die Beziehung zu ihr zu den
bestimmenden Faktoren gezählt werden muss, welche die heutige Gesellschaft und auch der Kir-
che in dieser Region bestimmen. Die Zeitungen, die Predigten und auch die persönlichen Ansich-
ten sind voll von Hinweisen auf die Vergangenheit. Die nahe Geschichte dieser Region ist der
hauptsächliche Erklärungsfaktor der Gegenwart in dieser Region. Die Identitäten werden von
ihrem Bezug zur Vergangenheit bestimmt oder verunsichert. Die Vergangenheit ist eine durch
verschiedene Interessen geleiteter Konstruktion.
Eine wichtige theologische Frage ist, wer auf welcher intellektuellen Basis das Recht hat, durch
die Rede über die Vergangenheit eine Gegenwart zu konstruieren. Es geht also nicht nur darum,
die theologische Vergangenheit wie ein Archäologe des langen zwanzigsten Jahrhunderts aus-
zugraben und aufzuzeigen. Das ist eine wichtige Vorbereitung für die eigentlichen theologischen
Fragestellungen, die heißen: Was ist Tradition, wie wird Sinn, Leben und Glaube tradiert. Von
Ost(Mittel)Europa her gesehen wird diese Frage nicht nur kühn wissenschaftlich gestellt, sondern
leidenschaftlich, als Frage von Leben und Tod. Daher ist Traditionalismus in Ost(Mittel)Europa
eine natürliche Konsequenz der regionalen Geschichte, wo die machtpolitischen Einschnitte so
radikal waren, dass die Gesellschaften mit der vollkommenen Vernichtung haben rechnen müs-
sen. Eine Theologie aus der Zweiten Welt hat die Aufgabe, die Tradition als Quelle des Überle-
bens wahrzunehmen und in einer postmodernen Zeit des alles Möglichen zu behaupten.
Nation
Die volle Abhängigkeit der kleinen Sprachnationen Ost(Mittel)Europas erwies sich vor allem
darin, dass ihre nationale Identität eng an die Verwendbarkeit ihrer Muttersprache gebunden
war.. Die Großmächte, unter denen diese Gesellschaften ihr nationale Eigenständigkeit ständig
erkämpfen mussten, begrenzten die Freiheit dieser Nationen indem sie den offiziellen Gebrauch
ihrer Muttersprache unterbunden haben. In ihrer Sprache lebt die Nation - schrieb ein großer
ungarischer Dichter. In der selben Zeit, als die katholische Kirche um ihr Lebensrecht unter der
neuen Bedingungen der Moderne gekämpft hat, haben diese Länder um ihre nationale Existenz
17
gekämpft. In jenen Ländern, in denen die Kirche und die Theologie diese nationale Autonomie
unterstützen konnte, teilte sie den Schicksaal des Volkes. Wo aber die selbe katholische Kirche
eher für die Mächtigen optierte, dort verlor sie ihre Volksnähe und auch ihre spätere Wirkungs-
möglichkeit. Dieser Konflikt um die Sprache und damit um die eigenständige Existenz dieser
Nationen, der sich im 19. Jahrhundert entwickelte, dauert bis heute noch. Überzeugende Beispie-
le sind die Konflikte in den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens oder in milderer
Ausgabe in den nachtrianonischen Restgebieten des ehemaligen Großungarns in Rumänien, Ser-
bien oder Slowakei.
Eine spezielle Theologie in Ost(Mittel)Europa ist herausgefordert, eine genuin katholische Ant-
wort auf diese nationalen Existenzängste zu geben. Diese Aufgabe ist höchst delikat und voll von
Risiken. Hierin wird sich wiederum zeigen, dass die Kirche und ihre Theologie nie in politischer
Unschuld leben und arbeiten kann. Die theologische Herausforderung der Angst und der Frei-
heitsfrage der Nationen beinhaltet eine theoretische Gedankenstruktur, in welcher diese Fragen
nicht individualistisch, sondern tief kollektivistisch gestellt sind. Hierin zeigt sich eine der wich-
tigsten Unterschiede in der Freiheitsauffassung Westens und Ostens darstellt.
Glaube und Risiko
In der Zeit der Unterdrückung haben die praktischen Themen der Theologie einen absoluten Vor-
rang gehabt. Was nicht direkt oder indirekt mit dem praktischen Leben unter den religions- und
kirchenfeindlichen Bedingungen in Zusammenhang stand, hat man reflexartig abgewertet. Da
aber das christliche Denken und vor allem die christliche Lebensführung in sich immer eine Risi-
kobereitschaft implizierte, wurde die Risikobereitschaft auch für die Theologie ein Qualitätskrite-
rium. Glaube ohne Risiko ist suspekt. Eine Theologie ohne Risikobereitschaft ist eine ideologisch
verformte Systemloyalität.
Nach der Wende besteht die Gefahr, dass man dieses theologisch provokative Erbe bezüglich des
engen Zusammenhangs zwischen Glaube, Theologie und Risiko als nicht mehr aktuell vergessen
wird. Heute gibt es keine Kirchenverfolgung früherer Art mehr. Auf dem ersten Blick ist die
Risikobereitschaft keine Qualitäts- oder Wahrheitskriterium mehr. Ein Glaube ohne Wagnis,
ohne Opposition ist positionslos und daher auch nutzlos – unabhängig von den jeweiligen gesell-
schaftlichen oder politischen Bedingungen.
Konzil: Zweitlese
Die oben genannten theologischen Themen werden nur zugänglich, wenn in diesen Ländern eine
tiefgehende Zweitlese des Konzils stattfinden kann. Als das Zweite Vatikanisches Konzil in Rom
tagte, war die nachstalinistische Kirchen- und Religionsverfolgung noch voll im Gange. Aus den
18
Ländern Ost(Mittel)Europas waren die Delegationen voll von kommunistischen Agenten durch-
setzt oder konnten – wie im Falle von Rumänien – gar nicht ausreisen. In den vier Konzilsperi-
oden blieben drei Stühle für die drei verhinderten Bischöfe unbesetzt. Das ist ein großes Symbol
für die Beziehung dieses Konzils zu Kirche und Theologie dieser Länder. Die Theologie soll sich
in diese freigehaltenen Stühle hineinsetzen, da die Konzilsinhalte im großen und ganzen in diesen
Ländern immer noch als Lernaufgabe gelten müssen.
Das Konzil hat aber auch eine eigene Geschichte in den einzelnen Ländern der Welt. Es wäre ein
Missverständnis zu meinen, dass es ein „Konzil pur“ gibt. Dieses Konzil, wie alle anderen, leben
in kreativer und kontextbedingten Erinnerung der Ortskirchen. Ein Konzil soll in unseren Län-
dern nicht nur nachgeholt, sondern auch kreativ rekonstruiert werden. Die Länder Ost(Mittel)-
Europas hatten zu nachkonziliaren theologischen Entwicklungen praktisch keinen Zugang. Des-
wegen fällt es diesen Ländern schwer, die zeitgenössische Theologie aus den anderen Teilen der
Welt zu verstehen. Andererseits sind unsere Theologen nicht verpflichtet, diese 35 Jahre durch-
zugehen. Sie haben vielmehr eine originelle Leseart zu erstellen. Darin wird sich zeigen, wie
durch die speziellen Erfahrungen das Konzil weitergeschrieben und auch teilweise ergänzt wer-
den kann.
Ich möchte diese Gedanken mit einem Zitat von Grass abrunden, der bereits als Auftakt zitiert
wurde. Er beruft sich an den ungarischen Schriftsteller György Konrád, der im Hinblick auf die
Geschichte Europas folgendes schrieb: „Erinnern ist menschlich, wir können sagen, das Humane
in sich.“ Die Fähigkeit zur Erinnerung ist zwiespältig. Sie ist ein Fluch, indem sie nicht von uns
ablässt, aber zugleich eine Gnade, indem sie den Tod aufhebt.6 Die Theologen in Europa können
darauf hoffen, dass aus dem östlichen Teil Europas eine Theologie wie eine Überraschung er-
wachsen wird. Diese wird nüchtern und bescheiden ein Zeichen für den Glauben dieser Christen
setzen, der einen kulturellen und wissenschaftlichen Tod besiegt hat.
6 F.A.Z. 04. Oktober 2000. 64.
19
KALEIDOSKOP DER WENDE
In diesem Kapitel werden Aussagen von Menschen aus der Kirchen unserer Region dargestellt.
Die Wende wurde von kirchlichen Verantwortlichen, Bischöfen und Theologen in vielfacher
Weise gedeutet. Bei verschiedenen internationalen Symposien und Konferenzen haben auch
mehrere aus dem Westen zur Wende und zu deren Wirkung Stellung genommen. Für eine Theo-
logie auf der Basis der osteuropäischen Erfahrungen ist es sehr nützlich zuerst diese Ansichten
und Deutungen wahrzunehmen. Sie beinhalten oft Ansätze für eine solche Theologie, tasten Fra-
gen an, die auch durch diese Theologie beantwortet werden müssen.
Basis dieser Sammlung war die Meldungen der Katholischen Presseagentur in Wien.7 Es wurden
in einer ersten Schritt mehr als 1000 Meldungen aus dem Gesamtmaterial abgesondert und ko-
diert.8 Mit Hilfe der Kodierung wurden die Aussagen zusammengestellt, die die politische Wen-
de in der Region versuchen zu deuten und kommentieren, sowie Textstellen, die über die Situati-
on und Aufgaben der Kirche und des Christentums sprechen. In einem letzten Schritt wurden
diese Textstellen in ein Themensystem eingeordnet und mit einem Begleittext versehen. Dabei
wurde bewusst darauf verzichtet, Vergleiche zwischen der Zeit der originellen Aussagen und der
heutigen Zeit zu ziehen. Die Rolle dieses Kapitels ist eine erinnernde Vergegenwärtigung der
originellen Erfahrungen und Deutungen der Wende.
WENDE OHNE ENDE
Zehn Jahre nach der Wende wurden die Erinnerungsfeste gefeiert. In den befreiten Ländern so-
wie in Deutschland, wo der Fall der Mauer auch die Wiedervereinigung des getrennten Landes
bedeutete, geht es heute noch um die Deutung dieses epochalen Geschehens. Neben den Fest-
lichkeiten und der Freude hat man die Unabgeschlossenheit der Umstrukturierung dieser Gesell-
schaften nicht vergessen. Mit Recht. Wichtige Persönlichkeiten aus dieser Region meldeten
gleich nach der Wende, dass es immer noch sehr viel zu tun sei.
Codruta Paraschiv, Ehefrau des während der Revolution unter mysteriösen Umständen zu Tode
gekommenen Dominic Paraschiv, dem Robert Dornhelm ein aufsehenerregendes filmisches
Denkmal gesetzt hat, räumte ein: Viele Menschen verstünden die Wahrheit und die Revolution
nicht. Aus Feigheit verschwiegen sie die Wahrheit. „Das alte System hat das Land mit Gewalttä-
7 Dia Analyse bediente sich der Kathpressarchiv (http://www.kathpress.co.at/) und umfasst die Zeitperiode 1989-1997. Der Autor bedankt sich für die engagierte Berichterstattung von Kathpress, die mit Feingefühl und Sach-kenntnis als Informationsschnittstelle zwischen der „freien Welt“ und der Welt hinter den eisernen Vorgang diente. Zwei Ostexperten sollen auch Namentlich genannt werden: Peter Musyl und Josef Pumberger.
8 Zu der Kodierung wurde das Program WinMax98 Professionell verwendet.
20
tigkeit und Furcht vermint“, bestätigte der reformierte Bischof Laszlo Tökes. Seines Erachtens
habe sich nicht geändert. Trotzdem: „Als Christen sehen wir mit Hoffnung in die Zukunft, ohne
einem naiven Optimismus verfallen zu wollen“. Tökes glaubt sogar an die Notwendigkeit und
Möglichkeit einer „zweiten Revolution“.9
Trotz dieser berechtigten Mahnungen darf man auch nicht einem naiven Pessimismus verfallen,
als wäre die gewaltlose Revolution vor zehn Jahren nur eine Täuschung. Der ungarische Mini-
sterpräsident József Antall betonte in dieser Hinsicht: „Wir müssen uns alle glücklich schätzen,
dass Gott uns diese Epoche geschenkt hat“.10 Mit diesem Geschenk wurde auch eine Aufgabe
von Gott gegeben, die vor allem in zwei Richtungen zu verstehen ist. Einerseits müssen diese
Länder, einschließlich der Kirche, nach der wirtschaftlichen und politischen Modernisierung
auch eine Modernisierung oder gar Heilung der Mentalität schaffen. Andererseits sie müssen mit
der neuen Situation der Marktwirtschaft, der Demokratie und der freien Öffentlichkeit klar kom-
men.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, hatte diese komplexe
Lage in einem Referat auf den Punkt gebracht: Die Wende sei noch nicht „damit geschafft, dass
man ein Regime abgeschüttelt hat“. Die Kirche vieler Länder sei gerade deshalb „in Not“, weil
sie jetzt „erst so richtig die Langzeitwirkungen der totalitären Systeme in den Herzen und den
Köpfen der Menschen spürt“.11 Dieses Erbe der „Sowjetisierung“ bestehe nach Kazimiera
Prunskiene, ehemaliger Ministerpräsidentin in Litauen, in Passivität, Mangel an Initiative und
Verantwortungsbereitschaft. Auch die Kirche selbst brauche „Hilfe zur Demokratisierung“, um
ihre Aufgaben erfüllen zu können.12
Ähnlich analysierten slowenische Professoren diese vielseitige Situation. Nach wie vor haben die
Reformländer mit den verbliebenen Resten ihrer sozialistischen Vergangenheit zu kämpfen, wäh-
rend die neu gewonnene Freiheit sich gegen mancherlei Widerstände und Missverständnisse nur
langsam Bahn bricht. Professor Anton Stres, Ordinarius für Philosophie an der Universität Ljub-
ljana und nunmehr Weihbischof in Ljubljana, der eine Art Inventur an Hand der Entwicklung in
Slowenien vornahm, bezeichnete es als schwere Hypothek, dass der Kommunismus das
„menschliche moralische Bewusstsein schlechthin“ getötet habe. Mangelndes Interesse am ge-
sellschaftlichen und öffentlichen Leben behinderte den Demokratisierungsprozess, für den sich
die katholische Kirche nachdrücklich eingesetzt habe. Es sei bei der „Stimme des Rufers in der
Wüste“ geblieben. Nicht ganz so skeptisch äußerte sich aber Sloweniens Vizepremier Außenmi-
nister und Vorsitzender der Christdemokraten, Lojze Peterle, der versicherte, Slowenien sei unter
9 Kathpress 04. 01. 1991. 10 Kathpress 28. 05. 1990. 11 Kathpress 06. 09. 1991. 12 Kathpress 06. 09. 1991.
21
jenen Reformländern, die den Prozess der Demokratisierung am besten überstanden haben. Al-
lerdings ortete er bei seinen Landsleuten eine „Nostalgie nach Sklaventum“, nach jener Zeit also,
in der alles von außen geregelt war.
Stres sagte dazu, Hand in Hand mit dem mangelnden Interesse am gesellschaftlichen und öffent-
lichen Leben gingen falsche Erwartungen, dass der Staat weiterhin für alles verantwortlich sei.
Dies falle am meisten im sozialen Bereich auf. „Von Moral im wahren Sinne des Wortes“, beton-
te der slowenische Theologe, „kann nur dann gesprochen werden, wenn wir nicht aus der Gesell-
schaft und ihren Interessen heraus denken, sondern aus der Sicht des Menschen als Person, als
freiem, verantwortungsvollem und geistigen Wesen, der sich durch seine moralischen Taten als
Ziel seines Lebens verwirklicht“. Die moralische Verwüstung in den ehemals sozialistischen
Ländern bezeichnete er als „Tschernobyl der Seelen“. Die Menschen seien nun nicht mehr fähig,
sich zu irgendeinem klaren und dauerhaften Wert zu bekennen und verantwortungsvolle Ent-
scheidungen zu treffen.
„Es war eine Illusion, zu glauben, nach der Wende könnten die Christen in Osteuropa irgendwie
Staat machen, Entwicklungen nachhaltig beeinflussen“, so der Präsident des Bayerischen Presse-
clubs Hans-Günter Röhrig aus Bamberg. Diese Sichtweise beherrschte auch einen Bericht, den
der reformierte Bischof von Oradea, László Tőkés über die Lage in Rumänien übermittelte. De-
mokratische Institutionen seien zwar entstanden, „aber noch nach alter Art und Weise, oder sie
funktionieren überhaupt nicht“. Nach wie vor ist die kommunistische Parteinomenklatur gegen-
wärtig.
Wie ungebrochen der Machthunger von Altkommunisten ist, wird nachhaltig deutlich in jenem
Teil des ehemaligen Jugoslawiens, in dem Serbiens Milosevic flexibel genug war, die „Zeichen
der Zeit“ zu erkennen. Er übernahm den Nationalismus, baute ihn aus, und konnte „in seinem
Windschatten den (bequemen) Sozialismus bestehen lassen“, so Andrej Smodisch Korrespondent
der ARD für Südosteuropa. Einen Erfüllungsgehilfen fand er dabei in der serbisch-orthodoxen
Kirche. Die orthodoxe Religionszugehörigkeit gehört zum wirkungsvollsten nationalen Erken-
nungszeichen. „Selbst die Kirche steht nicht im Gegensatz zur kommunistischen Regierung: Ver-
eint im Nationalismus ziehen sie an einem Strang, ja letztlich legitimiert die orthodoxe serbische
Staatskirche durch ihr Ja zum Nationalismus das nationalistische Milosevic-Regime und damit
indirekt die serbische Ausprägung des Kommunismus.“ 13 Auf die Problematik des Nationalismus
kommen wir weiter unten in Bezug zur Ökumene zurück. Hier bleiben wir noch kurz bei der
Frage, was der Fall der Mauer bedeutet hat und wie er bis heute nachwirkt.
13 Kathpress 11. 05. 1993. Es ist hier nicht unsere Aufgabe, die Rolle der serbisch-orthodoxen Kirche in der Kosovo-Krise zu erörtern oder gar zu beurteilen. Solche pauschale Aussagen weisen aber auf das Fehlen einer nüchternen Analyse hin, in der die Sichtweise der beschuldigten Orthodoxen mitbeachtet wird.
22
Der tschechische Primas, Kardinal Vlk unterstrich, die sichtbare „Berliner Mauer“ zwischen Ost
und West sei zwar gefallen, aber es gebe nach vier Jahrzehnten der kommunistischen Indoktrina-
tion immer noch „innerliche Berliner Mauern“ in vielen Köpfen.14 Die Mauer, die Europa bis
zum Jahr 1989 spaltete, existiere zwar nicht mehr, in einer gewissen Form sei aber die „Mauer in
den Herzen“ geblieben.15 Um auch diese Mauer abreißen zu können bedarf diese Region einer
tiefgreifenden und mutigen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte. Dafür plädieren
viele politische und kirchliche Verantwortliche und auch Wissenschaftler. Der Prager Historiker
Vilem Precan z.B. forderte eine objektive Prüfung und Wertung der historischen Geschehnisse.
Bisher sei über bestehende Schuld der Mantel des Schweigens gebreitet worden. Zur Aufarbei-
tung der Vergangenheit bedürfe es guten Willens, doch könne er nur ein Anfang sein. Es sei eine
fast übermenschliche Aufgabe, alle Vorurteile in diesem Bereich abzubauen. Eine nur liberale
Haltung sei ungenügend und moralisch unangemessen. Er forderte Mut zur Wahrheit und Ein-
sicht in bestehende Schuld.16 Diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist aber mit der
viel mehr aufgezwungenen Auseinandersetzung mit der Gegenwart belastet und erschwert.
Auf die Tschechische Republik bezogen meint Dominic Jaroslav Duka, Provinzial der böhmi-
schen Provinz des Dominikanerordens und Vorsitzender der Tschechischen Konferenz der Or-
densoberen: ein Großteil der Bevölkerung verfolge die Illusionen, die seit dem Zusammenbruch
der kommunistischen Diktatur gehegt wurden. Er beobachtet zunehmende Spannungen und
wachsende Aggressivität in der tschechischen Gesellschaft. Auch auf die Kirche habe sich die
neue Freiheit keineswegs nur positiv ausgewirkt.17
In ihrer kritischen Zeitanalyse ging Dorothee Sölle, protestantische Theologin auch auf die Situa-
tion der ehemaligen DDR ein. Es bestehe kein Zweifel, dass der „staatsozialistische Versuch
einer gerechten Gesellschaft gescheitert“ sei, gestand die für den Sozialismus engagierte Theolo-
gin ein. Sie kritisierte aber, dass in Deutschland mit dem „Sieg des Kapitalismus die Erfüllung
der Geschichte“ gefeiert werde. Die politische Wende von 1989 habe „nicht nur Befreiung ge-
bracht, der Sieg hat auch Opfer gefordert“. Sölle ortet nach dem Zusammenbruch des kommuni-
stischen Systems im ehemaligen Ostblock drei Gruppen von Verlierern: Die Frauen würden als
erste mit Arbeitslosigkeit und geringer Bezahlung konfrontiert. Die Dritte Welt habe im früheren
„Konkurrenzkampf zweier Systeme jonglieren“ können, im allumfassenden Kapitalismus werde
sie aber durch internationale Finanzorganisationen „in eine neue Form von Schuldsklaverei
schlimmster Ausprägung“ getrieben. Dritte Verliererin sei „die Erde“, da der Kapitalismus „keine
Notwendigkeit sieht, mit der Begrenztheit der Erde zu rechnen“. Die Errungenschaften der De-
mokratie, die den Kapitalismus erträglich machten, spielten hingegen in den neuen kapitalisti-
14 Kathpress 10. 02. 1997. 15 Kathpress 23. 06. 1997. 16 Kathpress 16. 02. 1993.
23
schen Ländern noch keine Rolle. Die Utopie von der Veränderung des „Systems“ dürfe daher
nicht aufgegeben werden.18
Nach Meinungen der oben zitierten verschiedenen Verantwortlichen und Experten wird klar, dass
drei Faktoren die heutige geistige Situation der Gesellschaften, darin der Kirchen dieser Region
bestimmen: ein enormer Mobilisationsschub, welcher die ganze Gesellschaft umstrukturiert, das
Erbe der Vergangenheit und ein Antwortzwang bezüglich der aktueller Fragen der janusköpfigen
Entwicklungen nach der Wende. Diese Faktoren wirken je nach Land anders aus. Allgemein ist
aber die Versuchung zum neuen Ghetto.
Tomas Halík war als geheim geweihter Priester enger Mitarbeiter von Kardinal Frantisek Toma-
sek, 1990 bis 1993 Sekretär der Bischofskonferenz und ist heute Religionsphilosoph an der
Karlsuniversität sowie Hochschulseelsorger. Er zog Bilanz über die Zeit zwischen den zwei
Papstbesuchen in Tschechien (1991 und 1995). Er erinnerte an die Stimmung beim Papstbesuch
vor fünf Jahren. Er sei als „Fest der Freiheit“ erlebt worden, als symbolisches Bekenntnis zu
jenen Werten und Traditionen, die nach Jahrzehnten der Unterdrückung wieder zum Leben er-
wachten, als Manifestation „unserer Rückkehr nach Europa“. Alle seien sich darin einig gewesen,
dass der Papst eine große Fähigkeit demonstriert habe, sich in die spezifische Mentalität der
Tschechen einzufühlen. Seine positive Einschätzung der Gestalt des Reformators Jan Hus sei als
„historische Tat“ empfunden worden: Sie sei ein Schritt zur Heilung der „Narben der Vergan-
genheit“ gewesen, zur Beseitigung der Hindernisse, die seit Jahrhunderten zwischen dem „tsche-
chischen Patriotismus“ und der katholischen Kirche liegen. Der Papst habe damals auch voraus-
schauend die tschechischen Katholiken aufgefordert, nicht zu den überlebten Formen des kirchli-
chen Lebens zurückzukehren. Statt dessen sollten sie „solidarisch mit allen Wahrheitssuchenden
und Freiheitsliebenden“ ihre in der Verfolgungszeit gewonnenen Erfahrungen nutzen, sich nicht
in ein Ghetto zurückziehen, sondern zum Sauerteig der freien Gesellschaft werden.19
Heute drohe genau das einzutreten: „Manche meinen, die katholische Kirche in Böhmen werde
tatsächlich allmählich zu einem Ghetto am Rande der Gesellschaft“, konstatierte Halík. Die Ent-
wicklung sei nicht so dramatisch, wie sie im Blick allein auf die statistischen Zahlen und auf das
Bild der Kirche in den Medien erscheine. Was sich auffallend geändert habe, sei nicht der Grad
der Religiosität, sondern eher die Akzeptanz der Kirche in der Gesellschaft. Es gehe nicht so sehr
die Zahl der Kirchgänger und der aktiven Gläubigen zurück als die der „Sympathisanten“. Bei
dieser letzten Gruppe sei das verbale Bekenntnis zur Kirche in der Zeit der Wende „eher eine
Distanzierung vom Kommunismus und eine Art Würdigung der Rolle der Kirche (konkret Kar-
17 Kathpress 25. 03. 1994. 18 Kathpress 22. 05. 1995. In diesen Punkten stimmt Sölle mit der Sicht des Papstes Johann Paul II. überein, der in
Centesimus Annus 25-28 diese Zusammenhänge eingehend betrachtet hat. 19 Ähnliche Forderungen stellte der Papst auch an die ungarischen Bischöfe bei seinem ersten Ungarnbesuch 1991.
24
dinal Tomaseks und dessen Mitarbeiter) in der Zeit des Widerstands gegen das totalitäre Regime“
gewesen, so der Theologe. Die „Sympathisanten“ hätten an die Kirche in der freien Gesellschaft
zum Teil Erwartungen gehegt, „die sie nicht erfüllen kann“. Andererseits sei die Kirche zu stark
durch die Zeit der Verfolgung geprägt gewesen, um sogleich völlig neue Strategien für ihre Tä-
tigkeit zu entwickeln.20
Auch der Wiener Pastoraltheologe, Prof. Paul M. Zulehner warnte auf Grund von statistischen
Daten vor dem Versuch, an die Verhältnisse vor dem Beginn der kommunistischen Herrschaft
anzuknüpfen. Dieser „historisierende Weg“ würde die Kirchen in ein „soziales Ghetto“ führen.21
Eine andere Form von Ghetto entsteht, wenn die Kirchen sich verschiedenen „C“-Parteien auslie-
fern. Im kommunistischen System, als die Partei gelernt hat, die Kirchen eher zu instrumentali-
sieren als zu vernichten, entstand ein ideologisches Zelt über Gesellschaft und Kirche. Nach dem
Wechsel scheint die Gefahr unumgänglich zu sein, dass ein neues ideologisches Zelt über der
Kirche aufgeschlagen wird. Das erste Zelt war kirchenfeindlich motiviert, das letztere erscheint
kirchenfreundlich, beide verhindern aber die autonome Entwicklung und Erneuerung der Kirche.
Um dieser Gettoisierungsgefahr zu entgehen, muss die Kirche für eine neue „politische“ Kultur
optieren. Die Zukunft der Kirche dieser Region hängt davon ab, wie sie die Alternative Ghetto
versus Exodus gestaltet.22 Ein neues Wagnis ist gefordert, sich nicht nach dem alten, vorkommu-
nistischen Muster, aber auch nicht in der Art der aufgezwungenen Sakristeiexistenz zu positionie-
ren, sondern – auf die Zeichen der Zeit achtend – aus der Kraft der Phantasie eines lebendigen
Glaubens mutige Schritte zu tun. Darin scheint ihre genuin christliche Aufgabe in der heutigen
Zeit dieser Region zu liegen. Diese Grundrichtung wird in vielen Stellungnahmen Option für eine
neue Kultur genannt.
NEUE KULTUR
Bischof Joachim Wanke (Erfurt) machte die Chancen, aber auch die Schwierigkeiten deutlich, die
mit dem ermöglichten „Weiterbau in Freiheit“ für die Katholiken in der DDR entstanden sind.
Generell seien die Probleme einer Verwurzelung des Christlichen in der Gesellschaft der DDR
jenen der Inkulturation in anderen säkularisierten Gesellschaft vergleichbar. Gerade hier sei es
aber wichtig, dass man nach der Abschüttelung eines unterdrückenden Regimes eine Kirche erle-
20 Kathpress 10.05.1995 21 Kathpress 27. 01. 1993. 22 Diese Alternative sah der vor einigen Jahren verstorbene deutsche Konzilstheologe Alois Müller bezüglich der
Konzilsrezeption. Vgl. ders., Der dritte Weg zu glauben. Christsein zwischen Rückzug und Auszug, Mainz 1990.
25
be, die ein Hort der Freiheit sei. Eine solche Kirche könne in einer pluralistischen Gesellschaft
ihren eigenständigen und wertvollen Beitrag zum Neubeginn beisteuern.23
Mit den Worten der thüringischen Pfarrersfrau Christina Vater: „Den Christen fehlt der Wind,
der sie während der Revolution zur Freiheit emporgehoben hat“. Jetzt wüchsen ihnen wieder
Gewichte an den Füßen. Viele Christen aus dem Widerstand sind dort jetzt aus dem gesellschaft-
lichen Abseits in die Arena der Staatspolitik getreten, bekleiden hohe Ämter in der Regierung.
Der „religiöse Impetus“ der ursprünglichen Bewegung sei weitgehend verloren gegangen, be-
merkte Jiri Payne, einst Heizer, nunmehr Abgeordneter im ersten freien Parlament Tschechiens.24
Immer schwerer werde es, der Entwicklung zu einer oberflächlichen Konsumgesellschaft mit
einem christlichen Ethos entgegenzutreten, betonte Tomas Halík. Die Kirche dürfe sich nicht mit
Warnungen vor einem Wertverlust begnügen, sondern müsse „kreativ“ sein und die „anderen
Werte“ vorleben. Vor allem sei hier der Dialog mit Mensch, Natur und Gott gemeint. Vaclav
Maly, Priester und ehemaliger Sprecher des „Bürgerforums“, nunmehr Weihbischof in Prag,
betonte die Chance der Kirche, Brücke zwischen Tschechen und Slowaken zu sein. Den slowaki-
schen Nationalismus schrieb er den Machtgelüsten einzelner Politiker zu, die das Volk miss-
brauchten.25
Für Kroatien betonte Bischof Komarica, dass die Kirche zwar ihre Gläubigen „im Geist des Plu-
ralismus“ erziehen und zugleich „Lücken mit wahren geistigen Werten füllen“ müsse. Darüber
hinaus komme ihr jedoch zu, „den Weg der authentischen Tradition kroatischer Kultur in die
Zukunft hinein zu verlängern“.26
Die Kirche werde beim Aufbau der ehemals sozialistischen Länder gebraucht. Weil sie, so Bi-
schof Komarica, „keine eigene Kultur hat“, sondern ihren Beitrag „in bestehende nationale Kul-
turen inkorporiert“, stellt sich ihre Aufgabe in jedem Land unterschiedlich.27
Der Bischof von Tarnow, Josef Zycinski sagte, „wir träumen nicht von einem naiven Pluralis-
mus“. Die polnische Volkskirche habe eine Zukunft, wenn sie sich seelsorglich auf „soziokultu-
relle Wandlungen“ einstelle. Das Zeugnis für die Werte des Evangeliums auch angesichts einer
„Fluktuation der Moden“ könne jedoch „in denselben Haltungen gesehen werden, die die Zeit-
probe während der Bedrohung durch den marxistischen Materialismus überstanden haben“.28
Der Erfurter Moraltheologe Wilhelm Ernst betonte, die Kirche stehe mit ihrer Soziallehre in
Deutschland vor einer „neuen Sozialen Frage“, die „weit umfassender“ sei als die Arbeiterfrage.
23 Kathpress 13. 08.1990. 24 Kathpress 04. 01. 1991. 25 Kathpress 04. 01. 1991. 26 Kathpress 06. 09. 1991. 27 Kathpress 06. 09. 1991. 28 Kathpress 06. 09. 1991.
26
Sie bestehe im „Ungleichgewicht“ zweier Mentalitäten. Weder eine „liberalistische“ noch eine
„Einheitsgesellschaft“ dürfe dabei entstehen. Die Kirche trage dazu durch den Ausbau der Bil-
dungsarbeit bei.29
Für den ostdeutschen Priesterphilosophen Konrad Feiereis liegt die „geistige Ursache“ für die
„Orientierungslosigkeit so vieler Menschen im Osten“ im Zusammenbruch des Fortschrittsden-
kens der kommunistischen Utopie. Auch „Pseudoästhetik und mancherlei Pseudokultur“ der
DDR wie Uniformen, Aufmärsche, Fahnenappelle und Rituale hätten ein deutliches Vakuum
hinterlassen. Schwerwiegende Konsequenzen habe nicht zuletzt die Tatsache, dass der Marxis-
mus „den klassischen Person-Begriff über Bord“ geworfen habe, der doch die Grundlage ethi-
schen Erkennens sei. Der zentrale Begriff „Gewissen“ sei „bis 1985 im staatlich verordneten
Atheismus unbekannt geblieben“, erklärte der Erfurter Philosoph. Die Kirche habe in dieser Si-
tuation eine doppelte Aufgabe: die Grenzen einer Ethik ohne Gott deutlich zu machen und durch
das „gelebte christliche Ethos Einfluss zu nehmen auf die Genese der sittlichen Erkenntnis der
Nichtglaubenden“.30
Der Blick der Gesellschaft richte sich derzeit „viel zu verengt“ nur auf die produktive Arbeit,
betont der Jenaer katholischer Pfarrer, ein Initiator des „runden Tisches“ in der ehemaligen DDR
Karl-Heinz Ducke. Dies müsse die Kirche herausfordern. Ihre Aufgabe sei es, die „vergessenen
Wirklichkeiten über den Menschen“ in Erinnerung zu rufen und neu nach dem Menschenbild zu
fragen. Der gesellschaftliche Stellenwert des Einzelnen dürfe nicht allein über die Arbeit festge-
legt werden. Würde und Wert des menschlichen Lebens hätten eine größere Bedeutung. Arbeits-
plätze wird dieser Priester mit diesen Hinweisen freilich nicht vermitteln können, vielleicht aber
Selbstwertgefühl oder zumindest Trost.31
Auf ganz Europa blickend formuliert Kardinal Vlk: Die Versöhnung der Christen aus Ost und
West sei dazu ein wichtiger Beitrag. Die politische Wende von 1989 bedeute auch für die Kir-
chen eine Herausforderung. Diese bestehe darin, einen Beitrag zu leisten, damit Europa „wieder
eine Seele bekommt“ (Jacques Delore). Es gehe darum, dass das gesamte Haus Europa ein
„wohnliches Haus“ wird. Dieses Haus habe zwar „verschiedene Wohnungen“, es habe aber nur
dann Bestand, wenn die Bewohner das Haus gemeinsam unterhalten. In der Vergangenheit sei
das nicht immer so gewesen, meinte Vlk und verwies auf die „unterschiedlichen Wege“ der
christlichen Kirchen. Die Bewohner des Hauses hätten verschiedene Interessen und Vorstellun-
gen gehabt, wie man das Haus bestellen sollte. Daneben habe es auch politische Gründe gegeben,
29 Kathpress 06. 09. 1991. 30 Kathpress 19. 01. 1993. 31 Kathpress 18. 07. 1991.
27
denn – so der Kardinal – „manche Regierungen versuchten, Kirchen oder Christen zu instrumen-
talisieren“.32
Diese Stimmen über den Beitrag der Kirche in den Länder der Region zeigen einstimmig, dass
die Kirche mit ihrer Kultur der christlich-ethischen Werte ein Sauerteig für die Gesellschaft sein
kann. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, müsse die Kirche auch eine innere Wende durch-
führen, die teils den Herausforderungen der Zeit entspreche, teils eine Bedingung für die glaub-
würdige Verkündigung sei. Manche Verantwortlichen der Kirche sind dieser Aufgabe bewusst.
Eine allzu rasche Kirchenreform zu wünschen wäre dennoch auch in dieser Region eine Zumu-
tung.
WENDE IN DER KIRCHE
„Ich bedaure es sehr, dass die Leitung unserer Kirche die Warnungen sowie die inspirierenden
Aufforderungen Johannes Pauls II. vor fünf Jahren sowie einige kritische und umsichtige Stim-
men innerhalb der Kirche nicht genügend ernstgenommen hat“ – so Halík im 1995. Vor allem die
Stimmen der jüngeren Generation katholischer Intellektueller und Publizisten, die sich heute vom
Zustand der Kirche „desillusioniert und enttäuscht fühlen“, würden zu wenig gehört. Der tsche-
chische Primas, Kardinal Miloslav Vlk, habe mit Recht auf entscheidende Defizite hingewiesen:
Es mangle in seiner Kirche an einer Kultur des Dialogs, die Laien verfügten nicht über genügend
Raum, um ihre Verantwortung für die Kirche geltend zu machen, es habe manches von der vor-
konziliaren Mentalität überlebt. Halík weiter: „Leider lassen sich bei einigen Bischöfen und an
einigen theologischen Fakultäten Provinzialismus sowie Unfähigkeit beobachten, vor allem die
Unfähigkeit, die Zeichen der Zeit zu lesen und dringliche Reformen des Seelsorgestils einzulei-
ten.“
Man müsse in Zukunft mehr Augenmerk auf eine solide Ausbildung von Priestern und Laien le-
gen, den Umgang der Kirche mit den Massenmedien verbessern, im ökumenischen Bereich ein-
fühlsamer sein und zwischen Kirche und Gesellschaft Brücken schlagen, forderte Halík. Vieles
werde sich in Ost(Mittel)Europa erst mit einem Generationswechsel ändern, „einiges ist jedoch
unbedingt bereits jetzt zu machen“. „Wenn wir nicht alles durch die Kirche in der Verfolgungs-
zeit Erreichte vertun wollen, muss der Kurs der letzten Jahre in bedeutendem Maß revidiert wer-
den.“
Für eine Erneuerung der katholischen Kirche in Ungarn im Sinne der beiden Briefe des hl. Paulus
an die Korinther hat sich der ungarische Theologe György Benyik ausgesprochen. Die urchristli-
che Gemeinde in Korinth habe damals vieles aus der dortigen Gesellschaft aufgegriffen, was ihr
32 Kathpress 23. 06. 1997.
28
positiv erschien. Korinth sei beispielsweise jener Ort gewesen, wo im antiken Christentum erst-
mals die Gleichstellung der Frau verwirklicht wurde. Innerhalb der christlichen Gemeinde in
Korinth hätten Frauen auch führende Ämter bekleiden können, in ihr hätten sich Mann und Frau,
Reiche, Arme und Sklaven gleichwertig gefühlt.
Er habe das Gefühl, dass die ungarische Kirche nach der Wende noch nicht den „entsprechenden
Ton“ gefunden habe, mit dem sie die ungarische Gesellschaft wirklich ansprechen könne. Die
heute in Ungarn lebenden Menschen hätten eine völlig andere Denkweise als sie Menschen vor
30 bis 40 Jahren. Wenn man diese neue Denkweise nicht ernstnehme oder hochmütig verurteile,
könne man den Menschen nicht das Evangelium vermitteln. Man müsse im Gegenteil – wie die
ersten Christen in Korinth – die Lebensweise der Menschen kennen und verstehen lernen, erst
dann könne man ihnen die christliche Botschaft nahe bringen, unterstrich der Theologe.33
Die berechtigte Aufforderung, die Kirche müsste sich an biblischen Leitbilder orientieren, stellt
aber die Frage nach der Verständnis der Botschaft der Evangelien. Im Blick auch auf dieses Pro-
blem haben Kardinal Franz König und Prof. Jakob Kremer ein Glaubensbuch veröffentlicht. Den
Anstoß zur Erarbeitung der Publikation gaben unter anderem die Orientierung suchenden Men-
schen aus Ost(Mittel)Europa . Konkreter, die Tausenden von Tschechen und Slowaken, die in
den Tagen nach der „Wende“ durch die Strassen Wiens zogen. Die Sorge, welches Bild diese
Menschen „von uns Christen im Westen“ erhalten, bewog Kardinal Dr. König und den Wiener
Ordinarius für Neutestamentlichte Bibelwissenschaft, Univ. Prof. Dr. Jacob Kremer, einen
schmalen Band herauszubringen, der den programmatischen Titel trägt „Jetzt die Wahrheit le-
ben – Glauben an der Schwelle zum dritten Jahrtausend“. Jakob Kremer: der Band möchte eine
Orientierung bieten, was auf dem Hintergrund neuerer theologischer Forschung – „und in Ab-
grenzung zu verbreiteten Missverständnissen“ – katholischer Glaube ist. Das Buch wendet sich
an „Glaubende, Verunsicherte und Nichtglaubende im Westen“, es ist aber ebenso mit dem Blick
auf die geistige Orientierungslosigkeit in den Länden des einstigen Ostblocks geschrieben. Viele
Menschen seien zwar auch heute von Jesus fasziniert, aber „falsche Vorstellungen“ über den
christlichen Glauben bildeten für sie eine Barriere. 34
Neben der Neubesinnung auf die recht verstandene biblische Botschaft, ist die nüchterne Analyse
der Erfahrungen der Menschen eine wichtige Quelle der kirchlichen Erneuerung. Diese Zeit der
Unterdrückung, Verfolgung und Instrumentalisierung durch die roten Regierungen sollte man
aber mit kritischem und selbstkritischen Blick zu betrachten.
Es sei nämlich eine Täuschung zu meinen, die osteuropäischen Kirchen seien gestärkt aus der
Unterdrückung durch die kommunistischen Regime hervorgegangen, bekannte der Prager Erzbi-
33 Kathpress 13. 09. 1994. 34 Kathpress 02. 10. 1991.
29
schof Miloslav Vlk, Vorsitzender des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen (CCEE). Für
mehr als die Hälfte der tschechischen Bevölkerung sind Glaube und Religion heute Fremdwörter.
Die nach der Wende häufig propagierte Einteilung in den „glaubensstarken Osten“ und den „gott-
losen Westen“ Europas ist überholt. Doch die Verständigung über den Geschichte gewordenen
ideologischen Graben hinweg fällt auch heute noch nicht leicht.35 Mehrere Experten, Bischöfe
und Theologen der Region beobachten, dass die kommunistische Diktatur auch die Kirchen, die
mehr oder weniger einen Widerstand geleistet haben, doch infiltrierte.36
„Wir blieben eine dirigierende Kirche“ schreiben die tschechischen Bischöfe. Dr. András Szen-
nay OSB, Altabt der alten Benediktinerabtei von Pannonhalma in Ungarn, führt diese Gedanken
weiter. Die Meinung der Tschechischen Bischofskonferenz und ihres Sekretärs trifft leider auch
auf die ungarischen Zustände zu. Mehr als einmal habe er in den vergangenen Jahren von Gläu-
bigen und Priestern gehört: In unserem Land übt jetzt die Kirche den dirigierenden Stil des
Kommunismus aus. Das sei ein Hinweis darauf, dass wir noch weit entfernt sind von der Praxis
einer christlichen, brüderlichen Gemeinschaft. Die Bischöfe bieten den Priestern und Gläubigen
das Bild einer dirigierenden, allwissenden Kirche, wenn sie nicht bereit sind, Priester und Laien
mit Fachkenntnissen in ihre Beratungen einzubeziehen. In unserer Kirche ist es sehr schwer, die
Praxis des Pluralismus zu leben. Wer anders sieht, formuliert, handelt (nicht von Glaubenswahr-
heiten ist die Rede!), erwecke in den Reihen des unteren und oberen Klerus oft Argwohn, aber
auch Angst. In der theologischen Literatur sei die „Vielfalt in der Kirche“ ein Gemeinplatz. Doch
eine ganze Generation denke bei uns noch im primitiven Bild der „festen Burg“, der „acies bene
ordinata“.37
Der neue Stil der Pastoral wurde bereits in der Untergrundkirche eingeübt, wo die Gruppen fast
über keine gesellschaftliche Institutionen verfügten. Ihre einzige Kraft in der Verkündigung war
das glaubwürdige und wahrhaftige Zeugnis des gelebten Glaubens. Dies könnte als Richtschnur
für die jetzige Zeit gelten. Nicht die Frage nach einer Katechese, sondern nach dem, was Chri-
stentum bedeutet, wäre vor allem relevant, betonte der Budapester Pfarrer und Pastoraltheologe
Ferenc Tomka. Nicht das „Vortragen“ sei entscheidend im pastoralen Stil, sondern die eigene
Glaubenserfahrung aus der Zeit der Untergrundbewegung.38
Was Dominik Toth, Weihbischof in Trnava, für die Slowakei feststellte, könnte als gemeinsames
Thema der katholischen Kirche in den ehemals sozialistischen Staaten stehen: „Unsere Kirche
hat heutzutage volle Freiheit“, doch das „gelobte Land“ stehe noch aus. Erst nach einer „inneren
35 Kathpress 14. 09. 1993. 36 Zu dieser Problematik s. Gönner, Die Stunde der Wahrheit. 37 Kathpress 09. 02. 1993. 38 Kathpress 04. 09. 1991.
30
Reinigung“, vergleichbar dem alttestamentarischen „Zug durch die Wüste“, werde man ans Ziel
gelangen.39
Für diese biblische und kontextuelle Neubesinnung sind Diözesansynoden geeignete Mittel, die
auch bei den vielen Besuchen des Papstes in dieser Region von diesem gefordert wurden. Als
eine „Wasserscheide“ auf dem Weg der ungarischen Kirche im nachkommunistischen Zeitalter
bezeichnete der Jugendseelsorger Miklos Blanckenstein (Budapest) den Papstbesuch. Besonders
die Forderung des Papstes nach der Durchführung von Diözesansynoden habe etwas in Bewe-
gung gebracht.
Sehr wichtig war bereits nach der Wende der Ausbau des Laien-Sekretariats bei der ungarischen
und auch bei anderen Bischofskonferenzen, das nicht nur dem Aufbau der Katholischen Aktion,
sondern auch den vielfältigen Laienbewegungen als ein mehr informelles Forum dienen soll. Der
Pressesprecher der ungarischen Bischofskonferenz, P. Laszlo Lukacs, gab sich vorsichtig optimi-
stisch in Bezug auf die vielfältigen Ziele, die sich die ungarische Kirche gesetzt hat. Ein Zeitraum
von zwei Jahren sei jedoch zu kurz, um eine tiefgehende Erneuerung einzuleiten, sagte er 1991.40
Der Alterzabt von Pannonhalma (Ungarn), Andras Szennay OSB, erinnerte: bei allen Papstbesu-
chen war – mit entsprechendem Gewicht – die Rede von den Laien. Die Aktivierung der Laien ist
vielerorts eine Schlüsselfrage. Ohne sie einzubeziehen und aufzuwerten werden wir bald bankrott
sein. Wir sollten sie endlich nicht mehr nur für „Lückenbüßer“ halten, sondern entsprechend
unseren theologischen Grundsätzen, nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen offiziellen kirchlichen
Erklärungen, schätzen. Gründe unserer Rückständigkeit in der Laienfrage sind das nicht zeitge-
rechte Kirchenbild und der Klerikalismus. Neben den sich theologisch bildenden und fortbilden-
den, tief religiösen Laien leben die Priester oft mit einem Gefühl von Minderwertigkeit. Ohne
Zweifel sind bei uns die Priester überlastet, viele arbeiten in einem Ausmaß, das ihrer Gesundheit
schadet. Einer der Gründe dafür ist aber gerade, dass Laien als Mitarbeiter nicht angenommen
werden. Schon in den Seminaren müssten die Priesteramtskandidaten zu einer Zusammenarbeit
mit den Laien erzogen werden. Umgekehrt müssten wir die besten Priesterkräfte bei der Ausbil-
dung der Laien einsetzen. Jene Laien, die schon arbeiten, oft aus purer Begeisterung, sollten mit
Liebe unterstützt und gefördert werden.
Wenn innerhalb von ein bis zwei Jahren nicht Hunderte von Laienmitarbeitern eingesetzt werden,
bleiben die Gläubigen infolge des katastrophalen Priestermangels ganz auf sich allein gestellt.
Sind die Laien dem „Zentrum“ und vielen Bischöfen, Priestern, immer noch so zuwider? Oder
39 Kathpress 06. 09. 1991. 40 Kathpress 19. 11. 1991.
31
hegen die Kleriker „Eifersucht“? Ich möchte hoffen, dass es nicht so ist. Ferner möchte ich fra-
gen: Wie lange wartet Rom noch mit der Weihe der „viri probati“?41
Die innere Erneuerung der Kirche braucht nach den Stellungnahmen der oben zitierten Amtsträ-
ger und Experten eine tiefe Besinnung auf die biblische Offenbarung und zugleich auf die Erfah-
rungen der letzten Jahrzehnte. Neben der Wende in der Besinnung ist auch eine Wende in der
Gestaltung der Strukturen der Kirche vonnöten. Hauptaspekte dieser strukturellen Erneuerung
sind vor allem die Abhaltung von Diözesansynoden, die Akzeptanz der pastoralen Kompetenz
der Laien sowie die Organisierung neuer Dialogstrukturen, wobei die Sekretariate der Bischofs-
konferenzen eine führende Rolle spielen können.
Diese Prozesse müssen theologisch inspiriert und begleitet werden. Eine solche Rolle der Theo-
logie, vor allem der Pastoraltheologie, ist durch die allgemeine Lage der Theologie dieser Region
geprägt. Die folgenden Aussagen zeigen einige Problempunkte der theologischen Erneuerung
auf.
THEOLOGISCHE BERÜHRUNGSÄNGSTE
Nach dem Fall der Mauer wurde es plötzlich möglich, zwischen West und Ost gegenseitige theo-
logische Treffen und Konsultationen abzuhalten. Die bis zur Wende voneinander getrennt arbei-
tenden Kollegen konnten unbehindert Einblick in die Arbeiten der Anderen zu erhalten. Diese
neue theologische Situation verursachte Berührungsängste, weckte Abwehrmechanismen und
förderte nicht selten Pauschalurteile. Neben der anfänglichen Suche nach einem intensiven Dia-
log mehrten sich immer mehr die Stimmen, die (vor diesem) eine genuine osteuropäische Theo-
logie wünschten. Eine Theologie, die fähig ist die speziellen Erfahrungen dieser Region souverän
und auch die westliche Theologie inspirierend zu erörtern. Die nächsten Abschnitte werden einen
ansazthaften Einblick in dieses Territorium ermöglichen.
Tomas Halík, bis Anfang des Jahres 1993 Sekretär der Tschechischen Bischofskonferenz, meint:
in den westlichen Ländern erscheint das Pochen der osteuropäischen Kirchen auf ihre spezifische
Glaubenserfahrung unter dem Kommunismus allzu leicht als eine Art Märtyrerkomplex, der den
Blick auf die pastoralen Herausforderungen der nachkommunistischen Lebenswelt eher verstellt
als erhellt. Irritiert und zuweilen in deutlicher Abwehrhaltung blickt umgekehrt die Kirche der
mittel- und osteuropäischen Länder auf die westliche Bedrohung durch Säkularisierung, Kon-
sum- und Profitgier, nicht zuletzt auf die Theologie im Westen, an die sie in den letzten Jahr-
zehnten der Isolation den Anschluss verloren hat. Vielfach werde die Theologie von den Kirchen
Osteuropas für einen „Luxus“ gehalten. Dies sei ein Irrtum und berge die Gefahr eines „reflexi-
41 Kathpress 09. 02. 1993.
32
onslosen, seichten Praktizismus“. Er fordert eine aus der Glaubenserfahrung unter dem Kommu-
nismus erwachsende Theologie, eine „Theologie nach dem Gulag“. Auch Halík sorgt sich, dass
die unter der politischen Knebelung entstandene enge Verbindung der Kirche mit der Bevölke-
rung unter den neuen Bedingungen einer freien, pluralen Gesellschaft verloren gehen könnte. Die
Kirche werde bald am Rande der Gesellschaft landen, wenn sie der modernen Gesellschaft mit
jener Strategie und Widerstandspsychologie begegne, die sie unter dem Marxismus hatte überle-
ben lassen.42
Die andere Seite dieser Medaille vertritt der Professor für Dogmatische Theologie an der Theolo-
gischen Akademie in Warschau, der Dominikanerpater Jacek Salij. Er rechtfertigte in einem Ge-
spräch mit polnischen Journalisten die Warnung Johannes Pauls II. vor „kritischen Theologen“:
„Es entspricht nicht den vom hl. Paulus aufgestellten Prinzipien zur Ordnung in der Kirche, wenn
Theologen versuchen, in der Kirche den Papst zu spielen. Sie haben einen ganz anderen Platz in
der Kirche.“ Der Papst erinnere in seiner Enzyklika (Veritatis splendor) daran, dass die Gesetze
heute nicht weniger bindend seien als zur Zeit ihrer Niederschrift, so Salij weiter. Die Moralge-
setze hätten eine ebenso zwingende Gültigkeit wie die physikalischen Gesetze. Deshalb könne
man das Dokument weder als „konservativ“ noch als „progressiv“ einreihen. „Die Missachtung
der Moralgesetze bringt immer Schaden – so wie ein Mensch, der das Gravitationsgesetz miss-
achtet und ins Fenster steigt, immer herunterfallen wird.“43
Die Problematik der West-Ost Zusammenarbeit an pastoraler und auch an theologischer Ebene
zeigt u.a. in der Slowakei, wo auch Bischöfe und Theologen meinen: manche Ratgeber aus dem
Ausland „bemuttern“, um nicht zu sagen belehren den slowakischen Episkopat.44 Die Bilanz, die
die Kirche nach fünf Jahren postkommunistischer Aufbauarbeit aufzuweisen hat, ist beachtlich,
aber es bleiben große Probleme: Wie kann der Glaube unter den Bedingungen des Übergangs
vom Kommunismus zur pluralistischen Konsumgesellschaft überzeugend gelebt werden? Trotz
der vielfältigen Unterschiede zur Tschechischen Republik und zu Ungarn – mit dem das Verhält-
nis wegen der großen und selbstbewussten Minderheit in der Slowakei gespannt ist – treten wie
in diesen Ländern auch in der Slowakei deutlich die großen Sorgen um die künftige Intelligenz
und um die künftigen Seelsorger, Priester, Diakone und Laien, zutage. Die Ausbildung der aka-
demischen Lehrer ist mangelhaft, vielfach vorkonziliar und mit neuen pädagogischen Einsichten
wenig konform.
Welchen Stellenwert das Zweite Vatikanische Konzil mit seinen zahlreichen pastoralen und ge-
sellschaftspolitischen Impulsen in der Realität des kirchlichen Lebens in der Slowakei hat, ist
42 Kathpress 14. 09. 1993. 43 Kathpress 08. 10. 1993. 44 So in einer Kathpressbericht zu dem Papstbesuch in der Slowakei 1995 Franz Humer, ein guter Kenner der östlichen
Nachbarstaaten von Österreich (Kathpress 29. 06. 1995).
33
schwer bis unmöglich auszumachen. Jene allerdings, die Angst vor dem Konzil und seinen
schmerzhaften Folgen haben, werden mitunter vom „Westen“ her in ihren Einwänden und Ge-
genargumenten unterstützt.45
Zu den wichtigsten Aufgaben der Theologie dieser Region gehört angesichts der drohenden eth-
nischen und nationalen Konflikten sicher die „Neutralisierung“ von Vorurteilen und Missver-
ständnissen. Der bosnische Religionssoziologe, Marco Orsolic schlug vor, für das 1997 in Graz
geplante ökumenische Treffen ein Dokument vorzubereiten, das mit den „Gespenstern der neue-
sten Vergangenheit“ sowie mit den Gräueltaten der jetzigen Zeit aufräumt. Noch seien aber die
charismatisch-prophetischen Potentiale des Glaubens durch „halbbewusste Bindung“ an Staaten
und Nationalitätsideologien gefesselt. So verstelle sich der Blick auf die universellen Werte der
menschlichen Würde und die daraus abgeleiteten Menschenrechte sowie Gerechtigkeit im Zu-
sammenleben der Völker bedauerte Orsolic. Die nationale Inbesitznahme von Religion habe in
Europa eine lange Geschichte. Geradezu exemplarisch sei die Existenz der vier europäischen
Kaiserreiche gewesen: Österreich-Ungarn als katholisches, das Zarenreich orthodox, islamisch
die Osmanen und protestantisch das deutsche Kaiserreich. Diese seien mit dem ersten Weltkrieg
zwar alle untergegangen, die geschaffenen Feindbilder wirken aber weiter, betonte Orsolic. Das
Zweite Vatikanische Konzil habe eine radikale Wende zur Bibel und zu dem, was Religion ei-
gentlich sei, gebracht. Nur dieser radikale Blick auf die Heiligen Schriften der monotheistischen
Religionen könne den religiös motivierten Feindbildern entgegentreten. Orsolic zitierte dazu den
Koran: „Mit den Schriftbesitzern (gemeint sind Juden und Christen) streitet nur auf die anstän-
digste Weise...und sagt: „Wir glauben an das, was uns und an das, was Euch geboffenbart wor-
den ist.“ Um diesen Gedanken im Konzilsdekret „Nostra aetate“ zu formulieren, habe die katho-
lische Kirche fast anderthalb Jahrtausende länger gebraucht, stellte Orsolic fest. Zu den drei mo-
notheistischen Religionen Islam, Judentum und Christentum gebe es keine Parallele in der gan-
zen Religionsgeschichte. Orsolic erinnerte an eine Aussage des Wiener Alterzbischofs Kardinal
Franz König, der das gemeinsame Erbe dieser drei Religionen als Ausgangsbasis für „Völkerver-
ständigung, Gerechtigkeit und Frieden“ bezeichnet hatte. Orsolic bedauerte es in diesem Zusam-
menhang sehr, dass zur laufenden Konferenz keine Muslime oder Juden als Beobachter eingela-
den worden seien.46
Dass nach 1989 gerade jüngere Theologen und Studenten der Ökumene ablehnend gegenüberste-
hen, hat nach Einschätzung des rumänischen orthodoxen Theologen Doz. Dr. Dorin Oanceas
mehrere Gründe. Für die ältere und mittlere Theologengeneration sei der Ökumenismus zu etwas
derart Selbstverständlichem geworden, dass sie sich in ihrer Lehre kaum mehr mit der Begrün-
dung der Einheit der Kirchen, sondern eher mit ihrer Vertiefung befassten. Auch sei man nach
45 Kathpress 29. 06. 1995.
34
der Wende mit so vielen anderen, unerwarteten Fragen konfrontiert worden, dass man die Wei-
tergabe ökumenischer Überzeugungen vernachlässigt habe. Zudem sei – so der siebenbürgische
Theologe – das orthodoxe Modell von Ökumene unzulänglich und nicht ausreichend fundiert,
hier liege „der empfindlichste Punkt“. Vor allem müssten Theorie und Glaubensvollzug in ein
einheitliches Ganzes gebracht werden. Dazu seien neue Denkansätze notwendig. Man brauche
ein „ökumenisches Verständnis der Welt, in dem einerseits die Vielfalt christlicher Glaubens-
und Lebensformen und andererseits die Einzigartigkeit der orthodoxen Glaubenswelt zur Geltung
kommt“. An der Theologischen Fakultät in Sibiu beginne man nun, ein solches Modell zu ent-
wickeln. Es soll in der Folge auf orthodoxer Ebene und dann auch mit Partnern anderer Konfes-
sionen diskutiert werden.47
Der katholische Krakauer Wissenschaftler Zdzislaw Kijas berichtete von den heutigen Schwie-
rigkeiten des Ökumenischen Rates der Kirchen in Polen, glaubhaft für die Verständigung zwi-
schen den Konfessionen einzutreten. Die kommunistischen Machthaber wollten eine Annäherung
und Zusammenarbeit der Kirchen verhindern. Der Ökumenische Rat habe sich – mitverursacht
durch mangelnde Gesprächsbereitschaft der Katholiken – für den Kampf der Kommunisten ge-
gen die katholische Kirche missbrauchen lassen. Dies belaste noch heute das Klima. Kijas sieht
allerdings eine Reihe von bescheidenen, aber wachsenden ökumenischen Initiativen in Polen, vor
allem auch an den Theologischen Hochschulen. Notwendig sei, dass alle Kirchen zu einer „offe-
nen“ anstelle einer „geschlossenen“ Ekklesiologie gelangen. Für die katholische Kirche werde
dabei eine eingehende Beschäftigung mit dem Zweiten Vaticanum, die in KP-Zeiten nicht mög-
lich war, wesentlich sein.48
Eine konzilsgemäße ökumenische Einstellung ist ansatzhaft schon in der Zeit der Kirchenverfol-
gung da gewesen, wie der Prager katholische Theologe Univ. Prof. Dr. Oto Madr berichtete. Er
verwies aus den Erfahrungen der Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Totalitarismus
auf den „praktischen Ökumenismus“, wie er sich schon vor dem Konzil unter den inhaftierten
Christen unterschiedlicher Konfessionen entwickelt hatte. Aus der Erkenntnis, dass alle Formu-
lierungen der Wahrheit nur „Annäherungen“ seien, müsse eine neue Bescheidenheit im ökumeni-
schen Dialog wachsen. Prof. Madr bezeichnete es als zentrale Aufgabe, die „Zeichen der Zeit“
richtig zu deuten: Alle Christen müssten zur Erkenntnis kommen, dass sowohl die ganze
Menschheit als auch die Natur „unsere Nächsten sind“.49
Um eine gewisse Stagnation in der Ökumene zu überwinden, muss nach Ansicht des rumäni-
schen orthodoxen Theologen Doz. Dr. Dorin Oancea die Beziehung zwischen Kirche und Staat
46 Kathpress 24. 08. 1995. 47 Kathpress 20. 03. 1997. 48 Kathpress 22. 11. 1995. 49 Kathpress 24. 01. 1994.
35
im kommunistischen System aufgearbeitet werden. Unter protestantischen und auch orthodoxen
Theologen seines Landes gebe es die Meinung, der Ökumenismus sei nur durch den Einfluss des
kommunistischen Staates zustandgekommen und er sei deswegen überholt. Dieser Einwand sei
„bis zu einem gewissen Punkt gerechtfertigt“, so Oancea bei einem „Pro Oriente“-Symposion am
19. März in Wien. Die Kommunisten hätten sich tatsächlich bemüht, zwischenkirchliche Kontak-
te zu fördern, um einerseits im Westen glaubwürdig zu werden und gleichzeitig die Theologen
unter Kontrolle zu halten. Entgegen der Absicht der Kommunisten hätten diese vielen Kontakte
aber zu einer tatsächlichen ökumenischen Annäherung geführt.
Die Schattenseiten dieser Zeit wirkten sich aber auf die Weitergabe und Neuaufnahme des Öku-
mene-Gedankens durch die jüngere Theologen- und Priestergeneration negativ aus, stellte Oan-
cea fest, der an der Orthodox-Theologischen Fakultät der Universität Sibiu (Hermannstadt) lehrt.
Die Autorität der älteren Generation sei durch die vermeintliche oder tatsächlich Kollaboration
mit den Regime infrage gestellt. In Rumänien stehe eine offene Diskussion über die Vorgänge
dieser Zeit noch aus. Die Aussichten seien aber „vielversprechend“. Als „entscheidenden Schritt“
in diese Richtung wertete Oancea, dass der Temesvarer orthodoxe Metropolit Nicolai Corneanu
als erster kirchlicher Würdenträger vor kurzem öffentlich eingestand, mit dem Geheimdienst
Securitate zusammengearbeitet zu haben.
Die Zurückhaltung in der Ökumene nach 1989 war laut Oancea in Rumänien auch zum Teil
durch die Spannungen zwischen den Volksgruppen geprägt. Ethnische und religiöse Zugehörig-
keit decken sich zum Großteil, die damit verbundenen Fragen seien aber „nicht ausreichend ge-
klärt“ gewesen. Allmählich sehe man aber ein, dass eine pauschale Verurteilung des Ökumenis-
mus aus solchen Motiven „nicht gerechtfertigt war“. „Man möchte die Zurückhaltung überwin-
den. Wir haben das Gefühl, dass uns ein Neuanfang bevorsteht“, so der orthodoxe Theologe, der
auch evangelische Theologie studiert und seine Promotion 1992 an der protestantischen Fakultät
in Cluj (Klausenburg) abgelegt hat.50
Eine strukturelle Möglichkeit der theologischen Erneuerung ist, wenn junge und ältere Theologen
und auch Priesteramtskandidaten aus Osten an westlichen Ausbildungsstätten studieren oder sich
weiterbilden können. Mit dieser Möglichkeit ist differenziert umzugehen. Manche Ost-Bischöfe
befürworten ausschließlich spezielle westlichen Fakultäten, wo sie meinen keine Angst vor einer
westlichen Verderbung ihrer Alumnaten rechnen zu müssen. Der emeritierte Wiener Kardinal
Groer nannte diesbezüglich ein Beispiel: Die ungarischen Bischöfe wünschen es nicht, das ihre
Theologen bei uns studieren. Solche Bischöfe gehören aber zu den ganz wenigen Ausnahmen. Es
wird auch diese Interkommunikation, die Osmose zwischen der Theologie des Westens und des
Ostens weiter geschehen. Die Rolle der Universitäten bzw. der Katholisch-Theologischen Fakul-
50 Kathpress 20. 03. 1997.
36
täten des westlichen Raumes, nicht nur des deutschsprachigen, sondern überhaupt des westlichen,
mitteleuropäischen westlichen Gebietes ist sicherlich eine sehr bedeutende Hilfe. Aber ich glaube
nicht, dass hier eine echte Hilfe schon gegeben ist.51
Angesichts dieser Äußerungen vor allem von den betroffenen Ländern mag klar sein, dass eine
„Theologie nach dem Gulag“ (Halík) der Komplexität der gesellschaftlichen und kirchlichen
Lage dieser Region entsprechen soll. Zusammenfassend kann man einige Dilemmata auflisten.
Wie ist die Bejahung und die Akzeptanz der politischen Freiheit aufrechtzuhalten, wenn die wirt-
schaftliche Lage in den meisten Länder eine „Nostalgie nach dem früheren Sklaventum“ (Peterle)
zu berechtigen scheint? Wie kann die Kirche in einem Zug ihre eigene Vergangenheit in und vor
dem kommunistischen Regime selbstkritisch aufarbeiten und sich in die neue Situation so ein-
üben, dass sie dabei eine zeitgemäße Verkündigungsarbeit leisten kann? Wie können die ererbten
theologischen Strömungen und Denkweisen nebeneinander weiterentwickelt werden, weil die
Kirche dauernd zum raschen Antworten auf ganz neue Fragen gezwungen ist? Eine Theologie
auf der Basis der osteuropäischen Erfahrungen soll sich diesen Dilemmata stellen und mindestens
ansatzweise eine Antwort wagen. Diese Antwortversuche kommen in den letzteren Kapitel dieses
Buches zum Wort. Zur weiteren vertieften Einbettung in die Realität dieser Region vor allem der
Kirche ergibt sich eine weitere Quelle: die Sicht des „Anderen“, nämlich die der Theologen und
Politiker aus dem „Westen“.
51 Kathpress 11. 07. 1994.
37
WENDE IM WESTEN
In diesem Kapitel werden die Ansichten von Sozialwissenschaftler und Theologen aus dem „frei-
en Europa“ über die „befreite Region Europas“ zusammengefasst.52 Allgemein gesehen ist in
ihrer Betrachtung der ost(mittel)europäischen Entwicklungen der letzten Jahre ein thematischer
Trend zu beobachten. Direkt nach der Wende gab es ein speziell an diese neue Region gerichtetes
Interesse. Die Wende in dieser Region war in dieser Zeit vor allem ein Symbol, hinter dem nur
bei sehr wenigen Beobachtern detaillierte Kenntnisse steckten. In den Jahren etwa zwischen
1993-1995 ließ dieses allgemeine Interesse nach. Es erschienen vor allem Publikationen aus Fe-
dern der westlichen Kollegen, die sich bereits vor der Wende mit der Problematik dieser Region
beschäftigt haben. In den letzten Jahren rückte diese Region als Thema aus einem gesamteuro-
päischen Blickwinkel neu ins Blickfeld. Jetzt überwiegen Beiträge, die sich mit den zentralen
Fragen: „Welches Christentum, welche Kirche für welches Europa?“ auseinandersetzen.
Für eine Theologie auf der Basis der ost(mittel)europäischer Erfahrungen sind die Einsichten der
westlichen Kollegen von großer Bedeutung. Sie geben Anlass, die eigene Position zu klären.
EINE REGION VOLLER GESPENSTER
Chaos
Die Kirchenregion, die den Bunkern des real existierenden Sozialismus entstiegen ist, wird vor
allem als Problemregion betrachtet. Allerdings werden Probleme gesehen, die auch in Westeuro-
pa die Geister scheiden. Mottoartig soll für diese Sicht ein Zitat von Walter Dirks, dem namhaf-
ten Denker dieses Jahrhunderts stehen. Er hat in einem Interview53 bereits nach der Wende zur
Problemregion Stellung genommen: „An der Frage Osteuropas werden wir scheitern. Es wird
eine chaotische Situation entstehen, die uns vor ganz unmögliche politische Fragen stellt... Ich
habe gehofft, daraus entstehe eine Solidarität mit Polen, Ungarn und mit anderen osteuropäischen
Staaten. Aber es... kamen die Leute mit der D-Mark, und man lieferte sich der Bundesrepublik
aus. Die Theologie muss freier und weiter werden. Sie muss entkirchlicht werden. Der Eigenwert
des theologischen Denkens gegenüber dem Lehramt muss erstritten werden.
52 Dieses Kapitel wurde während eines Studienaufenthaltes im Mai 1999 in Tübingen geschrieben, gefördert vom DAAD. Ich bedanke mich besonders bei den Kollegen Baumann und Hilberath (Institut für Ökumänische Theolo-gie) für die freundliche Aufnahme und für die feinfühligen Konsultationen.
53 Dirks, Gefahr ist 14.
38
Peter Madler unterstreicht die Umweltproblematik, die auch auf die chaotisch wahrgenommene
Situation in den Ostländer hindeutet: „Allerdings wissen wir inzwischen, welch ungeheueres
Ausmaß Umweltzerstörungen in Polen, der CSFR, oder DDR usw. angenommen haben... Das
Projekt einer ökologischen Theologie ist beklagenswert aktuell.“54
Region
Die postkommunistischen Länder bilden auf dem ersten Blick eine einheitliche Region. Die fei-
neren (kultur)historischen und sozialwissenschaftlichen Analysen gehen hinter dem einseitigen
politischen Kriterium weiter. Gert Pickel stellt auf Grund von statistischer Erhebungen und Se-
kundäranalysen sechs Ländergruppen in Europa auf. Die Basis seiner Gruppierung sind einerseits
die drei Trennlinien – ethnisch-konfessionelle, sozioökonomische und politisch-gesellschaftliche
–, andererseits ergänzt er sie mit zwei Achsen („erklärenden Differenzierungslinien“55): durch
eine „Ost-West-Schiene, welche sich mit der ehemaligen politisch-gesellschaftlichen Kulturlinie
deckt“ und zweitens durch eine Nord-Süd-Schiene, die durch die sozioökonomische Modernisie-
rung bedingt ist. Danach gehören die postsozialistischen Staaten in zwei Gruppen. In die Gruppe
der osteuropäischen Nationen mit katholischem Hintergrund bzw. katholischer Tradition wie
„Ungarn, Tschechien und Polen, aber auch Litauen und Slowenien“. In dieser Gruppe ist eine
starke kirchliche Bindekraft (bei überwiegend katholischer Bevölkerung) gekoppelt mit einem
eher niedrigen Modernisierungsstand durch die sozialistische Sozialisation konterkariert. In die
zweite Gruppe gehören die osteuropäischen Nationen mit überwiegend orthodoxer Bevölkerung,
insbesondere die Balkanstaaten sowie die Staaten der postsowjetischen Region. In einigen dieser
Länder „war die orthodoxe Kirche eng mit dem Staatssozialismus verknüpft“.
Diese Einteilung ist wegen ihrer Komplexität stark. Eigenheiten einzelner Länder stehen aber in
einigen Fällen solchen Zuordnungen entgegen. Tschechien hat z.B. nie eine überwiegend katholi-
sche Bevölkerung gehabt. Ein anderer Mangel dieser Einteilung ist, dass er die geschichtlichen
Wurzel und Traditionen dieser Länder bis zur sowjetischen Machtübernahme nicht in Betracht
ziehen kann.56 Die Arbeiten von Zulehner/Denz haben zudem gezeigt, dass bei der Erklärung der
Verschiedenheiten in der Reaktion auf die kommunistische Mobilisierung der wichtigste Faktor
die Kultur des jeweiligen Landes ist. Dieser wiederum ist vor allem geschichtlich geprägt.
Der Autor plädiert dafür, dass für eine Trendanalyse eher „von einem Säkularisierungstrend ge-
koppelt mit einem Lebenszykluseffekt ausgegangen werden muss“ und nicht aus der antireligiö-
sen Sozialisation in den ehemals kommunistischen Staaten.57 In allen Kulturregionen Europas
54 Dirks, Gefahr ist 124. 55 Pickel, Religiosität 162. 56 Ein solcher Versuch ist Spohn, Religion. 57 Pickel, Religiosität 166f.
39
beobachtet Pickel eine Tendenz: den Rückzug der Religiosität ins Private. Für eine kurze Zeit
nach dem Umbruch konnten zwar die Prozentsätze anders als erwartet ausfallen, aber dies darf
nicht dazu verführen, dass man die Rückwirkung auf die kommunistische Sozialisation über-
schätzt.
Universalisierung und Regionaldenken
Bei dem Entwurf einer Theologie, die auf der Basis der ost(mittel)europäischen Erfahrungen
entwickelt werden soll, ist es ratsam, die Wechselwirkung von Globalität und Partikularität in der
Betrachtung der Entwicklungen der europäischen Gesellschaften zu reflektieren. Dabei merken
die Autoren, dass diese Region voll von Spannungen ist.
„Generell scheint in Europa zeitgleich mit der Universalisierung der politisch-ethnischen Grund-
lagen auch die Tendenz zur wieder stärkeren Betonung des Partikulären und kulturell Unter-
schiedenden zu bestehen. In friedenspolitischer Hinsicht wichtig ist die menschenrechtlich fun-
dierte Entwicklung eines Volksgruppenrechtes, das den Rechten von Angehörigen einer Minder-
heit oder auch der Minderheit selbst Rechnung trägt und dadurch befriedend wirkt. Vorarbeiten
sind längst vorhanden, z.B. in der Charta der Volksgruppenrechte58. Denkbar sind zudem Schrit-
te, um die grenzüberschreitende, regionale Zusammenarbeit in Europa zu stärken und staatlichen
Grenzen ihren trennender Charakter noch mehr zu nehmen.“59
Es gibt in den Ländern Mittel- und Osteuropas ein heftiges Aufflammen von Bewegungen, die
von ethnischen Minderheiten getragen werden. Überall in Osteuropa hat das Ende des Kommu-
nismus Minderheiten neuen Auftrieb gegeben, die lange Zeit diskriminiert oder überhaupt nicht
erkennbar waren. In Europa gibt es 36 Staaten mit mehr als einer Million Einwohnern. Einer
davon, Portugal, scheint die einzige Ausnahme ohne Minderheitenprobleme zu sein. In fünf von
diesen Staaten werden bzw. wurden bis vor kurzem ethnische Konflikte gewaltsam ausgetragen
(Bosnien-Herzegowina, Rest-Jugoslawien, Kroatien, Russland, Türkei). Von diesen haben noch-
mals sieben Staaten ethnische Konflikte mit Nachbarstaaten zu bewältigen (Albanien, Bulgarien,
Griechenland, Estland, Lettland, Mazedonien, Ukraine). In weiteren fünf Staaten sind sichtbare
ethnische Spannungen vorhanden (Großbritannien, Moldawien, Rumänien, Slowakei, Spanien).
Fazit: Nur die Hälfte der Staaten Europas blieb bisher von Spannungen infolge der Minderheiten-
frage verschont, jedenfalls im beschriebenen Ausmaß, was keineswegs bedeutet, dass alle dage-
gen gefeit sind.60 Eine klare rechtliche Position der EU zu dieser Frage ist angesichts des bevor-
stehenden Beitritts mehrerer mittel- und osteuropäischer Staaten dringend erforderlich; als politi-
sches Kriterium wird der Minderheitenschutz von den Beitrittskandidaten bereits ausdrücklich
58 Deutscher Bundestag, Drucksache 12/796 (18. 6. 1991). 59 Langendörfer, Weltrepublik 54.
40
gefordert. Einen verbindlichen rechtlichen Standard gibt es aber auch in den fünfzehn Mitglied-
staaten der EU nicht.
Multireligiöse Region
Für die Theologie und für die kirchliche Verkündigung ist die Vielvölkerregion Ost(Mittel)-
Europa eine ernstzunehmende Tatsache. Die Multikulturalität und Multireligiosität erscheint in
diesen Ländern als Multiethnizität und Vielsprachigkeit. Die vielen Kulturen in der EU werden
durch die frühere oder spätere Einbindung der postsozialistischen Länder in großem Maße er-
gänzt. Diese Tatsache, die von den Büros in Brüssel und Straßburg mit zunehmenden Besorgnis
betrachtet wird, fordert die ansonsten vielgepriesene „Multizität“ heraus. Sie stellt neben den
Fragen wirtschaftlicher und sozialer Art besonders die Frage nach der Eigentümlichkeit der Seele
Europas. Viele Analysen der EU-Entwicklung weisen darauf hin, dass durch die Vereinheitli-
chung der wirtschaftlichen und finanziellen Ebene die Wichtigkeit der Bewahrung und Förderung
der Vielfalt an der kulturellen Ebene nicht von der Tagesordnung der Erweiterung gestrichen
werden darf.
Die Gesellschaften Ost(Mittel)Europas sind mit ihrer Geschichte Zeugen der ethnischen und
religiösen Konfliktlösungen. In dem letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts erwiesen sich zwar einige
ethnischen Konflikte als Zeitbomben, die bis zu kriegerischen Konflikten eskalierten, aber die
Grundtendenz der gesellschaftlichen Entwicklung ist doch das immer mehr gelingend Finden von
gewaltlosen, rechtlich verankerten Konfliktlösungen. Die Publikationen zur EU-Erweiterung
betonen sachgerecht, dass das ethnische Konfliktpotenzial nicht unterschätzt werden darf. Als
wichtige Ergänzung ist aber anzufügen, dass diese Region auch die Kunst des „Friedens in Viel-
falt“ in ihrer Geschichte lange Zeit meisterhaft und auch für die EU-Mitglieder beispielhaft ein-
geübt hat.
Als Fallbeispiel bietet sich die schrittweise entwickelte gesetzliche Regelung des Verhältnis zwi-
schen der Konfessionen und Religionen in der Österreich-Ungarischen Monarchie an, zu der
viele Staaten und konfessionell stark geprägte Ethnien gehörten. Richard Potz fasst die letzten
wichtigsten Schritte der Schaffung des konfessionellen und religiösen Friedens mit einer Erinne-
rung an einige entscheidende Gesetze zusammen. „Mit der Verfassung von 1867 tat die Donau-
monarchie den entscheidenden Schritt zu einem System der Kirchenfreiheit im konstitutionellen
Vielkonfessionenstaat.“61 Nach dieser Verfassung kam es zu einer Welle der religiösen Gesetz-
gebung. 1868 beseitigte das Gesetz über die interkonfessionelle Verhältnisse alle noch vorhande-
nen formalen Diskriminierungen unter den anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften,
60 Pipp, Im Schatten der Globalisierung. Der Autor ist Präsident des Österreichischen Volksgruppenzentrums. 61 Potz, Die Donaumonarchie.
41
wie z.B. einseitige Beschränkungen beim Religionswechsel und bei der religiösen Kindererzie-
hung oder das Verbot des Proselytismus. 1873 wurde die Metropolie für Bukovina und Dalmati-
en eingerichtet und zwei Jahre danach wurde die Orthodox-Theologische Fakultät in Czernowitz
eröffnet, wo Kleriker in großer Zahl ausgebildet werden konnten. Durch den Wiener Kongress
kam erneut eine orthodoxe Kirche zur Monarchie und im Jahr 1880 wurde bald ihre geistliche
Jurisdiktion durch einen Vertrag mit dem Ökumenischen Patriarchat geregelt. Diese Gesetze für
den konfessionellen Frieden werden im Jahre 1890 von einem Gesetz des interreligiösen Friedens
ergänzt, nämlich durch das Gesetz für die Israeliten. Somit ist in der Monarchie eine „weitgehend
homogene Rechtslage“ für die christlichen Konfessionen und für die Israeliten erreicht. Im selben
Jahr hat diese Monarchie beispielhaft die islamische Glaubensgemeinschaft anerkannt, was in der
heutigen Zeit eine wichtige Botschaft an die Länder mit großen islamischen Bevölkerungsantei-
len sein kann.
Die ökumenische Bewegung in den „freien Ländern des Westens“ und auch die Äußerungen des
Zweiten Vatikanischen Konzils in Lumen Gentium und im Missionsdekret fundieren diesen kon-
fessionellen Frieden von der Theologie und von der Lehre her in hinreichendem Maße. In der
letzten Zeit gibt es auch seitens der russischen Orthodoxie hoffnungsweckende Äußerungen. Man
braucht aber noch viel Zeit dazu, dass dieses ökumenische Gedankengut in organischer Weise zu
einem allgemeinen religiösen Wissen der einfachen Kleriker und Laien gehört. Suttner62 erinnert
dabei an die Tatsache der jahrzehntelangen Isolation dieser katholischen, unierten und orthodo-
xen Kirchen und ruft zur Geduld in dem Dialog auf. „Zahlreichen Katholiken ist wegen ihrer
langen Isolation vieles von dem, was das Zweite Vatikanische Konzil lehrte, noch nicht bekannt.
Ihre in der Illegalität geweihten Priester und Bischöfe entbehren verständlicherweise der theolo-
gischen Studien. Was sie im Untergrund an Rudimenten einer Ausbildung erlangten, beruht im
wesentlichen auf dem, was die sie unterweisenden Vorgänger aus der Theologie der Vorkriegs-
zeit in Erinnerung hatten. Denn in der Illegalität waren die Unierten vom Informationsfluss mit
den Glaubensbrüdern im Westen noch radikaler abgeschnitten als die ebenfalls isolierten, aber
wenigstens nicht völlig verbotenen lateinischen Katholiken. Sie haben es schwer, der orthodoxen
Kirche gegenüber zu einer dem Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils gemä-
ßen Haltung zu finden. Ihre Schwierigkeit wird noch gesteigert, weil auch bei vielen orthodoxen
Bischöfen und Priestern, mit denen sie es zu tun haben, in den zurückliegenden Jahrzehnten die
Umstände Mängel in der theologischen Ausbildung verursachten. Auch diese denken und han-
deln nicht immer, wie es dem neuen ökumenischen Aufbruch entspräche.“63
62 Suttner, Die mit Rom unierten Kirchen. 63 Suttner in: Felmy, Kirchen im Kontext 86.
42
Mitteleuropa, Modernisierung und Identität
In einem Artikel informiert Theo Mechtenberg über eine Entwicklung im Europa-Verständnis der
postsozialistischen Länder. Nach der Wende war die Parole „Zurück zu Europa“ bestimmend, der
aber in den letzten 3-5 Jahren eine andere Parole gefolgt ist: „Osterweiterung der EU“. Dieser
semantische Wandel weist auf das Selbstverständnis der postsozialistischen Länder hin. Sie be-
haupten, immer schon ein Teil von Europa gewesen zu sein. Sie wollen sogar mit ihrer speziellen
Identität und mit ihren eigenen Erfahrungen zu einer Art Neugeburt Europas beitragen. Mechten-
berg zitiert die Rede von Tadeusz Mazowiecki, dem ersten polnischen Ministerpräsidenten,
gehalten vor dem Europarat am 30. Januar 1990: „Wir kennen den Preis für das, was Europa ist,
für die europäische Norm, deren Erben heute die Bewohner des Westens sind, ohne eine Erb-
schaftssteuer entrichten zu müssen. Diesen Preis können wir ihnen in Erfahrung rufen. Was wir
in Europa einbringen, ist somit unser Glaube an Europa.“64 Die postsozialistischen Staaten dieser
Region wehren sich gegen eine neue „Internationalisierung“, die sie einerseits an den „sozialisti-
schen Internationalismus“ erinnert, die aber andererseits gegenüber den spezifischen kulturellen
Beiträgen dieser Gesellschaften taub macht. Bei die EU-Integration soll daher die Preisgabe die-
ser mittel-ost-europäischen Identität nicht als Preis gefordert werden.
Durch eine solche Betonung der Identität wird aber die Tatsache der schwachen Modernisierung
nicht geleugnet. Mechtenberg zitiert Gombrowitz, den bedeutenden polnischen Exilautor: Polen
ist ein Land zwischen Ost und West, ein Übergangsland, in welchem der Osten und der Westen
sich gegenseitig abschwächen. Es ist so ein Land der geschwächten Form. Keiner der großen
europäischen Kulturprozesse hat Polen wahrhaft umgekrempelt: weder die Renaissance, noch die
Religionskriege, noch die Industrierevolution; nur ein abgeschwächtes Echo von allem ist ge-
kommen.“65 Diese Beschreibung betrifft zunächst Polen, aber es ist zudem sicher, dass sie in
unterschiedlichem Maße den anderen Ländern der Region gerecht wird.
Des weiteren macht Mechtenberg darauf aufmerksam, dass nach Ansicht vieler in der katholi-
schen Kirche nach dem Hauptfeind Kommunismus nun „Liberalismus“ zu bekämpfen sei. Es ist
zu befürchten, dass auf der kulturellen Ebene, wo die Kirche in diesen Länder mitspielen kann,
zwei Fundamentalismen aufeinanderprallen: der liberale und der christliche. Abgesehen von der
inneren Vielfalt der Ausprägungen beider Denkweisen ist entscheidend, dass die Kirche ihre
Rolle nicht nur in der Anwaltschaft der nationalen Identität unter den veränderten gesellschaftli-
chen Verhältnissen erblickt, sondern auch in einen kritischen Dialog mit den säkularen Kräften
und Strömungen eintritt. „Ihre Aufgabe in den gegenwärtigen Modernisierungsprozessen sollte es
sein, auf einer metapolitischen Ebene zu agieren und als moralische Autorität die für den not-
64 Mechtenberg, Konflikt 4. 65 Mechtenberg, Konflikt 6.
43
wendigen gesellschaftlichen Zusammenhang unverzichtbaren Werte zu vermitteln, die der libera-
le Staat ebenso wenig wie ein europäischer Staatenverbund aus sich heraus erzeugen kann, ohne
die aber beide letztlich keinen Bestand haben.“
Nun ist das polnische Beispiel nicht ohne nötige Klärungen auf die anderen Länder der Region
übertragbar. Doch es ist wichtig, „dass sich jene geistig-kulturellen Kräfte herausbilden, die –
jenseits der politischen Machtkämpfe – ein Reflexionspotenzial darstellen, das in der Lage ist,
die Modernisierungsprozesse kritisch zu begleiten und einer durch den Primat des homo oeco-
nomicus möglicherweise bedingten kulturellen Entfremdung, entgegenzuwirken.“
Religiöse Situation
Franz Xaver Kaufmann nennt drei Bereiche, an denen die Folgen des Zusammenbruchs der
kommunistischen Ideologie und der sozialistischen Gesellschaftssysteme für die religiöse Situa-
tion in Osteuropa vermutet werden können. „Einerseits haben die Kirchen unter den drückenden
politischen Bedingungen offenkundig Freiräume nonkonformer Solidarisierungen und im Grenz-
fall auch gesellschaftlichen Protestes geboten, und es sind unter diejenigen, die jetzt in der deso-
laten Situation des Zusammenbruchs politische Verantwortung übernommen haben, bemerkens-
wert viele gläubige Christen. Zudem zeigt sich, dass der Zusammenbruch der kommunistischen
Herrschaftsgebilde ein Solidaritäts- und Orientierungsvakuum hinterlässt, das primär durch eth-
nische Orientierungen ausgefüllt wird, wobei die Grenzen der Volksgruppen häufig mit religiö-
sen oder konfessionellen Grenzen übereinstimmen. Von diesen drei Sachverhalten dürfte der
erstgenannte an Bedeutung verlieren; ob der zweitgenannte Faktor zu einer Gründung christlicher
Parteien wie im Westen in der Nachkriegszeit und damit zu einer politisch organisierten gesell-
schaftlichen Repräsentanz der Christen führt, dürfte überwiegend von nationalen Umständen
abhängen; und vom drittgenannten Faktor des Zusammenfallens von ethnischen und traditionell
religiösen Unterschieden ist eher eine Vertiefung als eine Überwindung der Konflikte zu erwar-
ten. Auf jedem Fall ist davon auszugehen, dass Mehrheiten in den meisten Länder durch das
atheistische Sozialisationsmilieu geprägt sind und von sich aus den Weg in jene betulichen For-
men des Volkskirchentums nicht finden werden, welche explizit religiösen Bestände Westeuro-
pas dominieren. Insbesondere in Deutschland ist damit zu rechnen, dass Konfessionslosigkeit nun
zum akzeptierten religiösen Status wird. Inwieweit aus solcher Laizität neuere Sinndeutungen
entstehen, die das vorhandene Solidaritäts- und Orientierungsvakuum füllen können, und was
deren Inhalt sein kann, bleibt eine offene Frage.“66
Die Modernisierung in Europa wird sich demnächst auch die (teilweise) vormodernen Gesell-
schaften der Reformländer immer mehr betreffen. „Gesellschaftliche Modernisierung ist ein Pro-
44
zess, in dem Menschen in jahrhundertlangen Kämpfen gelernt haben, auf ihren Teilgebieten be-
sonders leistungsfähige Sinnstrukturen und Funktionssysteme aufzubauen und in diesem Multi-
versum mit geteilten Loyalitäten leben.“ Daraus folgt für die Theologie, die in der heutigen Eu-
ropa plausibel sein will, dass sie einsehen muss, dass „es eine wie auch immer geartete Wahrheit
in dieser Welt nicht geben kann, sondern bestenfalls eine Vielzahl von Wahrheiten und Rationali-
täten, die in der öffentlichen Meinung um Einfluss konkurrieren und mit Bezug auf bestimmte
Geltungsbereiche höhere Plausibilität beanspruchen können als mit Bezug auf die anderen. Wer
in einer solchen Situation glaubt, mit dem Anspruch auf ein verbindliches integrales Wahrheits-
wissen auftreten zu können, hat sozusagen a priori verloren. Die christliche Tradition weist eine
Fülle anderer dynamischer Aspekte auf.“
Ein dem staatlichen Absolutismus nachgebildetes Kirchenverständnis einer hierarchisch aufge-
bauten societas perfecta vermag heute die Herzen nicht mehr zu ergreifen und kann deshalb auch
kein sichtbares Zeichen für die Nähe des Reiches Gottes sein. Dies haben wir an den Systemen
der kommunistischen Parteienherrschaft erlebt: Irgendwann verdunstete die Überzeugung auch
der Träger des Systems und die Hoffnung, auf dem eingeschlagenen Weg die eigenen Ideale zum
Erfolg zu führen. Ein Umdenken müsste mit der Einsicht beginnen, dass auch die Individuen von
der Komplexität der heutigen Verhältnisse grundsätzlich überfordert werden, so dass kirchliche
Forderungen in der Konkurrenz der vielfältigen Lebensanforderungen um ihrer Lebensdienlich-
keit willen gar nicht mehr ohne kulturspezifische und situationsspezifische Vermittlungen wirk-
sam werden können. Nur ein Glaubensangebot, das nicht mehr auf Autorität und Tradition, son-
dern auf freie Zustimmung seitens der Angesprochenen setzt, gewinnt in solcher Situation die
Chance, sich als glaubhaft zu erweisen.67
Babylon in Europa
Mit der politischen Wende und der EU-Osterweiterung stoßen die Westeuropäer auf eine bis dato
nahezu unbekannte und durch den eisernen Mauer abgeschirmte Dichte von Sprachen. Dies kann
den möglichen Ursachen der Berührungsängste zugerechnet werden. Um eine Vorstellung vom
Ausmaß dieser Sprachdichte zu machen ist es nützlich, nach Ländern die dort heute noch gespro-
chenen Sprachen einmal aufzulisten. Es werden nur die Sprachen ohne die Dialekte zusammen-
gestellt.68 Ich liste diese Sprachen einfach auf, um für die Leser den selben Schock zu ermitteln,
den ich meinerseits dabei erlebte.
66 Ders., Das janusköpfige Publikum 18. 67 A. a. O. 36-41. 68 Die Liste hat der Finne Tapani Salminen für die UNO angefertigt. In seiner Liste sind die Benennungen in Englisch.
Hier wurden die Sprachbezeichnungen mit Hilfe von Nelu Bradean-Ebinger (Budapest) ins Deutsche übertragen.
45
Albanien: Mazedonisch (Macedonian), Arumänisch (Aromunian), Gheg Albanisch (Gheg Alban-
ian), Tosk Albanisch (Tosk Albanian), Griechisch (Greek), Romani. Weißrussland: Polnisch
(Polish), Ukrainisch (Ukrainian), Weißrussisch (Belorussian), Russisch (Russian), Lettisch (Lat-
vian), Lithauisch (Lithuanian), Jiddisch (Yiddish, Judeo-German), Romani. Bosnien-
Herzegowina: Serbisch und Kroatisch (Serbo-Croatian), Romani. Bulgarien: Mazedonisch (Ma-
cedonian), Bulgarisch (Bulgarian), Arumänisch (Aromunian), Dako-Rumänisch (Daco-
Rumanian), Griechisch (Greek), Romani, Krim-Tatarisch (Crimean Tatar), Gagausisch (Gagauz),
Osman-Türkisch (Osman Turkish). Kroatien: Ungarisch (Hungarian), Serbisch und Kroatisch
(Serbo-Croatian), Venezisch (Venetian), Istrisch (Istriot), Dalmatinisch (Dalmatian), Istro-
Rumänisch (Istro-Rumanian), Romani. Tschechien: Polnisch (Polish), Tschechisch (Czech),
Hochdeutsch (High German), Bairisch (Bavarian, incl. Austrian German), Romani. Estland: Est-
nisch (Estonian), Lettisch (Latvian), Schwedisch (Swedish), Romani. Ungarn: Ungarisch (Hun-
garian), Slowakisch (Slovak), Slowenisch (Slovene), Serbisch und Kroatisch (Serbo-Croatian),
Hochdeutsch (High German), Bairisch (Bavarian, incl. Austrian German), Dako-Rumänisch (Da-
co-Rumanian), Romani. Lettland: Livisch (Livonian), Estnisch (Estonian), Weißrussisch (Belo-
russian), Lettisch (Latvian), Litauisch (Lithuanian), Romani. Litauen: Weißrussisch (Belorussi-
an), Lettisch (Latvian), Litauisch (Lithuanian), Jiddisch (Yiddish, Judeo-German), Romani, Ka-
raimisch (Karaim). Republik Mazedonien: Mazedonisch (Macedonia), Arumänisch (Aromunian),
Meglenitisch (Meglenitic), Gheg Albanisch (Gheg Albanian), Romani, Gagausisch (Gagauz),
Osmanisch-Türkisch (Osman Turkish). Moldavien: Bulgarisch (Bulgarian), Ukrainisch (Ukraini-
an), Jiddisch (Yiddish, Judeo-German), Dako-Rumänisch (Daco-Rumanian), Gagausisch (Ga-
gauz), Romani. Polen: Slowinzisch (Slovincian), Kaschubisch (Kashubian proper), Polnisch
(Polish), Ukrainisch (Ukrainian), Weißrussisch (Belorussian), Alt-Preußisch (Old Prussian),
Lithauisch (Lithuanian), Hochdeutsch (High German proper), Jiddisch (Yiddish, Judeo-German),
Romani. Rumänien: Dako-Rumänisch (Daco-Rumanian), Ungarisch (Hungarian), Serbisch und
Kroatisch (Serbo-Croatian), Bulgarisch (Bulgarian), Ukrainisch (Ukrainian), Hochdeutsch (High
German proper), Jiddisch (Yiddish Judeo-German), Griechisch (Greek), Romani, Krim-Tatarisch
(Crimean Tatar), Nogaisch (Nogai), Gagausisch (Gagauz). Russland (Europäischer Teil der Rus-
sischen Föderation ohne die Provinz Kaliningrad-Königsberg): Nordlappisch (North Sámi),
Skolt-Lappisch (Skolt Sámi), Akkala-Lappisch (Akkala Sámi), Kildin-Lappisch (Kildin Sámi),
Ter-Lappisch (Ter Sámi), Estnisch (Estonian), Wotisch (Votian), Finnisch (Finnish), Ingrisch
(Ingrian), Karelisch (Karelian proper), Olonezisch (Olonetsian), Lüdisch (Ludian), Weppsisch
(Vepsian), Erza (Erzya), Mokscha (Moksha), West-Tscheremissisch (Western Mari), Ost- Tsche-
remissisch (Eastern Mari), Mordwinisch (Udmurt), Permisch (Permyak), Wotjakisch (Komi pro-
per), Süd-Wogulisch (Southern Mansi), Tundra-Nenezisch (Tundra Nenets), Ukrainisch (Ukrai-
nian), Weißrussisch (Belorussian), Russisch (Russian), Lettisch (Latvian), Griechisch (Greek),
Romani, Tschuwaschisch (Chuvash), Tatarisch (Tatar), Baschkirisch (Bashkir), Nogaisch (No-
46
gai), Türkmenisch (Trukhmen), Kalmükisch (Kalmyk). Slowakei: Slowakisch (Slovak), Unga-
risch (Hungarian), Tschechisch (Czech), Ruthenisch (Rusyn), Bairisch (Bavarian, incl. Austrian
German), Romani. Slowenien: Slowenisch (Slovene), Ungarisch (Hungarian), Serbisch und Kroa-
tisch (Serbo-Croatian), Bairisch (Bavarian incl. Austrian German), Romani. Ukraine: Ukrainisch
(Ukrainian), Ungarisch (Hungarian), Polnisch (Polish), Slowakisch (Slovak), Bulgarisch (Bulga-
rian), Ruthenisch (Rusyn), Weßrussisch (Belorussian), Russisch (Russian), Jiddisch (Yiddish,
Judeo-German), Gothisch (Gothic), Dako-Rumänisch (Daco-Rumanian), Tosk-Albanisch (Tosk
Albanian), Griechisch (Greek), Romani, Karaimisch (Karaim), Krim-Tatarisch (Crimean Tatar),
Krimtschak-Tatarisch (Krimchak, Judeo-Crimean Tatar), Nogaisch (Nogai), Gagausisch (Ga-
gauz), Osmanisch-Türkisch (Osman Turkish).
Mit dieser Liste ist keineswegs gemeint, dass diese Sprachen tatsächlich in der Öffentlichkeit
gesprochen werden, sondern nur angedeutet, was für ein Verhältnis zwischen den allgemein be-
kannten und gesprochenen westeuropäischen Sprachen und den allgemein in Westeuropa nicht
gesprochenen Sprachen besteht.69 Sollten durch die allgemeine Entwicklung Sprachen aus dieser
Liste aussterben, so bleiben nach Tapani Salminen immer noch nach der Erweiterung 44 Spra-
chen in Europa, davon gibt es die überwiegende Mehrheit in den neuen Länder.
NATIONALISMUS
Nationalismus als Zentralfrage
Wohl kein anderes Thema interessiert mehr die (theologischen) Rezeptionen der Wende als die
Problematik der Nationalismus. Dies kann von mehrerer historischen Erfahrungen in der westli-
chen Welt erklärt werden, aber vor allem durch einen Schock, was sofort nach der Wende in den
befreiten Gesellschaften erfolgt ist. „Welche Alternative gibt es in Europa zum Nationalis-
mus?“ – fragt der Wirtschaftswissenschaftler Henner Kleinewefers. Im freiheitlichen Prozess, der
die unterdrückten Völker des Ostens in der Rückbesinnung auf ihre nationale Tradition zum Auf-
stand gegen die Vorherrschaft der Staatsnationen führte, haben die Kirchen ihren Beitrag gelei-
stet. Weil Kirche und Religion zur Kultur dieser Völker und ethnischen Gruppen gehören, an die
eine verdrängte Identität sich klammerte, haben sie in diesem Prozess eine entscheidende Rolle
gespielt, verschieden freilich nach dem Grad ihrer Inkulturation.70 Die Frage ist, ob diese Kirchen
imstande sind, auch in der (Übergangs-?)Phase des aufblühenden, nicht selten radikalen Nationa-
lismus eine stabilisierende Rolle zu spielen. Kleinewefers schreibt den etwas schockierend wir-
69 Tapani Salminen, Unesco red Book on Endangered Languages: Europe. http://www.helsinki.fi/~tasalmin/europe_index.html
70 Ders., Nationalismus, zit. Conzeminus, Die Kirchen und der Nationalismus 98.
47
kenden Satz: „Von den Kirchen ist nichts zu erhoffen; sie haben fast überall in Osteuropa eine
ausgeprägte nationalistische Tradition.“71 Das überrascht, weil die kirchliche Soziallehre zum
Nationalismus im Syllabus feststellt: „Anathem über jeden, der sagt, jede verbrecherische und
schamlose Handlung verdiene keinen Tadel, sondern sei durchaus gerechtfertigt und sogar ver-
dienstlich, wenn sie im Interesse des Vaterlandes liegt.“ (Nr. 67) Die Theologen im Westen dür-
fen ihre Hände nicht in den Schoß legen, sondern sie müssen sich mit einer neuen Perspektive
den Menschen Osteuropas mit ihren Ängsten und Vorbehalten zuwenden.
Nationalismus und Religion haben in der Region Ost(Mittel)Europas eine traditionelle Korrelati-
on. Die geschichtlichen Hintergründe dafür sind allgemein bekannt und werden auch in vielen
Publikationen in Erinnerung gerufen. Es geht dabei nicht um bloße Gelehrsamkeit oder Nostal-
gie, sondern diese geschichtlichen oder theoretischen Ausführungen sind Teile einer Suche nach
Deutungsmustern, nach Mitteln des Verstehens der heutigen Situation in den Reformstaaten, die
für westliche Beobachter Probleme darstellen, worüber sie bis zum Fall der Mauer hätte meinen
können, sie gehörten einer Vergangenheit an.
„Vor allem in Südosteuropa sind es häufig insbesondere frühere kommunistische Machthaber,
die populäremotionales Nationalempfinden im Interesse der eigenen Machterhaltung missbraucht
und dafür rücksichtslos Menschen geopfert haben. So bemühten z.B. Serben das unmenschliche
Leid, das sie in den Konzentrationslagern der kroatischen Ustascha erlitten hatten, als während
des Zweiten Weltkrieges Bosnien und Herzegowina zum von Hitler-Deutschland und Italien
geschaffenen Staat Kroatien gehörten, zur Rechtfertigung ihres heutigen Handelns gegenüber
ihren nichtserbischen Mitbürgern. Das Bemühen, sich in diesen blutigen Machtkämpfen auch der
Kirchen und Religionen zu bedienen, zeigt nicht geringere Erfolge angesichts der während des
Krieges umgekommenen Geistlichen und vollzogenen Zwangstaufen. Auch in der Ukraine hat
sich nach dem Sturz des Kommunismus die Situation ergeben, dass sich nicht nur die mit Rom
Unierten (Uniaten), die nach dem letzten Krieg der Russisch-Orthodoxen Kirche angegliedert
worden waren, heute als Ukrainisch-Katholische Kirche neu formierten und dabei auch um den
Besitz von Kirchengebäuden streiten, sondern darüber hinaus alte Machthaber das Entstehen
einer ukrainisch-nationalistisch orientierten orthodoxen Kirche unterstützen, die sich ebenfalls
vom Moskauer Patriarchat trennte.“
Otto Luchterhand, Hamburger Professor für Rechtswissenschaft, leitete seinen Vortrag am 29.
Essener Gespräch über das Verhältnis von Kirche und Staat, welches der Analyse der Situation in
Osteuropa gewidmet war, mit den folgenden etwas leidenschaftlichen Sätzen. „In keinem Teil
Europas ist trotz der ungeheuren menschlichen Verluste und zahllosen Zwangsumsiedlungen,
Vertreibungen, ethnischen Säuberungen im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg die na-
71 A. a. O. 98.
48
tionale Vielfalt so groß und die ethnische Gemengelage so verworren, zugleich aber auch die
Verbindung von Konfession und Nation, von Religionsgemeinschaft und Ethnos so eng und da-
her so trennend wie in Ostmittel-, Ost- und Südeuropa... nicht zufällig sprechen wir von der Rus-
sischen, Serbischen oder Bulgarischen Orthodoxen, von der Litauisch-Katholischen oder von der
Estnisch-Lutherischen Kirche.“72
„Der durch die neue Religionsfreiheit in den ehemals kommunistischen Ländern zutage getretene
religiöse Pluralismus hat auch zu Konfrontationen geführt: vor allem jene Kirchen, die sich als
Nationalkirchen verstehen und sich von Proselytismus bedroht sehen, tun sich mit einer gewissen
ökumenischen Offenheit oft schwer. Es wird heute darauf ankommen, in neuer Weise wieder
aufeinander zuzugehen, in der Hoffnung, dass spürbar wird, was der Apostel Paulus mit den
Worten aussagte: ‚Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede...’“73
Wolfhart Pannenberg sieht in einem säkularisierten Erwähltheitsglauben die eigentliche Wurzel
des europäischen Nationalismus. Die Kollisionen zwischen den säkularisierten Ideen einer be-
sonderen Erwähltheit haben die Geschichte des europäischen Nationalismus entstellt bis hin zur
Katastrophe des Ersten Weltkrieges und darüber hinaus. Daraus folgt, dass keine konfessionelle
Tradition kann ausschließlich für sich den Anspruch erheben, die christlichen Wurzeln der euro-
päischen Kultur und Geschichte zu verkörpern, jedenfalls kann keine konfessionelle Tradition
solche Ansprüche mit der Aussicht auf Glaubwürdigkeit erheben.74
Typologie des Nationalismus
Der in den postsozialistischen Ländern anzutreffende Nationalismus wird im westlichen Teil
Europas leicht als Gespenst aus der vormodernen Zeit betrachtet. Dagegen ist aber einzuwenden,
dass selbst in den modernen freien Gesellschaften der Nationalismus, in welchen seiner ge-
schichtlichen Arten auch immer, auch ein nicht zu übersehender Bestandteil des heutigen Euro-
pabildes ist. Weiter ist es bezüglich der Bedeutung des postsozialistischen Nationalismus zu klä-
ren, um welche Typen des Nationalismus es geht. Endre Kiss typisiert die Nationalismen des
XIX. Jahrhunderts – Fichtes „Reden an die deutsche Nation“ als Basis für alle nehmend – wie
folgt in drei Typen. Der struktur-modernisierende Nationalismus hat die Aufgabe, die Gesell-
schaft so zu modernisieren, dass „sie in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und politischer Einfluss
den am meisten fortgeschrittenen Staaten der Zeit ebenbürtig ist“. Den zweiten Typus des Natio-
nalismus nennt er romantisch-autopoietisch, wo die Nation „als Rahmen und gleichzeitig als
Substrat einer sich selbstorganisierenden Bewegung, deren Entfaltung die vollkommene Lösung
jeder historischen und aktuellen Frage der Menschheit in sich birgt“. Und drittens: Der etatisti-
72 In: ders., Religionsrechtliche Rahmenbedingungen 5. 73 Döpmann, Nationalismus und Religion 27-28.
49
sche-defensive Nationalismus ist mit realen und funktionierenden, voll ausgebauten politischen
Establishments verbunden. Seine Rolle ist vor allem die Produktion einer Legitimationsideologie
des bestehenden etatistischen Systems. Diesem Nationalismus fällt es nicht leicht, überall wenn
nötig Feinde des Staates zu finden oder zu schaffen. Kiss beobachtet, dass alle diese drei Typen
des Nationalismus im XIX. Jahrhundert in den postsozialistischen Entwicklungen zum Tragen
kamen. Nicht alle Typen des Nationalismus sind aber in der Wende wieder entstanden. Vor allem
der struktur-modernisierende Nationalismus war ein wesentlicher Bestandteil des demokratisch
eingestellten Antikommunismus. Man trifft ihn in der Ideen der Prager Frühlings genauso wie in
der Programmatik der polnischen Solidarnosč. Die Bedeutung der beiden anderen Typen des
Nationalismus vergrößerte sich im Zuge der Parteibildungen nach dem Fall der Mauer.75
Ökumene
Neben den ethnischen Konflikten und mit diesen auch engstens gekoppelt ist das zweitwichtigste
Problemfeld die Ökumene. Davon sind vor allem die GUS-Staaten betroffen, aber auch Rumäni-
en. Ein Teilbereich von Ökumene ist die Problematik um die neuprotestantischen Kleinkirchen
herum.
„Dass Atheisten katholische Christen werden, erscheint manchen Orthodoxen ein größeres Är-
gernis, als wenn sie Atheisten geblieben wären. Wenn heute von der Neuevangelisierung Europas
die Rede ist – das heißt also von Neumissionierung – , so wird sie wohl, wenn überhaupt, im
Wettbewerb der Kirchen stattfinden. Animositäten kann dieser Wettbewerb dann wecken, wenn
sich eine regionale Form einer universalistischen Religion mit dem ‚Einbruch’ einer anderen
Form, eines anderen Ritus z.B., konfrontiert sieht, der eine politische Notlage ausnutzt – oder
auch ökonomische Recourcen oder zivilisatorische Überlegenheiten ins Spiel bringt.“76
Die Problematik der Mission77 vor allem der neoprotestantischen Kleinkirchen gehört zu den
wichtigsten Fragen der neuen Religionsfreiheit in den Länder Osteuropas. Nach einer Untersu-
chung des Centres for Civil Society in Seattle waren 1993 in den ehemaligen kommunistischen
Staaten Osteuropas über 760 verschiedene westliche religiöse Gruppen, Kirchen und kirchenähn-
liche Organisationen missionarisch tätig. Diese Zahl ist zwar eher symbolisch als statistisch auf-
zufassen. Es ist aber eine nicht zu leugnende Tatsache, dass traditionelle Kirchen dieser Länder
wegen der „Sekteninvasion“ besorgt sind. Vor allem von orthodoxen Vertretern wir die Situation
in Bilder militärischer Prägung beschrieben: „Überrolltwerden“, „Invasion“ und „Bedrängtwer-
den“.
74 Pannenberg, Die Kirchen 130. 75 Kiss, Ein Versuch. 76 Spaemann, in: Dirks, Gefahr ist 285. 77 Vgl. Werner, Versöhnung.
50
In den letzten Jahren haben sich verschiedene ökumenischen Institutionen und Konferenzen mit
der Problematik der Proselytismus auseinandergesetzt. Vor allem bezüglich der Reformländer ist
ihr Grundansatz von großer Bedeutung, da es versucht, die auf den ersten Blick diametral gege-
nüberstehenden zwei Begriffe bzw. Haltungen „Mission“ und „Ökumene“ miteinander zu ver-
söhnen. Es wurden in diesen Initiativen wichtige Punkte eines „ökumenischen Verhaltenskodex“
formuliert. Dabei geht es darum, „die Problematik von ekklesiologisch und kulturell wenig sen-
siblen und wenig kooperativen Methoden der Evangelisation nicht mit externen Zwangsmittel
(d.h. z.B. staatlicher Religionsgesetzgebung78) anzugehen, die letztlich auf Kosten der Religions-
freiheit gehen würden, sondern mit einem gezielten Prozess der ökumenischen Sensibilisierung
und Selbstverpflichtung von Missionsorganisationen und Kirchen innerhalb (was besonders
wichtig und schwierig ist) wie außerhalb der bestehenden Strukturen ökumenisch-konziliarer
Verbindlichkeit.“79
In gemeinsamer Mission geht es um Partnerschaft, in der jeder Partner den Glauben und die Tra-
ditionen der anderen achtet; es geht um die Verantwortung der eigenen Ortskirche; es geht um
eine langfristige Verpflichtung, welche die Kultur berücksichtigt; es geht um die jurisdiktionelle
Anerkennung der Territorien, wonach Missionierung nur durch Einladung geschehen kann;
schließlich soll die missionarische Tätigkeit die ökumenische Beziehungen stärken. Es dürfen
keine Zwangsmittel angewendet werden, wozu auch finanzieller Druck oder kulturelle Entwurze-
lung gehören. Die Neubekehrten sollen den existierenden historischen Kirchen zugewiesen wer-
den. Solche und ähnliche Initiativen zeigen an, dass es möglich ist, einen gemeinsamen missiona-
rischen Weg zu riskieren, wobei die Inhalte, Methoden und vor allem die Geschwindigkeit der
Tätigkeit an den Erfahrungen und Interessen der missionarischen Partner gemessen werden.
NACH DER WENDE
Nach den Merkmalen und Problemfeldern der Region Ost(Mittel)Europas kommen wir direkt zu
den Artikeln, die sich konkret mit der Wende, mit ihrer Bedeutung für Gesellschaft und Kirche
beschäftigen.
Erfahrungen und Enttäuschungen
„Diejenigen die das Gefühl hatten, an der Destabilisierung der Totalitarismus mehr oder weniger
teilgenommen zu haben, besitzen nun kein Mittel den Bedingungen der demokratischen Freihei-
ten gegenüber. Es ist, als ob ihnen die Zielvorstellungen geraubt worden wäre durch das Ver-
78 Luchterhandt berichtet, dass „die Versuchung mit dem Instrument des Gesetztes entsprechende Barrieren aufzuzie-hen, in nahezu allen postkommunistischen Länder anzutreffen ist“. Ders., a. a. O. 37.
51
schwinden eines festen Gegners. Gleichzeitig finden sie kein Gehör mehr. Sie boten Freiheits-
räume, und nun werden sie selbst als Zwangssysteme betrachtet. Sie arbeiteten an der Emanzipa-
tion, und nun werden sie als gegenläufige und vergangenheitsbezogene Kräfte beurteilt. Ihnen
wurde jahrzehntelang die Anerkennung verweigert, während sie eine wirkliche Macht darstellten.
Sie beanspruchten, den Sinnhorizont überhaupt zu repräsentieren, aber nun werden sie durch die
Pluralität der Sinnangebote, welche mit den demokratischen Freiheiten einhergeht, selbst relati-
viert.“80
Bei zahlreichen Katholiken der ehemaligen Ostländer ist ein Wunsch verborgen: „das zusam-
menbrechende Gebilde, das wenn nicht auf einem militanten Atheismus, so doch auf einer reli-
giösen Gleichgültigkeit basiert hat, den Platz für eine andere Sinnhaftigkeit der Zivilisation und
der Kultur räumen würde, diesmal auf die Öffnung zur Transzendenz.“
Der Westen kann diese neue Sinnhaftigkeit nicht bringen, weil er sich an die Regeln der Markt-
wirtschaft klammert. Eine Nachfolge des Westens würde einen Weg in die Leere bedeuten. Von
dieser Grundeinstellung her ist das Klagen vieler Menschen über die jetzige Dekadenz des We-
stens zu verstehen: „Unterbetonung der moralischen Werte trotz eines Aufrufs der Regierungen
zum ethischen Handeln; Interesselosigkeit für die Belange der res publica zugunsten der Verfol-
gung privater Interessen; Zunahme der Korruption im wirtschaftlichen Bereich; das Vergessen
der Tatsache, dass der Westen seinen Reichtum z.T. der Ungerechtigkeit seiner Beziehungen zum
Süden verdankt; die Anklage aufgrund der Tatsache, dass die Umwelt zerstört wird ohne den
Willen, die eigene Lebensweise zu ändern.“81
Rechtliche Stellung der Kirchen
Die Reihe Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche hat sich im Jahr 1994 dem Thema
der Neuordnung des Verhältnisses von Staat und Kirche in Mittel- und Osteuropa gestellt. Otto
Luchterhandt, ein ausgezeichneter Kenner der Situation, hat seine großangelegte Studie82 zum
Thema in einem Referat zusammengefasst.83 schon vier Jahre nach der Wende kristallisieren sich
die Haupteigenschaften dieser gesetzlichen Neuregelung heraus. Die Erneuerung des Religions-
rechts sei heute (1994) noch bei weitem nicht abgeschlossen. Die Probleme, die diese Erneuerung
kompliziert und langsam machen, sind vor allem der Streit über das Ausmaß der „Wiedergutma-
chung“ und der allgemeine Drang zur Erneuerung vieler Gesetze, die andere Bereiche der gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Leben regeln sollen. Die fehlenden materiellen Ressourcen
halten die Religionsgemeinschaften in starker Abhängigkeit von der staatlichen Finanzquellen.
79 Werner, Versöhnung 102-103. 80 Duquoc, Jesus Christus 105. 81 A. a. O. 103-104. 82 Luchterhandt,a. a. O.
52
Ein weiterer Konfliktpunkt ist die Einrichtung eines Religionsunterricht in den öffentlichen Schu-
len und der geregelte Zugang zu den Medien. Grundlegend lässt dennoch behaupten, dass alle
Reformländer „ausnahmslos die klassische liberale bzw. menschenrechtliche Konzeption der
Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit in ihre Verfassung inkorporiert“ haben. Die Stel-
lung der Kirchen und Religionsgemeinschaften wird im allgemeinen bestimmt durch die Prinzi-
pien der religiös weltanschaulichen Neutralität des Staates, der Weltlichkeit des Staates, der frei-
en Selbstbestimmung der Religionsgemeinschaften im Rahmen der Gesetze, der grundsätzlichen
Gleichberechtigung der Religionsgemeinschaften und zur Kooperation mit den Religionsgemein-
schaften in beide Seiten betreffenden Angelegenheiten. Der Grundsatz der Trennung von Staat
und Kirche, unter kommunistischer Herrschaft fester Bestandteil von Ideologie und meist auch
des Verfassungsrechts, bleibt weiterhin dominantes Leitprinzip, hat aber mit dem Ende des Welt-
anschauungsstaates und dem Sieg menschlicher Prinzipien seine religionsfeindliche Komponente
der funktionalen und institutionellen Verdrängung der Religionsgemeinschaften aus der Öffent-
lichkeit verloren. Die wichtigste rechtlich-politische Garantie der religiösen Bürger und ihrer
Gemeinschaften in Staat und Gesellschaft ist die Etablierung des Verfassungsstaates und mit ihm
zugleich und als sein höchster Ausdruck der Siegeszug der Verfassungsgerichtsbarkeit in Ost-
und Südosteuropa.
Dies ist ein historischer Vorgang von epochaler Bedeutung. In einem Teil der Staaten haben auch
die Religionsgemeinschaften die Befugnis, sich bei Verletzung ihrer Rechte an das Verfassungs-
gericht zu wenden. Mit einer pointierten Zusammenfassung von Luchterhandt auf den Punkt
gebracht heißt es: „Die Lage der Kirchen und Religionsgemeinschaften ist heute in mancherlei
Hinsicht schwieriger, jedenfalls aber viel komplizierter geworden als sie es unter dem kommuni-
stischen Regime war, dies aber deswegen, weil sich ihre Lage grundlegend verbessert hat.“
Die Kirchen nach dem Kommunismus
José Casanova untersucht und typisiert eingehend die öffentlichen Möglichkeiten der Kirchen in
Osteuropa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus. Nach ihm seien alle religiösen, vor
allem kirchlichen Proteste in der Zeit des Kommunismus in sich positiv gewesen, da sie mehr
oder weniger die volle Entstehung des Sowjetmenschen und der „neuen Gesellschaft“ verhinder-
ten. Selbst dann müssen diese Protestbewegungen begrüßt werden, wenn ihr Interesse oft der
Verteidigung oder Bewahrung traditioneller hierokratischer Privilegien galt, ja sogar auch dann,
wenn eine solche Verteidigung in Form einer Anpassung an den Cäsaro-Papismus des Staates
stattfand. Den Kirchen fiel es leichter als allen anderen Institutionen, sich als Hüterin der nationa-
83 A. a. O. 68-69.
53
len und kulturellen Tradition zu verstehen und als Beschützerin einer gewissen Art von gesell-
schaftlicher Autonomie aufzutreten.
Neben dieser Grundform des Widerstandes erreichte die öffentliche kirchliche Aktivität ein qua-
litativ neues Niveau, sobald sie auch für die allgemeine Religionsfreiheit und für die Verteidi-
gung der allgemeinen Menschenrechte eingetreten ist. „Dadurch griffen sie den modernen Dis-
kurs der Individualrechte auf und erweiterten ihn.“84
Diese Entwicklung hat vier verschiedene Ebenen:
• Die allgemeine geistliche Wiedererweckung, in deren Mittelpunkt die Wiederein-
setzung des persönlichen moralischen Gewissens, die seelische Selbstfindung und
ein erneuertes Interesse an geistlichen Tradition, religiöser Erziehung, erbaulicher
Literatur usw. stand.
• Rückkehr der alten historischen Religionen, erneuerte oder neue Legalisierung re-
ligiöser Körperschaften ist die zweite Ebene.
• Vermutlich die verbreiteste Wiederbelebung der Religion sei die Verschmelzung
von religiöser und nationalistischer Identitäten. Es entstanden nationalistische
Bewegungen und Hand in Hand mit ihnen entwickelte sich „eine mitunter aggres-
sive Selbstbehauptung kollektiver religiösen Identitäten“.
• Viertens entstand in dieser Region zum ersten Mal ein freier Glaubensmarkt, wo
neben verschiedene traditionellen Religionen auch ganz neue religiöse Gruppen
finden hier fruchtbaren Boden.
Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus muss man sich aber auch die Frage stellen, wel-
ches die eventuellen Gefahren der jetzt in der Öffentlichkeit ungehindert wirkenden Religion
sind. Die größte Gefahr sei nach Casanova, wenn das politische Engagement der Religionen reli-
giöse Zwistigkeiten schürt. Casanova unterscheidet dabei zwischen religiös-säkularen, ethnisch-
religiösen und konfessionellen Streitigkeiten. Zum ersten meint er, dass die Trennung von Staat
und Kirche – trotz etlichen Zögerungen – in der ganzen Region gesetzlich verankert ist. Es wird
die allgemeine Religionsfreiheit und auch die vom Staat unabhängige Selbstbestimmung der
religiösen Institutionen akzeptiert. Was die ethnisch-religiöse Dimension angeht, es flammen
immer wieder nostalgisierende Versuche in Richtung reiner Nationalstaaten auf, wo die ethnisch-
religiöse Mehrheit den Staat von Minderheiten säubern kann. Diese manchmal überbetonte Ge-
fahr nuanciert Casanova, in dem er behauptet: „Ohne in irgendeiner Weise religiöse Institutionen
oder Autoritäten von ihrer Schuld entlasten zu wollen, sollte man gleichwohl anerkennen, dass
die aggressivsten Formen des ethnischen Nationalismus, ob nun in Bosnien oder in Nagorni-
54
Karabach, am wenigsten von religiösen Eiferern genährt werden.“85 Dieses Problem wird langfri-
stig nur dadurch gelöst, wenn die sogenannten geschichtlichen Kirchen aufhören „sich als Ge-
meinschaftskulte eines Nationalstaates zu betrachten und zu freiwilligen religiösen Gemeinschaf-
ten werden, die eher in der Zivilgesellschaft als in der Nation verankert sind.“86 Hier verrät der
Autor am eindeutigsten seine vielleicht kritiklose Vorliebe zum amerikanischen Modell der öf-
fentlichen Stellung der Religionsgemeinschaften, die aus einer ganz anderen Tradition unter ganz
anderen gesellschaftlichen Verhältnisse zustande gekommen war und sich wahrscheinlich nicht
(ohne weiteres) in die ost(mittel)europäische Region übertragen lässt. Aber Casanova meint, dass
sich in der Zukunft dieses Modell in ganz Europa durchsetzen werde. Entsprechend dem ameri-
kanischen Modell „Wettbewerb am Religionsmarkt“ meint Casanova, dass die grundsätzliche
Trennung von Kirchen und Staat, die auch ihre rechtliche Gleichstellung inkludiert, die religiösen
und konfessionellen Auseinandersetzungen nach der Eigenlogik des kulturellen Marktes ausge-
tragen lassen. Zwar ist die rechtliche, aber vor allem die praktische Situation in dieser Region
von dem amerikanischen noch weit entfernt, die Verhältnissen entsprechen aber zunehmend den
differenzierten Strukturen der Moderne.87
Der religiöse und konfessionelle Frieden ist durch zwei Prozesse gefährdet: die Streitigkeiten der
orthodoxen Kirchen und durch die „aggressive Expansionspolitik des römischen Katholizismus“
in der ganzen früheren Sowjetunion. Die Situation des konfessionellen Wettbewerbes hat Bünd-
nisse hervorgerufen. Die Orthodoxen verschiedener Prägung verbündeten sich gegen den römi-
schen Katholizismus, andererseits versuchen alle christlichen Großkirchen gemeinsam sich bzw.
ihre Gläubigen gegen die streitbaren evangelikalen Sekten zu schützen.
Diese Konflikte kann man als einen positiven Beitrag zum Demokratisierungsprozess betrachten,
weil sie in ganz Europa zu einem offenen religiösen Pluralismus führten. Dies aber ist in dieser
Region nur „durch die Freisetzung der religiösen Gemeinschaften aus ihrer traditionellen Bin-
dung an Staat und Nationen“ möglich.88 Ein anderes Szenario ist Samuel Huntington und anderen
folgend, wenn diese Konflikte Vorboten eines globalen Streits sind, die die internationalen Aus-
einandersetzungen des Zeitalters der Nationalstaaten und der Epoche des Kalten Krieges ablösen
werden.
Kollaboration
Ernst Christoph Suttner – ein guter Kenner der osteuropäischen Staaten – führt in einem Artikel
einen etwas seltsam klingenden Begriff von Märtyria aus. „Russlands Kirchenführer haben
84 Casanova, Chancen 199. 85 A. a. O. 201. 86 A. a. O. 202. 87 A. a. O. 203.
55
zwangsläufig nach einem ‚Modus vivendi’ mit den kirchenfeindlichen Behörden suchen müssen.
Dieser erwies sich der Ratlosigkeit der Kirche und wegen ihrer Schwäche gegenüber dem totali-
tären Staat als ein enges Korsett. Die scharfen und lieblosen Kritiker überhörten, dass russische
Hierarchen damals davon sprachen, dass sie sich einem Martyrium der Selbstverleugnung unter-
zogen. Sie beachteten nicht, dass viele Hierarchen bewusst auf die Reputation verzichteten, die
sie als unbeugsame Widerstandskämpfer persönlich hätten erwerben können; dass sie statt dessen
Kompromisse eingingen, damit sie dem christlichen Volk um einen Preis, der bisweilen sehr
hoch war, wenigstens die Spendung der Sakramente sicherten. Niemand bestreitet, dass beim
Kompromiss-Schließen Fehler gemacht wurden. Die Kritiker, die hämisch auf einschlägige Feh-
ler verweisen, bedenken zu wenig, dass keiner, der in einer schwierigen Situation zu Kompro-
misse gezwungen wird, ahnen kann, was sich später daraus entwickeln wird. Sie nehmen auch
nicht zur Kenntnis, dass der Geist Gottes den Kirchen Russlands in jener Epoche, in der viele
Bischöfe das Martyrium der Selbstverleugnung auf sich nahmen, in besonderem Maß beistand
und ihnen gerade damals die Kraft zu einem beispielhaften Zeugnisgeben verlieh.“89
Für das Verständnis der Haltung dieser genannten Bischöfe ist es nach Suttner wichtig, auf zwei
Tatsachen hinzuweisen. Erstens: die Ausbildung dieser Bischöfe (noch vor 1917) forderte eine
volle Loyalität gegenüber der Staatsmacht. Eine vom Staat unabhängige, autonome Kir-
che(npolitik) war für sie schlicht undenkbar. Zweitens konnten die ökumenisch-theologischen
Prozesse in diesem Jahrhundert, die sich in den freien Ländern Europas vollzogen haben, von
diesen Bischöfe hinter dem Eisernen Vorhang nicht mitverfolgt werden. Selbst die ganz wenigen
unter ihnen, die teilweise an einem oder anderen diesbezüglichen Programm durch Ausreisege-
nehmigung teilnehmen konnten, waren nicht imstande, die dort Gehörte zu Hause weiterzugeben.
„Zweite“ und „Dritte“ Welt
„Der Zusammenbruch des kommunistischen Systems in Osteuropa hat keineswegs nur negative
Auswirkungen auf die Dritte Welt. Er hat zu einem neuen wirtschaftspolitischem Realismus ge-
führt und in vielen Ländern demokratischen Bewegungen und Menschenrechtsgruppen Auftrieb
verliehen, was in einigen Fällen bereits zur Ablösung korrupter und autoritärer Regime geführt
hat. Eher zwiespältig fällt die Bilanz der Ost-West-Entspannung aus. Positiv zu bemerken ist,
dass sich Stellvertreterkriege in der Dritten Welt erheblich entschärft haben, seitdem die Super-
mächte ihre militärische Unterstützung für Konfliktparteien abbauen. Dies bietet betroffenen
Länder die Chance, ihre knappen Ressourcen nun in den Dienst ihrer Entwicklung zu stellen,
statt sie für Waffenkäufe zu verschwenden. Überdies entlastet der weltweite Abrüstungsprozess
88 A. a. O. 205. 89 Suttner, Konfliktlösung 772-773.
56
auch die Etats der reichen Länder. Die dadurch frei werdenden Gelder könnten für großzügigere
Entwicklungshilfe – etwa bei der Entschuldung – eingesetzt werden.“
Theologische Deutungsversuche
Auf der Basis der Erfahrungen mit der EKD und betroffen von der Wende und Wiedervereini-
gung Deutschlands versucht Jürgen Moltmann die Bedeutung der Wende und des Christsein in
der ehemaligen DDR auch theologisch zu reflektieren. Ein erster spezielles Merkmal des
Christseins im real existierenden Sozialismus war die persönliche und gesellschaftliche Klarheit
des christlichen Profils. Man konnte haarscharf feststellen, wo die Christen stehen und es gab das
klare Gegenüber der Nicht-Christen . Demgegenüber sind Kirche und Christentum in den westli-
chen Bundesländern öffentliche Einrichtungen und gehören so eng zur bürgerlichen Existenz,
dass „es schwer ist, einen Menschen einen Nichtchristen zu nennen, ohne an seiner bürgerlichen
Reputation zu zweifeln. Die Christen in den befreiten Ländern müssen das klare Profil ihres
Christsein nunmehr unter der neuen Verhältnissen des öffentlichen Lebens umsetzen. Die Her-
ausforderung heißt öffentliches Bewahren ohne Verlust des klaren Profils.
Ein entscheidender Charakter des christlichen Existenz war weiter die Option für den Frieden:
Absage an Geist, Logik und Praxis des nuklearen Abschreckungssystems, sowie die Befürwor-
tung eines Friedensdienstes ohne Waffe. Diese Option für den Frieden hatte u.a. einen systemkri-
tischen Zug an sich. Jetzt aber, da das System sich geändert hat, müssen die Christen ihre radika-
le Option für den Frieden in neuer Weise umsetzen - und dies angesichts der weithin ausgelaufe-
nen westlichen Friedensbewegungen. Letztlich haben die Christen in der ehemaligen DDR als
eine kleine Minderheit bei der Wende sich für das ganze Volk, für die Freiheit aller eingesetzt.
Sie haben nicht bequem die kleine Nischen genossen, sondern waren offen für alle. Wenn die
christliche Kirche eine Minderheit bleibt, schon ist oder noch werden wird, dann ist es für sie in
der Nachfolge der entscheidende Punkt, ob sie sich für die Anderen einsetzt oder in kleinen Di-
asporakreisen abgeschlossen bleibt. Hier ist die Brücke zu dem vierten und letzten Merkmal ge-
setzt, dass nämlich in der damaligen Zeit die Kirchengemeinde und die Aktionsgruppe oft eins
waren. In der befreiten Situation liegt die Gefahr nahe, dass die gesellschaftspolitische Verant-
wortung an „christliche Parteien“ oder an außergemeindliche Aktionsgruppen delegiert wird, als
wäre Nachfolge in der Gemeinde ohne politische Anteilnahme in den demokratischen Entwick-
lungen noch christlich.
Moderne
Der europäische Rationalismus, samt seinen bis heute wirksamen Folgen, ist - so Alain de Be-
noist - ein Kind des Christentums. Er kommt aus der Uminterpretierung des Wahrheitssinns bei
57
den Griechen (aletheia) in denjenigen eines rein abstrakt zu fassenden Grundes (causa) der Welt
nach dem Modell des völlig von seiner Schöpfung getrennten jüdischen Gottes. Dasaus sind in
der Moderne entstanden: die Autonomie des Subjekts einer objektivierten, aus manipulierbaren
Naturgesetzen bestehenden Welt gegenüber; die Abwertung der Religion zur Privatsache; die
Säkularisierung der abendländischen Gesellschaft; die Laizität des Staates; die illusorische Ideo-
logie eines grenzenlosen Fortschritts zu Gunsten einer abstrakt verstandenen Menschheit, die für
jedes Individuum dieselben Menschenrechte sichern möchte; und schließlich der Untergang des
Christentums selbst als bewegender Macht des europäischen Schicksals, in dem es nämlich den
aus seinem eigenem Schoß entlassenen Mächten zum Opfer gefallen ist. Dabei wäre sicher ein-
zuwenden, dass der jüdische Gott die Welt nicht sich selbst überlassen hat und weiter, dass das
Christentum zwar die Welt und auch den Menschen aus der Vielgötterwelt der Antike zu einer
Autonomie in der Kraft des Glaubens an Jesus Christus befreit hat, aber in seiner Tradition im-
mer den Gottesbezug in Erinnerung gehalten hat. Das Christentum hat für die Autonomie der
Schöpfung Wesentliches beigetragen, blieb aber immer in der Spannung zwischen Autonomie
und Theonomie. Bei der Geburt der Moderne in der Auffassung von Benoist war das Christentum
sicher dabei, aber es spielten in der von ihm beschriebenen Entwicklungen auch weitere Faktore
eine wichtige Rolle. Dabei ist vor allem an die andauernden und schließlich unerledigten Kon-
flikte zwischen den Konfessionen zu denken, die Wirtschaft, die Politik und auch das europäi-
sche Denken aus dem Bereich der durch die Kirchenkonflikte belasteten Religion in ein profanes
Feld rückte.
KIRCHE FÜR DAS NEUE EUROPA
Christentum für Europa
Jean-Marie Paupert, der in den fünfziger Jahren zu den glänzenden katholischen Intellektuellen
Frankreichs gehörte und heute sich gerne als katholischer Humanist versteht, ist in einem Vortrag
der Frage nachgegangen, ob das Christentum eine Religion für Europa sei. Die europäische Kul-
tur entwickelte sich im Dreieck Jerusalem, Athen und Rom. Europa bekommt seinen Wert in
dem Moment, als sich das Christentum auf seinem Boden niedergelassen hat. Dank des Römi-
schen Imperiums konnte sich hier die christliche Lehre sehr schnell in einem kohärenten großen
und kulturellen Universum entwickeln, um allmählich die Religion Europas zu werden, die von
da aus in die ganze Welt hinauszog. Es gab kaum einen Synkretismus. Das Christentum und das
christliche Europa neigten von Anfang an zu Entdeckung, Kolonisierung und Mission. Darin sind
sie einander verwandt. Das belegen viele historische Fakten: angefangen von den Entdeckungs-
reisen der Nestorianer in Persien, Zentralasien, Indien, China und Japan, über die Missionstätig-
keit der Franziskaner und Dominikaner während des 12. und 13. Jahrhunderts, die Verkündigung
58
des Evangeliums in Fernost durch die Dominikaner und Jesuiten, das spanisch-katholische A-
bendteuer in Amerika, bis zum skandinavischen Missionsaktivismus in allen vier Erdteilen wäh-
rend des 19. Jahrhunderts. „Ohne Zweifel ist Europa, das christliche Europa, die Christenheit,
deren Zentrum unser Kontinent war, an die Eroberung unseres Planeten gegangen; eine europäi-
sche Eroberung, der wir es verdanken, dass das Christentum und seine Kultur heute noch mehr
oder weniger in der ganzen Welt verbreitet sind.“
Einheit des Christentums – Einheit Europas
Wolfhart Pannenberg, der aus Ostdeutschland stammende protestantische Systematiker, der eine
ausgeprägte theologische Position in der ökumenischen Theologie vertritt, konzentriert sich auf
das Verhältnis zwischen der Einigung der Kirchen und der Einigung Europas. Nach ihm ist das
Christentum ist einer der wenigen Faktoren, die zumindest potenziell das Bewusstsein der Einheit
europäischer Kultur begründen können. Es ist eine wichtige Aufgabe intellektueller Orientierung
in unserer Zeit, die Menschen Europas zu bestärken in dem Bewusstsein, über alle nationalen
Grenzen hinweg durch ein gemeinsames kulturelles Klima bereits vereint zu sein. Heute ist es
aber eine gar nicht leichte Aufgabe, das moderne Kulturbewusstsein davon zu überzeugen, dass
Christentum und Kirchen in diesem europäischen Prozess von heute auch eine positive Rolle
spielen können. Die Erinnerung an die mittelalterlichen Vorkommnisse, als die kirchliche Politik
die Konflikte zwischen den Nationen vermehrte und auch ausnützte, ist immer noch in Erinne-
rung. Man vergisst nicht die römische Machtpolitik, die nicht nur im 11., sondern noch mehr im
15. Jahrhundert, als das östliche Christentum die höchste Krise seiner Selbstbehauptung gegen
die siegreiche islamische Eroberung zu bestehen hatte, die Führerschaft der orthodoxen Christen-
heit aber für den Westen erpresst und die Bevölkerung im Stich gelassen hat. Und in und nach
der Zeit der Reformation ergab sich die Emanzipation der öffentlichen Kultur von ihrer christli-
chen Wurzel als eine direkte Konsequenz der Geschichte kirchlicher Spaltungen und religiöser
Kriege, die eine Folge der Reformation waren. Ein Akt gemeinsamen Bekenntnisses der heutigen
christlichen Kirchen zu ihrer Mitschuld an der Geschichte europäischer Spaltungen und Konflikte
wird so zu einem wichtigen Beitrag der christlichen Kirchen im Einigungsprozess. Die ökumeni-
sche Bewegung soll deshalb ihre Verantwortung für Europa im Bewusstsein dieser Mitschuld
wahrnehmen. Dieselbe Selbstkorrektur muss auch bezüglich des Verhaltens der Kirche zu der
Frage der Menschenrechteerfolgen. Die kirchlichen Autoritäten standen oft der Moderne ent-
schieden kritisch gegenüber, obwohl diese sich mit ihren tiefen Wurzeln aus dem christlichen
Gedankengut speiste. Der Übergang zur Moderne war aber nicht ein Prozess einfacher Entfaltung
christlicher Ideen. Heute sind die Früchte dieses komplizierten Prozesses vom theologischen
Bewusstsein aller Kirchen angeeignet worden. Dennoch standen die meisten Kirchen in den frü-
heren Zeiten in Opposition zu den Gedanken der Menschenrechte und den bürgerlichen Freihei-
59
ten. Daher ist es geboten, dass die Kirchen theologisch diesen Prozess neu buchstabieren und die
nötigen Korrekturen bezüglich ihrer theologischen Stellung und inneren Strukturen vornehmen.
Dies kann für die künftige Rolle der Kirchen in einem vereinten Europa bedeutsam sein.
Die fehlende Einheit der westlichen und östlichen Kirchen ist auch ein Hindernis in der Rolle des
Christentums in Europa. Es geht nicht nur um theologischen Positionen, sondern auch um die
geschichtliche Reflexion über die „Rücksichtslosigkeit der kirchlichen und säkularen Politik des
Westens in ihren Beziehungen zum christlichen Osten“. Erst dies kann die Bedingung dafür
schaffen, dass durch die ostkirchlichen Traditionen nicht nur die Erinnerung an die klassische
griechische Antike in das Bewusstsein europäischer Kultur aufgenommen wird, sondern auch das
theologische, liturgische und spirituelle Erbe dieser östlichen Kirchen. Die Verstärkung der Be-
deutung einer mystischen Spiritualität ist auch eine nötige Korrektur der rationalisierenden Theo-
logien der westlichen Kirchen.
Die Erneuerung der ökumenischen Christenheit ist eine unaufschiebbare Notwendigkeit. Die
Kirchen sollen gemeinsam aufzeigen können, dass sie die Wunden der Vergangenheit kennen
und bereit sind zu heilen und dadurch sind sie erneut fähig auf die tiefen christlichen Wurzeln
Europas zu erinnern.
Von einer Globalkultur zur Hochkultur
Die Ergebnisse der europäischen Wertestudie 1990/1991 haben Peter Hünermann veranlasst,
nachzudenken, welche Kirche und welche Theologie für das in der Studie dargestellte Europa
eine ähnlich konstituierende Rolle spielen können, wie sie diese in der europäischen Hochkultur
ohne Frage gespielt haben.90 Dabei stellt Hünermann fest, dass die heutige Kultur nach dem Au-
seinanderfallen einer Hochkultur als Globalkultur zu bezeichnen sei. Grundzüge dieser Global-
kultur sind: die übergeordnete Wichtigkeit der Medien (was nicht in den Medien ist, hat kein
Existenz); eine Arbeitskultur und Kultur des Kommerzes – Arbeits- und Berufswelt sind „ge-
kennzeichnet durch eine ungeheure Kommunikationsdichte, ein ganz enges Beziehungsgeflecht.
Dies transformiert die überlieferte Hochkultur, welche eine Kultur der Sesshaftigkeit war, in eine
Kultur der Mobilität und Produktivität“; dazu kommt als weiteres Merkmal die Steigerung und
Perfektionierung partikularer Rationalitäten im Bildungsbereich; eng hängt damit zusammen die
Herausbildung partikularer Gestalten des Ethos. Was die religiöse Landschaft betrifft – zeigt die
Europastudie auch –, dass die religiösen Menschen in hohem Grad diesseitsorientiert sind, uner-
reichbar hohe Anforderungen gegenüber ihrem Lebens stellen, was wiederum desolidarisierend
wirkt. Dazu kommt, dass die traditionellen Grenzen zwischen den Religionen und Konfessionen
90 Hünermann, Glaube.
60
vor allem durch die Medien an Bedeutung verlieren – sie gelten heute keineswegs mehr maßgeb-
lich.
Aufgabe der Christen in Europa
„Weder die griechische Polis noch das auserwählte Volk, weder das Heilige Reich noch die Chri-
stenheit und das Abendland, weder der Osten noch eine neue Weltordnung können letztlich das
Fundament des europäischen Menschen sein. Dies klingt zwar sehr unbestimmt, dürfte aber je-
denfalls die Richtung anzeigen, in welche die Kirche, die Christen, die TheologInnen aus Ost-
und West in die Zukunft zu gehen hätten. Es ist die Aufgabe der Christen, den schwierigen Weg
der Offenheit für das Absolute, für Gott als allein letztem Ziel und damit der Offenheit für die
prinzipielle Überholbarkeit menschlicher Einrichtungen und Errungenschaften zu gehen. Es wäre
nicht zuletzt zu wünschen, dass dies gerade auch im innenkirchlichen Bereich geschieht, dass im
Christentum, in den europäischen Kirchen, weder ein Bibel noch die Tradition oder Institutionen
fixierender Fundamentalismus (oder ein damit verbundener Nationalismus) die Oberhand ge-
winnt, sondern dass vielmehr der mühsame Weg gegangen wird, der auch die Kirche (bzw. die
Kirchen) des Ostens und des Westens Europas nicht allein ein für allemal fixiertes Wahrheitssy-
stem überhöht, sondern deren menschliche Komponente, deren Vorläufigkeit, deren Nicht-
Identität mit dem angezielten Eigentlichen in Theorie und Praxis ernst nimmt.“ So schrieb Tamás
Nyiri91 von der Budapester Akademie.
Die politische Bedeutung der Wende ist offenkundig – sagt Eugen Biser – aber kaum einmal
wurde nach ihrer geistig-religiösen Bedeutung gefragt, obwohl diese geradezu in die Augen
springt.92 Dieser Mangel hängt vermutlich damit zusammen, dass dem freien Westen kaum zu
Bewusstsein kam, wie sehr er von dem jahrzehntelangen Freiheitsentzug, den die Ostvölker erlit-
ten, in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Wende ruft die elementare Bedeutung und Zu-
sammenhang der Freiheit und der Friede in Erinnerung. Sie gehören zu jenen höchsten Güter der
Menschheit, die man nicht voll besitzen kann, solange sie anderen vorenthalten sind. Die Wende
erinnert mit der Macht eines geschichtlichen Ereignisses erster Größenordnung daran, dass das
Wissen um die unvertretbare Würde eines jeden, der Menschenantlitz trägt, als ein Geschenk
Jesu an die Menschheit, besonders des abendländischen Kulturkreises zu gelten hat. Wenn das
aus dem großen Umbruch entstehende neue Europa nicht ins Chaos zurückfallen will, dann wird
es sich insbesondere auf die angesprochenen Konstanten besinnen müssen. Dabei muss ihm klar
91 Nyíri, Der dramatische Weg 25. 92 Biser, Leitsterne für Morgen 51-53.
61
werden, dass die Menschenwürde nur in Akten getätigter Menschlichkeit gelebt werden kann.
Und dies ist von Bedeutung angesichts der eingetretenen Unterkühlung nach der Wende.93
Friedensethische Ansätze
Friedensethik ist ein Teilbereich der katholischen Soziallehre. Hans Langendörfer (Bonn) skiz-
ziert in einem Aufsatz94 die wichtigsten Forderungen, die in dem Prozess der europäischen Um-
strukturierung nach der Wende von 89/90 von Bedeutung sind.
Um Frieden sichern zu können, soll man die möglichen Kriegsursachen beseitigen. Was Ost-
(Mittel)Europa betrifft, „fehlt es bislang an tragfähigen demokratischen Institutionen, einschließ-
lich einer soliden Gesetzgebung und Rechtspflege im Bereich der Menschenrechte und Grund-
freiheiten. Auch verfügen die neuen politischen Parteien dieser Länder über nur geringe Erfah-
rung, ein stabiles Parteispektrum konnte noch nicht entwickelt werden. Dies birgt die Gefahr
innenpolitischer Labilität in sich, die sogar friedensgefährdend sein könnte“95. Zu diesen Gedan-
ken, die im 1991 erschienen sind, also ziemlich frisch nach der Wende, kann man aufgrund der
regionalen Erfahrungen der darauffolgenden Jahre ergänzen, dass – hinsichtlich der ost(mittel)-
europäischen Region (also die GUS Staaten und die Balkanstaaten ausgenommen) – alle Länder
über ein ziemlich stabiles Mehrparteisystem verfügen und die Strukturen der Sicherung der
Grundrechte ausgebaut sind. Es gibt unter diesen Ländern zwar Unterschiede, aber der Grundton
der Entwicklung ist in der genannten Hinsicht beruhigend. Ein großes Problembereich waren die
Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Diese Kriege zeigten einerseits die Konflikte unter den
Ethnien und die Schwächen der dortigen demokratischen Strukturen auf. Andererseits haben
diese Kriege das ganze Europa und die USA vor der Frage gestellt: Wie kann Frieden in einem so
unbekannten und politisch unterentwickelten Nationenkonglomerat gesichert werden? Besonders
die Kosovo-Intervention der NATO und die Bombardierungen Serbiens zeigten die letzten Mit-
tel, die für Frieden – auch in der christlichen Soziallehre über Krieg als „ultima ratio“ vertrete-
ne – eingesetzt werden konnten. Damit sind möglicherweise die letzten Kriegsursachen auf der
europäischen Ebene ausgeräumt.
Friedensförderung und Friedenssicherung ist in dieser Region nur durch den Abbau des wirt-
schaftlichen Gefälles zwischen West und Ost möglich. Hierfür Lösungen zu finden ist zur weite-
ren Stabilisierung des Friedens von großer Bedeutung. Ein Krisenszenario ist die wirtschafts-
bzw. armutsbedingte Massenemigration von Ost- nach Westeuropa.96 Die Reformländer der Re-
gion haben die schwierige Aufgabe zu lösen: die Liberalisierung und Effizienzorientierung auf
93 Vgl. ausführlich ders., Ein Zeichen. 94 Langendörfer, Für eine Weltrepublik. 95 A. a. O. 53. 96 Zu dem Problem der Migration Hainz, Flüchtlinge in Europa.
62
der einen Seite mit Aspekten sozialer Zumutbarkeit auf der anderen Seite zu verbinden, was eine
Forderung der sozialen Gerechtigkeit wie auch des sozialen Friedens ist. Im Kontext der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung Gesamteuropas muss die Perspektive globaler Gerechtig-
keit und Solidarität offen bleiben. Weder die Europäische Gemeinschaft noch das Europa des
gesamteuropäischen Wirtschaftsraums dürfen ihre weltwirtschaftliche Verantwortung97 verges-
sen – wie sie auch in den anderen Bereichen der Friedensprozesses weltweit in die Pflicht ge-
nommen sind.98
Zur Beseitigung der Kriegsursachen und des wirtschaftlichen West-Ost-Gefälles sollen in der
Europäischen Gemeinschaft verbindliche gesetzliche Regelungen getroffen werden. Hier kann
der KSZE eine zentrale Bedeutung zukommen. Sie soll durch enge Verbindung mit dem Europa-
rat in manchen Punkten die rechtliche Verbindlichkeit von Vereinbarungen vergrößern. Diese
Regelungen auf der hohen politischen Ebene müssen aber subsidiär durch eine Förderung der
Nichtregierungsorganisationen und anderer zivilgesellschaftlichen Institutionen ergänzt werden.
Dies entspricht auch der katholischen Soziallehre, deren wichtiges Kernprinzip gerade die Subsi-
diarität ist. Nur so kann „der Freiheit der kleinen sozialen Einheiten und letztlich der Würde der
menschlichen Person hinreichen Rechnung getragen werden“.99 Im Verständnis der Subsidiarität
gibt es allerdings einen wesentlichen Unterschied zwischen der Auffassung der katholischen
Soziallehre und der Soziallehre der EU. In der Letzteren wird unter Subsidiarität vor allem die
Souveränität der Mitgliedsstaaten gegenüber den zentralen Instanzen der ganzen Europäischen
Gemeinschaft verstanden und gesichert. Nach der katholischen Soziallehre aber müssen die staat-
lichen und zwischenstaatlichen NGOs unterstützt werden, weil das „a garantee of institutional
pluralism“ ist.100
EU-Erweiterung, Rolle der Kirchen
„Den Kirchen könnten nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime für den Aufbau
der neuen politischen und sozioökonomischen Ordnung ein wichtige Rolle zufallen. Das bisheri-
ge offiziell propagierte Wertesystem ist zerfallen, und die Kirchen, die in Osteuropa in der Regel
mit der Titularnation des betreffenden Staates auf engste verbunden sind, könnten zum einen
sinnstiftend wirken, zum andern aber auch dadurch, dass sie ein Symbol nationaler Identität dar-
stellen, dem Staat eine Anknüpfung an vorsozialistische Traditionen erleichtern. Tatsächlich
besitzen die Kirchen fast überall eine hohe moralische Autorität, und die politischen Führungen
bemühen sich teilweise ostentativ um die Nähe zu den Kirchenführungen. Die faktische Rolle,
97 Zur globalen Strukturen der Verantwortung vgl. Büchele in Müller, Soziales Denken 70-72. 98 A. a. O. 55. 99 A. a. O. 56. 100 Sutherland, More Europe? 387.
63
die die Kirchen beim Aufbau der neuen Gesellschaften und auch bei der Annäherung an Westeu-
ropa spielen können, wird jedoch durch mehrere Faktoren beeinträchtigt. So hat die religiöse
Bindung breiter Kreise der Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur aufgrund des
auch in Westeuropa zu beobachtenden Säkularisierungstrends nachgelassen, sondern auch durch
die massive und teilweise brutale Unterdrückung der Religion zu kommunistischen Zeiten.“101
„Die oft zitierte Feststellung, dass Europa ohne das Christentum und ohne die Kirche, ohne die
Heiligen Benedikt, Cyrill und Method nicht das Europa wäre, als das es sich uns heute darstellt,
ist zwar sachlich richtig, aber zugleich auch ambivalent; denn ebenso haben die Auseinanderset-
zungen zwischen dem Kaiser und dem Papst, die Schismen, die Religionskämpfe und -kriege der
Neuzeit, die Auseinandersetzungen zwischen Kirche und Staat bis zu deren Trennung das heutige
Europa entscheidend geprägt.“102 Gesucht sei eine Seele für Europa (Jacques Delors), da Europa
auch eine Wertgemeinschaft ist. Die Kirchen können dazu beitragen, aber nicht als Lückenbüße-
rinnen, sondern aus ihrem grundlegenden Auftrag heraus, wie das Zweite Vatikanische Konzil im
Gaudium et spes in der Nummer 1 formuliert: „Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der
Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden“. In dieser neuen Europa sind
große Sorgen – Hoffnungen und Ängste – zu verkraften: die hohe Arbeitslosigkeit, die rasant
zunehmende weltweite Vernetzung von Datenträgern und Medien usw. „Die Absicht, die Union
durch den Beitritt neuer Mitgliedsländer aus Mittel- und Osteuropa zu erweitern, weckt nicht nur
Zweifel bei der Bevölkerung der Mitgliedsländer, sondern auch bei vielen Funktionären der Uni-
on. Ist dieses Projekt ausführbar, und wenn ja, zu welchen Bedingungen und mit welchen (wohl
unvermeidbaren) Opfern?“103
Der kirchliche Beitrag zu Europa sei nach Lothar Roos dadurch von Bedeutung, weil das große
Projekt „freier Mensch und Gesellschaft ohne Gott“ scheiterte. Die großen Errungenschaften der
säkularen Modernisierung, wie die Trennung von Politik und Ethik, von Wirtschaft und Ethik,
der Kult der Verwirklichung freier Subjektivität, haben in einer Phase Freiheiten hervorgebracht,
aber der Abschied von der transzendentalen Begründung der Grundwerte, wie Freiheit, Men-
schenwürde, Menschenrechte usw. öffnete den Weg zur Unkultur der Machiavellismus, Absolu-
tismus, Faschismus, Nationalsozialismus, Bolschewismus. Der Manchester-Liberalismus führte
zur Schule des Solidarismus (Heinrich Pesch). Die Rolle der Kirche sei daher, in ihrer Sozialleh-
re und vor allem in ihrer sozialen Praxis die fehlende Letztbegründung zu vertreten und ein leb-
bares Leben einzufordern. Das tut bereits die kirchliche Soziallehre, wie z.B. im Enzyklika Cen-
tesimus annus auch Papst Johannes Paul II. betonte: „Wenn es keine transzendente Wahrheit gibt,
der gehorchend der Mensch zu seiner vollen Identität gelangt, gibt es kein sicheres Prinzip, das
101 Ziemer, Das schwierige Zusammenwachsen, 108f. 102 Sutherland, More Europe? 378.
64
gerechte Beziehung zwischen den Menschen gewährleistet. Ihr Klasseninteresse bringt sie un-
weigerlich in Gegensatz zueinander. Wenn die transzendente Wahrheit nicht anerkannt wird,
dann triumphiert die Gewalt der Macht.“ (CA 44,2)104
Im Schutz und in der Förderung von Grundwerten sieht auch der Sozialethiker Franz Furger die
Rolle der Kirchen in der EU. Er erinnert daran, „dass die Gemeinschaft oder die Union als solche
so gut wie der moderne pluralistische und demokratische Einzelstaat in seinem Bereich zwar eine
funktionale Organisation im Dienst des Gemeinwohls darstellt, welche gewisse soziale Dienstlei-
stungen für Bildung, Verkehr, Schutz und Versicherung usw. zu gewährleisten, eine entspre-
chende Infrastruktur sicherzustellen und für Notfälle ein soziales Netz vorzubereiten hat. Keines-
falls jedoch ist er oder sie als solche eine im Sinn einer platonischen Idee selbstständige sittliche
Größe. Da weder der einzelne Staat noch eine Staatsgemeinschaft eine eigene Hoheit darstellen,
haben sie die gesellschaftlich anerkannten Werte zwar zu schützen; sie können sie aber weder
schaffen noch von sich aus garantieren oder aufheben. Was so schon für den einzelnen Staat
gilt... muss noch vermehrt für eine noch stärker pluralistische Staatsgemeinschaft gelten, zumal
wenn diese durch die Eingliederung der ehemaligen DDR und wohl in absehbarer Zeit durch den
Beitritt weiterer ehemals sogenannter sozialistischer Staaten Europas einem weiteren Säkularisa-
tionsschub ausgesetzt wird und dabei die traditionell christlichen Wertvorstellungen weiter
verblassen.“105 Der Schutz von Grundwerten braucht „sinntragende Instanzen“, die glaubwürdig
nur in ökumenischer Zusammenarbeit zu leisten sind.
„Von einem „gerechten“ Europa kann man nur sprechen, wenn
• nicht nur die liberalen Grundrechte, sondern auch die sozialen relativ einheitlich gestaltet sind;
• Entscheidungen in einem demokratisch legitimierten Parlament auf der Basis einer sub-sidiären Ordnung getroffen werden und
• die Einzelstaaten der EU nicht ihre Interessen auf Kosten ihrer Partner durchsetzen su-chen,
• ferner wenn Europa auch der Verantwortung für ein größeres Gemeinwohl gerecht wird und
• einen Beitrag zur weltweiten Wahrung des Friedens und der Umwelt leistet.“106
103 Kuhn, Brüssel. Der Autor ist seit März 1997 Leiter der Kontaktbüros Brüssel des Sekretariats der Österreichischen Bischofskonferenz.
104 Roos, Europa ohne Gott? 105 Furger, Akzente christlicher Sozialethik 108. 106 Furger a. a. O. 143.
65
THEOLOGISCHE APPELLE
Herausforderung zur Selbstbestimmung
Die osteuropäische Lektüre der westeuropäischen Beiträge ruft zur kirchlichen und theologischen
Selbstbesinnung auf. Abgesehen von einigen osteuropäischen Theologen kennen sich manche
westliche Kollegen besser aus, was die Zusammenhänge der gesellschaftlichen und kirchlichen
Entwicklungen in Ost(Mittel)Europa betrifft. Hier ist ein deutlicher Nachholbedarf zu konstatie-
ren: eine erweiterte theologische Reflexion auf die historischen und sozialwissenschaftlichen
Aspekte. Die zuvor skizzenhaft dargestellten Stellungnahmen können Mut zu einer solchen auto-
nomen Selbstreflexion geben. Sie können die Bedeutung der eigenen Erfahrungen für die theolo-
gische Arbeit erhöhen. Eine letzte Bemerkung sei, dass die Überholung des politischen Block-
denkens in der Theologie ist, die gesamteuropäische Problematik des Christentums und der Kir-
che auch aus dem Blickwinkel des Ostens eigens zu erörtern und dies für die Diskussionen im
vereinten Europa anzubieten. Dazu eine kurze Einführung.
Europäische Theologik – theologische Eurologik
In den theologischen Beiträgen der neunziger Jahre ist ein logisches Muster zu beobachten, das
sich die Arbeiten ziemlich einheitlich durchzieht. In diesem Muster gibt es drei Pole: Europa,
Kirche(n) und Theologie. Eine theologische Eurologik konzentriert auf die geistigen, kulturellen
und gesellschaftlichen Vorgänge in Europa und reflektiert sie aus theologischem Gesichtspunkt.
Sie geht demnach so vor: der Einigungsprozess in Europa wird vor allem durch wirtschaftliche
Interessen gesteuert. Sie ist aber im Vergleich zu anderen Einigungsversuchen in Europa dadurch
gekennzeichnet, dass sie gewaltlos, durch Verhandlungen gemeistert wird. Dieser Prozess
braucht aber „eine Seele“, eine Identität, die nicht ausschließlich durch die Sachlogik der wirt-
schaftlichen Interessen gesichert werden kann. Hier haben die Kirchen und hat die Theologie
ihren Ort, zu der geistigen-kulturellen Seite des Einigungsprozesses einen Beitrag zu leisten. Sie
muss die Person bewahren, die menschenachtende Ethik Europas schützen und die Solidarität
und Subsidiarität in diesem Prozess einfordern. Die Kirchen müssen Anwalt dieser Werte sein
und sie auch in ihrem eigenen Bereich beispielhaft zu verwirklichen.
Die europäische Theologik konzentriert auf die Charakteristiken der europäischen Theologie und
fragt danach, wie diese Eigenschaften durch die europäischen Einigungsprozesse kritisch hinter-
zufragen sei. Eine kritische Reflexion über die Entwicklung des theologischen Denkens in Euro-
pa zeigt, dass die Kirchen einen entscheidenden Beitrag zu der Entwicklung Europas beigetragen
haben. Dies ist geschichtlich und auch inhaltlich zu beschreiben. Dieser Beitrag war einerseits
direkt, andererseits indirekt. Direkt haben sie die Kultur der Antike bewahrt, indirekt haben sie
66
die von den Kirchen(konflikte) befreite, säkularisierte Moderne hervorgebracht. Die Theologie
reflektiert kritisch diese Entwicklung, ruft sie in Erinnerung und bietet damit einen wichtigen
Beitrag unter dem Motto „Seele Europas“ zur Konstruktion der Identität Europas an. Hier spielt
eine wichtige Rolle die Reflexion über die geteilte Christenheit, die zu einer verstärkten Ökume-
ne motiviert, sowie über das konfliktbeladene Verhältnis von Kirche und Moderne, die eine inne-
re Erneuerung der Theologie aus dem Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils fordert.
FOKUSIERUNGEN
Die zwei Kapitel über die wichtigsten Erfahrungen und Charakteristiken der Region der Reform-
länder – aus „östlicher und westlicher Sicht“ – haben hochgradige Gemeinsamkeiten. Sie sind
gemeinsam darin, dass die gesellschaftliche und kirchliche Wirklichkeit dieser Länder transpa-
rent gemacht werden müssen. Die dies verhindernden Kräfte und Interessen dienen nicht die
Erneuerung und Revitalisierung dieser Region. Es bedarf eines großen politischen und gläubigen
Muts von den Verantwortlichen in Gesellschaft und Kirche, sowie auch von den Bürgerinnen und
Bürgern sowie Christen und Christinnen dieser Länder, sich der fundamentalen Herausforderun-
gen zu stellen. Bevor wir diese Herausforderungen sowie die Versuche ihrer Bewältigung präsen-
tieren, lohnt es sich zusammenfassend die Erfahrungsbasis zu sichern.
Turbulente Entwicklungen
Die ganze Region ist von turbulenten Entwicklungen gekennzeichnet. Auf allen Ebenen der Ge-
sellschaften dieser Länder gibt es ein die Menschen bedrängendes Maß an Neuheiten. Die Bürger
sind höchstens gefordert; ihre Überlebenskraft ist maßlos beansprucht. Diese Grundstimmung der
gesellschaftlichen Entwicklung nach der Wende macht die manchmal hektischen Empfindlich-
keiten verständlich und akzeptabel. Es ist zur Kenntnis zu nehmen, dass nach den strukturellen
Änderungen in der Gesellschaft – sprich Politik, Wirtschaft, Bildung usw. – die Änderungen in
der Mentalität sowie in der Reflexion des Alltags nur langsam vorangehen. Den Bürger und den
Christen dieser Länder ist keine rasche Änderung zumutbar. Solidarität, Geduld, Ausdauer gehö-
ren daher zu den am meisten gefragten Werten. Während dieser Stabilisierungsperiode ist es
weitgehend verständlich, wenn aus der Vergangenheit Konzepte, Forderungen, Wünsche ans
Tageslicht treten, die im heutigen Westeuropa skeptisch bzw. ablehnend wahrgenommen werden.
Traditionalismus, Radikalismus, Fundamentalismus sind Begriffe und Wertungen, die für diese
Region nur mit höchstem kontextuellen Feingefühl verwendet werden dürfen.
Zu diesen regionalen Merkmalen gehören nach den Äußerungen der Experten aus Ost und West:
Nationalismus, Vergangenheitsbewältigung, kultureller, politischer und religiöser Pluralismus,
Beheimatung in Europa.
67
Religiöse Tendenzen
Alle Länder in dieser Region sind durch das Christentum geprägt. Ihre politische und wirtschaft-
liche Geschichte ist weitgehend durch das Christentum bestimmt. Die auch Säkularisierung ge-
nannte Entwicklung, die in Westeuropa in den letzten zwei Jahrhunderten die religiöse Grunddi-
mension der Gesellschaften radikal umgeformt hat, traf der Gesellschaften Ost(Mittel)Europas
auch, aber je nach dem Typus der Länder verschieden. Diese Länder haben aber gemeinsam, dass
sie alle nach einer bürgerlichen Säkularisierung durch die Zweiteilung Europas auf zwei politi-
sche Blöcke von einer kommunistischen Säkularisierung getroffen wurden. Diese Art der Säkula-
risierung entwickelte eine von den westlichen Gesellschaften in vieler Hinsichten diversen Stel-
lung der Religion in der Gesellschaft. Aus diesem Blickwinkel her muss man verschiedene Sub-
regionen in dieser Region wahrnehmen, die im Grad der Säkularisierung (und in Verbindung
damit der Modernisierung) voneinander abweichen. Etwas vereinfachend kann man sagen: je
westlicher, desto säkularisierter sind diese Gesellschaften. Diese geographische Bestimmung
scheint sich mit einer konfessionellen Bestimmung zusammenzufallen: je orthodoxer, desto we-
niger modernisiert und auch säkularisiert.
Die geschichtlich gesehen ziemlich einheitliche religiöse Landkarte dieser Region wurde nach
der Wende durch das Auftreten bzw. durch eine „Invasion“ nichtchristlicher (und auch nichtjüdi-
scher) Religionsgemeinschaften in unterschiedlichem Masse neugezeichnet. In den westlichen
Ländern dieser Region mit weniger, in den östlichen mit mehr gesetzlichen, politischen und kir-
chenpolitischen Konflikten gehört die religiöse Pluralismus allmählich zu den Selbstverständ-
lichkeiten des öffentlichen Alltags. Wie die kriegerischen und gesetzgeberischen Konflikte in den
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens und der Sowjetunion zeigen, überlappen sich die politi-
schen, nationalen, ethnischen und religiösen Interessen stark. Die friedliche Stabilität dieser neu-
en bzw. neugegründeten Länder hängt viel vom Religionsfrieden ab.
Kirchliche Erneuerung
Die kommunistische „Modernisierung“ und „Mobilisierung“ traf die Kirchen in diesen Länder
stark und nachhaltig. Je nach Land und Konfession zwar verschieden, überließ die religionsfeind-
liche Politik, also das Projekt der Vernichtung der Kirchen und die Verfolgung der Christen, in
jeder Hinsicht eine „Kirchenruine“. Die gesellschaftliche Neupositionierung der Kirchen, sowie
ihre innere Erneuerung steht überall an. Nach der Wende bedrängten die Kirchen dieser Region
riesige Aufgaben: die finanzielle und rechtliche Sicherung ihres Existenz, die Erwartungen der
Gesellschaft nach unterstützenden kirchlichen Diensten – in Bildung, in Kranken- und Alters-
pflege sowie in der Revitalisierung und Begründung gesellschaftlicher und persönlicher Grund-
werte, wobei die Kirchen selbst bezüglich der eigenen Glaubens- und personellen Resoursen ins
Klare kommen mussten. Diese allgemeine Erwartungslage ermöglicht nur in sehr begrenztem
68
Maß eine bewusste Planung und langfristige Strategien. Die Lage der Kirchen sowie ihre inneren
Aufbauarbeiten werden von einem großen Interesse der Medien begleitet, was nach den Jahr-
zehnten der Zensur eine in sich neue Situation für diese Kirchen ist.
In Anbetracht dieser Lage setzen die Kirchen dieser Region Optionen und Präferenzen. Sie wol-
len ihre existenzielle Sicherheit in der Gesellschaft durch Gesetze und Budgetverhandlungen
stabilisieren und sie wollen tragfähige Strukturen für ihre Verkündigungsarbeit ausbauen. Dabei
greifen sie mehr zu den Modellen der Vorkriegszeit, weniger zu den Versuchen in der Epoche
vor der Wende, sowie zu der erprobten Lösungen der westlichen Schwesterkirchen. Zu einem
autonomen Weg mangelt es ihnen oft an wirtschaftlichen und geistlichen Mitteln. Dennoch orien-
tieren sie sich an den Forderungen des Zweiten Vatikanischen Konzils und den Ansprachen des
Papstes anlässlich seiner Besuche in diesen Ländern. Sie wurden dabei ermutigt, aus dem Glau-
ben und aus den Analysen der Zeichen der Zeit originelle Wege in der modernen Gesellschaft zu
suchen, die Kirche in Richtung einer Communio-Ekklesiologie im Dienste der Neuevangelisie-
rung zu erneuern, zur Entwicklung einer neuen Kultur des Lebens in diesen Länder beizutragen
sowie durch einen vertieften Dialog zwischen den Konfessionen und Religionen einen Dienst für
den gesellschaftlichen Frieden zu leisten.
So kann man die durch den geschichtlichen Kairos gegebenen Situation und Erfahrungen dieser
Länder und Kirchen auf der Basis von Aussagen der östlichen und westlichen Verantwortlichen
und Experten fokussieren. Auf diesen Positionen baut unsere eigenständige tiefere Analyse der
Region, die Zusammenfassung der kirchlichen und theologischen Herausforderungen sowie der
Versuch einer regionalen Theologie aus Ost(Mittel)Europa, etwa eine Theologie der Zweiten
Welt auf.
69
OST-ERFAHRUNG – OST-THEOLOGIE
Nach dem Überblick über Erfahrungen und Deutungen der Wende wird in den folgenden Kapi-
teln der Versuch unternommen, Bedingungen, Methoden und Charakteristiken einer Theologie
zu entwerfen, die auf den Erfahrungen der Reformländer basiert und aus ihrem Kreis hervorgeht.
Anlass und Fokus für eine solche Theologie ist die geschichtliche Zäsur der „Wende“. Die Zeit-
spanne der Erfahrungen ist aber breiter: Sie umfasst vor der Wende die sogenannten 40 Jahren
und nach der Wende die vergangenen 10 Jahre. Bei der Wende haben sich diese Erfahrungen,
Hoffnungen und Ängste so sehr verdichtet, dass die Analyse dabei genügend Material findet.
In den folgenden Kapiteln wird es auch klar werden, warum es unmöglich war, eine spezielle
Theologie aus der „Zweiten Welt“ früher zu entwerfen. Es fehlten die gesellschaftlichen und
wissenschaftlichen Rahmenbedingungen dazu. Unser Versuch setzt aber keineswegs beim Null-
punkt ein. In den Ostblockstaaten existierte von Anfang an eine latente Theologie. Hinter den
Entscheidungen der Amtsträger, hinter den Deutungen und Erwägungen der Christen bei ihrer
folgenschweren Entscheidungen war bereits eine implizite Theologie da. Es gaben Autoren, die
offiziell in der Priesterausbildung Theologie doziert haben und wiederum andere, die in den „Ka-
takomben“ des Kommunismus eine Art Untergrundtheologie entwickelt und gelehrt haben. Hier
geht es also nicht darum einen Anfang ohne Vorgeschichte zu setzen, sondern eben darum: diese
Ansätze weiter zu führen, zu systematisieren und einen theologischen Schub für weitere Arbeiten
zu geben. Auch die Kirchenentwicklung und Pastoral in dieser Region braucht eine eigene Theo-
logie: eine Theologie der Zweiten Welt
Eine solche Theologie der Zweiten Welt mag den Anschein erwecken, dass sie ein posthumes
Verfahren sei: gerade in der Zeit nach der Wende scheint es höchstens einen theologiegeschicht-
lichen Stellenwert zu besitzen, eine Theologie der ehemaligen Zweiten Welt zu schreiben.
ZUM BEGRIFF: „ZEICHEN DER ZEIT“
Seit geraumer Zeit begann man in der Theologie über „Welten“ sprechen. Die katholische Kirche
erfuhr sich selbst immer mehr als Weltkirche. Zwar behielt sie ihr Zentrum in Europa. Aber an
den Teilnehmern des Zweiten Vatikanischen Konzils war eindeutig zu beobachten, dass die ka-
tholische Kirche nicht mehr ausschließlich oder gar überwiegend Europa-Kirche ist. Die bunten
Gesichter aus aller Welt brachten „ihre Welt“ in die Diskussionen über die Dokumente des Kon-
zils ein. Dadurch vertiefte sich die Wahrnehmung kulturell komplexer „Welten“. Die Kirche
70
kommt aus vielen Welten zusammen und nur so ist sie eine Weltkirche. Diese Erfahrung der
Konzilsväter fand ein Niederschlag in den Dokumenten, besonders in GS.107
Die eine Kirche, die aus der vielen Welten zusammenkommt, ließ sich nicht mehr als eine ein-
heitliche zu betrachten. Die Konzilsdokumente legitimierten im Prinzip das Miteinbeziehen eige-
ner Welterfahrungen in die Selbstbestimmung der Ortskirchen. Diese hermeneutische Öffnung
ermöglichte die Entwicklung eigenständiger theologischer Sichtweisen, die nicht mehr wie früher
von bestimmten philosophischen oder theologischen Schulen bestimmt waren, sondern vor allem
von der Erfahrung der verschiedensten geopolitischen-wirtschaftlichen-kulturellen Situationen.
Dieses Impuls fand seine erste eigenständige theologische Gestalt in der Befreiungstheologie.
Diese ihre eigene Erfahrungswelt in den Mittelpunkt der theologischen Reflexionsarbeit stellende
Theologie erarbeitet ihre Grundpositionen gegenüber der europäischen Welt und europäischen
Kirche. Sie nannte die Grunderfahrungen ihrer Theologie mit dem Sammelbegriff „Dritte Welt“
gegenüber der sog. nordatlantischen Hemisphäre: „der Ersten Welt“.
Hinter dem damaligen eisernen Vorhang lebte „eine sprachlose Kirche“, deren Vertreter zwar am
Konzil teilgenommen haben. Sie waren aber nur sehr begrenzt in der Lage, ihre eigene Situation
theologisch und sozialwissenschaftlich zu reflektieren und aus dieser Reflexion heraus an den
Diskussionen als „Zweite Welt“ teilzunehmen. Was sie bewegte, war den radikalen Antikommu-
nismus der westeuropäischen Amtsbrüder abzumildern und ihre eigene Unterdrückung nicht
durch missverständliche Äußerungen noch zu erschweren.
Durch die Betonung der „Dritten Welt“ wurde als Rückwirkung aus der früheren „einzigen“ Kir-
che Europas eine „Erste Welt“ geworden. Das innerkirchliche Gespräch ermöglichte tiefere Ana-
lysen der Geschichtlichkeit und Kontextualität der einzelnen Kirchen und veranlasste die Theo-
logen zu einer Neubesinnung der klassischen theologischen Themen. Der eiserne Vorhang fiel.
Seitdem ist in der „Zweiten Welt“ eine enorme Mobilisierung und Umstrukturierung zu beobach-
ten. Die Kirche ist aufgefordert, ihre eigene Lebenswelt zu reflektieren. Die Selbstverständlich-
keiten der eingefrorenen, immobilen Welt müssen neu durchgedacht werden. Die Kirche ist ei-
nerseits nicht mehr einer christentümlichen oder stalinistischen Regierung unterworfen, anderer-
seits verlor sie ihre Modelle und Mittel für ihre Selbstbehauptung. Die Kirche ist aber sowohl auf
die Erfahrungen der vielfarbig und kontextuell gewordenen Weltkirche angewiesen, wie auch auf
die Analysen der eigenen Kontextualität. Für die theologische Selbstreflexion im eigenen speziel-
len Kontext ist der theologische Hilfsbegriff „Zeichen der Zeit“ von Nutzen. Darum ist es nötig
den Bedeutungsumfeld dieses Begriffes näher zu betrachten.108
107 Vgl. besonders Nr. 4, 11 und 44. 108 Die folgenden Ausführungen gehen an meine Dissertation zurück: „Die Zeichen der Zeit und die katholische Kirche
Ungarns“, Wien 1991. Sie wurden hier weiter bearbeitet und ergänzt mit dem Abschnitt über die konkreten und komplexen Zeichen der „Wende“.
71
Begriffsgeschichte
Der biblische Begriff taucht als solcher in der Nummer sechs des Schreibens Papst Johannes’
XXIII. „Humanae salutis“ auf, mit dem er – der auch Lehrer der „Zeichen der Zeit“ genannt
wird109 – das Zweite Vatikanische Konzil einberief. Im lateinischen Text ist dieses terminus
technicus zwar nicht wortwörtlich zu finden, aber der Sache nach geht es Johannes XXIII. um
diese Zeichen, weshalb die deutsche (und französische) Übersetzung viermal die Zwischenüber-
schrift: „Zeichen der Zeit“ einfügt.110 Die erste Verwendung des Fachbegriffes „Zeichen der
Zeit“ findet sich allerdings in der berühmten Enzyklika desselben Papstes: Er wird Pacem in
terris an mehreren Stellen verwendet.111
Die Geschichte der Aufarbeitung dieses Begriffes charakterisiert sehr genau, wie sich die ur-
sprüngliche, aber sehr allgemein geformte Grundidee von Papst Johannes XXIII. –
„aggiornamento“ – durchsetzte. In den Diskussionen zeigte sich die Buntheit der an dem Konzil
teilnehmenden verschiedenen Auffassungen, und gerade bei der Bearbeitung dieses Begriffes war
der Beitrag der großen Zahl von Bischöfen aus nichteuropäischen Ländern ausschlaggebend. Am
01.09.1964 hat man sogar eine Unterkommission für die „Zeichen der Zeit“ gebildet. Sie erbat
von vielen Experten Unterstützung. Das Enddossier umfasste 90 Seiten.112
Die Arbeitsweise dieser Unterkommission ist in der Sitzung vom 30.12.1963 bestimmt worden:
„Man beschloss, nicht von einem theologischen Entwurf (von dem ganzen GS) auszugehen, son-
dern von evangelischen Wahrheiten, die zu der zugestaltenden Welt in einer direkten Beziehung
standen. Man musste den Dialog betonen, sich an die Lektüre der „Zeichen der Zeit“ machen....
Man musste die Grundlagen für die Achtung der Kirche vor den irdischen Wirklichkeiten le-
gen.“113
Aus dieser Arbeitsweise sowie aus der vielfältigen Verwendung des Begriffs in den Konzilsdo-
kumenten sowie in der darauffolgenden Kommentarliteratur wird besonders klar, dass die Kirche
sich entschlossen hat, einerseits die irdischen Wirklichkeiten mehr durch die Brille der Evangeli-
en als durch die Brille der sonstigen Kirchentradition zu lesen, andererseits selbst in der Ausle-
gung der biblischen Offenbarung Anregungen, hermeneutische Hinweise von der irdischen Wirk-
lichkeiten wahrzunehmen. Dies scheint die auch fundamentaltheologisch entscheidende Epo-
chenwende des Konzils im Verhältnis von Kirche und Welt zu sein. Die Kirche bekannte sich in
ihren letzten Konzilsdokumenten auch zur Haltung des Lernens von der Welt. Aus dem Gesagten
ist klar, dass die sog. „Zeichen der Zeit“ in erster Linie nicht konkrete Phänomene, Eigenschaf-
109 Chenu, Les signes des temps 35. 110 Vgl. die Übersetzung in Herder Korrespondenz 17 (1962/62) 479, 483, 487, 488. 111 Genau in den Nummer: 39-42, 75-79, 126-129, 142-145. 112 Vgl. LThK Bd. XIV 291. 113 LThK Bd. XIV 255 (Hervorhebung von mir).
72
ten, Zusammenhänge oder Tatsachen in der Welt- oder Zeitgeschichte meinen, sondern eher
dieses neue Verhältnis und ihre Konsequenzen markieren. „Nicht so sehr die tatsächliche Anwe-
sendheit des Ausdrucks „Zeichen der Zeit“ erstaunt uns in diesen Texten, sondern mehr die theo-
logische Kategorie, die sich daraus ergeben hat. Neben Schrift und Tradition, Liturgie und Spiri-
tualität ist die lebendige Art und Weise des Menschseins Fundort für Theologie.“114
Damit überholte die kirchliche Lehrentwicklung eine Art katholischer „Zwei-Reich-Lehre“. Die-
se von vielen Autoren offen und gründlich kritisierte und widerlegte Auffassung über Kirche und
Welt verpflichtete die Kirche mit ihren Institutionen, Ämtern und Auffassungen, sich über die
Welt zu setzen. Die göttliche Gnade erhob die Kirche mit ihren wesentlichsten Eigenschaften
über die Welt, wobei sie diese Welt einerseits als „massa damnata“, zu einem noch zu missionie-
renden Objekt degradierte, damit sie der Gnade der Erlösung teilhaftig werden könne. Als die
Geistesgeschichte der Neuzeit schon Jahrhunderte lang die radikale ontologische Differenz zwi-
schen Gott (Absolutum) und Welt (Seienden) behauptete, dachte und wirkte die Kirche so, als
existiere diese Differenz zwischen ihr und der Welt.
Während die Kirche ihre Überlegenheit theoretisch streng betonte, praktizierte sie den sog. „kon-
stantionischen Bund“ ungebrochen und bestimmte ihr Verhältnis zu verschiedenartigen Welter-
eignissen aus dem Blickwinkel ihres politischen Eigeninteresses. Diese Haltung kann als kirchli-
che „Zwei-Reich-Praxis“ bezeichnet werden. Diese Praxis schadete nicht nur der kirchlichen
Glaubwürdigkeit und Gottespräsentation, sondern behinderte in der Kirche selbst Erneuerungsin-
itiativen – wobei ein Schulbeispiel die unentwegte Betonung des ontologischen Unterschieds
zwischen dem allgemeinen und speziellen Kirchenamts sein mag.115 Zur Wahrnehmung der welt-
lichen Wirklichkeiten waren tragische Ereignisse der Geschichte des Zwanzigsten Jahrhunderts
mitentscheidend, insbesondere die beiden Weltkriege.
Der Fachausdruck, „Zeichen der Zeit“ ist also ein Begriff der mutigeren Kommunikation zwi-
schen Kirche und Welt, die in der Weltgeschichte die Heilsgeschichte entdeckt.
Die Offenbarung ist in Christus definitiv abgeschlossen. In diesem Sinne kann man nicht vertre-
ten, dass in den „Zeichen der Zeit“ neue Offenbarungsinhalte auftauchen könnten. In einem se-
kundären Sinn aber kann wohl angenommen werden, dass die einmal gegebenen Offenbarungs-
inhalte durch die „Zeichen der Zeit“ deutlicher ans Tageslicht treten. Karl Lehmann bemerkt,
dass die Theologie der Befreiung, in der die „Zeichen der Zeit“ besonders bedacht werden, die
konkrete Situation nicht im eigentlichen Sinne des Wortes als „locus theologicus“ beansprucht.
Die Normativität steht den eigentlichen Offenbarungsquellen zu.
114 Einführung: „Zeichen der Zeit“, in CONCILIUM 3 (1967) 417. 115 Vgl. Die diesbezüglichen Studien und Bücher von Edward Schillebeeckx, besonders Christliche Identität und kirch-
liches Amt.
73
Wenn man aber bedenkt, dass die Offenbarungsinhalte auch nach der traditionellen Theologie als
Frucht eines Gesprächs der gläubigen Christen zu sehen sind, wäre es eine zu rigorose Herme-
neutik, dieses Gespräch im jeweiligen Heute zu sehr dem einmal stattgefundenen unterordnen zu
wollen. Das Interpretierte und die Interpretation stehen ja nicht in einem Verhältnis wie Boden
und Baum, Grund und Überbau, sondern wie Stimme und Klang, Sprechen und Wort. Die Kirche
findet in ihren Offenbarungsquellen für die jeweilige Situation wegweisende Inhalte, die schon
(für die bisherige Auslegungen verborgen) da gewesen sind. Man braucht wohl nur an die Ach-
tung der Menschenrechte, an die Demokratie, sowie an die Freiheit zu verweisen. Die „Zeichen
der Zeit“ zeigen auf das zu Interpretierende, um es im Rahmen des schon Interpretierten klarer
erkennen zu können.
„Zeichen der Zeit“ ist aber auch ein Begriff, welcher der Kirchenlehre und der Kirchenstruktur
zur Bewegung verhilft, angesichts des sich im Weltgeschehen offenbarenden Gottes und dies
ohne Verlust der eigenen religiösen Selbstdeutung. Ein Begriff, mit dem die Ergebnisse der
Weltanalyse kirchlich aufgenommen, heimisch gemacht werden können ohne Aufgeben des An-
spruchs. Die Kirche richtet sich nicht nach der Welt, sondern nach dem Gott der Offenbarung.
„Zeichen der Zeit“ ist ein Begriff, der aus dem Bibel stammt – allerdings mit einem wesentlichen
kontextuellen Unterschied. Das Neue Testament benutzt oft den Begriff „kairos“.116 Das Bedeu-
tungsfeld hat als Christus Mittelpunkt, den Auferstandenen, den die Kirche in Momenten erken-
nen kann, bzw. muss. Der kairos ist die von Gott verfügte und gnadenhaft geschenkte Zeit, die
die Menschen zu Entscheidung ruft. „Während der abendländische Zeitbegriff quantitativ ist,
überwiegt im hebräischen Denken der qualitative Aspekt... Die unterschiedliche Auffassung
zeigt, dass die Zeit für die Israeliten etwas sinnlich Erfahrbares, für die Griechen hingegen etwas
mathematisch Ableitbares war“.117 Die Wendung „Zeichen der Zeit“ kommt in Jesu Mund nur
einmal vor: „Wenn es Abend wird, dann sagt ihr: es gibt schönes Wetter; denn der Himmel ist
rot, und am Morgen: heute gibt es Regen; denn der Himmel ist rot und trüb. Das Angesicht des
Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht“ (Mt 16, 2f). Zeichen können
die Wunder, die prophetischen Taten Jesu sein, durch welche die Zeitgenossen ihn als Messias
hätten erkennen müssen. Die biblischen Relationen sind also: a. Jesus wird zum Zeichen für die
Erkenntnismöglichkeit der Menschen, b. Die Menschen bleiben bei den Zeichen stecken und
erkennen ihn nicht. Weniger christologisch könnte man die Relationen so formulieren: a. Die
göttliche Taten lassen in Jesus den Messias erkennen, b. die Menschen sehen die Taten, aber sie
weigern sich, sie auch zu verstehen.
116 85 Mal (bei Paulus 30 Mal, im lukanischen Geschichtswerk 22 Mal) vgl. Coenen u.a., Theologisches Begriffslexi-kon III 1464.
117 Haag, Bibellexikon 1922.
74
Es geht aus dem plastischen Beispiel Jesu hervor, dass es in den „Zeichen der Zeit“, in seiner
Wundertätigkeit nicht um eine komplizierte, schwerverstehbare Entzifferung der komplexen
Wirklichkeit geht, sondern um alltägliche Klarheiten, eindeutige Entscheidungssituationen, wo
das Mitzuteilende eine einfache Selbstverständlichkeit ist. Für das Erkennen, für die Entzifferung
der kommenden Wetterlage braucht man darum keine Institutionen und Fachkräfte, sondern man
braucht nur seinen Hausverstand und den Willen zu verstehen.
Der oben genannte kontextuelle Unterschied besteht also darin, dass der heutige Mensch schein-
bar einerseits nicht mehr über den gesunden Menschenverstand verfügt, andererseits aber die
alltägliche Wirklichkeit so komplex geworden und nur durch oft undurchschaubare Instanzen
vermittelt ist, so dass der Mensch im Erkennen der Zeichen, in der Entdeckung der Fakten als
Zeichen vor einer ihn überfordernden Aufgabe steht. Allerdings darf die moralische Entschei-
dungsfähigkeit der Menschen in Entscheidungssituationen nicht angezweifelt werden. Wie das
Erkennen des Messias die Grunddimensionen und Grundfragen des Menschseins oder des Über-
lebens trifft, sind in der „heutigen Welt“ die „Zeichen der Zeit“ auch keine Alltagswirklichkeiten,
sondern die zentralste Frage des Lebens, als solche durch bestimmte Trends, Verhältnisse oder
Fakten dargestellt.
Bei den „Zeichen der Zeit“ kann man daher verschiedene Ebenen unterscheiden: die natürlich-
alltägliche, die kosmische und die theologische Ebene. Daraus geht hervor, dass die Kirche in
ihrer Deutungsaufgabe inmitten der Menschen steht. Sie befasst sich nicht mit exklusiven Fragen,
die durch wirklichkeitsfremde Kommissionen elaboriert werden. Sie steht mit den Menschen vor
denselben Fragen der Menschheit und versucht durch ihre Deutung zu den gemeinsamen Deu-
tungsversuchen der Menschheit beizutragen.
Im übrigen würde ich die „Christologische Bindung“118 der „Zeichen der Zeit“ nicht als zentral
betrachten, sondern eher die soteriologische. Die Kirche Christi hat nämlich die „Zeichen der
Zeit“ so zu deuten, dass die Menschheit Erlösung erfährt und praktiziert, überlebt oder nicht. Für
die Christenheit steht Christus in Mittelpunkt. Der Fragekreis der „Zeichen der Zeit“ hat aber
einen breiteren Horizont: die ganze Menschheit.
Der in der amtlichen und Fachliteratur vielleicht allzu oft verwendete Ausdruck „Zeichen der
Zeit“ ist somit kein Begriff für Bezeichnung von Fakten oder Verhältnissen. Er besagt eher ein
Verhältnis oder eine Methode. Er fordert zur analytischen Wahrnehmung des Kontextes für das
Experiment Nachfolge.
Während der Diskussionen um einen griffigen Ausdruck bzw. um den Inhalt des schon gefunde-
nen Ausdrucks „Zeichen der Zeit“ distanzierte sich das Konzil von der Formulierung „In voce
118 Schützeichel, Die „Zeichen der Zeit“ erkennen 305.
75
ergo temporis vocem Dei audire opportet“. Mit dem praktisch völligen Verschwinden dieses
Satzes im endgültigen Text (GS) ist die Sicht der „vox temporis vox Dei“ verschwunden.119 Der
Unterschied zwischen der beiden Formulierungen mag darin gelegen sein, dass die Formel „vox
temporis vox Dei“ das göttliche Offenbarungswort dem Zeitgeschehen unterordnet. Bei der Wahl
des Begriffes „Zeichen der Zeit“ hingegen wird der weltlichen Wirklichkeit ein sakramentaler,
also über Gott sprechender, auf Gott hinweisender Charakter zugeschrieben. Die erste Version
entzöge der Kirche den sog. „eschathologischen Vorbehalt“ (Metz) den weltlichen Ereignissen
gegenüber.
Die bisherigen Klärungen zum dem Begriff „Zeichen der Zeit“ haben eine spezielle Bedeutung
für die theologischen Arbeiten in Ost(Mittel)Europa . Für die Theologen in Ost(Mittel)Europa
nämlich können die mit dem Begriff „Zeichen der Zeit“ entstehenden sozialwissenschaftlichen
Aufgaben abschreckend wirken. Viele wissen selbst in der Fachtheologie um einen Nachholbe-
darf. Wie ist es da zumutbar, sich zudem noch in der Gesellschaftsanalyse auskennen zu müssen.
Darum scheint es nötig zu sein, in diesem Kapitel einiges über die Methoden der Analyse der
Zeit zu sagen. Ein zweites Bedenken in unserer Region gegen die Sozialwissenschaften ist, dass
sie Jahrzehnte lang für Christen nahezu unzugänglich waren. Der Marxismus argumentierte im-
mer auf Grund ökonomischer und sozialen Fakten. Sollen jetzt die Theologen solche Aspekte in
ihre Reflexionen aufnehmen? Darum scheint es auch noch notwendig zu sein, einiges über die
marxistische Ideologie in Erinnerung zu rufen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil auch in unserer
Region die Instruktionen über die Theologie der Befreiung bekannt worden sind. Eine oberfläch-
liche Lektüre dieser Instruktionen mag ein generelles Nein zu den Sozialwissenschaften zu be-
stärken – was keineswegs ihren Intentionen entspricht.
Analyse
Eine systematische, sozialwissenschaftliche Analyse anzufertigen ist nicht die eigentliche Aufga-
be der Theologie sowie der Theologen. Die Ergebnisse der Sozialwissenschaften müssen aber
von der Theologie respektiert und reflektiert werden, besonders in der Praktischen Theologie.
Dies ist erforderlich nicht nur für das Ziel: der Aufgabe der Glaubensvermittlung situationsge-
rechter entsprechen zu können. Yorick Spiegel gibt folgende Forschungsebenen an: „1. die reli-
giöse und christliche Lebenspraxis, 2. institutionalisierte Handlungen, 3. das Handeln der christ-
lichen Kirchen und Gemeinschaften als Institutionen.“120 Die Forschungen haben ein weiteres
Ziel: aus den Erkenntnissen der Sozialwissenschaften Anstöße zu erhalten für die kirchliche
Selbstkritik hinsichtlich der Menschenliebe, Nachfolge usf.
119 Vgl. LThK Bd. 14. 313. 120 Schröer, Praktische Theologie 226.
76
Die sozialwissenschaftlichen Analysemethoden der weltlichen Welt können aber mutatis mutan-
dis auch auf die menschliche Gestalt und auf die „Produktivität“ der Kirche angewendet werden.
Man will damit ja nicht der Gefahr verfallen, den Glauben oder die Sakramente auf das Messbare
zu reduzieren. Aber man darf die säkularen Zusammenhänge innerhalb der Kirche nicht außer
Acht lassen. So schreibt Henning Schröer mit Recht: „Was auf keinen Fall geduldet werden
kann, ist die Blockierung solcher Vorhaben (sprich empirische Sozialforschung) mit sofortigen
systematischen Bedenken, wie etwa dem Einwand: Aber messbar ist der Glaube nicht! oder:
Alles nur quantitativ!“121
„Da die Einsicht, dass Theologie außerstande ist, auf ihre Gegenwart in einer theologisch unmit-
telbar dem Evangelium entspringenden Perspektive zu verzichten, ist Theologie auf eine – im
weitesten Sinne – philosophische oder sozialwissenschaftliche Analyse der Gegenwart angewie-
sen, die theologisch interpretieren zu wollen sie nicht verzichten kann. Wenn es daher als unstrit-
tig gelten darf, dass Theologie eines nicht von ihr selbst herzustellenden Bewusstseins ihrer Ge-
genwart bedarf, so kann einzig über das gestritten werden, wie Theologie sich ihrer Gegenwart
bewusst zu werden vermag.“122 Dies gilt besonders für die Praktische Theologie, die ja auch
kritisch sein will gegenüber dem (eigenen) Theologietreiben und der Kirchenpraxis.
„Bei genauerer Betrachtung ist keine Forschungsmethodik ‘atheistisch’ oder ‘wertfrei’... Wesent-
lich ist, dass der Forscher sich seine Werte bewusst macht, sie ausspricht und ihre Auswirkungen
auf sein Forschungsinteresse reflektiert... Auch der Theologie bleibt die Entscheidung nicht er-
spart, welche theologische Relevanz sie den einzelnen Bewusstseinsebenen zuweist.“123 Diese
Entscheidung zu treffen ist nicht nur eine theoretische Angelegenheit, wie dies aus den Schick-
salserfahrungen besonders von Dritte-Welt-Theologen unserer Zeit, aber nicht zuletzt auch der
Theologen der Zweiten Welt ersichtlich wurde. In der Dritten Welt sind „die marxisierenden“,
also die marxistische Gesellschaftsanalyse präferierenden Theologen von den Regierungen mar-
ginalisiert oder grausam getötet worden.124 In der Zweiten Welt hingegen gerieten Theologen
immer wieder in Konflikt mit ihren „Parteizensoren“, wenn sie die marxistische Gesellschafts-
analyse zu wenig genutzt zu haben.
Vor allem aber gehört es zu den Aufgaben der Praktischen Theologen, die Erkenntnisse der Hu-
man- und Sozialwissenschaften ein zweites Mal zu durchdenken. Diese zweite Reflexion ist eine
theologische. Sie unterstellt, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass es keine Situation
gibt, in der Gott nicht handelnd gegenwärtig ist. Eben und erst dies deckt auf, dass vermeintlich
weltliche Situation ein theologischer Ort ist, eben ein ‚Kairos’. Die Situation wird zu einem Er-
121 A. a. O. 220. 122 Gremmmels in: Klostermann, Praktische Theologie 245. 123 Spiegel in: Klostermann, Praktische Theologie, 230. 124 Man braucht nur an Virgil Elizondo denken, der brutal ermordet wurde.
77
fahrungsort des Handelns Gottes in der Geschichte (und natürlich der Antwort des Menschen auf
Gottes Handeln). Wer erfahren will, was Gott von seiner heutigen Kirche an Praxis erwartet,
muss die ‚Zeichen der Zeit’ lesen und fragen, was Gott seiner Kirche durch diese Zeichen der
Zeit an Handlungsmöglichkeiten und damit Handlungsaufforderungen eröffnet.
Ideologie
Der Begriff Ideologie wird verschiedentlich definiert. Anton Grabner-Haider nennt Ideologie die
unterdrückerische Wahrheitsbehauptung gegenüber Andersdenkenden.125 Demnach ist der Unter-
schied zwischen Wahrheit und Ideologie in erster Linie nicht inhaltlicher, sondern funktionaler
Art. Die komplexe Situation der heutigen Welt sowie die immer feineren Annäherungen ermögli-
chenden Analysearten verbieten allzu eindeutige Aussagen – selbst in den Naturwissenschaften.
Auf der Ebene der Datensammlung ist eine ziemlich große Neutralität möglich. Bei dem Entwurf
einer Hypothese oder eines Modells ist eine Grundoption nicht zu umgehen. Eine der verwende-
ten Synthesearten oder noch mehr die Grundhypothese, die hinter einer in sich neutralen Daten-
sammlung steht, kann die Konklusionen nicht unberührt lassen. Bei der Anwendung der Zusam-
menhänge spielt man daher unausweichlich mit einer gebrochenen Sicht der Wirklichkeit und
soll immer wieder die Grenzen der Anwendungsmöglichkeit klar markieren.
In den achtziger Jahren wurde über die Anwendbarkeit der marxistischen Gesellschaftsanalyse in
der theologischen Arbeit viel diskutiert. Die Theologen der Befreiung bevorzugen diese Analyse-
art, bemerken jedoch, dass sie nur eine instrumentelle Rolle in ihren theologischen Werken
spielt.126 Dagegen behauptete die Kongregation für die Glaubenslehre, dass eine Methode, wie
eben die marxistische Gesellschaftsanalyse, unentrinnbar eine ideologische Voraussetzung in die
theologische Reflexion hineinbringt und so nicht imstande ist, von einer neuen Hermeneutik
abzusehen.127
„Ideologie ist heute zum Modewort geworden. Jeder halbwegs Gebildete führt es im Mund und
fast jeder verbindet einen anderen Begriff damit. In politischen Auseinandersetzungen, in philo-
sophischen Abhandlungen, aber auch schon im beruflichen Alltag heißt Ideologie irgend etwas
Unwahres oder Halbwahres, eine bewusste oder auch unbewusste Verschleierung oder Verbie-
gung von Tatsachen, oft mit dem Zweck verbunden, eigene Positionen zu rechtfertigen oder geg-
nerische zu wiederlegen. Von da hat der Begriff Ideologie etwas Anrüchiges. Selbst wenn sie
nicht schlechthin Lüge ist, so ist sie doch Täuschung oder Selbsttäuschung, ‚falsches Bewusst-
sein’, mit der Wahrheit im Widerspruch, von Eigeninteresse des einzelnen oder einer Gruppe
125 Ders., Ideologie und Religion. 11-36 und 92. 126 Vgl. Boff, Zum Gebrauch des „Marxismus“.
78
bestimmt, wenn nicht gar im Dienst egoistischer Zwecke erdacht. Dies vor allem gibt den An-
schein der Unmoralischen; denn Wahrheit kann nur zweckfrei sein.“128 Demnach sind ideologi-
schen Systeme für den Zusammenhalt großer Menschenmengen dienlich. Die Gefahr besteht
aber, dass sich diese Rolle der Ideologie umkehrt.
Neben der theoretischen Diskussion über Wahrheit und Ideologie muss aber die Erfahrung, der
jeweiligen gesellschaftspolitischen Kontexts mitbedacht werden. Die in der Zweiten Welt herr-
schende monolithische Partei besetzte die ganze wissenschaftliche Forschung. Nicht nur die Hu-
manwissenschaften, sondern auch die Naturwissenschaften waren der Kontrolle der Partei unter-
worfen. Besonders die Theologie, die Religionswissenschaft oder die damit zusammenhängende
Religionssoziologie waren einerseits sehr begrenzt, andererseits gezwungen, Perspektiven und
Interessen der Partei zu unterstützen. Die Qualität der Publikationen spielte gegenüber den ihnen
abverlangten ideologischen Diensten eine ziemlich untergeordnete Rolle.129
Darum war die erste Vatikanische Instruktion über einige Aspekte der Theologie der Befreiung130
von vielen Theologen der ungarischen Kirche sehr positiv aufgenommen worden, während die
ideologischen Parteiexperten sie hart abgewiesen haben. Die ungarischen Theologen sahen sich
in ihren schwierigen „ideologischen“ Kampf gegen die marxistische Weltsicht und kommunisti-
sche Zensur bestärkt. Die marxistischen Ideologen hingegen bedauerten, dass der Vatikan in
seinen traditionellen Antikommunismus zurückfiel und so das Gespräch unter Christen und Mar-
xisten unnötig erschwerte.
Die oben genannte erste Instruktion des Vatikans kritisierte den Gebrauch der marxistischen
Gesellschaftsanalyse durch die Befreiungstheologie gerade deshalb, um die Gefahr einer Ideolo-
gie abzuwehren. Sie unterstellte den Befreiungstheologen, sie setzten „bei der Lektüre der sozia-
len Wirklichkeit ein ideologisches A priori“ der Marxschen Gesellschaftsauffassung. Aus der
Diskussionen ist ersichtlich geworden, dass die Kritik der Glaubenskongregation eher politisch
als philosophisch oder theologisch zu verstehen ist. Sie befürchtete, dass durch die Anwendung
der Marxschen oder marxistischen Gesellschaftsanalyse die Kirche selbst dem marxistischen
(und atheistischen) Block sehr nahe kommt. Diese vermutbare Motivation der Kritik an der
Theologie der Befreiung seitens der Glaubenskongregation speist sich also aus einem politischen
Antimarxismus und ist damit selbst genau demselben Blockdenken ausgeliefert wie – laut ihrer
Kritik – die Theologen der Befreiung. Nicht so sehr die Unabhängigkeit oder gar die „Neutrali-
127 Instruktion über einige Aspekte der "Theologie der Befreiung" (6. August 1984) VII-IX. In: Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, herausgegeben vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz Nr. 57. vgl. Boff, Die am-bivalente Haltung.
128 Lemberg, Ideologie 25. 129 Mit dieser Lagebeschreibung sollen aber die Versuche, politikfreie (religions)soziologische Forschungen durchzu-
führen, keineswegs abqualifiziert werden. Die „Freiheit“ der Sozialwissenschaften war aber in allen unseren Län-dern besonders unter Kontrolle und in den Dienst der Parteiideologie gestellt.
130 Am 6. August 1984.
79
tät“ der gesellschaftsanalytischen Methode ist erforderlich, sondern die Sicherung der größtmög-
lichen Unabhängigkeit der kirchlichen Praxis.
Die Befreiungstheologen und ihre solidarischen europäischen Kollegen wehrten sich gegen diese
„Insinuationen“. Sie wiesen es ab, Marxisten im Sinn einer kommunistischen Partei zu sein. „Die
entscheidende Frage ist also nicht, ob Marx wiederholt oder ob ihm gefolgt wird, sondern ob die
geschichtlich gegebene Gesellschaft verstanden und verändert wird – eine Praxis, deren Modell
Marx anbietet... Es ist vor allem wichtig, den ‚Marxismus’ von den ‚Marxisten’ selbst zu befrei-
en...“.131 Mit dieser Unterscheidung kann man als Christ und Bürger eines (ehemaligen) real exi-
stierenden sozialistischen Staates methodologisch wohl einverstanden sein, vorausgesetzt, dass
auf dem Weg solcher Marxauslegung man sich nicht auch faktisch von Marx verabschiedet:
Dann aber könnte man das Anliegen auch ohne Bezug auf Marx vertreten, wie es eine gediegene,
auf die sozialkritische Tradition des Alten Testaments gestützte kirchliche Lehre versucht.
Aber wie oben gesagt, unsere Erfahrungen und unsere theoretischen Einsichten reichen aus, um
vom Gebrauch des Marxismus für die Entschlüsselung der gesellschaftlichen Vorgänge abzuse-
hen. Mag sein, dass die Befreiungstheologen die biblische Botschaft über den befreienden Gott
durch die Vermittlung der Marxschen Gesellschaftsanalyse in die Praxis leichter umsetzen konn-
ten. Die aus dieser Analyse stammende Option für die Armen verdient jedwede Unterstützung
und Rechtfertigung – die im übrigen auch von Seiten der obersten Kirchenleitung kam. Sie
dient(e) sogar dazu, den gesellschaftlichen und vor allem politischen Standort der Kirchen der
Ersten Welt neu zu überdenken.132 Diese Neubesinnung können sich auch die osteuropäischen
Kirchen nicht ersparen. In diesem Vorhaben sollten sie sich nicht von einem traditionellen oder
vorschnellen Antimarxismus leiten lassen, sondern gleich direkt auf die biblischen Quellen zu-
rückgreifen.
Im Vergleich zur Kritik der Kongregation der Glaubenslehre, die ihrerseits wieder heftig kritisiert
wurde, sind eben die Gesellschaftswissenschafter der Zweiten Welt imstande, ihre Kritik aus
eigener Erfahrung vorzutragen. Hier zeigt sich folgendes Bild: Die Klassenanalyse von Marx wie
z.B. die Gliederung der industriellen Gesellschaftsformen hat ihre Gültigkeit nur in speziellen
Epochen und gesellschaftliche Situationen. Die von Marx beschriebenen Schichten, Klassen,
gesellschaftlichen Subjekte und die aus ihren Eigenschaften abgeleiteten Prognosen traten, so die
Erfahrung der europäischen Geschichte, nicht ein. Die mit Recht prophetisch zu nennende Be-
freiungsvision und die dieser Vision dienende Klassenanalyse hat ihre Bedeutung nicht so sehr in
ihren Aussagen, sondern in ihrer Motivation. Auf die ungarische Gesellschaft angewendet kann
man sagen, dass die Klassenanalyse in ihrer spätfeudalen, unterindustrialisierten, adeligen Stel-
131 Boff, Zum Gebrauch des „Marxismus“ 44.
80
lung so gut wie nichts gebracht hat. Ihre Anwendung – so auch nichtstalinistischen Forscher –
erwies sich nicht als situationsgerecht. Die Kapitalkonzentration lag in Händen der Adeligen und
nicht in jenen der Bourgeoisie. Die Investitionslust war in Ungarn gering gewesen, die Groß-
grundbesitzer handelten nicht wie Großkapitalisten. Es gab keine Schicht der Proletarier in Un-
garn, wohl eine des verarmten Kleinadels, der Arbeitslosen, der Hausdiener. Eine unstädtische
Gesellschaft brachte keine Proletarierbewegung hervor, die zu gesellschaftlicher Umwälzung
hätte führen können. Dies machte z.B. eine Anweisung seitens eines Parteifunktionärs an der
ungarischen Soziologengesellschaft in den Siebzigerjahren klar, nach der in der soziologischen
Forschung die Arbeiterklasse (sprich das Proletariat) in Ungarn nicht zum Forschungsobjekt
gemacht werden konnte.
Zu alledem möchte ich aber betonen, dass in der ost(mittel)europäischen Theologie vor einen
allzu einseitigen Antimarxismus (sowie natürlich von einer unkritischen Philomarxismus) zu
warnen ist. Wie gesagt, die Grundmotivation des Marxismus kann ruhig prophetisch genannt
werden. Eine Gesellschaftsanalyse, die speziell auf die Erforschung jener Zusammenhänge aus-
gerichtet ist, die eine Unfreiheit von Menschen verursachen können, kann besonders hilfsreich
sein zur Formulierung der theologischer Fragestellungen. Ob diese Analyse Elemente oder
Grundbegriffe aus der marxistischen Analyse benutzt, ist meiner Meinung nach für die theologi-
sche „Zweitreflexion“ unerheblich.133 Eine theologische Aufarbeitung der originellen Marxschen
Religionskritik fand bis jetzt in unserer Region kaum statt. Die Theologie gerade in diesen Län-
dern kann sich aber diese kritische Rezeption nicht ersparen, da die religions- bzw. kirchenkriti-
schen Stimmen die Kirche sonst gar schnell an den Marxismus erinnern werden, was den Dialog
mit diesen (vielleicht eben liberalen) Stimmen nicht wegen ihrer Inhalte, sondern wegen ihrer
erinnernden Funktion unmöglich machen könnte.
Bevor wir uns zu den speziellen Zeichen der Zeit dieser postsozialistischen Region wenden, ist es
gut nochmals die Bedeutungsfelder dieses Begriffes in Erinnerung zu rufen. Das Zweite Vatika-
nische Konzil prägte den theologischen Hilfsbegriff von Papst Johannes XXIII, die „Zeichen der
Zeit“. Für das Konzil bedeutet dieser Terminus technicus die Möglichkeit, in geschichtlichen,
gesellschaftlichen Umständen nicht nur Fakten zu erkennen, sondern auch göttliche Fügungen.
Die Welt, die durch das Christentum säkularisiert ist, erhält hier wieder eine neue theologische
Bedeutung. In den Weltereignissen erblickt die Kirche ein Ort der theologischen Reflexion, einen
locus theologicus. In der Zeit des Konzils, also in den beginnenden Sechzigerjahren, bezeichne-
ten die Konzilstexte als Zeichen der Zeit unter anderem den Wunsch nach den Menschenrechten,
nach der Selbstbestimmung der Völker, die veränderte gesellschaftliche Stellung der Frauen und
132 Vgl. die unzähligen Rezeptionsliteratur selbst nur in dem deutschsprachigen Raum, z.B. von Norbert Greinacher, Johann Baptist Metz usw.
81
vor allem anderen die wachsende Bedeutung des Friedens. Wenn man in diese Zeit zurückblickt,
ist es leicht verständlich, dass gerade in diesen gesellschaftlichen Trends das Konzil ein Zeichen
der Zeit, ein Zeichen Gottes erblickte. Diese Trends gaben den Grundton der damaligen Zeit an,
und nach ruhigen Reflexionen konnte man damals schon erahnen, dass sie nicht Eintagsfliegen
der konziliaren Zeitgeschichte sind, sondern für längere Zeit bestimmende Faktoren sein werden.
Im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert würde das selbe Konzil wahrscheinlich unter anderem
die europäische Vereinigung unter den Zeichen der Zeit auflisten, wobei die neue „geschenkte
Freiheit“ der postsozialistischen Länder Ost(Mittel)Europas einer der wichtigsten Teilbereiche
wäre. Wie damals, so gelten heute für diese Ereignisse die Kriterien der Allgemeinheit, die um-
fassende Bedeutung, die langfristige Bestimmung, die tiefgreifende Wandlung usw. Wie die
theologische Besinnung über die damaligen Trends unter dem Terminus technicus „Zeichen der
Zeit“ für das Konzil und für die weiteren theologischen Arbeiten die Deutung dieser Trends er-
möglichte, so sollen heute Theologen und andere Kirchenmenschen sich um eine angemessene
theologische Deutung der neuen europäischen Freiheiten bemühen. Es ist eine wichtige Aufgabe,
aber auch eine schwere. Die Probleme dieser theologischen Geschichtshermeneutik bestehen vor
allem darin, dass die Bedingungen der theologischen Reflexionen dieser Freiheiten radikal anders
sind als jene des Konzils. Unter den Konzilsvätern und den sie begleitenden Theologen (periti)
waren viele Bürger der freien europäischen Staaten, und diese waren theologisch gut ausgebildet.
Sie waren wissenschaftlich befähigt, ihre eigene geschichtlichen Erfahrungen theologisch souve-
rän zu deuten. Die Bischöfe und die Theologen der Reformländer haben auch die Aufgabe, die
eigenen Erfahrungen theologisch autonom zu exegetisieren und zu kommentieren. Die Deutung
aber bedarf einer grundlegenden theologischen Kenntnis, die sie gerade wegen der Unfreiheiten
der letzten Jahrzehnte nicht in genügendem Maße angeeignet haben. Dies ist kein Vorwurf, son-
dern eine pures und nötiges Bekenntnis eines der Zügen ihrer und unserer Situation. Nicht aber
die theologischen Mängel machen diese Hermeneutik schwierig, sondern auch eine Art Unwille
bei der Kenntnisnahme der sozialwissenschaftlichen Zeitanalyse. In den Fünfziger- und Sechzi-
gerjahren lag im freieren Teil Europas neben der neuen Anthropologie auch die theologische
Reflexion der sozialwissenschaftlichen Ergebnisse im Trend. Dies steht – neben den biblischen
und patristischen Arbeiten – hinter den wichtigsten Konzilsdokumenten. Diese Interdisziplinari-
tät beeinflusste auch die Sprache der Konzilsdokumente und die Diskussionen an den Konzilsta-
gungen. Diese neue Sprache hat später für viele frustrierend gewirkt – manche behaupteten sogar,
dass die dogmatisierende Schwäche des Konzils in einem direkten Verhältnis zu seiner sozial-
wissenschaftlichen Sprache steht. Dieses Verhältnis ist auch für die kirchlich-theologischen Re-
flexionen der Reformländer kennzeichnend. Die soziale Wirklichkeit steht oft außerhalb der
133 Anders freilich argumentiert die Glaubenskongregation in ihren Instruktionen. Ihre kontextfreie grundsätzliche Argumentationsweise hat auch viel für sich.
82
theologisch reflektierten Bereiche und die Sozialwissenschaften als solche werden oft als
(post)marxistische Ideologien der theologischen Werkstätte ferngehalten. Wo aber keine solche
Analyse stattfinden kann, dort macht sich die Theologie taub und blind gegenüber den Zeichen
der Zeit und kann daher gar nicht die Richtlinien des letzten Konzils befolgen. Trotz dieser
Grundeinstellung gibt es einige Zellen und Projekte in den Kirchen der Reformländer, wo diese
gesellschaftswissenschaftliche Seite der Theologie nicht ausgeklammert, sondern im Gegenteil
geradezu gefördert wird.
DIE „ZEICHEN DER ZEIT“ IN DEN REFORMLÄNDERN
Auf den ersten Blick scheint es überaus klar zu sein, dass mit Zeichen der Zeit vor allen anderen
der Fall der Mauer gemeint werden soll, der eine neue Freiheit für die Gesellschaften des Ost-
blocks gebracht hat und eine neue Ordnung, die eigentlich eine alte, aber durch die kommunisti-
sche Machtübernahme unterbrochene, geschaffen hat. „Der Zusammenbruch des kommunisti-
schen Herrschaftssystems hat eine historisch einmalige Situation entstehen lassen – eine bis zu
den Wurzeln neue Verfassung und Rechtsordnung, der idealtypisch von der sozialistischen unter-
scheidet – beherrscht von einer grundlegenden Diskontinuität. Die Zahl der Staaten vermehrte
sich nach 1989 von 8 auf 18. Alle neuen Staaten mussten ihre ganze Rechtsordnung von Anfang
an aufbauen.“134 Die politischen Systeme wurden demokratisiert, über Nacht entstanden neue
Parteien oder alte neu. Die Prinzipien der Privatwirtschaft und der Marktwirtschaft wurden in
einigen Jahren mehr oder weniger konsequent verwirklicht. Es entstand ein neues Besitzerbürger-
tum, die Wirtschaft hat eine große Mobilisierung der Gesellschaft herbeigeführt, die sich auch in
der Ausbildung gezeigt hat. Andererseits ist es wichtig zu sehen, dass „der Zusammenbruch des
realen Sozialismus zwar die Zahl der als mehr oder weniger unterentwickelt einzustufenden Staa-
ten und Gesellschaften erhöht hat, aber zugleich die entwicklungspolitischen Optionen reduziert.
Denn der Sozialismus hat sich für absehbare Zeit nicht nur als Institutionenentwurf, sondern auch
als Entwicklungsutopie verbraucht. Die führende Konkurrenz verschiedener Entwicklungswege
hat, zumindest oberflächlich betrachtet, dem vorläufigen Sieg des Königspfads der Entwicklung,
nämlich dem westlich-liberalen, auf der Marktwirtschaft und einer demokratischen Ordnung
basierenden, Platz gemacht.“135
Die (vielleicht frühkapitalistischen) Änderungen brachten auch die „klassische“ Nachteile mit:
die Zahl der Arbeitslosen vermehrte sich rasch, die Schicht der Deprivierten wurde immer grö-
ßer, eine große Zahl von Bürgern musste immer unsicherer leben – auch was die grundlegendsten
Bedürfnisse des Alltagslebens betrifft. Ja, die Freiheit brachte diese Gesellschaften höchstens
134 Nohlen, Lexikon der Politik IV 463.
83
politisch-strukturell in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. In der Alltagswirklichkeit
müssen die Menschen eher das Gegenteil zur Kenntnis nehmen. Sie erfahren, dass sie die politi-
sche Freiheit mit dem Preis ihrer relativen Sicherheit bezahlt haben. Auch die Daten der neueren
Meinungsforschungen (vor allem AUFBRUCH© 1998 – geleitet durch Miklós Tomka und Paul
M. Zulehner) zeigen an, dass sich viele Bürger der neuen Demokratien nach den Fleischtöpfen
Ägyptens sehnen. In der Wertestruktur dieser Länder stehen die Werte Freiheit und Sicherheit
nebeneinander, die aber in der Wirklichkeit eher gegeneinander stehen. Die neuen politischen
Systeme zeigen eine überraschend große Stabilität, mindestens in den Ländern Ungarn, Tsche-
chien, Polen – aber selbst in Ländern, die aus der ehemaligen Sowjetunion zu einer staatlichen
Autonomie gekommen sind, kann man nur ungerecht über eine Instabilität des politischen Sy-
stems reden, auch wenn dort die Regierungen selten eine ganze Legislaturperiode durchhalten
können.
Was sind also die Zeichen der Zeit in diesen Länder: der Wunsch nach der Freiheit oder der
Wunsch nach der Sicherheit? Worauf soll man die theologische Reflexion konzentrieren: auf die
Bewertung der Freiheit, die eine göttliche Gnade ist und verwandt ist mit dem großartigen Be-
freiungsakt Jesu Christi an dem Kreuz des Leidens? Oder eher soll man die Sehnsucht nach Si-
cherheit ins Zentrum stellen, die Stabilität der Jerusalemer Gemeinde unter Petrus und Jakobus
als leitendes Bild für die Kirche dieser Länder nehmen und keineswegs die bewegten und risiko-
vollen Gemeinden des Paulus in Kleinasien (Ephesos, Korinth)? Oder man soll gerade darin ei-
nen unerlässlichen Beitrag der theologischen Reflexion erblicken, dass Freiheit und Sicherheit in
der göttlichen Vorsehung keinen Gegensatz bedeuten, sondern einander ergänzen? Eine Freiheit
der Wüstenwanderung hat nur einen Sinn, wenn das versprochene Land wirklich existiert und in
einem Land ist Glück nur möglich, wenn für die Sicherheit nicht die Freiheit geopfert werden
muss.
Ein Zeichen der Zeit ist also eher dieses Kraftfeld von Freiheit und Sicherheit – und jede theolo-
gische Rede, die die eine oder die andere auf Kosten der jeweils anderen zu sehr betont, ist irre-
führend. Dieser Spannungsfeld konsequent beizubehalten ist aber eine große Aufgabe und fordert
auch einen Mut in der Theologie. Manche kirchlichen Äußerungen bedienen sich mit dem aus-
schließlichen Bild der Freiheit und bezeichnen das Bedürfnis auf die Sicherheit als eine Versu-
chung, sogar als Sünde. Sie malen die Zeiten der Unfreiheit mit dunklen Farben an und differen-
zieren nicht zwischen verschiedenen Epochen der Sozialismus. Sie versuchen die geschichtliche
Epoche der vergangenen fünfzig Jahre zweipolig zu deuten: eine Zeit der Gefangenschaft, Ver-
folgung usw. und eine Zeit nach der Wende: Freiheit, Demokratie usw. Diese Einteilung ent-
spricht aber nur sehr begrenzt den Erfahrungen der Bürger. Und eine theologische Reflexion oder
135 A .a. O. 17.
84
eine kirchliche Verkündigung, die auf einer solche Interpretation aufbaut, wird auch wenig plau-
sibel für die Menschen in Gesellschaft und Kirche.
Neben der Überbetonung der Freiheit existiert auch die Überbetonung der Sicherheit. Sie wird als
extra starke Betonung von Tradition, Kontinuität und schrittweiser Entwicklung, Nüchternheit
usw. skeptisch bewertet. Diese Einstellung konzentriert sich berechtigt auf die alltäglichen Exi-
stenznöte der Bürger und weist richtig darauf hin, dass mit der Demokratie nicht die heile und
glückliche Parusie eingetroffen ist. So wird aber die erworbene Freiheit in einem Maße relati-
viert, dass es den Eindruck erweckt, als wäre Sozialismus deckungsgleich mit Demokratie, als
spiele die Eigentumsfrage in der Gesellschaftsentwicklung keine entscheidende Rolle, als wäre
die gesetzlich geregelte Stellung von Religion und Kirche nicht radikal eine andere als die ge-
setzlose „gute Beziehung zwischen Staat und Kirche“, welche von Emmerich Andras SJ. treffend
als „Kirche an der Leine des Staates“ bezeichnet wurde.
Beide Einseitigkeiten sind – neben politischen Interessen – mit der Unkenntnis in Gesellschafts-
fragen zu erklären, mit dem Mangel an Bereitschaft, die Gesellschaftsanalyse in die Deutung der
Zeichen der Zeit einzubeziehen. Nur eine differenzierte und gut fundierte Sicht der Wirklichkeit
ermöglicht eine seriöse Theologie und eine plausible Verkündigung – so können unsere Überle-
gungen als These zusammengefasst werden.
REFORMLÄNDER – EINE REGION?
In der derzeitigen Problematik der Gesellschaftsanalyse für eine theologische Rede über die ge-
sellschaftlichen Entwicklungen stellt sich die grundlegende Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist,
die postsozialistischen Reformländer in Ost(Mittel)Europa als eine einheitliche Region zu sehen.
Sollte das nicht möglich sein, dann dürfte es auch nicht möglich werden, die Erfahrungen dieser
Länder einheitlich als Basis einer theologischen Reflexion zu nehmen. Dann könnte man gar
nicht mehr über eine „Theologie nach dem Gulag“ träumen. Ich versuche auf der Basis der dies-
bezüglichen Fachliteratur nüchtern dafür zu argumentieren, solche Fragen zu bejahen: Ost-
(Mittel)Europa verdient die Bezeichnung einer Region.
Zum Begriff „Region“
Regionen sind relativ homogene geographische oder kulturelle Gebiete, die durch ähnliche Be-
völkerungen, Betätigungsweisen oder charakteristische Merkmale gekennzeichnet sind. Der Re-
gionalcharakter kann demographischer, literarischer oder künstlerischer, sprachlicher, wirtschaft-
licher oder politischer, religiöser oder verhaltensmäßiger Art sein. Region kann bestimmte Hand-
85
lungsweisen bedeuten, ein Bezugsystem für die Kontrolle von Handlungsweisen oder eine Auf-
fassungsweise oder analytische Methode darstellen.
Kulturregionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie relativ homogene Bevölkerungen, Kultu-
ren oder Eigenschaften hervorgebracht haben. Eine Region kann nicht auf ihre besondere örtliche
Lage fixiert werden. Wo eine Region als praktisches Instrument des Handels, der Planung oder
der Forschung entwickelt wurde, handelte es sich im allgemeinen um das, was Howard Odum
„eine vielfältig basierte Sozialregion“ (a composite societal region) nennt. In ihr besteht ein recht
hoher Grad von Homogenität, der auf zahlreichen historischen und statistischen Indizes beruht.
Diese Homogenität erwächst nicht aus einer Gleichförmigkeit, sondern vielmehr aus der Integra-
tion vieler heterogener Einzelheiten, so dass eine auf der Mannigfaltigkeit beruhende Einheit
entsteht und sich eine Reihe von Eigenschaften bilden, die im Vergleich mit denen anderer Re-
gionen charakteristisch sind.136 Fokussiert auf die kulturelle Identifikation heißt Region „a sense
of place“ und berührt alles was mit der symbolischen Konstruktion eines Ortes zusammen-
hängt.137
Bezogen auf die Reformländer Ost(Mittel)Europas138 können wir über eine Kulturregion spre-
chen, welche vor allem durch ihre Schicksalsgemeinschaft in den letzten fünfzig Jahren, durch
die darin entwickelten gesellschaftsbildenden Tätigkeiten und Techniken sowie durch die charak-
teristische Art und Weise der Weiterentwicklung ihrer nationalstaatlichen und ethnischen Tradi-
tionen kennzeichnet ist.
Regionskonstruktion
Regionen sind geographischen Gegebenheiten, aber auch kulturelle Geschaffenheiten. Eine tiefer
greifende konstitutionalistische Betrachtung weist auf, dass Regionen von Menschen geschaffen
werden. Durch einen gut strukturierbaren Vorgang entstehen neue Regionen und werden im sel-
ben Schritt frühere Regionen vernichtet. Regionalisierung wird in diesem Zusammenhang als
gesellschaftliches Phänomen – oder besser, als Aspekt der Gesellschaft – gesehen. Interessant
erscheint daher die Institutionalisierung von Regionen. Anssi Paasi differenziert diesen Prozess
auf vier Ebenen, die nicht so sehr als zeitliche Stufenfolge als vielmehr als vier notwendige Vor-
bedingungen gesehen werden sollten.
136 Bernsdorf, Wörterbuch der Soziologie, 882-885. Vgl. Regionalism, in: International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (Hg.) New York (1968), Bd. 13, 377-382.
137 The Dictionary of Human Geographie 3rd Edition, ed. by R.J. Johnston, D. Gregory und D.M. Smith, Oxford 1994. 138 Unter Reformländern verstehen wir die ost(mittel)europäischen Staaten, die durch die politische Wende von
1989/90 aus dem Satellitenstatus zur staatlichen Autonomie gekommen sind. Allerdings bilden die in die internatio-nale Forschung AUFBRUCH© aufgenommenen Gesellschaften nicht die Gruppe aller dieser Länder, sondern sie re-präsentieren sie.
86
Die bereits angegebenen sozilogischen Definitionen von „Region“ wurden in den letzten Jahr-
zehnten – vor allem angeregt vom finnischen Geograph, Anssi Paasi – konstruktivistisch weiter-
gedacht. Es wurde auch theoretisch nachgegangen, wie Regionen entstehen, wie gesellschaftliche
Interessen Regionen konstruieren. Dabei wurde die vielfältige Rolle von Institutionen und öffent-
lichen Meinungen klar. Bevor es eine von der theologischen Interesse geleitete Beschreibung der
„Region Ost(Mittel)Europa “ versucht wird, sollen die theoretische Hintergründe dieser theologi-
schen Institutionalisierung dieser Region dargestellt werden.139
Für den Erfolg von Regionen ist von entscheidender Bedeutung, ob sie es schaffen, sich selbst
und ihre Standorteigenschaften als Produkte im Wettbewerb der Regionen zu platzieren. Darüber
hinaus ist von Bedeutung, inwieweit es gelingt, innerhalb der Region so etwas wie eine emotio-
nale Bindung an das ‘Projekt Region’ zu herzustellen, oft auch kurz als ‘regionale Identität’ be-
zeichnet. Die Ausdrücke ‘Regionsproduktprodukt’ bzw. ‘regionale/raumbezogene Identität’ zie-
len wiederum auf den Einsatz einer handlungstheoretisch fundierten Regionsdefinition ab.
Anssi Paasi schlägt zunächst vor, Regionen als Ausdruck in einer Gesellschaft institutionalisier-
ter Praktiken zu sehen (im Gegensatz zum Konzept ‘place’, das aufgrund individueller Praktiken
definiert ist). Zu dieser Unterscheidung führt er wie folgt aus:
„[...] It is the place where an individual reproduces his material and intellectual existence.
This is structured through participation in social actions and in interaction with other peo-
ple and institutions, and through meanings given to these. Ones place ceases to exist
when one dies. The region, on the other hand, is an institutional sphere of longue duree
representing one specific dimension of the spatial structure of society.“140
Regionalisierung wird in diesem Zusammenhang als gesellschaftliches Phänomen – oder besser,
als Aspekt der Gesellschaft – gesehen – interessant erscheint daher die Institutionalisierung von
Regionen. Paasi differenziert diesen Prozess auf vier Ebenen, die nicht so sehr als zeitliche Stu-
fenfolge als vielmehr als vier notwendige Vorbedingungen gesehen werden sollten. Diese vier
Stufen sind:
• Annahme einer territorialen Gestalt,
• Entwicklung von konzeptioneller (symbolischer) Form,
• Entwicklung von Institutionen,
• Etablierung als Teilaspekt des regionalen Systems und des ‘Regionalbewusst-seins’ der jeweiligen Gesellschaft, was hier von Paasi abweichend lieber als „Tra-ditionalisierung“ bezeichnet wird.
Abbildung 1: Die Entstehungsdimensionen einer Region.
139 Vgl. Jekel, Regionalmanagement und Regionalmarketing. 140 Paasi, The institutionalization of regions 114.
Konzeptualisie- Territorialisie-
Institu tionalisierung Traditionalisi e-
87
Zu dieser Theorie der Institutionalisierung von Regionen sind einige Vorbemerkungen nötig:
Zunächst ist nicht unbedingt eine Reihenfolge der einzelnen Ebenen notwendig. Weiter ist zu
vermerken, dass die Theorie auf keinerlei Maßstabsbereich abzielt: Klar ist zunächst nur, dass
sich die Komplexität der Institutionalisierung von Regionen mit zunehmender Größe steigert.
Die Annahme einer territorialen Gestalt bezieht sich auf die Entwicklung von sozialen Praktiken,
durch die eine Region ihre Grenzen erhält. Diese Grenzen müssen nicht unbedingt administrati-
ver Art sein – sie sind es sogar in recht seltenen Fällen. Oft handelt es sich um recht vage Ideen,
um Erwartungshaltungen die verschiedene Elemente einer Region betreffen; das können unter
anderem Annahmen über kulturelle Eigenheiten oder Einwohner einer Region betreffende Ste-
reotype sein. Das heißt, dass diese Erwartungshaltungen oft nicht auf klar abgrenzbare, in einer
klassischen Projektion verortbare Regionen abzielen. Oft entsprechen diese Regionen längst nicht
mehr den ihnen zugemessenen Erwartungshaltungen. Diese Definition ist handlungs- bzw. struk-
turationstheoretisch als Produkt alltäglichen Handelns aufzufassen. Wenn man diese Handlungen
unter Bezugnahme auf Regeln und Ressourcen betrachtet, wird klar, dass sich das Räumliche
vom Gesellschaftlichen nur analytisch trennen lässt: Die physisch-materielle Umwelt, die kogni-
tive Umwelt und das Soziokulturelle sind als immanente Aspekte des Handelns und damit des
Gesellschaftlichen aufzufassen.
Als zweite Ebene wird die Entwicklung einer symbolischen Gestalt genannt. Damit wird die
Entwicklung von an gewisse Raumausschnitte gebundenen Symbolen bezeichnet, die die im
ersten Schritt genannten Erwartungshaltungen mit dem ‘Regionalbewusstsein’ der Bewohner
einer Region, aber auch außerhalb, in Verbindung setzen. Als vordergründigste Zeichen sind hier
natürlich Namen, aber auch Logos zu nennen. Diese Zeichen werden unter anderem genützt um
Grenzen zu setzen zwischen sozial-räumlichen Realitäten. Erst mit der Entwicklung symboli-
scher Zeichen kann Kommunikation über den ‘Gegenstand’ Region beginnen. Wirksam wir die-
ser Konstrukt erst dann, wenn er in die öffentliche Kommunikation einfließt. Erst diese Hebung
der Region in das diskursive Bewusstsein macht die Entwicklung regionaler Institutionen und
damit die Entwicklung eines ‘Regionalbewusstseins’ möglich. Aufgrund dieser Kopplung erfolgt
die Entwicklung einer symbolischen Gestalt meist gleichzeitig und als Voraussetzung zur Ent-
wicklung regionaler Institutionen. Mit Institutionen werden hier nicht nur formelle Institutionen
bezeichnet, sondern auch institutionalisierte Praktiken in Politik, Wirtschaft, Gesetzgebung, und
Administration; gleichzeitig muss es sich dabei nicht unbedingt um klassische Institutionen han-
deln, sondern um jede Form kollektiven Handelns.
Als letzte Ebene steht die etablierte Region: Der Institutionalisierungsprozess wird fortgesetzt,
nachdem die Region, wenn auch nicht unbedingt in administrativer Form, etabliert ist; Routinen
88
erhalten bzw. produzieren und reproduzieren die territoriale Form der Region und das Regional-
bewusstsein.
„The territorial unit is now ‘ready’ to be taken into use in ‘place marketing’ or as a weapon
in an ideological struggle over ressources and power, for example, in regional policy.“141
Die Bedeutung der Überlegungen zum Begriff „Region“ sind auch für die Zukunft Europas wich-
tig, das auch als „Europa der Regionen“ entworfen wird. Dieser Begriff hat sich bis heute sperrig
gegenüber einer allgemein gültigen Definition erwiesen, doch repräsentiert ideengeschichtlich
einen anti-etatistischen, utopischen Gegenentwurf zu einer auf den Nationalstaaten basierenden
europäischen politischen Ordnung. Der Utopie nach sollen die kulturell und wirtschaftlich mar-
ginalisierten peripher liegender Regionen aufgewertet werden, wie auch die subnationalen Akteu-
re in dem westeuropäischen Integrationsprozess. Sie sollen Mitspracherecht besitzen bei der In-
tegration.142 Unter Regionen versteht man verfassungsrechtlich geprägt solche subnationalen
Gebietskörperschaften, welche innerstaatlich über gewisse politische und rechtliche Handlungs-
befugnisse verfügen und die Einschränkung dieser Kompetenzen durch den vorrangig von den
Mitgliedstaaten und den Gemeinschaftsorganen getragenen Integrationsprozess thematisieren.
Nach dieser Utopie soll die EU föderal-subsidiär dreistufig Aufgebaut werden, innerhalb dessen
den Regionen autonom auszuübende Kompetenzen verbleiben und ihre Mitspracherecht weitge-
hend gesichert wird.143
Dass es theoretische Arbeiten in Institutionalisierungsprozesse erhebliche Rolle spielen können,
steht außer Zweifel, und kann heutzutage bezüglich unseres Themas vor allem mit dem berühmt
gewordenen und viel diskutieren Buch von Samuel Huntigton demonstriert werden. Seine Thesen
gingen schnell in die fachpolitischen Diskussionen ein und dann in die allgemeinen öffentlichen
Diskussionen. Dieser Hinweis mag darauf hindeuten, dass der Kirche auch durch ihre Theologie
ein Weg frei ist aus der auch biblisch gedeuteten Region der Märtyria eine Region der Auferste-
hung und Hoffnung zu konstruieren. Unsere Überlegungen zur regionalen Identität Mitteleuropas
möchten zu dieser Möglichkeit einige Ansätze anbieten.144
Die Region, die wir in unserer Forschung und in unserem Sprachgebrauch Ost(Mittel)Europa
nennen, ist eine künstliche Größe in Europa, die ursprünglich nur in begrenztem Maße als eine
Einheit angesehen werden konnte. Die Annahme ihrer geographischen Größe, die vor allem poli-
tisch gefärbten Symbole und die früheren gemeinsamen Institutionen gehören vor allem der Ver-
gangenheit an. Eine totale Verneinung dieser gemeinsamen Vergangenheit ist nicht möglich, und
141 Paasi, Deconstructing regions 247. 142 Conzelmann, Europa der Regionen 63ff. 143 Vgl. Hrbek/Weyand, Betrifft: Das Europa der Regionen. 144 In dem Kapitel über die Rolle der Kirche in der EU-Erweiterung wird darauf nochmals eingegangen.
89
wäre auch einer Vernichtung der persönlichen und gesellschaftlichen Biographie der ganzen
Region gleich. heute über diese Region zu sprechen ist also eine doppelte Aufgabe: eine rekon-
struierende und eine konstruierende. Es muss die gefährliche Erinnerung gewagt werden, mit der
tragischen Vergangenheit Rechenschaft zu machen. Aber hier darf man nicht stehen bleiben. Es
sollen Kraftquellen aus dieser Vergangenheit für eine kulturgerechte Praxis und Rede gefunden
werden. Es kann nicht zuletzt auch eine theologische Aufgabe zu sein, eine Region zu konstruie-
ren, die durch ihre kulturellen und politischen Gegebenheiten etwas besonderes aus der Offenba-
rung kennenlernen lässt. Eine regionale Theologie entsteht aus der tiefgehenden Inkulturation
aber sie lässt auch eine Kultur zu entstehen. Damit wird der vierte Aspekt von Paasi in dieser
Arbeit anwesend: eine christlich-theologische Etablierung des regionalen Bewusstseins. In den
nächsten Abschnitten werden diese regionbildende Faktoren etwas näher erläutert mit der Ab-
sicht, kontextuelle Faktoren für eine Theologie diesen Region zu aufzuspüren.
Schicksalsgemeinschaft
Die Frage nach dem Grund der Regionalität dieser Länder – Litauen, Ukraine, Polen, die neuen
Bundesländer Deutschlands (also die ehemalige DDR), Tschechien, Slowakei, Ungarn, Sieben-
bürgen (der westchristliche Teil von Rumänien), Kroatien, Slowenien – ist schwerwiegend und
nicht leicht zu beantworten. Das kulturelle Erbe dieser Länder ist sehr verschieden. Selbst zwi-
schen Nachbarländern gibt es bedeutende Unterscheide – man denke nur an Polen und die ehe-
malige DDR, an die Slowakei und Tschechien. Die Forschungen zeigen klar, dass die Faktor
„Kultur“ die größte Bedeutung hat, wenn man die unterschiedlichen Reaktionen auf die kommu-
nistische Machtübernahme und die unterschiedlichen Entwicklungen der Satellitenepoche zu
erklären versucht.
Daher muss man sich mit der These konfrontieren: Der einzige gemeinsame Nenner dieser Län-
der ist die Schicksalsgemeinschaft unter der sowjetischen Herrschaft. Diese politische Regionali-
tät wird aber dadurch geschwächt, dass die Verfolgungserinnerungen der Bürger der Länder zwi-
schen 18 und 65 Jahren ziemlich niedrig sind. Die politische Regionalität deckt sich zu wenig mit
der Erfahrungsregionalität. Wenn aber die Erfahrungsbasis schwach ist, dann kann die Theolo-
gie auf sie nicht bauen und ist eine „Theologie nach dem Gulag“ gar nicht möglich.
Dieser Sackgasse eines „videtur quod non“ kann man dadurch entkommen, dass man die Frage
klärt: Wie einheitlich sollen gesellschaftliche Erfahrungen sein, um auf ihnen eine theologische
Reflexion aufzubauen?
90
Totalitarismuserfahrung
Die Erfahrungen der Gesellschaften der Reformländer waren nicht nur während der Zeit des So-
zialismus, sondern sind auch nach dieser Periode immer noch sehr verschieden. Dies verursacht
innerhalb dieser Region eine Polarisierung hinsichtlich der Beschreibung der Lage nach dem Fall
der Mauer, auch was die theologische Reflexionen darüber betrifft. Eine grundlegende Gemein-
samkeit ist die Erinnerung an eine einheitliche Totalitarismuserfahrung. Diese Erfahrung haben
auch andere Länder in der selben Zeitspanne oder in anderen Zeiten erlebt. Ein Unterschied aber
ist, dass die Reformländer allzu rasch zu einer radikal durchgeführten Demokratisierung gekom-
men sind und/oder zu ihr gezwungen waren. Sie haben – auch ihre diversen Vorkriegsgeschichte
einbezogen – nicht 50 oder 100 Jahre für die Einübung in die modernen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse „Zeit gehabt“, sondern mussten in einigen Jahren mit der ganzen Problematik des
Mehrparteiensystems, der Marktwirtschaft, der freien Medien usw. klarzukommen. Die über
Nacht durchgeführten strukturellen Reformen brauchen noch Mentalitätsreformen, die sicher
nicht über Nacht zustande kommen können.
Geschichtliche Trennlinie zwischen „Ost“ und „West“
Neben den Verfolgungserfahrungen gibt es aber noch weitere gemeinsame Aspekte, die sozial-
wissenschaftlich schon, aber theologisch noch keineswegs genügend reflektiert sind. Ich versu-
che einige regionale Merkmale hier kurz aufzulisten, um dann an einigen eine theologische Re-
flexionsetüde zu versuchen.
Einen Blick auf die weiteren geschichtlichen Hintergründe hilft Otto Luchterhandt145 zu werfen,
indem er ausführt: „Nach dem Schisma 1054 erstreckt sich der Einfluss der Ostkirche auf die von
den Ostslawen (Großrussen, Ukrainer, Weißrussen), von dem überwiegenden Teil der Südslawen
(Bulgaren, Mazedonier, Serben) und den Rumänen besiedelten Gebiete. Die Jurisdiktion des
Papstes erfasste dagegen die westlich und nördlich angrenzenden Völker der Balten (Esten, Let-
ten, Litauer), die West- und den nördlichen Teil der Südslawen (Polen, Slowaken, Tschechen,
Slowenen, Kroaten) sowie die Ungarn. Die kirchlich-konfessionelle Jurisdiktionsgrenze wurde
im Laufe der Jahrhunderte zu einer alle Lebensbereiche beherrschenden Kulturgrenze zwischen
„West“ und „Ost“ in Europa, die auf dem Balkan Rumänien (Siebenbürgen) und Bosnien-
Herzegowina durchschneidet. Während der kommunistischen Herrschaftsepoche wurde sie durch
das stark unifizierende Regime überlagert, trat aber seit dessen Sturz in der osteuropäischen Re-
volution (1989-1991) wieder deutlich mit ihren charakteristischen Unterschieden nicht nur im
kirchlichen Bereich, sondern auch auf dem Gebiet der politischen und der Rechtskultur zutage...
wesentliche Gemeinsamkeit der Kirchen Osteuropas: sie sind besonders eng mit der jeweiligen
91
staatstragenden Ethnie verbunden, daher ‚Nationalkirchen’ und im spezifischem Sinne Volkskir-
chen.“ 146
Von der Ethnizität zum Nationalismus
Die Problematik der Ethnizität wurde von mehreren Autoren erörtert. Für diese soll hier nur als
Repräsentant István Bibó stehen.147 Sprachnationalismus ist ein Schlüsselbegriff von Bibó, mit
dem er eine Eigenschaft dieser Region bezeichnet. „Der moderne Begriff der Nation ist par ex-
cellence ein politischer Begriff: sein Ausgangspunkt ist ein staatlicher Rahmen, den das Volk
durch die Kraft der nationalen Massenemotionen erobern will.“148 Dies will nicht bedeuten, dass
die Nationen dieser Region durch die Sprache entstanden sind, denn Nationen werden auch hier
durch politische Faktoren begründet. Die besondere Rolle des Sprachnationalismus in diesem
Prozess ist aber eine Eigenschaft, die diese Region von den anderen in Europa unterscheiden
werden kann. Diese besondere Rolle verursachte, dass die historischen Emotionen dieser Natio-
nen im allgemeinen an andere und an größere Gebiete angebunden waren, als in denen die Be-
völkerung der jeweiligen Sprache tatsächlich gelebt hat. Besonders dort sind diese Emotionen
stark geworden, wo Sprachminderheiten in gut abgesonderten Gebiete gelebt haben. Diese Emo-
tionen verursachten allmählich Grenzspannungen und immer größere Unsicherheiten bezüglich
des Nationalstatus. Diese zentrale Rolle des Nationalismus begründet auch die existentielle Angst
dieser Gesellschaften von einer realen Vernichtungsutopie. Bibó weiter: Im Vergleich zu den
westeuropäischen Gesellschaften charakterisiert diese Region eine „ursprüngliche Rückständig-
keit“: die antidemokratischen Tendenzen, die Brutalität der politischen Methoden, die Gewalttä-
tigkeit der Nationalismus, die Tatsache, dass die politische Macht in den Händen der aristokrati-
schen Großgrundbesitzer, der Monopolkapitalisten, sowie der Militärclique liegt, wovon diese
Länder durch eigene Macht sich nicht befreien konnten. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Re-
gion unfähig wäre für politische Entwicklungen westeuropäischer Art.149 Bibó meint, dass diese
Rückständigkeit doch eher eine politische Sackgasse sei, und sie sei eine Frage der Entwick-
lungsstufe. Sie ist nicht zu leugnen, aber man soll auch einen gutes Stück der Liebe der Freiheit
in diesen Länder nicht außer Acht lassen, die eine Zeit lang im 19. Jahrhundert auch von den
westeuropäischen Staaten bewundert werden konnte.
Die Rahmenbedingungen der Nation mussten in dieser Region ständig gesichert, stabilisiert,
erkämpft und verteidigt werden, nicht nur gegen die Machtmittel des bestehenden Herrscherhau-
145 In: Nohlen, Lexikon der Politik, IV 284-291. 146 A. a. O. 285. 147 Bibó, Die Misere 248ff. 148 A. a. O., 195. 149 A. a. O., 212.
92
ses, sondern auch gegen die Gleichgültigkeit der eigenen Bevölkerung. Die national-existenzielle
Angst von der Vernichtung ist in dieser Gesellschaften eine greifbare Realität.150
Schöpflin151 konstatiert eine Bruchlinie zwischen Ost-West: Die westlichen Besucher meinen, sie
seien pragmatisch, professionell und zukunftsorientiert – also Rationalisten. Demgegenüber do-
miniert bei der Osteuropäern die Geschichte, das Pathos, die Wut und das Gefühl der Ungerech-
tigkeit. Diese Eigenschaften und Reflexe mögen zwar in den ausgehenden Neunzigerjahren nicht
mehr modisch sein, aber die Identitätsangst dieser Nationen und Gesellschaften basiert auf realen
geschichtlichen Erfahrungen, die Westeuropäer nie gemacht haben.
Kulturpolitische Gegenhypothese
Solche neuere Arbeiten reflektieren mehr die letzten 50 Jahre. Nach der politischen Wende blüh-
ten geographisch, politisch und kulturell motivierte Diskussionen über Mitteleuropa auf. Zu die-
ser Problematik äußerte sich in einer komparativistischen Literaturanalyse der britische Journalist
Thimoty Anton Ash. Seine Ausführungen bieten eine Basis dafür, die positive Entwicklungen
aus der „Unzeit“ der späteren Phase des Kommunismus zu evaluieren, was auch für eine theolo-
gische Reflexion nötig ist.
Der Autor analysiert drei namhaften Schriftsteller aus der mitteleuropäischen Region: Vaclav
Havel, György Konrád, Adam Michnik. Er meint, dass diese drei Denker in ihren Essays und
Büchern grundlegende Gemeinsamkeiten bezüglich der Existenz dieser Region bestimmt haben –
trotz der vielen Unterschiede in Stil, Auffassung und gesellschaftlicher Stellung. Havel und Kon-
rad benützen das Wort Osteuropa, wenn sie damit etwas Neutrales oder Negatives darstellen
wollen und (für die selbe Region) verwenden sie das Wort Mitteleuropa, wenn sie etwas Positi-
ves beschreiben wollen. Die Negativität stammt aus der Erfahrungen der sowjetrussischen He-
gemonie. Es ist eine Art kulturelle und politische Selbstverteidigung, wenn gegen diese Hegemo-
nie betont wird, dass die „ursprünglichen“ Eigenschaften dieser Gesellschaften die Fähigkeit zu
Rationalität, Humanismus, Demokratie und für eine skeptisch-tolerante Grundhaltung kenn-
zeichnend ist. Konrad selbst: „Mitteleuropa existiert nur als eine kulturpolitische Gegenhypothe-
se... Bürger von Mitteleuropa zu sein bedeutet keine Staatsbürgerschaft, sondern eine Weltan-
schauung, eine Herausforderung gegen die herrschenden Klischees.“152
Es gibt drei gemeinsame Punkte bei diesen drei Autoren, die diese Region definieren könnten.
Antipolitik (Konrad) ist eine Einstellung, die die herrschende Einteilung links-recht, sozialistisch-
kapitalistisch usw. einfach negiert und dagegen auf Grund des jüdisch-christlichen Individualis-
150 A. a. O., 217. – Zum Begriff politische Bruchlinie bezüglich dieser Region: Márkus, A posztkommunista Európa. 151 Schöpflin, Ráció.
93
mus gegen den Grundstein des Systems, nämlich die Lüge, aufsteht. Es ist eine Politik der Wahr-
heit (Michnik). Bezeichnend ist also, dass die Bedeutung der ethisch-moralischen persönlichen
Entscheidungen auf die Politik in diesen Länder größer ist, als in den westeuropäischen Ländern.
Zivilgesellschaft meint eine freie Zone von der bestehenden Machtverhältnissen, wo Alternativi-
tät, Persönlichkeit, und Unkonventionalität die geförderten Werte sind. Die Zivilgesellschaft
bietet nicht nur Überlebenschancen für viele Intellektuelle, die nicht „genügend“ partei- oder
machtkonform waren, sondern war auch eine Hexenküche der alternativen Wirtschaft, Politik
und Kommunikation. Aus diesen zivilgesellschaftlichen Kreisen wuchs oft die neue politische
Schicht heraus, die den politischen Machtwechsel durchgeführt hat. Gewaltlosigkeit wird als ein
zentrales Merkmal der milden Revolution hervorgehoben und wird vor allem nicht utopisch ge-
meint, sondern als „Sinn der europäischen Gesellschaftsentwicklung“ (Bibó) betrachtet. Gemeint
ist dabei nicht nur das Vermeiden der direkten körperlichen und indirekten strukturellen Gewalt-
ausübung, sondern auch die Förderung der Kreativität und Phantasie als gesellschaftsbildende
Kraft.
Mentalität der Doppelbödigkeit
Diese für die Region gemeinsamen gesellschaftlichen Eigenschaften haben auch Konsequenzen
für die persönliche Mentalität der Bürger. Vor allem eine Mentalität der Doppelbödigkeit scheint
mir in dieser Hinsicht für diese Region charakteristisch zu sein.153 Die lange Zeit der roten oder
rosaroten Macht prägte den Menschen die Haltung ein: anders in der Öffentlichkeit und anders
im privaten Bereich zu reden und zu leben. Die Eltern haben ihren Kindern oft gesagt: dies oder
das gilt für zu Hause, aber in der Schule darfst du so was nicht erzählen. An den Arbeitsplätzen
veranstaltete die Partei oder die ihr ausgelieferte Gewerkschaft politische Zusammenkünfte, an
denen man nolens volens der Parteiwahrheit Beifall klatschen musste. Man musste lange Zeit
überall und immer aufpassen, wer Gespräche mithört und ob man sich nicht in unglücklicher
Weise äußert. Alles was wahr ist, ist privat und geheim, alle anderen Wahrheiten, die öffentli-
chen, sind nur Parteiwahrheiten, sie sind „prawda“ in russischem und nicht „instina“, welches das
Wort für Tatsachenwahrheiten ist. Je jünger eine Generation in dieser Region ist, desto selbstver-
ständlicher ist für sie diese Doppelbödigkeit, die moralisch „Überlebenslüge“ genannt werden
könnte. Die immer jüngeren Generationen wurden aber immer weniger für eine Ehrlichkeit sozia-
lisiert und erzogen, langsam wurde es besser, sich Redlichkeit überhaupt nicht mehr anzueignen,
sondern nur die einzig wichtigste Mentalität: „Ja sagen für die Partei“. Eigene Einsichten wurden
langsam in sich gefährlich und galten nicht mehr als Erinnerung an die normale einbödige Welt.
152 Garton Ash Gibt es Mitteleuropa? (Hier zitiert nach Kell-e nekünk Közép-Európa? [Braucher wir Mitteleuropa?) in: Századvég Különszám, Budapest o.J., 87-103) 91.
94
Es gab fast gar keine Tatsachenwahrheit mehr, sondern nur die von der Partei gewünschte Praw-
da.
Diese doppelbödige Mentalität kennzeichnete alle Lebensbereiche, angefangen bei den Meldun-
gen über die Produktion einer Firma, über die soziale Situation der Bürger (damals Towarischi
also Genossen genannt), bis zur Medienwelt. „Herr Müller, was meinen sie über die heutige poli-
tische Lage“, fragt der Genosse. „Ich weiß noch nicht, weil ich die Parteizeitung heute noch nicht
gelesen habe.“ Diese bittere Humor drückt diese Situation treffend aus. Und nach der politischen
Wende wurde und konnte diese Doppelbödigkeit nicht über Nacht verlernt werden. Man konnte
damit sogar gute Geschäfte machen. Man nützte die Naivität und den auf Tatsachen gerichteten
Verhandlungsstil vor allem der westlichen Geschäftspartner gut aus. Man unterschrieb mit ruhi-
gem Gewissen Verträge, die vorhersehbar nie eingehalten wurden. Man erzählte mit Überzeu-
gung von Möglichkeiten, die in Wahrheit nie existierten. Man vertrat Positionen, die ansonsten
am fernsten von der eigentlichen Überzeugung standen usw.
Diese Mentalität machte auch vor den Toren der Kirche nicht Halt. In der ersten, härteren Zeit
der Verfolgung wusste ein jeder, dass die Bischöfe gezwungen waren, sogar in ihren Hirtenbriefe
die volle Loyalität zeigende kommunistische Phraseologie zu benutzen. Später war es nicht mehr
so eindeutig, da am Ende der sozialistischen Periode kaum noch Christen lebten, die die öffentli-
chen Aussagen ihrer Hirten überhaupt ernst genommen haben. Kirchenkritik hatte aber keinen
Sinn, da oft selbst die Kritiker nicht gemeint haben, dass ernst zu nehmen sei, was sie von den
Hirten hören. Auch heute noch existiert selbst in der Kirche eine doppelte Redeweise: eine Rede
für die kirchliche Öffentlichkeit, weil die Einheit der Kirche bewahrt werden soll. Eine andere
Rede für den internen und intimen Gebrauch.
Ob diese Art der Doppelbödigkeit moralisch zu verurteilen ist und ob sie in den nationalen und
internationalen Beziehungen Schaden verursachen würde, ist gründlich zu prüfen. Es scheint mir
aber wichtig zu sein, sie nicht eindeutig als Sünde, als Lüge zu qualifizieren, sondern darin den
Aspekt des Selbstschutzes zu entdecken. Wenn solche Lügen Überlebenslügen genannt werden
können, dann liegt hinter dieser Mentalität eine stark relativierende Kraft: Die öffentliche Ord-
nung ist nicht das letzte, nicht das alles Bestimmende. Es gibt Welten, Zeiten und Beziehungen,
die einer anderen Ordnung dienen, die unabhängig von den offiziellen Ordnungen ihre eigene
Autonomie und eigenen Gesetze aufrecht halten können. Es ist ein Widerstand gegen allerlei
Totalitäten. Ursprünglich gegen die rote Totalität, und heute gegen die totale Macht der wirt-
schaftlichen Rationalität. Man relativiert die bestehende Ordnung – auch wenn es etwas an Geld,
Karriere, Prestige usw. kostet. Man behält sich das Recht auf die Freiheit im Ernst des Alltags.
153 Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, der Frage nachzugehen, welche Vorgeschichte die Doppelbödig-keit in diesen Ländern hat.
95
Autonomiemangel
Ein weiterer gemeinsamer Aspekt ist der Mangel an Autonomie gegenüber gesellschaftlichen
Instanzen. Es gibt eine allgemeine Neigung dazu, Anordnungen zu befolgen und Probleme durch
solche Anordnungen zu lösen. Bibó schrieb einen großen Essay über die Judenfrage. Er beobach-
tet bei vielen Juden und Nichtjuden eine Untätigkeit und eine Hoffnung, dass es im Jahr 1944 in
Ungarn doch zu keinen Genozidien kommen könne. Das sei, u.a. dadurch zu erklären, dass alles,
was dazu geschehen hätte müsse, ganz offiziell durch die von der Regierung und anderen öffent-
lichen Stellen entlassenen Anordnungen, Sprüche und Bescheide geschehen hätte müssen. Die
unkritische Haltung gegenüber den Machtinhabern zeigt einen Mangel an Souveränität und Au-
tonomie auf. Souveränität und Autonomie gehören zu den grundlegendsten Charakteristiken der
Moderne.
Diese „naive“ Einstellung bezeichnete auch die Betrachtung der kirchlichen Entscheidungen.
Während des Kommunismus, einer Zeit der totalen Kontrolle, wo alle Entscheidungsrechte in
den Händen der Partei geballt waren, konnte sich eine moderne Autonomie weder praktisch noch
theoretisch entwickeln. Die nachholende Einübung passiert gerade in den letzten 10-20 Jahren,
als die internationalen Machtgremien (z.B. IWF, NATO) eine zentrale markt-totalitäre Entschei-
dungsmacht auf diese Region ausdehnten. Diese Zentren werden oft von der desolaten Marktsi-
tuation her als conditio sine qua non des Überlebens betrachtet. Eine kritische Haltung gegenüber
dem gesellschaftlichen Einfluss dieser Machtzentren wird oft als unsinnig oder als pure linke
Propaganda eingestuft und marginalisiert.
In eine ähnliche Rolle kann für die Katholiken dieser Länder auch die zentrale Leitung der Kir-
che hineingeraten, wenn sie den Ortskirchen der Reformländer im Grunde genommen nur durch
allgemeine Maßnahmen behilflich ist, um aus der desolaten Kirchenlage herauszukommen. Auch
für diese Ortskirchen wäre eine intensive Autonomieförderung kulturell gesehen mehr hilfreich,
als eine zu eindeutige und überklare Stabilisierung durch zentrale kirchlichen Anordnungen. Das
Lernen der Autonomie braucht Freiräume auch für falsche Entscheidungen – die man nicht nur
bei den einheimischen, sondern auch bei den römischen Kirchenleitung gelassen hinnehmen
sollte; sie benötigt aber auch klare Sicherheit bei den Grundlagen und in den Grundbeziehungen.
Diese Provokationen gelten selbstverständlich auch für die Amtsträger der Kirche in den Reform-
ländern, da das Umgehen mit der Freiheit auch in der Kirche von niemand anderen als von ihnen
selbst gelernt und eingeübt werden kann.
Auf den ersten Blick mögen diese zwei Aspekte einen Gegensatz zu bilden: durch Doppelbödig-
keit Bewahrung der Freiheit, durch mangelnde Autonomie Befolgung der Anordnungen. Ich
denke, dass in unseren Ländern diese beiden Mentalitäten parallel und paradox nebeneinander
stehen. Die Doppelbödigkeit ist ein erster Schritt in Richtung der wahrgenommenen und in der
96
Öffentlichkeit vertretenen „bürgerliche Autonomie“ – oder mit Bertold Brecht zu sagen: Coura-
ge. Aus der naiven Befolgung der Anordnungen kann eine nüchterne Einschätzung der Rolle der
Machtinstanzen wachsen, aus der Doppelbödigkeit eine gesellschaftliche Kreativität, mit ihnen
umzugehen.
ASPEKTE EINER THEOLOGIE AUS OST(MITTEL)EUROPA
Die Bedingungen für Kontextualität
In den letzten Jahrzehnten wurden viele kontextuelle Theologien entworfen. Die bedeutendste
unter ihnen ist wohl die Befreiungstheologie. Die Erfahrungen der zum Himmel schreienden
Armut hat Theologen, die ihre theologische Grundausbildung oft in Westeuropa (München,
Mainz, Tübingen, oder Strasbourg, Leuven, Nijmegen, Paris) bekommen haben, zur Einsicht
geführt, dass die theologischen Positionen einer eurozentrierten Theologie neu reflektiert werden
müssen. Sie sollen durch die Brille der Armutserfahrung, präziser der Gotteserfahrung in dem
Kontext der Armut, neu gelesen, neu kommentiert werden. Es ging und geht darum, die bibli-
schen Texte, die heiligen Texte der Offenbarung neu zu lesen. Wie die moderne Hermeneutik
sagt, werden Texte erst durch das Lesen lebendig. Oder noch radikaler: Ungelesene Texte „exi-
stieren" nicht. Man schafft Texte durch das Lesen. Die Befreiungstheologie – um bei ihrem Bei-
spiel zu bleiben – ist eine Dekonstruktion der lateinamerikanischen Wirklichkeit, die von einer
anderen Lesart konstruiert wurde. Dabei werden Aussagen, Erörterungen, Optionen von früher
oder von anderen kritisiert, verabschiedet und auch teils vernichtet um damit Platz für die neue
Lesart zu machen. Die Dekonstruktion führt zu einer theologisch fundierten Rekonstruktion.
Wenn man die Methodologie der Befreiungstheologie näher anschaut, dann geht es dort eher
darum, wer diese Befreiungstheologie entwirft und weniger darum, was in dieser Theologie ge-
sagt wird. Die Kontextualität nimmt ihren Anfang bei Personen.
Ähnliches lässt sich auch bezüglich der feministischen Theologie oder Ökotheologie beobachten.
Die Frauen reflektierten ihre eigene kulturell geprägte gesellschaftliche und kirchliche Situation.
Sie haben ein Unbehagen entdeckt und sich gefragt: Sollen sie sich dieser maskulin-kyrialen
Welt und Kirche anpassen, oder lässt sich eine andere Option treffen? Da sie sich in diesem herr-
schenden Kontext nicht zuhause gefühlt haben, weil ihre weibliche Erfahrungen von Gott, von
den biblischen Texten, von den Strukturen dieser Welt eine immer unerträglichere Diskrepanz
geschaffen haben, waren sie einfach außerstande, ihrer inneren Inspirationen Widerstand zu lei-
sten. Sie mussten sozusagen eine neue Theologie entwickeln, weil die alte für sie unerträglich
wurde. Ohne ein Gefühl der Fremdheit, der Unerträglichkeit wechselt keine ihre, keiner seine
Stellung in der Gesellschaft und in der Wissenschaft auch nicht in der Theologie.
97
Ein dritter Aspekt – neben Selbstfindung und Fremdsein – gilt als Bedingung einer Kontextuali-
tät, nämlich die Mittel des Lesens. Wenn oft darüber gesprochen wird, dass jede ihre Brille hat,
dann wird oft vergessen, dass „Brille“ nicht ganz identisch ist mit dem Ort, mit den Bestimmthei-
ten, in denen man lebt. In derselben Situation treffen Menschen verschiedene Entscheidungen.
Der eine bleibt, der andere geht. Der eine bleibt und wird loyal, der andere bleibt und macht Re-
volution. Die Armut in der Dritten Welt oder besser in der Zweidrittelwelt trifft viele, sie reagie-
ren aber anders darauf. Vielen Frauen wurde eine kulturell selbstverständliche Frauenrolle durch
die Sozialisation übermittel. Die einen nehmen sie an und finden sich damit zurecht. Die anderen
leiden darunter und wieder andere – statistisch gesehen vielleicht immer mehrere – agieren dage-
gen und suchen sich eine neue Frauenrolle und dazu auch eine sinnliche, sinnvolle und intellek-
tuelle Legitimation. Die Mittel sind entscheidend.
Für die Befreiungstheologie galt als Mittel vor allem die nachkonziliare (europäische) Theologie,
die eine freiere Bibellektüre und die verstärkte Beachtung der geschichtlichen und gesellschaftli-
chen Bedingtheit des Glaubensgutes ermöglichte. Ein weiteres Mittel war die Revolutionswelle
in Lateinamerika, die diesen engagierten Christen gezeigt hat, dass es auch andere politische
Optionen als die leidende Loyalität gibt. Diese Aufrührer und das Volk, das diesen folgte, hat die
Priester, Katecheten, Bischöfe und Theologen vor der Frage gestellt, die sie unbedingt beantwor-
ten mussten: Wo stehe ich? Bleibe ich in dieser Revolutionswelle bleibe beim (christlichen)
Volk, das mit der Revolution mitmacht, oder halte ich mich heraus und versuche sie auch zu-
rückzuhalten? Die Revolutionäre als „Mittel“ drängten sie zu einer Entscheidung, die für ein
Außenstehens keine Möglichkeit mehr offen ließ.
Diese Situation ist eine sehr prekäre und schwierige, weil damit die politisch „sauberen Hände“
schmutzig werden. Es gibt keine Neutralität mehr. Man wird schmutzig, so oder so. Die politi-
sche Jungfräulichkeit geht unweigerlich verloren. Selbst die Verweigerung einer Entscheidung ist
eine Entscheidung, da die Situation durch ihre innere Dramatik alle zum Teilnahme zwingt. Bei
der feministischen Theologie war dieses „Mittel“ weniger die westeuropäische nachkonziliare
Theologie, sondern eher die amerikanische feministische Literatur in Form von Großromanen,
Gedichten, Meditationen. Aber ohne eine feministische Revolutionswelle (in Amerika) würde
keine feministische Theologie entstanden sein. Ohne dauernd durch die Medien vermittelt be-
kommen, dass tatsächlich viele Frauen für eine frauengerechtere Gesellschaft und Kirche kämp-
fen und ihre gesellschaftliche Stellung und Reputation auch preiszugeben bereit sind, hätte keine
feministische Theologie sich entwickeln können. Die dialektische Wechselwirkung zwischen
gesellschaftlichen Trends und intellektueller Begleitung ist nicht zu leugnen. Es ist aber unnötig
darüber zu diskutieren, was zuerst war, die Henne oder das Ei: beide sind da.
Diese drei Vorgänge in der Nachkriegszeit bestimmen die Kontextualität der Theologie: Selbst-
findung, Fremdheit und die anstoßende gesellschaftliche Vorgänge. Ob es zu einer Theologie aus
98
der Erfahrungen von Ost(Mittel)Europa überhaupt kommen wird und kann, entscheiden die aus
der Befreiungstheologie und aus der feministischen Theologie gewonnenen Bedingungen.
Die Träger der Theologie in Ost(Mittel)Europa
Die Funktion der Theologie ist durch die Priesterausbildung und durch die Erweiterung, Um-
strukturierung oder Öffnung der Priesterseminare zur sogenannten Theologischen Hochschulen
oder in selteneren Fällen in Theologische Fakultäten bestimmt. Dieser geteilte Ort der Theologie
verursacht eine kreative Unsicherheit der Theologen, die in der Ausbildung stehen. Die geringe
Zahl an Priesteramtskandidaten – in der protestantischen Kirchen ist die Situation in diesem
Punkt radikal anders, was jetzt nicht reflektiert werden kann – , die in mehreren Ländern der
Region ein niedriges intellektuelles Niveau haben, zieht die Qualität der theologischen Ausbil-
dung nach unten. Die Mehrzahl der zivilen TheologiestudentInnen steht in einer religionspäd-
agogischen Ausbildung und bereitet sich nur in sehr seltenen Fällen auf eine wissenschaftliche
theologische Karriere vor. Für diese beiden bestimmenden Gruppen müsste die Ausbildung sehr
an der pastoralen Praxis ausgerichtet sein – und zwar zunächst unabhängig davon, was man unter
Praxis versteht und wie für eine angemessene Pastoralpraxis die Kontexte der Ortskirchen zu
berücksichtigen sind.
Es gibt ein kleinere Zahl an TheologiestudentInnen, die Theologie als Wissenschaft für sich stu-
dieren wollen. Sie sind hauptsächlich zivile Menschen, die Theologie als zweites Fach studieren.
Ihre Bedürfnisse, die sie auch gegenüber der theologischen Ausbildung vertreten, ist oft durch
positive Erfahrungen anhand ihres anderen Faches an den Universitäten bestimmt. Sie erwarten
daher auch in der Theologie eine hohe Qualität an Wissenschaftlichkeit und sind nicht selten
kritisch und verärgert, wenn die Ausbildung auf einem niedrigen Niveau geschieht.
Die Professorengruppe besteht hauptsächlich aus älteren Priestern, die ihre Ausbildung noch in
Zeiten der Kirchenverfolgung gemacht haben und jetzt auch nicht alleine für die Ausbildung
verantwortlich sind, sondern nebenbei auch eine pastorale Tätigkeit als Pfarrer ausüben müssen.
Unter ihnen gibt es nur wenige, die im Ausland studiert haben, wo sie sich mit der konziliaren
Theologie vertraut machen konnten. Eine ganz kleine Gruppe ist die Gruppe der zurückgekehrten
Theologen, die hauptsächlich Ordensleute sind. Sie haben oder mussten das Land bei der Auflö-
sung ihres Ordens verlassen und sind nach der politischen Wende um 1990 herum nach Hause
gerufen oder geschickt worden. Diese Theologen haben die beste Ausbildung, die kennen die
Konzilstexte und sind so oder so von dem sogenannten konziliaren Geist inspiriert worden.
Nach der Wende ist es möglich geworden, dass auch Laien in die theologische Ausbildung
einsteigen. Es sind aber nur die fortschrittlichsten Bischöfe und Rektoren, die Laientheologen
anstellen, nicht nur wegen einer vorkonziliaren Laienfeindlichkeit, sondern auch wegen des
99
Mangels an sicheren Finanzen, die den Laien unbedingt zugesichert werden muss. Der Laiensta-
tus garantiert von sich aus noch keine größere kontextuelle Empfindlichkeit, aber es ergeben sich
aus der Lebensstruktur eines Laien doch mehrere Anlässe zum emotionalen Kennenlernen der
Lebenssituationen der Bürger ihrer Gesellschaft. Dabei wird freilich gar leicht die eigene Lebens-
lage mit jener anderer verwechselt: ein Problem, das wiederum die Kleriker so nicht haben.
Armut und Reichtum der Osttheologie
Beim Vergleichen der theologischen Wirkungsräume West und Ost154 ist es wichtig, nicht nur die
Schwächen der einen gegenüber den anderen hervorzuheben, sondern auch deren Reichtum. Alle
religionssoziologischen bzw. statistischen Daten weisen eindeutig darauf hin, dass es innerhalb
des westlichen und des östlichen Teils Europas größere Unterschiede gibt als zwischen diesen
beiden Teilen. Die Niederlande und Nordirland im „Westen“ oder Tschechien und Polen in „Os-
ten“ liegen zwar geographisch nahe beieinander, kulturell und religiös sind sie aber weit vonein-
ander entfernt. Trotzdem scheint es möglich zu sein, einige typisch westliche und typisch östliche
Merkmale der Theologie, vor allem in der Arbeitsweise der (Pastoral)Theologie aufzuzeigen.155
Die nachstehende Tabelle bietet einen groben Überblick dieses Verhältnisses.
Westliche Theologie Theologie in Osten materieller und symbolischer Reichtum und lose Sy-stemgebundenheit
materielle Armut und starke Systemgebundenheit
dialogreich dialogarm kreativ mit der Tradition servil in der Tradition nach und nach frauenfreundlich nach und nach laienfreundlich
TABELLE 1: Vergleich zweier Formen von (Pastoral)Theologie
Materielle und symbolische Ebene
Wenn die westliche Theologie reich genannt wird, dann im Sinne der materiellen Ressourcen.
Zwar gibt es enorm große Unterschiede zwischen einem theologischen Institut in Nijmegen (NL)
oder in Köln (D); aber in den beiden Ländern gibt es an einem Institut mehrere vom Staat finan-
zierte Arbeitsstellen mit Sekretärin, mehreren Räumen, technischer Ausrüstung (Kopierer, PC,
Telephon, Fax, Internet usw.), regelmäßigem Institutsbudget, relativ leicht zugänglichen For-
schungsdrittmittel.
Dieser Reichtum an Ressourcen ermöglicht eine Konzentration auf die theologische Arbeit und
entlastet von der Sorge des alltäglichen Überleben – was die persönliche und die wissenschaftli-
che Seite gleichermaßen betrifft. Diese materielle Sicherheit – auch wenn in den kommenden
Jahren an westlichen Fakultäten wegen staatlicher Sparmaßnahmen ein Abbau geschehen könn-
154 Vgl. Máté-Tóth/Zulehner, Pastoraltheologie „Ost“.
100
te – zeigt sich z.B. krass darin, dass die Kollegen aus den postsozialistischen Staaten für eine
Konferenzreise nach Freising ein ganzes Monatsgehalt aus der eigenen Tasche ausgeben müssen,
ihre westliche Kollegen hingegen kaum mehr als 10% ihres Monatsgehalts.
Die Theologen in den östlichen Ländern haben sehr viel von ihrer Arbeitskraft für bessere oder
überhaupt für genügende materielle und strukturelle Bedingungen einsetzen müssen. Die Lehr-
stühle sind Einpersonenbetriebe. Es gibt keine MitarbeiterInnen, nahezu keine Skripten, Compu-
ter wurden erst in letzter Zeit zur Verfügung gestellt, es gab kein wirklich eigenständiges Budget,
sehr wenig Möglichkeiten, zu Büchern und Zeitschriften zu gelangen, keine Mittel für Fachkon-
ferenzen – um nur einige Merkmale der universitären theologischen Arbeit zu nennen, die in den
Ostländern die Armut zum Vorschein bringen. An der Lage der theologischen Bibliotheken ist
das eindrucksvoll zu beobachten. In den meisten Ländern wurden bis zur kommunistischen
Machtübernahme alle wichtigen Fachbücher vor allem aus dem deutschsprachigen Raum und
auch alle theologischen Publikationen des eigenen Landes (ziemlich streng nach Konfessionen
gesondert) gesammelt. Nach der Machtübernahme wurde das Sortiment eingefroren. 40 Jahre
später trifft man in den westlichen Ländern auf eine unüberschaubare und unbezahlbare Vielfalt
an theologischer Literatur, aus der dank persönlicher Kontakte einige Publikationen nach dem
Osten gelangen. Die einheimische Literatur ist gering und trägt die Merkmale der Vorkriegs-
zeit.156
Reichtum und Systemgebundenheit gehören zueinander. Unter System wird hier zweifaches ver-
standen. Einerseits das (rigoros oder lax verstandene) Lehrsystem der katholischen Kirche, ver-
treten von der einheimischen Bischofskonferenz. Andererseits das gesetzlich, finanziell und pre-
stigeartig verankerte universitäre System, das die Beteiligung am öffentlichen wissenschaftlichen
Prozess und damit einen gesellschaftlichen Ruf ermöglicht.
Es ist bei den Theologen im Westen und im Osten ein reziproker Zusammenhang des gesell-
schaftlichen und kirchlichen Systems zu beobachten. Für einen westlichen Theologen, bei dem
die Theologie als Wissenschaft staatlich anerkannt ist und die theologischen Lehrstellen durch
die staatlichen Gesetze gesichert und finanziert sind, ist die profane Systemgebundenheit stark.
Die kirchliche Gebundenheit ist einerseits gesetzlicher Art, da die kirchliche Stellung eines Theo-
logen durch geregelten gesetzlichen Maßnahmen fixiert und klar ist, inklusive Konkordate oder
andere Übereinkommen zwischen Kirche und Staat. Die inhaltliche Gebundenheit an das Lehr-
gebäude der katholischen Kirche ist teils Bedingung für die Ernennung, teils aber auch die Vor-
aussetzung für die Akzeptanz beim Volk Gottes. Bei dieser Darstellung wird bewusst nicht von
155 Was die ungarische Verhältnisse betrifft vgl. Nyíri, Theologie. 156 Es ist z.B. zeichenhaft, dass es in der theologischen Bibliothek der Szegediner Theologischen Hochschule insgesamt
30 ungarische Bücher zur Pastoraltheologie gibt, die nach 1950 erschienen sind, inklusive Gebetbücher, Synoden-dokumente und Reprintausgaben aus der Vorkriegszeit.
101
der natürlich gegebenen Spannung zwischen kirchlichem Amt und theologischer Freiheit ausge-
gangen, sondern vom theologischen Alltag. Die westlichen Theologen haben eine relative Ge-
bundenheit an beide Systeme, da sie hier und dort als öffentliche Persönlichkeiten über ihre eige-
ne Lage verhandeln können, wo diese Verhandlungen gesetzlich geregelt sind.
In der materiellen Armut der Osttheologie steckt eine größere gesellschaftliche Systemfreiheit, da
die staatlichgesetzliche Stellung der Osttheologen in den meisten Länder unklar und/oder nicht
geregelt ist. Demgegenüber sind sie sehr eng ins kirchliche System eingebettet und an dieses
rigoros gebunden. Dazu gehört vor allem die Tatsache, dass die Osttheologen größtenteils Kleri-
ker sind. Was die kirchliche Freiheit der theologischen Arbeit betrifft, arbeiten sie fast ausnahms-
los als ancilla hierarchiae. Die Theologie und die Theologen haben als Charisma der Kirche die
gemeinwohlgebundene Freiheit in der Kirche157 grob gesagt weder prinzipiell noch praktisch
verstanden und sind daher auch nicht gemäß dieser Freiheit geprägt. Sie treten sogar oft als Lehr-
amt auf.
Ihr relativer Reichtum band sie in das kirchliche Hochschulsystem ein, das den politischen und
ideologischen Machtverhältnissen ausgeliefert war. Um diesen Reichtum nutzen zu können, um
überhaupt universitäre Theologie treiben zu können, mussten sie für dieses System akzeptabel
sein. Ich denke hier in erster Linie nicht an mögliche Kollaborationspflichten mit den staatlichen
Behörden, sondern eher an die alltäglichen Bedingungen, die in den Verhandlungen mit dem
Staat und durch die (unreflektiert überkommenen) kirchlichen Sitten festgelegt waren. Die Leh-
renden mussten Priester sein, eine bestimmte Ausbildung aufweisen können, von der zuständigen
kirchlichen Autorität eine missio canonica und von staatlicher Seite eine Anstellung erhalten.
Daraus erwuchs eine materielle Armut aus doppelter Systemgebundenheit.
Ebene des Dialogs
Dialog ist ein auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil als inneres Moment der Offenbarung, des
Glaubens und der Kirche wiederentdeckt worden. In der profanen Wissenschaftsgeschichte galt
dieser längst als unverzichtbar. Man denke hier vor allem an Sokrates, dessen Philosophie diesen
Begriff prägte. in den Sozialwissenschaften hatte er eine hochrangige Stellung bezüglich der
Reflexionen über den Umkreis und Kontext des Wissenschaftlers und seiner Forschung. Theolo-
gie versteht sich als Wissenschaft. Ihre Wissenschaftlichkeit wird verschieden ausgelegt. Die
157 Der Begriff „Freiheit“ wird hier von zwei Dokumenten geprägt: „Einen besonderen Aspekt hat der Unterschied zwischen Lehramt und Theologen in bezug auf die ihnen eigene Freiheit und die damit verbundene kritische Funk-tion gegenüber den Gläubigen, gegenüber der Welt, ja sogar gegenüber einander.“ Internationale Theologenkom-mission: Thesen über das Verhältnis von kirchlichem Lehramt und Theologen zueinander (1975), These 8. – „Entstehen die Spannungen zwischen dem Theologen und dem Lehramt nicht aus einer Haltung der Feindschaft und des Widerspruchs, können sie als ein dynamisches Element und Anregung gelten, die Lehramt und Theologen zur Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben in gegenseitigem Dialog bestimmen.“ Kongregation für die Glaubens-lehre: Instruktion über die kirchliche Berufung des Theologen (1990), Nr. 25.
102
Theologie als universitäre Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten verschiedene Epochen
durchlebt und manche sprechen heute von einer Krise der Wissenschaftlichkeit der überkomme-
nen Theologie. Die kirchliche wissenschaftliche Theologie z.B. in Ungarn stand bis zur Eröff-
nung des theologischen Fernkurses in Budapest (Mitte der Achtzigerjahre) fast ausschließlich im
Dienst der Priesterausbildung.158 Sie ermöglichte sehr wenige wissenschaftliche Arbeiten neben
der Aufgabe der Priesterausbildung. Die Professoren sollten vor allem die Skripten für die Prie-
steramtskandidaten schreiben oder zusammenstellen. Auch wenn sie tiefere oder speziellere Ar-
beiten veröffentlichen wollten, mussten sie diesem Gesichtspunkt einen außerordentlichen Rang
beimessen. Das allgemeine Fehlen der theologischen Literatur der Nachkriegszeit begrenzte die
Wissenschaftlichkeit dieser Theologie stark. Die Zahl der monographischen Publikationen der
damaligen Professoren ist gering. Ein diesbezüglicher Vergleich mit Kollegen aus dem soge-
nannten „freien Westen“ ist nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Die theologische Arbeit, stark
verengt auf die Aufgaben der Priesterausbildung, verhinderte zumeist das Eingehen auf die Nöte
und Ängste der Personen und der kirchlichen Kleinzellen in der sozialistischen Gesellschaft.
Nicht nur die politische, sondern auch die innerkirchliche Aufgabenstellung der Theologie als
Wissenschaft zwangen die Theologen in die Ferne von den Bürgern und vom Kirchenvolk. Diese
aufgenötigte Ferne von aktuellen Erfahrungen der Menschen gab der Wissenschaftlichkeit der
Theologie eine spezielle Färbung, die sie zu einer Art „Nichttheologie“ gestaltete. Wenn äußere
und/oder innere Gründe nur eine Theologie unabhängig vom Kontext – bzw. allein bezogen auf
den kirchlichen Binnenkontext – als wissenschaftlich etablieren, dann gefährdet diese Bedingung
den Sinn solcher Theologie: sie wird zur Pseudotheologie im wissenschaftsähnlichen Gewand.
Konkreter: Die westliche Theologie – vor allem was die Pastoraltheologe betrifft – steht in star-
kem Dialog mit ihrem Umfeld und mit den Sozialwissenschaften. Dieser Dialog wird auch in
Konferenzen und in anderen Arten der wissenschaftlichen Diskussionen praktiziert. Die (Prakti-
sche) Theologie in den postsozialistischen Ländern hat die praktische und theoretische Bedeu-
tung solchen Dialogs weder praktisch noch wissenschaftstheoretisch rezipiert.
Ebene der Tradition
Das Schiff der universitären Theologie – in beiden Teilen Europas unter anderen Bedingungen –
wird von den Hauptströmungen der kirchlichen Tradition getragen. Diese bedeutet für sie Hei-
mat und damit Sicherheit. Sie hilft bei der Beschäftigung mit herkömmlichen theologischen
Themen Methoden und Ergebnisse der theologischen Vor-Denker einzubeziehen. Die universitä-
re Theologie versteht sich so als Erbin und Hüterin einer grandiosen Tradition, die ihre Identität
158 Vgl. die Berichte vieler Pastoraltheologen aus Ost(Mittel)Europa über die Situation ihrer theologischen Arbeit in: Zulehner/Máté-Tóth, Unterwegs.
103
stärkt. Dass sie in enger Beziehung zu den Hirten der konkreten Kirche steht und sich dem Lehr-
amt verpflichtet weiß, kann ihre Beheimatung in der Lehrtradition noch vertiefen.
Die Theologie in Westen hat ihre Kreativität in der Formung der Lehrtradition immer mehr ernst
genommen – wobei es auch zu harten Kontroversen gekommen ist.
Die Theologen an der katholischen Theologischen Akademie in Budapest waren ausschließlich
Priester. Das Zusammenspiel von Auswahlkriterien und Aufgaben in der Kirche Ungarns vergrö-
ßerte die Versuchung zur Klerikalisierung der Theologie. Wegen der allgemeinen Auffassung der
Kirchenleitung und der kirchenpolitischen Bestimmungen des staatlichen Kirchenamtes wurden
klerikal denkende Personen, die u.a. die Aufgabe hatten, das klerikale Kirchensystem zu unter-
stützen, für die universitäre Theologie bevorzugt. Die wenigen nicht klerikal denkenden Priester-
theologen waren anrüchig und wurden von manchen Bischöfen und Kollegen als subversiv ein-
gestuft.159 Der Vorteil der Beheimatung in der kirchlich-theologischen Tradition gepaart mit den
nichttheologischen Arbeitsbedingungen des Klerikerstandes implizierte eine pseudotheologische
Meinung: nur die klerikale Theologie sei traditionstreu.
Ebene der Geschlechter
Wenn man westliche Stellenangebote für theologische Fakultäten liest, fällt einem Theologen aus
den östlichen Ländern auf, dass oft steht: „bei gleicher Qualifikation Frauen bevorzugt“. Dies
deutet darauf hin, dass die frauenfreundlichere Kultur auch in der Kirche zu einer rechtlichen
Bedingung werden kann. Man könnte leicht eine kleine Statistik machen, wie viele Frauen heute
an theologischen Fakultäten in den westlichen Ländern arbeiten – auch wenn hier zwischen den
einzelnen Ländern große Unterschiede anzutreffen sind.
Demgegenüber ist es in den östlichen Länder Europas schwer, überhaupt Laien an theologischen
Fakultäten zu finden.
Ausblicke
Die politische Wende Anfang der Neunziger Jahre ermöglichte auch der Kirche, ihre Angelegen-
heiten unter freien gesellschaftlichen Verhältnissen souverän zu regeln. Diese Freiheit hat auch
Einfluss an das theologische Leben. In dieser Freiheit zeigt sich, was die Kirche von sich aus in
und mit ihrer Theologie anfängt. Die diesbezüglichen Verhältnisse liegen zwischen Renovation
und Restauration.
159 Aus ungarischer Sicht ist hier vor allem an den europaweit bekannten Philosophen und Theologen Prof. Tamás Nyíri zu denken, der für viele eine Pionierarbeit in Richtung nichtklerikale Theologie leistete und dafür auch genü-gende Konflikte an seiner Fakultät ernten musste.
104
Aus den intellektuellen und materiellen Ruinen versuchen die Kirchen der Transformationsländer
intellektuelle und materielle Aufbauarbeit zu leisten. Die institutionellen Bedingungen der theo-
logischen Arbeit verbessern sich. Es werden alt-neue Fakultäten eröffnet, internationale wissen-
schaftliche Kontakte werden aufgenommen, es werden begabte junge Menschen an ausländische
Fakultäten geschickt. Fachtheologische Zeitschriften und andere Grundliteratur entstehen lang-
sam.
In dieser Erneuerung zeigt sich oft heldenhafte Vitalität, wie mit dem Nachholbedarf umgegan-
gen werden kann. Manche Theologen beginnen erst nach der Wende, sich in Weltsprachen aus-
zudrücken, an internationalen Kongressen teilzunehmen oder ihre Thesen in einer interdiszi-
plinären Diskussion zu entfalten. Diese Wende spielt sich auch in anderen Wissenschaften ab und
ist demnach nicht allein ein Merkmal der Theologie. Für die Theologie ist aber der Abbau ihrer
aufgezwungenen Ghettoreflexe eine zusätzliche Aufgabe. In den neuen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen ist sie nicht selten der Versuchung ausgeliefert, im allgemein gewordenen und medi-
engestützten Pluralismus nach den alten Mustern der Verfolgungszeit einen neuen Feind und eine
„neue Verfolgung“ zu sehen. Es scheiden sich die Geister an der theologischen Bewertung der
neuen gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse. Daher ist eine vordringliche Aufgabe zeit-
genössischer Theologie, in fundierten theologischen Analysen die „Zeichen der Zeit“ zu erken-
nen. Dabei ist es besonders angebracht, mit einem feinen mentalhygienischen Gefühl die oft rigi-
den Abwehrmechanismen zu betrachten.
Unter Theologen und Kirchenmenschen in den westlichen Länder ist manchmal zu hören, dass
ihre Kollegen in Osten fundamentalistische Positionen vertreten und gerne Beziehungen zu tradi-
tionalistischen Trends pflegen. Inwieweit solche Behauptungen zutreffen, ist schwer zu beurtei-
len. Es ist aber sicher festzustellen, dass westliche Traditionalisten auf Grund derselben Einstel-
lung zur modernen Welt viel Verständnis für ihre östlichen Gleichgesinnten haben und daher mit
ihnen in der Auffassung über die Stellung und Mission der Kirche von heute weithin einig sind.
Der Unterschied zwischen westlichem und östlichem Traditionalismus ist vor allem zeitlicher
Art. Die ersteren sind nach jahrzehntelanger Modernisierung Traditionalisten geblieben, die letz-
teren wegen eines Modernisierungsschocks solche geworden. Die eindeutige Neigung des Ostens
zu Traditionen ist auch ein gesunder Reflex auf die aufgezwungene Entbindung der ganzen Ge-
sellschaft von den kulturellen Traditionen dieser Region und keineswegs nur ein radikales „Nein“
zur aufkommenden Modernisierung. Bei der enormen Herausforderung der Renovierung der
gesellschaftlichen und kirchlichen Verhältnisse inklusive der Theologie soll die lebendige Erin-
nerung an die Traditionen und das mutige Gespräch mit der neuen Zeit gleichzeitig gemacht
werden, wobei es durchaus manchmal zu ungewöhnlichen Denkversuchen kommen kann. Hier
ist der Mut gefragt, wirklich neuen Wein in neue Schläuche zu gießen.
105
Kontextuelle Vorarbeiten
Die Kontextualität als Theologie konstituierender Aspekt wurde zwar in den letzten Jahrzehnten
ins Zentrum der theologischen Reflexion gerückt, aber es wäre grundsätzlich falsch zu meinen,
dass die theologischen Arbeiten, die nicht ausdrücklich diesen Zug reflektieren, kontextlos wä-
ren. Eine Aufgabe ist demnach auch oder sogar insbesondere, die nichtreflektierte Kontextualität
der Theologie aus den ost(mittel)europäischen Ländern zu evaluieren.
Dies kann vor allem dadurch geschehen, dass man internationale Vergleiche macht. Es ist ratsam
nachzugehen, wie dasselbe Thema unter verschiedenen gesellschaftlichen Situationen und Zeiten
bearbeitet wurde. Wenn man hier die Ähnlichkeiten und Unterschiede beobachtet, stößt man auf
die speziellen Eigenschaften der diversen Kontexte.
Neben dieser vergleichenden Untersuchung an bestimmten Themen ist es ein weiterer Schritt
aufzuarbeiten, welche Themen in einem bestimmten Kontext wichtig waren und welche eben im
Schatten geblieben sind. Wo Theologen mit ihren Interessen ansetzen, dort meinen sie den Kon-
text ihrer Kirche und ihrer Gesellschaft, der Menschen schlechthin treffen zu können.
Bei der Untersuchung der kontextuellen Vorarbeiten muss man eine weitere Unterscheidung
vornehmen. Viele Arbeiten nach der politischen Wende scheinen die Kontextualität der Kirche
zu reflektieren, wobei sie die Situation, wie sie wahrnehmen, beschreiben. Wenn man Bücher,
aber vor allem Zeitschriften aus diesen Länder durchblättert oder solche, die im Westen erschie-
nen sind, stößt man oft auf solche Beschreibungen. Sie stellen die wichtigsten Charakteristiken
der Situation in und nach der kommunistischen oder sozialistischen Periode dar. Sie beschreiben
weiterhin auch die möglichen Folgen dieser Lage. Sie bedienen sich dabei zeitgeschichtlicher
und sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse. Und hier bleiben sie dann oft stehen. Sie gehen den
zweiten Schritt vom Sehen zum Urteilen und Handeln nicht mehr weiter, sondern verbleiben bei
der korrekten Beschreibung. So kann man zwar Kontexte kennenlernen, was schon von großer
Bedeutung ist. Aber das ist noch nicht die theologische Kontextarbeit, sondern lediglich eine
ihrer wichtigsten Bedingungen. Die Konsequenzen, die sich aus der Situation ergeben, müssen
nicht nur auf einer geschichtlichen und gesellschaftlichen Ebene gezogen werden, sondern auch
auf der Metaebene der theologischen Reflexion. Wenn man die Beschreibung der Lage und die
Beschreibung der theologischen Aussagen nur nebeneinander stellt, ist das noch keine Kontex-
tualität im strengen Sinne des Begriffes. Die kontextuelle theologische Arbeit beginnt mit dem
Reflexion über das wechselseitige – um nicht zu sagen dialektische – Verhältnis von Kontext und
Aussage.
Hier setzt die eigentliche theologische Reflexion an und hier wird es möglich, auch tiefere
Schichten der Situation und der theologischen Reflexion aufzudecken.
106
Es gibt auf dieser Linie auch Arbeiten, die an die Darstellung des Kontextes einfach eine Aufga-
benliste anfügen. Die Kirche war in dieser Region in eine Randexistenz gedrängt, jetzt hat sie die
Aufgabe, sich in der freien Öffentlichkeit zu bewegen. Früher konnte die theologische Diskussi-
on in der Kirche nicht ungehindert geführt werden, weil der Staat eine solche freimütige Ausein-
andersetzung durch starke Kontrolle blockierte und auch die Kirche meinte, dass durch die Dis-
kussionen ihre Schwachstellen ans Tageslicht kommen, wodurch die Verfolgung in der Form
lähmender Kontrolle noch zielgerichteter und wirkungsvoller hätte gemacht werden können. Jetzt
aber muss sich die Kirche der Aufgabe stellen, über theologischen Fragen freimütig und öffent-
lich zu diskutieren, denn ohne eine wissenschaftliche Diskussion gibt es keine Theologie, die sich
als Wissenschaft verstehen kann.
Das Modell „Beschreibung und Aufgabeliste“ ist noch keine kontextuelle theologische Leistung,
obwohl es sehr informativ sein kann. Kontextuell nennen wir die Theologie dann, wenn sie ein
Stück tiefer gräbt und aufzeigt, welche kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten die
Praxis und die Verkündigung der Kirche inhaltlich und strukturell beeinflusst haben und welche
Art von Aussagen der Logik der Umgebung entsprechen können. Oder umgekehrt: Welche Aus-
sagen und welche Praxis können auf bestimmte gesellschaftliche Gegebenheiten zurückgeführt
werden oder durch diese besser verstanden werden. Hier geht es also um die Theorie der Theolo-
gie und nicht um die Selbstverwirklichung oder um die gesellschaftlichen Stellung der Kirche.
Leitbild der Pastoral
Vorwiegend zwei ererbte Leitbilder bestimmen die Grundtendenzen des kirchlichen Denkens und
Wirkens. Das erste stammt aus der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, aus der Zeit der
christentümlichen Gesellschaft. Die gegen den Modernismus eingeführte theologische und pasto-
rale Strategie wurde in diesen Länder gut aufgenommen. Die katholische Kirche hat einen ziem-
lich erfolgreichen Kurs der Restaurierung eingeleitet. Sie hat sich vor allem mit ihrem Schul- und
Gesundheitswesen, mit der strengen neuscholastischen Theologie, mit der Wiederbelebung ihrer
Vereine, mit der Verstärkung ihres Einflusses im medialen und politischen Bereich zu einem der
wichtigsten gesellschaftlichen und kulturellen Akteure profiliert. Sie hat dabei viel Kraft aus dem
Feindbildern des Liberalismus und dann des Kommunismus gewonnen. Im Grunde genommen
wirkte sie als alter ego des Staates und verstand sich als moralisch-kultureller Garant der Zukunft
der Nation.
Dieses Leitbild kann mit dem dogmatischen Ausdruck societas perfecta benannt werden. Die
kirchenamtliche Quelle war dabei mehr der Antimodernismus des Ersten Vaticanums als der
durch Leo XIII. eingeleitete Sozialkatholizismus. Dieses Leitbild lebte im kirchlichen Bewusst-
sein auch dann weiter, als die kommunistische Modernisierung samt Religionsfeindlichkeit, A-
theismus, Kirchenverfolgung usw. die ganze gesellschaftliche und kulturelle Szene in diesen
107
Staaten umstrukturierte. Es konnte weiterleben, aber es konnte durch die Reflexionen auf die
neue Situation nicht weitergeführt werden. Eine maßgebende Zahl der heutigen Amtsträger, der
katholischen Intellektuellen und Theologen hat ihre Grundvorstellung über das Wesen der Kir-
che, über ihre Identität und Rolle in der Gesellschaft aus dieser Zeit.
Das zweite Leitbild stammt aus der Zeit der Randexistenz der Kirche. Um die Pastoral weiterfüh-
ren zu können, mussten einerseits dem roten Regime gegenüber überlebensnotwendige Zuge-
ständnisse gemacht werden. Andererseits konnten verkünderische Aktivitäten nur in den „Kata-
komben der Gesellschaft“, also im Schatten der Öffentlichkeit ausgeübt werden. Immer mehr
verstand sich die Kirche oder der wichtigere, vielleicht auch lebendigere Teil der Kirche als
„kleine Schar“, als „heiliger Rest“. Aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit ausgeschlossen,
unter totalkontrollierten Kirchenverhältnissen, hat sie ihre Tätigkeit vor allem in der Glaubens-
übergabe Face-to-face gesehen, in der Hoffnung, dass christlich gestimmte, moralisch gut ausge-
rüstete, miteinander solidarische Menschen als „Salz der Erde“ die Gesellschaft mit ihrer gewalt-
tätigen Antikultur beim Überleben verhelfen werden.
Beide Leitbilder haben gemeinsam, dass sie sich gegenüber einem Feind artikulieren – das erste
gegenüber dem deistischen Liberalismus, das zweite gegenüber dem atheistischen Kommunis-
mus. Verschieden sind sie vor allem darin, dass aus dem ersten Leitbild eine politische Macht-
stellung im Interesse der Pastoral erwuchs, aus dem anderen eine antipolitische oder apolitische
Randexistenz, allerdings mit gleichen Interessen.
Aus diesen Leitbildern folgt eine unterschiedliche, zweipolige Aufgabenstellung für die Theolo-
gie. Im Rahmen des ersten Bildes einer societas perfecta muss die Theologie apologetisch ge-
stimmt sein, um die intellektuelle Widerstandskraft der Kirche zu sichern. Im Rahmen des ande-
ren Bild muss sie mystisch-dialogisch sein, um die persönliche Lebensplanung der einzelnen
Christen mit christlichen Inhalten und Motivationen prägen zu können. Die erste Aufgabenbe-
stimmung kann die Theologie zur Stärkung ihrer Systematik motivieren, die zweite eher zur Ver-
tiefung ihres mystagogischen Charakters. Die Schwäche der ersten kann in ihrer Unfähigkeit zur
Dialog mit der nicht mehr christliche bestimmten Kultur, die der zweiten in dem Mangel an Fä-
higkeit zu den strukturkritischen Ansätze gesehen werden. In der kontextuellen Matrix gesagt:
Die erste kann wegen der Überbetonung der Andersartigkeit des aktuellen Kontextes, die zweite
wegen der Nivellierung seiner Bedeutung nur sehr begrenzt die Zeichen der Zeit als locus theo-
logicus betrachten.
108
Theologische Traditionen
Ultramontanismus
Der Begriff „Ultramontanismus“, „ultramontan“ war im 18. und 19. Jahrhundert ein Kampfbe-
griff in den politischen und kirchlichen Kämpfen in Italien, Frankreich, Deutschland und auch in
der Österreich-Ungarischen Monarchie. Es stand damals die Entwicklung der Nationalstaaten
und die neue Rolle des Kirchenstaates auf dem Spiel. In diesem Umbruch haben sich die politi-
schen Auffassungen theologisch-ekklesiologischer Inhalte bedient: einerseits des Gallikanismus
und Episkopalismus mit der starken Betonung sowohl der nationalstaatlichen wie der national-
kirchlichen Unabhängigkeit, andererseits eben des Papalismus, der die absolute politische und
kirchliche Souveränität des Papstes forderte. „Die wechselseitige Beeinflussung und auch die
Abhängigkeit der kirchlichen Strukturen und weltlichen Muster“160 ist sehr groß.
Über eine „ultramontane Ekklesiologie“ als theologische Lehre im strengen Sinn kann man nur
bedingt reden. Dennoch lassen sich nach Pottmeyer161 die allgemeinen theologischen Charakteri-
stika ihres Kirchenbildes so umschreiben:
• einseitig jurisdiktionelle Auffassung des Lehramtes als rechtssetzende Entschei-
dungs- und Weisungsinstanz;
• ausschließlich formale Autoritätsbegründung;
• Glaubensverpflichtung nach Art einer gesetzlichen Anordnung, Glaubenstreue als
gesetzlich geforderter Gehorsam;
• die Unterbindung und Verfolgung öffentlicher Kritik Roms;
• der obrigkeitlich bevormundende Umgang mit Bischöfen und Ortskirchen;
• Gewicht immer mehr auf die Entscheidungsbefugnis der rechtssetzenden Instanz,
wobei der Entscheidungsvorgang und die Entscheidungsvorbereitung immer mehr
in den Hintergrund tritt.
In ihrer theologischen Argumentation haben sich die ultramontanen Theologen von der traditio-
nellen Argumentationsweise gelöst, die sich auf die kirchliche Tradition beruft. „Christus habe
der Kirche eine unveränderliche Konstitution gegeben. Angesichts der ‘indefettibilità delle forma
estrinseca’ genüge es, auf den ‘governo attuale’ der Kirche zu schauen, um die immer gültige
Form des ‘governo ecclesiastico’ festzustellen.“162 Scharf wurde gegen die gegenseitige Ange-
160 Pottmeyer, Ultramontanismus 463. 161 Vgl. ders., Rezeption 58-66. Zum Ultramontanismus gilt als Grundliteratur Pottmeyer, Unfehlbarkeit und speziell
über die ultramontane Ekklesiologie: ders., Ultramontanismus. 162 Pottmeyer, Ultramontanismus 459.
109
wiesenheit des Papstes und der Kirche argumentiert. Der Papst und die kirchliche Autorität haben
in der Ausübung ihrer Entscheidungsgewalt nicht zu argumentieren, denn solches schade ihrer
Souveränität. Der eigentliche Sinn der gewollten Ausdehnung der päpstliche Unfehlbarkeit ist die
Möglichkeit der Forderung nach absolutem Gehorsam, der die Unterwerfung des Verstandes
einschließt. So wird Glaubensverkündigung mehr nach Art einer gesetzlichen Anordnung gese-
hen, der Glaube als gesetzlich geforderter Gehorsam.163
Die ultramontane Ekklesiologie, die im 19. Jahrhundert ausgebildet wurde, war universalistisch,
zentralistisch und autoritär: universalistisch, weil sie unter Kirche fast ausschließlich die Ge-
samtkirche verstand; zentralistisch, weil sie aus dem Jurisdiktionsprimat des Papstes ein Jurisdik-
tionsmonopol machte; autoritär, weil sie eine obrigkeitliche Autoritätsauffassung und -praxis
unterstützte und alle anderen Glieder der Kirche, einschließlich der Bischöfe, lediglich als Unter-
gebene des Papstes als der allein rechtssetzenden Instanz ansah. Die hierarchia iurisdictionis, die
rechtliche Über- und Unterordnung, war an Stelle der hierarchia ordinis zum vorrangigen Struk-
turprinzip der Kirche geworden. Die communio der Ortskirchen und das Bischofskollegium tra-
ten als strukturbestimmende Elemente der Kirchenverfassung zurück. Das in der Tradition ver-
ankerte Recht der Bischöfe, als Zeugen und Richter bei der Lehrfeststellung mitzuwirken, wurde
nicht mehr als rechtlich verbindlich, sondern höchstens noch als moralische Verpflichtung des
Papstes angesehen.
Societas perfecta
Die ultramontane Auffassung über die Kirche wird von Hervé Legrand unter dem ekklesiologi-
schen Stichwort „societas perfecta“ sehr anschaulich und kompakt beschrieben. Wir folgen hier
seinem Gedankengang.
Die Kirche hat sich im 19. Jahrhundert oft als „vollkommene Gesellschaft“ (societas perfecta)
verstanden und auch verkündet. Das geschah vor allem in der Absicht, dem Ansturm der aus der
Aufklärung und der Französischen Revolution entstandenen neuen Gesellschaft zu widerstehen.
Das Verständnis von Kirche in gesellschaftlichen Begriffen geht auf das Mittelalter und beson-
ders auf die nachtridentinische Zeit (Bellarmin) zurück. Der qualifizierende Ausdruck „voll-
kommen“ (perfecta) soll die totale Unabhängigkeit der Kirche dem Staat gegenüber sicherstellen.
Die Kirche versteht sich als vollkommen in ihrer Ordnung wie der Staat in der seinen. Sie ist mit
allen zur Verwirklichung ihres Zieles notwendigen Mitteln und Vollmachten ausgestattet. Diese
Gesellschaft sei „ungleich“ aufgebaut, das heißt: strikt hierarchisch gegliedert. Die Mittel zur
Erreichung des Zieles liegen allein in den Händen des Klerus, die Laien unterstehen in allem den
Klerikern. Im Umfeld der modernen Welt mit ihrer Emanzipation der Vernunft erschien es drin-
163 Pottmeyer, Unfehlbarkeit 352.
110
gend notwendig, dass die Hierarchie ihre ausschließliche Zuständigkeit in Sachen der Offenba-
rung mit aller Deutlichkeit sichtbar macht. Eine solche, weithin der Apologetik verpflichtete
Konstruktion hatte vor allem eines zur Folge: Sie stellte die Verwirklichung der Kirche in der
Vielfalt menschlicher Lebensräume in den Schatten, also etwa das Kirchesein ihrer Mitglieder an
einem bestimmten Ort.
Der Staat galt als erstes Analogon der Kirche. Daraus ergab sich eine starke Betonung der orga-
nisatorischen Seite der Kirche. Diese Sicht wurde dadurch noch verschärft, dass man sich genö-
tigt sah, Autonomie und Autosuffizienz zu unterstreichen (die „vollkommene Gesellschaft“ ist
das alter Ego des Staates!). Das eigentümlich Menschliche und Kulturelle jener Lebensräume, in
denen sich Kirche verkörpert, erschien nicht als wesentlich, es war nur ein günstiger oder eventu-
ell ungünstiger Boden für ihr Wirken.
In einem derart hierarchischen Gefüge sind die Laien von vornherein nur die Untergebenen der
Kleriker; sie werden von ihnen geleitet, unterwiesen und empfangen von ihnen die Sakramente.
Eine solche Sicht führt im Grunde zu einer Spaltung im Kirchenbegriff selbst. Die Gläubigen
sehen sich hier gleichsam zu Objekten klerikaler Seelsorge erniedrigt: Die Heilsgemeinschaft, die
Kleriker und Laien zur Einheit zusammenschließt und ihnen das gemeinsam gesprochene „Wir“
wie auch das daraus entspringende Tun ermöglicht, wird geschwächt. Das geschieht einerseits im
Blick auf die Mittel für ein Ziel, dem das sakramentale Leben dienen soll, und andererseits durch
ein damit verbundenes pneumatologisches Defizit im kirchlichen Leben. 164
Nach der vorkonziliaren Ekklesiologie165, die hier durch die Arbeiten des großen ungarischen
Dogmatiker A. Schütz demonstriert wird, ist die Kirche eine „societas perfecta“, in der die Mit-
glieder nach dem Willen Christi von Anfang an ungleich sind. Die Kirche ist nach ihrem Wesen
eine Monarchie. Die Kirche hat die Wahrheit, die sie allen Menschen verkündet. Als vollkom-
mene Gesellschaft ist sie gegenüber dem Staat unabhängig und autonom.166 Da aber ihre Mitglie-
der die selben sind wie die des Staates, hat die Kirche die Aufgabe, den Menschen die transzen-
dentalen Ziele zu zeigen und im Erreichen dieser Ziele hat der Staat die Pflicht, die zeitlichen
Güter und Anliegen so zu verwalten, dass dies der von der Kirche verkündigten göttlichen Ent-
scheidungen entspreche. In diesem Sinne, „Kraft der Werthierarchie“, ist der Staat der Kirche
untergeordnet.
164 In: Eicher, Neue Summe 88-89. 165 Hier können wir keine feinere Analyse der vorkonziliaren – keineswegs so einheitlichen – ekklesiologischen Wer-
ken machen. Die Ekklesiologien in unserer Region sind davon auch unberührt geblieben. 166 Es ist zu bedenken, dass sich die neoscholastische, ultramontane Auffassung von der Kirche gerade dort entwickelt
hat, wo die Kirche Gefahren ausgesetzt war und sich gegen liberale und totalitäre Einwirkungen verteidigen mußte. Schütz vermerkt in seiner Dogmatik, dass „besonders in dem heutigen totalitären Staat, der unbefugt den ganzen Mensch beschlagnahmt“, die Idee einer nach göttlichen Zielen eingerichteten vollkommenen Gesellschaft nicht ver-nebelt werden darf. (II 258). Im totalitären System des Kommunismus hat die ungarische Kirche diese Autonomie der ultramontanen Ekklesiologie aufgegeben und davon nur die starke Verteidigung der inneren Hierarchie behal-ten.
111
In der ultramontanen Auffassung über die Kirche spielt zweifellos die Einheit der Kirche die
zentrale Rolle. Diese Stellung der Einheit hat ihre geschichtliche Wurzel in der Zeit nach der
französischen und anderer europäischer Revolutionen. Die Kirche, besonders das Papsttum, mus-
ste sich von allen Seiten bedroht fühlen und daher einen Abwehrmechanismus entwickeln, dessen
wichtigste Kraft die Einheit war: nach außen geschlossen, nach innen streng hierarchisch und
einheitlich. Aufgrund der nationalkirchlichen Bestrebungen und dem theologischen Liebäugeln
mit den Freiheitsidealen der Revolutionen – beide Entwicklungslinien stießen auf harte Kritik –
gewann der Ultramontanismus in der katholischen Kirche mehr und mehr an Boden. Der Nie-
dergang der legitimistischen Systeme und der etappenweise sich vollziehende Verlust der Terri-
torien des Kirchenstaates begünstigten sein Vordringen. Auf jede nur denkbare Weise trieben die
Gefahren der Zeit dazu an, die innere Einheit zu verstärken. Das Empfinden der Volksmassen,
die Vereinheitlichung der Liturgien und die Renaissance der kanonistischen Studien trugen bei
zur Erhöhung des Papstes und zur Proklamation seiner Unfehlbarkeit. Er bot sich nun dar als das
Prinzip der Einheit, als allezeit zur Unterbindung jeden Konfliktes bereiter Schiedsrichter, der
zweifellos wirksamer war als der romantische Vitalismus.
Diese Entwicklung trug dazu bei, „die Einheit des Gottesvolkes mit der soziologischen Einheit
der institutionellen Kirche zu verwechseln; die Einheit im Glauben mit der Einheit in den kirchli-
chen Lehren, welche zu einer bestimmten Zeit dem Glauben dem Verstehen erschlossen haben;
die Einheit in der Parteinahme für das Evangelium mit der Einheit mangelnder Parteinahme aus
Furcht, bei der Hierarchie oder der Masse der Gläubigen Anstoß zu erregen“167.
Die Einheit in der Lehre spielte auch eine große Rolle in der Einheit der Struktur der Kirche. Die
sichtbare Einheit wird durch den Papst gesichert, durch seine allgemeine und überall verpflich-
tende jurisdiktionelle Gewalt. Schütz stellt die Einheit der sichtbaren Kirche mit den folgenden
Argumenten dar:
Die Einheit der Kirche ist in der Realität des „triplex vinculum“ zu begreifen: vinculum fidei,
hierarchicum et liturgicum. Unter diesen drei ist das vinculum hierarchicum wohl das wichtigste,
da die Orthodoxie und die Orthopraxie durch die Verwaltungsautorität des Papstes gesichert
werden.168
In der Regierungseinheit liegt „die Wurzel und die Versicherung der Einheit der katholischen
Kirche, das innere Prinzip der kirchlichen Einheit: die Katholiken anerkennen prinzipiell, dass
die kirchliche Leitung über göttliche Bevollmächtigung verfügt und darum halten sie ihre Befeh-
le im Gewissen verpflichtend und nicht nur als nützlich oder als eine erzwungene Tatsache“.169
167 Gérest, Nostalgie, 617. 168 Ders., Dogmatik, II 292-295. 169 A. a. O., 317.
112
Heute erreichte die westliche Menschheit den Höhepunkt der geistlichen Atomisierung, beson-
ders in den Fragen der Weltanschauung und weist eine marktschreierische Vielfältigkeit auf.
Dagegen zeigt die Kirche, die so viele Kulturen und Völker umarmt, eine geschlossene Ein-
heit.170
Eine derartige Einheit wurde gepaart mit einem römischen Zentralismus, anders gesagt mit einer
„universalistischen Ekklesiologie“. Demzufolge hatten die Ortskirchen oder Teilkirchen wenig
Eigenständigkeit. Das kirchliche Leben wurde von Gremien gesteuert, die streng übereinander
geordnet arbeiteten. Die Bischöfe eines Landes übten ihr Amt im Namen des Papstes aus und
verstanden ihr Amt als Umsetzung der päpstlichen Instruktionen. Diese strenge und nahezu aus-
schließliche Vertikalität der kirchlichen Beziehungen forderte, dass alle kirchlichen Aktivitäten,
seien sie pfarrlicher Art oder in der Art eines Vereines, sich durch den Bischof als katholisch
behaupten konnten. Die Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas verstärkte diese Auffassung
nur.171
In einer anschaulichen Tabelle möchte ich die ekklesiologischen Schwerpunkte zwischen der
Kirchensicht des Ultramontanismus und des Zweiten Vaticanums in Erinnerung rufen.
Ultramontan Zweites Vaticanum Societas perfecta: Ungleichheit Gemeinschaft: Gleich/Ungleich Alter ego: des Staates Kein alter ego: ungebunden Absoluter Zentralismus Zentralismus und Gremien Sakramente beim Priester Sakramente der Kirche: Mitfeiern Universalkirche Ortskirche Staatsrecht in der Kirche nachgeholte theologische Rechtstheorie
TABELLE 2: Theologische Ansätze zwischen Ultramontanismus und Zweitem Vaticanum
Wie diese Tabelle – selbstverständlich etwas vereinfachend – wohl zeigt, können die theologi-
schen Ansätze als Übergänge von einer ultramontanen Ekklesiologie zu der Communio-
Ekklesiologie gelten. Dabei ist zu beachten, dass in allen ekklesiologischen Richtungen Inkonse-
quenzen zu beobachten sind, die den diesbezüglichen Vergleich keineswegs mechanistisch
durchführen lassen.172
Theologie an der Basis
Neben der theologischen Sichtweise der Vorkriegszeit gehört zu der Traditionsquellen der heuti-
gen Theologie in unserer Region auch eine Theologie von der Basis her. Sie entwickelte sich in
170 A. a. O., 317. Neben diesen Ausführungen bekennt sich Schütz zur rechtmäßigen Vielfalt der theologischen Schu-len, der Ortsliturgien, die die Kirche – seiner Meinung nach – immer respektierte.
171 Vgl. Eicher, Neue Summe III 90 und 38-39. Ferner die ekklesiologischen Artikel von Rahner in: Schriften Bd. 14. und sein Kommentar zu LG im LThK.
172 Vgl. Alberigo L’ecclesiologia und Pottmeyer, Die zwiespältige Ekklesiologie.
113
einer doppelt bedrängten Situation unter den Bedingungen des real existierenden Sozialismus.
Einerseits wurden die Trägerpersonen und -gruppen im Sinne von einer Untergrundkirche an der
Basis wegen ihrer Unkontrollierbarkeit mehr verfolgt als die offiziell geduldeten Theologen und
Institutionen. Andererseits hatten diese Theologen oft gar kein Zugang selbst zu den mangelhaf-
ten wissenschaftlichen Apparaten, die den Geduldeten zur Verfügung standen. Im Vergleich mit
den beiden theologischen Wirkungsebenen ist es wichtig, nicht nur die Hindernisse der einen
gegenüber den anderen hervorzuheben, sondern auch deren Reichtum.
Die Theologen an der Basis konnten die Freiheit der Piraten genießen. Zwar wurden sie im ersten
Jahrzehnt der kommunistischen Machtübernahme oft mit dem Gefängnis bestraft, als Theologen
bedurften sie nie der Anerkennung des kirchlichen und staatlichen Systems und brauchten dem-
nach dafür auch keinerlei Bedingungen erfüllen. Sie wurden daher auch von niemandem als
Theologen kontrolliert. Die einzige Bedingung, der sie sich unterwerfen mussten, um eine Theo-
logie an der Basis treiben zu können, war die Akzeptanz der Basis. Diese Freiheit ging aber mit
der Armut an materiellen, finanziellen und strukturellen Mitteln Hand in Hand. Die Theologen an
der Basis mussten ihren Lebensunterhalt aus einem anderen Beruf als der Theologie bestreiten.
Sie mussten alle Mittel für ihre Theologie aus dem eigenen (Familien)Budget finanzieren. Wegen
der speziellen Situation in Ungarn wurden sie bis zur politischen Wende nie zu einer internatio-
nalen theologischen Zusammenarbeit eingeladen. Systemfreiheit also unter sehr ärmlichen Be-
dingungen.
Neben dem materiellen Reichtum wiegt der symbolische Reichtum im humanwissenschaftlichen
Bereich mehr. Die Theologen an der Basis waren in ihren Gruppen dem Dialog verpflichtet. Alle
ihre Erfahrungen, die die Ansätze ihrer theologischen Arbeiten mitbestimmt haben, wuchsen aus
einem ständigen Dialog mit der Basis. Da das universitäre System ihnen gegenüber keine Anfor-
derungen wie Vorlesungen, Prüfungen, usw. gestellt hatte, konnten sie in den gutorganisierten
Untergrundkanälen der Basiskirche eigentlich einen Dialog als Theologie vorantrieben. Ihre theo-
logischen Reflexionen waren daher sehr häufig Anspielungen an konkrete Gespräche mit Freun-
den und Gruppenmitgliedern. Ihre Leserschaft bestand vor allem in Personen, die sie persönlich
mehr oder weniger gekannt haben oder selbst Teilnehmer ähnlicher Gespräche gewesen waren.
Die Themenwahl wurde durch diese Dialoge bestimmt, oder für sie als eine Dialogförderung
ausgedacht. Diese enge Verbundenheit mit der Basis hatte auch hermeneutische und methodolo-
gische Konsequenzen. Sie hat keine theologischen Kriterien in die theologische Arbeit eingeführt
und die pastorale Zielsetzung weitgehend verstärkt. Dieser Reichtum an Dialog und die unkon-
trollierbare Verbundenheit und das Zusammenleben mit den Gruppen machte die Theologen der
Basis für die kirchlichen und staatlichen Behörden verdächtig. Alle totalitären Systeme dulden
solche Menschen und Tätigkeiten kaum, da sie in ihnen per definitionem nur Feinde sehen kön-
nen. Die Fragwürdigkeit ihrer Theologie und theologischen Tätigkeit in den Augen der Legiti-
114
mierten und der Verantwortungsträger hat auf ihre Arbeiten einen Einfluss genommen: die Anrü-
chigkeit konnte zum Kriterium für Originalität und Basisnähe werden. In Verruf zu arbeiten stör-
te den unmittelbaren Dialog mit der Basis und kann zu Schattendialog führen: vor der Basis wird
eigentlich nicht mit ihr, sondern mit den offiziellen Vertretern ein Dialog geführt. Obwohl von
diesen Versuchungen nicht unberührt gelassen, sind die Theologen der Basis dialogreich.
Theologie definiert sich als eine Wissenschaft. Ihre Wissenschaftlichkeit wird verschiedentlich
ausgelegt. Die Theologie als universitäre Wissenschaft hat selbst in den letzten Jahrzehnten auch
verschiedene Epochen durchlebt und manche sprechen bereits von einer Krise der so verstande-
nen Theologie.173
Auf der anderen Seite entwickelte sich die Theologie von der Basis her, wo die Theologen nicht
imstande waren, die Bedingungen der universitären Wissenschaftlichkeit zu erfüllen. Hans Wal-
denfels macht diesbezüglich darauf Aufmerksam, dass die Wissenschaftlichkeit auch nur eine
begrenzte Rolle in der theologischen Bewertung der Theologie spielt. „Im Gegensatz zum ‚elitä-
ren’ Tun der wissenschaftlichen Theologie wird für eine Theologie geworben, die auf die ‚Wis-
senschaftlichkeit’ verzichtet und sich als gläubige Reflexion auf das Handeln in der Gesellschaft
versteht, die dann ‘an der Basis’, an den ‚grass-roots’ stattfindet. Nun sind weder der Hand-
lungsbezug noch die Bindung an das ‚Volk’, an die ‚Basis’ zurückzuweisen. Sie müssen auch
von denen, die wissenschaftliche Theologie treiben, beachtet werden, wenn diese nicht zu einem
‚Glasperlenspiel’ (Hermann Hesse) werden oder in einem ‚elfenbeinernen Turm’ stattfinden
soll.“ 174
Diesen Mangel glichen sie durch die einfachere Sprache, die auch für wenig Gebildete verständ-
lich war und vor allem durch die Nähe zur Basis aus. Die Schriften der Basistheologie weisen
kaum Fußnoten und einen wissenschaftlichen Apparat auf. Sie sind arm an hermeneutischen
Reflexionen und können die Ergebnisse der fachtheologischen Diskussionen nicht referieren.
Dies ist wahrhaft Armut in theologische Arbeit – auch für ungarische Verhältnisse. Es liegt die
Versuchung nahe, die Unwissenschaftlichkeit als Originalität darzustellen und gegen echte wis-
senschaftliche Arbeiten einen nichttheologisch begründeten Abwehrmechanismus zu entwickeln.
Die Basistheologie und die Theologen von der Basis her sind nicht frei von solchen Unterstellun-
gen, dennoch dürfte ihre Theologie wegen der begrenzten Wissenschaftlichkeit nicht als Nicht-
theologie denunziert werden.
Die Priestertheologen an der Basis streuten gerne antiklerikale theologische Meinungen zur Ver-
teidigung ihrer Theologie und nicht selten als Kriterium der Authentizität ein und meinten oft, die
Tradition als ganze verneinen zu müssen. Sie versuchten aber, positiv eine Theologie zu entwic-
173 Byrne, Theologie. 174 Waldenfels, Fundamentaltheologie 63.
115
keln, die auch von Laien175 gleichberechtigt geleistet werden konnte. Laie meint in diesem Zu-
sammenhang nicht nur den Stand des Theologen, sondern vor allem den ursprünglichen Mangel
der theologischen Ausbildung universitären Ranges. Es wurden wegen dieses Mangels theologi-
sche Kurse in der Untergrund gegeben (Ungarn, Tschechien, Ukraine).
Diese Aspekte der Theologie an der Basis zu reflektieren und zu evaluieren gehört zu den eigen-
ständigen Quellen einer kontextuellen Theologie in Ost(Mittel)Europa.
THEMEN AUS ERFAHRUNG
Kontextuelle Theologie geschieht dadurch, dass die Themen, die aus der Erfahrung aktuell und
unumgänglich sind, eine wichtigere theologische Rolle zu spielen beginnen. Die Theologen fra-
gen danach, welche die Verstehenshilfen aus der Bibel, aus der christlichen Tradition, aus der
wissenschaftlichen Logik der Theologie zu den aktuell gewordenen Themen sind. Durch die
theologische Deutung dieser Themen aus dem Kontext wird die Theologie kontextuell und auch
provozierend.
Unter der Erfahrungen der postsozialistischen Länder in Ost(Mittel)Europa sollen jetzt einige
genannt und kommentiert werden, die zu den allgemeinsten und wichtigsten gezählt werden kön-
nen.
Mauer
Die Stadtrundfahrt mit dem Autobus in Berlin überquert mehrmals die früher so undurchlässige
Grenze zwischen Ost und West. Nach der Station beim Checkpoint Charlie – ein Museum und
Ehrenstelle für die Mauersteiger und Grenzgänger aus der ehemaligen DDR und Tschechoslowa-
kei – wird von der Reisebegleiterin mehrmals darauf hingewiesen, wann sich die Reisenden in
der ehemalig russischen oder in der ehemalig amerikanischen Zone befinden. Ein Teil der Mauer
steht noch. Früher war sie Trennwand zwischen Freiheit und Unfreiheit. Heute ist sie seit zehn
Jahren eine Sehenswürdigkeit: Symbol der Wiedervereinigung Deutschlands, der Befreiung und
der Freiheit. Um West-Berlin herum läuft durch die Straßen ein Streifen aus Steinen, der die
ehemalige Grenze in Erinnerung zu halten bestimmt ist. Der Bus fährt beim S-Bahnhof Fried-
richsstraße am sogenannten Tränenpalast vorbei. Hier mussten dreißig Jahre lang deutsche Bür-
ger aus Ost und West mit Tränen in den Augen voneinander Abschied nehmen. Die einen konn-
ten „hinüber“, den anderen wurde solches mit Polizeimacht und Grenzschutztruppen mit Schuss-
befehl untersagt.
175 Ähnlich wie der leidenschaftliche Bericht von Steinkamp, Laientheologe.
116
Die Mauer in Berlin ist ein Denkmal der politischen Abgrenzung zwischen den zwei politischen
Blöcken der Nachkriegszeit. Sie hat eine starke symbolische Kraft, die viele Künstler schon fas-
ziniert hat. Sie vergegenwärtigte im ausgehenden zwanzigsten Jahrhundert Grundthemen der
Menschheit: Freiheit und Gefangenschaft, Autonomie und Unterwerfung, Einheit und Trennung.
Solchen Mauern wurden und werden immer noch unterschiedliche Bedeutungen zugemessen, je
nach Biographie, die mehr oder weniger politisch gefärbt ist. Ossis und Wessis in ganz Europa –
aber besonders in Deutschland sind darin einig, dass diese Trennung einer Nation eine grundle-
gende Ungerechtigkeit gewesen ist. Die westlichen Gebiete haben Autonomie gehabt, wogegen
ihre Volksgenossen in Osten keine hatten. Die Grenze zwischen den beiden Blöcken konnte –
abgesehen von Ausnahmefällen – nur von der westlichen Seite her übertreten werden. Für viele,
vielleicht für die meisten westlichen Bürger haben die Mauern dafür gesorgt, dass sie Europa
langsam ohne Osteuropa gedacht haben. Gewiss gab es sehr viele, vor allem in den Grenzländern
Deutschlands, die die Mauer als ständige Herausforderung wahrgenommen haben und immer
wieder versuchten, mit oft bewundernswerter Kreativität durch Briefe, Päckchen, Reisen und
Tricks die Unhinterfragbarkeit der Teilung zu relativieren. Dennoch sind sie Ausnahmen. Hinge-
gen bewirkte die Abgrenzung bei den östlichen Bürgern, die sozusagen existentiell umgreifend
von den Mauer betroffen waren, eine ständige Provokation und weckte eine tiefe und schwer
ertragbare Sehnsucht nach Freiheit. Der Osten hat den Westen nie vergessen. Der Westen war
durch viele Kanäle immer präsent, parallel dazu auch ideologisiert. Und das alles geschah trotz
der starken Verächtlichmachungskampagne der kommunistischen oder sozialistischen Parteiideo-
logen, die bei allen oft krampfhaft herbeigeholten Anlässen nie müde wurden, den Menschen die
Fortschrittlichkeit ihres Blockes einzuprägen. Dies diente eher der gegenteiligen Ideologisierung
des Westens. Anfang der Achtzigerjahre hat mir in Berlin/Ost ein neunjähriger Bub gesagt: „Für
DM kann man alles kaufen, selbst das Glück“.
Die Deutungen gingen und gehen auseinander. Die Verurteilung der Trennung ist im ehemaligen
Osten und ehemaligen Westen geblieben. Der Fall der Mauer wird beiderseits als epochales Er-
eignis gelobt. Die Tiefenwirkung der Mauer ist aber in dem Jahrzehnt der europäischen Einigung
beiderseits geblieben. Für die „schon immer Freien“ ist der Osten ein Problem. Beseitigung der
Schäden, Probleme der Umstrukturierung und Sanierung der Wirtschaft, der Politik und derglei-
chen stehen an. Für die „Befreiten“ ist ihre Vergangenheit das Grundproblem. Sie sind gar nicht
oder nur zögernd bereit, 40 Jahre ihres Lebens für nichts, für einen Fehlschlag zu erklären. In
ihrem Inneren bleibt die Frage unbeantwortet: Was ist mit uns geschehen, wer sind wir jetzt, und
wer waren wir eigentlich einst? Sie suchen positive Anhaltspunkte in ihrer Geschichte der Un-
freiheit, um Person bleiben oder werden zu können. Die Antwort auf solch tiefgreifende Fragen
fällt nicht leicht und es ist auch gut so. Die schnellen Antworten sind nicht glaubwürdig oder
nicht nachvollziehbar. Die aus politischen und wirtschaftlichen Bereichen stammende Antworten
117
scheinen nur zum Teil befriedigend zu sein. Die Demokratie und die Marktwirtschaft sind zwar
im Alltagsempfinden sehr bestimmend. Es wird vermittelt, dass man jetzt politisch gesehen freier
lebt und wirtschaftlich morgen oder übermorgen auch alles in Ordnung werde. Für viele ist diese
Zukunftsvision beruhigend, aber für andere eben nicht.
Eine Theologie auf der Basis der osteuropäischer Erfahrungen soll sich der Aufgabe stellen, die
Suche der Menschen von dort nach einem Sinn zu Kenntnis nehmen und sie aus der Tradition der
christlichen Sinndeutungen zu begleiten. Es dürfen keineswegs einfach die Antworten aus dem
westlichen Teil Europas übertragen werden – das wäre eine Art Indoktrination in die Freiheit,
eine geistige Kolonialisierung übler Art. Im Gegenteil soll versucht werden die Kehrseiten der
negativen Erfahrungen aufzudecken, weitere Spielräume für die osteuropäische Sinndeutungen
zu eröffnen, bei der erforderlichen existentiellen Trauerarbeit einen solidarischen Beitrag zu lei-
sten. Um beim Symbol der Mauer zu bleiben: Das Experiment sinnvolles Lebens hinter der Mau-
er ist zu rekonstruieren, zu würdigen und für das Experiment politischer Freiheit fruchtbar zu
machen.
Negation der Negation ist neben Einheit und Kampf der Gegensätze und des Umschlags der
Quantität in Qualität das dritte Gesetz von Engels. Es besagt, dass alle Entwicklung eine Höher-
entwicklung ist. Die einzelnen Stadien in der Veränderung werden einerseits überwunden, aber
zugleich auch in ihrem positiven Gehalt bewahrt. Bei Hegel steht dafür der Ausdruck „aufhe-
ben“. Dieses Gesetz – welches in jedem marxistisch-leninistischen Philosophiekurs gelehrt wur-
de – provoziert die interpretatorische Kreativität der Denker, auch der Theologen, jene Aspekte
auszuwählen bzw. hervorzuheben, unter denen eine bestimmte historische Entwicklung als Nega-
tion oder als Negation der Negation betrachtet werden kann. Eine Geschichtsauffassung, die in
den aufeinanderfolgenden geschichtlichen Stadien einen ständigen linearen Fortschritt sieht,
weist auf eine spezielle Interpretation hin. Die Idee mit der Negation der Negation macht darauf
aufmerksam, dass zwar der Sieg der Demokratie und Marktwirtschaft über Proletardiktatur und
Planwirtschaft (Negation) ein Schritt nach vorne, also nach mehr Gerechtigkeit, mehr Mitbe-
stimmung, mehr sozialer Sicherheit ist; die Geschichte hat aber dadurch nicht ihre totale Erfül-
lung, ihr „Ende“ (Fukuyama) gefunden (Negation der Negation).
„Die zukünftigen Aufgaben“ – schreibt der Tübinger protestantische Dogmatiker Jürgen Molt-
mann – „der Kirchen und auch der politischen Theologie liegen hier: Im Namen der Opfer des
marktwirtschaftlichen Systems – nicht im Namen einer (sozialistischen oder fundamentalistisch
ökologischen) Ideologie – die Kritik am Kapitalismus öffentlich zu vertreten und durch Sozial-
wie Umweltpolitik Gerechtigkeit für Mensch und Natur zu schaffen. Das ist zur Zeit nicht oppor-
118
tun, aber die katholische Soziallehre enthält seit Rerum Novarum 1891 viel kritisches Potential
dafür.“176
Die Theologie muss weitergehen und eine souveräne Zweitlektüre wagen, wodurch aus dem
Negierten und aus dem Negieren das Positive aufgehoben wird. Die Osttheologie steigt ins Feld
der Interpretationen ein und wird bereit, aus ihren ureigenen theologischen Wurzeln negierende
Interpretationen zu negieren. Sie bricht interpretatorische Eindeutigkeiten auf, weil sie das Den-
ken aber vor allem die Handlungsspielräume verengen. Ein solches Vorhaben, ein „Lesen gegen
den Strom“, ist sozial und politisch nicht naiv. Die Theologie muss wissen, dass einem Phäno-
men eine Deutung, vor allem eine exklusive Deutung zu geben, die Machtfrage stellt. Durch
welche Macht werden andere möglichen Deutungen ausgeschlossen (exkommuniziert) oder ver-
boten? Neue Wege und Möglichkeiten in der Deutung eines Phänomens zu suchen, hinterfragt
die Legitimation der als einzig möglich dargestellten Interpretation und setzt ein Fragezeichen
hinter den Machtfaktor, der eine Monopolstellung beansprucht.
Über die Wertung der Lage der Kirche im Sozialismus und auch nach der Wende werden Diskus-
sionen geführt – je nach persönlichen Erfahrungen und jeweiligem Wissensstand. Es gibt aber
eine Menge von Eindeutigkeiten, über die ein weitreichender Konsens besteht. Solche einheitli-
che Meinungen spielen eine wichtige identitätsstiftende Rolle. Die Wende hat dem gesellschaftli-
chen Segment Kirche, aber auch die sie tragende ganze Gesellschaft, dermaßen neue Fragen ge-
stellt, dass sie ohne ein Mindestmaß an Konsens gar nicht bewältigen wären. Es muss einige
Fundamente geben, die – zumindest in einer Zeit des Übergangs – nicht hinterfragbar sind. Alles
andere würde eine unerträglich tiefe Krise verursachen. In der prophetischen Geschichte des
Judentums und des Christentums gibt es aber eine klare Tradition, gerade gegen die gängigen
Grunddeutungen zu bestimmten Phänomenen neue Bedeutungen hinzuzufügen. Man möge an die
fundamentalen Unsicherheiten der Geschichte des jüdischen Volkes denken – angefangen von
der ägyptischen Gefangenschaft über die Wüstenwanderung, die babylonische Gefangenschaft
bis zur Zeit der römischen Besatzung –, wo sich Propheten ständig zum Wort und Tat gemeldet
haben und eine vollkommen neue und originelle Deutung der Situation gegeben haben. Den Hö-
hepunkt solcher Neuinterpretationen ist die Theologie der Auferstehung Jesu Christi. Eine prä-
gnante Aufgabe der Theologie ist es gerade, durch die alles übersteigende Kraft des Göttlichen
die Welt, die Geschichte und auch die Menschen voll gegen den Trend zu interpretieren. Alle
diesseitige Mächte sind an der jenseitigen Macht Gottes zu messen. Nur eine Kirche, die den Mut
aufweist, selbst ihre eigenen „totalen“ Deutungssysteme von Zeit zu Zeit hinterzufragen, ist ein
Sakrament für die Welt, ein Zeichen Gottes für die Freiheit des Menschen.
176 Ders., Gott 62.
119
So müssen also aus dieser genuinen prophetischen Aufgabe der Theologie und der Kirche heraus
auch die wesentlichen Grundsteine der heutigen postkommunistischen Zeit mutig neu gelesen
und interpretiert werden. Es ist eine Aufgabe, die unbedingt das Vertrauen darin braucht, dass die
Kirche so wie sie sich jetzt in diesen Ländern darstellt, durch solche Relektüre nicht geschwächt,
sondern im Gegenteil gestärkt wird. Bei den Entwürfen von solcher Neuinterpretationen erweist
sich der feste Glaube daran, dass durch sie aus dem göttlichen Milieu neue Kräfte freigesetzt
werden können.
„Was wir auf keinem Fall brauchen, sind Leute, die Scheiße durch die rosarote Brille betrach-
ten“ – wird in der Herrentoilette des Tränenpalastes „kontextgerecht“ gemahnt. Die Versuche
politischer und/oder theologischer Art, die Ostblockvergangenheit zu verschönern, scheitern. Wo
es Tyrannei gibt, dort ist Tyrannei – schrieb 1956 der später als sozialistischer Dichter angesehe-
ne ungarische Dichter Gyula Illyés. Die Theologie verliert ihre prophetische Kraft und macht
sich unglaubwürdig, wenn sie die eben genannte rosarote Brille aufsetzt. Gerade aber im Beibe-
halten ihrer prophetischen Sendung ist sie verpflichtet, sich gegen die vereinfachenden Deutun-
gen zu stellen, die in unserem Fall dazu neigen, 40 Jahre Zeitgeschichte global zu verneinen und
nur als schwarzen Hintergrund für die Fackel der Freiheit zu stellen. Es soll eine Theologie ent-
stehen, die sich in die Geschichte des Ostblocks einfindet und darin die Funken der Vorsehung
entdeckt. So wirkt sie glaubwürdig und heilend.
Eine solche Theologie soll von Menschen der Oststaaten entworfen werden. Sie soll aber in ihrer
Entwicklung durch westliche Kollegen gegengelesen werden. Ziel bei dieser Arbeitseinteilung ist
es, die Priorität der Osterfahrungen methodologisch zu sichern, ohne dabei die Trennung zwi-
schen Ost und West strukturell weiterzuführen. Diese Theologie muss an die Ostmenschen adres-
siert werden – thematisch und stilistisch. Sie soll sich in ihrer Begriffs- und Methodenwahl an die
Begriffs- und Metapherwelt des Ostens anpassen. In ihren Thesen und Ausführungen wird sie
sich sicher an den gemeinsamen Schätzen der europäischen kirchlichen und theologischen Tradi-
tionen bedienen. Sie kann nur dadurch die Hoffnung pflegen und für die westliche theologische
Welt wichtige Ansätze zur Diskussion stellen.
Im Bus der Stadtrundfahrt in Berlin saßen wenige Deutsche, mehr Amerikaner, Japaner, Spanier
und Ungarn. Im Garten des Tränenpalastes spielte eine spanische Gruppe Mambos und Tangos.
Die dichte, künstliche Grenze zwischen Ost und West ist gefallen und parallel dazu ist das ganze
Europa multikulturell geworden. Es mag daher etwas anstößig wirken, wenn zehn Jahre nach
dem Fall der Mauer eine Autorengruppe gesucht wird, die gerade durch das Merkmal der Zuge-
hörigkeit zum Ostblock ausgewählt werden soll. Auf den ersten Blick kann man das zwar von der
Not der Vergangenheitsbewältigung her verstehen. Wer denn sonst soll eine existentiell tröstende
und kreative Theologie für den ehemaligen Ostblock entwickeln, wenn nicht die, die diese Erfah-
rungen gelebt haben und zum Teil sie auch dadurch geformt sind?
120
Mit dem speziellen Subjekt der Osttheologie ist aber wesentlich mehr gemeint. Es geht hier um
die Einsicht, dass Europa nicht einheitlich ist und selbst das vereinte Europa nicht ohne die au-
ßereuropäische Welt gedacht und geformt werden kann. Bei der Beibehaltung von vielen Grund-
werten, die in Europa von Bedeutung sind, ist aber am Prinzip festzuhalten, dass die Vielfalt der
Traditionen der ost-west-süd-nord-europäischen Nationen und Ethnien das eigentliche Europa
ausmacht. Der Grundsatz: je globaler, desto regionaler mag hier wegweisend sein. Mit der Be-
stimmung der Subjekte einer Osttheologie ist mittelbar auch daran erinnert, dass erst die Vielfalt
der Akzente der europäischen Theologie das Ganze dieser Theologie ausmacht: nicht additiv,
sondern kommunikativ gemeint.
Mangelwirtschaft
György Kornai, der aus Ungarn stammende Wirtschaftstheoretiker beschrieb das sozialistische
Wirtschaftsmodell mit dem Begriff „Mangelwirtschaft“.177 Im Mangel erblickte er den bestim-
menden Aspekt dieses Systems: Mangel an Grundstoffen, Ressourcen, Management, Wissen,
Ausbildung und Kreativität. Die heutige Wirtschaft des ehemaligen Ostblocks trägt immer noch
die Erbe dieses alles überschattenden Mangels. Es liegt auf der Hand, dass man Kornais geniale
Idee auch an die Kirche anwendet. Mangelkirche? Um bei unserer auf die Möglichkeit und Ei-
genschaften einer Osttheologie gerichteten Fragestellung zu bleiben, müssen wir der Frage nach-
gehen, ob das Vorhaben einer solchen Theologie nicht an dem vielgestaltigen Mangel in der Kir-
che und in der theologischen Wissenschaft scheitern wird. Manche Meldungen aus den Lokalkir-
chen unserer Region signalisieren mehrfache Mangelerscheinungen: Mangel an gut ausgebildeten
Theologen, an der wissenschaftlicher Literatur, an den praktischen Bedingungen der wissen-
schaftlichen Arbeit, an Sprachkenntnissen, an Dialogfähigkeit, an wissenschaftlicher Freiheit
usw. Solche Arbeitsbedingungen kennzeichnen – je nach Land in verschiedenem Maße – die
theologische Arbeit. Vielleicht ist Polen eine Ausnahme, sogar ein Gegenbeispiel, aber in allen
anderen Länder ist diese Mangelsituation durchaus bestimmend. Daher ist es verständlich, wenn
Kollegen aus dem ehemaligen Ostblock besorgte Stellungnahmen ihrer westlichen Kollegen über
die ständigen Kürzungen auch an der theologischen Fakultäten hören, dann sagen sie untereinan-
der: „Ihre Sorge möchten wir haben“.
Es ist klar, dass die Behebung dieser Mängel ein conditio sine qua non der Theologie in Ost-
(Mittel)Europa ist. Hier sind die Verantwortlichen der Kirche gefragt. Sie werden bald einsehen
müssen, dass ohne eine kontextnahe und wissenschaftlich gut fundierte Theologie auch eine
fruchtbare Verkündigung unmöglich ist. In manchen Ländern gibt es gelungene Versuche in
diese Richtung. An Hilfsbereitschaft aus dem Westen fehlt nicht. Man ist bereit Stipendien zu
177 Kornai, A magyar reformfolyamat 30-34.
121
geben, Bücher und Zeitschriften gratis zu abonnieren, theologische Ausbildungsstätten finanziell
zu fördern, zu Fachdiskussionen Kollegen aus dem Osten einzuladen usw. Es darf aber nicht
geleugnet werden, dass es im Osten wie im Westen kirchliche Kräfte gibt, die an einer Fixierung
der desolaten Lage interessiert sind. Nach Meinung mancher Ostbischöfe ist eine freie Theolo-
gie – man denkt dabei eigentlich an die deutsche Theologie –schwierig kontrollierbar. Die finan-
zielle Mittel zur Förderung der Theologie können nur aus der Pastoral genommen werden, der
verständlicherweise die höchste Priorität zukommt. Die wissenschaftliche Arbeit in der Theolo-
gie braucht und fordert Diskussionen in der Kirche, manchmal auch Spannungen und Kontrover-
sen, was von vielen Amtsträgern gefürchtet wird. Auch die Interdisziplinarität der Theologie und
das Verhältnis der theologischen Hochschulen zu den staatlichen Universitäten sind heiße Eisen.
Es wird zwar päpstlichen Dokumenten zufolge die Wichtigkeit des Dialogs mit den Wissenschaf-
ten und die nötige Präsenz der Theologie an der Universitäten betont, aber bei Umstrukturierun-
gen im universitären Bereich sind die kirchlichen Entscheidungsträger (lokal wie in Rom) eher
zurückhaltend. Nur in solchen Länder werden in der Tat enge Beziehungen zwischen Theologie
und staatliche Universität befürwortet, wo man einen sicheren katholischen Hintergrund vermu-
tet. In Polen und in Kroatien sind die theologischen Fakultäten innerhalb der staatlichen Univer-
sitäten, dagegen werden in der ehemaligen DDR und in Ungarn solche Bemühungen blockiert.
Die Theologische Hochschule in Erfurt scheint allerdings nach vielen kirchenpolitischen Mühsa-
len zu einer theologischen Fakultät im universitären Verbund zu werden.
Die sichere Förderung der Theologie ist eine unersetzbare Bedingung der kirchlichen Erneuerung
in Gesellschaften, die von umfassender gesellschaftlicher Umstrukturierung und durch starken
kulturellen Wandel gezeichnet sind. Mutatis mutandis können die Kirchenleitungen dieser Län-
der und auch in Rom für ihre Optionen treffende Modelle aus der Kirchengeschichte der Neuzeit
holen: Gegenreformation und Antimodernismus. Diese zwei kirchlichen Strategien werden heute
allseits kritisch beurteilt und auch immer nuancierter betrachtet. Ein gemeinsames Grundmotiv
der Strategie der Gegenreformation und des Antimodernismus war die Einsicht: Wenn die
„Welt“ sich radikal ändert – vor allem wenn diese Änderungen für die Kirche höchst problema-
tisch sind –, dann muss die intellektuelle Kraft der Kirche, müssen also Philosophie und Theolo-
gie dieser Wandlung standhalten. Viele theologische Stätten in Europa verdanken ihre heutige
Stärke gerade dieser ehemaligen Strategie. Eine Reihe von Fakultäten, Forschungen, Lexika und
Einsichten sind auf Grund dieser Einsicht entstanden, ohne welche die heutige Kirche und Theo-
logie ärmer und der kulturellen Strömungen wehrloser ausgeliefert wären.
Die heutige kulturelle Lage in Ost(Mittel)Europa fordert gerade eine starke und betont kontextu-
elle Theologie, die zur Wahrnehmung der heutigen Kultur fähig ist und die Bereitschaft besitzt,
den kulturellen „Nöten und Ängsten der Menschen“ entsprechenden intellektuellen Beistand zu
leisten. Die „alte“ Theologie ist nicht generell als untauglich zu verwerfen, sie hat „nur“ ihre
122
Plausibilität verloren. Sollten die Bedingungen der theologischen Arbeit nicht grundlegend ver-
bessert werden, dann verurteilt sich die Kirche zur Unfähigkeit zum Dialog mit dieser konkreten
Welt und untergräbt so auch die Möglichkeit ihrer eigenen Verkündigung. Die von Paul VI. in
Evangelii nuntiandi 1975 beklagte Kluft zwischen Evangelium und Kultur wird sich vergrößern.
Modern
Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem Wertesystem in West und in Ost, wie von
einer ungarischen Autorengruppe – geleitet von Elemér Hankiss – anhand Europäischer Werte-
studien bereits in den Achtzigerjahren gezeigt wurde.178 Für eine Theologie der Zweiten Welt ist
es nützlich, für die kirchliche Pastoral einen Einblick in jene Werte zu ermöglichen, welche die
Haltung der OsteuropäerInnen je nach Land mehr oder weniger bestimmen. Ohne diese Einsicht
ist eine situationsgerechte Pastoralplanung und eine den Menschen dienende Kirche unmöglich.
Es ist weiterhin zu prüfen, welche Repräsentanz diese für Ungarn und für die Achtzigerjahre
formulierten Forschungsergebnisse heute für die ganze ost(mittel)europäische Region besitzen.
Diese Prüfung würde freilich den Rahmen unserer Arbeit und ihrer Zielsetzung sprengen.
Zwischen 1977 und 1982 haben Hankiss und andere mit Hilfe von empirischen wertsoziologi-
schen Methoden eine Antwort auf die Frage gesucht, wie sich Wertebewusstsein und Wertord-
nung der ungarischen Gesellschaft in den letzten vier bis fünf Jahrzehnten formte. Die Ergebnis-
se, die teils auch auf andere osteuropäische Gesellschaften zutreffen, forderten eine Differenzie-
rung des Weberischen Begriffs der Modernisierung. Der westeuropäische Typ dieser Modernisie-
rung baut auf Zielrationalität, auf die am Markt orientierte, unternehmerisch-individuelle Ratio-
nalität. Dagegen aber baut die osteuropäische Modernisierung auf die zentralisierende Planratio-
nalität. Beide Prozesse darf man Modernisierung nennen, da beide die jeweiligen Gesellschaften
aus den feudalen und spätfeudalen Verhältnissen herausgebracht und eine entsprechende Mobili-
tät und Infrastruktur ausgebaut haben. Der wesentliche Unterschied liegt aber darin, dass in Ost-
europa (jetzt geographisch und nicht nur politisch gemeint) im 16. und 17. Jahrhundert der all-
gemeine Prozess der Verbürgerlichung zum Stillstand kam und in dieser Subregion keine bürger-
lich-kapitalistische Wirtschaft und Gesellschaftsordnung hervorbringen vermochte. Seit dem 19.
Jahrhundert versuchten hier Zentralregierungen eine solche Entwicklung zu starten, allerdings
mit wenig Erfolg. Dieses Erbe bestimmte die neuen Machthaber nach dem Zweiten Weltkrieg,
die durch die schon gekannte gewaltige Mobilisierung und Planwirtschaft den Totalanspruch des
Staates gegenüber der Gesellschaft und der Einzelnen dermaßen ausgedehnt hat, dass es zu einem
völligen Gegensatz zur Weberischen Zielrationalität gekommen ist.179
178 Hankiss u.a., Kényszerpályán. 179 A. a. O. 275-287.
123
Die Situation ist natürlich nicht in Entweder-Oder-Kategorien zu fassen. Während der Dominanz
der negativen, osteuropäischen Modernisierung bemerkt man Perioden und Züge einer der We-
berschen Konzeption entsprechenden Modernisierung. Nach einer eingehenden vergleichenden
Untersuchung kommen die Autoren zur folgender Zusammenfassung: „Was die Werte und Hal-
tungen betrifft, ist der Prozess der Modernisierung in einigen Punkten, wie Säkularisation, Intel-
lektualisierung und die Liquidierung der traditionellen Gemeinschaften bei uns weit vorange-
kommen. Auf anderen Ebenen, wie z.B. bei der Wertschätzung des Individuums, hinsichtlich des
Individualismus, der autonomen Persönlichkeit oder bei der Entwicklung der pragmatischen-
zielrationalen Haltung haben wir einen enormen Nachholbedarf gemessen an den westeuropäi-
schen Gesellschaften.“180
Im Vergleich zur selben Entwicklung in den USA schreiben die Autoren: „Es ist eine Divergenz
zu beobachten zwischen dem Wertewandel der ungarischen und der amerikanischen Gesellschaft,
der genau die Wirtschaftsentwicklung der beiden Gesellschaften widerspiegelt. Klar zeigt sich in
den Untersuchungen, dass in Amerika in den letzten 4-5 Jahrzehnten die traditionellen Moderni-
sierungstendenzen langsamer geworden sind und bei der jüngsten Generationen schon eine
„Postmodernisierung“ der Wertskala im Gange ist. Mit anderen Worten: Neben den bürgerlichen
Werten des zwanzigsten Jahrhunderts, wie zielrationale und pragmatische Handlung, sowie den
Werten des eigenständigen, autonomen Individuums, verstärken sich die Werte wie Gefühl, Ge-
meinschaft und Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit.
Der Weg des Wertebewusstseins der ungarischen Gesellschaft ist anders verlaufen. Anstelle der
Weberschen westeuropäischen Modernisierung spielte sich hier im 19. und 20. Jahrhundert eine
wesentlich unbedeutenderer und uneigentlicher Modernisierungsprozess ab. Die zielrationalen
und pragmatischen Handlungen, bzw. die Werte der Autonomie der Einzelnen, waren nicht so
dominierend wie im Westen. Die Tatsache der Unterwerfung unter eine zentralistische Macht
besiegelte diese Entwicklung. Die großen wirtschaftlichen und politischen Veränderungen nach
dem Zweiten Weltkrieg demobilisierten von einem Augenblick auf den anderem die traditionel-
len Gefühls- und Gemeinschaftswerte und öffneten dadurch den Weg für ein Prozess, den wir
negative oder leere Modernisierung genannt haben. Sie öffneten den Weg für einen reflexartigen
und schroffen Individualismus, der ohne Weltsicht, Tradition und Kultur nur auf die Anhäufung
der materiellen Werte und auf Überleben ausgerichtet ist.“
Obwohl der Wertewandel stark den Entwicklungen von Wirtschaft und Gesellschaft unterworfen
ist und diesen zugleich mitformt, kann man abgesehen davon auch Tendenzen aufdecken, welche
gegen diese negative Modernisierung wirken. Hankiss hat dafür folgende Aufgaben beschrieben:
180 A. a. O., 331f.
124
„1. Die negativen Modernisierungstendenzen bremsen. Also: a.) die traditionellen gemeinschaft-
liche Werte unter Schutz nehmen gegen eine weitere Verwüstung; die alltäglichem Zusammenle-
ben dienenden Werte und Normen stärken. b.) Mit allen Kräften die weitere Atomisierung der
Gesellschaft und die Verstärkung des leeren und wilden Individualismus zu bremsen.
2. Die auch heute unerlässlichen Werte der Weberischen-westlichen Modernisierung stärken.
Also: a.) die pragmatischen und zielrationalen Werte eines effektiven und verantwortungsbe-
wussten Handelns verstärken. b.) Die Werte des menschlichen Selbstbewusstseins und der Auto-
nomie kräftigen.
3. Aus der osteuropäischen Modernisation die negative Züge ausmerzen und die positiven ver-
stärken. Also: a.) Die persönlichkeitsschädigen und gemeinschaftszerstörenden, anomischen
Wirkungen, die eine Untertanenbewusstsein sozialisieren, neutralisieren; b.) Die Werte der
Seinssicherheit, der gesellschaftlichen Gleichheit und Gerechtigkeit verstärken und mit wahrhaf-
tigen Inhalte füllen.
4. Die Entwicklung des postmodernisierenden Prozesses in Bewegung bringen. Also: a.) Werte
stärken, welche der Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit dienen; b.) Die Werte der
Entwicklung der Gemeinschaftlichkeit kräftigen; c.) Jene Werte fördern, die eine gerechte und
wahrhaftige gesellschaftliche Solidarität unterstützen.“181
Diese Appelle von Hankiss gehören eng zu den Ausgangspunkten einer kontextgerechten Theo-
logie und Pastoralplanung. Wenn den Kirchen (auch) in diesen ostmitteleuropäischen Länder
eine Funktion der Stabilisierung der kulturellen und moralischen Grundwerte, wie Solidarität,
Achtung des Lebens usw. zukommen soll, was unter der Parole „für eine Seele Europas“ bekannt
ist, dann haben die oben kurz dargestellten Optionen eine bleibende und aktuelle Bedeutung.
SPRACHE UND MACHT
Sprache182 vermittelt nicht nur Inhalte, sondern vor allem eine Kultur. „Sprache ist ein struktu-
rierter Handlungsbereich; Sprechen ist regelgeleitetes Handeln... Wieweit die Gestalt einer Mit-
teilung ohne Bedeutungsverlust geändert werden kann (so dass man dann sagen mag, man bringe
denselben Inhalt in eine andere Form), ist eine nachgeordnete Frage. Primär stehen Sprachformen
den einzelnen Sprechakten gegenüber, die überhaupt nur durch übergreifende Ordnungsmuster
verständlich werden können.“183
181 A. a. O., 377f. 182 Die Problematik der neueren Sprachphilosophie und Hermeneutik faßt aus fundamentaltheologischem Gesichts-
punkt David Tracy knapp zusammen in: ders., Theologie. Besonders Kap. 3. Radikale Pluralität. Das Problem der Sprache, 73-97.
183 NHthG, V 76.
125
Bezüglich des Stils der öffentlichen Machausübung gibt es eine greifbare Differenz zwischen
Autokratie und Demokratie. Der autokratische Stil der Machtausübung betont alltäglich die
Überlegenheit, die Ferne von den Untertanen; die Äußerungen sind überwiegend formal und die
ständigen Wiederholungen spielen eine zentrale Rolle. Durch diesen Stil wird die Zweiteilung
der Gesellschaft, die Unabänderlichkeit der Strukturen und Verhältnisse sowie die unauflösbare
Einheit der Macht demonstriert und eingeprägt. Die politische Macht in der Autokratie ist über
die Menschen, die in der Demokratie neben ihnen.184
Die teils traditionellen, teils (halb)modernisierten Gesellschaften von Ost(Mittel)Europa und ihre
Öffentlichkeit wurde von der ideologisch aufgeladenen Sowjetmacht und von ihren auch sprach-
lich vermittelten Wissensmustern überlagert. Alles, was in der Öffentlichkeit gesagt werden durf-
te und konnte, war der Totalkontrolle untergeordnet. Diese totalitäre Prägung des öffentlichen
Diskurses, dieser ideologische Sprachterror, hat autonome Aussagen in der Öffentlichkeit nicht
zugelassen. Die Menschen in diesen Gesellschaften hatten selbstverständlich auch ihre eigene
Meinung über die politischen Verhältnisse ihres Landes, aber sie hatten keine Möglichkeit, in der
öffentlichen Sprachsphäre diesen Gedanken Ausdruck zu verleihen. Sie hatten eine Privatspra-
che185, aber kein Sprachmittel für die Diskussion über die gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Die öffentliche Sprache war in der „ägyptischen Gefangenschaft“, also in der Epoche der direk-
ten kommunistischen Unterdrückung, durch eine starke Dichotomie, Binalität oder Bipolarität
gekennzeichnet. Gut und Böse, Ost und West, Kapitalismus und Kommunismus standen unver-
einbar gegeneinander. Die öffentlichen Nachrichten und Kommentare waren in ihrer Dramaturgie
den Volksmärchen ähnlich: der große aber böse König wird von dem kleinen aber guten Prinzen
erobert. In den späteren Jahren versuchten die Ideologen des Apparats die positiven Eigenschaf-
ten der kleineren Gemeinschaften in der Gesellschaft zu preisen, um die unaufhaltbare positive
Entwicklung des Sozialismus an Beispielen des alltäglichen Arbeits– und Familienlebens zu
demonstrieren. Gesellschaftskritische Stimmen findet man eher erst in den Achtzigerjahren, wo
innere Probleme z.B. der Produktion betrachtet werden. Diese Kritiken treffen aber in dieser Zeit
nie die Strukturprobleme des Systems, sondern wurden als im Rahmen des Systems behandelbare
Schwierigkeiten betrachtet.
In dieser späteren Zeit des sozialistischen Systems – die ich gerne „babylonische Gefangen-
schaft“ nenne – entwickelt sich zwischen der politisch stark kontrollierten öffentlichen Sprach-
ebene und der Ebene der Privatsprache eine Zwischenebene der Öffentlichkeit. Die öffentlich-
legitimen Strukturen dieser Zwischenebene sind (noch) nicht gegeben. Trotzdem kursieren politi-
sche Meinungen in den Familien, in Kollegenkreisen, Fachgruppen und vor allem in den selbst-
184 Vgl. Laswell, Language of Politics. 185 Kuczi, Szociológia. Vor allem im Kapitel über die „Privatsprache, Ideologie und Gesellschaftswissenschaften“.
126
gebastelten Medien der zweiten Öffentlichkeit – Samisdat genannt. Diese Öffentlichkeit ist ein
Produkt dieser Region und ist von der Zivilebene der bürgerlichen Gesellschaften darin verschie-
den, dass dort auch in der offiziellen Öffentlichkeit die autonome, das ganze System hinterfra-
gende Kritik vorhanden ist und diese Zwischenebene eine Vorstufe zu der „ersten“ Öffentlichkeit
darstellt.
Es ist sinnvoll bei der Suche einer regionalen Identität nach Schlüsselwörtern Ausschau halten,
die in allen Länder des Region verwendet wurden und zur narrativen Identität (Ricoeur) der Ge-
sellschaften und der Bürger beigetragen haben. Bei einer so verwirrenden Sprachpluralität spielte
die russische Sprache eine wichtige Rolle. In allen Schularten müsste jeder als Pflichtfach Rus-
sisch lernen. In Ungarn z.B. hat man mindestens 10 Jahre bis zum jeden Diplom Russisch ler-
nen – an der Universität sogar auch ein Pflichtrigorosum ablegen müssen. Politiker und Diploma-
ten verhandelten innerhalb des Warschauer Paktes ausschließlich russisch.
Hier haben wir nicht die Aufgabe, die spezielle Art und Weise dieser russischen Sprache zu ana-
lysieren. Dennoch ist es für unsere Gedankenführung wichtig zu vermerken, dass diese russische
Sprache eine Art Parteisprache der KPdSU gewesen ist, die ziemlich weit von der Sprache eines
Dostojewskis, Tolstojs oder Puskins entfernt war.
Durch diese allgemeine Schulung und Verwendung der Sprache der „großen Sowjetunion“ wurde
eine politische und eine kulturelle Einheit erzielt. Zwar findet man wenige Hinweise auf das La-
tein (das als klerikale Sprache des kapitalistisch gedeuteten Vatikans gerade durch die russische
abgelöst wurde). Dennoch scheint es mir klar zu sein, dass die russische Sprache in ähnlicher
Weise die „Weltmacht“ im Ostblock repräsentierte wie das Latein die Weltmacht des Römischen
Kaisers deutscher Nation.
Das Verhältnis zur Sprache unter den Schüler und Studenten war auch ein Ausdruck ihrer politi-
schen Einstellung zum ganzen System, die sie vor allem durch ihre Eltern überkommen haben.
Russisch nicht zu lernen, obwohl es eine Pflichtfach war, bedeutete Opposition zum System.
Russisch als Diplomfach zu wählen, erhöhte die Karierchancen. Deutsch und Englisch – vor
allem in Privatunterricht – zu lernen hatte immer eine politischer Brisanz in sich.
Nicht nur die Schüler, sondern auch die Pädagogen hatten ein geteiltes Verhältnis zu dieser Spra-
che. Sie genossen Privilegien: z.B. während ihres Studiums ein halbes Jahr in der Sowjetunion
verbringen zu können. Weil dieses Fach für alle Pflicht war, waren die Lehrenden immer mit
Stunden ausgelastet. Viele unter ihnen konnten sogar durch viele Übersetzungsarbeiten zusätzli-
ches Geld verdienen. Andere – vor allem die ältere Lehrerinnen und Lehrer – haben Russisch
nachstudiert, um ihre Pädagogenstelle behalten zu können. Sie blieben dann zwar innerlich von
den mitgelieferten politischen Inhalten distanziert und darum versuchten deshalb lieber die klas-
sische Seite dieser Sprache den Schülern und Studenten beizubringen.
127
Die schulischen Sprachbücher haben nahezu ausschließlich die kommunistische Propaganda als
Lernmaterial benutzt. Majakowski z.B. konnte so wesentlich bekannter werden als Bulgakow.
Das enge Verhältnis von Sprache und politischer Optionen weichte sich im Laufe dieser vierzig-
jährigen Epoche auf. Wie die kommunistische (leninistisch-stalinistische) Ideologie immer
schwächer wurde, so verlor auch die russische Sprache in den Satellitenländern langsam ihre
politischen Dimensionen. Neben dieser Entwicklung konnte man aber noch einen weiteren Vor-
gang zu beobachten: Zentralbegriffe der ideologisch überlasteten Sprache haben in der alltägli-
chen Muttersprache eine Heimat gefunden. Selbst Menschen, die kaum Russisch konnten, ver-
wendeten im Alltag russische Ausdrücke, deren originellen Inhalt sie nie richtig kennengelernt
haben. Alle diese Importbegriffe haben auf dieser Ebene einen negativen Beiklang bekommen,
dem ursprünglichen ideologischen Inhalt gegenüber einen oppositionellen. Diese sprachliche
Wende ist geeignet zu der Beschreibung einer kulturellen Auflösung der totalitären Macht der
Sowjetunion und zu der Darstellung der Entwicklung der Autonomie in den Satellitenländer.
Nach dem politischen Wechsel zeigt das halb ernste, halb witzige Benutzen der ehemals wichtig-
sten ideologischen Grundbegriffe auch die immer größere geschichtliche und politische Distanz,
zugleich aber auch das hartnäckige Weiterleben der damaligen Erfahrungen. Eine Analyse der
Inhalte und der Rolle dieser Begriffe in der heutigen Sprache ermöglicht eine tiefere Sicht der
heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit der Region und sie bietet der theologischen Reflexion
Anhaltspunkte für eine kontextuell kritischen Begriffsauswahl. Diese Möglichkeiten werden an
zwei Fallbeispielen gezeigt. Versucht wird eine politisch–theologische Fingerübung zu den zwei
sowjetrussischen Begriffen „towarisch“ (Genosse) und „prawda“ (Wahrheit).
Fallbeispiele
Towarisch
Der Begriff „Towarisch“186 hat eine lange vorkommunistische Vorgeschichte. Die kommunisti-
sche Macht hat diesen Begriff für ihre Zwecke durch die starke Einschränkung des Bedeutun-
gumfeldes instrumentalisiert. Mit dem Begriff bezeichnete man die Parteimitglieder der Kommu-
nistischen und später der Sozialistischen Partei. Towarisch zu sein bedeutete eine lückenlose
Loyalität gegenüber der Partei und eine entschlossene Bereitschaft, in ihren Aktionen teilzuneh-
men. In der stalinistischen Zeit versuchten die Parteiideologen aus dieser Bezeichnung eine Eh-
renbezeichnung zu machen. Towarisch sollte demnach etwas Elitäres im Proletariat bedeuten.
Nicht alle sind Towarischi im eminenten Sinne des Wortes, sondern nur die Besten, die Enga-
186 Für die Ausführungen über die russische Sprache sowie für die sprachpolitischen Analysen der weiter unter betrach-teten Begriffe schulde ich meinen Kollegen Prof. Szergely Tóth (Szeged) Dank.
128
giertesten. Später aber mit der immer breiteren Verwendung dieses Begriffs vermochte man die
Unterteilung Genosse–Nicht-Genosse nicht mehr korrekt verwenden, darum mussten die Ideolo-
gen ein Attribut zu dem Wurzelbegriff hinzunehmen: Man unterschied nunmehr „gute“ oder
„schlechte“ Towarischi. Mit dieser Differenzierung zeigte sich die langsame Auflösung der inne-
ren gedanklichen und disziplinären Einheit der Partei. Die starke Differenz zwischen der Welten
in und außer der Partei wurde schwächer, so dass eine Trichotomie entstand: in der Partei die
guten und schlechten Genossen und die Nichtmitglieder, die gar nicht Genossen sind. Parallel mit
der parteiinternen Zweiteilung kam auch eine parteiexterne Zweiteilung zustande. Auch die
Nichtmitglieder (Nichtgenossen) wurden auch in zwei Gruppen gegliedert: in die loyale und die
illoyale Gruppe. Die Parole: „Wer nicht für uns ist, der ist gegen uns“ wurde langsam umgestellt:
„Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns“.
In dieser späteren Phase der sozialistischen Zeit, als die ideologische Aufladung des Begriffs
„Towarisch“ schwächer wurde, begann der Begriff einen gesellschaftliches Inhalt zu bekommen.
Wenn in einer Werkstatt ein Monteur seine Kollegen mit „Towarisch“ angesprochen hat, dann
meinte er damit nicht mehr auf ihre ideologische Einheit, sondern die arbeitende, kollegiale,
schicksalteilende Gemeinschaft der Werstattskollegen. Langsam wußten sie alle, dass vielleich
keiner unter ihnen ein „richtiger Towarisch“ im ursprünglichen Sinne des Wortes ist. Aber sie
bezogen sich mit dieser Bezeichnung auf die gemeinsame Arbeit, auf die Kollegialität, auf die
alltägliche Einheit ihrer Gruppe.
Die Interaktion zwischen Sprache und Wirklichkeit zeigte im Fall von „Towarisch“ die langsame
Entwicklung einer nicht total durchpolitisierten Sphäre der Alltagswelt, wo das Übergang von der
Totalkontrolle hin zur Freiheit der kleinen Kreise gut zu beobachten ist. Ältere Bürger der Region
verwenden den Begriff „Towarisch“ immer noch. Für manche unter ihnen sind die negativen
Beiklänge diese Wortes vorbei, aber der Begriff erinnert sie an Zeiten, wo sie in ihrem Alltagsle-
ben in ein Sozialsystem eingebunden waren, eine soziale Welt durchschaut haben und auch sich
selber mehr oder weniger verstanden haben. Towarisch ist heute ein liebes-nettes Wort gewor-
den, mit überwiegend positiven Inhalten – als Erinnerung eben.
Als die Partei der ungarischen Demokraten im Jahr 1990 ihren ersten freie Wahlkampf in Ungarn
geführt haben, haben sie ein Wahlplakat benutzt mit der Aufschrift: „Towarischi konjez“ (es ist
zu Ende, Genossen). Auf dem Plakat war der Hinterkopf eines russischen Soldats zu sehen. Mit
diesem Plakat spielte die Partei auf die ausschließlich negativen Emotionen der Wähler an.187 Im
Wahlkampf wollten sie durch die eindeutige Distanzierung von der von „Towarischi“ beherrsch-
ten Öffentlichkeit Wählerstimmen gewinnen. Die am Plakat gezeigten Genossen hatten im Jahr
187 Es wird erzählt, dass dieser Plakat einen sehr hohen Kurs unter russischen Intellektuellen in Moskau genoß. Sie wollten damit zeigen, dass auch Sie von der Sowjetmacht genug hatten.
129
1991 tatsächlich das Land verlassen. Vielleicht ist zur gleichen Zeit auch eine Kultur der Zu-
sammengehörigkeit aus den postsozialistischen Gesellschaften ausgewandert. Man beobachte
nur, wie versucht wird, die politischen Initiativen, die Wirklichkeits– und Sprachlücken, welche
mit dem Begriff „Towarisch“ verschwunden sind, mit Begriffen aus einer anderen Wirklichkeit –
vor allem „Nation“ und „Bürger“ – zu füllen.
Für die theologische Reflexion bietet die Reflexion auf den Begriff „Towarisch“ eine ausge-
zeichnete Lektion. Lange Zeit verstand sich die katholische Kirche als eine gesellschaftliche
Heilsgröße, die Gesellschaft der Erlösten. Außerhalb von ihr sah sie die „Welt“, die massa dam-
nata – eine Masse der Verdammten. Besonders in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg ver-
suchte die katholische Kirche, den säkularisierenden Gefahren der Moderne mit einem starken
antimondernistischen Kurs entgegenzuwirken. Sie benutzte dafür die neoscholastische Theologie,
die kulturell starken der Vereine sowie der Massendemonstrationen. Sie wollte mit ungeheuren
Anstrengungen zum alter ego des Staates werden. Alle Institutionen und Dimensionen des mo-
dernen Staates sollten in der Kirche und durch sie kopiert werden. Eine symmetrische Affinität
wurde erreicht. Dieser Millieukatholizismus (Karl Galbriel) zerteilte die Gesellschaft. Die immer
noch fast zu 100% getauften Bürger gehörten für sie in zwei Kategorien: insider und outsider,
gläubige (Christen, Katholiken) und nichtgläubige (Atheisten und manchmal Juden).
Je nach den (kirchen)geschichtlichen Traditionen des jeweiligen Landes löste sich dieses Millieu
langsam auf. Die Kirche musste von nun an feiner zwischen den verschiedenen Kategorien von
Menschen unterscheiden. Auch die Pastoraltheologie bediente sich der Distinktion: praktizieren-
de und nicht-praktizierende Gläubige (oder Katholiken) und parallel dazu gutwillige Menschen
und Atheisten. In dieser Zeit der beginnenden Auflösung des Blockkatholizismus suchte das
totalitäre atheistisch-kirchenfeindliche System diese Länder heim und verhinderte den Prozess
einer weiteren gesellschaftlichen Nuancierung. Die Kirche musste wieder Klarheit schaffen bis
hin zu einm einfachen Entweder-Oder. Zu ihrer Selbstverteidigung musste sie klare Entscheidun-
gen treffen, klare Beschlüsse verabschieden und die Linie zwischen Freunden und Feinden klar
ziehen.
In dieser Zeit der totalen Unterdrückung war es ein Risiko, sich „katholisch“, „Christ“ oder
„gläubig“ zu nennen. Kinder wurden in der Schulen vor ihrer Klassenkameraden gefragt, ob sie
gläubig sind. „Ja“ zu antworten bedeutete ausgelacht, aus gut verdienten Belohnungen ausge-
schlossen und zu einem Kreis der Rückständigen, Altmodischen und Gefährlichen gerechnet zu
werden. „Gläubig“ war ein beiderseits ideologisch hochgeladener Begriff in einer stark bipolaren
Gesellschaft.
Die ständige Aufweichung dieser Bipolarität ermöglichte es der Kirche, die durch öffentliche
Gewalt verhinderte Autonomie in der Betrachtung der gesellschaftlichen Wirklichkeit Schritt für
130
Schritt aufzunehmen und langsam einzuüben. Man begann vorsichtiger mit der Bezeichnung
„Gläubige“ umzugehen Man fühlte sich berechtigt, die Grenzen zwischen Kirche und Nicht-
Kirche laxer aufzufassen. Die Selbstbezeichnung der Menschen lockerte sich gleichfalls auf: Ab
Mitte der Siebzigerjahren haben sich bei der Meinungsumfragen immer mehr Menschen als
„gläubig nach eigener Art“ eingestuft. In kirchlichen Kreisen war es immer mehr möglich, auch
mit nicht ganz entschlossenem und ausgeprägtem Glaube ein Zuhause zu finden. Die kirchlichen
Gymnasien nahmen Kinder von atheistischen Parteimitgliedern auf, in kirchlichen Chören spielte
die gute Stimme eine ausschlaggebende Rolle und nicht mehr die standfeste Katholizität. Die
kirchlichen Gruppen der sogenannten „zweiten Öffentlichkeit“ waren immer mehr offen für die
„Suchenden“. Eine theologische Legitimierung dieser Öffnung lieferte der aus dem ursprüngli-
chen Kontext gerissene, falsch verstandene und inkorrekt benutzte Begriff des „anonymen
Christ“ von Karl Rahner. Trotz des theologischen Mißverständnisses drückte dieser Begriff die
reale Situation präzis aus. Auch die Kirche konnte sagen: „Wer nicht gegen uns ist, ist für uns“.
Die einen sind praktizierende Christen, die anderen nicht. Aber selbst die gutwilligen Atheisten
sind irgendwie „Christen“ –wenn auch anonym.
Dieser Begriffswandel drückte den Wandel der Kirche aus: Gemeinschaftlichkeit und Überleben
zählten mehr als das pure Bekenntnis; die Aufrechterhaltung eines praktischen Dialogs mit allen
Menschen mehr als die starke Betonung der eigenen Identität; die gemeinsame Suche nach mehr
Menschlichkeit und mehr Werten war wichtiger als die Provokation der Exklusivität des christli-
chen Heilsangebotes. Die Härte der Begriffswahl gehörte nunmehr den ganz traditionellen oder
enorm fortschrittlichen Kreisen an. Ansonsten benutzte man die weniger polarisierten Begriffe.
Die Wende hatte die Kirche überrascht. Sie musste rasch nach einen angemessenen Identität
suchen. Es galt, sich in den neuen Verhältnissen neu zu behaupten, wobei sie ziemlich wortkarg
erschien. Die Anwendung und Neubewertung der Erfahrungen der gerade verlassenen Zeit ge-
lang ihr kaum, sie griff daher sicherheitshalber zu Denksystemen der Vorkriegszeit zurück – und
damit auch zu ihrem vertrauten Wortschatz. Der Begriff „gläubig“ oder „Christ“ wurde über
Nacht in vieler Munde mit ethischen Nebenklängen aufgefüllt. Man redete über „richtige Chri-
sten“, „anständige Gläubige“ und über die, die nur der neuen politischen Mode wegen die Kirche
besuchen. Die Kirche wollte verständlicherweise mehr Klarheit und Autonomie schaffen; eindeu-
tiger sehen, mit wem sie in einer neuen Periode der Freiheit rechnen kann. Die Kriterien änderten
sich: nicht mehr Offenheit und Dialogbereitschaft gaben den Ton an, sondern immer mehr Klar-
heit und Forderungen.
Durch ein solches Vorgehen entzweite sich aber die Kirche immer mehr. Die einen waren mehr
für die nüchterne Weiterentwicklung der vorigen Jahrzehnte, die anderen dagegen verneinten
entschlossen die „Zwangsbahn“ des real existierten Sozialismus und waren fast zu keinerlei
Kompromissen bereit. Die gesellschaftlichen und sprachlichen Rahmenbedingungen eines losen
131
Zusammenhalts sind mit der Wende Vergangenheit geworden. Die Kirche steht vor der Aufgabe,
mit neuen Strukturen, Inhalten und Begriffen ihr gesellschaftliches Angebot zu formulieren. Sie
muss auf ihren Pilgerweg in der modernen Gesellschaft riskieren, aus ihrer Armut Kraft des
Glaubens schöpfen.
Prawda
Prawda ist die Wahrheit der Partei, woran geglaubt werden soll. In der Alltagssprache bedeutete
Prawda die Alltagswahrheiten: „Du hast recht“, „Es ist wahr“ usw. Für Wahrheit gibt es im Rus-
sischen noch den Begriff „istina“. Das bedeutet Wahrheit in einem höheren, enthobenen Grad,
„Wahrheit“ etwas philosophischer als die Prawda. Für die Erklärung einer Prawda braucht man
Istina, aber nicht umgekehrt. Prawda ist die Grundstufe von Wahrheit, Istina die obere oder ober-
ste Stufe. Zu Prawda gibt es viele Sprichwörter, zu Istina keines.
In der Sowjetunion bezeichnete Prawda die offizielle Zeitung der KPdSU.188 Die Prawda war
eigentlich keine richtige Tageszeitung, wo Nachrichten, Vorgänge dargestellt und kommentiert
wurden. Es wurden in ihr nicht Diskussionen der Gesellschaft medial vermittelt. Prawda ent-
sprach eher der Vorstellung eines Parteianzeigers oder eines Verordnungsblattes. In der Prawda
gab es daher nur Berichte über die Parteiaktivitäten, in ihr wurden die Beschlüsse der Partei be-
kannt gemacht. Selbst Scheindiskussionen durften in der Prawda nicht vorkommen, so eindeutig
und wichtig war es, die ungebrochene Einheit der Partei zu demonstrieren.
Neben der Prawda kontrollierte die Kommunistische Partei alle andere Zeitungen, wie auch sonst
die ganze Öffentlichkeit. Alle andere Zeitungen mussten die Prawda als Richtlinie bei der Redak-
tion berücksichtigen. In ihrer Form aber konnten vor allem die regionalen Zeitungen (die oft in
größerer Auflagenhöhe erschienen als die Prawda) von der Art eines Mitteilungsblattes abwei-
chen und versuchen, die Parteiwahrheit in menschlich näherer Art und Weise zu „verkaufen“.
Diese Art von Wahrheitsbegriff gehört eng zu der Naturkunde der totalitären Macht. Wahrheiten,
die auf die Basis der eigenen Erfahrungen aufgestellt werden, sollten jener Wahrheit weichen, die
auf Grund der Interessen der Machtinhaber verkündet werden. In den „klassischen“ totalitären
Systemen (Hitlerismus, Stalinismus) ist die Parteiwahrheit dermaßen betont, dass selbst die in-
nigsten und loyalsten Mitarbeiter des Zentralkomitees kein Recht auf Kritik bekommen haben.
Aussagen der allmächtigen ersten Parteisekretäre galten als Dogmen, woran zu glauben für ein
Überleben in dem System die einzige Möglichkeit war. Wer von dieser Prawda abwich, der
musste öffentliche Buße halten, Selbstkritik üben und war vollkommen der Gericht der Parteilei-
188 In allen Satellitenländern hatte jede Kommunistische Partei ein Organ von dieser Art, in Ungarn z.B. Nepszabadsag („Volksfreiheit“).
132
tung ausgeliefert. Ganze Institute kontrollierten die „Lage der Wahrheit“ in diesen Ländern und
zeigten gnadenlos alle an, die andere als die offizielle Meinung vertreten haben.
Diese Rolle der Prawda in dem Machtarsenal der Kommunisten entwickelte einerseits eine kritik-
lose Untertanenloyalität in den Menschen. Andererseits machte sie durch mehrere Generationen
hindurch vollkommen unfähig zu eigener Meinungsbildung und Meinungsvertretung.
Theologische Reflexionen
Für eine theologische Reflexion über das Verhältnis der Parteiwahrheit und der Wahrheit der
Kirche fasst Hans Michael Baumgartner die Geschichte des Wahrheitsproblems in philosophi-
scher Perspektive wie folgt zusammen: „Die Wahrheitsgarantie menschlichen Erkennens, der
Grund der Identität von Sein und Denken, verschiebt sich von der ideenhaft oder göttlich, in ei-
nem Schöpfungsakt begründeten Seinswirklichkeit zur Selbstgewissheit der Subjektivität und
verschwindet schließlich. Damit verschiebt sich auch die Wahrheitsproblematik vom ontolo-
gisch-logischen Wahrheitsverständnis zu einem Problem der semiotischen sowie der hermeneuti-
schen Sprachanalyse. Die Frage nach der Substanz der Wahrheit und ihrer Möglichkeitsbedin-
gungen wird ersetzt durch die Fragen nach den Kriterien, den Bedingungen, der Relevanz von
Wahrheit. Noch immer freilich wird Wahrheit definiert durch die Übereinstimmung von Sein und
Wissen, Sein und Denken, Wirklichkeit und Sprache, Tatsache und Aussage etc.; aber diese De-
finition, wie präzise sie auch immer entwickelt sein mag, wird nur noch als Namenerklärung der
Wahrheit, als Aufgabe dessen, was wir mit Wahrheit meinen, verstanden. Sie ist bestenfalls Ge-
genstand eines reflektierten Scharfsinns, jedoch nicht mehr ein Thema philosophischer Spekula-
tion. Der Ort der Wahrheitsproblematik ist die Sprache.“189
„Sprachliche Differenzierungen sind unerlässlich, wenn es um die angemessene Erfassung von
Machtphänomenen und Machtansprüchen geht.“190 Zu der kontextuell–theologischen Reflexion
der Begriffs „Prawda“ und seiner Rolle in dem kommunistischen und postkommunistischen Sy-
stem sollen folgende theologische Bereiche bedacht werden:
Interpretationsrecht
Die kirchliche und theologische Rede über die Wahrheit soll sich entschieden distanzieren von
einem exklusiven Interpretationsrecht, die an die exklusive Wahrheitsverkündigung und Wahr-
heitsauslegung des totalitären Systems erinnert. Wahrheitsämter sollen die regionalen Formen
und regionsgerechten Sprachen der Verkündigung und der Theologie forcieren und unterstützen.
Ein Beispiel ist dafür die Rolle des Katechismus der Katholischen Kirche. In der apostolischen
189 NHThG, V 230-241, hier 233. Hervorhebung von mir.
133
Konstitution „Fidei depositum“ zur Veröffentlichung des Weltkatechismus schreibt Papst Johan-
nes Paul II.: „Ich bitte daher die Hirten der Kirche und die Gläubigen, diesen Katechismus im
Geist der Gemeinschaft anzunehmen und ihn sorgfältig bei der Erfüllung ihrer Sendung zu be-
nutzen, wenn sie das Evangelium verkünden und zu einem Leben nach dem Evangelium aufru-
fen. Dieser Katechismus wir ihnen anvertraut, damit er als sicherer und authentischer Bezugstext
für die Darlegung der katholischen Lehre und in besonderer Weise für die Ausarbeitung der örtli-
chen Katechismen dient... Dieser Katechismus ist nicht dazu bestimmt, die von den kirchlichen
Autoritäten, den Diözesanbischöfen und den Bischofskonferenzen vorschriftgemäß approbierten
örtlichen Katechismen zu ersetzen, besonders wenn sie die Approbation des Apostolischen Stuh-
les erhalten haben. Er ist dazu bestimmt, zur Abfassung neuer örtlicher Katechismen zu ermun-
tern und die zu unterstützen, die den verschiedenen Situationen und Kulturen Rechnung tragen,
aber zugleich sorgfältig die Einheit des Glaubens und die Treue zur katholischen Lehre wah-
ren.“191
Die Wahrheit des Evangeliums, die Wahrheit der katholischen Kirche ist keine starre Wahrheit,
sondern ist die immer neu zu entdeckende Quelle des Lebens und der Freiheit. „Dann werdet ihr
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien“ (Joh 8,32). Es wäre also eine
Sackgasse, wenn anstelle der kontextgerechten Formulierungen der christlichen Botschaft (die
Wahrheit zum Leben) die Ortskirchen der Reformländer nur die muttersprachlichen Wiederho-
lungen der lehramtlichen Aussagen als christliche Wahrheit darstellen würden. Das wäre sozusa-
gen ein Prawda-Modell der Verkündigung. Die Diözesansynoden bieten einen angemessenen
Weg der dialogischen Wahrheitsfindung und Wahrheitsformulierung in der Communio der Orts-
kirche. Es ist aber darauf zu achten, durch welche expliziten und/oder impliziten Selektierungen
von Einladungen zur Synode die von der Diözesanleitung bevorzugten Ergebnisse strukturell
vorgesichert werden wollen. Synoden dürfen nicht nur als Einzelaktionen vorgestellt werden,
sondern eher als ein dialogaler Vorgang der Ortskirche.
Kirchliche und theologische Selbstkritik
Die einheimische Theologie muss die Diskussionen über den Wahrheitsbegriff dieser Länder
reflektieren, auch wenn die Wahrheitsinterpretationen materialistischer, atheistischer Prägung
sind. Denn diese haben das Denken der Intellektuellen in den letzten Jahrzehnten bestimmt und
keiner konnte sie sich davon befreien. Kirchliche und theologische Selbstkritik als Bedingung der
wahrhaftigen Verkündigung – Mannheim schreibt in Ideologie und Utopie192 über das sozialisti-
schen Denken: Es hat die Utopien all seiner Gegner als Ideologie enthüllt, aber auf sich selber hat
190 Werbick, Kirche 354. 191 In: Katechismus der Katholischen Kirche, München 1993, Nr.4, 29-35. Hier 34f. Hervorhebung von mir. 192 Im letzten Kapitel über die „heutige Situation“.
134
es diese Einsicht noch nicht angewendet. In der Zeit der totalen oder mäßigen Unterdrückung war
es selbstverständlich, dass die Kirche ihre inneren Konflikte nicht dem Gegner zeigen wollte,
denn dies hätte ihre Schwäche in einer Zeit gezeigt, in der nur die Starken überleben konnten.
Die „demonstrative“ Einheit der Kirche hat Selbstkritik strukturell weder ermöglicht noch gedul-
det. Heute hat die Kirche die Aufgabe die Selbstkritik aufzuwerten, darin einen Weg der reifen-
den Läuterung und nicht einen Weg der Vernichtung zu sehen. Dabei kann sie sich an der selbst-
kritische Vorbereitung des Papstes auf das Dritte Jahrtausend orientieren, wodurch die Glaub-
würdigkeit der Kirche in der modernen Welt verstärkt wird. Selbstkritik besteht nicht nur aus
kritischen Aussagen, sondern auch aus struktureller Ermöglichung der Meinungs- und Praxisplu-
ralität. Diese Pluralität existiert bereits in den Kirchen der Region Ost(Mittel)Europas. Die Lei-
tung dieser Kirche ist dazu aufgerufen, der Pluralität offiziell geschützte Freiheitsräume zu si-
chern. Es ist ein Legitimationsweise zu suchen, die ohne Schädigung der Einheit im Nötigen die
Pluralität im Möglichen fördert. Vor allem in den kirchlichen Medien und Ausbildungsanstalten
wäre es dringend, weniger utopisch und weniger verschönend die realen Zustände der Ortskir-
chen darzustellen. In der von vielerlei Konflikten beladenen gesellschaftlichen Situation kann die
Kirche mit ihrer modellhaften liebevollen Konfliktlösung der Gesellschaft ihr mehr Zeugnis ge-
ben, als mit der demonstrativen Darstellung eines konfliktfreien kirchlichen Milieus. Die Kirche
auf dem Weg ist glaubwürdiger als eine Kirche, die meint am Ziel zu sein.
Es ist immer ein Wagnis, die kirchlichen und theologischen Aussagen auf Grund neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse oder motiviert durch gesellschaftliche Vorgänge neu zu bedenken und
für die Verkündigung und für die theologischen Arbeiten neue Begriffe, Wörter und Sätze zu
suchen. Dabei muss sich die Theologie und müssen die Theologen sich selbst, ihre wissenschaft-
liche und kirchliche Rolle neu zu bedenken. Karl Barth habe gesagt: „Die Engel werden lachen,
wenn sie meine Theologie lesen“.193 Nicht nur die Beschäftigung mit den klassischen Texten des
Christentums und den Offenbarungsquellen, sondern auch die Wahrnehmung der Zeichen der
Zeit fordert, dass man eigene Irrtümer in den traditionellen theologischen Interpretationen fest-
stellt. Eines dieser Irrtümer ist, dass eine Theologie ohne Praxis möglich ist. Eine solche Theolo-
gie wäre eine kritiklose Bejahung der Realität und eine Absage an die eschathologische Perspek-
tive des Christentums. Sich der provokativen Frage der Praxis zu stellen bedeutet keineswegs
eine Abwendung von der Theorie auf hohem Niveau. Gerade umgekehrt, sie befruchtet die theo-
retischen Arbeiten und holt sie aus ihrem wissenschaftlichen Elfenbeinturm aus und befreit sie
von einer elitären Denkhaltung. Diese Befreiung ist u.a. eine wichtige Bedingung dafür, neben
den neueren wissenschaftlichen Erkenntnissen auch die reflektierten Wahrnehmungen der All-
tagsmenschen über die Wirklichkeit ernst nehmen zu können. Diese „Straßentheologien“ haben
193 Zit. Tracy, Theologie 141.
135
für alle akademischen Theologen erhebliche Bedeutung. Gerade in den postsozialistischen Re-
formländern, wo neben allen anderen Arten von Wissenschaften auch die Theologie in hohem
Maße kontrolliert und verhindert war, ist es dringend erforderlich, alle theologieproduktiven
Kräfte der realen Kirche auszuschöpfen. In diesem Prozess ist eine diskursive Theologie194 von-
nöten und auch eine Diskurs fördernde Verkündigung. Wenn die katholische Weltkirche am
Zweiten Vatikanischen Konzil den Dialog in vieler Hinsicht ins Zentrum gestellt hat, dann ist
dieser dialogische Prinzip auch unter den verschiedenen Arten von Theologie anzuwenden. Die-
ser Dialog bedeutet keineswegs eine Forderung des Aufhebens der eigenen Identität. Im Gegen-
teil, er ist eine Förderung zur kommunikativen, dialogischen Identität.195 Ein Dialog zu führen
bedeutet keineswegs die volle und kritiklose Akzeptierung der Einstellung oder der Aussagen des
Partners. Ein ernster Dialog ist gerade von Kritik, Diskussion, Widerstand usw. kennzeichnet.
Ein solcher kritischer Dialog soll auch mit jenen geführt werden, die aus dem Bedrängnis kom-
men, weil eine kritiklose Bejahung der Reflexionen ihrer Erfahrungen sie herabwürdigt. Ihr Lei-
den zu schätzen soll parallel gehen mit ihrer wahrhaftigen Einbindung in den theologischen Dis-
kurs der Region.
Ein noch schwierigerer Schritt im Dialog ist in dieser Region die Wahrnehmung der Erfahrungen
und Ansichten jener, die in der Zeit der Kommunismus und Sozialismus allzu loyal gegenüber
der Macht waren, sogar sich mehr oder weniger auch an der Verfolgung von Christen beteiligt
haben. Sie sind verständlicherweise in der Kirche nicht beliebt, und es wäre ungerecht, der Kir-
che das Recht abzusprechen, sie „Feinde“ oder „Verfolger“ zu nennen. Solche Menschen sind
aber auch Zeitgenossen und Zeugen einer Epoche, die von der Kirche strukturell einseitig erlebt
und erklärt wurde. Gerade die Menschen, die sich mit der Kirche sozusagen von der „anderen
Seite“ her beschäftigt haben, haben eine andere, aber gleichfalls authentische Sicht von der Kir-
che. Viele von ihnen – vor allem die älteren – erlebten in ihrer Biographie Verbindungen und
Entbindungen zu Religion und Kirche, die sich auf ihre (kirchenverfolgerische) Tätigkeit ausge-
wirkt haben. Die lange Zeit der vierzig Jahre hat auch in solchen Menschen innerliche Differen-
zierungen bewirkt, die es ihnen ermöglichen, mit der heutigen Kirche in Dialog zu treten. Ihre
Zeugnisse und Erfahrungen mit der Kirche aus der Analyse der Zeichen der Zeit aus politischer
Gründe dient nur zu Verkürzung der nötigen kirchlichen und theologischen Selbstkritik.
Sprachwunder
Die Analyse der Sprache ist ein gutes Werkzeug zur Analyse der gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Die oben angeführten Beispiele mögen gezeigt zu haben, dass die Kirche der Reformländer durch
194 Nach der Hermeneutik im Sinne von Tracy, Theologie. Allgemein im Sinne des dialogischen Charakters aller Wis-senschaften, insbesondere der Theologie.
195 Vgl. Van der Ven, Kommunikative Identität.
136
die nüchterne Reflexion der Alltagssprache Ansätze und Appelle für ihre eigene Stellung in der
Gesellschaft und für eine kontextgerechte Verkündigung und Theologie gewinnen können. Die
Christen und die kirchlichen Amtsträger kann dabei die Hoffnung motivieren, dass in ihrer Suche
nach einer neuen Identität und nach fruchtbringenden Formen und Strukturen ihrer Sprache der
Heilige Geist seinen Beistand leistet. Diesen Ortskirchen in den Reformländer ist die Chance
gegeben, das Sprachwunder von Pfingsten neu zu erleben und zu einer solchen Art von Evangeli-
sierung zu finden, die den Christen und Nichtchristen ihrer Länder die Erfahrung von einst auch
heute ermöglicht: „Jeder hörte sie in seiner Sprache reden“ (Apg 2,6).
THEOLOGISCHE HERAUSFORDERUNGEN
Die Zeichen der Zeit für eine Region herauszuarbeiten bedarf also feinfühliger Analysen. Neben
den nuancierten Gesellschaftsanalysen soll auch die Theologie dieser Länder nach speziell theo-
logischen Traditionen und methodologischen Hilfsbegriffe Ausschau halten, die einer „theology
after Gulag“ inhaltlich helfen können. Dabei können uns die Erfahrungen bei der Theoriebildung
in neueren Theologien helfen. Es ist hier unnötig, mehrere solche Theologien zu reflektieren. Ein
Beispiel mag für andere gelten.
Die Befreiungstheologie baut auf einer Erfahrungsbasis der Armen in der Dritten Welt auf. Diese
Armen sind aber sehr verschieden: es gibt Arme in der Armenvierteln, Arme, die ausgebeutet für
Reiche arbeiten, es gibt Arme, die am Land leben und wiederum gibt es Arme, die in der Stadt
oder in favelas leben. Die Armen, die diese Theologie methodologisch aber auch praktisch be-
vorzugen will, leben auf verschiedenen Kontinenten, wo die Unterschiede sozialwissenschaftlich
gesehen sicher unvergleichbar sind. Wenn man sozialwissenschaftlich die „Armen“ unter eine
analytische Lupe nimmt, dann merkt man, wie groß die Unterschiede unter der Armen sind. Den-
noch ist eine Befreiungstheologie möglich gewesen, weil die Erfahrungen der Armen in genü-
gendem Maß vorhanden waren, und sie konnten dadurch als Basis für eine theologische Reflexi-
on dienen. Bei den zweiten und dritten Schritten in der Befreiungstheologie merkten die Autoren
die methodologische Pflicht, differenzierter über die Armen reden zu müssten. Unter dem etwas
ideologischen Begriff wuchsen neuere Begriffe: Frauen, Landsarbeiter, Straßenkinder, Wortlose
usw. Für alle gilt, sie sind arm, aber alle haben ein Recht dazu ihre eigene Lebensgeschichte zu
vertreten. Die Theologie und die Verkündigung haben die Pflicht, diese verschiedenartigen Le-
bensgeschichten und Sozialgeschichten pluralitätsgerecht zu reflektieren.
Allegorisch gelten diese Einsichten auch für die Problematik der Einheit und Verschiedenheit der
ost(mittel)europäischen Reformländer. In den Gesellschaften dieser Länder existieren genügend
Verfolgungserfahrungen, um über sie eine theologische Reflexion machen zu können. Eine tie-
137
ferschürfende Reflexion ist aber dazu verpflichtet, die Unterschiedlichkeit der Verfolgung in
diesen Ländern zur Kenntnis zu nehmen.
Wie eine politische, so ist auch eine theologische Einübung vonnöten. Die theologische Ausbil-
dung in diesen Ländern war mehrheitlich weit weg von den nachkonziliaren Entwicklungen in
der Theologie. Im Rahmen dieser Ausbildung war es fast überall unmöglich, sich eingehend mit
Bibelkritik, Dogmenentwicklung usw. auseinanderzusetzen. Selbst die dafür nötige Grundlektüre
war nicht vorhanden. Theologische Diskussionen konnten nicht in der (kirchlichen) Öffentlich-
keit stattfinden, da jede neue Ansichten den Anschein der Schwäche wecken konnte, was man
um jeden Preis meiden wollte. Die in diesen Ländern bestimmende theologische Sicht war vor
allem durch die neuscholastische Reformwelle der ersten Hälfte des Jahrhunderts geprägt. Diese
aber war gerade nicht dazu fähig, die gesellschaftsanalytischen Möglichkeiten der Theologie zur
Entfaltung zu bringen. Mit Methoden und Traditionen der Neuscholastik, die gerade zur Abwehr
oder mehr theologisch gesagt, zur Apologetik gegen die Moderne entwickelt worden war, konn-
ten die grundlegenden Änderungen weder der kommunistischen Mobilisierung noch der Demo-
kratisierung reflektiert werden. Darum wurde in den letzten zehn Jahren in diesen Ländern auf
solche theologische Elemente der neuscholastischen Apologetik auch bei Fragen zurückgegrif-
fen, die einer anderen Art und eines anderen Stils von Theologie bedurft hätten. Das leuchtet
angesichts des Verständnisses des sogenannten Traditionalismus der Theologie und Kirche dieser
Länder ein. Ein „westlicher“ Traditionalismus ist eine bewusste und frei diskutierte Option ange-
sichts der Herausforderungen der heutigen Zeit. Ein „östlicher“ Traditionalismus ist weder frei,
noch diskutiert, sondern ist das nahezu einzig vorhandene Mittel für die kirchliche bzw. theologi-
sche Rede in der Zeit. So wie es nahezu unmöglich ist, eine Demokratie mit dem „homo sowjeti-
cus“ schnell aufzubauen, so ist es auch eine Zumutung, von der Kirchen der Reformländer eine
moderne Theologie und eine entsprechende kirchliche Kommunikation umgehend zu erwarten.
Hier ist eine Art Enthaltsamkeit gefordert – sowohl bei Erwartungen aus dem Westen wie auch
aus dem Osten selbst. Es wurden nämlich auch in diesen Ländern Stimmen laut, die meinen, dass
die Kirche und die Theologie zu langsam auf die neuen Herausforderungen reagiert und der Zug
der gesellschaftlichen Modernisierung zu schnell der Kirche vorbeifährt. Mögen zwar diese Kri-
tiken einen positiven Sinn haben, sollen sie auch bedenken, dass die Gesellschaft selbst hinsicht-
lich der Geschwindigkeit ihrer Entwicklung nicht einheitlich ist und – wie wir immer klarer se-
hen können – oft auch nicht hinsichtlich der Richtung der Entwicklung.
Es mag sein, dass die Sozialwissenschaften nicht eindeutig die entscheidenden Charakteristiken
einer Region oder einer Epoche klären können. Neben ihrer unersetzbaren Hilfeleistung muss
man auf die sensiblen Zeitzeugen hören, damit die Theologie und die Verkündigung nicht über
die Köpfe der Betroffenen passiert. Ohne eine solche Leistung vorwegnehmen zu wollen, möchte
ich abschließend eine kleine theologisches Etüde über die Schutz der Freiheit zu versuchen.
138
Der tiefe Sinn der Freiheit kommt aus der geschaffenen Existenz des Menschen. Die Schöpfung
ist ein Anfang und die Welt und der Mensch entwickelt sich ständig darin. Sie und er sind nie
fertig, ihre Perspektive ist die Vollendung in Gott. Solange man in dieser Zeit der fortwährenden
Schöpfung lebt, ist alles relativ, ergänzungsbedürftig. Entwicklung braucht einen Spielraum zwi-
schen dem Ist-Zustand und dem möglichen Zustand. Die Bedingung der Wahrnehmung dieses
Spielraumes heißt Freiheit. Sie ist die gemeinsame Möglichkeit von Gott und Menschen, die
geschenkte und ersehnte Vollendung zu verifizieren. Die Freiheit ist ein Existenzmerkmal des
Menschen, der von Gott her und zu Gott hin lebt und sich so verstehen kann.
Alles Reden und Schaffen in dieser Epoche ist relativ. Positiv ausgedrückt: ist von der existenti-
ellen Freiheit gekennzeichnet. Selbst die dogmatische Rede über Gott hebt diese Freiheit nicht
auf, sondern demonstriert sie durch ihre Zeitlichkeit. Die existentielle Freiheit darf und muss
nicht gegen die Gewissheit dogmatischer Aussagen der Kirche gestellt werden. Alle Wahrheiten
und Erfahrungen und Aussagen münden einmal in das vollendete und totale Existenz Gottes – so
auch die tiefen Einsichten in diese Vollendung. Die Freiheit ist Grund, Milieu und Perspektive
der Dogmen und konsequent auch aller Grundstrukturen und Grundmerkmale der Kirche. Diese
Freiheit ist keinen Freibrief für Willkür, aber auch keiner für einen Totalitätsanspruch.
Die oben kurz skizzierten gemeinsamen Eigenschaften der Region bieten für die Kirche und für
die Theologie Traditionen an, die für die theologische Rede und für die Kirchenentwicklung
ernstzunehmende kontextuelle Ansätze sein mögen. Durch die theologische Sicherung der e-
schathologischen Perspektive kann nicht nur in Kirche und Theologie, sondern auch für die
kirchlich nicht (mehr), aber religiös (immer noch) gebundenen Menschen die positive Seite der
Freiheit verstärkt werden. Dies ist vor allem gegen nachwirkende totalitäre und nationalistische
Tendenzen von entscheidender Bedeutung. Sie ist aber auch wichtig angesichts der Enttäuschun-
gen durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Übergangs und durch die vielfach befremdli-
che Werte- und Meinungspluralität der neuen „freien“ Situation.
Obzwar die (katholische) Kirche in den Reformländern in je anderer Weise ihre Rolle in dieser
letzten Epoche gespielt hat, war sie doch in manchen Ländern der Region ein Schutz für die Frei-
heit, für die zivile Gesellschaft und für die Bewahrung der Persönlichkeit. Diese praktische Ant-
wort auf die sich lang ausgedehnte „babylonische Gefangenschaft“ darf nicht einer überschnellen
Stabilisierung und Renovierung der Kirche geopfert werden. Es muss eher umgekehrt sein: Diese
Funktion der Kirche ist sehr zu wünschen in einer Zeit, in der die starke marktdiktierte Mobilität
den Menschen alle Obdache zu nehmen scheint. Die Kirche in dieser Region hat Erfahrung im
Umgang mit Alternativen und Kreativität, für eine strukturelle Freiheit. Diese Erfahrungen sind
prächtige Quellen, um die totalitarisierende Einbrüche der Moderne zu kontrastieren.
139
Die kirchliche und theologische Rede war in der Zeit des Sozialismus immer zurückgenommen.
Harte Worte gehörten damals in den Mund der Parteisekretäre. Diese gewaltlose Redeweise, die
auch an Jesu Rede erinnern kann, darf für die Kirche keine Machtlosigkeit und Unsicherheit be-
deuten. Gerade umgekehrt: Das Angebot des Heils wirkt leise, stellt sich aber gerade dadurch mit
„Gestaltungs-Macht“ ein. Die Redeweise der heutigen Öffentlichkeit und nicht zuletzt die der
lauten Medien ruft nach stillen Stellen des Nachdenkens, der Mystik und der Mystagogie, die
diese Kirchen lange Zeit als einzige Möglichkeit der Pastoral ein- und ausgeübt haben. Diese
Tradition weiterzuführen und zu pflegen, ist eine menschlichkeitsbewahrende Funktion der Kir-
che in der heutigen Zeit.
Manche Theologen und Amtsträger schrecken von der polarisierenden und polarisierten theologi-
schen Redeweise bei den „westlichen“ Kollegen zurück. Es wird befürchtet, dass theologische
Freiheit die Einheit der Kirche in der Verkündigung und in ihrer Struktur schwächt. Aus ihrer
Sachlogik heraus soll aber Pluralität in der Theologie keineswegs zu untragbarer Polarität führen.
Die Theologen dieser Länder haben die nötige Ruhe und Durchhaltekraft in der früheren Zeit
gelernt, um auch in ihrer theologischen Redeweise sprachlich eine gewaltlose Pluralität ausüben
und aushalten zu können. Sie werden sicher die Souveränität ihrer „westlichen“ Kollegen in der
Lebens- und Glaubensgemeinschaft ihrer Ortskirche lernen und für sie auch für kontextgerechtes
theologisches Arbeiten gute Partner werden. Dazu reicht ihre persönliche Ruhe allein nicht aus,
dazu müssen sie auch durch die einheimischen Hierarchie aus ihrer jetzigen Untertanenhaltung
zu einer verantwortungsvollen Eigenständigkeit befreit werden. Es ist ein langer Weg für die
Kirchen dieser Länder, bis sie mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart fertig werden. Die Zeit
drängt und die Landkarte muss unterwegs gezeichnet werden.
Die Erfahrungen und die heutige kirchliche und theologische Praxis in der Region von Ost-
(Mittel)Europa rufen dabei vor allem die grundlegende Wahrheit über die Freiheit in Erinne-
rung – vielleicht auch für die „freien Gesellschaften“.
140
HISTORISCHE TRAUER – FALLBEISPIEL UNGARN
Die Bestimmung der Zeichen der Zeit ist eine Aufgabe der Theologie, die sie hellhörig macht für
die Wahrnehmungen anderer Wissenschaften. Die theoretischen Arbeiten über eine theologische
Hermeneutik196 haben trotz aller Verschiedenheiten einstimmig eine originelle und gleichzeitig
kritische Hermeneutik gefordert. Originell meint, dass die Theologie und die Theologen sich
nicht die Mühe ersparen können, die Wirklichkeit mit den eigenen Augen anzusehen. Lange
Jahrhunderte galt für die Theologie die Philosophie als Vermittlerin der Wirklichkeit. Heute sind
andere Wissenschaften dazugekommen: Soziologie, Ökonomie, Geschichtswissenschaft usw. Die
Theologie soll im Zusammenspiel mit diesen Wissenschaften die von ihnen benutzten Daten
kennenlernen und zu deuten versuchen. Die Erklärungen der Daten und die Entdeckung der Zu-
sammenhänge ist gemeinsam zu leisten. Es ist ungenügend, wenn die Theologie nur die Deutun-
gen anderer Wissenschaften wahrnehmen würde, da dadurch ihre Nähe zur Wirklichkeit ge-
schwächt wäre. Durch den Vorgang der Analyse wird der Theologie auch die Möglichkeit gege-
ben, durch die methodologischen und theoretischen Diskussionen mit den anderen Wissenschaf-
ten ihre eigene Methodologie und Theorie hinterfragen zu können, aber auch umgekehrt, die
theoretische und methodologische Klarheit anderer Wissenschaften einzufordern. Diese Zusam-
menarbeit der Wissenschaften, es wird dafür der Fachausdruck „Multidisziplinrarität“ verwendet,
begründet auch die gegenseitige Kritik bei der Deutung der Daten. Von der philosophischen
Hermeneutik wissen wir, dass die Wirklichkeit weithin konstruiert wird. Es gibt, so die sozial-
wissenschaftliche Annahme, die „objektive Wirklichkeit“ nicht. Die gemeinsame und gegenseiti-
ge Kritik sichert die Klarstellungen der eigenen Interessen und Positionen, die in Deutungen
mitgeliefert werden. Die offengelegte Subjektivität ist objektiver als die subjektlose Objektivität.
Diesen Grundannehmen einer theologischen Gesellschaftsanalyse folgend, wird hier ein Versuch
unternommen, die Lage Ungarns zu deuten. Das Interesse dabei ist einerseits zu zeigen, durch
welche Schritte diese Gesellschaft zu ihrem heutigen Zustand gekommen ist, andererseits für eine
einheimische Theologie Grundlagen zu finden.197
GESCHICHTLICHE ORTSBESTIMMUNG
Ungarische Geschichtswissenschaftler (Kosáry, Szűcs, Hanák) teilen Europa in mehrere Zonen.
Sie sprechen über einen „inneren Höhenunterschied“ zwischen dem Zentrum und der Peripherie,
196 Für mich waren vor allem die folgenden Werke wichtig gewesen: Boff, Theologie und Praxis; Schreiter, Abschied; Tracy, Theologie als Gespräch.
197 Die nachstehenden Ausführungen gehen auf meine Dissertation zurück: Máté-Tóth, András: Die Zeichen der Zeit und die katholische Kirchen in Ungarn. Eine pastoralgeschichtliche Betrachtung, Wien 1991.
141
wobei seit dem 18. Jahrhundert unter dem Zentrum England, Niederlande und auch Frankreich,
unter der Peripherie die Länder östlich der Monarchie verstanden werden. Dieses europäische
Modell beobachtete seit dem 18. Jahrhundert eine graduelle Progressivität auf der Ebene der
Bevölkerung, der Wirtschaft oder auch der Kultur. Nicht nur die mehr entwickelten Zonen, son-
dern auch die Randzonen weisen diese Progressivität auf. Nach dem Ende des 18. Jahrhunderts,
das ganze 19. Jahrhundert hindurch, forderten die englische industrielle und die französische
gesellschaftlich-politische Revolution ein Aufholen der inneren Modernisierung der Peripherie.
Dieses Nachrücken gelang in der ungarisch-polnisch-russischen Zone nur mäßig.198
Die Koordinaten, die Ost(Mittel)Europa , und darin Ungarn bestimmen, versuchte – sich der
Historikerdebatte über die Zugehörigkeit Ungarns zu Europa anschließend199– u.a. der namhafte
ungarische Historiker, Jenő Szűcs200 so zu erklären: „Die Neuzeit ist aus der einen Richtung mit
der zweiten Expansion des Westens (1500-1640) gekommen... in der anderen Richtung gestaltete
die große Expansion des ‚gestutzten’ Ost-Europas das ‚vollständige’ Ost-Europa. Während das
zwischen den beiden eingeengte Mittel-Ost-Europa defensiv und fassungslos hinnehmen musste,
dass die Geschichte wieder eine Grenze zu West-Europa zeichnete, wurde es von Süd-Westen
von der letzten, aber stärksten Invasion bedrängt. So wusste es nicht mehr, ob es noch in den
Rahmen des Europäischen Okzident gehört oder nicht mehr.“201
Was waren die bestimmenden Eigenschaften der gesellschaftlichen Entwicklungen im Westen
und im Osten, zwischen denen sich das ungarische Modell geformt hat?
Szűcs kommentiert zustimmend Bibó: „Der Westen ordnete die Gesellschaft dem Staat unter, der
Osten aber verstaatlichte sie... Die örtlichen Autonomien lebten, wenn auch verkürzt, weiter.“202
Einer der fruchtbaren Widersprüche des westlichen Absolutismus ist, dass die Untertanen im
freigelassenen Raum unter dem Staat ihre Freiheiten zu der Freiheit summierten; die Bewegung
des zaristischen Absolutismus schloss jeden Wiederspruch aus und verwirklichte konsequent ihr
Konzept: „die Gesellschaft“ der Untertanen.203 Die Legitimation der Macht stammt im Westen
aus dem Naturrecht, im Osten aus „der Wahrheit“.204 Im Westen beriefen sich die Gegner des
Absolutismus auf die Freiheitsrechte, im Osten dagegen rang die Opposition um die allein hei-
lende und totale „Wahrheit“, aus deren Gefangenschaft sie sich auch in der Neuzeit nicht befreien
konnte.205 Diesen Unterschied der politischen Legitimation vermerkt auch T. Gábor Mózes in
seiner Analyse der „osteuropäischen Traditionen“ mit dem Untertitel: das byzantinische Para-
198 Kosáry, A történelem veszedelmei [Die Gefahren der Geschichte] 11f. und auch ders., A felvilágosodás Európában [Aufklärung in Europa] 3-11.
199 Gyáni, Történészviták. 200 Szűcs, Ungarns regionale Lage. 201 Szűcs, Vázlat Európa három történeti régiójáról [Eine Skizze über die drei historischen Regionen Europas] 14f. 202 A. a. O., 86. 203 A. a. O., 88. 204 A. a. O., 91.
142
digma. Er kommt zur Schlussfolgerung: „Während im Westen in der Neuzeit die aus göttlicher
Gnade herrschenden Monarchien stufenweise ein durchschaubares System, ein rationaler Plura-
lismus eines ‘gesellschaftlichen Vertrags’ abgelöst hat, erfolgte im Osten die Säkularisierung der
magischen Auffassung der Macht nur teilweise. Diese Auffassung vernebelt heute noch unser
Schicksal.206
Die Aufklärung im Westen war eine Sache der „Gesellschaft“ und nicht die des „Staates“. Die
Öffnung zum Europa von Peter dem Großen erschloss zwar die ausschließlich von oben gesteuer-
ten, begrenzten Bewegungsmöglichkeiten mitten in der grundsätzlichen gesellschaftspolitischen
Unbeweglichkeit. Zugleich entwickelte sich ähnlich wie im Westen die Staatsnation. Diese Kon-
vergenz verhüllte aber eine Divergenz. Nach dem östlichen Modell blieb im Prinzip und auch in
der Tat die russische Nation ein „der Freiheit des Staates“ (Marx) untergeordneter gesellschaftli-
cher Rahmen.207 Kosáry analysiert, wie Ungarn zur grandiosen Entwicklung der europäischen
Aufklärung aufgeschlossen hat. Diese Entwicklung ist der des Zentrums teilweise ähnlich, teil-
weise von ihr verschieden. Obwohl die Unterentwicklung des damaligen Ungarns von manchen
Autoren dadurch erklärt wird, dass z.B. die Befreiung der Burg Buda aus der Türkenherrschaft
erst im Jahr des Erscheinens des Werkes von Newton möglich wurde, ist die Erklärung der „Ver-
spätung“ dieser Region auf einer tieferen Ebene zu suchen. Die Aufklärung traf Ungarn in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In der feudalistischen Gesellschaft konnte die tragende Rol-
le der gesellschaftlichen Entwicklung nur der Adel, genauer gesagt ein Teil von ihm, spielen, der
4-5% der Gesamtbevölkerung ausgemacht hat. Die Aufnahme der neuen Ideen wurde in Ungarn
durch die inneren Spaltungen der Adelsschichten bestimmt.
Für die politischen Tendenzen der Peripherie ist kennzeichnend, dass es in manchen Ländern ein
aufgeklärter Absolutismus aufgetaucht ist, der aber aus dem bürgerlichen England oder Holland
fehlt. In Ungarn herrschte er zwischen 1765-1790. Dieser aufgeklärte Absolutismus löste eine
aufgeklärte ständische Bewegung aus, die mit einem kulturellen Programm begann und sich nach
den Jahren des Josephinismus so verbreitet hat, dass sie jede Ebene der Politik und der Wirtschaft
beeinflussen konnte. Diese Bewegung wurde aber von nur wenigen progressiven Adeligen ver-
treten. Die progressivsten Tendenzen vertraten die Gebildeten im Adel, die die Ideale der engli-
schen und französischen Revolution angenommen haben. Diese war aber die schwächste Schicht
des Adels. Nach der Krise der Jahrhundertwende entfaltete sich ab 1830 zuerst eine patriotische
liberale adelige Reformbewegung, die die Revolution von 1848 vorbereitet hat. „Alles zusam-
menfassend kann gesagt werden, dass die Aufklärung trotz der inneren Krise in Ungarn nicht
205 A. a. O., 92. 206 T. Gábor Mózes, Kelet-Európai hagyományaink [Unsere osteuropäische Traditionen] 101. 207 A. a. O., 94.
143
erfolglos geblieben ist. Ihr Erbe bildete später einen integrierten Teil der intellektuellen Ausrü-
stung der nachfolgenden Generationen“.208
„Wir können sogar über die Österreich-Ungarische Monarchie... ganz allgemein sagen, dass sie
sich in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts bei ihren Industrialisierungsprogram-
men in hohem Maße auf Privatkapital gestützt und diesem eine beachtliche Selbständigkeit zuge-
standen hat. Obwohl sie der Bourgeoisie den Zutritt zur politisch herrschenden Klasse verwehrte,
baute sie gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ein verfassungsmäßig-liberales politisches System
auf, das allerdings dem Parlament keine bedeutende Entscheidungskompetenz garantierte“.209
Aus einem wirtschaftsanalytischen Blickwinkel weist Peter Hanák darauf hin, dass der „ent-
scheidende Unterschied zwischen der mittel- und osteuropäischen kapitalistischen Agrarentwick-
lung darin (zu sehen ist), dass in den dazwischen liegenden Regionen schon in der letzten Phase
des Feudalismus der bürgerliche Landbesitz erschien, entweder in der offenen Form des Loskaufs
oder in der versteckten Form der Pacht, jedoch der Vertragspacht...“ Dennoch wurde 1848 und
dann nach 1867 „die liberale Losung des Reformzeitalters in Ungarn ‚Eigentum und Freiheit’
verwirklicht – gewiss nicht in ihrer reinen westlichen Form, sondern durch viele traditionelle
Elemente und Beschränkungen belastet“.210
Die Grenzsituation der Monarchie bedeutete u.a. einen einmaligen, unvergleichbaren Kompro-
miss zwischen dem Absolutismus und dem Ständewesen. Der Adel unterstrich sein Engagement
für die Freiheit des Volkes (wobei er unter Volk sich selber verstand) und verlängerte die Situati-
on der Leibeigenschaft, also seine absolutistischen Vorrechte. Daraus folgt das Paradoxon, dass
sich die führende Schicht der ungarischen Gesellschaft in dem doch „ausgleichenden“ staats-
rechtlichen Rahmen dennoch als „subversiv“ und „Opposition“ verstand.211
Die modernen europäischen Ideen des 18. Jh-s. forderten zwar dringend die Umgestaltung des
ständischen Rahmens, aber der unglücklichen Verhältnisse wegen konnte von einer Erneuerung
keine Rede gewesen sein. ... Während die westliche Staaten zu absoluten, aber durch die Führung
ihrer nationalen Führer zu modernen Staaten gewachsen sind, unterblieb in Ungarn weiterhin das
Wachsen.212
Die Geschichte Ungarns ist darum ein eigenartiges Modell, da es ein Hybrid mit zwei Gesichtern
darstellt: einerseits steigerte sie die osteuropäische Starrheit des Gesellschaftssystems, anderer-
seits konnte sie nie die westeuropäischen Elemente ausklammern. Diese Subregion trägt einer-
seits Elemente der leibeigenschaftlichen Demut, des machthaberischen Geistes, sowie der Über-
208 Kosáry, A felvilágosodás 10-20. 209 Konrád/Szelényi, Die Intelligenz 154). 210 Hanák, Mitteleuropa 181-182. 211 Hanák, Die Geschichte 116. 212 Szegfű, Der Staat Ungarn 20-21 und weiter 171-226.
144
ordnung der Angstmechanismen über die Mechanismen des Geistes. Andererseits trägt sie jedoch
Elemente in sich, die in glücklicher Konstellation „eine Bewegung Richtung größerer Freiheit
ermöglichen“213. Nach Bibó bedeutet 1945 darum eine Aufgabe der Wende, mit der Begrenzung,
dass zu ihr die Gesellschaft unvorbereitet war. Deshalb besaß sie nicht die „unwiderstehliche
Dynamik“ der echten Revolutionen.214
„Seit der Jahrtausendwende nahmen auch in der Monarchie die Tendenzen des Militarismus zu,
aber parallel dazu erstarkten auch die verfassungsmäßigen Organe und Foren der parlamentari-
schen Kontrolle. Die Österreich-Ungarische Monarchie war und blieb bis zum ersten Weltkrieg
die östliche Grenze der europäischen liberalen Verfassungsmäßigkeit. Dieses politische System
übernahm und behielt trotz Eingrenzung und mehrmaliger Verletzung das Erbe des europäischen
Humanismus, der Aufklärung und des Liberalismus, dabei auch den Pluralismus und die Tole-
ranz. Die staatspolitische Ordnung der Monarchie – und in ihr Ungarns – nahm eine Zwischenpo-
sition ein zwischen der westlichen parlamentarischen Demokratie und der östlichen Autokra-
tie“.215
„Der Genauigkeit halber müssen wir anmerken, dass das gegenwärtige Osteuropa zwei in sich
homogene und voneinander abgegrenzte Gebiete umfasst: das prawoslawische Osteuropa, zu
dem außer Russland vielleicht nur Rumänien, Bulgarien und Serbien gehören, und jener mit-
telosteuropäische Streifen, in dem sich der Einfluss des westlichen Christentums widerspiegelt,
vom Baltikum über Polen und Ungarn bis nach Kroatien, das sich trotz wesentlicher Parallelen
stark vom russischen Entwicklungsmuster abhob.“216
György Konrád beschreibt die Situation der „paradoxen Mitte“ nicht nur, um sie zu erklären,
sondern auch um sie als Berufung zu interpretieren: „Wir Budapester zwischen Ost und West,
wir Menschen der Mitte, haben auch etwas zu sagen. Wir verhelfen der Zwietracht zur Versöh-
nung, wir profanieren die militanten Extreme, wir exerzieren die paradoxe Mitte, wir machen in
uns das Unvergleichliche durch... Wir versuchen, den Ausgleich zwischen Kommunismus und
Kapitalismus, zwischen Ost und West durch unsere bloße Existenz, durch Ideale und durch über
den Verstand hinausgehende Klugheit zu fördern“.217
Zu den politisch-geschichtlichen Hintergründen der „heutigen“ Konflikte und Herausforderungen
gehört im wesentlichen auch die Frage der Nationalitäten. Ungarn war im Mittelalter schon ein
Land mit vielen Nationalitäten gewesen. Manche spätere Nationalitäten sind schon im Mittelalter
hier zu finden. Der Neubau im 18. Jahrhundert modifizierte aber die Verhältnisse gewaltig. Nach
213 A. a. O., 122. 214 In Szűcs, Vázlat 123. 215 Hanák, Mitteleuropa 189-190. 216 Konrád/Szelényi, Die Intelligenz 142. 217 Konrád, Antipolitik 112.
145
der Volkszählung von 1784 hatte Ungarn 9,2 Million Bürger. Damit vertrat Ungarn in der habs-
burgischen Monarchie 43,4%. Nach den 5,65 Millionen Deutschen sind die Magyaren die zweit-
größte Nationalität. Die sonstigen Nationalitäten auf ungarischem Boden sind: 1,5 rumänisch,
1,25 slowakisch, 1,1 deutsch, 0,7-0,8 kroatisch und 0,6 serbisch.218 Die Wurzeln der Frage reicht
bis zu dem dreifachen Begriff von „natio“ in der Zeit des Mittelalters und vor dem 18. Jahrhun-
dert: „magyar“ bedeutete einerseits ein Teil von „gens Hungarica“, der Hungarus, der dem re-
gnum Hungariae untertan ist. Darin lag ein Unterschied zu „natione“ und nach der Sprachen
möglich: lingua et moribus. Drittens konnte man „natio“ verstehen als Zugehörigkeit zu der sich
ständisch-korporativ organisierenden „natio Hungarica“. In dieser Epoche beinhaltete die Wahl
zwischen der dreifachen Zugehörigkeit nichts Zwanghaftes. Ab dem 19. Jahrhundert und beson-
ders nach dem Ausgleich geriet die ungarische Gemeinauffassung darin zu einer verhängnisvol-
len Illusion, dass sie meinte, die Hungarus untertänischer Bindung und die ständische Staatsnati-
on zu einer modernen Staatsnation fusionieren zu können. Dies leitete die Zeit des Nationalismus
ein, die durch einen starken Entscheidungszwang gekennzeichnet ist. Vor 1918 dominierte die
Staatsnation der Kulturnation gegenüber.219
„Der sprachliche Nationalismus stellt ein speziell mittel- und ost-europäisches Phänomen dar...
Der moderne Gedanke der Nation ist ein par excellence politischer Begriff... infolge der Erschei-
nung des sprachlichen Nationalismus im 19. Jahrhundert begannen alle Nationen ihrer Situation
hinsichtlich ihrer sprachlichen Verhältnisse Rechnung zu tragen: sie wollten die Sprachgeschwi-
ster über die Grenzen vereinen und wollten die Anderssprachigen in ihrem Land sprachlich ein-
verleiben... Diese Bewegung machte die politischen Grenzen flüssig und verursachte unter den
Nationen und Nationalitäten vielerlei Kriege und Katastrophen.“220
Für die Fragestellung dieser Arbeit scheinen die hier erwähnten Hintergründe die Ausgangslage
der ungarischen Gesellschaft von 1945 zu markieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg, infolge von
Jalta, kam Ungarn in den Machtbereich der eindeutig osteuropäischen – man müsste vielleicht
sagen asiatischen – Weltmacht. Dies machte für Ungarn das Nachholen der westeuropäischen
Entwicklung im Grunde unmöglich. Die „Revolution von oben“ und die monolithische Partei-
macht setzten die gesellschaftslähmenden Kräfte und Methoden frei. Dadurch musste Ungarn
beim unterentwickelten Teil Europas bleiben. Die Eigenschaften aber, die einen sogenannten
„ungarischen Weg“ kennzeichnen, ließen sich durch die weiter oben skizzierte Ungleichheit er-
klären. Darum konnte Ungarn die „fröhlichste Baracke des Ost-Blocks“ genannt werden und
dadurch konnte genau hier die ost-europäische Umgestaltung zuerst ihre (grund)gesetzliche Ver-
ankerung finden.
218 Kosáry, Előadások a magyar történelemről [Vorträge über die ungarische Geschichte] 306). 219 Szűcs, Történeti eredetkérdések [Historische Ursprungs-Fragen] 33).
146
Die Josephinistische Modernisierung
Die kirchlichen Entwicklungen sollen ab dem Josephinismus skizziert werden. Nachdem Joseph
II. (1780-1790) den Thron bestiegen hatte, begann er sofort mit der Durchführung seiner Kir-
chen-Reformen. Er wollte eine Stärkung der Gesellschaft und des Staates erreichen, indem er die
Macht der Privilegierten zurückdrängte und den niederen Klassen ein freieres Leben sicherte. Er
berief keinen Reichstag ein, sondern erließ seine Reformen auf dem Verordnungswege. Mit Ver-
ordnungen regelte er das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft von der Wiege bis zur Bahre
bis ins kleinste Detail. Seine ersten Maßnahmen bezogen sich auf die Einschränkung der im Lau-
fe der Jahrhunderte zu stark gewordenen Macht des Klerus. Er nahm der Kirche die Zensur aus
der Hand, das heißt das Recht auf die Kontrolle und Genehmigung von gedruckten Büchern und
Zeitschriften. Er limitierte die politische Rolle der Bischöfe sowie das Mitspracherecht des Papst-
tums. Er ließ alle Orden auflösen, die sich nicht mit Unterricht oder Krankenpflege befassten,
und verwendete ihr Vermögen in erster Linie für das Unterrichtswesen. Sein 1781 erlassenes
Toleranzedikt gab den Protestanten und Griechisch-Orthodoxen Glaubensfreiheit und das Recht,
höhere öffentliche Ämter zu bekleiden. Obwohl er am 26. Januar 1790 auf seinem Sterbebett mit
eigener Hand sein Lebenswerk zunichte machte, erschütterte sein Wirken die ungarische Kirche
dermaßen, dass der ungarische Historiker Gyula Szekfű schreiben konnte: „Sein Wirken gab
einen starken Anstoß zu der totalen Verweltlichung der ungarischen Welt.“ 221
Die weitere Erörterung der kirchlichen Situation berührt aber schon unser nächstes Thema: die
charakteristischen Konfliktbereiche zwischen der Kirche und den profanen Autonomiebestrebun-
gen.
ENTKIRCHLICHUNG DER GESELLSCHAFT
In diesem Punkt soll durch nähere Beschreibung und mit detaillierten Angaben erörtert werden,
in welchen Schritten sich die wichtigsten Ebenen der ungarischen Gesellschaft von der Kirche
abgelöst haben bzw. wie diese emanzipatorischen Tendenzen sich verwirklichen konnten. In
diesem Punkt unterlasse ich die Begriffsbestimmung der Säkularisation, bzw. die ausführliche
Behandlung der Frage wie weit und in welchem Sinn man für Ungarn eine Säkularisation im
westlichen Sinne des Wortes behaupten darf. Für diese Fragen und Diskussionen wird am Ende
dieses Abschnittes ein Exkurs folgen. Dort möchte ich zwischen Religionsfeindlichkeit und Au-
tonomiebestrebungen sowie zwischen System und Kultur der Säkularisation differenzieren.
220 Bibó, Válogatott tanulmányok [Ausgewählte Studien] II. 195-197. (Dt. ders., Misere der osteuropäischen Kleinstaa-terei)
221 Hermann, A katolikus egyház története [Die Geschichte der katholischen Kirche in Ungarn] 369.
147
Für diesen Punkt nehme ich Säkularisation im Sinne des Lexikons für Theologie und Kirche:
„die weltliche Verwendung des Göttlichen“222. Diese Definition wird noch mit einer Bemerkung
ergänzt, die gerade für Deutschland gültig ist und einen Gegenpol zur ungarischen Säkularisation
darzustellen vermag: in Deutschland also „weckte die Entmachtung der Kirche positive Kräfte im
katholischen Volk, das religiöse Leben erstarkte, innenkirchliche Fehlerquellen... verschwanden,
die moralische Autorität des Episkopats und des Papstes wuchs, eine Entwicklung, die freilich
nicht immer glücklich verlief (Ultramontanismus, päpstliche Zentralismus)“. Im Deutschen un-
terscheidet man bei diesem Prozess zwischen Säkularisation und Säkularisierung, wobei letzte-
re – gemäß dem jetzt zitierten Autor des entsprechenden Stichworts im Lexikon, Alfons Auer –
„den geschichtlichen Vorgang, der zur Geisteshaltung des Säkularismus (oder der Profanität)
geführt hat“223, bedeutet. Es werden also in diesem Punkt die Etappen der Säkularisation darge-
stellt.
Ich behandle die Schritte der strukturellen Entzweiung der einheitlichen, im wesentlichen von der
katholischen Kirche bestimmten ungarischen Welt in der geschichtlichen Reihenfolge und nicht
nach ihrer Bedeutung.
a. Die religiöse Toleranz;
b. Die Zivilehe;
c. Die Presse;
d. Das Schulsystem;
e. Die Trennung des Staates von der Kirche.
Die religiöse Toleranz
Die Sicherung der religiösen Toleranz scheint auf den ersten Blick nicht zur Frage der Säkulari-
sation zu gehören, da sie die einheitliche religiöse Erklärung oder Deutung der Wirklichkeit noch
nicht in Frage stellt. In einem Land aber, wo die katholische Kirche eine ausschließliche Kompe-
tenz dafür besaß, bedeutet die gesetzliche Aussprache der religiösen Toleranz den ersten Schritt
in der Richtung der Emanzipation. Die katholische Autoren beschreiben wohl diese Tendenz
nicht als eine Sicherung der religiösen Alternativen im Rahmen des religiösen Systems, sondern
als Ablösung von der Religiosität als solcher. „Das traurigste Ergebnis der Regierung von Joseph
II. ist die Verbreitung der Glaubenslosigkeit“ – schreibt der bedeutende katholische Historiker
der Jahrhundertwende János Karácsonyi.224
222 Bd. 9 252. 223 A. a. O., 253. 224 Karácsonyi, Magyarország egyháztörténete [Kirchengeschichte Ungarns] 252.
148
Kaiser Joseph II. war ein religiöser Mensch. Er versuchte „nicht aus einer dogmatischen, sondern
aus einer politischen“225 Motivation seinen Untertanen die Möglichkeit zu geben: nach ihrer ei-
genen Konfession ihr religiöses Leben führen zu dürfen – allerdings für die Lutheraner, Calvini-
sten und Unitarianer. Unter seinen mehreren Tausend Verordnungen ist eine der bedeutsamsten
das sog. edictum tolerantiale (1781). Dieses Edikt bestimmt für die ungarischen Protestanten,
dass – wo mindestens 100 protestantische Familien leben – sie ihre Religion ausüben, turmlose
Kirchen bauen, Priester und Lehrer beschäftigen dürfen. Obwohl er auf seinem Sterbebett später-
hin alle seine Verordnungen in einem „rescriptum repositorium“ zurückgenommen hat, behielt er
das Toleranzedikt bei. Obwohl seine Nachfolger im Sinne eines bürokratischen Josephinismus
das kirchliche Leben verschiedenartig beeinflussten, blieben die Hauptziele des Toleranzedikts
einer der wichtigsten Punkte der Verordnungen des ab 1848 autonomen Parlaments.
Am 31. März 1848 reichte Lajos Kossúth seinen Vorschlag über die religiöse Gleichberechti-
gung im Parlament „im Interesse der Beruhigung beiden Protestanten und der alt-gläubigen Grie-
chen“ ein. Im zweiten Punkt seines Vorschlags steht die umstrittene Forderung der Gleichheit
und Gegenseitigkeit aller gesetzlich eingeschriebenen Religionen. In der Diskussion versuchten
die katholischen Bischöfe die Verordnung der Gegenseitigkeit streichen zu lassen, und das mit
der für uns besonders interessanten Begründung: Sie mache eine Demokratisierung des inneren
Systems der katholischen Kirche möglich und sei gefährlich für das Patronatsrecht des Königs
(ius patronatus regii MTF 143-144). Darum wollten sie einen Einschub zu diesem zweiten Punkt
durchsetzen: „mit der Aufrechterhaltung unserer Dogmen und kirchlichen Zeremonien“.
Die Einwände und auch die Argumentation zeigt klar, dass die damalige Kirchenleitung in der
gesetzlichen Verankerung der religiösen Gleichheit ihre historischen Vorrechte bedroht sah.
Das Gesetz wurde ohne eine Änderung oder einen Einschub am 11. April 1848 sanktioniert und
ist als XX. Gesetzesartikel von 1848 bekannt geworden.226 Der Erzbischof von Kalocsa, also die
zweite kirchliche Persönlichkeit, begrüßte das neue Gesetz mit folgenden Worten: „Die ungari-
sche Freiheit wurde auch von Gott den Magyaren gegeben“.227 Diese Regelung behielt im Grun-
de genommen ihre Gültigkeit bis zur heutigen Zeit.228
Die Praktizierung der religiösen Toleranz in Ungarn zeigt, dass sie die traditionelle christentüm-
liche Rolle der katholischen Kirche nur im religiösen Bereich hat einschränken können. Aller-
dings zeigt dieser Akt einer Gesetzgebung des Parlaments, das – wenn auch nur im religiösen
Bereich, aber doch – die Kompetenz der katholischen Kirche einschränken wollte, eine eindeuti-
225 Hermann, a. a. O. 370. 226 Zeller, A magyar egyházpolitika [Die ungarische Kirchenpolitik] 85ff. 227 In Meszlényi, A magyar katolikus egyház [Die ungarische katholische Kirche] 35. 228 Über die damalige juristische Regelung der Religiosfreiheit in Ungarn: Hanuy, A vallásváltoztatás [Die Religions-
änderung].
149
ge Motivation, einen eindeutigen Anspruch der zivilen Gesetzgeber, ihre Autonomie auch gegen-
über der katholischen Kirche zu behaupten. Die Motivation für die Einführung der religiösen
Gleichberechtigung speist sich allerdings in erster Linie nicht aus einem liberalen Geist, sondern
aus einem patriotischen Bedürfnis der Stärkung der nationalen Unabhängigkeit Ungarns und des
Konfessionsfriedens. Die parlamentarische Opposition förderte allerdings diese Gesetzgebung
wegen ihrer liberalen Auffassung. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ist diese Auffassung
maßgebend für die Deák-Regierung geworden.
Die Zivilehe
Die Bestrebung für die Einführung der Zivilehe in Ungarn knüpft schon mehr an die Verbreitung
der liberalen, kirchenfeindlichen Auffassung als die der religiösen Gleichheit an. Man muss aber
bemerken, dass die Motivation hier auch nicht von einer patriotischen Forderung der Einheit des
Landes unabhängig ist, welche durch einen Konfessionsfrieden mitgesichert werden müsste.
Ein Gesetz von 1790/91 verordnete, dass Mischehen immer vor einem katholischen Priester zu
schließen sind, der aber diese nicht behindern darf. Die Ehe der Nichtkatholiken (besonders der
Protestanten) gehörte aber in dieser Zeit schon unter die gesetzliche Aufsicht des Bezirksgerichts.
Im Falle einer Scheidung ließ aber die katholische Kirche die Protestanten keine Mischehe
schließen, da für den katholischen Codex die Ehe zweier Protestanten „per se“ eine sakramentale
Ehe darstellt, die dann keine weitere Ehe zuließe.
Diese und ähnliche Konfliktmöglichkeiten belasteten und bedrohten den konfessionellen Frieden.
Die katholische Kirche versuchte immer wieder die Sicherung ihrer Rechte durch das Parlament.
Dies und die widrigen Umstände um die Mischehen gaben vielerlei Anlässe für die oppositionel-
len liberalen Kreise, die Vorrechte bzw. selbst die Grundauffassung der Kirche und ihrer Hierar-
chie anzugreifen und ihr gegenüber die staatliche Autonomie zu fördern. Für die Tragweite die-
ses Problems ist bezeichnend, dass Hermann in seinem großen Werk behauptet: „Was wir ‚unga-
rischen Kulturkampf’ nennen, beschränkt sich eigentlich auf das Eherecht und auf die dazugehö-
rigen Fragen.“229
Die Gesetzgebung von 1868 (Art. XLVIII und LIII) modifizierte zwar die vorherigen Verhältnis-
se z.B. mit der Verordnung, dass die Prozesse um Mischehen der nicht-katholischen Zuständig-
keit zugeordnet werden sollen. Dies bedeutete in der Praxis, dass die Scheidung für einen Katho-
liken dadurch ermöglicht wurde, dass er einfach zu einem Protestanten wurde. Diese Regelung
brachte keine Beruhigung der Frage. So reichte Bálint Solymosi am 23. Februar 1874 im Parla-
ment einen Vorschlag für die Zivilehe ein.230 Der eigentliche Gesetzvorschlag kam aber erst am
229 Hermann, a. a. O. 457. 230 Zeller, a. a. O. II. 382ff.
150
2. Dezember 1893 vor das Abgeordnetenhaus. Diese Zeitspanne erklärt sich einerseits durch den
öfteren Wechsel der Regierung, aber auch dadurch, dass die Frage der Zivilehe schon dermaßen
die Fragen der Trennung des Staates und der Kirche berührte, dass ihre Behandlung enorm
schwierig wurde. Das Verhalten des Vatikans bestimmte auch die Diskussionen und die hartnäc-
kige und fast apokalyptisch gesinnte Haltung der Kirche mit. Papst Pius IX. äußerte sich ohne
jedwede Kompromissbereitschaft über die Gesetze in Österreich von 1868, die auch die Zivilehe
einführten, wie folgt: „Diese verwerfen und verteufeln wir und halten sie für immer ungültig“.231
Die gesetzliche Ermöglichung der Zivilehe trat am 1. Oktober 1895 in Kraft und ist bekannt als
die Artikel XXXI und XXXIII von 1894.232 Nach dieser Verordnung wird vom Staat die kirchli-
che Ehe nicht anerkannt und die kirchenrechtlichen Sanktionen sind für ihn ungültig. In der spä-
teren Entwicklung wurde nunmehr darüber diskutiert in welcher Reihenfolge die „zwei Trauun-
gen“ durchgeführt werden sollen.
Die zahlreichen juristischen und kirchlichen Beiträge zur Diskussion sowie zum Gesetzentwurf
zeigen den Kernpunkt des Problems klar auf. Beispielhaft sei auf einen typischen, kämpferischen
Beitrag hingewiesen:
György Schopper argumentiert wie folgt: „Es ist eine Zivilehe geplant anstelle der kirchlichen
Ehe, die durch neun Jahrhunderte das Glück des Volkes und des Vaterlandes bildete.“ Er zitiert
den Deutschen Buchholz: „Es existiert gar kein vom Sakramente getrennter und doch sittlich-
würdiger Contract, welchen eine weltliche Obrigkeit als ihrer unabhängigen Gesetzgebung un-
terworfen betrachten könnte.“233 „Auch durch das ungarische Corpus Juris hindurch zieht sich als
ein roter Faden die Zuständigkeit der Kirche.“234 Er zitiert auch noch Abbé Fauchet, der behaup-
tet, dass die Verordnungen des Konzils von Trient jedem Einfluss des Throns überlegen sind.235
Die Zivilehe sei also dazu da, dass sie im Endeffekt „die kirchliche und zivile Gesellschaft total
zerstöre, das Ende dieser Rebellion ist die totale Auflösung“.236
Nach einem Vierteljahrhundert schrieb ein anderer Universitätsprofessor, Lajos Joób [1893] in
seiner großen vergleichenden Untersuchung über die Einführung und Folgen der Zivilehe in Eu-
ropa vertrat den Standpunkt, dass die Zivilehe „nicht nur nicht im Gegensatz zu der echten Reli-
giosität steht, sondern sie eher fördert und kirchlichen Streitereien vorbeugt“.237 Er behauptete
klarsichtig, dass die Wurzeln der Zivilehe in der Epoche der Erwachung des staatlichen Selbst-
231 Vgl. Acta Pii, IX. V. 123, ganz im Sinne von DS 2990-2993. 232 Karácsonyi a. a. O. 281 und Hermann a. a. O. 468-469. 233 Schopper, A polgári házasság 91Die Zivilehe] 39. 234 A. a. O., 89. 235 A. a. O., 120. 236 A. a. O., 92 und 155. 237 Joób, A polgári házasság történeti megvilágításban [Die Zivilehe in geschichtlicher Beleuchtung] 161.
151
bewusstseins und der Gewissensfreiheit zu suchen sind und nicht in den Idealen der französi-
schen Revolution, auf deren Flügeln sie zur weltweiten Verbreitung gekommen ist.238
Die Presse
Bei der Betrachtung der Auflösung der einheitlichen christlichen Gesellschaft kann die Erwäh-
nung der Presse als Kuckucksei vorkommen, da die Presse als Mittel der Staatsräson ein Kind der
Aufklärung ist und keineswegs ein Kind der Kirche(n). Ihr Beitrag zur Emanzipationsbestrebung
vom Absolutismus kommt geschichtlich gesehen ihrer Instrumentalisierung durch die Kirche und
dann ihrer zweiten Befreiung von der Kirche zuvor. In dieser „zweiten Emanzipation“ finden wir
einen Konflikt, in dem die autonomen, „weltlichen“ Bestrebungen ein starkes und sehr geeigne-
tes Mittel für ihre Selbstbehauptung gefunden haben. Epochal gesehen setzt dieser Vorgang bei
der Revolution im Jahre 1848 ein. Der eigentliche Konflikt um die Steuerung dieses bewusst-
seinsformenden Mittels war ein Ringen um das Zensurrecht zwischen dem Staat und der Kirche.
Der Konflikt wurde in Europa nie bleibend gelöst. Einmal überwachte der überstarke Staat, das
andere mal die kulturell mächtige Kirche die Presse. In diesem Punkt verfolge ich die ungarische
Geschichte dieses Ringens nur insofern, als aus ihm hervorgeht, wie die ungarische katholische
Kirche in der Geschichte lernte, wie sie mit den Mitteln ihrer Feinde gegen diese kämpfen muss.
„Die Katholiken wurden sich dessen ziemlich spät bewusst, was für eine tiefgreifende und weit-
reichende Kraft in der Presse steckt und dadurch fiel die Presse beinahe in allen europäischen
Ländern in die Herrschaft überwiegend katholikenfeindlicher Richtungen... sie hat nicht selten
das unerfahrene Publikum misshandelt und ist mit einer Vorliebe in den Dienst der liberalen
Ideale, der Religionslosigkeit, der Glaubensgleichgültigkeit und der laxen Moral getreten“, so
schreibt im Artikel „Die Presse“ das Katholische Lexikon in Ungarn – mit einem stark antilibera-
listischen und antisemitistischen Einschlag.239
In Ungarn starteten die ersten katholischen Zeitschriften in den Zwanziger-Dreißigerjahren des
19. Jahrhunderts. Aber die erste katholische Tageszeitung wurde erst im Jahre 1860 von Antal
Lonkay gegründet: „Idők Tanúja“ (Der Zeuge der Zeiten), die auch nach dem Ausgleich die Sen-
dung besaß, den katholischen Gedanken zu verbreiten, dann aber unter dem neuen Namen „Ma-
gyar Állam“ (Der ungarische Staat).240 Sie blieb, ohne prägenden Einfluss auf das liberale Be-
wusstsein ausgeübt zu haben, bis 1908 am Leben.
Im letzten Drittel des Jahrhunderts entstanden einige Zeitschriften, die einen kämpferischen Ka-
tholizismus vertraten und die stark mit Antisemitismus belastet waren. Darunter sind zwei unbe-
238 A. a. O., 168f. 239 Bd. IV. 125-126 240 Hermann a. a. O. 504.
152
dingt zu nennen: „Religio“ und „Magyar Sion“ (bzw. „Új Magyar Sion“) Im letzteren Organ
publizierte einer der hervorragendsten Gestalten der katholischen Kirche dieser Zeit: Ottokár
Prohászka.
Tamás Dersi analysierte eingehend die Gesellschaftsauffassung der katholischen Presse des letz-
ten Jahrzehntes.241 Gemäß seiner Einsichten beherrschte diese Presse eine erbitterte Feindselig-
keit gegen den Liberalismus und die Juden. Die katholische Presse führte einen entschlossenen
Kulturkampf gegen die Zerrüttung der Einheit. Er zitiert dafür ein prägnantes Beispiel aus einer
Nummer von „Magyar Állam“ (18. Oktober 1899). Von den Liberalen sagt er: „Sie wühlen die
Besitzverhältnisse, die Institutionen durch, verfälschen die Verfassung, verhöhnen die Religion,
verletzen das Selbstgefühl, zerbrechen das Rückgrad des Volkes, verdrehen den Sinn der Moral,
beuteln die Bewohner aus, machen den Staat kaputt und entehren die Gesetze.“242 Die Presse
versuchte zwar einer innerkirchlichen Erneuerung und einer Stärkung der katholischen Identität
im Sinne von Rerum Novarum zu dienen, verdrehte aber die Intention dieser Enzyklika, weil sie
den Großgrundbesitz in Schutz nahm.243 Als ein Teil ihres Kampfes gegen die Sozialdemokratie
attackierte sie auch die Juden und formulierte die sloganartige Behauptung: Liberalismus und
Marxismus sind ihrer Religionsfeindlichkeit wegen wie Mutter und Kind, und beide seien eine
gemeine Sache der Juden.244
Auf solcher Weise rüstete besonders Béla Bangha SJ das Pressewesen auf und gründete eine
selbständige katholische Nachrichtenagentur („Magyar Kultúra“, später der heutige „Magyar
Kurir“). Auf ihrem Weg ging die katholische Presse in Ungarn ihre letzten selbstbewussten
Schritte bis 1950. In diesem Jahr unterjochte der Stalinismus die ganze ungarische Presse und
zwang sie in den Dienst seiner Ideologie. Das Milieu der katholischen Presse spiegelt allerdings
die Unfähigkeit der Toleranz gegenüber einer von der unabhängigen Presse vertretenen, autono-
men Weltauffassung wider.
Etwas Persönliches sei hier noch bemerkt. Als ich während des Schreibens dieses Punktes einen
ziemlich gutgebildeten Pfarrer aus meiner Stadt getroffen habe und erwähnte, worüber ich
schreibe, antwortete er: „Es ist wichtig aufzuzeigen, wie die Kirche die Presse aus den Händen
der Juden zurückzunehmen versuchte“. Seine Auffassung über die Besitzverhältnisse des ungari-
schen Pressewesens seit seinen Anfängen bis seiner Gegenwart spiegelt jene oben bemerkte Un-
fähigkeit wider, die auch im ungarischen „Heute“ eine Nachwirkung besitzt.
241 Dersi, A századvég katolikus sajtója [Die katholische Presse des Jahrhundertsende] 242 A. a. O., 118. 243 Magyar Állam 20. July 1893, zit. Dersi, a. a. O. 121. 244 A. a. O., 124-127.
153
Das Schulsystem
Die Schulen, oder im weiteren Sinn die systematische Erziehung, sichern den kulturellen Einfluss
einer Institution auf die breiten Schichten der Bevölkerung. Schulen in kirchlichen Händen und
später der Religionsunterricht in den nicht-kirchlichen Schulen bilden den nächsten Konflikt-
punkt in unserer Darstellung.
In Ungarn gehörten im Grunde genommen alle Schulen der katholischen oder der protestanti-
schen Kirche. Die Grund- oder Kleinschulen wurden im 18. Jahrhundert von den Dorfpfarrern
geführt, die von den zuständigen Bischöfen mit der Erhaltung oder Gründung von Schulen beauf-
tragt waren.245 Die Mittelschulen gehörten bis 1777 auch ganz zur Kirche bzw. zu den Kirchen.
Die katholischen Mittelschulen wurden von Orden betreut, besonders von den Jesuiten (bis zu
ihrer Auflösung und nach ihrer erneuten Zulassung) und von den Piaristen.
Die Anordnung von Maria Theresia, ihre Ratio educationis von 1777, bewirkte die einheitliche
Organisierung des ungarischen Schulsystems und stellte das Schulwesen unter staatliche Auf-
sicht, was aber die inhaltliche kirchliche Zuständigkeit nicht einschränkte. Nach Kaiser Joseph II.
gab Franz I. die zweite Ratio educationis (1806) heraus, in der ungarischsprachige Unterricht
gesichert wurde. Größere Bedeutung kam dem Gesetz über die Volksschulen von 1868 zu, durch
das die Kirche manche ihrer Grundschulen verloren hat, da das Gesetz diese Schulen unter die
Zuständigkeit der Bürgermeister in den Dörfern stellte. Diese Verordnung gehört auch zum Pro-
blemkreis der religiösen Toleranz, da nach der neuen Regelung die Dörfer „gemeinsame“ (d.h.
gemischte) oder gar konfessionsneutrale Schulen einrichten durften. Diese neue Situation berühr-
te schon enorm die Frage der kirchlichen Anwesenheit und der Besitzverhältnisse im Schulsy-
stem. In diesem Konflikt klammerte sich die Kirche an die gesetzliche Sicherung des
Religionsunterrichtes. Das Recht auf Religionsunterricht in den Schulen wurde bis zur
kommunistischen Ungarischen Räterepublik und dem ideologischen Kulturkampf des
Stalinismus nicht in Frage gestellt.
Am 21. März 1919 übernahm der Revolutionäre Regierende Rat die Macht und proklamierte die
Ungarische Räterepublik. Die zentrale und örtliche Macht übernahmen die Arbeiterräte. Für die
Aufrechthaltung der Ordnung im Lande sorgte die Rote Wache. Auch die Schulen wurden ver-
staatlicht, Kirche und Staat wurden gesetzlich vollkommen voneinander getrennt, man begann
mit einer breitgefächerten Aufklärungsarbeit.246 Es wurde angeordnet, dass die Schüler vom obli-
gatorischen Religionsunterricht befreit werden sollen. Primas Csernoch erhob am 18. und 23.
Januar Protest gegen die Abschaffung dieser Pflicht. Am ersten August wurde auf der letzten
dramatischen Tagung des Budapester Zentralen Arbeiterrates der Rücktritt des Revolutionären
245 Mészáros, Katolikus kisiskoláink 1717-1773 között [Unsere katholische Volksschulen zwischen 1717-1773]. 246 Hanák, Mitteleuropa 201-202.
154
Regierenden Rates bekannt gegeben, und am 1. März 1920 wählte die überwältigende Mehrheit
der Abgeordneten den 52jährigen Miklós Horthy zum Reichsverweser der – von einem steifen
Konservativismus und leidenschaftlichen Revanchismus beseelt – auch die Zuständigkeit der
Kirche im Schulsystem wiederherstellte. Bis 1948 blieb dann die überwiegende Mehrheit der
Schulen unter kirchlichem Einfluss, teils auf Grund der die Besitzverhältnisse, teils durch die
Orden und überall durch den obligatorischen Religionsunterricht. Gergely spricht sogar von ei-
nem Schulmonopol: „Die katholische Kirche konnte so ihr Schulmonopol der feudalistischen
Zeiten größtenteils auch in der bürgerlichen Epoche bis 1948 beibehalten.“247
Das Gesetz Nr. XXXIII aus dem Jahre 1948 verstaatlichte die kirchlichen Schulen – mit Aus-
nahme der ausschließlich kirchlichen Zwecken dienenden theologischen Hochschulen, Diakon-
und Diakonissen-Ausbildungsstätten. Die Gesetzverordnung Nr. V aus dem Jahre 1949 hob den
obligatorischen Religionsunterricht auf. Diese Verordnungen zeigen schon die gewaltige Kir-
chenfeindlichkeit der Ungarischen Revolutionären Arbeiter-und-Bauern-Regierung und beschlie-
ßen eine geschichtliche Epoche, in der die Kirche in Ungarn ihre Rechte im Unterrichtswesen
fast uneingeschränkt genießen konnte, was ihr einen bestimmenden Einfluss auf das kulturelle
Leben des Landes gesichert hatte. Im Fall des Schulsystems fällt also die Verweltlichung der
Gesellschaft mit dem stalinistischen Verordnungssystem zusammen, wie dies auch bei der Tren-
nung des Staates und der Kirche der Fall ist.
Die Trennung von Staat und Kirche
Die französische Revolution hat die Kirche vom Staat getrennt und diese Trennung durch ihre
ganze Geschichte beibehalten. Die katholische Religion war bis 1848 in Ungarn Staatsreligion.
Ihre Stellung bestimmte bereits der hl Stephan I., der Landesgründer. Die Frage der Einheit und
Trennung der beiden Organisationen ist keine bloß juristische oder offizielle gewalttechnische
Sache, sondern ein Problem der Möglichkeit der Verwirklichung grundlegendster Menschenrech-
te, sowie – was unsere Fragestellung betrifft – eine Grundbedingung des partnerschaftlichen
Kontakts von Staat und Kirche.
In diesem Punkt sehe ich bewusst ab von der Erörterung des Problemkreises der Komplizenschaft
der Kirche(n) mit dem „Thron“, die seit der sogenannten konstantinischen Wende die ganze Ge-
schichte des Christentums überschattet hat. Mir geht es hier nur um die Darstellung der Grund-
strukturen des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche in Ungarn, angefangen an dem Punkt, an
dem es erstmals in Frage gestellt worden ist. Die mit dieser Frage eng zusammenhängenden Pro-
bleme der religiösen Toleranz sowie der Misch- und Zivilehen wurden schon zuvor erörtert. So
bleibt noch die Skizzierung des Prozesses übrig, wie es in der ungarischen Geschichte dazu ge-
247 Gergely, Katolikus egyház magyar társadalom [Die katholische Kirche und die ungarische Gesellschaft] 54.
155
kommen ist, dass nach der misslungenen „Vorübung“ der Trennung durch die Räterepublik
(1919) die Trennung des Staates von der Kirche im Jahre 1948 stattgefunden hat.
Die Interessen an der Trennung müssen in zwei Unterpunkten behandelt werden, wobei der Un-
terschied im Kreis der Initiatoren besteht.
Die katholische Autonomiebewegung des liberalen Katholizismus
In den Jahren 1851 und 1854 erschien das zweibändige Werk von József Eötvös, dem damaligen
Kultusminister: „Der Einfluss der herrschenden Ideale des 19. Jahrhunderts auf das Staatswesen“,
in dem er die liberalen Prinzipien des Verhältnisses des Staates gegenüber der Kirche entwickelt
hat. Seine Darlegungen holten die Forderung der „katholischen Autonomie“ aus der Vergessen-
heit zurück, zu der erstmals am 7. April 1848 ein Gesetzentwurf zur gesetzlichen Aufhebung der
katholischen Religion als Staatsreligion als Petition eingereicht worden war. Die Ideen von Eöt-
vös, die in vielem jenen von Lammenais und Montalambert ähnelten, gründeten sich auf ein au-
tonomes Verhältnis der Kirche zum Staat. Er führte u.a. aus: „Eine Religion, die auf die Unter-
stützung des Staates angewiesen ist oder die auch nur ihren Status dem Staat zu verdanken hat,
kann ihm nichts nutzen; die Situation, die der Kirche im Staat gegeben wurde, steht gerade im
Gegensatz zu den Grundidealen des Christentums, durch welche Ideale es seinen großen Einfluss
auf unsere Verbürgerlichung auszuüben vermochte“. „Wenn der Staat vom Christentum eine
Unterstützung erhalten will, muss er es befreien, sonst wäre nur eine Staatsreligion möglich und
kein Christentum, da der Staat von den von der Religion aufgestellten Prinzipien abhängig sein
muss, und nicht umgekehrt.“248
Die katholische Autonomie bedeutete somit die vollkommene Unabhängigkeit der Kirche vom
Staat: damit wurde aber auch der Staat zum freien Staat; zugleich sicherte das ein Mitsprache-
recht der Laien in den Sachen der Kirche. Die Parole lautete: „Freie Kirche im freien Staat. Die
Bischöfe verstanden demgegenüber unter Autonomie nur die autonome Verwaltung der Kirche
(d.h. diese Verwaltung sollte nicht zum Kultusministerium gehören, sondern soll eine innere
Angelegenheit der Kirche sein) und weniger das Mitspracherecht der Laien.“249 Radikalere
Stimmen gingen aber so weit, dass die Kirche von Rom, vom Staat und von der eigenen Hierar-
chie emanzipiert werden sollte. Sie forderten eine innere Erneuerung der Kirche: ihre Demokrati-
sierung und Dezentralisierung, eine freie Schule, die zivile Ehe, die Aufhebung des Pflichtzöli-
bats. Diese liberalen Gedanken haben eine breite Resonanz im niederen Klerus gefunden. Es
handelte sich für die liberalen Katholiken darum, von den traditionellen Bindungen losgelöst, ihr
Engagement für die Erneuerung der Gesellschaft ausüben zu können.
248 Eötvös, A XIX. század II. 424 und 432. 249 Hermann a. a. O. 446.
156
Die Liberalen wollten die Autonomie noch vor dem Ende des Ersten Vaticanums verwirklichen,
sie wollten ihre Kongresse und Wahlen abhalten, um mit dieser neuen Struktur der Gesellschaft
dienlich werden zu können. In der Autonomie sollten 2/3 der Stimmen die Laien bekommen, was
das herrschende Prinzip stark gefährdet hätte; dass es eine möglichst große Übereinstimmung mit
dem Episkopat geben müsse. Die ersten Kongresse arbeiteten mehr an der Strategie der Abhand-
lungen als über die Standfestigkeit der Prinzipien. Inzwischen verabschiedete das Konzil sein
Dogma über die päpstliche Infallibilität, wodurch die katholische Hierarchie mit Sicherheit damit
rechnen konnte, dass Rom die Beschlüsse der Autonomie nicht gutheißen würde. Sie wusste,
dass unter Papst Pius IX. die eine Dezentralisierung und Partikularisierung anstrebende Autono-
mie zum hierarchischen und zentralistischen Charakter der Kirche im Gegensatz steht. So wurde
die Autonomiefrage ab 1871 auf Grund der Bitte des Episkopats ad acta gelegt. „Seit 1871 wollte
keine verantwortliche Kraft ernsthaft die Verwirklichung der Autonomie. Die Regierung wollte
sie nicht, da sie die katholischen Güter nicht verlieren wollte, der König wollte sie nicht, da sie
das Patronatsrecht verkürzen würde, Rom wollte sie nicht, da sie im Gegensatz zum hierarchi-
schen System der katholischen Kirche stünde.“250
Somit war die katholische Autonomie weniger eine Bestrebung als vielmehr eine politische
Technik, die nationalen Probleme des Landes nach dem Ausgleich sowie die liberalen Bestre-
bungen, nicht zuletzt zur Stärkung der Regierung, miteinander zu verknüpfen.251 Mit der Elimi-
nierung der Autonomiebestrebungen verabschiedete sich die katholische Kirche Ungarns von
einer möglichen Lösung der Vereinbarung der liberalen Ideale mit der christlichen Grundtraditi-
on, die ihr einen weltweiten Rang hätte beimessen können. „Unter günstigeren Umständen hätte
aus der christlichen Bildung von Deák und Eötvös ein Kern der neuen Richtung erwachsen kön-
nen. Statt dessen musste die katholische Richtung, belastet mit dem Fluch der Freundschaft mit
Österreich, den Platz dem Liberalismus und dem Materialismus übergeben“: so fasst die Konse-
quenzen dieser Entwicklung Szegfű zusammen.252 Die „feudale“ Selbstbetrachtung aber auch das
feudale Rechtswesen lebte bis 1949 weiter.
Die Trennung durch die kommunistische Regierung
Juristisch gesehen spricht man gewöhnlich von der „Trennung“ von Staat und Kirche in Ungarn,
als 20. Gesetz aus dem Jahre 1949:
„1. Die Ungarische Volksrepublik gewährleistet den Bürgern die Gewissensfreiheit sowie das Recht der freien
Religionsausübung.
250 Hermann a. a. O. 452. 251 Die Aktualität der Interesse für die Thematik der Autonomiebewegung zeigt das Sammelband von Sarnyai, Állam
és egyház. Sowie auch seine diesbezügliche Dissertation von 2001. 252 Szegfű, Három nemzedék [Drei Generationen] 228.
157
2. Im Interesse der Gewährleistung der Gewissensfreiheit verfügt die Ungarische Volksrepublik die Trennung
zwischen Kirche und Staat.“253
Gergely will der Trennung den folgenden Inhalt geben: „In dem Prozess der volksdemokrati-
schen Revolution kam es zu der Ausführung der wichtigsten Anliegen der Säkularisation bürger-
lich-liberaler Art. Diese Aufgabe erbte die Revolution aus der geschichtlichen Tradition als Kon-
sequenz der unvollendeten und halbheitlichen bürgerlichen Entwicklung“.254 Diese Deutung ist
aber unzulässig, da die „Trennung“ durch die kommunistischen Machthaber in praxi zu einer den
Josephinismus übertreffenden Unterdrückung und Abhängigkeit führte. Die ausschließlich juri-
stische Sicht soll also mit der geschichtlichen und politischen ergänzt werden.
Durch das Unterjochen der Kirche(n) wurde die historische Entwicklung des kirchlichen Status
blitzartig unterbrochen, wodurch die Kirche in eine Art politisches Vakuum geraten ist. Obwohl
ihre Rechte in der Verfassung gesichert waren, betrieb das Staatliche Kirchenamt ihre Verfol-
gung ebenfalls auf gesetzlicher Basis (aufgestellt im Jahre 1951 mit dem Gesetz Nr. 1 „Zur Ver-
richtung der Obliegenheiten zwischen dem Staate und den Religionsgemeinschaften, insbesonde-
re zum Zwecke der Durchführung der mit den einzelnen Religionsgemeinschaften getroffenen
Abkommen und Vereinbarungen sowie im Interesse der Unterstützung der Religionsgemein-
schaften von Seiten des Staates“255).
Aus diesen zwei exemplarischen Darstellungen wird klar, dass die „klassische Trennung“ von
Staat und Kirche in Ungarn als Aufgabe in der Regierung und der Kirche(n) noch bevorsteht. Die
traditionelle Rolle der Kirche bis zur rechtlichen Trennung von 1949 sowie die rechtlich gesi-
cherte staatliche Abhängigkeitslage und ihre Konsequenzen machten für die Kirche die Neube-
stimmung ihres Verhältnisses zum Staat unmöglich.
KIRCHE UNTER DEM SOZIALISMUS
In diesem Punkt möchte ich die Grundstruktur des Verhältnisses von Staat und Kirche unter dem
Kommunismus darstellen. Ich beschränke mich nur auf die wichtigsten Elemente, die das Ver-
stehen der Hintergründe künftiger kirchlicher Alternativen aus der Geschichte her erleichtern
können. Über systematischen sozialwissenschaftlichen und historischen Analysen dieser trauri-
gen Epoche verfügt man immer mehr. Über eine theologische Analyse aber noch nicht. Diese
Arbeit ist bewusst keine Geschichtsstudie. Daher braucht sie nicht auf die detaillierte Beschrei-
bung der letzten 40 Jahre der ungarischen Kirchengeschichte eingehen. Ich wähle auch lieber den
253 Zit. András/Morel, 1969 82. 254 Gergely, a. a. O. 101. 255 In: András/Morel, Bilanz der ungarischen Katholizismus 85.
158
Weg der Bilder, um die Möglichkeiten der Kirche auf die entsprechenden Herausforderungen der
„Zeichen der Zeit“ in Ungarn beleuchten zu können.
Babylonische Gefangenschaft
Das Alte Testament malt zwei große Gefangenschaftsbilder: das „ägyptische“ und das „babyloni-
sche“. Die Charakteristiken der beiden Gefangenschaften gehen auseinander.
Charakteristisch für die ägyptische Gefangenschaft ist: klare Verhältnisse mit den ägyptischen
Herrschern; klares Erkennen der Situation als Gefängnis und daher eindeutiger Wunsch nach
Befreiung; Kampf (mit Gott) gegen den Pharao und Sieg über ihn; Verheißung Kanaans und
Glauben an diese; starke Identität des Volkes.
Charakteristika der babylonischen Gefangenschaft sind hingegen: Anpassung an die babyloni-
schen Verhältnisse; kein starker Gegensatz zwischen den Fronten; Babylon löst sich auf, daher
kein Auszug; kein neues Land, sondern das Wiederbeleben des Alten; die Identität des Volkes ist
schwach.
Meine These:
Das Bild der „ägyptischen Gefangenschaft“ erklärt die Situation der Kirche unter der stalinisti-
schen Herrschaft (1950-1964), für die zweite Phase der Epoche ist aber das der „babyloni-
schen“ geeignet (1964-1988 bzw. 1990).
Die kommunistischen Machthaber versuchten die ganze Gesellschaft zu „demobilisieren“.256
Dabei sahen sie als stärksten Feind die katholische Kirche, die für die neue Regierung die ausge-
prägteste Unterstützung der alten Ära bedeutete. Der Kampf gegen die Kirche verlief wie folgt:
„Im Dezember 1948 wurde Kardinal Mindszenty, das Oberhaupt der katholischen Kirche, verhaf-
tet und zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Innerhalb der Priesterschaft versuchte man,
eine Spaltung herbeizuführen. Nachdem der Versuch, eine ungarische Nationalkirche zu gründen,
fehlgeschlagen war, organisierte man eine kircheninterne Bewegung, die Friedenspriesterbewe-
gung, um die Bischöfe unter Druck zu setzen. Gleichzeitig wurden mit Berufung auf eine polizei-
lich notwendige Maßnahme insgesamt 3500 Ordensleute interniert. Schließlich kam am
30.August 1950 ein Abkommen zustande.
Der Kampf gegen die Kirche ging indessen auch in der Folge weiter: Die Tätigkeit der religiösen
Orden wurde mit wenigen Ausnahmen verboten, mehrere Bischöfe unter Hausarrest gestellt.
József Grősz, Erzbischof von Kalocsa, der das Abkommen unterzeichnet hatte, verurteilte man zu
15 Jahren Gefängnis. Der Staat gründete eine eigene Institution, das Staatliche Kirchenamt, und
256 Hankiss, Keleteurópai alternatívák [Osteuropäische Alternativen] 27-73.
159
setzte in die Ordinariatskanzleien staatliche Funktionäre ein; die personelle Besetzung der Kir-
chenämter bedurfte nunmehr jeweils der staatlichen Zustimmung. Die Knabenseminare wurden
aufgelöst, die Zahl der Priesterseminare von dreizehn auf sechs reduziert.“257
Besonders kennzeichnend ist, wie der Staat die Kirchenleitung in den Dienst seiner unterdrücke-
rischen Ziele gestellt hat. Dies geschah im Übereinkommen von 1950. Bezeichnend sind beson-
ders sein erster und zweiter Punkt:
„Das Bischofskollegium anerkennt und fördert aus staatsbürgerlichem Pflichtgefühl heraus die
Staatsordnung und die Verfassung der Ungarischen Volksrepublik. Es erklärt, dass gegen jene
kirchlichen Personen, die sich gegen die gesetzmäßige Ordnung der Ungarischen Volksrepublik
sowie, gegen die Aufbauarbeit ihrer Regierung stellen, den kirchlichen Gesetzen gemäß vorge-
gangen wird.
Das Bischofskollegium verurteilt entschieden jegliche, gleich woher rührende, gegen die staatli-
che und gesellschaftliche Ordnung der Ungarischen Volksrepublik gerichtete aufrührerische Tä-
tigkeit. Es erklärt, dass es keinerlei missbräuchliche, der religiösen Gesinnung der Gläubigen
oder der katholischen Kirche entgegengesetzte Tätigkeit gestattet, die auf staatsfeindliche politi-
sche Ziele ausgerichtet ist.“258
Diese Verordnung verpflichtete die Bischöfe dazu, die Loyalität der Volksrepublik gegenüber als
Richtlinie ihrer kircheninternen Tätigkeit zu nehmen.
In dieser Epoche versuchte die Kirchenleitung die Einheit der Kirche zu bewahren. Hinter der
öffentlichen Loyalität behielt die Kirche als ganze ihre andersartige Einstellung, und von enormer
Angst heimgesucht, versuchte sie ihre Grundaufgaben teils in den Kirchengebäuden, teils im
Untergrund zu erfüllen. Zeugnisse dieser Weigerung sind die vielen Prozesse gegen aktive Prie-
ster und Laien.259
Der staatliche Totalitätsanspruch nutzte die stark hierarchische Gliederung der ungarischen Kir-
che aus. Aus diesem Blickwinkel fand der totalitäre Kommunismus in der Kirche symmetrische
Strukturen vor.
„Der Totalitätsanspruch des sozialistischen Staates erfordert die Eingliederung auch der religiö-
sen Organisationsformen ins Gesamtgefüge der staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen.
Im Interesse dieser Eingliederung ist der hierarchische Aufbau der Kirche erwünscht: Er wird
begrüßt und verstärkt – auch bei Religionsgemeinschaften andersgearteten Tradition. Bei der
pyramidenförmigen Organisation werden höhere Instanzen für alle unteren verantwortlich ge-
macht. Entsprechend wird von unteren Instanzen eine vollkommene Unterordnung, bis hin zum
257 András, Das „Cultural Lag“ 26. 258 András/Morel a. a. O. 83-84.
160
Verlust der Selbständigkeit, erwartet. Informationsfluss und Befehlswege sind dabei übersicht-
lich.“ 260
Unterstützt von der damaligen kommunistenfeindlichen Ostpolitik des Vatikans und begeistert
von den Gebeten des Papstes und der Christen für die „schweigende Kirche hinter dem eisernen
Vorhang“ hoffte die katholische Kirche, dass diese Periode der totalen Unterdrückung bald vorü-
bergeht und die Kirche wieder die ihrer Tradition gerechte Stellung in der Gesellschaft erhalten
wird.
Der Verlauf der Weltgeschichte musste die Kirche ernüchtern. Die von manchen erwartete „Be-
freiung“ hat sich als unerfüllbare Hoffnung erwiesen. Selbst nach Stalins Tod (1953) und nach
der teils erfolgreichen, wenn auch niedergeschlagenen Revolution von 1956 musste die Kirche
mit einem langen Zusammenleben unter der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei rechnen.
Auch in Westeuropa zog der Kalte Krieg ein. Es sah in der Aufteilung der Welt von Jalta einen
status quo, dessen Beibehaltung die Wahrscheinlichkeit eines Dritten Weltkrieges geringer
macht. Die Ostpolitik des Vatikans hat auch dieser geteilten Europalage Rechnung getragen und
unter Papst Paul VI. (besonders unter Kardinal Casaroli) einen neuen „friedlicheren Kurs“ dem
Ostblock gegenüber begonnen. Andererseits „suchten... die sozialistischen Regierungen Kontakt
mit dem Heiligen Stuhl, um auf diesem Wege Einfluss auf die Kirche zu gewinnen und die Ka-
tholiken in ihrem Machtbereich leichter an ihren Kurs binden zu können“261.
So kam es zu dem sogenannten Teilabkommen zwischen dem Vatikan und der ungarischen Re-
gierung im Jahre 1964. Da der Text auch heute noch nicht veröffentlicht ist, kann ich nur das
damalige Pressekommuniqué von Magyar Kurir (15. September 1964) zitieren:
„Die Regierung der Ungarischen Volksrepublik und der Hl. Stuhl sind übereingekommen, das
Ergebnis der bisher geführten Verhandlungen in einem für beide Teile verbindlichen Dokument
festzuhalten... Beide Teile haben ihrer Bereitschaft Ausdruck verliehen, auch in Zukunft den
Gedankenaustausch zu pflegen mit dem Bestreben, nach Möglichkeit auch in anderen Fragen
Übereinkommen zu erzielen.“262
Das Übereinkommen wandelte die ägyptische Gefangenschaft zu einer „babylonischen“. Ich
zitiere András: „Der Heilige Stuhl setzte neue Bischöfe ein... Für die ungarische Kirchenpolitik
bedeuten die Sechzigerjahre eine Periode der Konsolidierung zwischen Kirche und Staat, in der
die Kirche Ungarns ihren Platz innerhalb des Sozialismus gefunden hat. Mit der Ernennung von
Dr. László Lékai zum Erzbischof von Esztergom und damit zum Primas von Ungarn im Februar
259 Zwischen 1952-1971 5 Prozesse. 260 Pseudonym: Georgius Frater, Zur Trennung von Staat und Kirche. 261 Adriányi in Jedin, Handbuch der Kirchengeschichte. Bd. VI. 324. 262 Zit. András/Morel a. a. O. 93.
161
1976 konnte man schließlich die Periode des offenen Kirchenkampfes als beendet ansehen“.263
Die neue Periode ist mit der Bezeichnung „das gute Verhältnis zwischen Staat und Kirche“ in die
ungarische Geschichtsschreibung eingegangen – auch in die der katholischen Kirche.
Die Partei und die von ihr gesteuerte Regierung sahen in den Kirchen keine Feinde der Ungari-
schen Volksrepublik mehr. Die ideologische Voraussetzungen der Feindschaft verschwanden u.a.
auch dadurch, dass russische Religionsforscher immer lauter ihre neuen Ansichten verkündeten,
dass die sozialistische Gesellschaft mit einem längeren Zusammenleben mit den Kirchen rechnen
müsse. Die „Pax Kadariensis“ ermöglichte eine innere Freiheit der Kirche, die allerdings durch
die ständige Überwachung vom Staatlichen Kirchenamt und durch die (manchmal als übergroß
erscheinende) Anpassung des höheren Klerus und der Bischöfe an die staatlichen Interessen be-
grenzt wurde. „Mit der Zeit ging man innerhalb der Kirche bei jeder seelsorglichen und kirchlich-
administrativen Frage von der Überlegung aus, wie sich der zuständige Staatsbeamte wohl dazu
stellen werde und wie man sein Einverständnis werde erringen können. Solcherart war es relativ
einfach, die kirchlichen Führer dazu zu bringen, in Erklärungen und politische Gesten einzuwilli-
gen, die den allgemeinen Bestrebungen des Staates entsprachen.“264
Da die innenkirchliche Arbeit in dem oben skizzierten Rahmen fast ungestört betrieben werden
konnte – was etwa den Religionsunterricht oder die Sakramentenspendung betrifft –, begannen
sich nach und nach alle Priester und aktiven Laien mit dem „modus vivendi“ des „Sakristeiexi-
stenz“ abzufinden. Diese allgemeine Anpassung verstärkte die Sensibilität und inneren Abwehr-
mechanismen gegenüber Aktivitäten oder Ideen, die diese ruhige kirchliche Lage stören würden.
Der so gestaltete „modus vivendi“ wurde vom Klerus traditionell-klerikaler Auffassung ge-
schätzt. Er hat „die Situation nicht erlitten, sondern eigentlich als günstig“ eingeschätzt. So wur-
de aus der Situation der „babylonischen Gefangenschaft“ eine innere Orientierungsgrundlage, die
die Interessen und die Aktivitäten der Kirche bestimmten. Durch die Lähmungstechnik des Kada-
rismus und durch das klerikalistische System der ungarischen katholischen Kirche war es relativ
einfach, die Bestellung und den Aufstieg der Amtsträger oft im Gegensatz zu innenkirchlichen
Zielen durch die Loyalität den Regimezielen gegenüber zu bestimmen. Dadurch stabilisierte sich
das ungarische politische System, das sein humanistisches Image öfter durch die gelöste Kirchen-
frage in Richtung Westen demonstrierte. Ich nenne dieses staatliche Umgehen mit der Kirche
Instrumentalisierung.
Am Ende dieser Epoche der „babylonischen Gefangenschaft“ begann „Babylon“ zu wackeln. Die
einzige Partei und ihre Regierung gerieten in eine Krise, die nicht mehr durch Scheinlösungen
263 András a. a. O. 226. 264 András a. a. O. 226.
162
behoben werden konnte.265 Die Kirche kann nun mit all ihren Institutionen und Gläubigen „zu-
rückkehren“ – aber wohin? „Die wichtigste Frage, auf welche die ungarische Theologie (aber
auch die Kirche als ganze – Bemerkung von mir) Antwort geben muss... Welche Rolle kommt
der Kirche im heutigen sozialistischen (im Jahr 1990 muss man schon pluralistischen sagen –
Anmerkung von mir) Ungarn zu? Die Forderung nach einer eindeutigen und bindenden Antwort
auf diese fundamentale Frage hat in den Überlegungen, als was sich die Kirche Ungarns in der
heutigen Zeit verstehe, eine wahrhafte Krise hervorgerufen. Eine klare Antwort gibt es auch heu-
te noch nicht.“266
Behinderte Trauer
Das zweite Bild für die nuancierte Deutung der Situation der Kirche unter dem Sozialismus ent-
nehme ich aus der Erfahrungen der Psychoanalyse: die behinderte Trauer.
Freud definiert das Phänomen der Trauer wie folgt: „Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den
Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland,
Freiheit, ein Ideal usw. Die schwere Trauer... enthält die nämliche schmerzliche Stimmung, den
Verlust des Interesses für die Außenwelt... den Verlust der Fähigkeit, irgendein neues Liebesob-
jekt zu wählen... die Abwendung von jeder Leistung, die nicht mit dem Andenken des Verstorbe-
nen in Beziehung steht. Wir fassen es leicht, dass diese Hemmung und Einschränkung des Ichs
der Ausdruck der ausschließlichen Hingabe an die Trauer ist, wobei für andere Absichten und
Interessen nichts übrigbleibt.267
Über die Arbeit der Trauernden schreibt er weiter: „Die Realitätsprüfung hat gezeigt, dass das
geliebte Objekt nicht mehr besteht, und erlässt nun die Aufforderung, alle Libido aus ihren Ver-
knüpfungen mit diesem Objekt abzuziehen. Dagegen erhebt sich ein begreifliches Sträuben...
Dies Sträuben kann so intensiv sein, dass eine Abwendung von der Realität und ein Festhalten
des Objekts durch halluzinatorische Wunschpsychose zustande kommt. Das Normale ist, dass der
Respekt vor der Realität den Sieg behält. Tatsächlich wird das Ich nach der Vollendung der
Trauerarbeit wieder frei und ungehemmt.“268 „Die normale Trauer überwindet den Verlust des
Objekts und absorbiert gleichfalls während ihres Bestandes alle Energien des Ichs.“269
Yorick Spiegel unterscheidet vier Phasen der Trauer. „Die erste Phase ist die des Schocks, der die
Regression einleitet. Sie kommt aber noch nicht zum vollen Ausbruch, da in der 2. Phase der
Kontrolle Familie, Umwelt und professionelle Krisen sie kurzfristig abfangen. In den zwei ab-
265 Hankiss, Keleteurópai alternatívák 144-156. 266 András a. a. O. 228. 267 Freud, Trauer und Melancholie 197f. 268 A. a. O., 198f. 269 A. a. O., 208.
163
schließenden Phasen ist der Trauernde dagegen weitgehend sich selber überlassen. In der 3. Pha-
se überwiegt regressives Verhalten, während in der 4. Phase schrittweise eine neue Anpassung an
das gesellschaftlich Geforderte erreicht wird.... Die Phase des Schocks hält meist nur für wenige
Stunden an und ist auch bei längerer Dauer normale weise nach ein bis zwei Tagen vorüber. Die
kontrollierte Phase erreicht ihr Ende mit der Beerdigung und der Abreise der Verwandten, also
zwischen drei und sieben Tagen. Das regressive Stadium ist bereits nach vier bis sechs bzw.
sechs bis zehn Wochen durchgestanden. Die adaptive Phase schließlich endet rund sechs Monate
(spätestens ein Jahr) nach dem Tod.270
Dieser normale Ablauf der Trauer kann aber gestört werden. „Generell kann man sagen, dass
dann von einer pathologischen Trauer gesprochen werden kann, wenn der Trauerprozess in einer
der drei erstgenannten Phasen hängen bleibt. Der Schock kann unter bestimmten Bedingungen so
groß sein, dass die Regression der Trauer überhaupt nicht in Gang kommt (behinderte Trauer).271
Wenn die Trauerarbeit gestört und unvollkommen geleistet wird, dann bleibt der Patient in einer
pathologischen Bindung zu dem Verstorbenen und kann leicht z.B. in eine voreilige (zweite) Ehe
hineingehen. Der neue Ehepartner wird nicht nach seinen unverwechselbaren eigenen Eigen-
schaften ausgewählt, sonder nach seiner erinnernden Funktion.
Dieses Bild kann nunmehr auf die Entwicklung der ungarischen Kirche zwischen 1950-1988
oder auch nach 1988 angewendet werden.
Plötzliches Sterben der traditionellen Rolle der katholischen Kirche Ungarns in der Periode
1948-1950. Die enorme und gewaltige Umwandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse, darunter
besonders des kirchlichen Status innerhalb der nicht mehr christentümlichen Gesellschaft, traf die
Kirche als ein Schock. Das kirchliche Bewusstsein war gar nicht imstande, diese schockierende
Wende der Geschichte aufzugreifen, nüchtern zu reflektieren und mit den neuen Machthabern
und der neuartigen Situation ins Gespräch zu kommen.
Die strenge und systematische Demobilisation der Gesellschaft und die Aufhebung bzw. das
Auslaugen aller kirchlichen Institutionen, sowie die contraselektive Ersetzung kirchlicher Schlüs-
selfiguren mit staatsloyalen Marionettfiguren entzogen der Kirche jedwede Grundlage für eine
Reflexion der neuen Situation. Diese Unmöglichkeit bedeutet ein pathologisches Stehen bleiben
am Sterbebett der feudal-klerikalen Rolle der Kirche, also ein Steckenbleiben in der Schockpha-
se.
Die lange Dauer dieses Zustandes verursachte in der Kirche eine Bereitschaft zur Kollaboration
mit den neuen Rollenspielern der Gesellschaft. Da dies aber ohne Aufarbeitung der (weiteren und
270 Spiegel, Der Prozeß des Trauerns 58f. 271 A. a. O., 59.
164
schon auch der näheren) kirchlichen Vergangenheit zustande gekommen ist, ist die Kirche zu
einer Komplizenschaft mit den von Kommunisten bestimmten Trägern der gesellschaftlichen
Prozesse geraten, ohne ihrer eigenen Berufung hinreichend gerecht werden zu können. So spielte
die Kirche seit Kard. Lékai eine Rolle in Ungarn, die ihrer Form nach zwar ihrer geschichtlichen
Rolle ähnlich ist, ihrem Inhalt nach aber eine tragische Art von (pastoraler) Untätigkeit darstellt.
Diese geschichtliche oder politische Schizophrenie macht nicht nur ein gerechtes Verhältnis ge-
genüber profanen Faktoren des gesellschaftlichen Lebens unmöglich, sondern hemmt auch die
innenkirchliche Erneuerung.
Mit den Jahren seit 1988 ist für die katholische Kirche die Zeit gekommen, sich auf eine Therapie
einzulassen, wobei die inhaltlichen Rahmenbedingungen mit dem originellen Geist des Zweiten
Vaticanums durchaus gegeben sind.
Das unvollkommen durchgeführte Trauerarbeit braucht Erinnerung und Durcharbeiten. Freud
beschreibt diese Behandlungstechnik. „Der Arzt deckt die dem Kranken unbekannten Widerstän-
de auf... Das Ziel ist: deskriptiv: die Ausfüllung der Lücken der Erinnerung, dynamisch: die Ü-
berwindung der Verdrängungswiderstände... Die Überwindung der Widerstände wird bekanntlich
dadurch eingeleitet, dass der Arzt den vom Analysierten niemals erkannten Widerstand aufdeckt
und ihn dem Patienten mitteilt... Man muss dem Kranken die Zeit lassen, sich in dem ihm nun
bekannten Widerstand zu vertiefen, ihn durchzuarbeiten, ihn zu überwinden... Der Arzt hat dabei
nichts anderes zu tun, als zuzuwarten und einen Ablauf zuzulassen, der nicht vermieden, auch
nicht immer beschleunigt werden kann... Dieses Durcharbeiten der Widerstände mag in der Pra-
xis zu einer beschwerlichen Aufgabe für den Analysierten und zu einer Geduldsprobe für den
Arzt werden. Es ist aber jenes Stück der Arbeit, welches die größte verändernde Einwirkung auf
den Patienten hat...“272
Die geschichtliche Darstellung und die theologische Deutung Ungarns zeigte mindestens in gro-
ben Skizzen, dass hier (auch) vor allem Eindeutigkeit zu vermeiden ist. Die geschichtlichen Er-
fahrungen und die vielfältigen Deutungen sind so divers, dass eine abrundende Auslegung die
weitere hermeneutischen Prozesse nur blockiert und nicht weiterführt. An nichts mehr mangelt es
in Ungarn und auch in ganz Ost(Mittel)Europa , als an einem ruhigen, Gesellschaft und Frieden
stiftenden Nachdenken über die Identität unter den gnadenlos anstürmenden Herausforderungen.
In den weiteren Kapiteln werden – als Durchführungen – sehr konkrete, das gesellschaftliche und
kirchliche Denken sehr bestimmende Fragen behandelt. Die erste Frage ist zeitgeschichtlicher
Art, die anderen betreffen mehr die zukünftigen Entwicklungen. Zuerst wird über die Frage An-
passung und/oder Widerstand in der sozialistischen Zeit nachgedacht. Dann drei weiteren Fragen,
272 Freud, Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten 207 und 214-215.
165
worüber in dieser Region viel diskutiert wird, und daher repräsentieren sie weitgehend das theo-
logische Denken von hier und heute. Die erste Frage lautet: sind die Laien träger der konziliaren
Erneuerung der Kirche. Die zweite: ist die Kultur von Ost(Mittel)Europa eine säkulare Kultur?
Und schließlich die dritte: was für eine Rolle kann die Kirche in dem Prozess der Osterweiterung
der Europäischen Union spielen. Mit der Wahl dieses letzteren Themas sollte auch ein Zeichen
gesetzt werden, dass es in dieser Region der aktuelle Kontext immer weniger die politische
Zweiteilung Europas und ihre Folgen für die Religion und Kirche bestimmt wird, sondern es
kommen neuere Faktoren ins Spiel, deren Betrachtung nicht von einer historisierenden Nabel-
schau verhindert werden darf.
166
ZUKUNFT DER VERGANGENHEIT
Auftakt
Nach dem prophetischen Sündenbekenntnis des Papstes am Beginn des Millenniums liegt es auf
der Hand, das Thema Konformismus und Widerstand der Katholischen Kirche in Ost(Mittel)-
Europa eingebettet in den theologischen und liturgischen Rahmen zusammenfassend zu behan-
deln. Im Apostolischen Schreiben Tertio Millennio Adveniente (Nr. 33-36) kündigte der Papst an,
dass das Jubiläum des Jahres 2000 die Gelegenheit zu einer „Reinigung des Gedächtnisses“ der
Kirche „von allen Denk- und Handlungsweisen, die im Verlauf des vergangenen Millenniums
geradezu Formen eines Gegenzeugnisses und Skandals darstellten“, biete.
„Somit gehört zum Weg der Kirche auch das Bekenntnis zur Erneuerung und die Bitte um Verge-
bung (ecclesia semper reformanda). Die Kirche gewinnt damit an Glaubwürdigkeit vor Gott und
den Menschen. Sie dient der Einheit der Menschen unterschiedlicher Kulturen, Religionsrichtun-
gen und Weltanschauungen, wenn sie um Vergebung bittet für das Übel, das in der Vergangen-
heit von Gliedern der Kirche und gerade auch von ihren Repräsentanten den Menschen anderer
Gemeinschaften zugefügt worden ist. Zwar gibt es keine Kollektivschuld, deren Zurechnung eine
Verletzung der ethischen Verantwortung jeder Person für ihre eigenen Taten wäre. Aber Verant-
wortung, Schuldübernahme und Bitte um Verzeihung dienen einer ‚Reinigung des Gedächtnis-
ses’, das Menschen und Menschengruppen auch über die Generationen miteinander verbindet
oder trennt und gegeneinander aufbringt.“273
Unser Ziel kann es nicht sein, alle Spezialitäten und Tatsachen, die zum komplexen Thema Kon-
formismus und Widerstand gehören, zu referieren. Unser Ziel ist es vielmehr, übersichtlich die
Konturen der Problematik zu schildern und dabei die wichtigsten Ähnlichkeiten und Verschie-
denheiten in den postkommunistischen Ländern Ost(Mittel)Europas aufzuzeigen. Die For-
schungslage zum Thema ist je nach Land verschieden. Die meisten Analysen und Berichte er-
schienen sicherlich in Deutschland. Die kirchlichen und staatlichen Archive sind dort seit der
Wende zugänglich, es wurde auch kirchlicherseits eine Untersuchungskommission eingerichtet.
In anderen Ländern dagegen wurde die Archive erst in den letzten Jahren geöffnet gemacht und
es wurde bis heute keine von der Kirche initiierte Forschung begonnen. In diesen Ländern – vor
allem in Slowenien, Ungarn und Rumänien – wurden die diesbezüglichen Forschungsarbeiten
u.a. durch die Förderungen des Pastoralen Forums im Rahmen der Forschung AUFBRUCH©
273 Internationale Theologische Kommission: Erinnern und Versöhnen. Die Kirche und die Verfehlungen in ihrer Ver-gangenheit (22. Februar 2000), Vorwort zur deutschen Ausgabe.
167
begonnen, beruhen daher auf ganz primären und originellen Datenerhebungen und sind in ihrer
Darstellung stark durch die einzelnen Autoren geprägt.
Der erste Teil dieser Behandlung erschien in dem Sammelband: Kirche im Aufbruch.274 Die dor-
tige Version wurde an Hand der theologischen Zielsetzung dieses Buches überarbeitet und weit-
gehend ergänzt. Wegen der engen Zusammengehörigkeit der ausführlichen komparativen Zu-
sammenfassung, der historischen Trauerarbeit in den untersuchten Ländern und der theologi-
schen Betrachtung ist es m. E. nicht ausreichend, einfach nur auf diese bereits erwähnte Studie
hinzuweisen. Sie wird hier überarbeitet übernommen, um die theologische Seite deutlicher dar-
stellen zu können.
Unser Thema birgt sicher eine politische Brisanz an sich, will aber nach der ursprünglichen Ziel-
setzung der ganzen Forschung AUFBRUCH© pastoral ausgerichtet bleiben. Sie will den kirchli-
chen Entscheidungsträgern eine fundierte, aber praktische Hilfe für die Weiterbearbeitung dieses
Themenfeldes anbieten. Sie ist eine theologische Arbeit, indem sie für die Bewertung der Befun-
de auf die Offenbarungsquellen und auf die reichhaltige Tradition der Kirche zurückgreift. Sie ist
eine wissenschaftliche Arbeit und fühlt sich der intellektuellen Redlichkeit verpflichtet. Es wäre
aber falsch zu meinen, dass die Beschäftigung mit diesem Thema nicht zu politischen und kir-
chenpolitischen Urteilen führen wird. Diese nehmen die Autoren im Sinne der Stellungnahme der
Europäischen Theologenkommission zur Kenntnis: „Die Zuweisung historischer Verantwortung
hat nur einen Sinn, wenn die betreffenden Vorgänge mit intellektueller Redlichkeit wissenschaft-
lich fundiert dargestellt werden.“275 „Wir alle sind uns bewusst, wie sehr die historische For-
schung das Fundament der psychologischen Gesundheit der Völker und Kirchen bleibt. Sie rei-
nigt das Gedächtnis von Illusionen und Ideologien... Zweifellos, die Anamnese der Gnaden und
Irrtümer, durch die jede Kirche Gott aufzeigt, führt zur Aufdeckung unbekannter Wege von Got-
tes Erbarmen, das die tragische Entzweiung in das Gute verwandeln wird.“276 Dieselbe Stellung-
nahme drückt auch jene spirituelle Dimension dieser Arbeit aus, der die Autoren sich verpflichtet
fühlen: Es geht „um das dankbare Bekenntnis zu Gott, der seine Barmherzigkeit ‚von Generation
zu Generation’ (Lk 1,50) erweist. Denn Gott will das Leben und nicht den Tod des Sünders, er
will die Liebe und nicht Furcht und Angst.“277
274 In: Máté-Tóth/Mikluščák, Kirche im Aufbruch, 318-338: zusammen mit dem slowenischen Theologen Janez Juhant.
275 Erinnern und Versöhnen, IV. Kap. 276 Michel Van Paris zitiert von Dmytryschyn, N./Dobko, T. in: Máté-Tóth/Mikluščák, Kirche im Aufbruch 319. 277 Erinnern und Versöhnen, V. Kap.
168
Zum Begriff „Widerstand“
Mehrfach wird die Rolle der Kirche während der kommunistischen Diktatur mit dem Begriff
„Widerstand“ etikettiert. Es ist wichtig, diesbezüglich eine präzisierende Klärung anhand der
Bemerkung des Erfurter Historikers, Josef Pilvousek, vorauszuschicken. Wenn man Opposition
als relativ offene, wenigstens zeitweilig und teilweise legal handelnde Gegnerschaft zum SED-
Regime versteht, Widerstand dagegen als ausschließlich illegales und konspiratives Handeln, so
kann widerständiges Verhalten der Katholischen Kirche mit keinem der Begriffe deckungsgleich
sein. Weltanschauliche Dissidenz, mehr oder weniger verdeckte mündliche Regimekritik, passi-
ver Widerstand, Verweigerung, nonkonformes Verhalten waren in der gesamten DDR-
Geschichte auch in der Kirche weit verbreitet. Das begrifflich nicht klar zufassende Phänomen
lässt nur die Möglichkeit, unterschiedliche Begriffe alternativ zu verwenden. Für die Katholische
Kirche insgesamt und für ihre Kirchenleitung könnte noch am ehesten der Begriff Resistenz zu-
treffen, also eine Abwehr, Begrenzung, Eindämmung des umfassenden Anspruchs des Regimes
bzw. eine in der Kirchenzugehörigkeit wurzelnde Widerstandsfähigkeit – Resistenz gegen die
marxistische Ideologie – so Pilvousek. Da es weder in den betroffenen Ländern noch internatio-
nal eine einheitliche Begrifflichkeit gibt, die der nötigen Differenzierung und dem Feingefühl bei
der Beschreibung der Rolle der Katholischen Kirche als Institution und der Katholiken als gläu-
bige Menschen gerecht werden kann, ist es vonnöten, die zu benützenden Begriffe inhaltlich
immer sorgfältig zu bestimmen. Plakative Äußerungen und die unkritische Übernahme einer
politischen Redeweise verhindert die Aufdeckung der Tiefdimensionen und bildet ein Hindernis
in der schwierigen Arbeit mit der Vergangenheit.
Dementsprechend wird hier über Widerstand geredet, wenn sich kirchliche Institutionen, Grup-
pen oder Einzelpersonen einer direkten Anordnung, einer Regelung oder einem Gesetz bewusst,
aktiv und öffentlich widersetzen. Unter passivem Widerstand verstehen wir, wenn auf dieselben
Situationen mit Abwehr oder ohne eine solche in der Öffentlichkeit reagiert wird. Wir unter-
scheiden die Ebene der gesetzlichen Regelungen und Anordnungen, die unmittelbar die kirchli-
chen Angelegenheiten regeln wollten, von den allgemeinen Regelungen, die nur mittelbar – aber
oft mit durchaus ähnlichem Schwergewicht – die Pastoral oder die Ausübung des Christseins
betrafen. Die ideologische Ebene soll anders als die praktische Ebene behandelt werden. Die
gleichen Differenzierungen gelten analog bei den Begriffen Konformismus, Kollaboration usw.
Schatten der Vergangenheit
Vergangenheitsbewältigung ist in der ganzen Gesellschaft eine Herausforderung, die nach spezi-
ellen geschichtlichen Zäsuren eine starke Aktualität bekommen. So war es in ganz Europa nach
dem Zweiten Weltkrieg und so ist es auch seit dem Fall der Berliner Mauer (1989 bzw. 1991). In
169
der Öffentlichkeit unserer Gesellschaften wird aus der Vergangenheit mit verschiedenen Vorzei-
chen ein politisches Schwert geschmiedet – einmal gegen die möglichen und/oder vermutlichen
Verantwortlichen für die allgemein desolate Lage, ein anderes Mal gegen die neuen Machthaber,
die in der Vergangenheit zu wenig Widerstand geleistet hätten.
Dabei hat die Kirche eine spezielle Aufgabe und auch Chance. Nicht politisch und taktisch moti-
viert, sondern aus Treue zum Evangelium und im Glauben an den barmherzigen Gott, kann sie
eine historische Trauerarbeit eminenter Art und Weise durchführen. Primär braucht auch die
Kirche selbst Klarheit, Offenheit und das Bekenntnis zu Gott. Dies wäre auch ein Zeugnis für die
ganze Gesellschaft über die Möglichkeit des verantwortlichen Umgangs mit der Vergangenheit.
Diese gesellschaftliche Wirkung ist wichtig, ist aber nur eine Konsequenz dieser Aufklärung.
„Es handelt sich um die Verherrlichung Gottes. Denn ein Leben im Gehorsam gegenüber der
Wahrheit Gottes und den Herausforderungen, die von ihr ausgehen, führt hin zu einer Form des
Bekennens unserer Sünden und Fehler, die vom Bekenntnis zur ewigen Barmherzigkeit und Ge-
rechtigkeit des Herrn nicht zu trennen ist.“278
Historische Hintergründe
Als Einstieg seien hier einige Gedanken aus Slowenien vorgestellt, die auch für etliche andere
Ländern zutreffen. Die diktatorischen autoritativen Regime versuchten die persönliche Entschei-
dung durch eine Systemsteuerung zu ersetzen und somit die Person mit dem System konform zu
machen. Aus diesem Grund kam die Fragestellung des Widerstands und des Konformismus in
einer ganz besonderen Art und Weise gerade im Kommunismus auf. In Anbetracht der Wende
weg von der Person, die das kommunistische System anstrebte, wurden politische und andere
Methoden und Vorgangsweisen so subtil herausgearbeitet, dass die Frage des Kommunismus und
die des Widerstandes selbst in die Struktur der Persönlichkeit eingriff.
Die „Autoritätsanhänglichkeit“ gehört zur Kulturgeschichte Sloweniens. Dieses Unterwerfungs-
bewusstsein wurde dann im kommunistischen Regime potenziert, ausgeprägt und ausgearbeitet.
Die Methoden der Tortur des marxistischen Totalitarismus wurden in einer so besonderen Per-
fektion ausgeführt, dass die Menschen weniger Bewegungsspielraum hatten, um dieser Tortur
auszuweichen. Die marxistischen, revolutionären Methoden stießen aber trotz dieser psychologi-
schen Voraussetzungen bei den Slowenen auf Widerstand, da die marxistische Revolution wäh-
rend der Kriegszeit eine zusätzliche Belastung für das Überleben der Slowenen war. Sie griff
obendrein noch das Christentum, eine wesentliche Dimension der slowenischen Kultur, an.
278 Erinnern und Versöhnen, Einleitung.
170
Die kommunistische Gewalt unter der Bevölkerung zwang also die katholischen Kräfte, sich zu
organisieren, um sich selbst zu verteidigen. So entstanden die sogenannten Dorfwachen. Das war
eigentlich auch das Ziel der Kommunisten, nämlich einen außerordentlichen bzw. revolutionären
Zustand zu schaffen. Nur so konnte ihre Doktrin „des Klassenfeindes“ funktionieren. Sie konnten
damit aber auch alle ihre tatsächlichen oder vermeintlichen Gegner als Kollaborateure bezeich-
nen. Diese Bezeichnung wurde in der kommunistischen Ära medienpropagandistisch in das öf-
fentliche Bewusstsein eingepflanzt und auch nach der Wende im Jahr 1989 diente dies als Vor-
wand für die Erhaltung der politischen Macht der postkommunistischen Nomenklatur. Nach der
Wende hat man die Taktik nur insofern gewechselt, dass statt der Rhetorik der Revolution die der
Befreiung verwendet bzw. missbraucht wurde. Die immerwährenden Befreier sind natürlich die
ehemaligen Kommunisten bzw. Postkommunisten – alle oppositionellen Kräfte und die Vertreter
der Kirche wurden mit dem Feindbild versehen.
Man muss immer vor Augen haben, was die kommunistischen Methoden im Volk verursacht
haben. Zunächst wurde die (meist katholische) Elite der Nation beseitigt. Die neuen Behörden
setzten mit ihren Methoden in der Nation das Prinzip der negativen Selektion durch, wonach
Lüge, Ungewissheit und Unsicherheit, Angst und Terror das gesellschaftliche und persönliche
Leben bestimmten.
Nur politisch, kulturell und soziologisch bedeutungslose Menschen konnten „unberührt“ leben,
mussten jedoch bereits seit Beginn der Revolution im Krieg den Kommunisten ihre Loyalität
erweisen. Auf diese Problematik kommen wir später noch zurück. Die revolutionäre Umwand-
lung des slowenischen Bewusstseins funktionierte auch wegen dessen Neigung der Slowenen
zum kollektiven Bewusstsein, wie Markeš in seiner Studie »Das Nationale und die Kirche« be-
tont. Trotz der umfassenden Maßnahmen gegen das katholische Bewusstsein konnte mit der Zeit
eine Überlagerung des Bewusstseins erreicht werden, die aber besonders jetzt nach der Wende
von 1990 funktioniert.
Phasen und Arten der Diktatur
Obzwar alle Länder nach dem Vertrag von Jalta (1944) der sowjetischen Zone zugeordnet und
dadurch in ihrer Geschichte zwischen 1947 und 1948 und zwischen 1989 und 1991 der Politik
und Mobilisation der KPdSU ausgeliefert waren, sind sie dennoch mehr oder weniger einen eige-
nen Weg gegangen, der einerseits durch die geschichtlichen und kulturellen Traditionen der je-
weiligen Gesellschaften und andererseits durch die inneren Machtverhältnisse bestimmt wurde.
Die politischen, zeitgeschichtlichen und soziologischen Forschungen zeigen klar, dass es in die-
171
ser langen Periode Einschnitte gab und sich die Stärke sowie die Art und Weise der Diktatur
veränderte. Man spricht mindestens von zwei Unterperioden279, über eine stalinistisch-harte und
einer weichere Diktatur: Beide erhielten in der Fachliteratur verschiedenen Bezeichnungen, in
der theologischen Literatur werden Anklänge zu einer ägyptischer und einer babylonischer Ge-
fangenschaft entdeckt. Diese Bezeichnungen und Abstufungen beziehen sich vor allem auf die
großpolitischen, institutionellen Bereiche der Gesellschaft. Die handelnden Subjekte sind dabei
die Institutionen, wie Regierung, Partei, Kommissariat und bei der Kirche die Bischofskonferenz,
Priestervereine, Pfarreien, Presse usw. Eine andere Ebene der Gesellschaft bilden die Einzelper-
sonen mit ihrer Familie und ihrem Bekanntenkreis, mit ihrem eigenen Wissen und Gewissen, mit
ihren Ängsten und Hoffnungen. Zuerst wollen wir diese Phasen der Großpolitik skizzieren und
dabei die institutionellen Handlungsfelder der Kirche beschreiben. Die Betrachtung der persönli-
cheren Ebene bildet den zweiten Schritt in diesem Kapitel.
Die erste Periode der Diktatur begann mit der kommunistischen Machtübernahme zwischen 1945
und 1950. Religion und Kirche wurden zu Hauptfeinden des neuen Systems erklärt und „zum
Tode“ verurteilt. Auf der ideologischen Ebene wurde die religiöse Einstellung gebrandmarkt und
in der Öffentlichkeit und an Ausbildungs- und Arbeitsstätten verfolgt. Auf der institutionellen
Ebene wurden nahezu alle kirchlichen Institutionen verstaatlicht und die kirchliche Tätigkeit fast
ausschließlich auf die Spendung der Sakramente beschränkt. Die Mittel der Diktatur dieser Peri-
ode waren hart: Verhaftungen, Schauprozesse gegen symbolische Figuren der Kirche, Totalkon-
trolle der kirchlichen Öffentlichkeit und Kommunikation, Zwangsmaßnahmen bei der kirchlichen
Personalpolitik, Verhinderung der Beziehungen zum Vatikan. Die Haltung der Kirche in dieser
Periode ist vor allem durch Widerstand gekennzeichnet.
Diese direkte und harte Diktatur ist allmählich milder geworden. Durch den Tod Stalins, durch
die Revolutionen und Aufstände in den Satellitenländern, durch die allgemeine Entspannungspo-
litik in Europa, durch die immer größere finanzielle Schwäche der UdSSR, aber auch durch die
immer tieferen Risse und Spaltungen innerhalb der KPdSU sowie in den Geschwisterparteien
bedingt, musste sich auch die Religions- und Kirchenpolitik ändern. Zu den Einschnitten gehören
aber auch kirchliche Entwicklungen, wie das Zweite Vatikanische Konzil, die Wahl des polni-
279 Gudea und Marţian unterscheiden für die Unierte Kirche in Rumänien vier Perioden: „die Zeit des Terrors (1948-1955), die Zeit der gesetzlichen Verurteilungen (1956-1964), die Zeit der kontrollierten Katakomben (1964-1973), die Zeit der frei sich entwickelnden Katakomben (1973-1989)“ (vgl. Gudea/Marţian, Typologie). Grubišić definiert für Kroatien: „die Beziehung zwischen Kirche und Staat kann am angemessensten in einer chronologischen Auftei-lung in drei große gesellschaftliche Perioden verstanden werden: geteilte (1945-1960), mehrschichtige (1960-1974) und politisierte (bis 1990) Gesellschaft“ (ders., Konformismus). – Die hier zitierten Manuskripte sind nichtveröf-fentlichte Länderstudien der Aufbruch-Forschung. (Vgl. noch Pollak, Religiöser Wandel 12ff, der die Perioden von Tomka nachzeichnet. Er unterscheidet auf Grund religionsstatistischer Daten drei Perioden: unmittelbare Nach-kriegsjahre, mit starker Widerstandskraft; die fünfziger-siebziger Jahre, mit der Unterwefung der Gesellschaft und eine dritte Periode, „die in der zweiten Helfte der siebziger Jahre einsetzte und bis zum Untergang des kommunisti-schen Herrschaftsregimes dauerte“. Hier zeichneten sich „gegenläufige Entwicklungstendenzen ab“.)
172
schen Kardinals Karol Wojtiła zu Papst Johannes Paul II. sowie die verstärkte westliche Publizi-
tät über die Religions(un)freiheit unter dem roten Stern.
Nach diesen politischen und kirchlichen Einschnitten entwickelte sich in den meisten Ländern
eine mildere Form der Diktatur. Bei der Beibehaltung der führenden Rolle der kommunistischen
Parteien und der internationalen Beziehungen des Warschauer Paktes wurde der Religion und
den Kirchen ein Lebensrecht zugesichert. Die Regime versuchten neben der weiteren totalen
Kontrolle doch in der Kirche und in den Christen Verbündete für die Lösung der immer schwie-
rigeren Lage des Systems zu suchen. Es begann eine gegenseitige Taktik zwischen ungleichen
Partnern. Es wurden keine Priester mehr inhaftiert, langsam wurde den Kirchen mehr Öffentlich-
keitsarbeit genehmigt, die Ausreise ins westliche Ausland wurde sporadisch ermöglicht, die di-
plomatischen Beziehungen mit dem Vatikan wurden in das politische Tagesprogramm
aufgenommen. In dieser Periode hat die Kirche langsam ihre frühere Widerstandshaltung für eine
Haltung der „Nestbehütung“ aufgegeben und wurde – Polen, Kroatien und Slowenien ausgenom-
men – zu einer gesellschaftlichen Insel mit schwacher öffentlicher Kommunikation. Sie hat die
Ausgleichsangebote des Staates wahrgenommen und etwas zögerlich als pastorale Chance zu
nutzen vermocht. Die Merkmale dieser Epoche sollen nach Gudea und Marţian veranschaulicht
werden. „Nach 1964, als der Bruch mit der sowjetischen wirtschaftlichen Politik deutlich wurde, verän-
derte sich auch die Innenpolitik, besonders jene den Kirchen gegenüber, aber nur in dem Maße,
in dem die sich in die Politik des Staates eingliederten. An der Spitze aller Kirchen wurden un-
terwürfige Leitungen eingesetzt, unter der Anführung der Abteilung für Kulte, die Maßnahmen
gegen die eigenen Priester und Laien ergriffen, die die atheistische Politik und die Unterwürfig-
keit der jeweiligen Kirche kritisierten. Gleichzeitig wurde der Staat der wichtigste religiöse Ver-
folger, wegen der immer aktiveren Kontakte zu den westlichen demokratischen Staaten immer
nachgiebiger in Bezug auf die religiöse Bewegung im allgemeinen und sogar mit der Griechisch-
Katholischen Kirche im besonderen.“
Der Kampf der Kommunisten im ehemaligen Jugoslawien gegen die Kirchen und Katholiken
hörte nie auf, er wurde nur in einer anderen Art und Weise ausgeführt. Dieser Kampf nahm be-
sonders nach der Unterzeichnung des Protokolls zwischen Jugoslawien und dem Heiligen Stuhl
(1966) mildere Formen an. Das ermöglichte auch ein differenzierteres Denken über die Lage der
Gläubigen in der Gesellschaft.280
Anfang der Sechzigerjahre ließ die streng repressive Haltung gegenüber den Gläubigen und der
Kirche nach. Die Anzahl der politisch motivierten Prozesse von Priestern und Gläubigen nahm
ab, die Strafen waren weniger drastisch als in der vergangenen Periode, und es gab auch weniger
politische Hetze gegen die Religion und die Kirche. Die Aussichten und der Wunsch nach der
173
Verbesserung der Beziehungen wuchsen, sowohl bei den Angehörigen der herrschenden Partei
als auch bei den Hierarchiemitgliedern. Es scheint jedoch so, als ob es nur um eine Änderung der
Arbeitsmethoden und der Taktik ging. Aus den weiteren Beziehungen zwischen dem sozialisti-
schen politischen System und der Kirche kann man sehen, dass die Verhältnisse im Wesentlichen
unverändert blieben. Nach dem Zusammenbruch des „kroatischen Frühlings“ (1971) bis zu den
demokratischen Veränderungen (1990) lässt sich die Beziehung des politischen Regimes der
Kirche gegenüber als eine Zeit der An- und Entspannung, der Bestreitung und des Schätzens, der
Konfrontation und Taktisierung, der Verdächtigung ohne Ehrlichkeit beschreiben.281
Die Kirchen hatten in den verschiedenen Ländern zwar verschiedene Ausgangssituationen, und
ihr gesellschaftlicher Einfluss war auch unterschiedlich, dennoch ist diese eben skizzierte Ten-
denz in allen Ländern zu beobachten. Die schwierigsten Erfahrungen unter den untersuchten
Ländern haben sicher die ehemaligen Teilrepubliken der Sowjetunion erleiden müssen: die Uk-
raine und Litauen.282
Die Kirche als Fremdkörper
In der ersten Phase der Diktatur haben die religions- und kirchenfeindlichen Regime – motiviert
vom Traum einer völlig neuen Gesellschaft und einem völlig neuen Menschen – alle kirchlichen
Institutionen entweder aufgelöst, verboten, verstaatlicht oder vollständig der staatlichen Kontrolle
unterzogen. Die Institutionen konnten auf drei Arten darauf antworten, wobei ihre Spielräume
enorm begrenzt waren. Sie konnten die Auflösung einfach mit all ihren Konsequenzen hinneh-
men. Musterbeispiele dafür sind die kirchlichen Krankenhäuser, die Schulen, die Ordensgemein-
schaften, die Sozialanstalten, Druckereien und Redaktionen. Alle materiellen Ressourcen gingen
in das staatliche Besitztum über, die Angestellten konnten teilweise dort weiterarbeiten, mussten
teilweise emigrieren oder ein völlig neues Leben beginnen. Wo bei der Durchführung der Ver-
staatlichung Verantwortliche Widerstand geleistet haben, wurden sie als Systemfeinde für viele
Jahre in Gefängnissen festgehalten, des Landes verwiesen oder sogar getötet. Eine weitere Ant-
wort war – nach einigen Jahren der Umorientierung – die begrenzte Weiterführung der ursprüng-
lichen Tätigkeit im Untergrund. Musterbeispiele sind dafür z.B. einige Ordensgemeinschaften,
das Samisdat-Schrifttum, die Katechese im Untergrund, die Weiterführung der verschiedenen
Ausbildungen in Kleingruppen und Basisbewegungen. Man hat dabei viel Risiko auf sich ge-
nommen. Die Kirche spaltete sich in eine offizielle und in eine inoffizielle Seite auf, die Kom-
munikation zwischen den beiden Seiten war unregelmäßig, willkürlich, sehr schwach und oft
irreführend. Nur der Glaube an die Einheit der Kirche und das Erbe des innenkirchlichen Ver-
280 Juhant, Konformismus. 281 Grubišić u. a., Konformismus. 282 Navickas, Konformismus und Dmytryschyn/Dobko, Widerstand.
174
trauens hat die Einheit der Kirche in dieser Zeit gesichert. Man pflegte die Hoffnung, dass alle
treu zum Glauben und zur Kirche stehen und nur schwerste Folterungen die Menschen zum Ab-
fall bringen könnten. Die dritte Antwortmöglichkeit war die offizielle Weiterführung der Tätig-
keit, jedoch nach staatlichen Richtlinien. So erschienen einige beinahe völlig zensurierte, kirchli-
che Zeitungen und so konnten einige Ordensschulen weiterhin unterrichten. Die Angestellten
haben gemeint, dass diese antikirchliche Zeit bald vorübergehen, und sich die Situation in der
ganzen Gesellschaft normalisieren würde. Sie dachten daran, diese Übergangszeit durchzuste-
hen – auch wenn ihre weitergeführte Tätigkeit bei weitem nicht dem entsprechen konnte, was
ihrem Wissen und gutem Gewissen entsprach. Die Entscheidungsträger waren bei der Fortfüh-
rung dieser kirchlichen Institute genau so wenig frei und uneingeschränkt, wie andere, die ihre
Institute unter Androhungen schließen mussten. Die Logik des Systems war auf eine totalitäre
Machtkonzentration aufgebaut, die Interessen der Betroffenen wurden völlig außer Acht gelas-
sen.
In dieser ersten Phase der Diktatur hat der Staat nicht nur kirchliche Institute verstaatlicht oder
aufgelöst, sondern neue, kirchenähnliche Institutionen zur Ausführung seiner Ziele geschaffen.
Die bekanntesten Institutionen sind die sogenannten „patriotischen Priestervereine“283, die wir in
allen Ländern in jeweils verschiedenen Formen wiederfinden. Diese Vereine oder Körperschaften
hatten gemäß ihren Statuten kommunistische Vorstellungen und Ziele zu verwirklichen. Sie
mussten das repräsentieren, was die Partei unter einer systemkonformen Kirche verstand. In die-
ser Periode konnten die Kommunisten nur wenige Priester (nach Mariañski 10% in Polen) für
solche Vereine gewinnen und daher blieben die Fronten zwischen den wahrhaft kirchlichen und
pseudokirchlichen Institutionen klar.284 Aber selbst die Mitarbeit in solchen Vereinen wurde in
den meisten Fällen erzwungen, nur ganz wenige führende Mitglieder vertraten die „patriotischen
Ziele“ von ganzem Herzen.
Während der weiteren Periode der Diktatur gab es immer mehr Möglichkeiten, ureigene kirchli-
che Ziele und Wertvorstellungen an die Öffentlichkeit zu bringen. In den Ländern, wo der Frei-
heitsgrad der Gesellschaft allgemein größer wurde, hatte auch die Kirche mehr Bewegungsspiel-
raum für ihre pastorale Tätigkeit. Ein wichtiges, direktes Mittel des kulturellen Widerstandes in
Polen, im ehemaligen Jugoslawien und in der DDR und teilweise auch in Ungarn bildeten die
Hirtenbriefe der Bischofskonferenzen sowie der einzelnen Bischöfe. Durch sie wurden immer
deutlicher vom System abweichende Werte vertreten, wie z.B. die Unantastbarkeit des menschli-
283 In Ungarn 1950: Priesterliche Friedensbewegung, in Polen 1949: Hauptpriesterkommission (GKK) des Kämpfer-bundes für Freiheit und Demokratie (ZBoWiD), in Slowenien und auch in anderen Teilen des ehemaligen Jugosla-wien 1949: Cyril-Methodius Verein (ĆMD), in der ehemaligen Tschechoslowakei: „Pacem in terris“.
284 Der kroatische Erzbischof Stepinac nannte diese Initiative mit „sehr starken und tadelnden Worten: ‚heuchlerischer, teuflischer Verein’, ‚Umarmung des Teufels’, ‚Synagoge des Satans’, ‚satanischer Auswuchs’, und die Priester, die sich diesem Verein angeschlossen hatten ‚übertraurige Brüder’, ‚Verräter der Kirche Gottes’, ‚Judas’, ‚Verrückte nach einer Linsenschüssel’“ (Grubišić, Konformismus)
175
chen Lebens, die Rechte der Eltern auf die Erziehung ihrer Kinder, die Unvereinbarkeit der Teil-
nahme an der Jugendweihe usw. Durch die Ausweitung des Spielraumes der kirchlichen Staats-
politik kam es zur Vermehrung der möglichen politischen Optionen. In den diversen Verhand-
lungen mit den staatlichen Organen konnten auch kirchliche Institutionen mehr Freiheit für mehr
Zugeständnisse aushandeln. Die politische und kirchliche Situation wurde immer komplizierter,
die früher klaren Grenzen zwischen Treue und Verrat wurden allmählich unklarer.
In dieser Zeit konnten aber auch neuere kirchliche Initiativen in gewissen Bereichen der Öffent-
lichkeit aktiv sein. Etwa ab der Mitte der Siebzigerjahre wuchsen die kirchlichen Erneuerungs-
bewegungen, und es entstanden auch teils politisch aktive Gruppen, wie z.B. der Aktionskreis
Halle.
Mariañski unterstreicht, dass die Kirche in Polen in sich die einzige Alternative zum atheisti-
schen Staat bildete, was strukturell gesehen auch bei allen anderen Ländern zutrifft: Die Kirche
protestierte gegen die Reduktion des Menschen auf das zeitliche Maß, den Ausschluss des trans-
zendentalen Horizontes und wies darauf hin, dass das Bedürfnis nach Gott ein Grundfaktor der
persönlichen Entwicklung darstellt und die Negation Gottes zur Schaffung eines geistigen Vaku-
ums und zu Unsicherheit führt. Die Anliegen Gottes und des Menschen seien untrennbar. Im
Bereich des öffentlichen Lebens „blieb die Kirche über viele Jahre die einzige nicht den Kom-
munisten unterworfene Macht und der einzige öffentliche Raum, in dem keine Lügen verbreitet
wurden. Das machte die Kirche zu einer besonderen Oase menschlicher Authentizität, umgeben
von unwahrhaftigen und lügenhaften Institutionen, in denen die Menschen sich fremd fühlen
mussten“285. Die Kirche war ein deutliches Gegengewicht zum kommunistischen Staat.
Verfolgungserinnerungen
Neben den großpolitischen Komponenten sind die Fragen des Widerstandes eine sehr private
Angelegenheit. Die eigentliche Belastung der Vergangenheit lag bei den einzelnen ChristInnen –
unabhängig von ihrer/seiner Funktion. Hier trifft man moralische Erwägungen und auch Urteile,
die einerseits unumgänglich sind, anderseits aber einen besonderen Sorgfalt bedürfen. Wie bei
der institutionellen Ebene der Problematik, so sollen auch hier einige Rahmenbedingungen er-
wähnt werden, unter denen man die Art und Weise des Konformismus sowie des Widerstands
behandeln kann. Die Meinungsforschung des Projektes AUFBRUCH© hat zu den Verfolgungen
einige Fragen gestellt. Die Antworten unterstützen zwei Thesen, die aufgrund anderer Quellen
285 Mariański, Widerstand.
176
bereits formuliert werden konnten. Die Diktatur ließ mit der Zeit nach; die Wahrnehmung der
Verfolgung ist in jedem Land sehr unterschiedlich.286
Die Meinungen über die Tatsache der Kirchenverfolgung und auch über ihre Intensität divergie-
ren stark. Vor allem in Ostdeutschland, aber auch in Slowenien und Ungarn meinen viele, dass es
überhaupt keine Kirchenverfolgung gab. Über die Dauer einer Kirchenverfolgung meinen zwei
Drittel der Befragten, dass es 40 Jahre lang fortlaufend eine Verfolgung gab, ein Drittel der Be-
fragten (Ungarn, Slowenien und Polen) meint dagegen, dass es die Kirchenverfolgung nur für
kurze Zeit gab.
Die Meinung über die Kirchenverfolgung ist aber ziemlich unabhängig vom Alter.287 Das gleiche
gilt, wenn man die Meinungen nach dem Grad der Ausbildung oder nach der Größe des Wohnor-
tes gruppiert. Zu diesen statistischen Ergebnissen sei jedoch angemerkt, dass die Befragung nur
bis zum Alter von 65 Jahren durchgeführt wurde. Wie die biographischen Interviews zeigen, hat
die Generation über 65 Jahren reiche Erinnerungen an die „schwarzen Jahre“ der Diktatur. Die
Wahrnehmung dieser Daten kann die Kirche zu einer Überprüfung ihrer öffentlichen Argumenta-
tion mit den Verfolgungen führen.
Generationen
Die institutionelle und die personbezogene Ebene weisen parallel auf, wie in den betroffenen
Ländern die Geschichte der kommunistischen Diktatur verlief. Die vor allem auf biographischen
Tiefinterviews basierenden Studien von Navickas und Bögre haben mehrere Generationen mit
speziellen Konfliktlagen herausgearbeitet. Die Einteilung der Generationen nach Geburtsjahren
kann je nach Land unterschiedlich ausfallen, aber die Konflikte sind in allen betroffenen Ländern
typisch und sehr ähnlich.
I. Generation: geboren vor 1925-1928. Dieser Altersgruppe wird die am Vorabend der sowjeti-
schen Okkupation geborene Bevölkerung zugerechnet. Als die Sowjetzeit begann, besaßen sie
bereits ihre festen Wertevorstellungen und hatten ihren Lebensweg eingeschlagen.
286 Ausführlich über die weiteren Zusammenhänge der Verfolgungserfahrungen in: Tomka/Zulehner, Religion in den Reformländern, 150-155.
287 Meinungen über die Kirchenverfolgung in den zehn postsozialistischen Ländern, unterteilt in drei Altersgruppen.
18-30 J. 31-50 J. 51-65 J.
Keine Kirchenverfolgung 25,5% 46,5% 28,0% Kurze Kirchenverfolgung 25,6% 46,8% 27,6% Kirchenverfolgung dauerte 40 Jahre lang 31,8% 43,3% 24,9% Gläubige benachteiligt 25,7% 42,7% 31,6% Bekannte benachteiligt 25,3% 42,6% 32,1% Selbst benachteiligt 14,7% 45,1% 40,2%
Quelle: AUFBRUCH© 1998
177
II. Generation: geboren um 1935-1943. Zu dieser Altersgruppe gehören Menschen, die entweder
am Vorabend der sowjetischen Okkupation oder in den ersten Jahres des Krieges geboren wur-
den. Sie können zwei unterschiedlichen Epochen zugeteilt werden: Ihre Wurzeln haben sie noch
in das vorsowjetische System geschlagen, aber aufgewachsen sind sie bereits unter den radikal
veränderten Umständen.
III. Generation: geboren um 1944-55. Die Vertreter dieser Gruppe sind entweder am Ende des
Krieges oder in den ersten Nachkriegsjahren geboren worden. Ihre Kindheit verlief im sowjeti-
schen Milieu. Die Vertreter dieser Generation mussten sich auch am meisten den Herausforde-
rungen der Massenurbanisierung stellen.
IV. Generation: geboren um 1951-1969. Die Vertreter dieser Gruppe lebten sich vollständig in
die Sowjetzeit ein. Bereits die Generation ihrer Eltern war unter den sowjetischen Umständen
aufgewachsen.
V. Generation: Sie setzt sich aus den Personen zusammen, die nach 1970 geboren wurden. Ihre
Kindheit und Teenagerzeit verliefen im sowjetischen System, ihr Schulabschluss fiel jedoch mit
dem Zusammenbruch der Sowjetmacht zusammen. Die Vertreter dieser Altersgruppe sind viel
häufiger als die anderen Generationen auf den zunehmenden Nihilismus und die Selbstdestrukti-
on innerhalb des sowjetischen Systems gestoßen. Dieser Umstand wirkte sich natürlich auch auf
die Entstehung der Wertevorstellungen dieser Altersgruppe aus.
Diese Einsichten stimmen mit den Ergebnissen der Meinungsforschung überein, nach denen in
den meisten Ländern über einen Generationsbruch288 bezüglich Religiosität, Wertevorstellungen
und Kultur gesprochen werden muss. Im Folgenden werden die typischen Konfliktfelder auf der
institutionellen sowie auf der persönlichen Ebene dargestellt.
Spielräume
Für die gesamte Forschung AUFBRUCH© hat die simplifizierende Meinung einen wichtigen
Anstoß gegeben, wonach unter den Verhältnissen der kommunistischen Diktaturen in Ost-
(Mittel)Europa eigentlich nur zwei Haltungen seitens der Kirche und der ChristInnen möglich
waren: die der MärtyrerInnen und die der Friedenspriester. Die großangelegte und mit interdiszi-
plinären Mitteln arbeitete Forschung hat aufgezeigt, dass diese Zweiteilung weder den gesell-
schaftlichen Umständen noch der realen kirchlich-christlichen Praxis entspricht.
288 Bögre, Konformismus.
178
MärtyrerInnen und Lapsi
Die größte Schwierigkeit bei der Frage nach Konformismus und Widerstand ist die Behandlung
des Problems der persönlichen Entscheidungen. Hier brauchen Kirche und Gesellschaft, aber
auch die Betroffenen eine echte Hilfe, da die Meinungen der Betroffenen und der Beobachter hier
am meisten auseinanderlaufen. Die Kirche hat von Anfang an die MärtyrerInnen verehrt und
ihnen in vorkonstantinischer Zeit sogar besondere Rechte zugestanden. Der Abfall in Glaubens-
fragen wurde dagegen am stärksten verurteilt. Nachdem berühmten Werk des hl. Cyprian289 be-
zeichnen wir hier die Abgefallenen mit dem kirchengeschichtlichen Begriff „Lapsi“, um dadurch
die Breite der Handlungsmöglichkeiten mit einer nicht politisch kornnotierten Bezeichnung an-
zudeuten. Auch heute noch gelten weltweit bekannte Amtsträger der Kirchen im Ostblock als
Symbole des Widerstandes oder der Apostasie. Ohne ihren eigenen Lebensweg instrumentalisie-
ren zu wollen, soll gesagt werden, dass diese herausragenden Persönlichkeiten nur zwei Endpole
einer langen und kurvenreichen Linie bilden. Unsere Forschung sieht als eine besonders wichtige
Aufgabe die Ermöglichung einer differenzierten Sicht über die Mehrheit, nicht nur unter den
Amtsträgern, sondern auch unter den Frauen und Männern dieser Zeit. Aufgrund dieser Untersu-
chungen kann man nüchtern behaupten, dass die Kirche in diesen Ländern sowohl eine Kirche
der Märtyrer und Bekenner als auch eine Kirche der Lapsi war.
„Um also die sittlichen Akte des Menschen und die mit ihnen einhergehenden Wirkungen richtig
zu verstehen, müssen wir in die Lebens- und Kulturwelt derer eintreten, die diese Handlungen
begangen haben. Allein auf diese Weise können wir uns ihren Motivationen und ihren leitenden
moralischen Grundüberzeugungen nähern.“290
Nach mehrfachen qualitativen Untersuchungen und eingehenden Diskussionen konnte die inter-
nationale Forschergruppe des Projektes AUFBRUCH© eine seriöse Typologie gestalten.291 Sie
basiert hauptsächlich auf drei miteinander eher stark korrelierenden Aspekten: die Religiosität,
die Karrierechance und die Zeit bzw. die entsprechende Epoche der Diktatur. Diese drei Aspekte
bilden einen Kraftfeld, in das sich alle Betroffenen einordnen lassen, ohne unverantwortliche
Vereinfachungen aber mit einer möglichst eingehenden Wahrnehmung des je unterschiedlichen,
gesellschaftlichen Umfeldes. Die Dimensionen können in einem dreidimensionalen Koordinaten-
system veranschaulicht werden.
289 Liber de lapsis in: PL 4 2 473-510. 290 Erinnern und Versöhnen, Kap. V. 291 Die Typologie geht auf einem früheren Entwurf der ungarischen Soziologin Zsuzsa Bögre zurück und wurde in
Lovran (Kroatien) 1999 und in Berlin 2000 an zwei Aufbruch-Symposien international diskutiert und weiterent-wickelt.
179
1 3
Zeit Relig ios itä t
K arrierechancen
2
Abbildung 2: Dimensionen der Typologie von Konformismus und Widerstand in der Epo-che der kommunistischen Diktatur in Ost(Mittel)Europa
Mit der Achse 1 wurde die Religiosität, mit der Achse 2 die Erwartungen des gesellschaftlichen
Systems kennzeichnet. Die zwei Achsen bilden ein Koordinatensystem. Mit einer Geraden vom
Nullpunkt ausgehend in gleicher Entfernung von beiden Achsen wurde die Zeit markiert. Wenn
sich das Verhalten einer Person der waagerechten Achse des Koordinatensystems nähert, dann
bedeutet das, dass sie sich in ihrem Verhalten massiv den gesellschaftlichen Erwartungen ange-
passt hat. Wenn ein Verhalten der senkrechten Achse nahe kommt, dann bedeutet das, dass die
Religiosität im Leben dieser Person eher eine entscheidende Rolle spielte.
Die zwei Achsen bezeichnen also solche Verhaltensweisen, die explizit die eine oder die andere
Orientierung ausdrücken. Zwischen den beiden Achsen haben wir die Verhaltensweisen aufge-
zeichnet, die sich in irgendeiner Form beiden Systemen anpassen wollten. Diese Anpassung ist
mit dem ständigen Zusammenleben mit den Konflikten, mit dem Tragen der Konflikte einherge-
gangen. In mehreren Fällen war es nur dadurch möglich, dass die Einzelpersonen ihre Religiosi-
tät umformuliert haben. Sie haben sie in ihr eigenes Leben integriert. Die Religion hatte eine
solche Bedeutung für sie, wie sie diese erlebten. Dieses Verhalten behandeln die Survey-
Forschungen heute als die Einstellung „ich bin religiös auf meine eigene Art und Weise“. In die-
sem Koordinatensystem können folgende Typen festgestellt werden:
180
A. Gesellschaftsorientiert-konformer, religiöser Lebensweg
Diese Personen waren die eindeutigen Gewinner der sozialen Mobilität. Sie konnten dies errei-
chen, weil sie ihre religiöse Überzeugung aufgegeben haben. Sie haben eine hohe Schulbildung
erworben, anhand derer sie aus ihrer Umgebung herausragten. Sie verfügten über genügend Am-
bitionen und persönliche Fähigkeiten, um sogar führende Positionen an ihren Arbeitsplätzen zu
erlangen. Aus diesem Interesse haben sie der religiösen Wertordnung den Rücken zugewandt,
sogar um den Preis der Verdrängung ihrer Gefühle. Die gesellschaftliche Durchsetzung ist für sie
so wichtig geworden, dass sie ihre Überzeugung dieser untergeordnet haben. Im Mittelpunkt
ihres Alltagslebens stand der Erwerb der schulischen Qualifikation, um den Anforderungen am
Arbeitsplatz gerecht zu werden. Ihre Erinnerungen erzählen hauptsächlich darüber. Auch ihre
Gewohnheiten auf dem Gebiet der Freundschaft und der sozialen Beziehungen haben sie diesem
Gesichtspunkt untergeordnet. Sie haben den Weg der Kirche und der religiösen Ereignisse ver-
lassen. Sie haben nicht einmal ihre Kinder am Religionsunterricht teilnehmen lassen, auch wenn
sie selbst das gerne wollten.
A1. Ferngebliebene und Zurückgekehrte
Eine Untergruppe bilden dabei die Menschen, die in ihrer Kindheit religiös erzogen wurden, dann
für die gesellschaftliche Karriere ihre Religiosität aufgegeben haben, später jedoch, als der dies-
bezügliche gesellschaftliche Druck nachließ, wieder zu den Werten ihrer Kindheit zurückkehrten.
Sie lebten in einer Zeit, in der man zwischen den beiden Wertorientierungen bzw. Verpflichtun-
gen wählen musste. Sie wollten in diejenige Ebene der gesellschaftlichen Hierarchie gelangen,
wo religiöse Menschen nicht geduldet wurden. Bei ihrer Entscheidung haben die Menschen, die
ihre Religion bewusst aufgaben, eine ernste Identitätskrise erlebt. Bei der Erinnerung an diese
Ereignisse beschuldigen sie sich, indem sie sich in mehreren Fällen selbst Verräter nennen.
A2. Die nie Wiederkehrenden – die Pragmatiker
Die Pragmatiker unterscheiden sich von der vorigen Gruppe in dem Punkt, dass es für sie kein
Problem in Hinsicht auf die Wertordnung bedeutete, sich der vorgegebenen atheistischen Gesell-
schaftsordnung anzupassen. Für sie bedeutete die Religion in ihrer Kindheit ein formal-
kulturelles Leben. Die Kirche war ein Ort, den man zu „besuchen“ hatte, aber die für sie wichti-
gen und großen Dinge passierten außerhalb der Kirche. Ihr Leben war durch die harte Arbeit
charakterisiert, sie lebten leistungsorientiert.
181
B. Autonom-religiöse Lebenswege
Hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Durchsetzung war für diese Personen das Erlangen von Posi-
tionen zweitrangig. Wenn sie zwischen der Religion und dem gesellschaftlichen Aufstieg zu
wählen hatten, haben sie sich in jedem Fall für die Religion entschieden. Deshalb waren sie an
ihren Arbeitsplätzen ständig benachteiligt. In dieser Gruppe haben nur diejenigen ein Diplom
erworben, die „zufällig“ an einer Universität aufgenommen wurden. Eine führende Position
konnten sie bis 1989 nicht erlangen. Ihre Religiosität war jedem bekannt, ihre Vorgesetzten und
KollegInnen hatten sich daran gewöhnt, wie auch an die Tatsache, dass sie deshalb einen gesell-
schaftlichen Nachteil zu erleiden hatten. Sie waren im Verhältnis zur gesellschaftlichen Erwar-
tung und zum Konformismus deviant. Trotzdem haben sie sich überall als sehr gute Arbeitskräfte
erwiesen. Sie haben aber weder des gesellschaftlichen Aufstiegs wegen, noch für Anerkennung
mit ihren Vorgesetzten zusammengearbeitet. Die fleißige Arbeit und das Ertragen der Schwierig-
keiten war ein Ergebnis ihrer Religiosität.
B1. Die Bewahrer der Tradition
Wir nennen diejenigen so, die im vergangenen System im Dienst der Kirche standen, ohne sich
dem Staat zu ergeben. Vom sozialistischen System haben sie nichts akzeptiert und sie haben sich
auch nicht angepasst. Einige haben auf eine vielversprechende, kirchliche Karriere verzichtet.
Das Regime hat ihre Arbeit beobachtet, aber dies stellte keine echte Gefahr für sie dar. Ihre Tä-
tigkeit hat den Rahmen der traditionellen Kirche nicht gesprengt. Sie waren keine Mitglieder in
religiösen Gemeinschaften und haben nicht an den eine Kirchenreform befürwortenden Bewe-
gungen teilgenommen. Eine solche Reform war sogar in den Augen der Bewahrer der Tradition –
daher ihre Bezeichnung – mit den Traditionen der Kirche unvereinbar. Ihr Leben war voll von
zugestandenen oder verschwiegenen Konflikten. Sie verstanden sich nur mit denjenigen, die auf
den Traditionen der offiziellen Kirche beharrten. Sie konnten aber auch nicht jenen Teil der offi-
ziellen Kirche akzeptieren, der einen Kompromiss mit dem Staat geschlossen hatte. Sie haben
sich also sowohl von den Mitgliedern der Untergrundkirche als auch von den mit dem Staat im
Dialog stehenden Kirchenvertretern abgewandt. Indem sie auf ihre Bewahrer-Rolle bestanden,
konnten sie sich nicht an die veränderte Welt anpassen. Die Behauptung würde zugespitzt etwa
so lauten: Wessen Denkweise von der ihren abweichte, den zählten sie zu den Feinden der Kir-
che. In dieser Lage sind sie einsam und zu Sonderlingen geworden und dies auch geblieben.
B2. Heilige Aktivisten
Wir zählen diejenigen in diese Gruppe, welche die Religionsverfolgung nicht allein, sondern mit
ihren Leidensgenossen auf sich nahmen. Sie lebten fortwährend in einer Gemeinschaft, was ihren
Lebensweg sehr bewegt machte. Am meisten bedeutete für sie ihre religiöse Umgebung und die
182
von dort erhaltene Anerkennung. Ihr echtes Lebensziel haben sie hier gefunden. Sie haben die
Welt zweigeteilt, in wir und sie. „Wir“ bedeutete ihre religiöse Gemeinschaft. Dafür waren sie
sogar bereit, ins Gefängnis zu gehen. Sie lebten auf „Inseln“, sowohl innerhalb der Gesellschaft
als auch in der Kirche. „Sie“ bedeutete die Gesellschaft. Wer ihr Leben kannte, konnte sie mit
Recht beneiden. In einer Gesellschaft, wo es an Gemeinschaften mangelte, waren stabile zwi-
schenmenschliche Beziehungen sehr selten. Deshalb galten sie in den Augen anderer als stark
und sonderbar.
C. Verberger
Das sind jene Personen, die weder ihre religiöse Überzeugung, noch den gesellschaftlichen Auf-
stieg aufgeben wollten. Dieser Voraussetzung konnten sie aber nur dann entsprechen, wenn sie
die Bedeutung der Religion neu definierten. Als sie nicht zur Kirche gehen durften, meinten sie:
„auch ohne Kirche kann man religiös sein“. Wenn es gefährlich war, ihre Überzeugung offenzu-
legen, dann sagten sie dazu: „Es zählt, wie man sich verhält, und nicht, was man sagt.“ Die Reli-
giosität bedeutete einmal ein moralisches Verhalten, ein andermal eine humanistische Einstel-
lung, manchmal sogar die bewusste Anpassung an die religionsfeindliche Gesellschaft durch eine
völlige Umdeutung der Religiosität.
C1. Einsame Verberger
Wer ohne Kirche oder Untergrund-Organisation allein geblieben ist, hat normalerweise die Reli-
gion für sich neu definiert. Diese Personen haben sich von der öffentlichen Religionspraxis fern-
gehalten, sie sind nur dann in die Kirche gegangen, wenn sie unerkannt bleiben konnten. Der
Sinn der Glaubenspraxis hat sich für sie verändert. Er wurde nicht mehr von der Kirche be-
stimmt, sondern von den Umständen diktiert. Wer dieses Verhalten gewählt hat, war sich des
Verbergens bewusst und erlebte es als schicksalhaft. Es bedeutete keinen inneren Konflikt für sie,
weil sie sich nicht freiwillig, sondern durch den Druck der Umgebung so verhalten haben. Der
einsam erlebte Glaube entwickelt sich ohnehin nach den Lebensumständen der Einzelperson und
führt sehr wahrscheinlich zu Einengungen.
C2. Verberger in der Gemeinschaft
Die andere Gruppe der Verberger hat ihre Religion in Gemeinschaft erlebt. Dabei geht es um
diejenigen, die weit entfernt von ihrem Wohnort eine religiöse Gemeinschaft oder Kirchenge-
meinschaft gefunden haben, die sie anonym aufgenommen hat. Sie haben an einem fremden Ort,
aber dafür regelmäßig ihren Glauben praktiziert. Sie haben sich, wenn auch unter Ausschließung
der sie kennenden Öffentlichkeit, an die von der Kirche vorgeschriebenen Normen gehalten. In
ihrer Religiosität waren sie den „heiligen Aktivisten“ sehr ähnlich, in ihrem sozialen Verhalten
183
unterschieden sie sich. Sie mussten zwischen dem Erlangen der gesellschaftlichen Karriere und
der Beibehaltung der Religiosität balancieren.
D. Konfliktloser, religiöser Lebensweg – die Treuen
Diese Menschen haben eine niedrigere soziale Stellung gerbt, und sie konnten oder wollten keine
höheren Positionen erreichen. Sie sind nie in eine solche soziale Lage (in eine höhere Position)
geraten, in der sich über sie herausstellen hätte können, wie weit sie bei der Erfüllung von for-
mellen, gesellschaftlichen Erwartungen gegangen wären. Kleinere Kompromisse haben sie zwar
im Laufe ihres Lebens geschlossen, mit ihrer Glaubenspraxis haben sie jedoch nicht aufgehört.
Nach der Darstellung dieser Typen können einige Thesen formuliert werden, die vor allem die
verschiedenen Epochen der Diktatur fokussieren. In der ersten, widerstehenden Epoche der Kir-
che (während der Religionsverfolgung) können wir viele Ähnlichkeiten im Verhalten der vier
Gruppen finden. Die wirksamste Verhaltensweise ist die kirchenorientierte Haltung. Zur Zeit der
Isolierung haben sich die Typen stark von einander abgegrenzt. In der zweiten Epoche (1956-
1964) ist der Unterschied zwischen den autonom-religiösen und den gesellschaftsorientierten
Verhaltensweisen größer geworden. In der dialogvisierenden Epoche der Kirche haben sich die
vier Verhaltenstypen einerseits weiter polarisiert, andererseits aber teilweise einander angenähert.
Die Entfernung zwischen den beiden Typen der autonomen Religiosität hat sich vergrößert. Die
Entfernung zwischen den autonomen und konfliktlosen Gruppen ist kleiner geworden. Die sozia-
le Entfernung zwischen den autonomen und den gesellschaftsorientierten Gruppen hat sich ver-
größert.
Bischöfliche Optionen
In den betroffenen Ländern und in der internationalen Literatur werden Bischöfe aus der Zeit der
harten und der milderen Diktatur als Symbolfiguren bezüglich Anpassung und Widerstand er-
wähnt. Durch ihre etwas schematisierte Biographie werden sie für die Beschreibung und Deutung
dieser Zeiten genommen. Unsere Forschung hatte nicht die Aufgabe, eine vergleichende Biogra-
phieforschung der Bischöfe in Ost(Mittel)Europa durchzuführen, die Länderberichte bieten aber
Anhaltspunkte für die kurze Skizzierung dieses Teilthemas.
Bezüglich Ungarn wird Kardinal József Mindszenty als Symbol des Wiederstands, Kardinal
László Lékai dagegen als Symbol der Anpassung gesehen. Ersterer hat eine sehr harte Linie be-
züglich der Verhandlung mit den Kommunisten geführt und dafür viele Jahre im Gefängnis ver-
bracht, wo er häufig gefoltert wurde. Aus seinem ehemaligen Sekretär wurde sein Nachfolger, als
Mindszentys Primatsstuhl von Papst Paul VI. als vakant erklärt wurde. Lékai (Erzbischof und
Primas in Esztergom ab 1976) war ein Mann der kleinen Schritte, der in der Zeit der nachlassen-
184
den Diktatur versuchte, die Spielräume der Kirche immer mehr zu erweitern. Dafür erntete er
Ansehen in der Politik, schied aber die Geister in der Kirche. Viele waren der Meinung, dass er
ein Verräter war, viele meinten andererseits, dass er unter den gegebenen Umständen eine erfolg-
reiche Verhandlungspolitik zu führen vermochte. Die heutigen Erinnerungen, die auf eine offizi-
elle Geschichtsschreibung zielen und eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Legitimierung
der Kirchenleitung nach der Wende spielen, versuchen die Kontinuität der bischöflichen Optio-
nen zu betonen. Es wird Kardinal Mindszenty als Märtyrer, Kardinal Lékai als Politiker geprie-
sen, ohne die große Verschiedenheit ihrer Einstellungen bezüglich der Diktatur zu betrachten.
Bemerkenswert ist auch die Beharrlichkeit der Kirche auf dem Symbolismus des durchgehenden
Widerstands von Bischöfen. Ein Beispiel dafür ist in Kroatien Bischof Stepinac. Mit der Beatifi-
kation von Kardinal Stepinac und anderer MärtyrerInnen wurde dieser Symbolismus unter den
neuen gesellschaftlichen Umständen nach der Wende zusätzlich verstärkt. Die Auswahl solcher
„Heiliger“ ist meistens sehr begründet. Eine gewisse Absolutisierung des radikalen Widerstands
überdeckt und verschleiert aber gewissermaßen alle anderen Wege und Schritte und dient auch
implizit dazu, dass einige andere, vielleicht weniger relevante, aber trotzdem unumgängliche
Tatsachen im geschichtlichen Vergessen bleiben.292
Neben dieser öffentlichen Betrachtungsweise gibt es eine latente, stärker zeitgeschichtlich orien-
tierte Diskussion über diese großen Kardinalspersönlichkeiten, an der aber eher Fachleute als
Amtsträger teilnehmen.
Es darf aber nicht vertuscht werden, was die Länderberichte aus mehreren Ländern hervorheben:
Auch unter den Bischöfen hat es einige gegeben, die informell mit der Geheimpolizei zusam-
mengearbeitet haben.293 Es wäre aber grundsätzlich falsch zu meinen, dass diese Gruppe einheit-
lich gewesen wäre. Die Archivarbeiten haben gezeigt, dass man mindestens drei Typen solcher
Kollaborateure wahrnehmen kann. Der erste Typ ist der Karrierist, der nur Informationen wei-
tergibt, wenn das für seine eigene Karriere von Nutzen ist. (Typische Karriere: Bischofsweihe,
größere Pfarre, Publikationsgenehmigung, Ausreise nach Westen u.a.m.) Die anderen Extreme
werden von Bischöfen verkörpert, die durch ihre schwere Krankheit oder sexuelle Probleme er-
presst werden konnten. Die meisten sind aber im Interesse der Kirche diesen Weg gegangen, in
der Hoffnung, durch ihre Tätigkeit den pastoralen Handlungsspielraum der Kirche erweitern zu
können und/oder engagierte ChristInnen und Gruppen vor der Verfolgung schützen zu können.
In Slowenien soll Vekoslav Grmič, der Weihbischof von Maribor und Dogmatikprofessor an der
Theologischen Fakultät, mit den Kommunisten zusammengearbeitet haben, was in den Doku-
mentationen der Geheimpolizei aufgezeichnet und später veröffentlicht wurde. Er arbeitete am
292 Grubišić, Konformismus. 293 Gudea/Marţian, Typologie und Pilvousek, Widerstand.
185
Projekt der sogenannten „sozialistischen (Selbstverwaltungs-)Theologie“. Er versuchte zu erör-
tern, wie die Christlichsozialen vor der Revolution (vor dem zweiten Weltkrieg) die Katholiken
als kirchenkritische ChristInnen deklarierten, zugleich aber animierte er sie zur Unterordnung
unter die staatlichen kommunistischen Macht. Diese Funktion übt er sogar noch heute nach der
Wende aus. Es ist eine slowenische Spezialität, dass die frühere Konformität mit dem System
sogar nach der Wende eine enorme Rolle spielt. Die Kommunisten verwenden alle Mitarbeiter,
auch den bereits erwähnten Bischof und manche Priester und sonstige wichtige Mitarbeiter des
Systems, um weiterhin die Macht über die Nation zu behalten.294
Nachwirkungen
Hiermit schließen wir die Darstellung der Rahmenbedingungen und der institutionellen und per-
sönlichen Entscheidung- und Handlungsalternativen in den verschiedenen Epochen der kommu-
nistischen Diktatur in Ost(Mittel)Europa . Es bleibt noch die Aufgabe, Entwürfe für die theologi-
sche und pastorale Behandlung zu formulieren.
Wie wir gesehen und auch genügend argumentiert haben, ist die Problematik des Konformismus
und Widerstands in dieser Region sehr komplex, was zu einer nüchternen und feinen Differenzie-
rungen verpflichtet. Man soll sich gegen die vereinfachende, globalisierende Sicht wehren, nach
der die Diktatur in allen Ländern durch die 40 Jahre hindurch gleich geblieben ist und eigentlich
nur zwei gegensätzliche Handlungsalternativen offen ließ. Die Analyse der Lebenswege hat ge-
zeigt, dass keine Art von Moralisierung diese Geschichte verstehen und deuten lässt. Nur eine
fundierte und präzise Analyse des gesellschaftlichen und religiösen Umfeldes ermöglicht Aussa-
gen über die moralischen Erwägungen, die eher ein Angebot für die Betroffenen als ein Aus-
gangspunkt für einen Urteil sein können. Dennoch hat jeder in der Kirche und in der ganzen Ge-
sellschaft ein Recht auf Information über die tatsächliche Haltung und das Durchhalten der Kir-
che und der Christen in einer atheistisch-materialistischen Diktatur. Das Recht auf diese Informa-
tion verlangt auch Grenzziehungen, wobei das moralisch zu Bejahende klar vom moralisch zu
Verneinenden unterschieden werden soll. Vor allem die Katholiken, aber auch alle Mitglieder der
Gesellschaft haben ein Recht darauf, dass Meinungen und Handlungen auch Konsequenzen ha-
ben. Die Regelung dieser Konsequenzen soll aber nach allgemeinen und speziellen, kirchlichen
Grundsätzen passieren und darf nicht willkürlichen Interessenkonflikte ausgeliefert werden.295
294 Juhant, Konformismus. 295 Nach der Zielsetzung dieses Buches wird hier die Frage nicht mehr behandelt, wie theologisch, kirchenrechtlich und
praktisch mit der Vergangenheit nach der Wende umgegangen wurde/wird.
186
Theologische Weiterführung
Für die theologische Weiterführung werden Anhaltspunkte aus der Kirchengeschichte, Kirchen-
recht und aus der Moraltheologie genommen, um die Ergebnisse, Einsichten und Einstellungen
über die in Ost(Mittel)Europa heute höchst aktuellen Fragen der Vergangenheit in die lebendige
Tradition der Weltkirche einzubinden und auch um Anregungen zu finden für die pastorale
Handhabung dieser Problematik.
Botschaft des Evangeliums
Mit seinem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen (vgl. Mt 13,24-30. 36-43) gab Jesus ein
deutliches Zeichen dafür, dass eine entgültige Trennung nicht in seinem Leben und nicht in je-
nem seiner Jünger stattfindet, sondern seinem Vater vorbehalten ist, wenn die „Zeit der Ernte da
ist“. Dieses Gleichnis gehört zu den eschathologischen Reden und ist eine eindeutige Provokation
denen gegenüber, die in dieser Epoche schon Entgültiges über die zeitlichen Dinge aussagen
wollen. Jesus spricht dafür, dass solche Urteile bei Gott verbleiben sollen, damit unter den Men-
schen keine moralische Klassengesellschaft aufgestellt werden kann, wo die Heiligen und die
Sünder je eine Klasse bilden. Jesus will damit keineswegs die moralische Urteilskraft der Men-
schen untergraben, er will lediglich bei den praktischen Durchführungen gegen die Exkommuni-
kation optieren. Während ihrer ganzen irdischen Pilgerschaft wird auch in der Kirche der gute
Weizen unentwirrbar mit dem Unkraut zusammenwachsen, d.h. die Heiligkeit steht neben Un-
treue und Sünde.
Zwischen Sünden vergeben und Sünden bekennen gibt es nach der Lehre Jesu freilich ein wech-
selseitiges Verhältnis. Wie die Kirche in dem Gebet des Meisters betet: „Vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigem“ (Mt 6,12.12-15), so kann die Kirche wirklich
Vergebung lernen, wenn sie bei Gott für die eigene Verfehlungen um Vergebung bittet. Es ist
nicht psychologisch, sondern theologisch wichtig zu unterstreichen, dass diese Wechselbezie-
hung für die Identität und für die Praxis der Kirche grundlegend ist. Die Internationale Theolo-
genkommission betont in ihrem Schreiben: „Jesus insistiert auf diesem Verhalten des Geschädig-
ten gegenüber seinen Schuldigen. Er ist aufgerufen, den ersten Schritt zu tun. Nur der kann den
Teufelskreis der Vergeltung durchbrechen, der ‚von Herzen’ vergibt (vgl. Mt 18,35; Mk 11,25),
wohlwissend, dass er selbst Sünder ist vor Gott, der die ehrliche Bitte um Vergebung nie zu-
rückweist. In der Bergpredigt erwartet Jesus von dem, der weiß, dass sein Bruder etwas gegen
ihn hat, ‚dass er hingeht und sich mit seinem Bruder versöhnt, ehe er seine Gabe auf dem Altar
opfert’“ (Mt 5,23f.).“
187
Kirchengeschichte
Die Kirchengeschichte ist voll von Vorwegnahmen des Urteils mit der Konsequenz der Exkom-
munikation vor allem in den Zeiten von Bedrängnissen durch Häretiker, Reformatoren oder kul-
turelle Attacken der modernen Zeit. Die Urteile standen im Dienst der Identitäts- und Einheitssi-
cherung der Kirche. Die Lehre über die Kirche hat aber nie behauptet, dass die Kirche sündenfrei
oder sünderfrei wäre.
Ein historisches Beispiel ist nützlich in Erinnerung zu rufen, wie ein Papst über die Sünden der
Kirchenmitglieder auch im Klerikerstand spricht – ohne natürlich damit gesagt zu haben, dass die
Kirche als solche zu „Unkraut“ geworden wäre. Der Reformpapst Hadrian VI. hat in einer Bot-
schaft an den Reichstag von Nürnberg am 25. November 1522 aufrichtig bekannt: „Missbräuche
in geistlichen Dingen, Übertretungen der Gebote, ja, dass alles sich zum Ärgeren verkehrt hat. So
ist es nicht zu verwundern, dass die Krankheit sich vom Haupt auf die Glieder, von den Päpsten
auf die Prälaten verpflanzt hat. Wir alle, Prälaten und Geistliche, ‚sind vom Wege des Rechtes
abgewichen, und es gab schon lange keinen einzigen, der Gutes tat’ (Ps 14,3). Deshalb müssen
wir alle Gott die Ehre geben und uns vor ihm demütigen; ein jeder von uns soll betrachten, wes-
halb er gefallen, und sich lieber selber richten, als dass er von Gott am Tage seines Zornes ge-
richtet werde.“296
Eine selbstkritische Haltung hat das Zweite Vatikanum in einigen Punkte eingenommen, die vor
allem Verfehlungen in der Zeit der Moderne bedauern:
• die Verfehlungen gegen die Einheit: „In Demut bitten wir also Gott und die getrennten
Brüder um Verzeihung, wie auch wir unseren Schuldigem vergeben“297;
• negative Erscheinungen der Geschichte auf, bei denen Christen eine bestimmte Verant-
wortung zukommt. „Deshalb sind gewisse Geisteshaltungen, die einst auch unter Chri-
sten wegen eines unzulänglichen Verständnisses für die legitime Autonomie der Wissen-
schaft vorkamen, zu bedauern. Durch die dadurch entfachten Schwierigkeiten und Aus-
einandersetzungen schufen sie in der Mentalität vieler die Überzeugung von einem Wi-
derspruch zwischen Glauben und Wissenschaft“298;
• „die Entstehung des Atheismus“, bei der auch die Gläubigen „einen gewissen Anteil“
haben können, insofern man sagen muss, „dass sie durch Vernachlässigung der Glau-
benserziehung, durch missverständliche Darstellung der Lehre oder auch durch Mängel
296 Vgl. Erwin Iserloh, Die protestantische Reformation 111. 297 Unitatis redintegratio 7. 298 Gaudium et spes 36.
188
ihres religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen Lebens das wahre Antlitz Gottes und
der Religion eher verhüllen als offenbaren“299;
• Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und
von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet haben“.300
Diese Marksteine in der Kirchengeschichte dienten als Hintergrund des Sündenbekenntnisses des
jetzigen Papstes zur Jahrtausendwende und können auch zur kritisch nüchternen Geschichtsbe-
trachtung der Kirche in Ost(Mittel)Europa verhelfen. Nach der kirchengeschichtlich bewiesenen
Selbstkritik der Kirche soll der Frage nachgegangen werden, was für kirchenrechtliche Basis für
die Beurteilung des Problems der kirchlichen Kollaboration gefunden werden kann.
Apostasie im Kirchenrecht
Im gültigen Kirchenrecht gehört das Problem der Kollaboration zum Casus der Apostasie. Sie hat
zwei Arten: die Ablehnung einer zentralen Wahrheit oder den Beitritt zu einer explizit kirche-
feindlichen Organisation. Diesbezüglich hat dieser Codex die Bestimmungen des Codex 1917
nach dem Sinn übernommen, nur dort wurden die Freimauer als kirchenfeindliche Vereinigung
eigens erwähnt und die anderen gegen die Kirche agierenden Vereinigungen im Vergleich zu den
Freimauer betrachtet. Der gemeinsame Nenner sind aber klar die Machenschaften gegen die Kir-
che.301
Der Codex unterscheidet drei Arten des Glaubensverfalls im Can. 751: „Häresie nennt man die
nach Empfang der Taufe erfolgte beharrliche Leugnung einer kraft göttlichen und katholischen
Glaubens zu glaubenden Wahrheit oder einen beharrlichen Zweifel an einer solchen Glaubens-
wahrheit; Apostasie nennt man die Ablehnung des christlichen Glaubens im ganzen; Schisma
nennt man die Verweigerung der Unterordnung unter den Papst oder der Gemeinschaft mit den
diesem untergebenen Gliedern der Kirche.“ Der Begriff Apostasie wird näher umschrieben von
can 694 §1,1 CIC: „offenkundig vom katholischen Glauben abfallen“ sowie im can 194 §1,2 CIC
„vom katholischen Glauben oder von der Gemeinschaft der Kirche öffentlich abfallen“ und in
can 316 §1 „öffentlich den katholischen Glauben aufgeben“. Apostasie kann sich äußern im Bei-
tritt zu einer heidnischen oder atheistischen Vereinigung oder auch in einem praktischen Atheis-
mus. „Der Beitritt als solcher macht freilich nicht das Wesen der Apostasie aus.“302 Anderen
299 Gaudium et spes 19. 300 Nostra aetate 4. 301 Can. 2335. Nomen dantes sectae massonicae aliisve eiusdem generis associationibus quae contra Ecclesiam vel
legitimas civiles potestates machinantur, contrahunt ipso facto excommunicationem Sedi Apostolicae simpliciter re-servatam. (CIC 1917) (Hervorhebung von mir.)
302 Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht I 126-128.
189
kirchenrechtlichen Überlegungen nach tritt dieser Canon auch in Kraft, wenn jemand nicht in
eine der genannten Vereinigungen beitritt, sondern ihre Ziele fordert.303
„Ein Sonderfall der Apostasie ist das Bekenntnis zum Kommunismus. Die kommunistische
Weltanschauung ist materialistisch und antichristlich. Wer sich zur Lehre der Kommunisten be-
kennt, insbesondere wer diese Lehre verteidigt oder verbreitet, ist vom katholischen Glauben
abgefallen.“304 Obzwar in Kommentaren behauptet wird, dass nach dem Zusammenbruch mei-
sten kommunistischen Regierungen seit dem Ende der Achtzigerjahre die anstehende Frage „frei-
lich ihre Brisanz verloren“ hat, zeigen die Analysen über die nicht aufgearbeitete kirchliche Ver-
gangenheit deutlich, dass diese Problematik ihre Aktualität und Schwere keineswegs verloren
hat.305
Can. 1364: 1. Der Apostat, de Häretiker oder der Schismatiker ziehen sich die Exkommunikation
als Tatstrafe zu...“; §2. „Wenn andauernde Widersetzlichkeit oder die Schwere des Ärgernisses
es erfordern, können weitere Strafen hinzugefügt werden, die Entlassung aus dem Klerikerstand
nicht ausgenommen.“
Can. 1323: „Straffrei bleibt, wer Übertretung eines Gesetzes oder eines Verwaltungsbefehls... 3°
gehandelt hat aufgrund physischer Gewalt... 4° aus schwerer Furcht, wenngleich nur relativ
schwer, gezwungen oder aufgrund einer Notlage oder erheblicher Beschwernis gehandelt hat... 5°
aus Notwehr einen gegen sich oder einen anderen handelnden ungerechten Angreifer unter Be-
achtung des gebotenen Verhältnismäßigkeit abgewehrt hat... 7° ohne Schuld geglaubt hat, einer
der in den nn. 4 oder 5 aufgeführten Umstände liege vor.“
Diese Vorschriften bieten genügende Distinktionen für die Prüfung des breiten und bunten Spek-
trums der sogenannten Kollaboration. Meines Wissens wurde in der katholischen Kirche nach der
politischen Wende gegen keinen der Bischöfe und Priester Strafferfahren in Gang gesetzt und
auch die kirchenrechtliche Fachliteratur behandelte die Anwendungsmöglichkeiten der oben
zitierten Canons nicht. Eine mögliche rechtliche Erklärung dafür mag die Sicherung der Straf-
freiheit durch „Notwehr“ sein, worauf sich viele damaligen Verantwortungsträger beriefen und
was auch in manchen gutwilligen Publikationen über diese Sachlage erwähnt wird. Es ist hier
sicher keine Aufgabe diesen Mangel am Rechtshandeln nachzuholen, aber darauf hinzuweisen
scheint wichtig zu sein.
303 Münsteraner Kommentar zum Codex Iuris Canonici III 751. 304 Es wurden die christlichen Eltern im Monitum (1950) davon gewarnt, daß sie kommunistische Jugendorganisatio-
nen unterstützen, weil diese die Kinder auf ideologischen und praktischen Ebene gegen die Religion und Kirche er-ziehen. Die Strafe für die Christen, die doch solche Organisationen – unabhängig von den Namen – fördern, ist gleich mit der der Mitgliedschaft oder der Förderung der kommunistischen Partei, wie es in dem Decretum von 1949 steht. In dem ganannten Decretum hat die Kongregation die Frage eindeutig und kommentarlos bejaht, daß die Christen, die der kommunistischen Ideologie huldigen, oder sie propagieren gelten als Apostaten des katholischen Glaubens und werden ipso facto mit dem Exkommunication bestraft. (SC Off. vom 1.7.1949: AAS 41 (1949) 334. SC Off. vom 28.07.1950: AAS 42 (1950) 553).
190
Für die kirchenrechtliche Prüfung einzelner Fälle ist es von Bedeutung, welche verpflichtenden
ortskirchlichen Erlasse von der Kirchenleitung über die Haltung gegenüber staatlichen Behörden
schriftlich oder mündig gegeben wurden. Vor allem in der ehemaligen DDR gab es solche klare
Anweisungen, die die allgemeinen kirchlichen Gesetze für die konkreten Fälle angepasst haben.
„Die schriftlichen Anweisungen wurden durch mündliche Instruktionen auf den Priesterkonfe-
renzen regelmäßig ergänzt... Bedeutung und Wirkkraft dieser Anweisungen sind trotz gelegentli-
cher individueller Überschreitungen im katholischen Bereich alles andere als zu unterschätzen:
97 Prozent aller kirchlicher Mitarbeiter hielten sich in einem historischen Zeitraum von vierzig
Jahren an diese Richtlinien.“306 In Ungarn haben Bischöfe erst im Jahr 1957 „eine detaillierte
Meinung über die Friedenspriesterbewegung zwischen 1950 und 1956“ veröffentlicht, die aller-
dings damals schon aufgelöst war.307 In den meisten Ländern Ost(Mittel)Europas unter kommu-
nistischen Diktatur war es für die Kirchenleitung unmöglich, ihre Stellung klar und öffentlich den
Priestern und den Gläubigen bekannt zu machen.
Lapsi – ein Modell für heute
Die Interesse an den Abgefallenen ist heutzutage keine besondere Seltenheit und ist keineswegs
begrenzt auf die Theologen der Reformstaaten. Der wichtigste zeitgenössische Autor zu dieser
Frage, der heilige Cyprian von Karthago, Bischof, Lapsus und dann Martyrer, der erste Theologe
Afrikas im dritten Jahrhundert, weckt heute Interesse.308 Dies ist nicht nur seiner Persönlichkeit
zu danken, sondern auch der überaus turbulenten Situation seiner Zeit – nicht nur in Nordafrika,
sondern auch in der ganzen Christenheit. Unsere Aufmerksamkeit widmen wir Cyprian und der
Lapsi-problematik seiner Zeit darum, weil es in den Reformländern allgemein und insbesondere
in der Kirche dieser Region an theologischen Anhaltspunkten zur Betrachtung und Erwägung der
Kollaborateure mangelt. Es gibt eine politische Betrachtung und auch eine historische, vor allem
anderen aber wird mit dieser unerledigten, unaufgearbeiteten Thematik Politik gemacht: links
und rechts, zivil und kirchlich mit der gleichen Lust.
Diese Betrachtung ist gleichfalls ein Versuch, Zusammenhänge aus der Kirchengeschichte durch
die spezielle Brille der Zweiten Welt neu zu lesen und zu deuten. Die Historiker haben es beson-
ders ungern, wenn jemand – ein Theologe – unter dem Motto, „historia est magistra vitae“, Jahr-
hunderte überspringt und zu Aussagen kommt, die nicht mehr wissenschaftlich, sondern nur
305 Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht I 126-128. 306 Grande/Schäfer, Interne Richtlinien 394f. 307 Orbán, Friedensbewegung 201. 308 Cyprians Bekehrung zum Christentum fällt in die vierziger Jahre des 3. Jahrhunderts. Er war ein wohlhabender,
gebildeter, kompetenter Mann, der bald zum Priester und auch kurz darauf zum Bischof geweiht wird. Dann wird er Metropolit für alle nordafrikanischen Gemeinden. Eine schnelle und beachtliche Karriere, die allerdings damals gar nicht untypisch war.
191
ideologisch gelten. Dies ist mit einem Zweitlese nicht gemeint. Wir sind uns dessen voll bewusst,
dass es gar nur wenig Ähnlichkeiten zwischen dem vierten und dem zwanzigsten Jahrhundert
gibt. Eine Kirche von damals und die Kirche von heute sind zwei verschiedene Welten. Dennoch
können Verhältnisse, Überlegungen, theologische Gesichtspunkte von damals für unsere heutige
Problematik Anhaltspunkte anbieten, mit denen wir unsere heutige Situation tiefer verstehen und
seriöser deuten können.
Der Vergleich fußt auf dem hermeneutischen Prinzip, wonach die existentielle Grundlage des
Menschen vergleichbar ist, obwohl der Mensch immer wieder einer historisch bedingten Ent-
fremdung ausgesetzt ist. Das ist aber möglich, indem der Mensch sich als dialogisches Wesen
annimmt und bereit ist, den anderen (das Du) als Dialogpartner anzunehmen. Dadurch wird die
existentielle Situation angesprochen und zwar gerade durch diesen Dialog. Der Mensch, der be-
reit ist, Dialog zu führen, kann hermeneutisch auch die Wahrheit erschließen. Die grundsätzliche
Dialogbestimmtheit des Menschen ‚zwingt’ den Menschen, im Dialog mit den anderen zu blei-
ben.
Hier bedeutet das Dialogbereitschaft mit der Geschichte und so auch mit der Gegenwart. Die
„Märtyrer- und die Lapsi-situationen“ entstanden gerade auf Grund der mangelnden Bereitschaft,
für die eigene Lebenssituation im Dialog eine Lösung auszuhandeln. Mit anderen Worten: Der
Mensch soll seiner existentiellen Verfasstheit gemäß leben. Diese schließt aber das Bemühen, die
existentiellen (die ontischen wie die sozialen Lebensbedingungen) so zu gestalten, dass die
Grundverfasstheit des Menschen - seine existentielle oder ontologische Grundlage bewahrt
bleibt. Zu dieser Grundlage gehört aber die Dialog-Verfasstheit unbedingt dazu. Damit ist die
Offenheit des Menschen zum Dialog (zu sich selbst, zu anderen und zu Gott gemeint – was hier
nicht detailliert ausgearbeitet werden kann). Nach Gadamer verschließt sich der Mensch in äuße-
ren ‚Kunstbedingungen’, wenn er nicht die Dialoggrundlagen freizulegen bereit ist. Der Konflikt
und die Folgen sowohl des Märtyrertums wie der „Lapsi“ entsteht gerade dadurch, dass die le-
bensmäßigen Konfliktssituation nicht im Dialog ausgetragen wurden. So wird das Modell des
Verstehens und der Annahme der menschlichen Dialog-Grundverfassung die Grundlage sowohl
des Verstehens einer jeden historischen Existenz, wie auch der Vergleichsmöglichkeit der ver-
schiedenen Existenzbedingungen sowie die Grundlage zur Lösung solcher Konflikte überhaupt
sein.309
Es muss aber ein wichtiger Unterschied respektiert werden. In der frühchristlichen Verfolgungs-
zeit sind viele Christen nach dem Zeugnis der Väter zum Götzenopfer gezwungen worden, unter
dem Kommunismus konnten jedoch die ‚gewöhnlichen’ Christen (mindestens nach der ersten
Phase) überleben.
309 Vergl. Gadamer, Die Universalität.
192
Somit verlieren wir gar nicht unsere Ehre vor den Vorfahren in der Nachfolge Christi und verein-
fachen die heutigen Zusammenhänge auch nicht. Wir greifen nur zu den Schätzen der kirchlichen
Tradition zurück, kritisch, engagiert und frei.
Zum Begriff „Lapsi“
Nach dem Reichsgesetz von Kaiser Decius (249) nannte man lapsi jene Christen, die in Form
eines Bittopfers ihre Loyalität gegenüber den Staatsgöttern und dem Kaiser erwiesen haben. Wer
das von den Behörden kontrollierte Opfer nicht vollzog und die nach dem Opfer ausgestellte
Bescheinigung nicht vorweisen konnte, dem drohten als Strafmaß Einkerkerung, Folter und Tod.
Wer als Christ das Opfer darbrachte, war exkommuniziert (Apostasie). Unter den Lapsi unter-
scheidet Cyprian die sacrificati und die libellatici.310 Erstere haben das Opfer vollgezogen, letzte-
re haben eine Bescheinigung gekauft, ohne geopfert zu haben.311 Die Christen wurden nicht we-
gen des nomen christianum bestraft, sondern aus der Sicht des Staates wegen der Gehorsamsver-
weigerung.
Neuere Forschungen haben gezeigt, dass der Opferbefehl nicht direkt gegen die Christen gerich-
tet war, sondern er galt allen Bürger des Reiches. Ein Opfer hatte zwei Ziele zu erreichen. Einer-
seits die Verstärkung der Verbindung zwischen Religion und Staat, andererseits das Beten für das
Wohlbefinden des Imperators. Die Christen haben natürlich für den Kaiser gebetet, weil sie
meinten, alle Macht komme von Gott. Tertullian konnte sogar schreiben: „Wir schwören nicht
beim Genius des Kaisers, sondern bei der salus Caesarum, die erhabener ist.“ Das Problem der
Christen bestand darin, mit dem Opfer eine Idololatrie zu begehen, was mit dem Christentum
unvereinbar ist. Der Rückfall in die pagane Religion bedeutet nach Cyprian der Verlust der Tauf-
gnade. Andererseits hielten die Römer die Gebete der Christen für den Kaiser eher suspekt und
gefährlich, weil sie nicht in der kontrollierten kultischen Öffentlichkeit geschahen. So meinten
sie, dass sie mehr Schaden, als Heil für den Herrscher bringen.
Zu den politischen Hintergründen dieser Opferforderung gehört vor allem, dass die erste Hälfte
des dritten Jahrhunderts durch die Bedrohung des Imperium Romanum gekennzeichnet war. In
dieser Krisensituation besinnt sich der römische Senat auf die alten Traditionen der römischen
Religion und begegnet der Toleranz der syrischen Kaiser östlichen Kulten gegenüber, zu denen
nach paganer Einschätzung auch das Christentum gehörte, mit zunehmender Skepsis. Sie waren
310 Frühere Werke haben noch weitere Untergruppen unter den Lapsi angenommen (z.B. turificati), aber die spätere Forschung hat diese Bemühungen widerlegt. Darum genügt es auch, uns hier danach zu fragen, welche theologi-schen Erwägungen für Cyprian für die Beurteilung der oben genannten zwei Gruppen angemessen sind.
311 Vgl. LThK 6, 652.
193
der Meinung, dass nur die Rückkehr zur Religion der Väter und eine gewissenhafte Verehrung
der Götter die Krise beheben und die alte Größe des Reiches wieder heraufführen kann.312
Das Problem der Apostasie musste von Anfang an in der Kirchengeschichte behandelt werden.
Nach der ältesten Überlieferungen galt Apostasie neben Mord und Ehebruch als eine Sünde, die
nicht vergeben werden konnte. Erst im dritten Jahrhundert begann einen alternative Praxis, wo-
nach einige Bischöfe begannen, die reuigen Sünder nach einer angemessenen Bußzeit wieder in
die Kirche aufzunehmen. Gegen diese Praxis haben viele Bischöfe protestiert. Noch mehr ver-
schärfte sich diese Problematik dadurch, dass bezüglich der Verfolgungen von Decius und Di-
okletian nicht nur Einzelfälle, sondern eine ganze Schar von Lapsi darauf drang, in die Kirche
wieder aufgenommen zu werden. Diese Bußproblematik belastete die damalige Zeit, führte zu
Schismen und zuletzt zum Donatistenstreit.
Es geht seit dem Apostolischen Zeit darum, die Ideale der vollen Absage an der Sünde, an das
Böse, mit der Realität der Sünder in den Gemeinden zu vereinbaren. Ein Mittel dafür ist die Be-
kehrung. Sie äußert sich in einer Zeit in reuigem Gebet, in Fasten und Almosengeben. Wesentli-
cher Bestandteil ist aber auch das Bekenntnis der Sündhaftigkeit vor Gott und vor der Gemein-
schaft der Brüder und Schwestern.313 Unter den Autoren findet man Rigorose und Laxe. Erstere
wollen im Interesse der Bewahrung der Heiligkeit der Kirche die Bedingungen der Wiederauf-
nahme der schweren Sünder in die Kirche erschweren. Die anderen hatten mehr Verständnis und
betonten das Erbarmen Gottes, das nach der (auch mehrfachen) Bekehrung die Heiligkeit des
Christen und der Kirche voll wiederherstellt.
Zur Zeit Cyprians brach eine erneute Diskussion um diese Bußregelungen aus, da nach der Deci-
schen Verfolgung die hohe Zahl der Abgefallenen die kirchliche Führung zu einer Überprüfung
der bisherigen Bußpraxis wenigstens in Einzelpunkten nötigte. „Dieser Phase der altchristlichen
Bußstreitigkeiten kommt kirchengeschichtlich die größte Tragweite zu, weil sie die kirchliche
Einheit in hohem Maße bedrohte und auch tatsächlich zu Spaltungen führte, die in der weit ver-
breiteten novatianischen Gegenkirche ihren Höhepunkt erreichten.“314 In den ersten Jahrzehnten
des dritten Jahrhunderts hatten die Christen eine ruhige Periode, die das Anwachsen ihrer Zahl
mit sich brachte. Allerdings wiesen die Väter darauf hin, dass die positiven Änderungen der kai-
serlichen Politik gegenüber den Christen Gefahren mit sich bringt. Auch Cyprian geißelt nach
Beendigung der Verfolgung der Christen ihre Gewinnsucht und diesseitige Lebensauffassung.
Ähnlich urteilt Dionysios von Alexandrien, als sich unter dem Decischen Opferbefehl viele Ge-
meindemitglieder als Scheinchristen erwiesen.315
312 Stritzky, Erwägungen 2-5. 313 Did 14, 1. 17. 314 Baus, Die Heiligkeit 373. 315 Stritzky, Erwägungen 2.
194
Es sollen die wichtigsten Positionen von Cyprian und Novatian kurz dargestellt werden und dann
abschließend das Ergebnis des Streites, welches uns zu einigen theologischen Grundoptionen für
die aktuelle Behandlung der Problematik der Lapsi in der nachkommunistischen Zeit Ost(Mittel)-
Europas anbietet.
Cyprian
Während der Decischen Verfolgung war Cyprian in Emigration.316 Dort wurde ihm berichtet,
dass an der von ihm gelehrten Bußpraxis Anstoß genommen werde. Einige Presbyter nahmen
ohne sein Wissen Abgefallene wieder in die Kirche auf, ohne von ihnen irgend eine Bußleistung
verlangt zu haben. Mehrere Abgefallene zeigten nämlich ein sogenanntes libellum pacis auf, d.h.
einen Brief von einem Märtyrer mit der Bitte um baldige oder sofortige Gewährung der kirchli-
chen Gemeinschaft für die Abgefallenen. Cyprians Antwort war eindeutig: Er verbot diese Praxis
und sprach den Presbytern das Recht der Wiederaufnahme ab. Die Friedensbriefe können nur als
Empfehlungen an die zuständige kirchliche Autorität betrachtet werden. Wenn der Abgefallene
todkrank war und auch einen Friedensbrief vorweisen konnte, dann dürfe er wieder aufgenom-
men werden. Andere als die Sterbenden aber müssten schon vorher Beweise echter Bußfertigkeit
gezeigt haben.
Die Reaktionen in Karthago auf diese Anweisungen des abwesenden Bischofs waren unter-
schiedlich. Einige haben ihre Praxis sofort danach gerichtet, andere aber revoltierten. Als Cyprian
im Jahr 251 nach Karthago zurückkehrte, hat er seine berühmte Schrift De lapsis geschrieben und
im selben Jahr eine Synode zusammengerufen. Seine Standpunkte, von Synodenbeschlüssen
unterstützt, haben eine differenzierte Haltung festgelegt. Ernste Buße muss von allen Abgefalle-
nen gefordert werden. Eine Sonderstellung erhielten die libellatici, dass heißt, die einen Freibrief
vorweisen konnten, und die sacrificati. Erstere konnten nach genauer Prüfung ihres Falles wieder
aufgenommen werden, die anderen nur in Todesgefahr. Sie haben sich einer eindeutigen Ver-
leugnung ihres Glaubens schuldig gemacht. „Wer aber sich bisher sich nicht zur Übernahme der
Buße bereit gefunden hatte, sollte auch in der Todesgefahr vom Frieden mit der Kirche ausge-
schlossen bleiben, da offensichtlich kein Bußwille vorhanden sei.“317
Als theologischer Hintergrund der Einstellung Cyprians dienen die zentrale Stelle des Bischofs
und der Eucharistie. Schon Campenhausen hat darauf hingewiesen, dass das kirchliche Denken
von Cyprian „in der Wurzel sakral-juristisch und sakral-politisch bestimmt (ist); die Wertschät-
zung des Bischofsamtes ist der unmittelbare Ausdruck seines religiös verstandenen Ordnungswil-
316 Sein eigenes Verhalten zu Beginn der Verfolgung, als er untergetaucht war, brachte ihn gegenüber den Bekennern in eine schwierige Position. Man wollte ihn deshalb auch in Rom in Mißkredit zu bringen.
317 Baus, Die Heiligkeit der Christen 374.
195
lens“.318 Die Kirche besteht aus dem Bischof, aus dem Klerus und aus den standhaft gebliebenen
Gläubigen. Der Bischof ist Garant der Einheit, seine zentrale Rolle wird gerade durch die Ableh-
nung einer kurschlüssigen Wiederaufnahme der Lapsi herausgestellt. Der Bischof trägt die Sorge
dafür, dass die Gemeinde die Einheit bewahrt und nicht durch inkompetente Beschlüsse verwäs-
sert wird.
Es mag sein, dass er der erste christliche Autor ist, der in seinen Briefen längere Traktate über die
Eucharistie geschrieben hat. Zum paganen Opfer gehörte auch das Essen des Opfermahls. Hier
sieht Cyprian ein Parallele zwischen der mensa Domini (der Eucharistie) und der mensa daemo-
niorum (dem heidinischen Opfermahl). Bezüglich der Lapsi stellt er fest, dass paganes und christ-
liches Opfer einander ausschließen. Die Wiederaufnahme der Abgefallenen in die kirchliche
Gemeinschaft und damit auch ihre Zulassung zum eucharistischen Mahl soll die Gläubigen zum
Martyrium befähigen, das nach Meinung Cyprians nur derjenige auf sich zu nehmen vermag, den
die Kirche zu diesem Kampf rüstet und durch den Empfang der Eucharistie stärkt.319
Es mag bei dieser Regelungen klar sein, dass ohne entsprechende Bußleistung keine Versöhnung
mit der Kirche stattfinden kann, aber auch, dass der kirchlichen Führung die Entscheidung über
die einzelnen Fälle zustehe. Es war also keine Frage, ob es überhaupt eine Buße in diesen Fällen
für die Abgefallenen möglich ist. Über diese Möglichkeit waren sich die Diskussionsparteien
einig. Es wurde lediglich die mildere Handhabung Cyprians von seinen Gegner kritisiert, die für
die Bewahrung und für die Wiederherstellung der Einheit der Kirche eine rigorose Praxis für
angebrachter hielten.
Novatian
Die rigorosere Praxis wurde in Rom praktiziert. Wortführer dieser Meinung war der wortstarke
Novatian. Ursprünglich stimmte Novatian in allen wichtigsten Punkten der Bußpraxis mit den
Regelungen von Karthago überein. Seine Stellung änderte sich, als der Papst Fabian nicht ihn,
sondern Cornelius zum Bischof von Rom ernannt hat. Darauf hin hat Novatian eine Gegenkirche
aufgebaut, für die er sehr erfolgreich u.a. damit geworben hat, dass die Wiederaufnahme der
Abgefallenen grundsätzlich zu verweigern sei. Eine römische Synode, woran etwa 60 Bischöfe
teilgenommen haben, bekräftigte die Praxis von Karthago. In Rom und in Karthago konnte Nova-
tian keine echten Erfolge haben, da die präventiven Maßnahmen des Papstes und von Cyprian
dies erfolgreich verhindern konnten. Aber im Osten hat er mehrere Bischöfe gewonnen, wo sein
Rigorismus noch lange Zeit weiterlebte. Es entstanden kleine rigoristische Gemeinschaften, die
sich anspruchsvoll Katharer, also die Kirche der Reinen, nannten.
318 Campenhausen, Kirchliches Amt 297f. 319 Ep 57,4.
196
Donatistenstreit
Das innere Problem des Umganges mit der Lapsi führte zu Spaltungen innerhalb der Kirche in
einer Zeit, als die Kirche ihre volle Bewegungsfreiheit wegen strenger Verfolgungen nicht entfal-
ten konnte. Mit Konstantin änderte sich die Situation. Jetzt wurde aus dieser inneren Konflikten
und Schismen ein Problem, das die neuen Beziehungen zwischen der Kirche und der kaiserlichen
Macht stark beeinflusste. Dieser Streit ist eine Folgeerscheinung der Diokletianischen Kirchen-
verfolgung.
Während dieser Verfolgung wollte der Kaiser die Christen dadurch schwächen, dass er sie ver-
pflichtete, ihm ihre heiligen Geräte, Bücher und Schriften auszuliefern. Die diesem Befehl nach-
gegangen sind, hießen traditores. Eine rigoristische Minderheit in Afrika betrachtete diese Tat als
Apostasie. Zu den traditores gehörten wichtige Persönlichkeiten, führende Gestalten der damali-
gen Christenheit, vor allem Bischöfe. Die von ihnen spendeten Sakramente und Weihen wurden
von den Rigoristen nicht anerkannt. Es kam in diesem Streit zu einer römischen Synode unter
Leitung von Papst Miltiades, auf der die Donatisten verurteilt wurden. Aber sie erreichten beim
Kaiser die Einberufung einer weiteren Synode in Arles, welche auf die donatistischen Sonderleh-
ren einging und die von ihnen vorgenommenen Weihen als gültig erkannte. Die Donatisten haben
dennoch in Afrika eine Gegenhierarchie ausgebaut und pochten auf die Autonomie der afrikani-
schen Kirche. 316 hat sich Konstantin entgültig gegen sie entschieden, wodurch die Donatisten
im ganzen Reich verfolgt wurden.
Die Theologie der Donatisten basierte auf die Ekklesiologie von Cyprian. Demnach können die
Sakramente nur in der völligen communio mit der Kirche gespendet werden. Darum hat eine
Ketzertaufe keine Gültigkeit. Um der vollen communio willen müssen die Christen, die eine
Ketzertaufe haben, neu getauft werden. Dies galt auch für die Weihe. Bis zum Ende des vierten
Jahrhunderts gab es die sporadische Praxis der Wiedertaufe und Wiederweihe; diese war aber
immer unpopulär und wurde bei den Wiederaufgenommenen immer weniger praktiziert.320
Fazit
Die Konflikte haben zu einer klaren Vorgabe geführt. Gegen den Rigorismus wurde eine erbar-
mungsvolle Haltung gestellt, die sich auf den Gründer der Kirche berufen konnte. Andererseits
soll allzu laxistischen Tendenzen Widerstand geleistet werden.
• Die Entscheidungsträger fahren zwischen Skylla des Erbarmens und Charybdis
der Schwere der Sünde.
• Die Autorität der Bischöfe soll gesichert werden.
197
• Die Tatbestände sollen präzis und seriös aufgedeckt werden.
• Es muss eine klare Grenzlinie zwischen Treue und Verrat gezogen werden.
• Bei einer größeren Menge der Abgefallenen erhöht sich der Druck zum Handeln.
• Diese Problematik verlangt nach theologischer Weisheit, nicht nur nach prakti-
scher und kirchenrechtlicher Tätigkeit.
• Die Einheit der Kirche kann nicht durch die Verwässerung der Moral und der
Lehre bewahrt oder wiederhergestellt werden.
Die Buße ist nach der Lehre Cyprians eindeutig eine private und zugleich auch eine kirchliche
Angelegenheit. Nach seiner Bußetheologie kann es auch nicht anders sein. „Sein Kampf gegen
die Laxisten ist in einem die Forderung der persönlicher harten Buße, wie die Forderung, sich der
Exhomologese zu unterziehen und sich von dem dazu allein autorisierten Bischof die communi-
catio erteilen zu lassen, während der bekämpfte Laxismus beides in gleicher Weise unterlässt.“321
Kirche der Kirche der Reinen?
Theologisch betrachtet verschärfte diese spannende Geschichte des vorkonstantinischen Chri-
stentums in der Theologie der Donatisten eine Auffassung von der Kirche, die in der späteren
Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag für viele eine starke Plausibilität genießt: die Kirche der
Reinen. In der Lebenszeit von Donatus entwickelte sich bereits eine solche Ekklesiologie durch
den Konflikt um Wiedertaufe und Wiederweihe. Nach seinem To verstärkte sich diese Sicht
durch die Verfolgungswelle gegen die Donatisten. Die Donatisten hielten sich eindeutig für den
„heiligen Rest“. Diese Sicht bestimmte ihre Bibelkommentare und bruchlos ihre sakramentale
Praxis. Das zentrale Element ihrer Theologie war der hohe Stellenwert des Martyriums. Die logi-
sche Folge dieser Ekklesiologie ist eine sehr strenge Kirchendisziplin und die praktische Durch-
führung einer klar festgelegten Grenze der Kirche. Die Bischöfe, die „traditores“ waren, haben
einen Makel, der sich wie eine ansteckende Krankheit in der Kirche verbreitet. Durch ihre Wei-
hen stecken sie viele Inhaber der Bischofssitze an. In der ganzen Kirche blieb nur das Weizen-
korn der „Heiligen“ übrig. Dieser heilige Rest ist dazu berufen, die ganze Kirche wieder zu heili-
gen. Die Hauptmittel dieser Heiligung sind die Wiedertaufe sowie die Wiederweihe, die strenge
Einhaltung der echten kirchlichen Traditionen. Die Theologen dieser „Schule“ bemühten sich bei
der Abfassung ihrer Schriften um eine an der klassischen Kultur geschulte Beredsamkeit und
waren durchdrungen von der Kraft des biblischen Wortes.
320 Donatismus, in: LThK III 332f. 321 Rahner, Die Bußlehre 389.
198
Die historischen und theologischen Kontexte der Region Ost(Mittel)Europas machen eine eher
abweisende Haltung gegenüber kirchlichen Schuldbekenntnissen leicht verständlich. Die Kirche
wurde mehr oder weniger stark verfolgt, sie hat Wunden erlitten, die noch bei weitem nicht ge-
heilt sind. Diese Erfahrungen legen nahe, das theologische Argument „die Kirche ist heilig“ ein-
seitig so auszulegen, dass die Kirche keiner Vergebung bedürfe. Neben diesem Argument ist aber
einen weiteres Argument in Betracht zu ziehen: die Kirche besteht aus sündigen Gliedern. Beide
Argumente müssen gleichzeitig die Praxis der Kirche bestimmen.
199
ZUR THEOLOGIE DER LAIEN
LAIEN NACH DEM KONZIL
Eine richtig epochenbrechende Wende ist die neuartige Betrachtung der Laien auf dem Zweiten
Vatikanischen Konzil. Die neue Sicht der Laie wurde im vierten Kapitel der Dogmatischen Kon-
stitution über die Kirche (Lumen Gentium) grundgelegt und dann in einem zusätzlichen Dekret
über das Laienapostolat (Apostolicam actuositatem) weiter entfaltet. Entsprechend dieser neuen
Sicht wurde das neue Kirchenrecht (Codex Iuris Canonici 1983) überarbeitet, wo die neuartige
Behandlung der Laien sicher zu den wichtigsten Neuheiten gehört. Die „Probleme“, die bezüg-
lich der Praxis – nicht der theologischen Neuauffassung – der Laien nach dem Konzil auftauch-
ten, wurden an der Synode über die Laien (1.-30. Okt. 1987 über die „Berufung und Sendung der
Laien in Kirche und Welt zwanzig Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil“) behandelt
und später (30. Dez. 1988) im wichtigen Nachsynodalen Apostolischen Mahnschreiben des Pap-
stes II. Johannes Paul „Christifideles laici“ (CL) betrachtet.
Da dieses Dokument besonders klar die Tragweite der Theologie und der Praxis der Laien in der
heutigen Kirche erörtert, liegt es auf der Hand, diesem Dokument entlang die theologische Sicht
der Laie auf Grund der Erfahrungen Ost(Mittel)Europas darzustellen.
„Die Herausforderung, der sich die Synodenväter stellten, bestand im Grunde darin, konkrete
Wege zu finden, damit die vielversprechende »Theorie« über die Laien, die das Konzil zum Aus-
druck gebracht hat, zur echten kirchlichen Praxis wird.“ (CL 2)
In Lauf der Kirchengeschichte wurden Neuerungen zunächst stets von einer neuartigen Praxis
vorbereitet und erst dann offiziell anerkannt. Das Leben bricht sich Bahnen, aber die offizielle
Sichtweise wird teilweise auch als Hindernis empfunden. So kommt es zu neuen Klarstellungen
an amtlicher Ebene. Bezüglich der Laienfrage ist „Christifideles laici“ als eine Klarstellung zu
verstehen. Konzilsdokumente, vor allem Konstitutionen gehören zu den kirchlichen Dokumenten
höchsten Ranges, daher haben die darauffolgenden Stellungnahmen erklärenden und ergänzen-
den Charakter und sind keineswegs Richtigstellungen.322 Wenn wir uns jetzt näher mit „Christifi-
deles laici“ beschäftigen, werden wir es als eine (Zwischen-)Station des wandernden Gottesvol-
kes betrachten.
Durch einige Zitate lässt sich das Anliegen dieses Dokumentes klar markieren.
322 Vgl. Hilberath, Theologie des Laien 219-220.
200
„Der Blick auf die nachkonziliare Zeit schenkte den Synodenvätern die Überzeugung, dass der
Geist die Kirche weiterhin erneuert, indem er in zahlreichen Laien neue Impulse der Heiligkeit
und der Teilnahme weckt. Zeugnis davon gibt unter anderem der neue Stil der Zusammenarbeit
zwischen Priestern, Ordensleuten und Laien; die Mitwirkung in der Liturgie, in der Verkündi-
gung des Wortes Gottes und in der Katechese; die vielen Dienste, die Laien anvertraut und von
diesen übernommen werden; das vielfältige Entstehen von Gruppen, Vereinigungen und geistli-
chen Gemeinschaften, sowie von gemeinsamen Initiativen der Laien; die umfassendere und be-
deutsamere Teilnahme der Frauen am Leben der Kirche und an den Entwicklungen in der Ge-
sellschaft.
Die Synode hat aber auch gezeigt, dass der Weg, den die Laien nach dem Konzil begangen ha-
ben, nicht ganz frei von Gefahren und Schwierigkeiten war. Wir denken vor allem an zwei Versu-
chungen, denen sie nicht immer widerstanden haben: Die Versuchung, ihr Interesse so stark auf
die kirchlichen Dienste und Aufgaben zu konzentrieren, dass sie sich praktisch oft von ihrer Ver-
antwortung im Beruf, in der Gesellschaft, in der Welt der Wirtschaft, der Kultur und der Politik
dispensieren; und die Versuchung, die zu Unrecht bestehende Kluft zwischen Glauben und Le-
ben, zwischen der grundsätzlichen Annahme des Evangeliums und dem konkreten Tun in ver-
schiedenen säkularen und weltlichen Bereichen zu rechtfertigen. Die Synode hat in ihrer Arbeit
immer wieder auf das II. Vatikanische Konzil zurückgegriffen, dessen Lehre über die Laien aus
einem Abstand von zwanzig Jahren eine erstaunliche Aktualität, ja eine fast prophetische Bedeu-
tung aufweist. Sie kann die Antworten, die heute auf die neuen Probleme gegeben werden müs-
sen, erhellen und für diese richtungweisend sein.“
Einige Probleme treten durch eine bestimmte ‚Neuartigkeit’ hervor, so dass sie zumindest im
chronologischen Sinn als nachkonzilar bezeichnet werden können. Ihnen widmeten die Synoden-
väter im Lauf ihrer Besprechungen und Überlegungen besondere Aufmerksamkeit. Von diesen
sollen vor allem die kirchlichen Dienste und Aufgaben, die Laien anvertraut sind oder anvertraut
werden sollen, hier genannt sein, das Wachstum und die Verbreitung von neuen »Bewegungen«
neben anderen Formen der Zusammenschlüsse der Laien sowie die Stellung und Aufgabe der
Frau in Kirche und Gesellschaft. (CL 2)
Gesellschaftsanalyse
Die Synodenväter haben ihren theologischen und spirituellen Ausführungen eine Gesellschafts-
analyse vorgeschickt. Sie beobachteten, dass die heute Welt voll ist von Spannungen und Wider-
sprüchen. Parallel zur Überbewertung der Diesseitigkeit gibt es eine Sehnsucht nach der Jenseits.
Parallel zur vielfältigen Versklavung der Menschen wird die Unantastbarkeit der menschlichen
Person, die Freiheit für die Gewissensentscheidungen bejaht. „Es gibt verhängnisvolle Gegensät-
201
ze zwischen Menschen, Gruppen, Kategorien, Nationen und Nationenblöcken andererseits „die
Seligpreisung des Evangeliums: ‚Selig, die Frieden stiften’ (Mt 5, 9) findet unter den heutigen
Menschen eine neue und bedeutungsträchtige Resonanz: Ganze Völker leben, leiden und arbeiten
heute für Frieden und Gerechtigkeit.“323
Die ganze Kirche ist von dieser komplexen und spannungsreichen Situation herausgefordert, und
darin haben die Laien eine besondere Berufung und Sendung: „Durch sie wird die Kirche Christi
in den verschiedensten Bereichen der Welt als Zeichen und Quelle der Hoffnung und der Liebe
präsent.“324
Würde der Laien
Das nachsynodale Schreiben gründet ganz in der Auffassung des Konzils über die Würde der
Laien, die in aus der Taufe kommt. Das bedeutet, dass diese Würde nicht von der Kirchenleitung
abhängt, sondern sie ist ein Wert, der in Gott wurzelt. Dies ist die tiefste Fundierung der Identität
der Laien. Durch die Taufe nehmen alle Kirchenmitglieder an der Communio der Kirche teil und
können ihre Berufung je nach ihren Charismen entfalten. Durch die Taufe wird man Kind Gottes,
Tempel des Geistes und ein Leib in Christus. Die Taufe ermöglicht und eröffnet einem die Teil-
habe am priesterlichen, prophetischen und königlichen Amt Jesu Christi.
Die Taufe ist in diesem Dokument sehr spirituell aufgefasst, ganz im Gegensatz zu einer juristi-
schen Sichtweise, die daraus vor allem eine rechtliche Mitgliedschaft ableitet. Die Identität der
Laien hat also eine sakramentale und eine spirituelle Dimension.
Aus dieser Dimension heraus gibt das Dokument ein „Definition“ des Laienseins, die Kirchen-
konstitution des Konzils zitierend:
„Unter der Bezeichnung Laien - so beschreibt sie die Konstitution Lumen Gentium - sind hier
alle Christgläubigen verstanden, mit Ausnahme der Glieder des Weihestandes und des in der
Kirche anerkannten Ordensstandes, das heißt, die Christgläubigen, die durch die Taufe Christus
einverleibt, zum Volk Gottes gemacht und des priesterlichen, prophetischen und königlichen
Amtes Christi auf ihre Weise teilhaftig, zu ihrem Teil die Sendung des ganzen christlichen Volkes
in der Kirche und in der Welt ausüben“.325
In einer säkularen Kultur, die sich nach Spiritualität sehnt, in einer Kultur, wo die Solidarität oft
den verschiedenen Egoismen geopfert wird, werden die Laien mächtige Herolde des Glaubens an
323 CL 6. 324 CL 7. 325 CL 9.
202
die zu erhoffenden Dinge (vgl. Hebr 11,1), wenn sie mit einem Leben aus dem Glauben das Be-
kenntnis des Glaubens ohne Zögern verbinden.326
Charakteristisch ist für dieses Dokument (und auch für mache andere Dokumente des Papstes
Johannes Paul II.) ist diese besonders spirituelle Sicht der Wirklichkeit. Diese bestimmende Sicht
verpflichtet zu einer tief religiöser Hermeneutik des Textes. Obwohl in „Christifideles laici“ die
Berufung und die Sendung der Laien in Gesellschaft und Kirche behandelt wird und das Doku-
ment auch als eine Programmschrift der Laienmitarbeit gelesen werden kann, versteht kann man
das Dokument nur dann, wenn man die grundlegend spirituelle Einstellung des Papstes wahr-
nimmt.
„Der Weltcharakter der Laien kann darum nicht nur im soziologischen, sondern muss auch im
theologischen Sinn betrachtet werden.“327
Diese spirituelle Sichtweise ist in den Ländern Ost(Mittel)Europas mehr willkommen als in We-
sten. Viele Optionen über die Zukunftsperspektive des Christentums oder der Kirche betonen,
dass die Zukunft von der spirituell-mystischen Renaissance abhängt. Rahner hat am Ende seines
Lebens wiederholt formuliert: Der Christ der Zukunft wird mystisch sein oder er wird nicht sein.
Das gilt analog auch für die ganze Kirche.
„So stellen das In-der-Welt-Sein und In-der-Welt-Handeln für die Laien nicht nur eine anthropo-
logische und soziologische Gegebenheit dar, sondern auch und vor allem eine spezifisch theolo-
gische und kirchliche. In der Welt offenbart Gott ihnen seinen Willen und ihre besondere Beru-
fung, »in der Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge das Reich Gottes zu
suchen«.
„Der Ort der Laien in der Kirche muss grundsätzlich von dieser Neuheit des Christlichen her
definiert und durch den Weltcharakter der Laien charakterisiert werden.“328
Diese Mystik ist aber nicht weltfremd oder gar weltverneinend. Sie entspringt aus einer persönli-
chen Liebe zu Gott und gleichzeitig aus einer klaren und offenen Wirklichkeitsanalyse. Diese
beiden Seiten schließen einander nicht aus, ganz im Gegenteil, sie bedingen einander gegenseitig.
Die Laien entdecken und entfalten ihre Spiritualität in der Welt, wo sie zur Heiligkeit aufgerufen
sind. Es ist eine Aktivität, eine Praxis der Mystik, die jede fatalistische Untätigkeit ausschließt.
„Die Einheit des Lebens der Laien ist von entscheidender Bedeutung: Sie müssen sich in ihrem
alltäglichen beruflichen und gesellschaftlichen Leben heiligen. Um ihre Berufung zu erfüllen,
müssen die Laien ihr Tun im Alltag als Möglichkeit der Vereinigung mit Gott und der Erfüllung
326 LG 35. 327 CL 15. 328 CL 15.
203
seines Willens sowie als Dienst an den anderen Menschen betrachten, um sie in Christus zur
Gemeinschaft mit Gott zu führen.“329
Die mystische Sicht kann aber auch überbetont werden, wodurch implizit ein weltfremdes Laien-
bild entsteht. Das Sekretariat für Laienfragen im Vatikan hat 1999 ein Konferenz über die Fir-
mung organisiert. Bischof Albert-Marie de Monléon OP hat in seinem Vortrag die Auswirkungen
des Heiligen Geistes auf das Leben der Laien plakativ zusammengefasst: „Er führt ein betendes
Leben, steht mit Christus in Gemeinschaft, versteht die Heilige Schrift, liebt die Kirche und ist
kreativ in der Verwirklichung der Evangelien“. Das sind Charakteristiken, die eher auf Mystik
und Kirche zentriert sind.330
Dienstbereiche
Nach dem radikal neuen Ort der Laien in der kirchlichen Lehre werden in Christifideles laici
auch die wichtigsten Bereiche des pastoralen Dienstes noch ausführlicher als im Konzil darge-
stellt, in denen Laien eingesetzt werden können. Diese Bereiche der Pastoral sind ursprünglich an
die Priester, an ihr Hirtenamt, aber nicht an den Ordo, an die Weihe gebunden. Die Umstände in
der Kirche erfordern aber, dass diese priesterlichen Aufgaben von Laien wahrgenommen und
ausgeübt werden. Das ist eine Einladung der Laien in den Dienstbereich der Priesters. Wie weit
dies praktisch geht, wird auch weiterhin vom Priester oder vom Bischof bestimmt.
„Wenn es zum Wohl der Kirche nützlich oder notwendig ist, können die Hirten entsprechend den
Normen des Universalrechts den Laien bestimmte Aufgaben anvertrauen, die zwar mit ihrem
eigenen Hirtenamt verbunden sind, aber den Charakter des Ordo nicht voraussetzen. Der Codex
schreibt: »Wo es ein Bedarf der Kirche nahe legt, weil für diese Dienste Beauftragte nicht zur
Verfügung stehen, können auch Laien, selbst wenn sie nicht Lektoren oder Akolythen sind, nach
Maßgabe der Rechtsvorschriften bestimmte Aufgaben erfüllen, nämlich den Dienst am Wort, die
Leitung liturgischer Gebete, die Spendung der Taufe und die Austeilung der heiligen Kommuni-
on«.“331
Ein weiteres Feld bilden die Aufgabenbereiche organisatorischer Art, die früher eindeutig an die
Leitungsgewalt der Kleriker gebunden waren, heuten aber auch von Laien übernommen werden
können.
„Es ist darum selbstverständlich, dass die Aufgaben, die nicht spezifisch den geweihten Amtsträ-
gern zukommen, von den Laien übernommen werden“.332
329 CL 17. 330 Vgl. Pontificium 2000, 11. 331 CL 23. 332 CL 23.
204
Die „Selbstverständlichkeit“ dieser Zuständigkeit ist eine theologische, aber wie viele Laien in
einigen Ortskirchen erfahren (müssen), keine praktische Selbstverständlichkeit. Das Dokument
fährt fort mit einer gestuften Liste, angefangen von der Eben der Weltkirche bis zur Ebene der
Pfarrei. Allgemein ist dabei wichtig, dass auch diese Teilnahme an der Leitung auf Einladung
durch die Priester geschieht und die Entscheidung und Kontrolle in den Händen der geweihten
Amtsträger bleibt. Die auch kirchenrechtlich gesehen neue Form der Partizipation der Laien am
kirchlichen Leben sind die verschiedenen Räte, in denen die Laien mit ihrer weltlichen Sach-
kenntnis bei der Vorbereitung von priesterlichen Entscheidungen teilnehmen können: der Diöze-
sanrat, der Pastoralrat in der Pfarre usw.
„Die letzte Synode hat in diesem Sinn die Bitte um die Förderung der Errichtung von Diözesan-
pastoralräten gestellt, die man den Verhältnissen und Bedürfnissen entsprechend einschalten
soll. Auf Diözesanebene sei diese die wichtigste Form der Mitarbeit und des Dialogs sowie der
gemeinsamen Urteilsbildung. Die Mitwirkung der Laien in diesen Räten kann die Möglichkeiten
der Konsultation erweitern, so wie das Prinzip der Mitwirkung - die in einzelnen Fällen auch
Mitentscheidung ist - auf breiterer Basis und intensiver zur Anwendung kommen lassen.“333
Die Liste schließt mit dem Spezialfall der geteilten Leitung einer kirchlichen Gemeinde. Das
bedeutet wiederum eine Öffnung gegenüber früherem Denken. Hier wird vorsichtig aber unmiss-
verständlich die Möglichkeit dazu eröffnet, dass in bestimmten Fällen Laien die Leitung von
Pfarreien übertragen bekommen. Der Text bedient sich hier wiederum Ausdrücken, die oft wenig
mit der heutigen Realität der Pfarrstruktur in Einklang sind: „lebendige Gemeinde“ und „Flexibi-
lität“:
„Damit alle diese Pfarreien lebendige, christliche Gemeinden werden, müssen die jeweiligen
örtlichen Autoritäten dafür Sorge tragen, dass: a) die Pfarrstrukturen den Situationen mit der
großen Flexibilität, die das Kirchenrecht vor allem durch die Förderung der Teilhabe der Laien
an der pastoralen Verantwortung gewährt, angepasst werden; b) die kleinen Basisgemeinschaf-
ten, auch lebendige Gemeinden genannt, in denen die Gläubigen einander das Wort Gottes ver-
kündigen und im Dienst und in der Liebe tätig werden können, wachsen.“334
Es wird anhand dieser Tätigkeitsbereiche nicht weniger ausgesagt, als dass die Laien innerhalb
des priesterlichen, königlichen und prophetischen Dienstes der Kirche Dienste und Verantwor-
tungen übernehmen können, und zwar auf Einladung und unter Leitung der hierarchischen
Dienstträger. Dass also Laien in dieser Ekklesiologie und Pastoralplanung nicht nur als Betreute,
sondern auch als Betreuer, nicht nur „Objekte“ der Pastoral, sondern auch ihre „Subjekte“ sein
können und auch sein sollen.
333 CL 25. 334 CL 26.
205
DISKUSSIONSPUNKTE
Kirche und/oder Welt
„Den Laien ist der Weltcharakter ganz besonders zu eigen. Denn die Glieder des heiligen Stan-
des sind, obwohl sie bisweilen mit weltlichen Dingen zu tun haben können, sogar in Ausübung
eines weltlichen Berufes, vor allem aufgrund ihrer besonderen Berufung und ihrer Entscheidung
wegen dem heiligen Dienst zugeordnet, während die Ordensleute durch ihren Stand ein hervor-
stechendes und herausragendes Zeugnis dafür geben, dass die Welt ohne den Geist der Seligprei-
sungen nicht verwandelt und Gott dargebracht werden kann.“335
In dem Konzilsdokument über die Kirche wird ausdrücklich betont, dass in der Verwirklichung
der Sendung der Kirche das ganze Communio beansprucht ist, wobei Kleriker, Laien und Or-
densleute in je verschiedener Art und Weise ihren Dienst ausüben. Bei der Aufteilung der Tätig-
keitsbereiche und auch der wesentlichen Kompetenzen stößt man auf eine Zweiteilung der Wirk-
lichkeit: auf den profanen und auf den heiligen Bereich. Diese grundlegend religiöse Einstellung
spiegelt sich in allen Lehrdokumenten bezüglich der Laien wie Christifideles Laici und noch
mehr der späteren „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der
Priester“ wider. Die Laien gehören eher zum Bereich „Welt“ und die Kleriker eher zum Bereich
„Heil“. Die Aufteilung ist nicht nur praktischer Art, also lediglich eine einfache Aufgabenauftei-
lung. Sie ist theologisch gesehen fundamental und daher auch ein großes theologisches Problem,
worüber sich viele Theologen der ganzen Theologiegeschichte verschiedentlich geäußert haben.
Hier wäre es fehl am Platz, diese Geschichte auch nur in groben Zügen zu skizzieren. Es sei aber
vermerkt, dass in dieser Entwicklung die biblisch orientierte, aber anders zu versehende Gegen-
überstellung von Kirche (Jünger Jesu) und „Welt“ (als der johanneisch bösen Welt) langsam in
die Kirche selbst hineingetragen wurde; ihr Ergebnis ist u.a. die Entzweiung von Klerikern und
Laien hinsichtlich ihr Relation zur Welt ist.
Obwohl es auch theologisch, aber vor allem kirchenrechtlich entscheidend ist, die Aufgaben des
kirchlichen Auftrages aufzuteilen – diese Aufteilung gehört zu den wesentlichen Elementen einer
(auch heiligen) Großorganisation – , so ist doch darauf aufmerksam zu machen, dass die Grund-
ausrichtung der ganzen Kirche religiös und weltlich zugleich ist. Auch eine tiefgehende Speziali-
sierung in den Aufgaben befreit die Priester nicht davon, in der Welt zu sein und auch die Laien
nicht davon, in den Kirchenstrukturen verantwortlich zu wirken. Sonst würde sich das kirchliche
Denken eines theologisch unhaltbaren Kirchenbegriffs bedienen, was unlösbare Schwierigkeiten
335 LG 31.
206
in der Auffassung über die Kleriker und über die Laien mit sich brächte.336 Diese Gefahr des
doppelten Kirchenbegriffes wird nicht genügend wahrgenommen und rezipiert.
Instruktion
Christifideles laici wurde 1988 verfasst, beinahe zehn Jahre danach (1997) brachte die Glaubens-
kongregation ihre viel diskutierte „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am
Dienst der Priester“ heraus.
„Das Ziel dieses Dokuments besteht einfach darin, eine klare und verbindliche Antwort zu geben
auf drängende und zahlreich bei unseren Dikasterien eingelangte Anfragen von Bischöfen, Prie-
stern und Laien, die gebeten haben, hinsichtlich neuer Formen ‘pastoraler’ Tätigkeiten von Lai-
en im Bereich der Pfarreien und Diözesen aufgeklärt zu werden.“337
Dieser Satz zeigt, dass nach dem Konzil, auf dem die Laien eine sehr eingehende Förderung be-
kommen haben und auch noch nach Christifideles laici, welche den Unterschied der Tätigkeits-
felder der Priester und der Laien wiederholt unterstrichen haben, die Glaubenskongregation es
erneut für nötig hielt, im pastoralen Bereich die alleinige Zuständigkeit der Priester zu schützen
und die Laien auf ihre ureigenen weltlichen Bereiche zu verweisen. Es wäre vielleicht nicht ganz
falsch zu sagen, dass diese Instruktion eher ein Priesterinstruktion denn ein Laieninstruktion ist.
„Damit sich diese Zusammenarbeit harmonisch in den pastoralen Dienst einfügt, ist es zur Ver-
meidung pastoraler Abweichungen und disziplinärer Missbräuche notwendig, dass die lehrmäßi-
gen Prinzipien klar sind und die geltenden Vorschriften mit Entschiedenheit in der ganzen Kirche
sorgfältig und loyal angewandt werden, ohne den Begriff der Ausnahme missbräuchlich auf sol-
che Fälle auszudehnen, die nicht als ‘Ausnahme’ betrachtet werden können.“338
„Die Verschiedenheit betrifft die ‚Art’ der Teilhabe am Priestertum Christi und berührt das We-
sen in diesem Sinn: ‚Während das gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich in der Entfaltung
der Taufgnade, im Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, im Leben gemäß dem Hei-
ligen Geist vollzieht, steht das Amtspriestertum im Dienst dieses gemeinsamen Priestertums. Es
bezieht sich auf die Entfaltung der Taufgnade aller Christen’. (KKK 1547) Demzufolge ist das
Amtspriestertum ‚vom gemeinsamen Priestertum dem Wesen nach verschieden, denn es verleiht
eine heilige Vollmacht zum Dienst an den Gläubigen’. (KKK 1592) Deswegen ist der Priester
gerufen zu ‚wachsen im Bewusstsein der tiefen Gemeinschaft, die ihn an das Gottesvolk bindet’,
um ‚die Mitverantwortung für die eine gemeinsame Heilssendung anzuregen und zu entfalten, mit
336 Vgl. Pottmeyer, Kirche. 337 Instruktion, Vorwort. 338 Instruktion, 4.
207
lebhafter und herzlicher Anerkennung aller Charismen und Aufgaben, die der Geist den Gläubi-
gen für die Auferbauung der Kirche schenkt’. (Pastores dabo vobis 74.)“339
Die Diskussionen über dieses Instruktion fanden im westlichen Teil Europas statt. Es hat einen
tieferen Grund, dass im anderen Teil Europas die Kirchen eher diskussionsschwach sind. In der
Zeit der Verfolgung durften sie ihre feste Einheit nicht mit innenkirchlicher Meinungsvielfalt und
Diskussionen schwächen. Aber noch ein konkreterer Grund ist es, dass die Indienstnahme von
Laien für presbyteriale Aufgaben in diesen Kirchen noch nicht so weit entwickelt ist. Angeblich
haben z. B. die ungarischen Bischöfe auf diese Instruktion geantwortet, dass dieses Problem in
Ungarn nicht bekannt sei.
Trotz theoretischer und begrifflicher Klarheit bei der Abgrenzung der Kompetenz- und Tätig-
keitsbereiche von Priestern und Laien, zeigt die Praxis der Ortskirchen und die sie eingehend
reflektierende Theologie die Schwierigkeiten mit deren scharfer Trennung. Obwohl viele meinen,
dass die Instruktion ein deutlicher Rückschritt zum Konzil darstellt, ist es andererseits auch wahr,
dass solche Instruktionen doch immer auch „nur“ Antworten auf das sich reich entwickeltes Kir-
chenleben vor Ort sind.
Zwei-Stände-Kirche
Jürgen Werbick macht in seiner Ekklesiologie aufmerksam, dass der Begriff „laos“ in der bibli-
schen Sprache „ursprünglich gerade nicht die Differenz zwischen Amtsträger und Nichtamtsträ-
ger in der Gemeinde, sondern die zwischen Glaubenden und Nichtglaubenden bezeichnete.
Schon bei Clemens von Alexandrien änderte sich diese Situation und wurde in der Zeit der Ge-
genreformation noch verstärkt. Die Reformation hat nämlich das Gefälle vom Kleriker zum Lai-
en bestritten und auch aufgehoben. In der Zeit nach der Reformation bis zum Zweiten Vatikani-
schen Konzil herrschte die Sicht der Römischen Katechismus, nach dem nur die priesterliche
(bischöfliche und päpstliche) Vollmacht die Einheit der Kirche sichern kann. Das Zweite Vatika-
nische Konzil nahm solche Übersteigerungen bewusst zurück, und sah die Aufgabe des kirchli-
chen Amtes im Dienst an der Einheit des Volkes Gottes mit seinem Herrn.340
Er rundet seinen theologiegeschichtlichen Überblick mit einer nicht nur theologischen Behaup-
tung ab: Ob das Amt der Amtsträger „als eine Herrschafts- oder als eine Dienstwirklichkeit zu
verstehen ist, das entscheidet sich nicht an der theologischen Deutung des Dienstamtes, sondern
an seiner Ausübung, letztlich also daran, von welchen Kriterien sich die Amtsführung faktisch
leiten und von welcher Perspektive sie sich bestimmen lässt“.341 Das alte Kirchenbild war hierar-
339 A. a. O. 340 Werbick, Kirche 135ff. 341 A. a. O., 140.
208
chiefixiert. Benannt sein soll damit die tiefe bewusstseinspaltende Zäsur zwischen Klerikern und
Nicht-Klerikern („Laien“) innerhalb der Kirche. Diese Zäsur ging bisweilen so weit, dass man
von zwei Völkern in der Kirche sprach.
PROBLEMFELDER IN OST(MITTEL)EUROPA
In den letzten zehn Jahren hat sich das Zahlenverhältnis zwischen Priestern und Laien in Ost-
(Mittel)Europa stark verändert. In der Zeit bis zur Wende gab es (ausgenommen in der ehemali-
gen DDR) nur sehr wenige Laienmitarbeiter in der Pfarre oder anderswo. Nach der Wende ent-
wickelte sich die Zahl der angestellten Laien exponentiell. In Ungarn z.B. wurde die Gruppe der
ReligionspädagogInnen die zahlenmäßig Gruppe der Hauptamtlichen in Kirche. Heute arbeiten
im religionspädagogischen Bereich viel mehr Laien als es Priester in Ungarn gibt. Das hat Kon-
sequenzen und fordert auch theologische Reflexionen. Richárd Korzenszky OSB, der einige Jah-
re hindurch der Schulreferent bei der Ungarischen Bischofskonferenz war, schrieb in seinem
Bericht als eine subjektive Bemerkung im Jahr 1993 an die Bischofskonferenz: „Ich sehe in die-
ser Art der Erscheinung der Laien in verantwortlichen kirchlichen Arbeitstätigkeiten für die ka-
tholische Kirche Ungarns eine ernsthafte Herausforderung. Es ist eine großartige Chance Mitar-
beiter zu gewinnen, aber es besteht auch die Gefahr, dass eine eventuell bildungsmäßig schlecht
vorbereitete Gruppe ernsthafte innere Spannungen verursachen wird. Dieses Problem muss be-
wusst behandelt werden.“ Für eine strukturelle Änderung bezüglich des Laienstatus ist eine struk-
turelle Änderung in der Auffassung über die Kirche eine unbedingte Bedingung. Ohne ein neues
oder präzisiertes Kirchenbild ist keine Präzisierung der Rolle der Laien in der Kirche möglich.
Kirchenbild(er)
Für die theologische Stabilisierung eines konzilsgemäßen Laienbildes in Ost(Mittel)Europa sind
mehrere Aspekte zu bedenken. Erstens müssen die Aussagen des Konzils über die Würde und
Dienstfelder der Laien in Gesellschaft und Kirche immer wieder in Erinnerung gerufen werden,
da in diesen Ländern diese Inhalte und Schwerpunktsetzungen des Konzils keineswegs zum All-
gemeingut des katholischen Denkens gehören. Es muss auch zweitens gesehen werden, dass die
Kirche in diesen Ländern nach 40 Jahren Kommunismus in einer völlig desolaten Lage ist. Die
nach der politischen Wende vergangenen zehn Jahre waren für wichtige Schritte der Erneuerung
des kirchlichen Lebens teilweise genügend, aber bei weitem nicht für eine kontextgerechte Pasto-
ralplanung und für die Sicherung einer (auch) dazu notwendigen theologischen Arbeit.
Eine spezielle Aufgabe der Theologie und der Theologen in diesen Ländern wäre das Erreichen
einer theologischen Originalität in der Behandlung dieser und anderer Fragen. Es ist zwar unbe-
dingt nötig, die theologischen Entwicklungen in den westlichen Ländern hinsichtlich der Laien-
209
frage wahrzunehmen. Aber eine Theologie in dieser Region darf dabei nicht stehen bleiben. Es
bedarf einer tiefgehenden theoretischen und kritischen Reflexion, ob die Denkmodelle in der
„westlichen“ Theologie auch für die Analyse in „Osten“ geeignet sind. Wenn z. B. im westlichen
Teil Europas und auch in Nordamerika „die“ Laien zu einem großen Teil kirchliche Angestellte
sind, so sind sie in unserem Teil Europas nur im geringen Maß kirchliche Arbeitnehmer. Sie sind
zumeist engagierte Katholiken einer Kirche, die eine Entklerikalisierung weder theoretisch noch
praktisch durchgemacht hat. So stehen diese Laien als Personen einem klerikalen Kirchensystems
frontal gegenüber und werden von dieser strukturellen Grundsituation her eher als unbefugte
Partisanen der Pastoral angesehen und behandelt.
Das Bild der Laien wird von dem Bild der Kirche bestimmt. Das Kirchenbild der Theologie ist
nie ganz unabhängig von den gesellschaftlichen Modellen, von den Denksystemen, innerhalb
derer es gemalt wird. In Gesellschaften, die seit längerer Zeit in einer Demokratie leben, wird
auch das Denken über die Kirche demokratische Elemente aufzeigen. In einer anspruchsvolleren
Theologie werden die Merkmale der demokratischen Gesellschaft und des Sozialstaates kritisch
rezipiert. Diese Kritik soll in beide Richtungen gerichtet werden. Die gesellschaftlichen Vorgän-
ge sollen im Lichte der Evangelien erwogen werden, sie sollen aber auch als Herausforderungen
daraufhin geprüft werden, ob durch sie für die Kirche ein tieferes Verständnis von Glaubens-
wahrheiten ermöglicht wird.
Eine solche theologische Reflexion geschieht immer inmitten der konkreten gesellschaftlichen
und kirchlichen Praxis. Sie hat zwar theoretische Ansprüche, sie muss aber gleichzeitig praxisre-
levant zu sein. Somit stiftet eine solche theologische Reflexion auch eine vorhersehbare Unruhe
in Gesellschaft und Kirche. Sie hinterfragt die Traditionen, die Zusammenhänge und die aktuel-
len Vorgänge. Sie durchkreuzt übliche Deutungen, stellt auch dort Fragen, wo es bislang Selbst-
verständlichkeiten gibt. Ihr Ziel ist es nicht, subversiv zu werden. Wenn sie aber nicht zeit- und
raumlos ist, wird sie bis zu einem bestimmten Grad unausweichlich subversiv.
Das in Ost(Mittel)Europa vorherrschende Kirchenbild beruht auf Modellen, die vor allem im 19.
Jahrhundert entwickelt wurden. Der gemeinsame Nenner dieser Kirchenbilder ist die Neigung
nach Absonderung, nach Selbstverteidigung in einem religions- und kirchenunfreundlichem oder
sogar ihnen gegenüber feindlich gesinnten gesellschaftlichen Milieu. Diese Kirchenmodelle sind
auch in den Reformländern nicht exklusiv. Doch auf Grund vieler geschichtlicher und aktueller
Erfahrungen haben sie einen größeren Einfluss als in den Ländern mit einer eingeübten Demo-
kratie und ihrem Pluralismus. Vermutlich wird deshalb in westlichen Kirchengebieten das konzi-
liare Kirchenbild von der Mehrheit der Katholiken eher geteilt als das vorkonziliare. In Ost-
(Mittel)Europa scheint dies gerade umgekehrt zu sein, vor allem wenn man die Kirchenleitungen
beobachtet.
210
Vollkommene Gesellschaft
Es wurde bereits weiter oben über dieses wichtige Bild der Kirche einiges ausgeführt. Hier sollen
die dort gesagten noch mal in Erinnerung gerufen und weiter präzisiert werden. Societas perfecta
ist ein Begriff über die Kirche. Er sollte im 19. Jahrhundert, als die geistig-pneumatische Seite
der Kirche überbetont wurde, ein strukturelles Gegengewicht bilden. Die Grundgedanken der
katholischen Ekklesiologie konzentrieren sich demnach auf eine göttliche Stiftung durch den
historischen Jesus, sowie auf den Begriff „Corpus Christi mysticum“. Das gilt aber nicht nur von
der Gemeinde der Gläubigen, sondern von der „societas perfecta“ „mit allen rechtlichen und
gesellschaftlichen Bestandteilen“.342 Die Hervorhebung dieses strukturell-rechtlichen Aspekts der
Kirchenauffassung war auch gegenüber dem Staat wichtig, der in allen Lebensbereichen einen
Absolutheitsanspruch der Gesellschaft erhob bzw. der immer mehr Gesellschaftsbereiche säkula-
risierte. Die Kirche stellte sich in dieser Kompetenzkampf als starker Konfliktpartner dar. In
Wirklichkeit wurde sie aber auf diesem Weg zu einem modernen gesellschaftlichen Subsystem
umgeformt. Der Begriff „societas perfecta“ ist also nicht moralisch gemeint, er soll lediglich die
totale Unabhängigkeit der Kirche dem Staat gegenüber sicherstellen.343
Die Auffassung über die Kirche als „societas perfecta“ rührt also aus einer gesellschaftlichen
Epoche, wo die Kirche radikal ihre ursprüngliche gesellschaftliche (Macht)stellung stufenweise
verlor und versuchte dabei Stärken als Selbstverteidigung aufzuzeigen. Dieses politisch gestimm-
te ekklesial-apologetische Modell wird in den Kirchen der Reformländern auch durch eine spezi-
elle Schicksalserfahrung und eine sie begleitende Situationswahrnehmung begünstigt. Diese Ge-
sellschaften lernen im Grunde genommen erst seit einem Jahrzehnt die moderne Demokratie
kennen, die selbst in mancher Hinsicht in statu nascendi ist. Nach der Epoche der starken Ein-
grenzung des institutionellen Kircheseins muss diese Kirche Stärke zeigen, damit sie in der jun-
gen demokratischen Gesellschaft zu einer ernst zu nehmenden Institution wird. Sie drängt in das
Gesellschaftsfeld aus einem Abseits herein, im Gegensatz zum 19. Jahrhundert, als sie ihre Stelle
in der Mitte der Gesellschaft verlor. Die Stärke bilden ihre ausgebauten Organisationen sowie
stabile Regelungen der Kirchenfinanzierung sein. Dieses Interesse kann von der besonderen ge-
sellschaftlichen Situation der Kirche in Ost(Mittel)Europa her durchaus verstanden werden. The-
oretisch legitimiert wird es im katholischen Denken mit dem theologischen Erbgut von der „so-
cietas perfecta“. Die Situation der neuen Positionierung der Kirche unter den neuen demokrati-
schen Verhältnissen braucht aber nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Legi-
timation, die in dieser modernen Gesellschaft verstanden und auch akzeptiert werden kann. Die-
sem Bedürfnis dient der Begriff von der „Volkskirche“.
342 AAS 35, 1943, 224. – Vgl. RGG Bd. 3, S. 1212. 343 Legrand, Die Gestalt der Kirche 88.
211
Volkskirche
Der Begriff „Volkskirche“344 verweist auf die andere Seite der bereits kurz besprochenen Ge-
schichte der Kirche und ihrer Ekklesiologie hin. Die struktur- und institutionszentrierte Selbstbe-
hauptung der Kirche („societas perfecta“) wurde unter den demokratischen Verhältnissen mit
dem Hinweis auf das christliche (weil getaufte und dadurch wie automatisch zur Kirche gehören-
de) Volk ergänzt. Besondern in den Ländern, wo die Katholiken eine deutliche Mehrheit bilde-
ten, war es naheliegend zu behaupten: das Volk in sich gehört zur Kirche, es ist das Volk der
Kirche, trägt die Leitung der Kirche, begründet und erklärt die Rechte der Kirche in der Gesell-
schaft.
Der Begriff wurde zuerst von dem protestantischen Theologen Heinrich Wichern im Jahre 1848
gebraucht und hatte damals den Sinn eines Erneuerungsprogramms der „Staatskirche“ im Sinne
der aufbrechenden nationalen und demokratischen Bewegung.345 „Aus soziologischer Sicht kann
Volkskirche zur Kennzeichnung einer gesellschaftliche Verfassung des Christentums dienen, die
durch rechtliche Unabhängigkeit von Kirche und Staat, durch soziale Selbstverständlichkeit der
Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Religionsgemeinschaft und durch die Selbstverständlichkeit
der über die Generationen stabilen Mitgliedschaft in derselben Religionsgemeinschaft gekenn-
zeichnet ist.“346
Selbstverständlich ist es ungenügend, nur aus diesem soziologischen und politologischen Blick-
winkel diese Entwicklung zu beschreiben. Die Kirche in dieser Zeit – in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts – hat eine enorme moderne Mobilisierung erfolgreich durchgeführt. Sie hat die
modernen Mittel und die modernen gesellschaftlichen Strukturen in den Dienst der Pastoral ge-
stellt, wofür die wichtigsten Beispiele die kirchlichen Medien, die kirchlich geförderten Volks-
parteien oder die Actio catholica sind. In dieser Zeit zeigte sich wiederum die Stärke der Ge-
meinschaftlichkeit des Christentums katholischer Tradition.
Doch haben Autoren wie Karl Gabriel, Franz Xaver Kaufmann oder Paul M. Zulehner Recht,
wenn sie behaupten, dass in dieser Epoche eigentlich eine Verkirchlichung des Christentums
stattfand und trotz breiter Erfolge die Kirche zu einer von den anderen Teilen der Gesellschaft
abgesonderte Großorganisation wurde.
In vielen pastoralen Angelegenheiten orientieren sich die Kirchen Ost(Mittel)Europas auch heute
noch an diesem Leitbild. Man versucht, gestützt auf statistische Daten über die Anzahl der Ka-
tholiken, in den jeweiligen Ländern eine Volkskirche zu revitalisieren. Vor allem in den Ländern,
wo Katholiken in größeren Mengen unter anderen Konfessionen leben (wie in Ungarn, Slowakei,
344 Link, Art. „Volkskirche“ in: Ev. Staatslexikon. – Mette, Art. „Volkskirche“ in: LThK. 345 Kaufmann, Religion 123. 346 A. a. O., 143.
212
Litauen), ist dies der Fall. Die Vorstellung über eine breite katholische Basis in der Bevölkerung
kann aber nicht die doch mehr bestimmende Situation der „Leutereligion“347 richtig wahrnehmen
und verweilt bei der Idee: Alle Getauften sollten per definitionem die Kirche unterstützen. Dies
auch nicht ganz zu unzutreffend, da in verschiedenen Gebieten vor allem bei den Lebenswenden,
nahezu von allen Kirchenmitgliedern kirchlicher Beistand in Anspruch genommen wird und die
Zahl der Dominikantes bei 30-40% liegt. Diese Reste einer verlorenen Kirchenwelt können noch
weiter gepflegt werden, vor allem wenn sie zu einem geschlossenen Milieu werden.
Allerdings ist auch eine andere Denkweise zulässig. In Demokratien zählen die Stimmen der
einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Daher werden auch die Kirchen zunehmend nach er Anzahl
jener Personen gewichtet, die formell einer Kirche angehören. Die Frage der individuellen Betei-
ligung am Glauben und Leben der Kirche kann demokratiepolitisch dabei ebenso wenig eine
Rolle spielen wie die Frage, in welchem Ausmaß eine Wählerin oder ein Wähler das Programm
einer politischen Partei teilt.
Milieu
Eine historische Sozialform des Christentums wird nach Karl Gabriel Block- oder Milieu-
Katholizismus genannt. Diese soziologische Beschreibung fand eine ziemlich breite Resonanz in
der Ekklesiologie, da sie einen triftigen Begriff für den Übergang von der Volkskirche in das
Auswahlchristentum anbot. Nach Gabriel348 wird das Milieu durch ein geschlossenes, sich scharf
abgrenzendes religiöses Deutungssystem charakterisiert, welches ein starkes katholisches Wir-
Gefühl ermöglicht. Es wird darin durch ein alle Lebensbereiche umfassendes Institutionennetz
eine eigene Welt aufgebaut, die eine nahezu hermetische Abgrenzung von den Nichtkatholiken
ermöglicht. In dieser Milieu-Kirche wird eine sehr lebendige, bin ins Alltag hineinreichende
religiöse Praxis geübt, konzentriert vor allem auf die Sakramenten- und Marienfrömmigkeit. In
diesem geschlossenen Kulturraum wird die religiös-ethische Normierung der alltäglichen Le-
bensvollzüge durch den Ortspfarrer geltend gemacht, der ein überdurchschnittlich großes Prestige
genießt.
In den Ländern Ost(Mittel)Europas gibt es noch genügend katholische Bereiche, wo ein solches
Kirchenbild als Leitbild in der Positionierung der Kirche nach der Wende benutzt wird. In großen
und mittelgroßen katholischen Städten schaffte es die Kirche, zumindest im Schulwesen einen
katholischen Raum aufzubauen. Von der Volksschule bis zum Gymnasium kann in einer katholi-
schen Schule gelernt werden, wo die LehrerInnen eine sehr starke Bindung an den Ortspfarrer
haben.
347 Zulehner, „Leutereligion“. 348 Gabriel, Christentum 74ff.
213
Auf der Suche nach sicheren kulturellen Orten, an denen die vielfältige Probleme mit der enorm
kompliziert gewordenen Welt, die Unsicherheiten bezüglich der Zukunft der Kinder und der
Jugend gemeistert werden können, drängen viele Menschen dazu, ein solches Milieu aufrecht zu
halten und darin die eigentliche tragfähige Kirche zu sehen.
Volk Gottes
Es gehört zu den wichtigsten Eigenschaften des Kirchenbildes des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, dass es die Kirche in der modernen Gesellschaft mit dem biblischen Bild als „Volk Gottes“
unterwegs darstellte. Die Tragweite dieser Entscheidung ist noch nicht abzuschätzen. Pastorale
Impulse, theologische Weiterführungen, weitere kirchliche Dokumente – u.a. der neue Codex
von 1983 – und etliche Überlegungen in der Pastoralplanung wurden von diesem Bildwechsel
mitverursacht, geprägt und auch scharf kritisiert.
In unserem Kontext hat das Kirchenbild vom „Volk Gottes unterwegs“ große Bedeutung, da es
eine Mobilität, Abänderbarkeit, Reformierbarkeit im Denken über die konkrete Gestalt der Kir-
che ermöglicht, und den Menschen in der Kirche unabhängig von ihrer amtlichen Stelle einen
theologisch fundierten Mut verleiht, über Christentum, Kirche und Verkündigung nachzudenken
und vor allem sich als vollwertiges, aktives Mitglied dieser hochrangigen Gemeinschaft deuten
zu können. Die Volk-Gottes-Ekklesiologie, gemeinsam mit der etwas anders akzentuierten
Communio-Ekklesiologie entspricht der modernen, pluralistischen Gesellschaft und ermöglicht
der Kirche, ihrer Berufung unter den (neuen) demokratischen Verhältnissen originell und inkultu-
riert zu entsprechen.
In den Ländern Ost(Mittel)Europas wird das Bild vom „Volk Gottes“ in erster Linie nicht als
Alternative zur hierarchisch strukturierten Kirche ausgelegt und verwendet, sondern als ein ande-
rer Aspekt dieser Kirche. Dieses Bild der Mobilität findet impulsreiches Echo in den kleineren
kirchlichen Gemeinschaften, in Pfarreien mit jungen, aufgeschlossenen Priestern und auch in der
theologischen Fachliteratur nachkonziliarer Prägung. Weil es ein offizielles, in den Konzilsdo-
kumenten benutztes Bild ist, wird die dahinter stehende Auffassung über die Kirche als einer
gemeinsamen Visionsbasis aufgefasst und nur von extrem konservativen Kreisen frontal kriti-
siert. Die Spannungen, die durch die Gleichzeitigkeit verschiedener Kirchenauffassungen verur-
sacht sind, werden allerdings theologisch zu wenig gesehen und seriös ausgetragen.
Organisationskultur
Die Kirche in den Reformländern ist strukturell unterentwickelt. In den Jahren nach der politi-
schen Wende wurde es auch der Kirche gesetzlich ermöglicht, neue Institutionen und Strukturen
der Pastoral zu entwickeln. Die Restaurierung der Kirchenstruktur hatte vor allem zwei Schwer-
214
punkte: die Finanzierung und die Diözesanstruktur. Parallel damit haben viele Christen mit pasto-
ralen Absichten Vereine und Kreise gegründet bzw. wiedergegründet. Die Anzahl dieser Grün-
dungen erreicht aber bei weitem nicht die Zahl der Vereine der Zwischenkriegszeit. Die Grunder-
fahrung in dieser Kirchen ist eine Strukturvielfalt mit niedrigem Vernetzungsniveau. Die Kirche-
leitung verlor in der Neugründungsphase ihren Überblick, was Unsicherheiten verursacht. Nicht
selten entsteht der Verdacht, dass die eine oder der andere Initiative mit den Zielen der Kirche
nicht voll übereinstimmt. Das aus der Zeit der Kircheverfolgung und -behinderung herkommende
Misstrauen wird durch die schwache Kommunikation zwischen den neuen und alten Institutionen
oft nur noch weiter verstärkt. Auch die InitiatorInnen der neuen Gruppierungen und Institute –
mehrheitlich sind es Laien – reagieren auf diese Situation des strukturell verursachten Misstrau-
ens oft mit einer überbetonten Katholizität, die tendenziell klerikal geprägt sind. So verstärken
sich diese Attitüden gegenseitig in Richtung einer praktischen Neoklerikalismus, obwohl auf
beiden Seiten die wichtige Rolle der Laien und die geschwisterlichen Formen der kirchlichen
Kommunikation ständig unterstrichen werden.
Diese strukturelle Grundsituation fordert von allen Kirchenmitglieder unabhängig von ihrem
Stand in der Kirche als Institution ein Denken in Strukturen. „Die angemessene Antwort auf die
von uns stehenden Herausforderungen liegt darin, dass wir alle, jedes einzelne Organisationsmit-
glied, egal auf welcher Ebene... institutionell zu denken und zu handeln lernen.“349 Diese durch
viele Erfahrungen fundierte Aussage von Karl Berkel trifft auf die Situation der Laien oder noch
weiter gefasst auf die Situation der heutigen Pastoral in den Reformländern völlig zu.
Recht auf Vereinigungen
Das derzeit gültige katholische Kirchenrecht (CIC 1983) bestimmt im zweiten Buch über das
Volk Gottes, dass die Gläubigen Recht haben auf Gründung von Vereinigungen und Unterneh-
mungen für die Zwecke von Caritas, Frömmigkeit, apostolische Tätigkeit (can 215, 216 CIC). Sie
können dies „frei“ zu tun, und sie haben dort das Recht auf Leitung. Diese Gründungen sollen
sich nicht ohne Zustimmung der zuständigen kirchlichen Autorität katholisch nennen. Zu den
Gründungen selbst brauchen sie keine Genehmigung eines kirchlichen Behörde einzuholen.
Die Freiheit der Gründung, Bestimmung und Leitung solcher Vereinigungen ist eine Neuheit in
der katholischen Kirche und besonders in den Reformländern. Der gesellschaftliche Kontext
dieser Rechte ist von den Vereinsgesetzten der neuen Demokratien und von einer unübersichtli-
chen Vielzahl an Gründungen geprägt. Die Laien, die eine kirchliche Vereinigung gründen oder
dort mitarbeiten, entnehmen die Organisationsformen den vergleichbaren Organisationen in der
Gesellschaft. Es gibt in der Kirche kein präzis ausgearbeitetes eigenes Vereinigungsrecht. Die
215
gesellschaftlichen Vereinigungen sind auch ein Symbol des Abbaus einer monolithischen Gesell-
schaft. Sie sind Verkörperungen der bürgerlichen Autonomie und sind Dialogspartner der staatli-
chen Institutionen. Die kirchlichen Vereinigungen – in ihrer Mannigfaltigkeit je nach Form, Grö-
ße und Ziel – haben auch ein Recht auf Autonomie und auf Verhandlungspartnerschaft auch
gegenüber der traditionellen kirchlichen Institutionen, wie Pfarre, Gemeinde, Diözese und ihre
Ämter.
Freiheit braucht Strukturen. Die Wahrnehmung und „Inbetriebnahme“ der Freiheit der Laien
braucht entsprechende kirchliche Strukturen, Rechte und Regeln. Solche Strukturen werden die
Laien in den Status des institutionellen Bewusstseins und der gesellschaftlichen Kommunikation
bringen können. Die Hierarchie wird auch lernen, mit solchen neuen Strukturen besser zu arbei-
ten.
Kompetenzen und Verantwortungen
Nach der Wende kam es zu einem Bildungs-Boom in der Gesellschaft und auch in der Kirche.
Der Staat hat in manchen Reformländern in der Bildung ein breites Feld freigegeben und damit
dieses der freien Privatinitiative überlassen. In der Kirche entdeckte man, dass auf dem Bil-
dungsmarkt vorher nie gekannten Möglichkeiten aufkamen. Die kirchlichen Aus- und Weiterbil-
dungen zielten vor allem auf die Sicherung der Kräfte für den Religionsunterricht, auf die spiritu-
elle Bildung, weniger aber auf gesellschaftspolitische Aspekte. Die internationale Zusammenar-
beit mit westlichen Ländern konnte im Bildungsbereich verstärkt werden. Etliche Bildungsmo-
delle wurden „importiert“, teilweise auch inkulturiert.
Dieser auch kirchliche Bildungs-Boom spielt eine spezielle Rolle in der Horizonterweiterung der
Laien. Wie schon vermerkt ist die personalstärkste Gruppe der Laien die breite Schicht der Ka-
thechetInnen. Daneben nehmen etliche Laien in kirchlichen Bildungsanstalten Aufgaben wahr.
Ihre zivile, bürgerliche Kompetenz ist da und auch hinsichtlich der kirchlichen Aspekte der je-
weiligen Bildungsthematik haben sie ein reichhaltiges Weiterbildungsangebot. Im allgemeinen
kann gesagt werden, dass die Bildung in den Ländern mit größeren Priestermangel (Tschechien,
Ungarn, Ex-DDR, Slowenien) zu 90% in Händen von Laien liegt und zu 99% von Laien bean-
sprucht wird. Bezüglich der Quantität gibt es hier kaum noch Möglichkeit der Weiterentwick-
lung, die Qualität hingegen kann noch verbessert werden. Durch diese neue Bildungslage ent-
stand und entsteht weiterhin eine immer größere Gruppe von Laien mit genügender theologischer
und pastoraler Kompetenz. Die Frage ist, wie die Kirche mit den vielen kompetenten Laien um-
geht, welche Verantwortungen sie bereit ist ihnen zu übertragen.
349 Berkel, Führungstechnik 183.
216
Mit einem Bild – die große Zahl der kompetenten Laien ist wie ein Lokomotive: aufgeheizt aber
nicht in Fahrt. Diese Situation ist eine Herausforderung für die Kirchenleitung. Es müssen die
pastoralen Aufgaben neu verteilt werden, und zu den übertragenen Aufgaben müssen Verantwor-
tungen dazu gegeben werden. Andererseits fordert diese Sachlage auch die kompetenten Laien
heraus, Verantwortung dort überzunehmen, wo sie nicht von der kirchlichen Obrigkeit freigege-
ben werden. Solche Felder zu finden und zu besetzen braucht Kreativität und Mut. Aber ein Aus-
gleich zwischen Kompetenz und Verantwortung ist dringend vonnöten.
Etliche konkrete Beispiele zeigen, dass Laien mit viel Kompetenz und mit wenig Verantwortung
kirchliche Arbeitsfelder enttäuscht und gekränkt verlassen. Sie haben lange Zeit versucht, eine
würdige Stelle in der Kirche oder mit der Kirche als Lebensgrundlage zu finden. Nach vielen
gescheiterten Versuchen geben sie auf und streichen die Sache der Kirche aus ihrem Kalender
und auch aus ihren alltäglichen Gedanken. Sie verlieren das Interesse an der Entwicklung der
Kirche und schließen ihre kirchlich engagierte Lebensphase mit einer negativen Bilanz ab.
Subsidiäre Institutionalisierung
Die Enzyklika „Quadragesimo anno“ (1931) betont, es würde gegen die Gerechtigkeit verstoßen,
„das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinschaften leisten und zum guten Ende führen
können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen“350. Auf diese
Passage baut der Instruktion der Glaubenskongregation „Libertatis conscientia“ (1986) ihre Ar-
gumentation auf: „Kraft des zweiten Prinzips (der Subsidiarität nämlich) aber ist es weder dem
Gemeinwesen noch irgendeiner Gesellschaft erlaubt, sich auf der Ebene an die Stelle der Initiati-
ven und der Verantwortlichkeit von Personen und zwischengeschalteten Gemeinschaften zu set-
zen, auf der sie tätig werden können, oder ihren unbedingt notwendigen Freiheitsraum zu zerstö-
ren...“351 Bezüglich der Entwicklungen innerhalb der Kirche mahnt „Christifideles laici“ (1988):
„Bei der Synodenversammlung hat es jedoch auch solche gegeben, die, neben positiven Urteilen,
andere negative brachten: über den nicht genügend vorsichtigen Gebrauch des Wortes ‚Dienst’,
über Vermischung und manchmal Gleichstellung von allgemeinem und Amtpriestertum und dar-
über, dass manche kirchlichen Gesetze und Normen zu wenig beachtet würden; dass die Deutung
des Konzepts der ‚Subsidiarität’ willkürlich erfolge; dass die christgläubigen Laien auf gewisse
Weise ‚klerikalisiert’ würden; dass die Gefahr bestehe, dass eine gewisse kirchliche Dienststruk-
tur tatsächlich festgelegt werde, die parallel zu der ist, die im Sakrament der Weihe gründet.“352
350 Nr. 79. 351 Nr. 73. 352 CL 26.
217
Die in den Dokumenten der kirchlichen Soziallehre formulierten Aussagen über die Subsidiarität
treffen mutatis mutandis auch dem Vorgang der Institutionalisierung (in) der Kirche zu. Vor
allem in einer Zeit des kirchlichen Neuaufbaus – die wir in den Reformländern beobachten kön-
nen – ist es von entscheidender Bedeutung, wie die Unterstrukturen der Kirche institutionell ge-
sehen immer noch die selbe Kirche bleiben. Theologisch geht es dabei eigentlich darum, wie die
Einheit der Kirche in Verkündigung, Handlung und Kommunikation institutionell gesichert wer-
den kann: Welches Strukturbild der Kirche kann durch den vielfachen Subinstitutionen ihre
Kirchlichkeit und ihre Einheit in der Kirche gewährleisten?
Die nachkonziliaren Dokumente der Kirche über die Laien betonen immer mehr die Mahnung,
dass die verstärkte Mitwirkung der Laien in der Kirche und ihre Wirkung als Kirche nicht die
hierarchische Grundstruktur der Kirche und nicht die an die Weihe gebundene Führungsgewalt
der Klerus angreifen dürfen.353 Die Konzentrierung der Kirchenleitung auf diese innenkirchliche
Problematik darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die hauptsächlichen Dienste der Laien
nicht im Bereich der Sakramentenpastoral oder der Liturgie zu entfalten sei, sondern im soge-
nannten Weltdienst. Diese innenkirchliche Problematik ist gar nicht belanglos, aber die Konzen-
trierung auf die innerkirchliche Seite der Berufung der Laien scheint heute wesentlich wichtiger
zu sein.
Laienbild(er)
Die theologischen und organisatorischen Rahmen bestimmen oder prägen auch die Bilder der
Laien in dieser Reformregion. Wie wir bei den Kirchenbildern gesehen haben, dass sie gleichzei-
tig das theologische und pastorale Denken der Kirche einfärben, so sind die Bilder der Laie auch
allgegenwärtig wirkmächtig. Diese Bilder sind vor allem in der Praxis der Pastoralfelder vorzu-
finden und weniger in der ohnedies sparsamen pastoraltheologischen Literatur. Sie werden nicht
nur von den Kleriker getragen, sondern kennzeichnen oft die Identität der Laien selber. Die mei-
sten Länder in dieser Region sind in erster Stelle nicht von einer Kleriker-Laien-Spannung oder
Spaltung charakterisiert, sondern eher von einer Einheit der im Folgenden beschriebenen Laien-
bilder. Es mangelt nicht an Konflikten zwischen den zwei „Ständen“ der Kirche, aber diese sind
eher latent. Wo sie in die kirchliche Öffentlichkeit einbrechen, handelt es sich meistens um Ex-
tremfälle, die von der allgemeinen kirchlichen Meinung viel mehr mit Skepsis als mit Laiensoli-
darität empfinden werden.
353 Vgl. vor allem „Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester“ (1997), 5.
218
Frommer Messbesucher
Das Idealbild des Laien ist ein frommer Messbesucher. Die religiöse Praxis der praktizierenden
Alltagskatholiken war selbst in der „kommunistischen Verfolgungszeit“ vor allem oder manch-
mal ausschließlich durch den regelmäßigen Messbesuch verwirklicht. Die „Kirche in der Sakri-
stei“ traf die Laien in der eucharistischen Liturgie; lange Zeit, in einigen Ländern sogar bis zu der
politischen Wende passierte die kirchliche Kommunikation beinahe ausschließlich in diesem
heiligen Raum unter der aufmerksam schweigenden Beteiligung der Messbesucher. In vielen
Fällen ist das Kriterium der Christlichkeit identisch mit dem Messbesuch; die Entwicklungen in
der Kirche werden nicht selten daran gemessen, wie viele Laien zur Sonntagsmesse kommen. Bei
dieser Bedeutung des Messbesuches als Hauptmerkmal der Laienexistenz wird hier von der reli-
giösen Bedeutung und kirchlichen Lehre der Eucharistie abgesehen. Es geht hier nur darum, die
praktischen Merkmale eines Laien in Ost(Mittel)Europa zu beschrieben.
So wie die meisten Priester den Messbesuch der Laien hoch bewerten, identifizieren sich auch
viele engagierte Laien mit der Rolle des frommen Messbesuchers. Durch biographische Inter-
views wurde klar, welche identitätsstiftende Bedeutung diesem Messbesuch von den Laien bei-
gemessen wird. Viele – vor allem weniger gebildete Menschen in weniger modernisierten Gebie-
te – betrachten das Messbesuch als Hauptkriterium für die Treue zum Christentum und Kirche.
Gehorsamer Ausführer
Die zentrale und exklusive Rolle des Pfarrers in den Gemeinden mit oft gar keinem pastoralen
Gremien (wie z. B. Pfarrgemeinderat) entspricht auf der Laienseite eine Ausführerrolle. Die Aus-
bildung der Priester geschieht in vielen Priesterseminaren noch in der vorkonziliaren Auffassung,
wonach die Priester für alles in der Gemeinden nicht nur letzte, sondern alle Verantwortungen
tragen. Wenn sie delegieren, dann nur die Arbeit und nicht die Verantwortung und die dazu nöti-
ge Handlungsfreiheit. Im Grunde genommen sind die Laien passiv, ihre Aktivität wird vom Pfar-
rer erst durch die Erteilung von Aufträgen freigesetzt. Da meistens nur die Pfarrer über genügen-
de Informationen über die pastoralen Erfordernisse verfügen, geben sie diese Information nicht
weiter, um sie mit fachkundigen Laien zu besprechen und um zur gemeinsam getragenen Ent-
scheidungen zu kommen, sondern sie verteilen Aufgaben und erwarten eine präzise Ausführung.
Unter den Laien ist demgemäss mehr eine abwartende Grundeinstellung verbreitet: sie warten auf
die Zuweisung von Aufgaben; Eigeninitiativen sind eher in größeren Stadtpfarreien mit mehr
höher gebildeten Laien anzutreffen. Neben der mangelnden Bereitschaft zur Initiative mangelt es
noch mehr an Informationen darüber, was zu tun, zu lösen wäre.
219
Selbstloser und fleißiger Diener
Die ersten zwei Merkmale der Laien waren vor allem von deren Passivität gekennzeichnet. Die
Kirchen in diesen Ländern sind aber voll von selbstlosen und fleißigen Dienern (Männern und
noch mehr Frauen), die ihr Christsein vor allem darin verwirklichen, dass sie sich (meistens gra-
tis) zur Verfügung stellen. Diese Ehrenamtlichkeit ist im Grunde keine frei Wahl der Betroffe-
nen, sondern eher ein aus der Religiosität und aus dem Kirchenbild erwachsendes Pflichtgefühl
des Dienensmüssens. Die stärkste Generation sind dabei die älteren Menschen, die vor der
Kriegszeit eingeübt haben, dass für die Kirche etwas zu tun; das gehört einfach zu einem anstän-
digen Katholiken. Damals war die Kirche reich an (Laien-)Personal. Nach dem Krieg verlor die
Kirche nahezu ihre ganzes Laienpersonal und hatte weder das Recht noch die Finanzen, um Lai-
enangestellte zu beschäftigen. Aber das Pflichtgefühl blieb erhalten, obgleich die Chancen für
eine Anstellung aussichtslos blieben.
Viele in diesem Kreis der Laiendiener stammen aus den Erneuerungsbewegungen. Es gibt zwar
darüber keine richtige Statistik, aber es ist vielleicht nicht ganz unrecht zu behaupten, dass die
meisten aktiven Laien aus diesen Bewegungen kommen und ihre Aktivität für die Kirche eng-
stens mit ihrer Bewegungsspiritualität zusammenhängt. Diese Ansichten fanden auch manchmal
in den Abschlussdokumenten der Diözesansynoden einen Niederschlag. Dadurch entsteht eine
Spezialität in der Auffassung der Laien. Die selbstlosen Diener werden nicht selten Laien im
eigentlichen Sinne des Wortes genannt, wogegen die Messbesucher und Ausführer einfach nur
als einfache „Gläubige“ gelten. Der aus dem Konzil kommende Ausdruck „Laie“ wird hier in
einem speziellen Sinne des Wortes verwendet, was auch ekklesiologische Probleme mit sich
bringt. Nach der Lehre des Konzils, des Kirchenrechtes und aller kirchlichen Dokumente hängt
das Laienstatus nicht mit der Tätigkeit oder Einstellung zusammen, sondern mit der Taufe, mit
der göttlichen Berufung und mit der fundamentalen Partizipation am dreifachen Amt Jesu Christi.
In dieser Hinsicht ist also „Laie“ ein Programmwort für eine Kirche, wo alle nach ihren speziel-
len Charismen an der Arbeit im Weinberg des Herrn teilnehmen. Wer dort nicht arbeitet, der lässt
sich nur von einem kirchlichen Service bedienen.
Ein wichtiges Moment spielt dabei die Finanzierung. In den meisten Ländern Ost(Mittel)Europas
gibt es im Verhältnis zu Westeuropa nur sehr wenige kirchliche Angestellte. Die erste Begrün-
dung dafür ist das Mangel an Finanzierungsmitteln. Das Problem ist aber weniger wirtschaftlich
als theologisch. Viele Fallanalysen haben gezeigt, dass im Notfall die Finanzierungsfrage hätte
gelöst werden können, wenn kein kognitives Hindernis nicht im Wege stünde. Diese ekklesiolo-
gische Einstellung heißt: Dienen in der Kirche ist eine Auszeichnung für die Laien, ein Opfer,
das man Gott darbringt. Ein Pfarrer sagte in einem Interview: „Wenn ein Laie Geld für seine
Arbeit in der Kirche fordert, ist er schon verdächtig.“
220
Mit dieser Aussagen sollte die Problematik der Finanzierung nicht gemildert werden. Auch die
mannigfachen Lösungsversuche sollen nicht unterschätzt werden, die eine angemessene Einstel-
lungsmöglichkeit für Laienmitarbeiter anzielen. Es geht hier nur darum, einen Aspekt der Auf-
fassung über die Laien und ihrer eigenen Selbstdefinition auszuarbeiten.
Politischer Fürsprecher
Die Wende brachte erneut die Möglichkeit, dass Christen oder Menschen, die die europäischen
jüdisch-christlichen Traditionen der Politik für wertvoll gehalten haben, eine aktive politische
Tätigkeit, vor allem als Abgeordnete auf Landes- oder Kommunalebene übernehmen. Die Kir-
chenleitung erblickt in dieser Laienrolle eine Chance für die Erweiterung ihrer pastoralen (und
auch politischen) Gestaltungsmöglichkeiten. Diese Laien sind für die Kirche politische Fürspre-
cher, sie werden bei vielen konkreten kirchlichen Angelegenheiten aufgesucht, in kirchlicher
Kreisen gerne gesehen und von kirchlich positiv gestimmten Wählern auch gewählt. Dabei kann
davon abgesehen werden, was für christliche Qualität und Programme diese neuen Politiker ver-
treten und wie ihre enge Zusammenarbeit mit bestimmten kirchlichen Gruppen und Persönlich-
keiten sich auf das Image der Kirche auswirken. Grundlegend aber für das Bild der Laien in Ost-
(Mittel)Europa ist dieser Merkmal des politischen Fürsprechers, der sich dann auch verpflichtet
fühlt, sozusagen neben seiner politischen Arbeit für das Gemeinwohl zusätzlich auch für die
Kirche Lobbyarbeit zu machen. Die Berichte und Interviews solcher Politiker deuten auf eine
gegenseitige Legitimierung hin: die katholische Kirchenleitung legitimiert den christlichen Poli-
tiker und umgekehrt, der Politiker legitimiert kirchliche Vorhaben.
PASTORALTHEOLOGISCHE ERMUTIGUNGEN
Die Theologie, vor allem die Praktische Theologie, hat die Aufgabe, durch seriöse wissenschaft-
liche Arbeit und durch sprachliche Klarheit die wandernde Kirche als Institution und die wan-
dernden Christen zu einer kontextgerechten und engagierten Nachfolge zu ermutigen. Eine Theo-
logie ohne Dynamik des Geistes und der Lebensräume ist eigentlich keine Rede über Gott. Eine
Theologie ohne seriöse Wissenschaftlichkeit, wozu im Falle der Praktischen Theologie insbeson-
dere auch die Gesellschaftsanalyse gehört, ist keine wissenschaftliche Rede über Gott. Ohne Kul-
turregionen schematisieren zu wollen, kann man doch ungeschützt den Eindruck referieren, dass
die Theologie in der freien Gesellschaften eher der Versuchung ausgeliefert ist, mehr die Wissen-
schaftlichkeit als die Mystik in der theologischen Arbeit in Vordergrund zu stellen und in den
Kirchen der neugewonnenen Freiheit ist es eher umgekehrt. Vielleicht aber kann man gerade in
der Praktischen Theologie der letzten zwei Jahrzehnte eine wiedergewonnene Lebensnähe beo-
bachten. Man denke nur an die vermehrte Bedeutung der Kontextualität oder der Biographiefor-
221
schung im Westen. In Osten ist die Aufgabe der Vertiefung der Wissenschaftlichkeit, die vor
allem in der Aufnahme der Methodendiskussion und in der Wahrnehmung der Rolle der Sozial-
wissenschaften bestünde, noch weitgehend ungelöst.
Im folgenden sollen pastoraltheologische Ermutigungen gegeben werden, wobei es vor allem um
die Laien in der „Welt“, also in der Gesellschaft gehen soll. Der eine Grund ist kontextuell. Die
Mitarbeit der Laien im direkt pastoralen Dienst des Priesters ist ein viel diskutiertes Thema, wel-
ches viele Empfindlichkeiten berührt und viele Emotionen weckt. In der Kirche der Reformlän-
der ist diese Dimension dermaßen im Vordergrund, dass die Arbeit der Laien in der Gesellschaft
nahezu nie vorkommt, obgleich diese die deutlich betonte Seite der Lehre des Konzils und auch
von „Christifideles laici“ ist. Anscheinend betont das Lehramt diesbezüglich auch mehr die
Grenze der Mitarbeit der Laien und weniger die breiten Felder ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten,
die kirchenrechtlich im neuen Kodex gesichert sind. Hier entstanden Barrieren, die wahrschein-
lich nicht schnell abgebaut werden können. Eine Theologie auf der Basis der Erfahrungen der
Gesellschaften Ost(Mittel)Europas ist nicht dazu berufen, in diese Diskussion zu meistern.
Würde der Jünger
Die wichtigste Quelle der christlichen Identität ist die Bibel. Die religiösen Menschen –
mindestens in der Großreligionen – haben ein „Kreaturgefühl“ gegenüber einem Gott, der „my-
sterium tremendum et fascinosum“354 zugleich ist. Die Evangelien, basierend auf der Volk-Gottes
Auffassung des ersten Bundes, sprechen über die Gemeinschaft aller Nachfolger Jesu als Volk
Gottes. Die Mitglieder dieses Volkes sind Kinder Gottes, sind Jünger Jesu, sind die, für die Jesus
sein Leben hingegeben, denen er seinen Geist gesandt hat. Dadurch wurden sie zu einem priester-
lichen Volk. Die Identität der Christen beruht auf dieser Erwählung. Die Jünger Jesu damals und
heute auch gewinnen ihre Identität durch die Nachfolge, durch das starke religiöse Bewusstsein,
dass Gott sie liebt, und ihnen alle Perspektiven öffnet über Unglück und Tod hinaus.
Der springende Punkt der theologischen Ermutigung ist die regelmäßige Kundgabe dieser Bot-
schaft von einem liebenden Gott, der kein totalitärer Herrscher ist, der nicht willkürlich entschei-
det, der sich in Jesus als der Schwächste unter der Schwachen gezeigt hat. Die Würde der Jünger
und heute aller Christen, da sie alle unterschiedslos und gleichrangig zum Volk Gottes gehören,
speist sich nicht von Strukturen, nicht von der Hierarchie, nicht von ihren Arbeitsverhältnissen in
der Kirche und auch nicht von ihrem Schicksal in der Gesellschaft, sondern grundsätzlich aus der
religiös erfassten, von Gott initiierten und aufrechtgehaltenen Nähe zu ihm in Christus durch den
heiligen Geist.
354 Otto, Das Heilige.
222
Die Laienfrage mag in der Theologie ein großes Probleme sein, da sich die Theologie als Wis-
senschaft um die Klarheit der Begriffe kümmert, und diese Begriffe haben in der Kirche nicht nur
eine intellektuelle, sondern auch immer eine politische Geschichte.
In einer solchen Situation der Kirche in den Reformländern hat die Erinnerung an die Botschaft
über das Volk Gottes und die daraus resultierende Identität und Würde aller Christen eine beson-
dere Bedeutung, da die Kirche nach vielen Jahren der Verfolgung zu sehr auf die Wiederherstel-
lung von Strukturen konzentriert ist, Inhalte des Glaubens aber in den Hintergrund zu treten in
Gefahr sind. Nach zehn Jahren Freiheit ist aber die Zeit reif, uns erneut und voller Engagement
auf die Inhalte der christlichen Botschaft zu konzentrieren und dabei die Frische des Geistes des
Konzils allen in Originalton zugänglich zu machen.
Spiritualität der Weltgestaltung
Die ganze Kirche ist missionarisch. Wenn sie diese Sendung zur Welt, die Aufgabe der (modell-
haften) Neugestaltung dieser Gesellschaft nicht erfüllt, dann ist sie nun mehr eine Hülle, aber
keine lebendige religiöse Organisation mehr. Im Grunde genommen ist es für Christen unhaltbar,
die Erfahrung des Geistes Gottes nicht weitergeben zu wollen. Alle biblischen Erzählungen be-
weisen, dass der Geist Gottes zur Märtyria drängt. Eine nichtmissionarische Kirche hat ihr Pro-
blem vor allem nicht mit den Missionsinstituten, sondern mit ihrem Glauben, mit der Leben-
digkeit ihrer Frömmigkeit.
In einer Zeit, in der die klerikale Seite der Kirche – verursacht durch vielen äußeren und inneren
Probleme der heutigen Zeit – schwach ist, stehen die Laien, die mündigen Bürger der Kirche
Gottes, vor eine großen Herausforderung: die Verantwortung für die Weitergabe des Wortes
Gottes voll wahrzunehmen und danach zu handeln. Nicht die Bischöfe und die Pfarrer sind die
Träger des missionarischen Auftrages, sondern der Geist Gottes selbst. Im Bewusstsein dieses
Auftrages sind die Laien, die zivilen Menschen dort wo sie leben und arbeiten, Boten Gottes. Die
Menschen um uns herum fragen nicht danach, wie es mit der „missio canonica“ rechtlich aus-
sieht, sondern danach, wie glaubwürdig und alternativ die Praxis und das Denken eines jeden ist.
Jeder Laie verwirklicht seine religiöse Lebensaufgabe durch sein christliches Dasein in der Welt.
Wo Laien für mehr Gerechtigkeit, mehr Solidarität, mehr Liebe, mehr Ehrlichkeit, mehr Wahr-
heit in ihrem zivilen Lebensbereich auftreten, dort wird die göttliche Botschaft der Evangelium
präsent.
In diesem Sinne, über alle korrekten theologischen Korrekturen hinaus, wirkt es eindeutig befrei-
end, wenn auf den Weltcharakter des Laiendienstes hingewiesen wird. Die Laien sind nicht in der
kirchliche Verkündigung deshalb wichtig, weil sie etwas mehr Spielraum innerhalb der Kirche
erreichen können oder des Priestermangels wegen vorübergehend auch sollen, sondern weil ohne
223
Laien Gott und das Evangelium in der Welt nicht in vielfältigster Weise präsent ist. Ohne Laien
gibt es keine Kirche in der Welt. Auch der Weltdienst der Laien ist somit ein geistlicher Dienst,
insofern nämlich „ein geistlicher Mensch sein“ heißt: aus dem Heiligen Geist Gottes heraus zu
leben.355
Kirche für die zivile Gesellschaft in Ost(Mittel)Europa
In der kirchlichen Öffentlichkeit der Reformländer wird seit der Wende weit und breit erzählt,
wie die Kirche in ihrer Struktur, in ihrer gesellschaftlichen Stellung und in ihren Mitgliedern
verfolgt und verhindert wurde. Dabei wird oft wenig wahrgenommen, dass die kommunistische
Diktatur die ganze Gesellschaft stark umstrukturiert hat. Die kirchlichen Mikrostrukturen wurden
als Teil der Zivilgesellschaft vernichtet oder unter Totalkontrolle gestellt. Wenn nach der wieder-
gewonnenen Freiheit die Kirche sich auch strukturelle erholen will, dann soll sie dies auch als
Beitrag zur Revitalisierung der ganzen Zivilgesellschaft verstehen. Auf diesem Feld hat die Kir-
che sogar eine spezielle Sendung in diesen Ländern. Der Glaube und der Vertrauensvorschuss
unter den Gläubigen, die soziale Dimension der christlichen Botschaft drängen die Christen dazu,
lebendige Mikrostrukturen aufzubauen oder zu revitalisieren. Wenn Christen aus ihrer Fach-
kenntnis und aus ihrem politischen Interesse her Vereine und ähnliche Mikroinstitutionen grün-
den und am Leben halten, dann ist diese Tätigkeit zugleich eine Heilung der im Kommunismus
strukturell verarmten Gesellschaft. Dazu brauchen Laien wiederum nur begrenzt kirchenamtliche
Genehmigungen. Es soll dabei vielmehr eine politische Eigenständigkeit in Anspruch genommen
werden. Solche Initiativen dürfen nicht von der Gutwilligkeit von Amtsträgern abhängig gemacht
werden, da diese im allgemeinen weniger über diese neue gesetzlichen Möglichkeiten Kenntnis
haben. Die christlichen Inhalte und Lösungen dieser kleinen Gesellschaften machen sie zu einem
Moment am kirchlichen Leben. Nur für einen eventuellen offiziellen kirchlichen Status brauchen
sie eine Anerkennung der zuständigen kirchlichen Behörden.
Im Oktober 1998 hat Papst Johannes Paul II. in seiner Ansprache an die kroatischen Bischöfe den
engen Zusammenhang zwischen dem Aufbau der Kirche und jenem der zivilen Gesellschaft am
Beispiel der Familienpastoral unterstrichen. „Die pastorale Begleitung der Familien, vor allem
wenn dabei auch junge Leute involviert werden, ist ein klarer Weg für die Zukunft der Kirche
und der zivilen Gesellschaft.“ Selbst also die direkten pastoralen Tätigkeiten haben eine gesell-
schaftliche Relevanz, manchmal viel mehr als Tätigkeiten, die direkt gesellschaftliche Bereiche
zum Ziel haben.
355 Hilberath, a. a. O. 228.
224
Suche der geeigneten Formen der Rückendeckung
Es gehört zur pastoralen Ermutigung, auch die Schwierigkeiten rund um die Laienarbeit wahrzu-
nehmen und zu betrachten. Sie entstehen am meisten durch Diskrepanzen theologischer, organi-
satorischer und persönlicher Art. Die kirchliche Lehre und auch die kirchenrechtlichen Regelun-
gen gelten als theoretische Richtlinien in der Gestaltung der Laienarbeit. Oft aber sind sie wenig
bekannt und noch weniger hinsichtlich ihrer Praxisrelevanz in der kirchlichen Öffentlichkeit
ausdiskutiert. Für die Laienarbeit sollen daher Prioritäten gesetzt werden, die den internationalen
kirchlichen Richtlinien und der organisatorischen Kapazität der konkreten ortskirchlichen Ver-
hältnisse entsprechen.
Es sollen vor allem solche Laientätigkeiten gefördert werden, die möglichst wenige kirchenamt-
liche Beziehungen haben. Aus dem gesunden Laienbewusstsein heraus sollen ruhig christliche
Initiativen starten und arbeiten in dem Bewusstsein ihrer Bedeutung für die Heiligung der Perso-
nen und der Welt. Diese sollen mit einer aufgeschlossenen Ruhe ihre Tätigkeit ausüben und inne-
re Freiheit und subsidiäres Bewusstsein ständig in Erinnerung zu halten. In dieser Hinsicht ist der
sogenannte Weltcharakter der Laien eine befreiende Botschaft, die besagt, dass nicht nur von den
Amtsträger geförderten Laientätigkeiten kirchlich und Wege der Heiligkeit sind. Es sollen die
Amtsträger auch befreit werden von einem umfassenden Kompetenzzwang, über alles Bescheid
wissen zu wollen und alles kontrollieren zu müssen. Je mehr Laien als Partner und nicht als Un-
tertanen mit Klerikern verhandeln, desto mehr werden auch die Kleriker eine partnerschaftliche
Kommunikationsart einüben können. Hier haben Laien mehr Verantwortung, da die Kleriker in
die hierarchischen Traditionen der Kirche mehr eingebunden sind und solche Partnerschaftlich-
keiten auch oftmals als strukturfremd empfinden.
Es ist weiterhin von Bedeutung landesweite Laiennetze aufzubauen: für regelmäßige Konsulta-
tionen, für gemeinsame Projekte und Bewerbungen und nicht zuletzt für Weitebildungen. Wenn
solche Netze viele Christen mobilisieren können, dann werden sie auch die Gutwilligkeit der
Kirchenleitung leichter gewinnen können, da sie auf die tief im amtlichen Denken verankerte
volkskirchliche Traditionen erinnern werden. Diese Initiativen werden vielleicht bereits in der
Aufbauphase vorsichtige Anweisungen von der Hierarchen bekommen, die aber nicht entmuti-
gend wirken dürfen. Die Tätigkeit dieser Netzwerke gilt im traditionellen, vorkonziliaren Sinne
des Wortes nicht als kirchliche Tätigkeit, sondern als „weltliche“.
Es ist also keine dogmatische, sondern eine kommunikative Problematik, die auch auf dieser
Ebene behandelt werden soll. Bei solchen Konfliktfällen dogmatische Elemente in die Diskussi-
on einzubeziehen, ist dogmatisch unrichtig und pastoral schädlich. Ein typischer Fall ist, wenn
bei solchen Initiativen die Kirchenleitung die Kirchlichkeit anzweifelt. Hier sollen selbstbewusste
und gut ausgebildete Laien eine beruhigende Antwort geben, die sich mehr auf die persönliche
225
und institutionelle Situation der Amtsträger denn auf die von ihnen inkorrekt zu Wort gebrachten
dogmatische Vorwürfe konzentriert. Plakativ ausgedrückt: autonom arbeiten und die Rücken-
deckung möglichst nicht verlieren.
Wort ergreifen
In den Zeiten der politischen Blockierung der kirchlichen Verkündigung hat der christliche Tat,
die christliche Praxis eine besondere Bedeutung bekommen. Man pflegte zu sagen: die Taten
sollen Christus verkündigen. Selbst aber in diesen behinderten Zeiten wusste die Kirche und
wussten die Christen, dass keine gesellschaftliche Situation die Kirche und sie selbst vom Ver-
kündigungsauftrag lossprechen kann. Doch die Grundsituation der „schweigende Kirche“ hat
heute noch Nachwirkung, in dem die Christen und die kirchlichen Institutionen sich mit der Öf-
fentlichkeitsarbeit schwer tun. Grundlegend ist die Kirche in diesen Ländern immer noch eher
eine „schweigsame Kirche“, wenn man von direkt politischen und kulturpolitischen Äußerungen
einzelner Bischöfe einmal absieht. Diese Stellungnahmen werden zwar von den Medien immer
aufgegriffen und die innere marktorientierte Logik der Medien vermittelt sie, wodurch der An-
schein erweckt werden kann, die Kirche schweige nicht. Wenn man aber bedenkt, wie viele Öf-
fentlichkeitsimpulse von Institutionen (mit der Kirche gleichem Gewicht) täglich ausgehen müs-
sen, um die Interessierten wenigstens mit den Grundbotschaften bekannt zu machen, dann ist das
Bild der schweigende Kirche gar nicht ungerecht.
Wenn die Verantwortlichen der Kirche nicht an die Öffentlichkeit treten oder wenn ihre Stel-
lungnahmen nicht der Forderungen der heutigen medialen Kommunikationskultur entsprechen,
dann darf das nicht bedeuten, dass Laien schweigen sollen oder dürfen. Die ganze Kirche ist
missionarisch, das ganze Gottesvolk soll die Botschaft der Liebe in die Welt bringen: Also auch
die Laien. Wenn die heutige Öffentlichkeit zu klerikal und zu wenig informiert ist, dann es das
auch auf Grund einer Unterlassung der Laien. Das stimmt auch dann noch, wenn man aus vielen
Untersuchungen erfährt, dass die Medien selber mit Vorzug die institutionelle und dadurch die
klerikale Seite der Kirche zum Wort bringen. Dies hindert aber die Laien nicht, ihre Sicht in die
mediale Öffentlichkeit zu bringen. Es geht diesbezüglich vor allem nicht darum, über kirchliche
Verhältnisse zu sprechen und auch nicht im Namen der Kirche zu sprechen. Es geht vielmehr
darum, die christliche Sicht der weltlichen Dinge souverän und klar in die gesellschaftliche Öf-
fentlichkeit zu bringen. Dazu braucht man keine kirchliche Erlaubnis, aber man braucht Fach-
kräfte, die in den heutigen Medien zu Hause sind.
Um das Wort ergreifen zu können, um authentisch und kompetent reden zu können ist Bildung
erforderlich. Eine der größten Aufgaben, aber auch Chancen der Laien ist, wenn sie gut ausgebil-
det sind. Eine der wichtigsten Aufgaben der (internationalen) Kirche ist, die Bildung (ihrer Mit-
226
glieder) zu stärken. Wenn Laien gut ausgebildet sich zu Wort zu melden, dann wird ihr erstrangi-
ges Gesprächspartner, die Gesellschaft, ihnen auch Gehör schenken.
Dienste in der Kirche
Die Diskussionen über die Laien nach „Christifideles laici“, aber noch mehr anlässlich der In-
struktion, konzentrierten sich auf die Rechte und Tragweite der pastoralen Mitbeteiligung und der
Entscheidungsgewalt der Laien innerhalb der Kirche. Vor allem in solchen Ortskirchen ist dies
ein drängendes Problem, die entweder grundsätzlich Missionsgebiete sind, wo die kirchliche
Struktur noch sehr unterentwickelt ist, oder dort, wo die selbe Struktur so gut (wie in der
Schweiz) ausgebaut ist, dass die amtlichen Mitglieder dieser Struktur mehrheitlich Laien sind.
In Ost(Mittel)Europa ist es eine wichtige Aufgabe, die theologische Tiefe und die praktische
Tragweite der Laiendienste in der Pastoraltätigkeit überhaupt erst bekannt zu machen. Es kann
befreiend wirken, dass diesbezüglich die verpflichtenden Dokumente des Lehramtes aus dieser
Region her gesehen progressiv und provokativ sind. Theologische oder kirchenrechtliche Beden-
ken können die Amtsträger der ortskirchlichen Hierarchie nicht gegen eine weitgehend erweite-
rungsbedürftige pastorale Mitbeteiligung der Laien bringen. Vielleicht anders als nach der west-
europäischen Grunderfahrung können Laien hierzulande sagen, „der Papst steht hinter uns“,
wenn wir mehr Laien in pastoralen Aufgabenfeldern haben möchten.
Eine weitere Aufgabe ist, auf Grund der inneren Sicherheit bezüglich der zugesagten Rechte der
pastoralen Mitwirkung mit einer gelassenen Ruhe die Hierarchie an diese Rechte zu erinnern.
Ruhe und innere Gelassenheit sind hier darum von besonderer Bedeutung, da die allgemeine
gesellschaftliche und kirchliche Umstellung auf die neue Situation nach der Wende ohnedies
schon so viel Hektik mit sich bringt, dass mit einer unruhigen Forderung auch allgemeine Ab-
wehrmechanismen hervorgerufen werden können. Dass man diese Situation versteht, darf aber
nicht von der Aufgabe befreien, die Rechte anzufordern.
227
SÄKULARE KULTUR IN OST(MITTEL)EUROPA
Unsere Frage ist, wie weit und mit welchen Inhalten kann man heute in den sogenannten Reform-
ländern über eine säkulare Kultur reden und wenn ja, vor welche Herausforderungen stellt dann
diese Kultur die Lehre und die Praxis der katholischen Kirche.356 Wir möchten diese Frage in
drei Schritten angehen. Zuerst untersuchen wir die Anwesenheit den klassischen Atheismus. Er
bildete sich im 19. Jahrhundert heraus und hat eine dreifache Ausprägung, je nach welchem posi-
tiven Wert durch die Leugnung der Existenz Gottes betont werden sollte.357 In einem zweiten
Schritt stellen wir dar, in welchem Maß die Menschen in diesen Reformländern eine klassische
atheistische Position vertreten. Wir werden beobachten können, dass diese Atheismus nur in zwei
Ländern der Region stark ausgeprägt ist, in den neuen Bundesländern Deutschlands und in
Tschechien. Drittens versuchen wir, uns einen Überblick über die Areligiösität dieser Länder zu
verschaffen um dann zu sehen, welches die wichtigen Werte und Erwartungen von diesen areli-
giösen Menschen sind. Diese dreischrittige Darstellung hat ein doppelter Ziel. Einerseits die dif-
ferenzierte Wahrnehmung jener Kultur, in der wir leben. Andererseits das Verständnis dieser
kulturellen Lage als Zeichen der Zeit, die die Kirche für ihre angemessene Verkündigung und
Praxis reflektieren soll.
GOTTES NICHTGLAUBE
Im 19. Jahrhundert wurde eine atheistische oder eine atheistisierende Einstellung zur Mode. Sie
wurde vor allem dadurch motiviert, dass das Christentum und die christlichen Kirchen gegenüber
der bürgerlichen Entwicklung der Moderne und der Problematik der Menschen eine abweisende
Haltung eingenommen haben. Diese Haltung kann mit dem Syllabus vom Papst Pius IX. (8. De-
zember 1864.) und mit den Beschlüssen des Ersten Vatikanischen Konzils (1870) symbolisiert
werden. Im Syllabus – einer Sammlung von Irrtümern – hat die katholische Kirche ein apologeti-
sches Nein gesagt zur Autonomie der modernen Gesellschaft, zur freien Wissenschaft, zur sich
entwickelnden Demokratie. Die Kirche hat sich in dieser Zeit – übrigens voll berechtigt – durch
diese Moderne bedrängt gefühlt und antwortete mit Abwehr. Einige Zitate aus dem Syllabus
mögen diese Abwehrhaltung in Erinnerung rufen. Verworfen wurden u.a. die folgenden Thesen:
„Die Kirche ist vom Staat und der Staat von der Kirche zu trennen.“358
356 Urspünglich gehen die Überlegungen auf einen Vortrag zurück, den ich im Mai 2000 in Tschechien bei einer Ver-anstaltung der Katholischen Akademie Österreichs gehalten habe. Hier wurden die dortigen Reflexionen eingearbei-tet, wofür ich den dort Anwesenden dankbar bin.
357 Vgl. Küng, Existiert Gott? 221-381. 358 DH 2955.
228
„Die Staatsverfassung verfügt als Ursprung und Quelle aller Rechte über ein Recht, das von
keinen Grenzen eingeschränkt ist.“359)
„Von Katholiken kann jene Art der Jugendbildung gebilligt werden, die vom katholischen Glau-
ben und von der Vollmacht der Kirche losgetrennt ist und die ihr Augenmerk lediglich oder auch
nur in erster Linie auf die Naturwissenschaft und die Ziele des irdischen gesellschaftlichen Le-
bens richtet.“360
„Die Methode und die Grundsätze, nach denen die alten scholastischen Lehrer die Theologie
ausbildeten, entsprechen keineswegs der Erfordernissen unserer Zeiten und dem Fortschritt der
Wissenschaften.“361
In diesem Kontext also entwickelten sich drei Hauptarten des Atheismus, deren bekannteste Ver-
treter Feuerbach, Marx und Freud waren. Feuerbach meinte, dass die Menschen befreit werden
sollen von der Übermacht Gottes. Seine These war, nicht Gott hab den Menschen geschaffen,
sondern die Menschen schufen Gott, weil sie nicht an die eigene Kraft und Größe glauben konn-
ten oder durften. Darum muss man im Interesse der Menschen Gott verneinen. Marx argumen-
tierte wirtschaftspolitisch. Die Kirchen mit ihrem Gott unterstützen die ungerechte gesellschaftli-
che Situation, wodurch viele Proletarier unterdrückt werden. Eine Befreiung von dieser „sozialen
Sünde“ kann nur durch die Leugnung Gottes herbeigeführt werden. Dann werden die Menschen
nicht mehr vom „Opium des Volkes“ berauscht und werden imstande gesetzt, für ihre Rechte zu
kämpfen. Freud schließlich meinte, dass die Menschen wegen einer therapiebedürftigen Neurose
unfrei seien und diese Neurose werde durch die Kirchen und durch die Gottesvorstellungen ver-
ursacht. Wenn den Menschen klar gemacht werden kann, dass es keinen Gott gibt, der sie wegen
Vatermord verurteilt, dann werden sie psychisch befreit.
Die Grundlogik aller dieser Atheismen ist: je menschlicher, desto atheistischer. Für die Men-
schen zu kämpfen bedeutet unausweichlich auch gegen Gott zu kämpfen. Und da die Kirche den
Gottesglauben verkündigen und in der Gesellschaft einen großen Einfluss haben, sollen sie auch
logischer Weise im selben Befreiungsprogramm zurückgedrängt werden. Es ist also gar nicht zu
verwundern, dass die Kirche von damals auf ein solches Programm nur mit Abwehr, Verurtei-
lungen und Exkommunikation antworten konnte.
Die Zeiten haben sich verändert, was bezüglich Atheismus Zweierlei bedeutet. Die Kirchen ver-
loren weitgehend ihre gesellschaftlichen und kulturellen Einflussmöglichkeiten. Ihre Machtposi-
tion provoziert die „Progressiven“ nicht mehr. Die Kirchen haben ihre eigene Geschichte und
Lehre revidiert und sehen in diesen Atheismen nicht mehr einseitig Feinde des Glaubens und der
359 DH 2939. 360 DH 2948. 361 DH 2913.
229
Kirche, sondern auch eine teils berechtigte Rückmeldung auf die kirchliche Lehre und Praxis. In
dieser Haltung sprach das Zweite Vatikanische Konzil über den Atheismus in dem Pastoralkon-
stitution Kirche in der Welt von heute.362 Das Konzil meint, dass man sorgfältig die Arten vom
Atheismus prüfen soll. Es wird vom Konzil wahrgenommen, dass
„Manche sind, wie es scheint, mehr interessiert an der Bejahung des Menschen als an der Leug-
nung Gottes, rühmen aber den Menschen so, dass ihr Glaube an Gott keine Lebensmacht mehr
bleibt.“363
Die Kirche bekennt ihre Mitverantwortung und Mitschuld an der Entstehung des Atheismus:
„Gewiss sind die, die in Ungehorsam gegen den Spruch ihres Gewissens absichtlich Gott von
ihrem Herzen fernzuhalten und religiöse Fragen zu vermeiden suchen, nicht ohne Schuld; aber
auch die Gläubigen selbst tragen daran eine gewisse Verantwortung. Denn der Atheismus, allsei-
tig betrachtet, ist nicht eine ursprüngliche und eigenständige Erscheinung; er entsteht vielmehr
aus verschiedenen Ursachen, zu denen auch die kritische Reaktion gegen die Religionen, und
zwar in einigen Ländern vor allem gegen die christliche Religion, zählt. Deshalb können an die-
ser Entstehung des Atheismus die Gläubigen einen erheblichen Anteil haben, insofern man sagen
muss, dass sie durch Vernachlässigung der Glaubenserziehung, durch missverständliche Darstel-
lung der Lehre oder auch durch die Mängel ihres religiösen, sittlichen und gesellschaftlichen
Lebens das wahre Antlitz Gottes und der Religion eher verhüllen als offenbaren.“364
Die Kirche verurteilt „mit aller Festigkeit“ den Atheismus, aber fügt sofort hinzu:
„Jedoch sucht die Kirche die tiefer in der atheistischen Mentalität liegenden Gründe für die
Leugnung Gottes zu erfassen und ist im Bewusstsein vom Gewicht der Fragen, die der Atheismus
aufgibt, wie auch um der Liebe zu allen Menschen willen der Meinung, dass diese Gründe ernst
und gründlicher geprüft werden müssen.“365
Eine ernste Prüfung bedeutet in Bezug auf unsere Fragestellung, dass die Kirche und die Theolo-
gie mit einer bestimmten Unvoreingenommenheit das Existenz des Atheismus wahrnehmen soll.
Es ist in der Region Ost(Mittel)Europas eine nicht zu leichte Aufgabe, da in der Geschichte die-
ser Region mit dem theoretischen Atheismus eine gewaltige Religions- und Kirchenverfolgung
verknüpft war, deren Wunden vor allem in der älteren Generation noch nicht geheilt sind. Der
Kurzschluss ist aber zu vermeiden: Den heutigen Atheismus mit der erlittenen Kirchenfeindlich-
keit gleichzusetzen. Eine sorgfältige Prüfung soll aber vor allem sehen können, wie weit über-
362 GS 19-21. 363 GS 19. 364 A. a. O. 365 GS 21.
230
haupt noch atheistische Positionen in der postsozialistischen Gesellschaften anwesend sind. Zu
dieser Prüfung möchte unser nächste Schritt einen bescheidenen Beitrag leisten.
(UN)GLAUBE AN GOTT
Wenn man direkt nach der Glaube an Gott fragt (Welche der folgenden Aussagen beschreibt am
besten ihre eigene Auffassung?), antworten die Menschen:
Häufigkeit Gültige Prozente a. glaube nicht 1283 12,7% b. weiß nicht ob 888 8,8% c. nicht an persönlichen Gott 1408 13,9% d. manchmal ja manchmal nein 937 9,2% e. glaube trotz Zweifel 1905 18,8% f. weiß dass Gott existiert 3709 36,6% gesamt 10130 100,0%
TABELLE 3: Verbreitung des Gottesglaubens in postkommunistischen Ländern (Quelle: AUFBRUCH© 1998)
Nach der geschichtlichen Entwicklung des philosophischen Gottesglaubens kann man diese
Antwortalternativen in die vier klassischen Kategorie einordnen. Die Antwort a. gilt als athei-
stisch, b. als agnostisch, c. als deistisch, e. und f. gelten als theistisch. Die Antwort d. weist auf
keine Einstellung hin, denn unsicher kann man in allen Kategorien sein. Nach diesem Meinungs-
bild können wir eine vorsichtige These formulieren: Unter Nichtgläubigen verstehen wir Athei-
sten und Agnostiker. Sie bilden im allgemeinen in den Reformländern etwa 20% der Bevölke-
rung. Aus dieser Meinungslage ist es wichtig eine Korrektur vorzunehmen. In vielen Dokumenten und
Stellungnahmen wird von Bischöfen und Theologen, aber auch von manchen christlichen Politi-
kern eine andere Aufteilung benutzt. Sie vertreten, dass auf der einen Seite die Christen stehen,
auf der anderen Seite hingegen die Atheisten, die mit den marxistisch-leninistischen Kommuni-
sten gleichgesetzt werden. Im Gegenteil dazu zeigt unsere Forschung AUFBRUCH©, dass es in
den Reformländern nahezu mit einer kleinen Zahl von kämpferischen Atheisten kommunistischer
Prägung gerechnet werden muss.366
366 Das selbe Meinungsbild entsteht auch ,wenn man danach fragt, wie nahe sich die Menschen zu Gott fühlen. Auf diese Frage antworten 16% der Befragten, dass sie nicht an Gott glauben. Oder als man gefragt hat, „Bitte, sagen Sie mir, woran Sie aus den Folgenden glauben und woran Sie nicht glauben!“, dann haben 22% mit „nicht an Gott“ und 12% mit „weiss nicht“ geantwortet.
231
Abwesenheit Gottes
Das Konzil sprach aber nicht nur über den „systematischen Atheismus“, sondern auch über ande-
re Arten dieser Weltdeutung. Wir wenden uns daher der Frage zu, wie und in welchem Maß ist
Gott im Leben der Menschen unserer Region abwesend erlebt wird. Wie weit ist unsere heutige
Kultur von einer Gottesabwesendheit gekennzeichnet?
„Das Leben hat einen Sinn, weil Gott existiert“ – sagen die Gläubigen. Wir dürfen Menschen als
nichtgläubig bezeichnen, wenn sie mit dieser Aussage nicht einverstanden sind. Das gleiche gilt
bei der Aussagen: „Gott hat den Lauf unseres Lebens“ vorausbestimmt oder „Die Leiden und das
Elend haben nur einen Sinn, wenn man an Gott glaubt“. In den Reformländern sieht die Mei-
nungslage wie folgt aus. Etwa ein Viertel der Bevölkerung deutet das Leben ohne Gott. Sie sind
nicht Atheisten im klassischen Sinne des Wortes, sie haben einfach eine andere Lebensdeutung
gefunden.
Im Leben von mehr als der Hälfte der Bevölkerung ist ein Gott anwesend, der dem Leben und
Leiden einen Sinn gibt. Diese Menschen meinen, dass ihr Lebensweg durch die göttliche Vorse-
hung vorgezeichnet ist. Ein Viertel der Bevölkerung glaubt aber das Gegenteil – in ihrem Leben
gibt es keinen Gott. Wer sind diese Menschen?
Wenn man den Anteil der Nichtgläubigen nach Ländern auflistet, dann wird es möglich drei
Ländertypen zu beobachten. Zum ersten Typ gehören Länder, wo der Anteil der Nichtglaubenden
überwiegt. Es sind die Ex-DDR und Tschechien. Zum zweiten Typ zählen die Länder, wo einen
starker, aber nicht überwiegender Anteil von Nichtgläubigen existiert: dazu zählen die Slowakei,
Slowenien und Ungarn. In die dritte Gruppe gehören die Länder, wo praktisch nur wenige Nicht-
glaubende sind: in Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien und die Ukraine.
Die Nichtgläubigen sind im Vergleich zur Gesamtbevölkerung etwas besser gebildet, vor allem
was die Mittelschule betrifft (54%). Unter den höher Gebildeten ist dieser Unterschied klein
(14%). Das bedeutet, dass die klassische These: je gebildeter, desto säkularisierter, nur bei den
mittleren Schulen zutrifft. Die mittleren Schulen bedeuten in dieser Forschung Gymnasien, Fach-
schulen und Schulen, die mit der Fachausbildung auch ein Abitur ermöglichen. In der untersuch-
ten Region generiert eine universitäre Ausbildung keinen Unglauben.
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass es in den Ländern Ost(Mittel)Europas wenige
Atheisten im klassischen Sinne des Wortes gibt. Obzwar unsere Untersuchung in zehn postkom-
munistischen Ländern keine Fragen nach einem kämpferischen Atheismus gestellt hat, ist es
dennoch mit hoher Wahrscheinlichkeit treffend zu meinen, dass die Kirchen – eventuell die Ex-
DDR und Tschechien ausgenommen – für ihre Pastoral nicht mit einer solchen Einstellung rech-
nen müssen.
232
RELIGIOSITÄT
„Einmal abgesehen davon, ob Sie in die Kirche gehen oder nicht – würden Sie sagen, dass Sie
ganz besonders religiös sind; einigermaßen religiös sind; sind weder religiös, noch nicht-religiös;
einigermaßen nicht-religiös sind; ganz besonders nicht-religiös sind...“ So stellte die Forschung
AUFBRUCH© eine sehr differenzierte Frage zur religiösen Selbstdefinition.367
In der erforschten Region bilden jene Menschen, die sich in irgend einer Weise als religiös defi-
nieren, die Mehrheit (56%). Es gibt aber einen bedeutenden Anteil, die sich als nichtreligiös be-
zeichnen (25%). Die ganz besonders Religiösen bilden eine kleine Minderheit (13%).
Wenn man die Daten nach Ländern368 aufschlüsselt, dann ergeben sich mindestens drei größere
Gruppen von Ländern in dieser Region: stark religiöse Länder (Kroatien, Polen, Litauen und
Rumänien), mehrheitlich religiöse Länder (Slowakei, Slowenien, Ungarn und Ukraine) und
schließlich mehrheitlich nichtreligiöse Länder (Deutschland-Ost und Tschechien). Daraus ergibt
sich, dass es für diese postsozialistische Region – trotz gemeinsamer politischer Erfahrungsba-
sis – kein einheitlicher Pastoralplan aufgestellt werden kann. Es müssen in den einzelnen Län-
dern andere Schwerpunkte gesetzt werden, je nachdem, ob sie stark säkularisiert und moderni-
siert sind oder ob sie eine vormoderne, stark religiöse Kultur haben.
Religiöse Selbsteinschätzung kann vieles bedeuten, je nach dem, welche Merkmale man der Re-
ligiosität zuweist. Wenn man die Lage der Religiosität untersuchen will, fragt man danach, ob die
Befragten gerne in sich einkehren und ob sie sich neben der irdischen Wirklichkeit auch eine
andere Dimension vorstellen können, die wir philosophisch „transzendent“ bezeichnen.
367 Näheres darüber in Tomka/Zulehner, Religion in den Reformländern 159ff. 368 Relgiöse Ausstattung der zehn untersuchten Länder (in Prozent): gar nicht religiös einigermassen
nicht religiös weder – noch einigermassen
religiös ganz besonders
religiös Deutschland 36,3 15,6 17,8 23,1 2,0 Kroatien 6,4 3,9 12,2 42,6 33,4 Litauen 2,7 4,8 23,0 60,7 7,2 Polen 2,5 3,5 18,4 53,9 20,7 Rumänien 4,1 13,8 18,4 51,2 11,8 Slowakei 22,4 3,8 18,3 43,8 10,3 Slowenien 10,2 13,3 26,6 43,6 5,1 Tschechien 35,2 16,1 16,3 22,1 7,0 Ukraine 19,3 6,1 15,7 47,3 7,4 Ungarn 19,3 10,4 11,6 37,8 20,6 Gesamt 16,0 9,0 17,6 42,6 12,7
233
Gebet und Meditation
Die Forschung AUFBRUCH© konnte diese Dimensionen der Religiosität nicht untersuchen, aber
es gibt andere Forschungen, die darüber ein statistisch sicheres Bild zeichnen lassen.369 Da wir
uns vor allem mit der säkularen Kultur beschäftigen, greife ich zwei Länder heraus: Tschechien
für die stark säkularisierten und Ungarn für die einigermaßen säkularisierten Länder.
Gebet und Meditation sind Grundbedürfnisse der Menschen – unabhängig von der konkreten
Religion, der jemand anhängt. Unter Gebet versteht man eher eine innere Tätigkeit, eine Hin-
wendung zu Gott (im Sinn einer Religionsgemeinschaft), wogegen wir unter Meditation dieselbe
innere Bewegung aber ohne einer solchen Gemeinschaftscharakter verstehen. In einer säkulari-
sierten Kultur wird weniger gebetet, schon eher meditiert.
Land oft nie Gebetshäufigkeit Tschechien 12 61 Ungarn 26 38 Meditation Tschechien 33 65 Ungarn 57 42
TABELLE 4: Gebetshäufigkeit in Ungarn und Tschechien (in Prozent)
Es ist also diesbezüglich auch die Frage offen, ob unter dem Begriff „Gebet“ nicht das kirchliche
Meditationsangebot zu verstehen sei und unter dem Begriff „Meditation“ eine nichtkirchliche
oder kirchenfreie Angelegenheit. Wenn dies zutrifft, dann unterstützt dieser Befund die allgemei-
ne These, dass in Europa nicht die Religiosität als solche im Verschwinden ist, sondern ihre insti-
tutionelle Vermittlung im Zuge der Individualisierung und Entinstitutionalisierung modernen
Lebens schwächer bzw. anders geworden ist.
Transzendenz
In diesen beiden Beispielländern Tschechien und Ungarn zusammengenommen ist es interessant
zu beobachten, dass selbst solche Menschen, die sich gar nicht oder einigermaßen nichtreligiös
bezeichnen, dennoch eine Glaubenswelt besitzen, in der Spuren einer transzendenten Dimension
entdeckt werden können. Bei der Beurteilung dieser Glaubenswelt ist es wichtig zu betonen, dass
die Deutung der Glaubenssätze von nichtreligiösen Menschen wahrscheinlich eher nicht aus der
Tradition der christlichen Kirchen genommen wird. Die Inhalte dieser Glaubenssätze sind eher
synkretistischer, manchmal fernöstlicher Herkunft und/oder vielleicht Reaktion auf ein einseitig
materialistisches Welt- und Menschenbild.
369 Ich denke vor allem an die rägelmäßig durchgeführte Europäische Wertestudie. Ich kann mich hier an die Studie von 1990 stützen. Vgl. Zulehner/Denz, Wie Europa lebt und Glaubt.
234
Christliche Glaubenssätze werden von den Nichtreligiösen fast gar nicht geglaubt. Hingegen
finden Seele, Wunder, Zukunftsvoraussage und Heilung durch Handauflegung selbst bei Nichtre-
ligiösen Zustimmung.
Glaube daran
Teufel 3 Hölle 2 Himmel 5 Seele 28 Wunder 16 Zukunftsvoraussage 16 Heilung durch Handauflegung 17
TABELLE 5: Zustimmung zu Glaubenspositionen
Wenn also in den ganz oder teils säkularisierten Ländern nach religiösen Themen gesucht werden
soll, die vermutlich eine breite gesellschaftliche Öffentlichkeit interessieren, dann bieten beson-
ders die esoterischen Themen dazu eine gute Gelegenheit. Christen und Kirchen sollten sich da-
von nicht abschrecken lassen und besonders nicht zuzulassen, dass diese Themen nur durch Wer-
bemacher, neue Gurus und esoterischen Schulen besetzt werden. Die christliche Tradition des
Mittelalters bietet genügende Anhaltspunkte dazu, dass über solche Themen der Mystik die ori-
ginell christliche Botschaft vermittelt werden kann. Die Christen können bei diesen Themen den
Menschen auch intellektuelle Mittel dazu vermitteln, wie sie ihre seelischen Bedürfnisse unter
Warnung ihrer Würde und Autonomie befriedigen können. Die Kirchen können dabei auch ler-
nen, dass nicht nur die intellektuellen und/oder moralischen Seiten des Evangeliums verkündet
werden müssen, sondern auch die geistigen und psychischen Tiefdimensionen der selben Bot-
schaft eine Rolle spielen.
Wertestruktur der Nichtreligiösen
Unabhängig von der Religion und von der Kirche wurde auch danach gefragt, was im Leben
wichtig ist. Die Liste der befürworteten Werte zeigt nur die am meisten wichtigen und die am
wenigsten wichtigen Werte.370 Die führenden befürworteten Werte sind für die Nichtreligiösen
„Verantwortung haben“ und „andere achten“. Im Vergleich zur Wertehierarchie der Religiösen
sieht man, dass die Nichtreligiösen etwas mehr verantwortungsfreudig sind, aber die Religiösen
370 Es wurden die Prozentsätze der ersten und zweiten von fünf Antwortmöglichkeiten addiert. Wichtige Werte Nichtreligiöse Schnitt Religiöse Verantwortung haben 42 40 36 andere achten 40 42 44 Das Eigene teilen 5 5 5 sparsam sein 4 5 7 andere Sitten akzeptieren 3 2 1
235
sind etwas mehr bereit die anderen zu achten. An der letzten Stelle der Wertestruktur der Nichtre-
ligiösen stehen die Werte „das Eigene teilen“, „sparsam sein“ und „andere Sitten zu akzeptieren“.
Die Unterschiede zur Wertewahl der Religiösen ist dabei auch nicht sehr groß. Sie sind genauso
(wenig) solidarisch gestimmt als die Religiösen, wollen aber weniger sparsam sein. Die Religiö-
sen sind noch weniger bereit, andere Sitten zu akzeptieren, als die Nichtreligiösen.
Aus dieser kurzen Einsicht in die Wertestruktur der mehr säkularisierten Gesellschaften ergibt
sich für die Christen und Kirchen, dass eine scharfe oder pointierte Gegenüberstellung in der
Frage der Moralitäten nicht der vorfindbaren Meinungslage entspricht. Die Kirchen müssen dar-
über nachdenken, warum ihre Gläubigen bei der Übernahme von Verantwortungen schüchterner
sind als die Nichtgläubigen. Es kann damit zusammenhängen, dass lange Zeit die Christen in
diesen Ländern nur sehr begrenzt in der Lage waren, überhaupt gesellschaftliche Verantwortun-
gen zu übernehmen. Andererseits ist es zu bedenken, ob die Verkündigung der Kirchen nicht
einen Nachholbedarf hat in der Schöpfungstheologie, wonach die ganze Schöpfung von dem
Schöpfer in die Verantwortung der Menschen gestellt wurde. Dasselbe gilt für die Lehre des
Zweiten Vatikanischen Konzils, wo die Kirche besonders die Laien aufgefordert hat, mit allen
ihren Kenntnissen und Fähigkeiten am der Aufbau einer besseren Welt mitzuarbeiten. Sie sollen
dies im Bewusstsein zu tun, dass für sie die Nachfolge Jesu auch in der Übernahme dieser weltli-
chen Aufgabe bestehe.
Eine moralische Überheblichkeit der Christen ist unbegründet. Sie müssen mit ihren nichtgläubi-
gen Landsleuten gemeinsam die Wichtigkeit der Werte der Solidarität neu entdecken und sie
gemeinsam mit ihnen einzuüben.
Kirchenerwartungen der Nichtreligiösen
Die Nichtreligiösen wünschen demnach, dass sich die Kirche zu den sozialen Problemen äußert
und sie wünschen nicht, dass sie sich mit den moralischen Problemen der Einzelnen beschäftigt.
Eine dritte Gruppe der gefragten Themen umfasst die Fragen der Regierungspolitik und der Me-
dien. Die Zustimmung zu dieser Thematik kann vor allem durch die allgemeine Politikverdros-
senheit der Region erklärt werden. Die allgemeine Erwartung gegenüber den Kirchen ist (nicht
nur bei den Nichtreligiösen), dass sie eine Alternative zum Bereich der Politik – wahrscheinlich
ist Parteipolitik die Medien, die diese Welt darstellen und teils auch konstruieren. gemeint –
bieten, da die Politik eine Ort der Sünde, der Lüge und der Korruption sei.
Der Ort, wo sich die Kirche im intellektuellen Raum in einer stark säkularisierten Kultur positio-
nieren kann, ist neben der esoterischen Dimension die Frage der Gerechtigkeit der Welt. Eine
theologische Interpretation dieses statistischen Befundes ist durch die Erinnerung an die prophe-
tische Tradition der jüdisch-christlichen Verkündigung fundiert. Die mächtigen Prophetengestal-
236
ten des Judentums inklusive des Rabbi Jesus, den Messias, prangerten die soziale Ungerechtig-
keiten ihrer Zeit an. Sie wollten die religiös-nationale Identität ihres Volkes dadurch stärken, dass
sie sich für eine größere Gerechtigkeit stark machten. Aus dieser gesellschaftspolitischen Option
haben sie die privaten Moralitäten hergeleitet und begründet. Sie verkündeten eine Kultur der
Solidarität, ohne Volkschauvinismus. Sie haben das Augenmerk der Mächtigen auf die Armen,
Fremden, Witwen geleitet. Heute würden wir in den Reformländern sagen können: Sie haben für
die Rentner, Arbeitslosen und Zigeuner optiert.
AUSBLICKE
Zusammenfassend können wir sagen, dass es in den Reformländern in Ost(Mittel)Europa nur
wenige Atheisten gibt. Aber es gibt einige Länder, die stark säkularisiert sind. Für diese Länder
kann die Kirche eine Pastoral entwickeln, die einerseits den freien geistigen Innenraum der Indi-
viduen wahrnimmt, und die andererseits empfindlich für die soziale Sünde ist. Diese Akzentset-
zung ist keineswegs Anpassung an die Welt, sondern die Beachtung der Bedürfnisse der Men-
schen. Die oben dargestellten Themenbereiche bestimmen in sich nicht die Inhalte der Verkündi-
gung, sondern sie zeigen Dialogfelder auf, wo die Kirche ihre Botschaft anbieten kann.
Die ost(mittel)europäischen Kirchen waren in ihrer Geschichte unter der kommunistischen Herr-
schaft in kleine Nischen und gesellschaftliche Ghettos verwiesen worden. Für sie war es theore-
tisch und praktisch untersagt, evangeliumsgerecht über die soziale Problematik zu reden. Dar-
um – und auch durch eine moralisierende Auffassung des Verkündigungsauftrages –
konzentrierten sie sich auf das Privatleben und auf die Privatmoral. Dadurch förderten sie selber
die Privatisierung des Glaubens. Plakativ ausgedrückt: Sie konnten und haben aus den Konzils-
dokumenten eher Sacrosanctum concilium und Lumen gentium rezipiert und umgesetzt, Gaudi-
um et Spes und Dignitatis humanae dagegen kaum. Nach der politischen Wende haben sich in
der Kirche die vielfältigen charismatischen und geistlichen Bewegungen ausgebreitet, die weithin
dieser Privatisierung entsprachen. Die Kirche waren vorrangig damit beschäftigt, ihre rechtliche
und finanzielle Stabilität zurückzugewinnen. Nach zehn Jahre politischer Freiheit ist die Zeit
gekommen, diese administrativ nützliche Aufgabe zu beenden und in der Öffentlichkeit die Sozi-
allehre der Kirche, ihre Option für mehr Gerechtigkeit und Solidarität bekannt zu machen.
Die esoterischen und die sozialethischen Themen stehen einander ziemlich fern. Es gibt eine
negative Korrelation zwischen den beiden. Je esoterischer, desto weniger sozial ist die Haltung
eines Menschen und umgekehrt. Die Kirchen werden hier zu eine Korrektur drängen. Die Einheit
von Personalität und Sozialität ist ein wichtiger und heute besonders aktueller Bestand der christ-
lichen Soziallehre. Die christliche Anthropologie sieht den Menschen als ein sozial vernetztes
Individuum und schützt gleichzeitig die Würde der Person in der Gesellschaft. In Lehre und Pra-
237
xis sollte die Kirche diese zwei Dimensionen wieder miteinander verknüpfen, um in den heutigen
säkularen Gesellschaften das ganze Evangelium wirksam verkünden zu können.
238
OSTERWEITERUNG DER EU UND KIRCHE
In dem folgenden Beitrag versuche ich aus der Sicht eines ost-(mittel)europäischen Theologen
die Rolle der (katholischen) Kirche in den Gesellschaften Ost(Mittel)Europas an der Türschwelle
der Osterweiterung der Europäischen Union zu beschreiben. Näher geht es darum, die sogenann-
ten europäischen Werte, die von der EU vertreten werden, in der Wertestruktur der heutigen Kul-
turen Ost(Mittel)Europas zu suchen und die Einstellung der Kirche in diesen Ländern zu diesen
Werten zu evaluieren. In den päpstlichen Dokumenten über die vorrangige Rolle der Kirche bei
diesem Prozess wird betont, die Kirche soll die Werte des Evangeliums in Europa vertreten. Die
Verkündigung und die Theologie in Ost(Mittel)Europa ist herausgefordert den europäischen
Wertekanon und die Wertekollisionen wahrzunehmen, will sie ihre Aufgaben in den heutigen
Gesellschaften dieser Länder ernstnehmen.
Im ersten Schritt wird der Begriff „Wertegemeinschaft“ beschrieben, um dann in einem zweiten
Schritt einige Diskussionsfragen bezüglich der Korrelation zwischen Wertegemeinschaft und
Osterweiterung zu stellen. Abschließend wird danach gefragt, wie die Kirchen in den Reformge-
sellschaften zur Werten der europäischen Wertegemeinschaft stehen. Theologisch gesprochen
geht es dabei um die Frage, ob die Kirche dieser Region im Prozess der Osterweiterung die „Zei-
chen der Zeit“ als Kairos für ihre Repositionierung und für ihre innere Revitalisierung erblickt.
Es soll eine eingrenzende Bemerkung vorausgeschickt werden. Mit dem Thema EU und Oster-
weiterung beginne ich mich erst seit Kurzem zu beschäftigen. Auf einem Intensivkurs zu diesem
Thema – organisiert durch die IZ und durch das EZFF Tübingen371 – wurde ich ermutigt, meine
dortigen Erwägungen weiterführen. Ich hatte zudem die glückliche Gelegenheit, die nachstehen-
den Gedanken einmal in Bonn mit der Gesellschaft für Politologie und einmal in Berlin in einem
EU-Seminar zu diskutieren. Wichtige theologische und auch sozialwissenschaftliche Anregungen
habe ich beim Renovabis Kongress 2001 in Freising vor allem durch die Erwägungen des Wiener
Pastoraltheologen Paul M. Zulehner bekommen. Eine etwas tiefer liegende Quelle dieser Interes-
sen ist ein Forschungsprojekt, das in diesem Buch schon mehrmals zitiert worden ist und das ich
auch im Folgenden mehrmals erwähnen werde. Das internationale Großprojekt AUFBRUCH©
beforscht seit 6 Jahren die Entwicklung der Religiosität und die Positionierung der Kirchen in
zehn postsozialistischen Ländern Europas während des Kommunismus sowie deren Repositionie-
rung nach der Wende 1989/91. Ich durfte den qualitativen Teil dieses internationalen Projekts
koordinieren und die Erhebung vielen Daten sowie das gemeinsame Gewinnen wichtiger Ein-
sichten Schritt für Schritt begleiten.
371 Internationales Zentrum der Universität Tübingen und Europäisches Zentrum für die Föderalismusforschung in Tübingen.
239
WERTEGEMEINSCHAFT
Ich möchte meine Ausführungen mit einem Zitat von Vaclav Havel eines Tschechen beginnen,
der in seinem Vorwort zur Charta der Europäischen Identität ein typisch mitteleuropäisches Bild
über die Wertegemeinschaft gemalt hat.
„Die Europäische Union beruht auf einem großen Ensemble zivilisatorischer Werte, deren Wur-
zeln zweifellos auf die Antike und das Christentum zurückgehen und die sich durch zwei Jahrtau-
sende hindurch zu jener Gestalt entwickelt haben, die wir heute als die Grundlagen der moder-
nen Demokratie, des Rechtsstaates und der Bürgergesellschaft begreifen. Das Ensemble dieser
Werte hat sein klar umrissenes sittliches Fundament und seine manifeste metaphysische Veranke-
rung, und zwar ungeachtet dessen, inwieweit der moderne Mensch sich das eingesteht oder
nicht.“372
Große Worte haben viele Bedeutungen und wecken immer die Frage, wer hat das Recht, sie zu
bestimmen – und wie war mit diesem Recht umgegangen worden und geht man heute damit um.
Der Begriff „Wert(e)gemeinschaft“ kann historisch ausgelegt werden, was für uns hier nicht die
Aufgabe ist. Er muss vielmehr praktisch ausgelegt werden als Wegweiser in kulturellen, politi-
schen und auch kirchlichen Diskussionen über die Zukunft der Reformgesellschaften, aber auch
ganz Europas.
„Europa ist vor allem eine Wertegemeinschaft. Das Ziel des europäischen Einigungswerkes ist
die Bewahrung, das Bewusst machen, die kritische Überprüfung und die Fortentwicklung dieser
Werte. Die europäischen Grundwerte liegen in dem Bekenntnis zu Toleranz, Humanität und Brü-
derlichkeit. Aufbauend auf den geschichtlichen Wurzeln der Antike und des Christentums hat
Europa im Laufe der Geschichte mit der Renaissance, dem Humanismus und der Aufklärung die
überkommenen Werte weiterentwickelt. Dies führte zu einer demokratischen Ordnung, der all-
gemeinen Geltung der Grund- und Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit...
Europa hat seine eigenen Werte immer wieder in Frage gestellt und gegen sie verstoßen. Nach
einem Zeitalter eines hemmungslosen Nationalismus, des Imperialismus und des Totalitarismus
sind die Europäer daran gegangen, Freiheit, Recht und Demokratie zum Prinzip ihrer zwischen-
staatlichen Beziehungen zu machen.“ 373
In dieser Charta wird noch erwähnt, dass zu diesen Werten wichtige Schritte waren: die Konven-
tion der Menschenrechte und die Grundfreiheiten von 1950, die Gemeinschaftscharta der sozia-
len Grundrechte von 1989 und die Schaffung einer europäischen Unionsbürgerschaft.
372 Im Vorwort von: Václav Havel zur CHARTA DER EUROPÄISCHEN IDENTITÄT (http://www.europa-web.de/europa/02wwswww/203chart/chartade.htm)
373 Charta der Europäischen Identität, 1995.
240
Die Berufung in dieser Charta auf die grundlegenden Werte hat nicht zuletzt der Präfekt der
Glaubenskongregation Joseph Kardinal Ratzinger mehrmals unterstrichen. „Insofern ist hier we-
sentlich christliches Erbe in seiner besonderen Art von Gültigkeit kodifiziert. Dass es Werte gibt,
die für niemanden manipulierbar sind, ist die eigentliche Gewähr unserer Freiheit und menschli-
cher Größe; der Glaube sieht darin das Geheimnis des Schöpfers und der von ihm dem Menschen
verliehenen Gottebenbildlichkeit. So schützt dieser Satz ein Wesenselement der christlichen
Identität Europas in einer auch dem Ungläubigen verstehbaren Formulierung.“374
Nach den oben zitierten Dokumenten sind die europäischen Werte politische Werte. Europa be-
deutet aber in Ost(Mittel)Europa nicht nur, vielleicht gar nicht in erster Linie eine politische Ver-
änderung, sondern eine politisch gesicherte Hoffnung auf einen höheren materiellen Wohlstand.
Ganz simplifiziert ausgedrückt, Europa bedeutet, dass man ein eigenes Telephon hat, dass man
ein besseres (sprich ein westliches) Auto fahren kann usw. Die Grundeinstellung zur EU in die-
sen postsozialistischen Ländern hängt vor allem davon ab, wie diese seit zehn Jahren befreiten
Menschen ihre wirtschaftliche Lage und Zukunft beurteilen. Mehrere Studien über die neuen
Bundesländer haben schon den engen Zusammenhang zwischen Wohlstand und Demokratie
ausgearbeitet.
„Im Osten wie im Westen der Bundesrepublik erschwert eine negative Perzeption der Wirt-
schaftslage die Unterstützung des politischen Systems und seiner Elemente, im Westen allerdings
weniger als im Osten. Dort kommt mit der DDR-Nostalgie ein weiterer integrationshemmender
Faktor hinzu, dessen Bedeutung sich jedoch nicht problemlos bestimmen lässt.“375
Auf die Nostalgie komme ich später noch zurück. Was die integrationshemmende Bedeutung der
Wirtschaftslage in den neuen Bundesländern anbelangt, gilt auch mutatis mutandis für die ande-
ren neuen Länder in der europäischen Völkergemeinschaft.
In den folgenden Ausführungen versuche ich also die postsozialistischen Länder auf diese
Grundwerten Europas hin zu untersuchen. Ich beginne mit den wirtschaftlich-materiellen Seite
und dann komme ich zu den politischen Werten.
„Nicht wie Milch und Honig“
Diesen Untertitel entnehme ich dem Buch, das ich mit dem slowakischen Theologen Pavel
Mikluščák beim Schwabenverlag in der Reihe Gott nach dem Kommunismus veröffentlicht habe.
Es geht dort darum, wie die Kirchen in der neuen Freiheit der jungen Reformdemokratien ihre
gesellschaftlichen Positionen suchen und welche Änderungen in der Kircheninnenarchitektur von
374 Die Zeit 50/2000. 375 Gabriel, Anpassung.
241
dieser neuen Freiheit her provoziert werden. Die Grundeinstellung der Menschen in unseren
Ländern ist eine Enttäuschung bezüglich der wirtschaftlichen Früchte der neuen Freiheit.
Es gibt nur zwei Länder, wo die Mehrheit der Befragten der Meinung war, dass ihr Einkommen
ausreicht, um damit ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können: Slowenien und Tschechien. In
mehreren Ländern überwiegen die Menschen mit (zu) niedrigem Einkommen.
In der Hälfte der Länder überwiegt die Meinung, dass der Wohlstand in den nächsten fünf Jahren
zurückgehen wird. Drei Länder – Kroatien, Polen und die Ukraine – weisen eine deutliche An-
zahl an Menschen auf, welche die Hoffnung pflegen, dass ihr Wohlstand in fünf Jahren viel bes-
ser sein wird.
Diese kurzen Einblicke in die Meinungslage bezüglich der wirtschaftlichen Lage gestatten die
Verwendung des biblischen Bildes des langen Wüstenweges des Volks Israel nach dem Auszug
aus der Sklaverei in Ägypten auf dem Weg ins gelobte Land Kanaan: „Nicht wie Milch und Ho-
nig“. Aus dieser Perspektive kann man die vorsichtige These formulieren: Die politischen Werte
Europas werden in Ost(Mittel)Europa umso mehr respektiert werden, je mehr sich der Wohlstand
in diesen Ländern stabilisiert. Plakativ: Je mehr Wohlstand, desto engere Wertegemeinschaft mit
der EU.
Kommunismus-Nostalgie
Die Untersuchungen des Projekts AUFBRUCH© zeigen, dass in einigen Ländern der Region eine
beachtlich starke Kommunismus-Nostalgie anzutreffen ist. Da die oben aufgelisteten EU-Werte
im Kommunismus nicht geduldet und praktiziert waren, kann man vorsichtig die These voraus-
schicken: je mehr Kommunismus-Nostalgie, desto weniger Wertegemeinschaft mit den EU-
Ländern.
Auf die Frage, wann waren die Menschen am meisten glücklich, haben viele Befragten die Peri-
ode nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Wende angegeben, was in der Forschung dann – die
allgemeine Bezeichnung in Ost(Mittel)Europa folgend – als kommunistische Periode identifiziert
wurde. Es ist hier nicht möglich bezüglich der Diskussion Stellung zu nehmen, ob diese Wort-
wahl politisch sachgerecht oder politisch überhaupt korrekt ist und wenn ja, unter welchen Ein-
grenzungen. Es ist aber auch nicht nötig, da es hier darum geht, dass eine bedeutende Zahl der
Menschen nicht nach der Wende, also in der demokratischen Periode glücklich ist.
Hiernach pflegt also die Hälfte der Befragten in Ost(Mittel)Europa eine näher nicht bestimmte,
allgemeine Nostalgie nach der Zeit vor der Wende. Das Bild differenziert sich, wenn man die
selbe Frage nach Ländern analysiert.
242
Die Länderdaten zeigen, dass diese Kommunismus-Nostalgie vor allem in den Ländern Ukraine,
Slowakei und Ungarn stark ist. Immerhin bleibt aber klar, dass in der Mehrzahl der Länder Glück
nicht nach der Wende eingetroffen ist. Diese Einsicht unterstützt die vorhin schon erwähnte The-
se, dass in vielen Ländern Ost(Mittel)Europas mit der Freiheit nicht die glücklichste Periode
eingetroffen ist. Dieser Zusammenhang erklärt auch die Einstellung zu den politischen Werten:
Demokratie, Freiheit und Menschenrechte.
Demokratie
New Democratic Barometer hat 1993 in zehn postsozialistischen Ländern untersucht, was die
Menschen vom neuen politischen System halten. Die Frage wurde so gestellt, dass das heutige
politische System nicht als „Demokratie“ angegeben wurde, aber das vorherige System mit
„communist“ genannt wurde. Die Antwortlage zeigt, dass in einigen Ländern ziemlich viele mei-
nen, diese zwei Systeme seien identisch.
BG CZ H PL RO SK SLO HR UKR UA Viel besser 52 31 32 30 39 22 12 21 14 13 Etwas besser 37 43 27 40 41 40 41 32 25 29 Gleich 0 23 37 23 18 33 39 38 46 47 Etwas schlechter 8 3 4 5 1 4 7 6 12 9 Viel schlechter 3 1 1 2 1 2 1 3 3 3
TABELLE 6: Wertschätzung des neuen politischen Systems (Quelle: Eurobarometer 1993)
In keinem Land wird Kommunismus als ein besseres System als das heutige wahrgenommen.
Alle Länder meinen, dass das heutige System doch wesentlich oder mindestens etwas besser sei
als der Kommunismus. Interessant ist aber die Meinung, wonach beide Systeme identisch seien.
Diese Meinung führt vor allem in der Ukraine, in Weißrussland, sowie in Kroatien und Ungarn.
Aber außer Bulgarien erhält diese Meinung überall ziemlich hohe Zustimmung.
Für unsere Fragestellung bedeutet dies, dass in dieser postsozialistischen Region die politischen
Werte, wie sie in den betroffenen Ländern wahrgenommen werden können, signifikant nicht
eindeutig von dem früheren System unterscheiden werden. Aber alle diese neuen politischen
Systeme der Region berufen sich auf Europa, auf die Demokratie und auf die Freiheit und versu-
chen sie sich damit zu legitimieren. Obwohl die heutige Politik in diesen Ländern ja oftmals weit
weg von der eingeübten Demokratien der EU-Länder liegen, werden dennoch auf der Legitimati-
onsebene diese politischen Werte dauernd betont. Die Meinungen beziehen sich also indirekt
auch auf diese Ideologie.
Die oben genannte Forschung hat in den Jahren 1992, 1993 und 1995 verschiedene Typen der
Demokraten in der Region Ost(Mittel)Europas festgestellt. In der Werteskala der Forschung
243
wurden die Werte „demokratisch“ und „autoritär“ einander gegenübergestellt. Für die ganze
Region kann man auf Grund der erhobenen Daten über eine stabile Lage bezüglich der Einstel-
lung zur Demokratie reden.
1992 1993 1995 Confident democrats 57 53 59 Anxious democrats 19 19 14 Hopeful authoritarians 16 19 16 Dejected authoritarians 9 9 11
TABELLE 7: Politische Typologie 1992-1995 (Werte sind Prozentwerte) (Quelle: New Democratic Barometer 1995)
Die Demokraten – ob mit Vertrauen oder mit Besorgnis, sei dahingestellt – überwiegen in dieser
Region klar. Interessant kann sein, dass in einigen Ländern der Anteil der hoffnungsvollen De-
mokraten erheblich größer geworden ist, während er in den anderen Ländern stabil geblieben ist.
Einen Rückfall weist nur die Ukraine auf.
BG CZ H PL RO SK SLO HR UKR UA Democrats 1992 54 57 64 32 66 61 82 66 45 49 Democrats 1993 54 65 60 42 62 58 0 63 40 37 Democrats 1995 63 73 65 34 82 59 76 66 46 30
TABELLE 8: Demokraten in Osteuropa 1992-1995 (Quelle: New Democratic Barometer 1995)
In den Jahren 1991 und 1995 wurde zudem gefragt, was die Menschen vom politischen Wechsel
in Ost(Mittel)Europa halten. Die Antworten wurden nach den politischen Typen geordnet. Dem-
nach ist zu sehen, dass in einigen Ländern die Demokraten die erlebte Demokratie zwischen 1991
und 1995 mehr, in anderen Ländern weniger bejahen können. Unabhängig davon, was man De-
mokratie oder Demokrat nennt, sind hier die innere Zusammenhänge und Erwägungen der „real
existierenden Demokratien“ Ost(Mittel)Europas zu beobachten.
Besonders klar ist die Vergrößerung der Zustimmung der Demokraten zum realen politischen
System ihres Landes in jenen Ländern, die als erste in den Wartesaal der EU stehen: Polen und
Slowenien. Im Jahr 1995 erreichte Polen den Grad Tschechiens. Beeindruckend ist allerdings,
dass in Ungarn, das oft als Sieger der Umstellung genannt wurde, die Bejahung des Systems von
den Demokraten von Anfang an niedrig ist und in den beforschten fünf Jahren noch niedriger
geworden ist. Das kann vielleicht auch an der besonderen Strenge der Ungaren oder an ihrer
weltbekannten Unzufriedenheit liegen.
Bei der Beurteilung des Wertes „Demokratie“ kann die Einschätzung der Rolle des Parlaments
und der politischen Parteien von Bedeutung zu sein. In dieser Region Ost(Mittel)Europas wird
deren Rolle stabil positiv beurteilt. Auf die Frage: „Manche Menschen meinen, dass ihr Land
244
besser geleitet wäre, wenn die Arbeit des Parlaments suspendiert wäre und man nicht mehr die
vielen politischen Parteien habe. Wie gerne würde sie das in den nächsten Jahren gesehen?“
1991 1995 Sehr gerne 5 5 Vielleicht 26 25 Nicht gerne 38 42 Keineswegs 32 29
TABELLE 9: Wertschätzung politischer Institutionen 1991 und 1995 in Ost(Mittel)Europa (Quelle: Eurobarometer 1998)
Diese Stabilität ist bemerkenswert, da in mehreren Ländern der Region eine demokratische
Staatsform erst nach dem Fall der Mauer aufgebaut wurde.
Zusammenfassend kann man vorsichtig sagen, dass die Bürger der neuen Demokratien größten-
teils und grundsätzlich den Wert der Demokratie bejahen. Allerdings zeigen die Vergleiche mit
dem früheren Staatssystem oder mit den Werten aus der näheren und/oder ferneren Vergangen-
heit Unsicherheiten auf. Dieser Zusammenhang möge Politiker und Protagonisten der Meinungs-
bildung darauf aufmerksam machen, dass allzu starke Gegenüberstellungen von politischen Sy-
stemen in dieser Region besonders große Polarisierungen innerhalb dieser Region provozieren
kann.
Freiheit
Der zweite Wert der EU, der in den Reformländern geprüft werden soll, ist die Freiheit. Viele
politische Bezeichnungen der Veränderungen in diesen Ländern geben den Grundton an, etwa:
Weg in die Freiheit, Befreiung, Länder der neuen Freiheit usw. Die politischen Konstellationen
dieser Länder haben sich tatsächlich rasch und tiefgreifend verändert. Das politische System
wurde auf Demokratie umgestellt, die durch freie Wahlen, freie Medien, Sicherung der Freiheits-
rechte erreicht wurde. Diese Freiheiten sind unwiderruflich.
Freiheit kann aber vieles bedeuten. Freiheit hat in diesen Gesellschaften der Reformländer eine
ziemlich einheitlich starke Betonung, insofern sie die Freiheit der Nation betrifft. Aus der Ge-
schichte des 19. Jahrhunderts wissen wir, dass all diese Länder unter einer fremden Herrschaft
gelebt haben. Ihre Staatlichkeit mussten sie im Gegenwind entwickeln und bewahren. Ihre
Kämpfe für die nationale Freiheit konzentrierte sich vor allem auf zwei Kristallisationspunkte:
nationale Autonomie und Freiheit der nationalen Sprache. Nation und Kultur wurden angesichts
mehrheitlicher Ethnien errungen, was in einzelnen Staaten größere Ausgrenzungen verursacht
hat. Die Problematik der ethnischen Minderheiten gehört zu den schwerwiegenden Problemen
der Region. Wenn also in den Gesellschaften von Ost(Mittel)Europa Freiheit gesagt wird, klin-
gen diese kulturelle Hintergründe der nationalen und ethnischen Unabhängigkeit mit. Demge-
245
genüber wird Freiheit in den Gesellschaften von Westeuropa mehr als Freiheit der Person ausge-
legt.
In diesem Sinne äußerte sich der ungarische Kultusminister in einem Interview über die Frage
der europäischen Identität. Seine Aussagen zeigen, dass selbst bei einer eleganten Formulierung
eines belehrten Ministers die Zentrierung auf die nationale Kultur durchschlägt.
„Es ist eine Frage, ob Europa überhaupt eine kulturelle Identität besitzt, oder eher die Nationen,
die hier leben, einen besonderen kulturellen Charakter besitzen. Ich bin überzeugt, dass die eu-
ropäische Kultur so lange europäisch bleiben kann, solange eine lateinische, mitteleuropäische,
mediterrane, germanische, slawische und skandinavische Kultur existiert und in diesen Regionen
eine französische, portugiesische, irische, ungarische, deutsche, österreichische und slowenische
Identität.“376
Im Jahr 1995 wurde in den neuen Reformländern die Identitätsfrage untersucht.377 Die Daten
zeigen, was für eine wichtige Rolle die nationale Identität spielt. Es genügt hier nur den Durch-
schnitt zu zeigen.
Integral nationale 34 Lokale, regionale 28 Vor allem national-staatliche 22 Europäische 11 Andere 6
TABELLE 10: Verständnisse nationaler Identität (Quelle: New Democratic Barometer 1995)
Man sieht, dass das Verständnis von Identität sich vor allem auf die – so oder so verstandene –
nationale Identität konzentriert. Das ist eine eindeutige kulturelle Bestimmtheit dieser Region,
die einen sehr hohen Erklärungswert bei vielen politischen Aktivitäten und Einstellungen besitzt.
So auch beim Verständnis von Freiheit, worauf jetzt näher eingegangen werden soll.
Bei den regelmäßigen Berichte über die Prozesse in den Staaten, die sich der EU anschließen
wollen, werden unter politischen Freiheiten einige Aspekte überprüft: die bürgerlichen und poli-
tischen Rechte, wirtschaftliche Rechte, soziale und kulturelle Rechte, Minderheitenrechte und
Minderheitenschutz. Hier können wir nicht alle Bereiche hinsichtlich der Wertegemeinschaft und
der Osterweiterung analysieren. Es können lediglich einige Aspekte hervorgehoben werden, die
für ein Weiterdenken anregen sollen.
Die Forschung AUFBRUCH© hat die Frage gestellt: „Die viele Freiheit, die heute die jungen
Menschen haben, ist sicher nicht gut.“. Diese Frage bezieht sich zwar in erster Linie nicht auf die
376 Rockenbauer, Interview. 377 Vgl. New Democracies Barometer Website (Surveys in Eastern Europe): http://rs2.tarki.hu:90/ndb-html/
246
politische Freiheit der Gesellschaft, sondern eher auf eine Qualität der Erziehung, kann dennoch
einen Einblick in die allgemeine Einstellung der Menschen zum Wechselspiel Freiheit versus
Autorität geben. Viele Untersuchungen bezeugen, dass die Einstellung zu dieser Frage eine ziem-
lich hohe Korrelation zu anderen Freiheitsthemen aufweist. Ich stelle die unterschiedlichen Hal-
tungen mit Hilfe des „Index Autoritarismus“378 dar:
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Deutschland Ost
Kroatien
Slowakei
Tschechien
Ungarn
Slowenien
Litauen
Ukraine
Rumänien
Polensehr schwach
schwach
stark
sehr stark
Abbildung 3: Autoritarismus in postkommunistischen Ländern (Quelle: AUFBRUCH© 1998)
In einigen Ländern neigen die Menschen eher zum Autoritarismus, in anderen Ländern eher zur
Freiheitlichkeit. Besonders Kroatien und die Ukraine sind deutlich näher zum Autoritarismus,
und entgegen vielen Vorurteilen z.B. Rumänien näher zur Freiheitlichkeit.
Zu der Akzeptanz der Freiheit gehört ein sehr wichtiger, in vielen hochrangigen EU-Dokumenten
erwähnter Aspekt: die Rechte der Ausländer. In Ländern, die an ihrer Grenze ein Schild mit dem
Text aufstellen: „Das Boot ist voll.“ werden auch die Freiheiten der Einheimischen anders gese-
hen als in Ländern, die mit den Fremden in vieler Hinsichten loyaler umgehen können. Damit
will keineswegs geleugnet werden, dass die Problematik des Minderheitenschutzes die Regierun-
gen und die Bürger eines jeden europäischen Landes – jetzt nur geographisch gemeint –belastet.
Es soll lediglich auf den engen Zusammenhang zwischen den Freiheiten der Ausländer und jenen
der Einheimischen hingewiesen werden.
378 Tomka/Zulehner, Religion in den Reformländern 235ff. Zum Zusammenhang von Autoritarismus, Religion und Kirche vgl. Tomka/Zulehner, Religion im gesellschaftlichen Kontext 119ff., Zulehner, Untertan 242ff. und ders., Kehrt die Religion wieder? 261ff.
247
Es wurde in der Forschung AUFBRUCH© gefragt, was die Menschen darüber meinen, dass sich
die Ausländer mit ihrem Lebensstil an den Lebensstil des Gastlandes anpassen sollen. Es gibt
Länder, wo diese Anpassungsanforderung stark verneint wird: in Litauen, in der Slowakei, in
Slowenien und Tschechien. Es gibt hingegen Länder, wo die Bejahung stärker ist: in Kroatien
und in der Ukraine.
Bei der Möglichkeit einer politischen Tätigkeit der Ausländer ist das Bild dem vorherigen ähn-
lich. Vor allem Kroaten würden mehrheitlich diese Tätigkeit untersagen. Aber auch in der Ukrai-
ne und in Rumänien ist diese Position zwar nicht führend, dennoch stark. Gegenüber der politi-
schen Tätigkeit der Ausländer sind Ungarn und Slowenien mehr tolerant. In den Ländern, wo
beide extreme Positionen sehr stark sind, kann man hinsichtlich der Ausländerintegration mit
starken Polarisierungen rechnen. Musterbeispiel dafür sind in dieser Fragestellung die Länder
Rumänien und Slowenien. Die Polarisierung kann vor allem dadurch aktualisiert werden, dass
ein starker politischer Entscheidungsdruck entsteht, wenn das alltägliche Leben der Bürger un-
mittelbar betroffen ist. Eine solche Frage ist z.B. in Rumänien das Verhältnis der Parteien der
ungarischen Minderheit zu den Parteien oder zur Regierungspolitik in Ungarn. Anhand dieser
Fragen polarisiert sich die Gesellschaft und die Machthaber neigen oft dazu, im Interesse der
Stabilisierung der innenpolitischen Lage Freiheiten der Ausländer oder der ethnischen Minder-
heiten stärker zu beschränken.
Zuletzt noch eine sehr persönliche, dennoch sehr relevante Fragestellung, ob es gut ist, dass Aus-
länder mit Einheimischen eine Ehe schließen, also die Problematik der ethnischen Mischehen.
Mehrheitlich gegen solche Ehen sind die Länder Kroatien, Litauen, Slowakei, Slowenien und
Ungarn. Toleranter sind Polen und Tschechien. Diese zwei Ländergruppen können dadurch er-
klärt werden, dass in Polen und Tschechien die ethnischen Minderheiten die kleinste Rolle in der
Region der Reformländer spielen, wogegen z.B. in der Slowakei dieses Problem von eminenter
Bedeutung ist.
Die Lage der Freiheit als EU-Wert in den Ländern Ost(Mittel)Europas kann zusammenfassend
damit abgerundet werden, dass die Frage der Freiheit in den verschiedenen Ländern der Region
ein sehr differenziertes Bild aufweist. Festgestellt werden konnte, dass einerseits der kulturelle
Kontext der Freiheitsfrage in dieser Region eindeutig mit der traditionellen Problematik der na-
tionalen Autonomie verbunden ist und zweitens, dass die weitere Sicherung der politischen Frei-
heiten in diesen Ländern vor allem von einer gelungenen Minderheitenpolitik abhängt.
„Der Nationalstaat wird vorläufig und mittelfristig seine Funktion als Bewegungsrahmen von
Demokratie und Politik behalten, auch wenn es gelingt, nationale Egoismen durch supranationa-
le Strukturen einzugrenzen. Eine nationalstaatlich organisierte Politik muss nicht automatisch zu
einem Rückfall in nationalistische Verhaltensweisen führen, denn ein heterogener Nationalstaat
248
kann, wie Ralf Dahrendorf betont, auch zivilisierende Wirkung haben, wenn er den Prinzipien
der Solidarität und der Weltbürgerschaft verpflichtet ist. Für Deutschland379 heißt das, an die
positiven Traditionen anzuknüpfen: Außenpolitische Selbstbeschränkung und militärischer Ge-
waltverzicht in bezug auf strategische und ökonomische Nationalinteressen, Rechtsstaatlichkeit,
Toleranz, Pluralismus und Schutz von Minderheiten, ökologische Reformpolitik und sozialstaatli-
cher Interessenausgleich.“380
Die Autoren dieses Zitates sehen die Lösung der Problematik der nationalen Egoismen, des Na-
tionalismus in der Vertiefung und konsequenter Einübung der Werte der EU. Auf diesem Weg
sollen die EU-Länder bleiben und auf diesem Weg können die Beitrittsländer den Frieden in
Europa und auch in ihren eigenen Gesellschaften bewahren.
WERTEZUKUNFT
Die Auseinandersetzung mit der Frage der Wertegemeinschaft und der EU-Osterweiterung hat
aus der Sicht von Ost(Mittel)Europa zwei Problembereiche eröffnet, die noch angedeutet werden
sollen. Der erste Problembereich ist der Zusammenhang der Meinungslage und der Jugend. Die
Werteproblematik ist in unseren Ländern eng mit einem Aspekt verbunden, der möglicherweise
für die nächste Generation nicht mehr relevant wird, nämlich mit der Problematik der nationalen
Identität. Die tiefgreifenden Änderungen der Identifizierungen schreiten weiter voran und werden
durch die Osterweiterung noch einen wichtigen Schub bekommen.
Die Generation meiner Kinder kommt in Welt der Erwachsenen in einer Zeit, in der Ungarn zu
EU gehören wird. Sie werden ihre Monatslöhne nicht mehr in Landeswährung erhalten, sie wer-
den keine Grenzkontrolle mehr in Europa erleben, sie werden in ihrer Arbeitsuche ein grenzenlo-
ses Angebot des EU Binnenmarktes vorfinden. Sie werden zu Hause sicher ungarisch sprechen,
aber in der Arbeitswelt und in der Politik werden sie die Sprache des EU-Englisch reden.
Höchstwahrscheinlich wird für sie die Komponente ihrer Nationalität viel weniger bedeuten als
für mich oder für meinen Vater. Anstelle der nationalen Identitäten werden für sie vielleicht eher
regionale Identitäten und u-topische, orts-lose Identitäten Plausibilität haben. Damit wird sich
ihre Grundeinstellung ändert und dadurch auch die Wertelage Europas.
Es können aber auch andere Zeiten kommen, und zwar selbst in den heutigen EU-Ländern, die
durch ein verstärktes Angstgefühl bei der Verteidigung der EU-Grundwerte bestimmt werden.
„Die schwierige Lage jenseits der Grenzen hat für das Leben innerhalb der Union schwerwie-
gende Konsequenzen. Die Menschen haben das Gefühl, auf einer Insel des Friedens zu leben, der
379 Ich glaube auch für die ost(mittel)europäischen Reformländer!
249
aber so gefährdet ist, dass sie um dieses Friedens willen bereit sind, die Augen vor Verstößen
gegen bestimmte Grundrechte und -freiheiten zu verschließen… Die Außengrenzen der Union
säumt eine Phalanx streng bewachter Grenzstationen und Wachtürme, die beklemmende Gefühle
aufkommen lassen. Die geographisch exponiertesten Mitgliedstaaten erwecken zunehmend den
Eindruck von Festungen… Einige Mitgliedstaaten ergriffen aus Besorgnis um ihre Sicherheit
drastische Maßnahmen, so etwa die Wiedereinführung der Todesstrafe für Terroranschläge und
die Verhängung lebenslanger Haft für die Mitwirkung in kriminellen Vereinigungen. Somit
nimmt der ‚europäische Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts’ immer mehr polizei-
staatliche Züge an.“381
Auch die EU ist also mit keinem Mittel davor sicher, dass ihre heutigen Werte auch noch für
Morgen gelten werden. Es kann auch ein Szenario auf die nächste Generation zukommen, wo in
der EU Werte zur Geltung kommen, die noch bei der Eintrittsvorbereitung der Reformländer als
Gründe für eine EU-Abwehr gegolten haben: Menschenrechte, Abschaffung der Todesstrafe usw.
Auf diese Fragen der nächsten Generation kann ich momentan keine Antwort finden. Vielleicht
weil ich ein Theologe bin, muss ich doch bekennen, dass ich bin bezüglich der allgemeinen Sta-
bilität der EU-Werte(gemeinschaft) ein bisschen besorgt. Der Wertekanon der EU entstand viel-
leicht u.a. deduktiv aus (christlich-religiösen und humanistischen) Ideen nach der Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs. Heute aber habe ich den Eindruck, dass sich diese Werte aus den wirtschaftlichen
Zwängen speisen und sobald diese Zwänge sich ändern, werden auch die Werte der EU anders
formuliert, sie also im Endeffekt mitverändert werden.
Ein zweiter offener Problembereich ist die Korrelation der Erweiterung und der Polarität der
Gesellschaften der Reformländer. Wie in den dargestellten Analysen klar zu sehen war, gibt es in
der Region Länder, in denen wegen der Neigung zu extremen Positionen größere Polarisierungen
wahrscheinlich werden. Die EU nimmt immer klarer politische Formationen an, durch welche die
staatlich-nationale Souveränität der Mitgliedsländer teilweise an die EU übertragen wird. Dieser
Aspekt der EU ist in den Beitrittsländern – mindestens was Ungarn betrifft – nicht allgemein
bekannt oder wird politisch bewusst herabgespielt. Wird aber dies mit der Zeit immer klarer,
wird auch die zentrale Identitätsproblematik dieser Länder provoziert und dadurch die innere
Polarisierung dieser Gesellschaften vergrößert. Wenn diese Polarität sich zu einer zu schwierigen
innerpolitischen Problematik entwickelt, könnte sozusagen der „äußere Feind“ - sprich die EU –
als Sündenbock zur Problemlösung herangezogen werden. Ein globaler Affront gegen die EU
beinhaltet auch eine generelle Abwehr der EU als Wertegemeinschaft.
380 Emmerich/Probst, Intellektuellen-Status. 381 http://europa.eu.int/comm/cdp/scenario/scenarios_de.pdf
250
EU-WERTE UND DIE KIRCHE
Die zentralen Werte, die in der europäischen Gemeinschaft als kulturelle Grundlagen angesehen
werden und deren Akzeptanz von allen EU-Kandidaten erwartet werden, sind vor allem Freiheit,
Demokratie und Menschenrechte, aber auch Gerechtigkeit. Diese Werte werden in der Sozialleh-
re der Kirche seit etwa 200 Jahren eingehend betrachtet. Hier soll kein geschichtlicher Rückblick
auf die Entwicklung der Lehre der Kirche bezüglich der genannten Werte gemacht werden. Es ist
aber klar, dass in den Sozialenzykliken der Päpste der vergangenen Jahrhunderte eine entschei-
dende Wende zu beobachten ist: von einer radikalen Abwehr gegen diese Werte zu deren grund-
sätzlichen und zugleich differenzierten Bejahung. Was bei unserer Fragestellung Werte in der EU
und in Ost(Mittel)Europa und die Kirche betrifft, sind die neuesten Enzykliken des Papstes, so-
wie seine Ansprachen anlässlich seiner vielfältigen Pastoralbesuche in den Reformstaaten weg-
weisend für die Kirche und auch für die Theologie. In diesen hochrangigen Schriften des Papstes
wird ein differenziertes Europabild vermittelt, vor allem was die Entwicklungen nach der politi-
schen Wende 1989/1991 betrifft.
Apostasie Europas?
Die erste Vollversammlung der Europäischen Bischöfe im 1991 fand unter dem Zeichen der
Hoffnung und Dank statt. „Eine große Hoffnung hat sich erhoben, Hoffnung auf Freiheit, auf
Verantwortung, auf Solidarität und geistige Werte. In dieser bevorzugten Stunde, in der wir le-
ben, rufen alle nach einer vollmenschlichen Zivilisation. Diese ungeheure Hoffnung der Mensch-
heit darf nicht enttäuscht werden“, sagte der Papst damals noch in seiner Ansprache an der Voll-
versammlung des Päpstlichen Rates für die Kultur.382 Die Enttäuschung ist aber da und auf dem
zweiten Synode mussten die Bischöfe sie wahrnehmen.
Angesichts dieser Enttäuschung gelte es, das Evangelium für Europa erneut zu verkünden. Das
ist die grundlegende Stellungnahme der Europäischen Bischöfe laut dem „Instrumentum laboris“
der Zweiten Sonderversammlung für Europa mit dem Titel „Jesus Christus, der lebt in seiner
Kirche, Quelle der Hoffnung für Europa“.383 „Denn es mangelt nicht an neuen gefährlichen Illu-
sionen und Enttäuschungen, auf die Johannes Paul II. von vornherein hinwies. Unverkennbar
382 Vgl. L’Osstervatore Romano Deutsch Nr. 4/1990, 9. 383 Diese Zweite Sondersynode für Europa tagte vom 1.-23. Oktober 1999. Bis heute gibt es kein Abschlußdokument.
In vorbereitenden Arbeitspapier sind aber laut Einführung die ersten Reflexionen der europäischen Bischöfe einge-arbeitet. So kann man diese Lineamenta als ein grundlegendes und aktuelles Zeugnis der Kirche Europas über Euro-pa von heute betrachten. Doch bleibt auch die Selbsteinschränkung des Dokumentes zu beachten: „Seiner Natur nach ist das Instrumentum laboris ein Arbeitspapier. Es darf keineswegs als Vorwegnahme der Beschlüsse der Syn-odenversammlung gesehen werden, wenn auch der Konsens, der sich in gewissen Punkten aus den Antworten er-gibt, sich zweifellos in den Ergebnissen der Synode niederschlagen wird.“
251
bestehen große Gefahren und Besorgnisse. Gerade diese Mischung von Enttäuschungen, Besorg-
nissen und Gefahren zeigt ein Europa, das scheinbar jede Hoffnung verloren hat.“384
An die Stelle der kulturellen Herrschaft des Marxismus ist die Herrschaft eines undifferenzierten
und tendenziös skeptischen oder nihilistischen Pluralismus getreten. Er ist im heutigen Leben der
Gesellschaft weit verzweigt und führt zu einer stark eingeschränkten Anthropologie, ja nicht
selten zum Verzicht auf jede Möglichkeit von Sinngebung.385 Auf sozialer Ebene zum Beispiel
kann das Phänomen der Globalisierung, weil es oft ausschließlich oder überwiegend vom kom-
merziellen Denken und zum Vorteil der Mächtigen gesteuert wird, Vorbote weiterer Ungleich-
heiten, Ungerechtigkeiten und Ausgrenzungen sein.386 Im kulturellen Bereich „breiten sich eine
Mentalität und Verhaltensweisen aus, die ausschließlich die Befriedigung der eigenen spontanen
Wünsche und der wirtschaftlichen Interessen gelten lassen durch eine irrige Verabsolutierung der
Freiheit des Einzelnen und durch den Verzicht auf jede Begegnung mit einer Wahrheit und mit
Werten, die über den persönlichen Horizont oder den der Gruppen hinausgehen. Obwohl der
aufgezwungene Marxismus zusammengebrochen ist, sind der praktische Atheismus und der Ma-
terialismus in ganz Europa weit verbreitet. Ohne dass sie aufgezwungen und nicht einmal aus-
drücklich genannt werden, leiten sie dazu an, zu denken und zu leben, ,als ob Gott nicht existier-
te’“.387
Ebenso gibt es im Innern der Kirche die Tendenz, alles in Frage zu stellen, so als müsse in ihr in
bezug auf Fragen der Ethik und Glaubenslehre gleichfalls das demokratische Mehrheitsprinzip
gelten. In diesem Gesamtbild wird die Gefahr immer spürbarer, dass durch die Verabsolutierung
und einseitige Bekräftigung einiger Werte und gültiger Prinzipien zum Nachteil anderer die eu-
ropäische Zivilisation in Frage gestellt wird. Wird zum Beispiel die Freiheit verabsolutiert und
aus ihrem Bezug zu anderen Werten wie der Solidarität herausgerissen, kann sie zum Zerfall
unseres Gesellschaftssystems führen. Eine als absoluter Wert beanspruchte Freiheit läuft Gefahr,
die Gesellschaft zu zerstören, die sie hat aufbauen helfen.388
Junge Menschen suchen das religiöse Erleben, aber oft in synkretistischer Wegen, in Symbolen,
die weit weg von der Wahrheit des Evangeliums liegen. Es droht Europa eine formale Entch-
ristlichung, da in manchen Ländern die Zahl der Getauften drastisch und dauernd sinkt. Die Li-
neamenta sprechen sogar über eine „Apostasie Europas“. Die Antwort der Bischöfe ist der Auf-
ruf auf Neuevangelisierung, „eine neue Inkulturation des Evangeliums“.389
384 Instrumentum laboris, 11. 385 A. a. O. 386 Instrumentum laboris, 12. 387 Instrumentum laboris, 13. 388 A. a. O. 389 Instrumentum laboris, 15.
252
Die tieferen Gründe für diese Apostasie sind nach dem Arbeitspapier von 1999 in eine sehr klare
Liste zusammengefasst:390
In der Gesellschaft
• das Entstehen eines Denkens ohne „Sinnfrage“,
• individualistische und kein gemeinsames Ideal und Gemeinwohl,
• Streben nach Autonomie,
• das komplexe Phänomen der Säkularisierung und „Entheiligung“,
• Tendenz zur allumfassenden und alles kontrollierenden Rationalisierung.
In der Kirche
• religiöse Gleichgültigkeit,
• Gleichgültigkeit des Klerus angesichts der Zweifel und Dramen so vieler Men-
schen in Schwierigkeiten,
• geringe Glaubwürdigkeit vieler „Männer der Kirche“,
• Mangel an katholischen Bildungsstätten für Laien,
• mangelhafte Organisation der katholischen Presse.
In einem Vortrag über die Lage der Europäischen Werte hat auch Joseph Kardinal Ratzinger,
Präfekt des Glaubenskongregation, den oben dargestellten Werteverfall herausgestrichen. Nach
der Analyse des Wertetransports von Europa nach anderer Kontinenten der Welt kommt Ratzin-
ger zu der Behauptung, dass Europa kulturell leer geworden sei.
„Ich sehe da eine paradoxe Synchronie: Mit dem Sieg der posteuropäischen technisch-säkularen
Welt, mit der Universalisierung ihres Lebensmusters und ihrer Denkweise verbindet sich der
Eindruck, dass die Wertewelt Europas, seine Kultur und sein Glaube, worauf seine Identität be-
ruhten, am Ende und eigentlich schon abgetreten seien; dass nun die Stunde der Wertesysteme
anderer Welten, des präkolumbianischen Amerika, des Islam, der asiatischen Mystik gekommen
sei. Europa scheint in dieser Stunde seines äußersten Erfolgs von innen her leer geworden,
gleichsam von einer lebensbedrohenden Kreislaufkrise gelähmt, sozusagen auf Transplantate
angewiesen, die dann aber doch seine Identität aufheben müssen. Diesem inneren Absterben der
390 Instrumentum laboris, 21.
253
tragenden seelischen Kräfte entspricht es, dass auch ethnisch Europa auf dem Weg der Verab-
schiedung begriffen erscheint.“391
Nach dieser Lagebeschreibung auf die düstere geistig-religiöse Situation Europas wollen die
europäischen Bischöfe Antwort geben. Die pastoralen Einsichten, Optionen und Anweisungen
können in Bezug auf die Werteproblematik Europas auch als Option für die Neu-Bewertung Eu-
ropas aufgefasst werden. Die Logik des Schreibens ist, dass die Kirche in diesem Prozess der
Neustrukturierung Europas vor eine zweifache Aufgabe gestellt ist. Einerseits muss sie kräftig
und glaubwürdig die Neuevangelisierung fortsetzen, andererseits muss sie auch durch die Selbst-
erneuerung zur konkreten Tradierung der Werte des Evangeliums beitragen.
„Dabei stützt und leitet uns die Gewissheit, dass „Christus, der Herr, der Weg ist; er heilt unsere
inneren und äußeren Wunden, stellt in uns das göttliche Bild wieder her, das wir durch die Sünde
verdunkelt haben“ des weiteren die Gewissheit, dass die christlichen Wurzeln Europas, wenn sie
wiederentdeckt und wiederbelebt werden, in allen lebendige Hoffnung und neue Dynamik wecken
können, die zur Überwindung der gegenwärtigen Schwierigkeiten beitragen und eine geistige
und menschliche Weiterentwicklung für die Zukunft sicherstellen.“392
Der kirchliche Beitrag zur Erneuerung Europas wird plastisch zusammengefasst: „Im einzelnen
kann der Beitrag der Kirche zum Wachstum der Hoffnung in Europa so beschrieben werden: Die
Spiritualität kann eine Antwort auf die Leere und Frustration der Konsumgesellschaft sein. Der
Sinn für Gemeinschaft kann die Schranken der Voreingenommenheit und der Nationalismen
durchbrechen sowie den drohenden Zerfall der Gesellschaft aufhalten. Das missionarische Zeug-
nis ist Ausdruck der Sorge um das Wohl des Einzelnen, damit er den Sinn seines Lebens fin-
det.“393
Beitrag der Kirchen Ost(Mittel)Europas
Die Menschen, die Christen und die religiösen Institutionen werden ihre Grunderfahrungen die in
die EU mit bringen. Diese können aus der Sicht des Anderen, in dieser Beziehung aus der Sicht
der heutigen Mitglieder der EU, anders als aus dem Blickwinkel der Länder Ost(Mittel)Europas
eingeschätzt werden. Wo man heute über rückständige Modernisierung zu sprechen pflegt, dort
können die traditionellen Werte der Gesellschaften dieser Region als Gegengewicht bezüglich
einer (allzu sehr) entwickelten Modernisierung gelten, die auch Individualisierung bedeutet.
Wenn in Westeuropa die Kinderlosigkeit auch als ein ökonomisches Problem den Politikern Sor-
gen bereitet, „bringen“ die Familien der mehr traditionellen Gesellschaften heuten noch durch-
391 in: Die Zeit 50/2000. 392 Instrumentum laboris, 37. 393 Instrumentum laboris, 38.
254
schnittlich mehr Kinder pro Erwachsene in die EU mit. Wo die Problematik der Demokratisie-
rung in Ost(Mittel)Europa hervorgehoben wird, da die langen Schatten der totalitären Vergan-
genheit eine raschere Demokratisierung bremsen, dort können die grundlegend machtskeptischer
Traditionen Osteuropas als eine gesunde Mahnung gegen ein sorgenloses Machtvertrauen ange-
sehen werden.
Die Kirchen in dieser Region mussten Orte eines risikofreudigen Glaubens werden, da in der Zeit
der Religionsverfolgung ein Glaube ohne Bereitschaft auf ein Stück Martyrium unvorstellbar und
unpraktizierbar war.394 Dieser grundlegende Zusammenhang zwischen Glauben und Martyrium
gestaltete den Glauben praxisnah. Nur dort wird Glaube und Kirche ernst genommen und ein
berechtigtes gesellschaftliches Ansehen haben, wo die Opferbereitschaft in der Nachfolge Jesu
klar wird. Eine Kirche und ein Glaube ohne risiko-(opfer)bereite Option ist den biblischen Vätern
und der heutigen Meinungslage unwürdig. Die religionssoziologischen Untersuchungen in der
Region Ost(Mittel)Europas395 bezeugen, dass die Kirche dort ein größeres Ansehen und eine
breitere Glaubwürdigkeit, wo sie ihr Schicksaal mit den Menschen der Gesellschaft teilte. Dies
gilt nicht nur für die Zeit der kommunistischen Diktatur, sondern für eine längere geschichtliche
Periode. Die Frage ist, ob die Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit der Christen in Ost(Mittel)-
Europa auch unter demokratischen Verhältnissen eine positive machtkritische Option bleibt oder
ob sie nur gegen die Feinde von Religion und Kirche galt.
Papst Johannes Paul II. hat in allen Reformländern Ost(Mittel)Europa einen und in einigen Län-
dern mehrere Pastoralbesuche gemacht. In seinen Ansprachen sind konkret viele Ansätze er-
wähnt, wie die kulturellen und religiösen Traditionen der jeweiligen Ländern als eine Besonder-
heit anzusehen sind. Diese Ansätze gelten auch als mögliche Beiträge dieser Länder zu der Neu-
Bewertung Europas angesichts der besorgniserregenden geistig-religiösen Lage.396
Eine vorrangige Option für die eigene Kultur kennzeichnet viele Ansprachen des Papstes. Dahin-
ter steht eine Theorie über die Wirkung der kommunistischen Ideologie auf die Kultur dieser
Gesellschaften, aber auch über ihre „ursprünglichen“ christlichen Inhalte vor dem Zweiten Welt-
krieg. Der Aufruf auf die erneute Vergegenwärtigung dieser kulturellen christlichen Wurzeln
trifft auf die Neigung dieser Gesellschaften zur Erinnerung, wenn nicht sogar zur Nostalgie. Die
Reflexion auf die kulturellen Wurzeln gewinnt gerade in der Region Ost(Mittel)Europas eine
besondere Bedeutung dadurch, dass in der kommunistischen Ideologie und totalen Mobilisierung
die Schaffung des neuen Menschen, neuer Kultur, neuen Werten und neuer sozialen Beziehungen
eine ganz zentrale Rolle spielte. Auch wenn die tatsächlichen christlichen Inhalte der früheren
Epochen der Region vielfältig ausgelegt werden können, die Option für die eine kluge Revitali-
394 Máté-Tóth, Bulányi. 395 Pollak, Religiöser Wandel. Tomka/Zulehner, Religion in dem gesellschaftlichen Kontext.
255
sierung dieser Überreste der vorkommunistischen Vergangenheit bilden doch ein bedeutenden
Aufruf gegen die allgemeine postmoderne Neigung zur Amnesie. Die Kirche hat die Aufgabe der
Anamnese, sie ist (vor allem in homogen katholischen Ländern) dazu auch fähig, da sie in der
Zeit der antireligiösen und antikirchlichen Unterdrückung strukturell und auch selbst durch ihre
staatlich eingeengte Verkündigung Bewahrin von Werten gewesen ist, die von dem System stark
attackiert waren.
„In recent decades, your country, like other parts of Eastern Europe, has suffered the tragedy
produced by atheistic materialism. Today, in the new democratic climate, it is necessary to give
strong support to the new evangelization, so that the human person, the family and society as a
whole will not be harmed and fall into the trap of consumerism and hedonism. There is a need to
proclaim and bear witness to the values which make life authentic and joyful, satisfying the hu-
man heart and filling it with hope of the inheritance prepared by God for his children. The
Church in Croatia, therefore, is called to rediscover her own religious and cultural roots in or-
der serenely and confidently to cross the threshold of the new Millennium which is now so
near.397
Die Zukunft der Kirche und der zivilen Gesellschaft hat in der Sicht des Papstes und auch in der
Sicht vieler Bischöfe der Region eine tiefe Einheit. Unter ziviler Gesellschaft verstehen die Bür-
ger der Region etwas Oppositionelles gegen die totalitäre Macht. Zivil zu sein hieß lange Zeit
nicht nur Bürger zu sein, sondern bedeutete die aktive Tradierung eines alternativen Gesell-
schaftsmodells, wo die Machtinhaber nicht alle Lebensbereiche unter nahezu totaler Kontrolle
halten können, sondern wo vor dem Einfluss der Macht geschützte Freiräume vorhanden sind.
Dies ist eine Tradition in den postsozialistischen Gesellschaften, die mehr oder weniger in allen
Ländern auch in der Kirche praktiziert worden ist. Wenn die Kirche als Großinstitution in ihrer
pastoralen Tätigkeit verhindert war, haben viele pastorale Aufgaben und Verantwortungen etwa
kleinere Gruppen, Bewegungen, Zirkel, Netze subsidiär übernommen. Diese kirchlichen Mikro-
oder Mesostrukturen beruhten nicht selten auf familiären Beziehungen. Ihrer Lebens- und Kom-
munikationsweise nach waren sie sehr ähnlich zur Kultur der Großfamilien. In der Zeit der enor-
men Individualisierung die in vielen westlichen Gesellschaften vonstatten geht und die auch in
den zunehmend modernisierten Gesellschaften Ost(Mittel)Europas immer mehr bemerkbar ist,
hat die Kirche eine Chance, mit der Beibehaltung der speziellen Gemeinschaftlichkeit zu einer
lebenswürdigen Zukunft beizutragen.
„The pastoral care of families, especially as it involves young people, is clearly way of building
the future of the Church and of civil society. The promotion of the dignity of the person and of the
396 Die Quellen werden nach den Zitaten angegeben. 397 Papst Johannes Paul II. in Kroatien: Message to the Bischops’ Conference From Split, 4 October in the year 1998.
256
family, respect for the right to life, which is especially threatened today, together with the defen-
ce of the weakest elements of society, must have a special place in your apostolic concerns, all to
„give a soul“ to modern Croatia.398
Europa konnte und kann nach dem Zweiten Weltkrieg nur als eine plurale Vielfalt von Kulturen
gedacht werden. Nicht nur die europäischen Völker machen die EU-Palette bunt, sondern die
MitbürgerInnen aus anderer Kontinenten, die oft seit mehreren Generationen hindurch in Europa
leben. Die Parole der Einheit in Vielfalt erweist sich in der Verwirklichung immer mehr als pro-
blematisch. Die Vielfalt der Sprachen und Kulturen, das dauernde Abstimmen der wirtschaftli-
chen und politischen Interessen der Mitgliedstaaten, die in Größe und Einfluss doch wesentlich
verschieden sind: diese mannigfaltige Vielfalt zu einer losen, aber funktionsfähigen Einheit zu
meistern, gilt als eine der größten und schwierigsten Herausforderungen der heutigen EU. Dieses
Problem wird durch eine Erweiterung in Richtung Ost(Mittel)Europa exponentiell schwieriger.
Die Bedenken über eine institutionelle und politische Unüberbrückbarkeit der enormen Vielfalt
scheint für viele immer realistischer zu werden. Die in einem kulturellen Sinne des Wortes west-
christliche Kultur von Europa wird mit islamischen und polytheistischen Kulturelementen immer
mehr vermengt, um von der in sich selbst sehr spannungsreichen slawischen, serbischen oder
griechischen Orthodoxie ganz zu schweigen. In den Ansprachen des Papstes, die er in orthodoxen
Ländern hält, kommt die Gedanke ständig vor, dass die Kirchen verschiedener liturgischer Tradi-
tionen durch ein friedliches Zusammensein nicht nur für das eine Christentum, sondern auch für
die Einheit der verschiedenen Kulturen, schließlich für die Einheit der ganzen Menschheit ein
Beispiel geben könnten. Obwohl diese Aufforderung vor allem für die Konfessionen gilt: als
Modell der Einheit Europas verliert er nichts von seiner Gültigkeit:
„Die Zugehörigkeit zu der einen Kirche unter Achtung der unterschiedlichen rituellen Traditio-
nen zu leben bietet euch die einmalige Gelegenheit, ein bedeutsames ‚kirchliches Laboratorium’
zu betreiben, in dem die Einheit in der Vielfalt aufgebaut wird“.399
Nationen, Ethnien, Minderheiten, Sprachen, Regionen, unterschiedlichste Erinnerungen und ge-
genteilige Interessen sind die prägenden Merkmale der heutigen Europäischen Union und auch
der Region Ost(Mittel)Europas. Die Gesellschaften der Reformstaaten und darin die Kirchen
stehen vor einen zweifachen Herausforderung. Sie müssen ihre Stellung im Übergang zur Demo-
kratie wahrnehmen und gleichzeitig auch mitgestalten, und sie müssen zweitens mit der Berufung
zu einer Inkulturation des Evangeliums nie aufhören. Bei der nüchternen Wahrnehmung der
Komplexität dieser Situation dürfte doch gelten: Ohne Erneuerung der Kirche keine
(Neu)evangelisierung, und ohne Evangelisierung kein neues Europa.
398 A. a. O.
257
LITERATUR
Alberigo, Giuseppe (1981): L’ecclesiologia del Vaticano II: dinamismi e prospettive. Bologna: Peeters.
András, Emmerich (1982): Das "Cultural Lag" von Ungarns Gesellschaft und Kirche in der Nachkriegszeit. Concilium 18: 224-228.
András, Emmerich u.a. (1969): Bilanz des ungarischen Katholizismus. München: Heimatwerk. Anič, Rebeka, Peter Miščik (2001): Laien, Frauen, Jugend. In: Máté-Tóth András / Mikluscak,
Pavel (Hg.), Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie, Ostfildern: Schwabenverlag. 131-172. [Zulehner, Paul M. u.a. (Hg.): Gott nach dem Kommunismus Bd. 6.]
Bartnik, Czesław Stanisław (1986): Formen der politischen Theologie in Polen. Regensburg: Friedrich Pustet Verlag.
Baus, Karl (1999): Die Heiligkeit des Christen und seiner Kirche. In: Jedin, Hubert (Hg.), Hand-buch der Kirchengeschichte Bd. I., Freiburg: Herder. 360-388.
Beinert, Wolfgang (Hg.) (1991): Glaube als Zustimmung. Freiburg: Herder. [Quaestiones Dispu-tatae Bd. 131.]
Berkel, Karl (1996): Von der Führungstechnik zur Führungsethik. Denkanstöße zu Unterneh-mens- und Personalführung. In: Friesl, Christian (Hg.), Christsein als Beruf. Neue Perspek-tiven für theologische Karrieren, Innsbruck, Wien: Tyrolia. 176-194.
Bernsdorf, Wilhelm (Hg.) (1969): Wörterbuch der Soziologie. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag. Best, Heinrich u.a. (1997): Elites in Transition. Elite Research in Central and Eastern Europe.
Opladen: Leske und Budrich. Bibó, István (1986): Válogatott tanulmányok. Budapest: Magvető. Bibó, István (1992): Die Misere der osteuropäischen Kleinstaaterei. Frankfurt M. Biser, Eugen (1993): Ein Zeichen - deutungslos. Zum Problem der unverstandenen Wende. Litte-
rae 3: 33-40. Biser, Eugen (1994): Leitsterne für Morgen. In Europa menschlich leben: Wertewandel, Orientie-
rungskrise, Sinnsuche. In: Krieger, Walter / Rauter, Horst M. (Hgrs.), Christliche Visionen für ein offenes Europa. Österreichische Pastoraltagung 28. bis 30. Dezember 1993, Wien: Herder 49-59.
Boff, Clodovis (1983): Theologie und Praxis. München: Kaiser. Boff, Clodovis (1986): Die ambivalente Haltung der „Instruktion zur Theologie der Befreiung“
gegenüber dem Marxismus. In: Rottländer, Peter (Hg.), Theologie der Befreiung und Mar-xismus, Münster: edition liberación 109-115.
Boff, Clodovis (1986): Zum Gebrauch des „Marxismus“ in der Theologie. Einige Thesen. In: Rottländer, Peter (Hg.), Theologie der Befreiung und Marxismus, Münster: edition liberaci-ón. 37-44.
Boff, Leonardo, Boff, Clodovis (1986): Wie treibt man Theologie der Befreiung? Düsseldorf: Patmos.
Bortnowska, Halina (1996): Transition to democracy in Easten Europe: a religious and theologi-cal challenge. In: Camps, Arnulf / Goldewijk, Berma K. (eds.), Cultural Identity in Latin America and in Europe, Kampen: Kok Pharos 31-37. [Camps, P. H. J. M. (ed.): Kerk en Theologie in Context Bd. 32.]
Büchele, Herwig (1991): Für eine Weltrepublik frei verbündeter Staaten. In: Müller, Johannes / Kreber, Walter (Hgrs.), Soziales Denken in einer zerrissenen Welt. Anstöße der Katholi-schen Soziallehre, Freiburg Br.: Herder 70-72. [Quaestiones Disputatae Bd. 136.]
Byrne, J. M. (1994): Theologie und christlicher Glaube. Concilium 30: 476-483. Campenhausen, Hans von (1963): Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei
399 Ansprache vom Papst Johannes Paul II. an die Bischöfe in der Apostolischen Nuntiatur, Kiew Sonntag, 24. Juni 2001.
258
Jahrhunderten. Tübingen: Mohr. Camps, Arnulf, u.a. (eds.) (1996): Cultural Identity in Latin America and in Europe. Kampen:
Kok Pharos. [Camps, P. H. J. M. (ed.), Kerk en Theologie in Context Bd. 32.] Casanova, José (1996): Chancen und Gefahren öffentlicher Religion. Ost- und Westeuropa im
Vergleich. In: Kallscheuer, Otto (Hg.), Das Europa der Religionen, Frankfurt M.: Fischer. 181-216.
Chenu, Marie D. (1965): Les signes des temps. Nouwell revue theologique 87: 23-39. Coenen, L., Beyreuther, E., Bietenhard, H. (hrsg) (1967-1971): Theologisches Begriffslexikon
zum Neuen Testament,. Band I. II,1.2, Wuppertal: Brockhaus Conzelmann, Thomas (1996): Europa der Regionen. In: Kohler-Koch, Beate / Woyke, Wichard
(Hg.), Die Europäische Union, München: C. H. Beck. 61-67. [Nohlen, Dieter (Hg.): Lexi-kon der Politik Bd. 5.]
Conzeminus, Victor (1993): Die Kirchen und der Nationalismus. In: Hünermann, Peter (Hg.), Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theologie, Freiburg Br.: Herder. 82-99. [Fries, Heinrich, Schnackenburg, Rudolf (Hg.): [Quaestiones Disputatae Bd. 144.]
Delors, Jacques (1999): Zur Rolle der Kirche im europäischen Einigungsprozeß. In: Schreer, Werner / Steins, Georg (Hgs.), Auf neue Art Kirche zu sein. Wirklichkeiten, Herausforde-rungen, Wandlungen. Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer, München: Bernwald bei Don Bosco 390-394.
Demel, Sabine (2000): Christen zweiter Klasse? Stimmen der Zeit 218: 8, 555-567. Dersi, Tamás (1973): A századvég katolikus sajtója. Budapest: Akadémia Kiadó. Dirks, Walter (1991): Gefahr ist. Wächst das Rettende auch. Befreiende Theologie für Europa.
Salzburg: Friedrich Pustet Verlag. Dmytryschyn, N. u. a. (2000): Widerstand und Anpassung (Ukraine) In: Länderberichte zum
Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript] Döpmann, Hans-Dieter (1996): Nationalismus und Religion. Jahrbuch Mission 17-28. Duquoc, Christian (1993): Jesus Christus, Mittelpunkt des Europa für morgen. In: Hünermann,
Peter (Hg.), Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theologie, Freiburg Br.: Herder 100-110. [Fries, Heinrich, Schnackenburg, Rudolf (Hg.): Quaestiones Disputatae Bd. 144.]
Emmerich, Wolfgang, Lothar Probst (1998): Intellektuellen-Status und intellektuelle Kontrover-sen im Kontext der Wiedervereinigung. In: Institut für kulturwissenschaftliche Deutschland-studien an der Universität Bremen (Hg.), Intellektuellen-Status und intellektuelle Kontro-versen, Bremen: Materialien und Ergebnisse aus Forschungsprojekten des Institutes (http://www.deutschlandstudien.uni-bremen.de/deutschlandstudien/hefte/heft4.htm)
Eötvös József (1981 – usprünglich 1851/1854): A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra [Der Einfluss der herrschenden Ideen des XIXen Jahrhunderts auf den Staat]. Buda-pest: Szépirodalmi
Eötvös József (1996-1998), The dominant ideas of the nineteenth century an their impact in the state. [ed. and annot. with an introductory essay by D. Mervyn Jones]. New York: Columbia University Press.
Favazza, Joseph A. (1999): Chaos Contained: the Construction of Religion in Cyprian of Cartha-ge. Questions Liturgiques 80: 2, 81-90.
Felmy, Karl C., u.a. (Hrsg.) (1991): Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen: auf dem Weg ins dritte Jahrtausend: Aleksandr Men in memoriam (1935-1990). Göttingen: Vanden-hoeck & Ruprecht.
Firlit, Elzbieta (1995): Die Rolle der Pfarrgemeinden im polnischen Transformationsprozeß. In: Spieker, Manfred (Hg.), Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und Ost-deutschland. Sozialethische Probleme der Transformationsprozesse, Paderborn: Ferdinand Schöningh 75-96.
Freud, Sigmund (1982): Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten. In: Freud, Sigmund Schriften zur Behandlungstechnik (Studienausgabe Ergänzungsband), Frankfurt M.: 205-215.
Freud, Sigmund (1982): Trauer und Melancholie. Psychologie des Unbewußten (Studienausgabe) Bd. III., Frankfurt M.: 193-212.
Fritschen, Klaus (1999): "Nihil innovetur" – "opto omnes in ecclesiam regredi". Kerygma und
259
Dogma 45: 64-85. Furger, Franz (Hg.) (1995): Akzente christlicher Sozialethik. Schwerpunkte und Wandel in 100
Jahren „Christlicher Sozialwissenschaften„ an der Universität Münster. Gabriel, Karl (1992): Christentum zwischen Tradition und Postmoderne. Freiburg Br.: Herder. Gabriel, Oscar W. (1996): Anpassung, Integration oder Polarisierung? Zur Entwicklung der poli-
tischen Kultur im vereinigten Deutschland. Stuttgart: Universität Stuttgart. (http://www.uni-stuttgart.de/wechselwirkungen/ww1996/gabriel.htm#DDR)
Gadamer, Hans-Georg (1993): Die Universalität des hermeneutischen Problems. In: Gadamer, Hans-Georg Wahrheit und Methode II., Tübingen: Mohr 219-231.
Garton Ash, Timothy (1986): Gibt es Mitteleuropa? (orig. The New York Review of Books 15. Okt. 1986. 45-52).
Garton Ash, Timothy (1999): Zeit der Freiheit: aus den Zentren von Mitteleuropa. München: Hanser.
Gatz, Erwin (1999): Kirche und Katholizismus seit 1945. I-II. Bde. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schönigh.
Georgius (Pseudonym), Frater (1982): Zur Trennung von Staat und Kirche in sozialistischen Gesellschaften Osteuropas. Concilium 18: 244-249.
Gérest, Clemens (1975): Nostalgie der Einheit in der Kirche und Politik der Vertuschung von Konflikten. Concilium 11: 607-617.
Gergely, Jenő (1989): Katolikus egyház, magyar társadalom 1890-1986. Prohászkától Lékaiig [Katholische Kirche, ungarische Gesellschaft 1890-1986. Von Prohászka bis Lékai]. Buda-pest: Tankönyvkiadó.
Gönner, Hannes (1995): Die Stunde der Wahrheit. Frankfurt M.: Peter Lang. Grabner-Haider, Anton (1981): Ideologie und Religion. Interaktion und Sinnsysteme in der mo-
dernen Gesellschaft. Freiburg: Herder. Grande, Dieter, Bernd Schäfer (1997): Interne Richtlinien und Bewertungsmaßstäbe zu kirchli-
chen Kontakten mit dem MfS. In: Vollnhals, Clemens (Hg.), Die Kirchenpolitik von SED und die Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz, Berlin: Ch. Links Verlag 388-404.
Gremmmels, Christian (1974): Das Problem theologischer Gegenwartsanalyse. In: Klostermann, Ferdinand / Zerfaß, Rolf (Hgrs.), Praktische Theologie heute, München: Kaiser 240-265.
Gudea, Nicolae u. a. (2000): Heilige, "Lapsi" und Kollaborateure in der heutigen Sicht der Öf-fentlichkeit und der Kirche (Rumänien) In: Länderberichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Gudea, Nicolae u. a. (2000): Korrelation zwischen Glaube und Karriere (Rumänien) In: Länder-berichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Gudea, Nicolae u. a. (2000): Typologie der Anpassung und des Widerstandes im Totalitarismus (Rumänien) In: Länderberichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Gudea, Nicolae u. a. (2000): Widerstand und Konformismus (Rumänien) In: Länderberichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Gyáni, Gábor (1988): Történészviták hazánk Európán belüli hovatartozásáról. Valóság 4, 76-83. Hainz, Michael (1991): Flüchtlinge in Europa Botschafter weltweiten Unrechts. In: Müller, Jo-
hannes / Kreber, Walter (Hgrs.), Soziales Denken in einer zerrissenen Welt. Anstöße der Katholischen Soziallehre, Freiburg Br.: Herder. 156-169. [Quaestiones Disputatae Bd. 136.]
Hanák, Péter (1988): Die Geschichte Ungarns. Budapest: Corvina. Hanák, Péter (1988): Mitteleuropa als historische Region der Neuzeit. Mitteleuropa – Traum oder
Trauma, Bremen: Temmen 175-191. Hankiss Elemér (1989): Kelet-európai alternatívák. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Hankiss Elemér u.a. (1986): Kényszerpályán [Auf der Zwangsbahn]. Budapest: Institut für So-
ziologie. Hanuy A vallásváltoztatás az egyházjog és a magyar államjog szerint [Religionsänderung nach
der Kirchenrecht und der ungarischen Staatsrecht]. Pécs: 1905. Heppner, Harald, u.a. (Hgs.) (1996): Das Europa-Verständnis im orthodoxen Südosteuropa.
Graz: Institut für Ökumänische Theologie und Patrologie an der Universität Graz. [Bauer, Johannes B., u.a. (Hgs.), Grazer theologische Studien Bd. 21.]
Hermann, Egyed (1973): A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München: Au-
260
rora. Hilberath, Bernd J. (1999): Theologie des Laien. Zu den Spannungen zwischen dem Zweiten
Vatikanischen Konzil und der Laien-Instruktion. Stimmen der Zeit 217: 4, 219-232. Hrbek, Rudolf u.a. (1994): Betrifft: das Europa der Regionen. Fakten, Probleme, Perspektiven.
München: Beck. Hübner, Siegfried (1962): Kirchenbuße und Exkommunikation bei Cyprian. Zeitschrift für Theo-
logie und Kirche 84: 49-84, 171-215. Hünermann, Peter (1995): Glaube und Theologie Momente europäischer Identität. In: Delgado,
Mariano / Lutz-Bachmann, Matthias (Hgrs.), Herausforderung Europa. Wege zu einer euro-päischen Identität. München: Beck 95-114.
Hünermann, Peter (Hg.) (1993): Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theologie. Freiburg: Herder. [Fries, Heinrich, u.a. (Hg.), Quaestiones Disputatae Bd. 144.]
Hünermann, Peter (Hg.) (1996): Gott - ein Fremder in unserem Haus? Die Zukunft des Glaubens in Europa. Freiburg: Herder. [Hünermann, Peter, u.a. (Hg.), Quaestiones Disputatae Bd. 165.]
Huntigton, Samuel P. (1997): Kampf der Kulturen, München. Wien: Europa Verlag. Jedin, Hubert (Hg.) (1963ff): Handbuch der Kirchengeschichte I-VII. Bde. Freiburg Br.: Herder. Jekel, Thomas (1998), Regionalmanagement und Regionalmarketing. Theoretische Grundlagen
kommunikativer Regionalplanung. In: Schriftenreihe des Salzburger Instituts für Raumord-nung und Wohnen, Bd. 18.
Joób, Lajos (1893): A polgári házasság történeti megvilágításban. Budapesti Szemle 75: 161-189, 338-371.
Juhant, Janez (2000): Konformismus und Widerstand (Slowenien) In: Länderberichte zum The-ma "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Juhant, Janez (2000): Theologie und Kirche in der gesellschaftlichen Wirklichkeit Sloweniens. Bulletin ET 11: 2, 172-184.
Kallscheuer, Otto (Hg.) (1996): Das Europa der Religionen. Frankfurt: Fischer. Karácsonyi, János (1929): Magyarország egyháztörténete. Veszprém. Kasper, Walter (Hg.) (1993-2001): Lexikon für Theologie und Kirche. 3., völlig neu bearb. Aufl.
Freiburg Br.: Herder. Kaufmann, Franz-Xaver (1989): Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven.
Tübingen: J.C.B. Mohr. Kaufmann, Franz-Xaver (1989): Unbeabsichtigte Nebenfolgen kirchlicher Leitungsstrukturen.
Vom Triumphalismus zur Tradierungskrise. In: Pottmeyer, Hermann J. (Hg.), Kirche im Kontext der modernen Gesellschaft. Zur Strukturfrage der römisch-katholischen Kirche, Zü-rich: Katholische Akademie Freiburg, Verlag Schnell & Steiner. 8-34.
Kaufmann, Franz-Xaver (1993): Das janusköpfige Publikum von Kirche und Theologie. Zur kulturellen und gesellschaftlichen Physiognomie Europas. In: Hünermann, Peter (Hg.), Das neue Europa. Herausforderungen für Kirche und Theologie, Freiburg: Herder 11-41. [Fries, Heinrich, Schnackenburg, Rudolf (Hg.): Quaestiones Disputatae Bd. 144.]
Kerkhofs, Jan Z. P. M. (1995): Europa ohne Priester? Düsseldorf: Patmos. Kiss, Endre (1997): Ein Versuch, den postsozialistischen Nationalismus zu interpretieren. In:
Robert Hettlage u.a. (Hrsg.), Kollektive Identität in Krisen. Ethnizität in Region, Nation, Europa, Opladen: Westdeutscher Verlag 194-206.
Kleinewefers, Henner (1992): Nationalismus wieder zum Problem geworden. Schweizerischer Monatshefte 72: 300-316.
Klostermann, Ferdinand u.a. (1974): Praktische Theologie heute. München: Kaiser. Kohler-Koch, Beate u.a. (1996): Die Europäische Union. München: C. H. Beck. Konrád, György (1985): Antipolitik, Mitteleuropäischen Meditationen. Frankfurt M.: Suhrkamp. Konrád, György u.a. (1981): Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Frankfurt M.:
Suhrkamp. Kornai, György (1987): A magyar reformfolyamat: víziók, remények és a valóság I. [Ungarischer
Reformprozeß: Visionen, Hoffnungen und die Realität]. Gazdaság 21: 2, 30-34. Kosáry, Domokos (1984): Előadások a magyar történelemről. Budapest: RTV-Minerva. Kosáry, Domokos (1987): A felvilágosodás Európában és Magyarországon [Aufklärung in Euro-
261
pa und Ungarn]. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, Országos Pedagógiai Intézet. Kosáry, Domokos (1987): A történelem veszedelmei. Budapest: Magvető. Krötke, Wolf (1990): Die Kirche und die "freidliche Revolution" in der DDR. Zeitschrift für
Theologie und Kirche 87: 4, 521-544. Krötke, Wolf (1995): Gestalten christlicher Freiheit in der Kirche - Wirkungen christlicher Frei-
heit in der Gesellschaft. Zeitschrift für Theologie und Kirche 92: 2, 238-250. Krötke, Wolf (1997): Das beschädigte Wahrheitszeugnis der Kirche. Zu den Folgen der Einfluß-
nahme des MfS auf die Kirche. In: Vollnhals, Clemens (Hg.), Die Kirchenpolitik von SED und die Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz, Berlin: Ch. Links Verlag. 405-414.
Kuczi, Tibor (1992): Szociológia, ideológia, közbeszéd [Soziologie, Ideologie, öffentliches Ge-spräch] . Budapest: Scientia Humana.
Kuhn, Michael (1997): Jetzt sind die auch schon in Brüssel!? Theologisch-praktische Quartal-schrift 145: 4, 384-390.
Küng, Hans (1981): Existiert Gott? Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit. München : Piper. Kunst, Hermann (Hg.) (1975): Evangelisches Staatslexikon. 2., vollst. neu bearb. u. erw. Aufl.
XIII. Bde. Stuttgart: Kreuz Verlag. Langendörfer, H. (1991): Für eine Weltrepublik frei verbündeter Staaten. In: Kerber, Walter /
Müller, Johannes (Hrsg.), Soziales Denken in einer zerrissenen Welt: Anstösse der katholi-schen Soziallehre in Europa, Freiburg Br.: Herder 52-63.
Laswell, Harold (1965): Language of Politics: Studies in Quantitative Semantics. Cambridge: University Press.
Legrand, Hervé (1989): Die Gestalt der Kirche. In: Eicher, Peter (Hg.), Neue Summe Theologie III. Der Dienst der Gemeinde, Freiburg: Herder. 87-181.
Lemberg, Eugen (1971): Ideologie und Gesellschaft. Stuttgart: Kohlhammer. Link, Christoph (1987): Art. "Volkskirche". Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart: Kreuz Verlag
Sp. 3903-3910. Luchterhandt, Otto (1995): Religionsrechtliche Rahmenbedingungen für eine Neuordnung des
Verhältnisses von Staat und Kirche in den Ländern Mittel- und Osteuropas. Essener Gesprä-che 29: 5-65.
Luchterhandt, Otto (1997): Kichen - Osteuropa. In: Nohlen, Dieter, u.a. (Hg.), Die östlichen und südlichen Länder, München: C. H. Beck. 284-291. [Nohlen, Dieter (Hg.): Lexikon der Poli-tik Bd. 4.]
Mariański, Janusz (1999): Widerstand und Konformismus (Polen) In: Länderberichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Márkus, György (1995): A posztkommunista Európa realitásai és a törésvonal-elmélet [Die Rea-litäten vom postkommunistischen Europa und die Theorie der Bruchlinie]. Európai Szle 6: (1) 97-112.
Máté-Tóth András (1991): Igazság Istene. A II. világ történelmi tapasztalatai mint „locus theolo-gicus“ [Gott der Gerechtigkeit. Die geschichtlichen Erfahrungen der Zweiten Welt als “lo-cus theologicus”]. Teológia 25: 27-33.
Máté-Tóth András (1991): Ungarns Kirche zwischen Ultramontanismus und kreativer Autono-mie. Pastoralblatt 43: 6, 309-316.
Máté-Tóth András (1996): Bulányi und die Bokor-Bewegung. Eine pastoraltheologische Würdi-gung. Wien: UKI.
Máté-Tóth András (1998): Ecclesiogenese. Pastorale Strategien für eine Kirche des 21. Jahrhun-derts. Actio - Zeitschrift für Akademiker 42, 4, 27-35.
Máté-Tóth András (2000): Eine Theologie der Zweiten Welt? Concilium 36: 3, 278-285. Máté-Tóth András (2000): Ist eine Theologie "after Gulag" möglich? Diakonia 31: 6, 437-443. Máté-Tóth András (2000): Ost-Erfahrung – Ost-Theologie. Die Zeichen der Zeit als theologische
Herausforderung. In: Baumgartner, Isidor, u.a. (Hg.), Den Himmel offen halten. Ein Plä-doyer für Kirchenentwicklung in Europa, Innsbruck: Tyrolia. 237-254.
Máté-Tóth András u.a. (2000): Nicht wie Milch und Honig. Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der postkommunistischen Länder Ost(Mittel)Europas. Ostfildern: Schwabenverlag.
Máté-Tóth András, Paul M. Zulehner (1998): Pastoraltheologie "Ost". Pastoraltheologische In-formationen 18: 2, 367-386.
262
Máté-Tóth András, u.a. (Hg.) (2001): Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie. Ostfildern: Schwabenverlag. [Zulehner, Paul M., u.a. (Hg.), Gott nach dem Kommunismus Bd. 6.]
Máté-Tóth, András (1991): The „second world“ as context for theology, (A „második világ“ mint a teológiaművelés kontextusa). In: Nieuwenhove, J. v. G. B. K. (szerk.), Popular Religion, Liberation and Contextual Theology. Amsterdam: Kok 183-191.
Máté-Tóth, András (1994): Katolikus konfliktuskultúra. Egyházfórum 9: 1, 30-44. Máté-Tóth, András (1995): Zwischen Treue und Verrat. Actio Dezember, Máté-Tóth, András, Janez Juhant (2001): Widerstand und Konformismus. In: Máté-Tóth András /
Mikluscak, Pavel (Hg.), Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie, Ostfildern: Schwabenverlag. 318-338. [Zulehner, Paul M. u.a. (Hg.): Gott nach dem Kommunismus Bd. 6.]
Mechtenberg, Theo (1997): Konflikt zwischen Modernisierung und Identität: ein Beitrag zum ost-westlichen Europa-Diskurs. Orientierung 61: 1, 3-9.
Mészáros, István (1980): Katolikus kisiskoláink 1714-1773 között. Budapest. Meszlényi, Antal (1928): A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Budapest . Mikluscak, Pavel, András Máté-Tóth (2001): Kirche im Aufbruch. In: Máté-Tóth András /
Mikluscak, Pavel (Hg.), Kirche im Aufbruch. Zur pastoralen Entwicklung in Ost(Mittel)Europa: eine qualitative Studie, Ostfildern: Schwabenverlag. 360-382. [Zulehner, Paul M. u.a. (Hg.): Gott nach dem Kommunismus Bd. 6.]
Moltmann, Jürgen (1997): Gott im Projekt der modernen Welt. Beiträge zur öffentlichen Rele-vanz der Theologie. Gütersloh: Kaiser Gütersloher Verlagshaus.
Navickas, Andrius (2000): Konformismus und Widerstand (Litauen) In: Länderberichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Neubert, Ehrhart (1997): Zur Instrumentalisierung von Theologie und Kircherecht durch das MfS. In: Vollnhals, Clemens (Hg.), Die Kirchenpolitik von SED und die Staatssicherheit. Eine Zwischenbilanz, Berlin: Ch. Links Verlag. 329-352.
Nohlen, Dieter u.a. (1997): Die östlichen und südlichen Länder. München: C. H. Beck. Nyíri, Tamás (1994): Der dramatische Weg Europas. In: Krieger, Walter / Rauter, Horst M.
(Hgrs.), Christliche Visionen für ein offenes Europa. Österreichische Pastoraltagung 28. bis 30. Dezember 1993, Wien: Herder. 11-26.
Nyíri, Tamás (1997): Theologie in Ost und West. Karl Rahners Beitrag. Frankfurt: Peter Lang Verlag.
Orabona, Luciano (1990): Etica "penitentiale" die Cipriano e aspetti politico-sociali der cristiane-simo nel III secolo. Vetera Christianorum 27: 273-302.
Orbán, József G. (1996): Friedensbewegung katholischer Priester in Ungarn, 1950-1956. Buda-pest: METEM.
Otto, Rudolf (1991): Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Ver-hältnis zum Rationalen. München: Beck.
Paasi, Anssi (1986): The institutionalization of regions: a theoretical framework for understan-dingthe emergence of regions and the constitution of regional identity. Fennia 164: 1, 105-146.
Paasi, Anssi (1991): Deconstructing regions: notes on the scales of human life. Environment and Planning 23: 239-256.
Pannenberg, Wolfhart (1992): Ultramontanismus und Ekklesiologie. Stimmen der Zeit 117: 449-464.
Pannenberg, Wolfhart (1994): Die Kirchen und die entstehende Einheit Europas. Communio 124-136.
Pickel, Gert (1996): Religiosität und kirchliche Integration in Europa. Informationes theologiae Europae 5: 159-170.
Pilvousek, Josef (2000): Widerstand und Konformismus (DDR) In: Länderberichte zum Thema "Widerstand und Konformismus" [Manuskript]
Pipp Marian (1998): Im Schatten der Globalisierung, Fokus 6-7. Pollack, Detlef u.a. (1998): Religiöser Wandel in den postkommunistischen Ländern Ost- und
Mitteleuropas. Würzburg: Ergon Verlag.
263
Pontificium Consilium pro Laicis (2000): Rediscovering Confirmation. Vatican City. Pottmeyer, Hermann J. (1975): Unfehlbarkeit und Souveränität. Die päpstliche Unfehlbarkeit im
System der ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.
Pottmeyer, Hermann J. (1983): Die zwiespältige Ekklesiologie des Zweiten Vaticanums. Ursache nachkonziliarer Konflikte. Tübingener Theologische Zeitschrift 92: 272-283.
Pottmeyer, Hermann J. (1983): Die zwiespältige Ekklesiologie des Zweiten Vaticanums – Ursache nachkonziliarer Konflikte. Trierer Theologische Zeitschrift 92: 272-283.
Pottmeyer, Hermann J. (1989): Kirche - Selbstverständnis und Strukturen. Theologische und gesellschaftliche Herausforderung zur Gläubwürdigkeit. In: Pottmeyer, Hermann J. (Hg.), Kirche im Kontext der modernen Gesellschaft. Zur Strukturfrage der römisch-katholischen Kirche, Zürich: Katholische Akademie, Freiburg: Verlag Schnell & Steiner 99-123.
Pottmeyer, Hermann J. (1991): Rezeption und Gehorsam Aktuelle Aspekte der wiederentdeckten Realität `Rezeption`. In: Beinert, Wolfgang (Hg.), Glaube als Zustimmung, Freiburg: Her-der 51-91. [Quaestiones Disputatae Bd. 131.]
Potz, Richard (1994): Die Donaumonarchie als multikonfessioneller Staat, Kanon XII: 49-65, 62-65.
Prudky, Libor u.a. (2001): Religion und Kirchen in Ost(Mittel)Europa: Tschechien, Kroatien, Polen. Ostfildern: Schwabenverlag.
Rahner, Karl (1952): Die Bußlehre des heiligen Cyprian von Chartago. Zeitschrift für katholische Theologie 74: 257-276, 381-438.
Ratzinger, Joseph K. (2000): Europas Kultur und ihre Krise. Die Zeit Nr. 50. http://www.zeit.de/2000/50/
Robbers, Gerhard (1999): Amsterdam war nur der Anfang. Die kirchen in der Europäischen Uni-on. In: Schreer, Werner / Steins, Georg (Hgs.), Auf neue Art Kirche zu sein. Wirklichkeiten, Herausforderungen, Wandlungen. Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer, München: Bern-wald bei Don Bosco. 395-403. Rockenbauer, Zoltán (2000): Interjú. Európai Utas 11: 2. Roos, Lothar (1998): "Europa ohne Gott?". Lebendige Seelsorge 49: 2 / 3, 93-99. Sarnyai Csaba Máté (Hg.) (2001): Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarorszá-
gon: 1848-1918. Budapest: METEM Scheffczyk, Leo (2000): Das allgemeine Priestertum als theologischer Ort der Laien in der Kir-
che. Studia Missionalia 49: 55-82. Schillebeeckx, Edward (1985): Christliche Identität und kirchliches Amt. Düsseldorf: Patmos. Schöpflin, Georg (1998): Ráció, identitás, hatalom [Ratio, Identität, Macht]. Régió 9:23-33. Schopper, György (1868): A polgári házasság. Buda. Schreiter, Robert J. (1985): Constructing local Theologies. New York: Orbis Books [dt. Schrei-
ter, Robert J. (1991): Abschied von Gott der Europäer. Zur Entwicklung regionaler Theolo-gien. Mit einem Vorwort von Edward Schillebeeckx. Salzburg: Verlag Anton Pustet.]
Schreer, Werner, u.a. (Hgs.) (1999): Auf neue Art Kirche zu sein. Wirklichkeiten, Herausforde-rungen, Wandlungen. Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer. München: Bernwald bei Don Bosco.
Schröer, Henning (1974): Praktische Theologie als empirische Theologie. In: Klostermann, Fer-dinand / Zerfaß, Rolf (Hgrs.), Praktische Theologie heute, München: Kaiser
Selinger, Rudolf (1994): Die Religionspolitik des Kaisers Decius. Anatomie einer Christenver-folgung. Frankfurt M.
Spiegel, Yorick (1981): Der Prozess des Trauerns. Analyse und Beratung. München: Kaiser-Taschenbücher.
Spieker, Manfred (1995): Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und Ostdeutsch-land. Sozialethische Probleme der Transformationsprozesse. Paderborn: Ferdinand Schö-ningh.
Spieker, Manfred (1998): Mittel- und Osteuropa im Aufbruch. Eine Zwischenbilanz. Köln: J.P. Bachem Verlag.
Spohn, Willfried (1996): Religion und Nationalismus in Osteuropa. Ein vergleichender Erklä-rungsansatz. Informationes theologiae Europae 5: 211-224.
264
Stehle, Hansjakob (1993): Geheimdiplomatie im Vatikan. Die Päpste und die Kommunisten. Zürich: Benzinger.
Steinkamp, Hermann (1988): Als Laien-Theologe im pastoralen Dienst der "Priesterkirhce"? Pastoraltheologische Informationen 8: 1, 193-207.
Stritzky, Maria-Barbara v. (1986): Erwägungen zum Decischen Opferbefehl und seinen Folgen unter besonderer Berücksichtigung der Beurteilung durch Cyprian. RQ 81: 1-25.
Sutherland, Peter (1997): More Europe? Europe in a Christian perspective. Studies 86: 380-388. Suttner, Ernst C. (1996): Die mit Rom unierten Kirchen der Ukraine und Siebenbürgens nach
dem Sturz der kommunistischen Diktatur, in: Jahrbuch Mission, 75-88. Suttner, Ernst C. (1997): Konfliktlösung im Geist des Apostels Paulus: zu den Nachwehen der
Kirchenverfolgungen unter dem Kommunismus. Stimmen der Zeit 215: 11, 770-778. Szegfű, Gyula (1918): A magyar állam életrajza (dt. Der Staat Ungarn, eine Geschichtsstudie.
Berlin: Deutsche Verlags Anstalt 1917). Budapest: Dick Manó. Szegfű, Gyula (1920): Három nemzedék. Budapest: Élet RT. Szűcs, Jenő (1983): Vázlat Európa három történeti régiójáról. Budapest: Magvető. Szűcs, Jenő (1985): Történeti "eredet"-kérdések és nemzeti tudat. Valóság 3, 31-49. Szűcs, Jenő (1988): Ungarns regionale Lage in Europa. Mitteleuropa – Traum oder Trauma,
Bremen: Temmen 161-175. T. Gábor, Mózes (1985): Kelet-Európai hagyományaink: a bizánci paradigma. Valóság 12, 95-
102. Tomka Miklós u.a. (1999): Religion in den Reformländern Ost(Mittel)Europas. Ostfildern:
Schwabenverlag. Tomka Miklós u.a. (2000): Religion in dem gesellschaftlichen Kontext Ost(Mittel)Europas. Ost-
fildern: Schwabenverlag. Tracy, David (1993): Theologie als Gespräch. Eine postmoderne Hermeneutik. Mainz: Grüne-
wald. van der Veer, Peter, u.a. (Hg.) (1999): Nation and Religion. Perspectives on Europe and Asia.
Princeton: Princeton University Press. Van der Ven, Johannes A. (1994): Kommunikative Identität der Ortskirche. Communio 30: 5,
394-402. Virt, Günter (Hg.) (1993): Historische Verantwortung vor der Gegenwart. Frankfurt M.: Peter
Lang [Nembach, Ulrich (Hg.), Forschungen zur praktischen Theologie Bd. 11.] Vlk, Miloslav (1999): Kirchliche Identitätsfindung in der Zeit nach dem Kommunismus. In:
Schreer, Werner / Steins, Georg (Hgs.), Auf neue Art Kirche zu sein. Wirklichkeiten, Her-ausforderungen, Wandlungen. Festschrift für Bischof Dr. Josef Homeyer, München: Bern-wald bei Don Bosco. 430-446.
Waldenfels, Hans (1985): Kontextuelle Fundamentaltheologie. Paderborn: Schöningh. Werbick, Jürgen (1994): Kirche. Ein ekklesiologischer Entwurf für Studium und Praxis. Frei-
burg, Basel, Wien: Herder. Werner, Dietrich (1996): Versöhnung in der gemeinsamen Mission im säkularisierten Europa.
Initiativen von KEK und ÖRK zum Problemfeld von Mission und Proselytismus in Osteu-ropa. Jahrbuch Mission 101-116.
Wilkanowicz, Stefan (1995): Die Rolle der Laien im polnischen Transformationsprozeß. In: Spieker, Manfred (Hg.), Nach der Wende: Kirche und Gesellschaft in Polen und Ost-deutschland. Sozialethische Probleme der Transformationsprozesse, Paderborn: Ferdinand Schöningh 59-74.
Zeller, Árpád (1894): A magyar egyházpolitika 1847-1894. Budapest. Ziemer, Klaus (1998): Das schwierige Zusammenwachsen von Ost und West in Europa. Wort
und Antwort 39: 3, 105-109. Zulehner, Paul M. (1982): "Leutereligion". Eine neue Gestalt des christentums auf dem Weg
durch die 80er Jahre? Wien. Zulehner, Paul M. u.a. (1991): Vom Untertan zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose anhand
der Untersuchungen "Religion im Leben der Österreicher 1970 bis 1990. Freiburg: Herder. Zulehner, Paul M. u.a. (1993): Wie Europa lebt und Glaubt. Düsseldorf: Patmos. Zulehner, Paul M. u.a. (1997): Unterwegs zur Pastoraltheologie in den postkommunistischen
265
Ländern Europas 3. Bde. Wien, Szeged: Pastorales Forum. Zulehner, Paul M. u.a. (2001): Kehrt die Religion wieder? Religion im Leben der Menschen
1970-2000. Band 1: Wahrnehmen. Ostfildern: Schwabenverlag.
266
LISTE DER TABELLEN UND ABBILDUNGEN
TABELLE 1: Vergleich zweier Formen von (Pastoral)Theologie 99 TABELLE 2: Theologische Ansätze zwischen Ultramontanismus und Zweitem Vaticanum 112 TABELLE 3: Verbreitung des Gottesglaubens in postkommunistischen Ländern 230 TABELLE 4: Gebetshäufigkeit in Ungarn und Tschechien (in Prozent) 233 TABELLE 5: Zustimmung zu Glaubenspositionen 234 TABELLE 6: Wertschätzung des neuen politischen Systems 242 TABELLE 7: Politische Typologie 1992-1995 (Werte sind Prozentwerte) 243 TABELLE 8: Demokraten in Osteuropa 1992-1995 243 TABELLE 9: Wertschätzung politischer Institutionen 1991 und 1995 in Ost(Mittel)Europa 244 TABELLE 10: Verständnisse nationaler Identität 245 Abbildung 1: Die Entstehungsdimensionen einer Region. 86 Abbildung 2: Dimensionen der Typologie von Konformismus und Widerstand in der Epoche der kommunistischen Diktatur in Ost(Mittel)Europa 179 Abbildung 3: Autoritarismus in postkommunistischen Ländern 246