Hinter verschlossenen Türen. Akteure und Praxen der Wissensaushandlung am Beispiel des...
-
Upload
koenig-ludwig-haus -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Hinter verschlossenen Türen. Akteure und Praxen der Wissensaushandlung am Beispiel des...
Impressum
BERLINER BLÄTTER Ethnographische und ethnologische Beiträge Herausgegeben von der Gesellschaft für Ethnographie (GfE) und dem Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin ISSN: 1434-0542 Redaktionsanschrift: Geschäftsstelle der Gesellschaft für Ethnographie (GfE) am Institut für Europäische Ethnologie z. Hd. Geschäftsführerirr Prof. Dr. Beate Binder Mohrenstraße 41, 10117 Berlin Tel.: 030-2093-3712, Fax: 030-2093-3726 E-mail: beate. [email protected] -berlin.de, http:/ /www.ethnologie.hu-ber lin.de
Redaktion: Katrin Amelang, Beate Binder, Falk Blask, Alexa Färber, Sebastian Mohr, Franka Schneider, Elisabeth Tietmeyer Heftredaktion: Antonia Davidovic-Walther, Michaela Fenske, Lioba KellerDrescher, FrankaSchneider Satz und Layout: Matthias Schöbe
Die BERLINER BLÄTTER erscheinen unregelmäßig, mindestens jedoch zweimal im Jahr. Bankverbindungen: Berliner Bank, BLZ 100 200 00, Konto 2096990200, IBAN: DE 19 1002 0000 2096 9902 00, BIC: BEBEDEBBXXX
Die Rechte verbleiben bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren.
Die Isotopen auf dem Cover wurden von Gerd Arntz (1900-1988) gestaltet und sind nun im Besitz des Gerd Arntz Archivs, das vom Gerneentemuseum Den Haag verwaltet wird. Die Bilder wurden mit freundlicher Genehmigung von der Internetseite www.gerdarntz.org entnommen, die vom Designbüro Ontwerpwerk, Den Haag initiiert und gestaltet wurde.
Gefördert aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Die Deutsche Bibliothek- CIP Einheitsaufnahme Volkskundliches Wissen. Akteure und Praktiken Berliner Blätter : Ethnographische und ethnologische Beiträge ; Heft 50 I 2009-Münster : LIT, 2009
ISSN 1434-0542 ISBN 978-3-643-10307-9
© LIT VERLAG Münster- Harnburg- Berlin- London Chausseestr. 128/129 10115 Berlin Tel. 030-28040880 Fax 030-28040882
Hinter verschlossenen Türen Akteure und Praxen der Wissensaushandlung am Beispiel des "Handwörterbuchs der Sage"
Michaela Fenske, Regina Bendix
Ein Verleger erinnert sich
"Er war ein musischer, eher künstlerischer, als ein systematisch-wissenschaftlicher Mensch, und das hat sich auch in seiner Arbeitsorganisation (. .. ) gezeigt. Er war ein absoluter Einzelkämpfer, (. .. ) der da dann schließlich (. .. ) -ja, wie soll ich sagen - im Material erstickt ist und das gar nicht mehr alleine schaffen konnte. Mitarbeiter zu finden war schwierig für ihn, besonders im Ausland. Weil die Ausländer natürlich sahen, dass er gar nicht über das Material, das sie in ihrem Land betraf, verfügen konnte. Und sie sahen die Lücken überall. (. .. ) Es ist dann sehr schwierig gewesen, und das hat dann leider zu dem Abbruch des Unternehmens geführt. "1
Mehr als vierzig Jahre nach der Sitzung im Januar 1964, in der entschieden wurde, eines der Großunternehmen des Faches Volkskunde aus der bundesrepublikanischen Nachkriegszeit- das "Handwörterbuch der Sage" - einzustellen, ist es die schillernde PersonWill-Erich Peuckert (1895-1969), die sofort erinnert wird, wenn damalige Akteure die Geschichte des Handwörterbuchs erzählen. So auch seitens des Verlegers, Dietrich Ruprecht, damals Jungverleger im traditionsreichen Verlag "Vandenhoeck & Ruprecht" in Göttingen. Ruprechts Erinnerung birgt einerseits zentrale Aspekte aus der Palette von Erklärungen, die auch im Fach für das Scheitern des auf sieben Bände geplanten
Sagen-Handwörterbuchs geltend gemacht werden: Die Person Peuckerts schien sowohl von der Art und Weise der Arbeitsorganisation und dem Wissenschaftsverständnis als auch von ihrem Alter her wenig geeignet, ein Großprojekt in dem geplanten Zuschnitt zu bewältigen. Die Sammlung der Materialien des Handwörterbuchs entsprach nach Auffassung der Fachleute nicht mehr den internationalen wissenschaftlichen Standards der Nachkriegszeit. Andererseits erinnert sich Ruprecht auch an seine eigene Rolle und vergegenwärtigt, welche Energie der Verlag seinerzeit in das Projekt investierte. Ruprecht übernahm die Aufgabe, das Handwörterbuch der Sage zu betreuen, auf Wunsch seines Vaters:
"Mein Vater hat mir das sehr gerne übertragen, weil(. .. ) es war erstens ein großes Unternehmen. Und er (der Vater) war froh, dass er mich als jungen damals da einsetzten konnte, aber ich hab' dann gesehen, wie mühsam das Geschäft auch war mit ihm (Peuckert)."
So wird die Geschichte eines unter unzähligen Projekten des Verlags auch zu einem Stück Lebensgeschichte des Verlegers - nicht nur, weil dieses besondere Projekt außerordentlich viel Energie verschlang, sondern auch, weil die persönliche Geschichte eines Verlegers und seines Verlags, Biografie und Beruf, in dieser Generation mittelständischer Verlage noch untrennbar verbunden waren. Verlage waren Familien-
27
Michaela Fenske, Regina Bendix
unternehmen und auch im bundesrepublikanischen Nachkriegsalltag noch häufig eine Angelegenheit von "Vätern und Söhnen".2
Im konkreten Fall von Peuckerts SagenHandwärterbuch erwies sich die vermutete Langzeitaufgabe allerdings als unerwartet begrenzt. Auch die Erinnerung an die zur Einstellung des Großprojekts führenden Ereignisse geht in Ruprechts Bericht ein; dabei wirkt seine Schilderung selbst nach über 40 Jahren so lebhaft, als sei die entscheidende Sitzung erst kürzlich gewesen:
"Denn als die Tür dann aufging und ich hereingebeten wurde ( ... )oder das weiß ich gar nicht mehr situativ so genau, ob er (Peuckert) dann schon ( .. .) zurückgetreten war, weil er offensichtlich sehr erschüttert war, aber sich nicht mehr dagegen gesträubt hat."
Ruprecht berichtet nicht distanziert und resümierend, sondern in aktiver Wortwahl, aus der die Betroffenheit unmittelbar spürbar bleibt. Aus heutiger Sicht wirft diese Betroffenheit Fragen auf: Warum musste der Verleger in dieser entscheidenden Sitzung eigentlich vor einer verschlossenen Türe warten? Und wer war im Raum hinter der verschlossenen Türe versammelt? Was wurde hinter der verschlossenen Türe verhandelt?
Der vorliegende Beitrag3 rekonstruiert die Antworten auf diese Fragen und nutzt sie als Folie, um die Geschichte einer unvollendeten Enzyklopädie und der an ihr beteiligten Akteure zu analysieren. Dafür werden Ergebnisse aus der Analyse von Archivdokumentationen sowie Oral History Interviews in dichter Beschreibung zusammengewoben.4 Der gewählte Zugang gewährt Einblick in kulturelle Praxen der Wissensproduktion anhand eines der gewichtigsten WissensformateS, die Kulturund Geisteswissenschaftlerlinnen hervor-
28
bringen, - den Enzyklopädien. Damit soll ein Beitrag geleistet werden zur historischethnografisch fundierten Erforschung von Wissenschaftskulturen und deren bisher kaum zum Untersuchungsfeld gemachtem kulturellen Habitus. Der theoretische Horizont dieses Beitrags wird von der kulturanthropologischen Wissensforschung abgesteckt. 6 Wissen wird hier als ein kulturelles Konstrukt betrachtet, das sozial, durch die Aushandlung unterschiedlicher Akteure, definiert und vermittelt wird. Wissenschaft und Öffentlichkeit sind demnach keine getrennten Bereiche, sondern verschiedene Akteure im Prozess des "Wissen-Schaffens". Dabei ist die heutige Zeit, die Spätmoderne, durch die Aufweichung der ehemals scharf gezogenen Grenzen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit geprägt. Vor diesem Hintergrund gewinnen auch die Akteure an Bedeutung, die bei der Wahrnehmung von Wissen, seinem Zustandekommen und seiner Weitergabe bislang oft übersehen wurden, wie etwa die Verleger.7
Indem im vorliegenden Fall einer der wichtigsten Agenten des Wissenstransfers in einem wesentlichen Gespräch nicht einbezogen wurde, separierte sich die Wissenschaft -ganz konkret mittels einer verschlossenen Türe- in ihrem Entscheidungsprozess zugleich von ihrem zentralen Mittler gegenüber der Öffentlichkeit; Wissensproduktion und-transferwurden getrennt. Das Beispiel der kontroversen Geschichte des Handwörterbuchs der Sage führt zugleich in die Wissensgeschichte des Faches Volkskunde ein als einem Beispiel für grundlegende Leitlinien der bundesrepublikanischen Wissensund Wissenschaftskultur der Nachkriegszeit in den Geisteswissenschaften. Das Beispiel illustriert die Rolle der enzyklopädischen Projekte als wichtige Instrumente der (Neu-) Bestimmung volkskundlichen Wissens und
der Volkskunde als akademischer Disziplin. Diese Positionierung vollzog sich im betrachteten Zeitraum durch räumlich und diskursiv erzielte Inklusions-und Exklusionspraktiken, die das Kräftespiel zwischen changierenden Wissenschafts- und Verlagsinteressen, verschiedenen Aspirationen und Loyalitäten illustrieren. Gleichzeitig bietet der Fall des in Statu Nascendi gestoppten "Handwörterbuchs der Sage" Gelegenheit, einen Paradigmenwechsel in der Konzeption des Enzyklopädischen nachzuvollziehen und damit das programmatische Selbstverständnis nachfolgender erfolgreicher wissenschaftlicher Nachschlagewerke zu erläutern. Der hier vollzogene Blick hinter die Türe soll gleichsam dazu beitragen, verschiedenste Schlösser und Türen zu öffnen, deren Verriegelung einer freien, reflexiven Wissensentwicklung im Wege steht.
Was also geschah hinter der verschlossenen Türe? Und wie kam es zu dieser Sitzung im Wohnhaus bei der sogenannten Engelsmühle?
Was warum im Wohnhaus bei der Engelsmühle geschah
"Engelsmühle" hieß der idyllische Wohnort, den sich Peuckert für die Zeit nach seiner Emeritierung im Jahre 1959 als Wohn- und Arbeitsstätte ausgesucht hatte. In dem neu gebauten Einfamilienhaus auf dem Gelände eines ehemaligen Gutes mit Mühle8 nahe Darmstadt richtete Peuckert auch die Arbeitsstelle des Sagen-Handwörterbuchs ein. Gemeinsam mit einer Sekretärin und zeitweilig mit einem Assistenten- nach eigenen Worten "mit dem kleinsten Arbeiterstab, den je ein wissenschaftliches Handwörterbuch hatte"9 - arbeitete er an der Verwirklichung seines Projekts. Es war die erste
Hinter verschlossenen Türen
von insgesamt drei Enzyklopädien, die 1958 der Fachwelt vorgestellt wurden. Im ersten Band der von dem Kieler (ab 1960 Göttinger) Volkskundler Kurt Ranke (1908-1985) begründeten internationalen Zeitschrift "Fabula" kündigten die Herausgeber offiziell zwei der geplanten Enzyklopädien als neue Projekte der deutschen Erzählforschung mit internationalem Anspruch an. 10 Das folkloristische "Dreigestirn" umfasste neben dem Sagen-Handwärterbuch die ab 1975 erfolgreich verwirklichte "Encyclopedie/ Enzyklopädie des Märchens" sowie eine geplante, aber nie erschienene "Enzyklopädie des Schwanks und der komischen Formen". Die drei Enzyklopädien sollten die reichen Wissensbestände von beinahe zweihundert Jahren Erzählforschung zusammentragen. Peuckert stellte bereits ein Jahr nach der Ankündigung der Projekte zum ersten internationalen Kongress der Erzählforscher/ innen in Kiel und Kopenhagen im Jahr 1959 einen Vorabdruck aus der ersten Lieferung seines Sagen-Handwörterbuches vor.11 Von 1960 bis 1963 folgten die ersten drei gedruckten Lieferungen.
Der frühe Start gereichte Peuckerts Projekt insofern zum Nachteil, als so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg die Infrastruktur für ein groß angelegtes Projekt international noch nicht gegeben war. Zugleich hatte der Prozess der Verhandlung zeitgemäßer Maßstäbe für enzyklopädische Unternehmen der Nachkriegszeit gerade erst begonnen. Es war das "Handwörterbuch der Sage", anhand dessen das Fach in Deutschland diese Maßstäbe definierte. Dabei wurden sich die führenden, vor allem deutschsprachigen Erzählforscher in einem Punkt in ihrer Sitzung im Wohnhaus bei der Engelsmühle einig: So wie Peuckert es machte, sollte nach dem Krieg keine internationale Enzyklopädie mehr gemacht werden.
29
Michaela Fenske, Regina Bendix
Kontroversen hatte es schon zu Beginn gegeben: So deutete der Nachfolger Peuckerts auf dem Göttinger Lehrstuhl und spätere Hauptherausgeber der "Enzyklopädie des Märchens", Kurt Ranke, dem Verlag "Vandenhoeck & Ruprecht" gegenüber bereits 1958 an, dass er hinsichtlich der geplanten Projekte ein neues Konzept präferiere.U Unter dem Titel "Handwörterbuch der Volkserzählung" wollte er ein Gesamtwerk der Erzählforschung schaffen. Die gattungsbezogene Einteilung in Sage-Märchen-Schwank beruhte nämlich noch gänzlich auf der Tradition der enzyklopädischen Unternehmungen der 1920er J ahre.13 Ranke aber setzte- auch bei der Konzeption seiner "Enzyklopädie des Märchens" - zunehmend weniger auf
Will-Erich Peuckerts Wohnhaus bei der
Engelsmühle
30
Fortsetzung des Alten als vielmehr auf die Konzeption neuer, ihm zeitgemäß erscheinender Konzepte.14 Ganz anders verhielt es sich mit Peuckert: Er setzte nach wie vor auf Tradition; sein unmittelbares Vorbild war das "Handwörterbuch des Aberglaubens" 1S, dem er stilistisch und formal folgte. Dabei setzte sich Peuckert mit seiner Konzeption zunächst wohl deshalb durch, weil sein Projekt bereits weit fortgeschritten war. Eine umfangreiche Materialsammlung war zusammengetragen 16, und seit 1949 flossen Fördermittel der "Deutschen Forschungsgemeinschaft". Ranke hatte demgegenüber erst 1955 die Aufgabe der Herausgabe einer Märchen-Enzyklopädie übernommen. Dementsprechend teilte Peuckert seinem Verleger auf dessen Nachfrage hin im Mai 1956 mit, das" Märchenhandbuch liege noch in weiter Ferne"17
, an ein Zusammengehen der zwei Unternehmen sei daherweder aus verlegerischer noch aus wissenschaftlicher Perspektive zu denken. Zunächst lief alles wie von Peuckert geplant: Offiziell wurde das Wohnhaus bei der Engelsmühle als "Zweigstelle" des Göttinger Instituts geführt; die in Göttingen tätigen Assistenten fertigten für das Handwörterbuch Kopien an und besorgten Bücher aus der "Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek", während im Wohnhaus bei der Engelsmühle emsig am Handwörterbuch gearbeitet wurde.
Bereits nach Erscheinen der ersten zwei Lieferungen des Sagen-Handwörterbuchs gab es massive Kritik: Zahlreiche redaktionelle Schnitzer wie die vergesseneN ennung von Autorennamen, die im Text verwendeten verschiedenen Zeitformen, der persönlich gehaltene Stil des Schreibens (etwa die Verwendung der Ich-Form), uneinheitlich verwendete Abkürzungen oder das fehlende Literaturverzeichnis verärgerten Autoren,
Die ausgeschlossene Öffentlichkeit: Verlage und Forschung fördernde Institutionen
"Die Peinlichkeit wollten sie (die anwesenden Wissenschaftler) wohl Herrn Peuckert ersparen, dass ein nicht unmittelbar wissenschaftlich Betroffener dies erlebt hat" -so erklärt der Verleger Ruprecht heute seinen Ausschluss aus der Sitzung am 6. Januar 1964. Damit benennt Ruprecht das zentrale Kriterium, das zu seinem Ausschluss führte: seine Zugehörigkeit zur Öffentlichkeit. Zwar hatte Ruprecht ein geisteswissenschaftliches Studium mit Promotion abgeschlossen, doch gehörte sein Berufsfeld sowohl in seiner Selbstwahrnehmung als auch in der Wahrnehmung der anwesenden Wissenschaftler nicht zu den Wissenschaften. Das war durchaus nicht immer so gewesen: Bis ins 20. Jahrhundert hinein teilten Verleger und Wissenschaftler die gleiche bürgerliche Lebenswelt, Habitus und Wertsetzungen.28 Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde ihre Beziehung zunehmend marktförmig gestaltet. Eine Folge davon ist die Konstruktion eines idealtypischen Gegensatzes zwischen dem seinen Idealen verpflichteten Wissenschaftler und dem primär dem Markt dienenden Verleger.29 Dabei sollte nicht übersehen werden, dass die Beziehung zwischen Wissenschaftlern und ihren Verlegern auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehr komplex war. Verlage entpuppen sich als Manager vieler verschiedener Kapitalien im Bourdieu'schen Sinne, darunter auch der sozialen Kapitalien in Form von sozialen Beziehungen.
So entsprach der vermuteten Rücksichtnahme auf die Gefühle Peuckerts, die Ruprecht den beteiligten Wissenschaftlern
Hinter verschlossenen Türen
unterstellt, auf der anderen Seite eine beachtliche Diskretion, mit der der Verlag sein Geschäft betrieb. Nachdem Peuckert 1953 dem Verlag das Projekt vorgestellt hatte, holte der Verlag Gutachten von Fachwissenschaftlern ein. Diese Gutachten bescheinigten ebenso wie die Fachgutachten, die die Forschungsgemeinschaft einholte, der geplanten Enzyklopädie und der Person Peuckerts beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Durchführung des Vorhabens. Auf dieser Grundlage investierte der Verlag bis 1964 beträchtliche Mittel und Energien in das Projekt.30
Der Verlag regelte die Zusammenarbeit mit der Druckerei und finanzierte den Druck, soweit diese Kosten nicht bereits durch den Vorschuss des Förderers abgedeckt waren. Der Verlag finanzierte Büromaterialien und stattete Peuckerts Arbeitsstelle mit kleineren technischen Geräten aus; er besorgte Literatur für Peuckerts Bibliothek, die Grundlage des Handwörterbuchs war; er warb international für das Projekt und stellte zu diesem Zweck Werbematerialien her, die auf Kongressen, Tagungen und Messen verteilt wurden. Weitaus wichtiger aber war die Professionalisierung von Produktion und Gestaltung des Handwörterbuchs, auf die der Verlag unermüdlich drängte. Das von Peuckert präferierte Layout des "Handwörterbuchs des Aberglaubens" erhielt durch den Verlag eine rationellere und damit zugleich zeitgemäße Gestaltung; der Verlag drängte auf die strikte Einhaltung von redaktionellen Richtlinien und die Verwendung leserfreundlicher Literaturangaben und Abkürzungen. Die Erstellung von satzfertigen Manuskripten sollte aufgrund der Schulung von Peuckerts Mitarbeitern in Verlag und Druckerei erleichtert werden. Der Verlag bemühte sich, Peuckerts für Außenstehende chaotische Arbeitsweise
33
als Wissen empfangend berücksichtigt; sie wurde aber nicht an der Auswahl und Gestaltung dieses Wissens beteiligt oder als beteiligt imaginiert- die Trennung von Laien und Experten wurde aufrecht erhalten bzw. im Fall der Volkskunde deutlich. Denn die Trennung von Wissenschaft und Öffentlichkeit stellte für das Fach Volkskunde nach dem Zweiten Weltkrieg eine noch keineswegs eindeutige Position dar. Das Entstehen des Faches und seine Entwicklung waren bis ins 20. Jahrhundert hinein durch das Mitwirken etwa von bürgerlichen Honoratioren wie Pfarrern und Lehrern geprägt.35 Diese "Wissensmilieus" repräsentierten innerhalb des Faches die interessierte Öffentlichkeit. Die sich im Fach nach dem Zweiten Weltkrieg abzeichnende Trennung zwischen Experten und Laien wird in der Forschung auch als eine spezifische Art und Weise des Umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit gedeutet.36
Die von Peuckert in Auseinandersetzung mit dem Soziologen Hans Maus über das Fortbestehen der Volkskunde nach 1945 postulierte Trennung zweier Volkskunden während der Zeit des Nationalsozialismus37
ermöglichte demnach eine eindeutige Abgrenzung: in eine am Faschismus ideologisch beteiligte "angewandte Volkskunde" der Laien auf der einen und eine ideologieresistente Volkskunde der "neutral" bzw. "objektiv" weiter arbeitenden Wissenschaftler auf der anderen Seite. Diese klare Trennung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zum beruflichen Selbstverständnis der an Universitäten lehrenden Volkskundler. So schrieb Ranke beispielsweise später im Hinblick auf die in der Fachgesellschaft immer noch tätigen nichtwissenschaftliehen Akteure, dass er sich nicht denken könne, was "der Vorsitzende des Schwäbischen Albvereins
Hinter verschlossenen Türen
oder die Männer vomMorgensternmit den modernen Aspekten unserer Wissenschaft zu tun haben "38
• Ihm und den anderen Vertretern der Nachkriegs-Volkskunde war es um die Setzung neuer, in ihren Augen streng wissenschaftlicher Standards gegangen. Und bei diesem schwierigen Prozess war das gewählte Format Enzyklopädie-trotz und wegen seines erstrebten breiteren Zielpublikums - in diesen ersten Jahrzehnten nach dem Krieg Garant für die weitere Verwissenschaftlichung der Disziplin.39
Konstruktionsprinzipien des Enzyklopädischen im Fach Volkskunde
Bezeichnenderweise erschienen nach der in und für die Schweiz verfassten Einführung in die Volkskunde von Richard Weiss40 in der Bundesrepublik über geraume Zeit keine neuen Einführungsbände zur deutschsprachigen Volkskunde.41 Versuche der Einführung folgten erst gut zwei Jahrzehnte nach Kriegsende, begleitet von heftigen Dekonstruktionen des Faches und seines Vokabulars im Zuge einer ersten Welle der bewussten Vergangenheits bewältigung.42
Eine Analyse dieser Phase bestätigt einerseits die richtungsweisende Impulskraft einer neuen Generation, andererseits aber auch die Schwierigkeit, diese neuen Ideen auch wirkungsmächtig unterzubringen. Viele der Anliegen, die in der deutschen Volkskunde zur Tagung von Falkenstein (1970) geführt haben, wurden auf Flugblättern, in institutseigenen Verlagen und- im Fall der zentralen Falkensteinprotokolle - in Typoskript publiziert.43
Ganz anders sieht dies beim Wissensformat Enzyklopädie aus. Die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme von Großprojekten enzyklopädischen Formates wurde im Falle
35
pädisierung: Es wies eine lange Tradition und daher umfangreiche Wissensbestände auf. Und der Untersuchungsgegenstand, die die Völker verbindenden Erzählungen, empfahl sich nach dem Krieg in besonderem Maße als ein Projekt der Zusammenarbeit der deutschen Volkskunde mit der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft. Auf diese Weise konnte man sich selbst vergleichsweise leicht als Teil der neuen westlichen Wertegemeinschaft darstellen. Von den drei geplanten enzyklopädischen Projekten erhofften sich die für die Forschungsgemeinschaft gutachtenden Volkskundler sogar noch mehr, nämlich die Rückkehr der deutschen Volkskunde an die Spitze internationaler Wissenschaft. 51
In diesem Zusammenhang empfahl sich auch das Wissensformat Typenkatalog. Dieses zur Dokumentation der Verbreitung von Erzählungen genutzte Werkzeug machte ähnlich einer Enzyklopädie Ansprüche strenger Objektivität geltend und schien daher vom Vorwurf möglicher ideologischer Belastungen frei. Typenkataloge wandten gemäß der ihnen zugrunde liegenden geografisch-historischen Methode ein international geltendes System an, sodass auf dieser Basis weltweit Austausch und Kommunikation über abstrahierte Erzählinhalte möglich war. Bereits Anfang der 1970er Jahre verkündeten allerdings namhafte Erzählforscher der damals neuen Generation bei aller gebotenen Wertschätzung ihre Auffassung einer Überbewertung der Kataloge in der deutschen Erzählforschung der Nachkriegszeit bzw. unterstützen vorhandene alternative Konzepte.SZ Auch die "Enzyklopädie des Märchens" änderte unter dem Argumentationsdruck dieser Akteure später ihr zunächst starkam internationalen Typenkatalog von Antti Aarne und Stith Thompson53 ausgerichtetes Konzept. Dies
Hinter verschlossenen Türen
zeigt bereits ein Vergleich der sich über die Jahre zunächst stark verändernden Stichwortverzeichnisse, aber auch die intensiven Diskussionen, die nach Rudolf Sehendas Übernahme des Göttinger Lehrstuhls im Jahr 1973 geführt wurden. So bat Schenda, nachdem er seine Mitherausgeberschaft an der Märchen-Enzyklopädie zugesagt hatte, um eine Stichwortliste, um das der Enzyklopädie zugrunde liegende Konzept zu verstehen und ggf. Veränderungsvorschläge machen zu können. Später präsentierte er eine konsequent am lebendigen Erzählen orientierte Konzeption, in der das Märchen letztendlich als die rare Sondergattung, die es im menschlichen Erzählen darstellt, verortet werden und seine Benennung allenfalls den Titel der Enzyklopädie, nicht aber deren Inhalt determinieren sollte.54 Aus solchen Überlegungen entstanden Modifikationen der Stichwortliste, die zeigen, dass es sich bei der Auswahl von Wissen für Fach-Enzyklopädien um diffizile und differenzierte Aushandlungsprozesse handelt. Die Argumentationen waren zeitgebunden und Akteure unterschiedlicher Generationen und unterschiedlich geprägter Forschungsinteressen konnten dabei zu sehr verschiedenen Ergebnissen kommen. Mehr noch: Das Format "Enzyklopädie" erwies sich auch als ein Feld möglicher Auseinandersetzung von Akteuren aus verschiedenen Wissenschaftlergenerationen um ihr jeweiliges Verständnis von Wissenschaft. Zugleich erweisen sich Enzyklopädien damit als ein Anliegen bestimmter Akteure.
Generation und Wissensmacht
Wissenshistorisch ist bislang kaum erforscht, welche Personen Enzyklopädien zu ihrem wissenschaftlichen Anliegen machten und
37
wendige Glaubwürdigkeit. Er verhalf dem ob seiner Mitwirkungen im NS-System angeschlagenen Fach mit seinem persönlichen Renommee zu einer gewissen Akzeptanz. In diesem Zusammenhang steht auch Peuckerts Überzeugung von einer möglichen Weiterführung des Fachs auf bisheriger Grundlage nach 1945 in seiner Stellungnahme zur Volkskunde im Nationalsozialismus.59 In seinen Lehrveranstaltungen vermittelte Peuckert Kerngebiete des Fachs auf Basis seiner Kulturschichtentheorie60 und streifte weniger die ihn so faszinierenden Bereiche der Magie und des Übernatürlichen.61 Er bemühte sich, diese Bereiche in einer entmythologisierten und damit "parteilosen" Form einer Generation zu vermitteln, die aus dem Krieg kam und das schwierige Erbe aus der Zeit des Nationalsozialismus, von Krieg und Zerstörung in sich trug. Dass ihm dies offensichtlich gelang und dass er im ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von jungen Fachkräften für das Fach zu begeistern wusste, geht aus Veröffentlichungen, Briefen wie auch aus Oral-History-Interviews hervor. 62
Auf der gefestigten Position des Göttinger Lehrstuhls gelang es ihm auch, den von ihm persönlich lange gehegten Plan des "Handwörterbuchs der Sage" in die Tat umzusetzen. Peuckert sah darin die Vollendung seines "Lebensplans"63
, spiegele doch die Gattung "Sage" die geistige Welt des "einfachen Volks" wider, die im Zentrum seines Interesses stand. Sagen waren ihm historische Quelle und damit Zugang zu vergangenen Glaubenswelten. Die vorhandenen Wissensbestände zusammenzutragen, schien für ihn ein krönender Abschluss seiner bisherigen Arbeiten auf dem Feld der G laubensvorstellungen.
Nun gehörte Peuckerts Wissenschaftsund Fachverständnis in den 1960er Jahren
Hinter verschlossenen Türen
nach wie vor der Ära der 1920er Jahre an. Und in diesem Stil, im Stil des "Handwörterbuchs des Aberglaubens", gedachte er auch vierzigJahrespäter sein Sagen-Handwörterbuch zu organisieren. Seine Originalität und Genialität, die in den frühen Werken von der Fachwelt weit über die Volkskunde hinaus als vielversprechend gelobt worden waren, 64 schlugen sich auch in diesem Projekt in Gestalt einer besonderen Auffassung der Materie nieder. Dazu gehört etwa die Verschmelzung von wissenschaftlicher Darstellung und Dargestelltem, von Faktizität und Fiktion, die sich bei gerrauer Lektüre auch im Stichwortverzeichnis und den ersten Lieferungen seines Handwörterbuchs nachweisen lässt. 65 Dass Peuckert nach 1945 diese früheren Traditionen fortsetzte und an seine Vorkriegsarbeiten nahtlos anknüpfte, sollte ihn dann allerdings innerhalb der Volkskunde zunehmend isolieren. 66 In den ersten Jahren derNachkriegszeitherrschte jedoch noch ein ähnliches Verständnis von Wissensproduktion vor, erkennbar an der Wiederaufnahme von kriegsbedingt abgebrochenen Projekten auch in anderen Wissenschaften. Dies lässt sich ferner am guten Leumund erkennen, der Peuckert in den Gutachten zu seinen ersten Anträgen für das SagenHandwärterbuch an die "Deutsche Forschungsgemeinschaft" ab 1949 bescheinigt wurde.67 Doch gerade die Begutachtungen der Anträge zum "Handwörterbuch der Sage" und die Rezensionen zeigen auch einen sukzessiven Wandel der Einstellungen, der in die überaus kritische Einschätzung der ersten Lieferungen des Sagen-Handwörterbuchs mündete.
Die inhaltliche Problematik des Handwörterbuchs lässt sich mit Peuckerts - aus Sicht der frühen 1960er Jahre- unzeitgemäßem Stil der Wissensproduktion erklären. Die Natur der Gutachterkritik, die Son-
39
dass eine grosse Zahl deutscher und ausserdeutscher Kollegen mit mir der gleichen Meinung sind, dass es diesem Werk bislang noch an einer europäischen Fundierung gefehlt habe(. .. ). (. .. )Ich bin immer noch der Meinung, dass unsere Wissenschaft hier durchaus recht gehandelt hat( ... ). "70
Weniger gefangen in der Befindlichkeit eines Menschen am Ausgang seines Berufslebens sahen die Kritiker von Peukerts Projekt sich und ihr Tun unter anderen Gesichtspunkten: Mitten im Aufbau eines Faches nach einer schwierigen Epoche galt es zu manövrieren, um "dem Richtigen", dem Zukunftsträchtigen unter denUnternehmen den Weg zu bahnen. Für diese Fachvertreter- der amerikanische Folklorist Richard Dorson hätte sie "young Turks" genannt71
- galt es abzuwägen zwischen dem Interesse, das Fach ebenso wie die eigene Person innerhalb des Faches zu stärken und der Wertschätzung für einen älteren Kollegen, dessen Tun inkongruent mit der wissenschaftlichen Gegenwart war. 72 Die Forschungsgemeinschaft sah sich als Moderatorinder fachlichen Klärung und unterstützte grundsätzlich den von den Wissenschaftlern schließlich gefassten Plan einerneuen wissenschaftlichen Fundierung des Projekts.73 Im Verlag "Vandenhoeck & Ruprecht" war man zunächst über die Resultate der Januar-Sitzung erschüttert. Der Senior-Verleger schrieb Peuckert einen Brief, in dem er das Vorgefallene bedauerte. Aktennotizen zeigen, dass man seitens des Verlags meinte, dass Peuckert in der besagten Sitzung regelrecht" in die Enge getrieben "74
worden war. Zugleich sah sich der Verlag verpflichtet, die Subskribenten über die vorläufige Einstellung des Handwörterbuchs zu informieren.
An der Mitteilung des Verlags an die Subskribenten entzündete sich ein Konflikt um die "Ehre" der beteiligten Per-
Hinter verschlossenen Türen
sonen. Es gab ein zähes Ringen um die Formulierungen. Insbesondere Peuckert wollte sich keineswegs fehlende fachliche und wissenschaftliche Expertise nachsagen lassen.75 Im Nachhinein überwog dieser Kampf um die Ehre, der umgekehrt Macht und Bedeutung des Wissensformats "Enzyklopädie" spiegelt. Die Fachkollegen, allen voran Ranke, suchten die persönliche Kränkung Peuckerts zu mildern. Noch im Wohnhaus bei der Engelsmühle versuchte Ranke, Peuckerts Interesse auf neue Projekte zu lenken. Später schrieb er darüber an Leopold Kretzenbacher:
"Erst heute komme ich dazu, Dir mitzuteilen, warum wir uns nicht am 6. Januar im D-Zug getroffen haben. Ich war noch längere Zeit bei Peuckert und erlebte nach dem ersten trotzigen Verzicht dann so etwas wie einen Zusammenbruch, und (ich) musste ihm über diese Zeit hinweg helfen. I eh glaube auch, dass es mir gelungen ist, eine Art Euphorie herbeizuführen. Die Tatsache, dass er sich jetzt mit aller Macht auf neue Themen und Bücher wirft, zeugt jedenfalls davon. Ich bin ganz offen der Meinung, dass dieser Schritt vor allem für ihn sehr heilsam ist. Er kehrt jetzt zu seinen eigentlichen Forschungsbereichen, die seinem Können und seinen wissenschaftlichen Anlagen entsprechen, zurück. Verzeih' mir daher bitte, dass ich den Zug nicht mehr erreichen konnte. "76
Ranke beantragte Mittel für anderen Projekte Peuckerts bei der Forschungsgemeinschaft bzw. unterstützte Peuckert bei deren Beantragung.77 In Reaktion auf die Vorkommnisse der Januar-Sitzung ernannte die Mitgliederversammlung der "Deutschen Gesellschaft für Volkskunde" Peuckert zum Ehrenmitglied.78 Peuckert aber reagierte gekränkt und kündigte seinen Rücktritt aus allen Fachgesellschaften an.79 Er knüpfte an seinen Ruf aus der Zwischenkriegszeit als
41
Anmerkungen
1 Interview mit Dr. Dietrich Ruprecht im Verlagshaus Vandenhoeck &.Ruprecht, Göttingen, im Januar 2007 (Interviewerin: Michaela Fenske, Transkription: Esther Heckmann). Soweit nicht anders angemerkt, stammen alle im Folgenden wiedergegeben wörtlichen Zitate aus diesem Interview.
2 Wilhelm Ruprecht: Väter und Söhne. Zwei Jahrhunderte Buchhändler in einer deutschen Universitätsstadt. Göttingen 1935.
3 Die Verfasserinnen bedanken sich bei ihren internationalen Kooperationspartnerlinnen für die fruchtbare Zusammenarbeit. Besonderer Dank gilt Ingrid Tomkowiak, Institut für populäre Kulturen, Abt. Populäre Literaturen, Zürich, sowie Paul Michel und den Kolleg/innen des Projekts "Allgemeinwissen und Gesellschaft", Zürich- ihre kollegiale Unterstützung, ihr Rat und ihre Diskussionsfreude sind uns steter Ansporn. Last but not least danken wir herzlich der studentischen Projektmitarbeiterin, Esther Heckmann, Göttingen, für ihre engagierte Freude an der Wissenschaft, mit der sie das Projekt unterstützt hat.
4 Eingesehen und ausgewertet wurden die relevanten Bestände folgender Archive: Archiv der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG-Archiv), Bonn; Deutsches Volksliedarchiv, Freiburg; Archiv der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, JohannesKünzig-Institut (DGV-Archiv), Freiburg; Einstellungsakten Will-Erich Peuckert, Universitätsarchiv, Göttingen; Freiburger Sagenarchiv, J ohannes-Künzig-Institut, Freiburg; Archiv der Enzyklopädie des Märchens, Göttingen (nur veröffentlichte Unterlagen); Archiv des Instituts für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie der Universität Göttingen (Institutsarchiv KAEE), Göttingen; Nachlass Max Lüthi, Universitätsarchiv, Zürich; Nachlass WillErich Peuckert, Handschriftenabteilung der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek (Nachlass Peuckert), Göttingen; Nachlass Rudolf Schenda, Zentralbibliothek, Zürich; Teil-Nachlass Rudolf Schenda, Institut für populäre Kulturen, Abt. Populäre
Hinter verschlossenen Türen
Literaturen und Medien, Zürich; Archiv des Verlags Vandenhoeck & Ruprecht (Verlagsarchiv V&R), Göttingen. Aus Platzgründen wird im Folgenden nur wenig direkt zitiert. Dabei gilt die Regel, dass im Falle der Personennamen von DFG-Fachgutachtern und DFG-Referenten sowie die Namen aller noch lebenden Zeitzeugen, die sich im Vorfeld dezidiert gegen die wissenshistorische Erforschung der folkloristischen Unternehmen der 1950er bis 1970er Jahre ausgesprochen haben, anonymisiert sind.
5 Zum Konzept des Wissensformats vgl. Wolfgang Kaschuba u. a.: Volkskundliches Wissen und gesellschaftlicher Wissenstransfer. Zur Produktion kultureller Wissensformate im 20. Jahrhundert, in: Thomas Hengartner/Michael Sirnon (Hg.): Bilder, Bücher, Bytes. Zur Medialität des Alltags. 36. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, 23.-26. September in Mainz. Mainz (im Druck).
6 Z. B. Fredrik Barth: An Anthropology of Knowledge, in: Current Anthropology 43. Jg., 2002, 1, 1-18; Johannes Fried/Thomas Kailer (Hg.): Wissenskulturen. Beiträge zu einem forschungsstrategischen Konzept. Berlin 2003; Helga Nowotny/Peter Scott/ Michael Gibbons: Wissenschaft neu denken. Wissen und Öffentlichkeit in einem Zeitalter der Ungewissheit. Weilerswist 2004; Karirr Knorr-Cetina: Wissenskulturen. Ein Vergleich naturwissenschaftlicher Wissensformen. Frankfurt am Main 2002 [1999].
7 Die Rolle von Verlagen im Wissenstransfer wird im Zusammenhang mit der neuen Wissensforschung zunehmend beachtet, zuletzt: Monika Estermann/Ute Schneider (Hg.): Wissenschaftsverlage zwischen Professionalisierung und Popularisierung. Wiesbaden 2007; für die Volkskunde: Heidemarie Schade: De Gruyter und die Volkskunde bis 1945. Ein Verlagsarchiv als wissenschaftsgeschichtliche Quelle, in: Wolfgang Brückner (Hg.): Volkskunde als akademische Disziplin. Studien zur Institutionenausbildung. Wien 1983, 145-160.
8 Der Name eines der ursprünglichen Besit-
43
Bausinger, Gerhard Heilfurth, Leopold Kretzenbacher, Will-Erich Peuckert, Kurt Ranke (als Geschäftsführer der Kommission berufen), Lutz Röhrich, Robert Wildhaber, Matthias Zender; DGV-Archiv, Freiburg, Protokolle der Vorstandssitzungen, Protokoll vom 27.6.1963.
22 Nachzulesen etwa in Rankes Korrespondenz im Institutsarchiv KAEE, Göttingen, bes. Ordner A-C, G-J, K-L, M-0, P-S, Sche-Z. Vermutlich geben hier die für Forschung gesperrten Geschäftsunterlagen der Arbeitsstelle "Enzyklopädie des Märchens" der Jahre 1950-1975 weiteren Aufschluss.
23 Kurt Ranke an Leopold Kretzenbacher, 8.11.1963, Institutsarchiv KAEE, Göttingen, Ordner K-L.
24 Anwesend waren Leopold Kretzenbacher (Kiel), Maurits de Meyer (Antwerpen), Kurt Ranke (Göttingen), Matthias Zender (Bann). Hermann Bausillger (Tübingen) und Robert Wildhaber (Basel) gaben ihr Votum im Vorfeld schriftlich ab, vgl. Protokoll der Kornmissionssitzung am 6. Januar 1964, Verlagsarchiv V&R, Nr. 143: Autoren mit Mappe P (1937-1970).
25 Ebd. 26 Ebd. 27 Interview mit Dr. Dietrich Ruprecht (wie
Anm. 1). 28 Hartmut Zwahr (Hg.): Verleger und Wissen
schaftler. Göttingen 1996. 29 Dietrich Kerlen: Der Verlag. Lehrbuch der
Buchverlagswirtschaft. Stuttgart 2006, bes. S. 21-28.
30 Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Auswertung der Unterlagen im Verlagsarchiv V&R, Göttingen, Autoren mit Mappe P (1937-1970), passim.
31 Teil-Nachlass Rudolf Schenda, Institut für populäre Kulturen, Abt. Populäre Literaturen und Medien, Zürich, passim.
32 Franz Josef Brüggemeier/Friedemann Schmoll: Der Atlas der deutschen Volkskunde und die DFG, in: Forschergruppe zur Geschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1920-1970. Bericht zur Abschlusskonferenz am 30. und 31. Januar 2008, Berlin, www.histsem.uni-freiburg. de/DFG-Geschichte/Bericht2008.pdf (Zugriff 12.8.2008); Friedemann Schmoll: Wie kommt das Volk in die Karte? Zur Visualisie-
Hinter verschlossenen Türen
rung volkskundlichen Wissens im "Atlas der deutschen Volkskunde", in: Helge Gerndt/ Michaela Haibl (Hg.): Der Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft. Münster u. a. 2005, 233-250.
33 Für das Handwörterbuch der Sage vgl. z. B. Aktennotiz von Dietrich Ruprecht vom 12.2.1953, Verlagsarchiv V&R, Göttingen, Nr. 143: Autoren mit Mappe P (1937-1970).
34 Z. B. Carsten Kretschmann: Einleitung: Wissenspopularisierung - ein altes, neues Forschungsfeld, in: ders. (Hg.): Wissenspopularisierung. Konzepte der Wissensverbreitung im Wandel. Berlin 2003, 7-21 (und die dort zusammengefasste Literatur).
35 Z. B. Anita Bagus: Volkskultur in der bildungsbürgerlichen Welt. Zum lnstitutionalisierungsprozeß wissenschaftlicher Volkskunde im wilhelminischen Kaiserreich am Beispiel der Hessischen Vereinigung für Volkskunde. Gießen 2005; Kaschuba u. a., im Druck.
36 Z. B. Andreas Bruck: Vergangenheitsbewältigung?! Kritische Anmerkungen zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Volkskunde, in: Zeitschrift für Volkskunde 86. J g, 1990, 177-202, bes. 178 und die dort zitierte Literatur.
37 Will-Erich Peuckert: Zur Situation der Volkskunde, in: Die Nachbarn 1. Jg., 1948, 130-135.
38 DGV-Archiv, Freiburg, Ehemalige Mitglieder, Ranke, 3.3.1970.
39 Die Verbindung zwischen Wissenschaftlern und Laien ist im Fach Volkskunde grundlegend aufzuarbeiten. Für ein Großprojekt, wie dies volkskundliche Atlanten darstellen, waren die konzeptionierenden Wissenschaftler für die Datengewinnung fast komplett auf die Mithilfe von Laien angewiesen; die Analyse und Herausgabe lag dagegen fest in der Hand der Wissenschaftler. Manche der Beitragsautoren des "Handwörterbuchs des Aberglaubens" können durchaus in die Kategorie der "Amateure" eingeordnet werden, und es ist wissensgeschichtlich gewinnbringend, die Kategorie der "Laien" unter den Perspektiven zu untersuchen, die Marjorie Garher für die Literaturwissenschaft angewandt hat, vgl. Marjorie Garber: Academic lnstincts. Princeton 2001, 3-51. Vgl. auch Davidovic-Walther!Welz in diesem Band.
45



























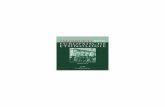





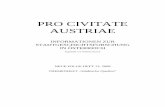








![Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320785600d668140c0d09f0/grundherrschaft-und-sozialstrukturen-im-mittelalterlichen-schlesien-adelige-eigenwirtschaft.jpg)


