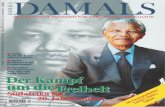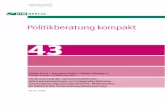Kosten- und Entgelthöhe der kommunalen Abwasserbeseitigung im Fokus
Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im...
Transcript of Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im...
Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adlige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg
Dominik Nowakowski
Einleitung
Schlesien, als eine der westlichsten Regionen Polens, gelangte bereits im 12. und 13. Jahrhundert in den Einwirkungsbereich des deutschen Kulturkreises. Zu den Hauptmerkmalen dieses kulturellen Einflusses gehörten neben der deutschrecht-lichen Anlage von Städten und Dörfern auch der fortschreitende Prozess der Feu-dalisierung in der Gesellschaft und die Entwicklung von Grundherrschaft. Eine wesentliche Rolle spielten bei diesen Veränderungen die immigrierten deutschen Ritter. Der Themenkreis um das schlesische Rittertum genießt seit mehreren Jah-ren großes Interesse in der Forschung. Die Arbeiten zu diesem Fragenkomplex sind selbstverständlich vorwiegend im Kreis der Historiker entstanden. Die gro-ße Zahl der Veröffentlichungen war verbunden mit den in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts und am Anfang des nächsten Jahrhunderts aufgenommenen Ar-beiten zu den schriftlichen Quellen und mit ihrer Herausgabe in Form von Re-gesten, im Rahmen der Serie Codex diplomaticus Silesiae.1 Später, bereits in der
1 Regesten zur schlesischen Geschichte (weiter als: RS), Bd. I-III, hrsg. von Colmar Grünha-gen, Breslau 1875-1886 (Codex Diplomaticus Silesiae [weiter als: CDS], VII); Bd. IV-VI, hrsg. von Colmar Grünhagen und Konrad Wutke, Breslau 1892-1903 (CDS, XVI, XVIII, XXII); Bd. VII, hrsg.
228 Dominik Nowakowski
Zwischenkriegsperiode, sind neben zahlreichen Monographien über die einzelnen Ritterfamilien die ersten Arbeiten zur Entwicklung der privaten Grundherrschaft auf den Gebieten der einzelnen Herzogtümer entstanden. In der Nachkriegszeit haben die Studien über das schlesische Rittertum keinen Erfolg gehabt. Nach der Veröffentlichung der monographischen Bearbeitung von Marek Cetwiński, in welcher der Verfasser den wirtschaftlichen, politischen und finanziellen Fragen sowie dem Zustrom der fremden Ritter nachgeht2, hat sich der Forschungstand sichtbar verbessert. Von ähnlichem Charakter zeugt die neulich veröffentlichte Arbeit von Ulrich Schmilewski.3 Ein Mangel der beiden Bearbeitungen bildet si-cherlich ihre chronologischen Grenzen, die sich auf das 13. Jahrhundert beschrän-ken. Von grundsätzlicher Bedeutung für die Forschungen über das fremde schle-sische Rittertum ist die vor über zehn Jahren veröffentlichte Arbeit von Tomasz Jurek. Der Verfasser beschäftigte sich viel mit der Migration der Ritter aus dem Reichgebiet und mit ihren Karrieren an den Höfen der schlesischen Piasten sowie mit ihren Beziehungen zu dem ansässigen Rittertum. Wegen der chronologischen Bestimmung des Rahmens der Arbeit bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde der im zweiten Teil der Arbeit veröffentlichte Katalog der ritterlichen Familien zum Ausgangspunkt für weitere Forschungen.4
Der Zustrom des fremden Rittertums hat, als wesentlicher Träger westeuro-päischer Kultur, die regionalen Umwandlungsprozesse stark beschleunigt. Dank der Forschungen Jureks wissen wir, dass auf dem Gebiet des Herzogtums Glogau (poln. Głogów) fremde Ritter am zahlreichsten im letzten Viertel des 13. Jahrhun-derts sowie im ersten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts eintrafen, also im Zeitraum der größten politischen Erfolge Herzog Heinrichs III. von Glogau (Regierungs-zeit 1278-1309).5 Innenpolitisch versuchten die schlesischen Herzöge, eigenstän-dige adelige Initiativen zur Feudalisierung (Vergabe von Lehen an Ritter, Dorf-gründungen u. Ä. m.) zu kontrollieren und zu begrenzen. Auch die Glogauer Herrscher bemühten sich, die Mediatisierung der Gesellschaft zu beschleunigen, unter anderem durch ständiges Wechseln der Machteliten. Herrschaftliche Ämter und Hofämter sowie Landgüter wurden häufig neu übertragen – meistens an die Ritterschaft fremder Herkunft.6
von Konrad Wutke, Breslau 1923 (CDS, XXIX); Bd. VIII, hrsg. von Konrad Wutke und Erich Randt, Breslau 1930 (CDS, XXX).
2 Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII w., cz. I: Pochodzenie – gospodarka – polityka, Wrocław 1980; cz. II: Biogramy i rodowody, Wrocław 1982.
3 Ulrich Schmilewski, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle, Würzburg 2001.
4 Tomasz Jurek, Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku, Poznań 1996.5 Ebd., S. 19-28.6 Sławomir Gawlas, O kształt zjednoczonego Królestwa, Warszawa 1996, S. 38-48, 80-88;
Dominik Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008, S. 235, 310.
229Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
Die Problematik des Grundbesitzes im Herzogtum Glogau ist, mit Ausnah-me der Gebiete um Sagan (poln. Żagań), bis heute nicht bearbeitet.7 Grundlage für die Rekonstruktion der Privatgüter bilden schriftliche Quellen.8 Betrach-tet man diese in ihrer Gesamtheit, so stellt man fest, dass ein erhebliches Un-gleichgewicht zwischen den frühen (13. Jahrhundert) und späten Quellen (15. Jahrhundert) besteht. Dieser Unterschied ergibt sich, wie es scheint, vorrangig aus der Tatsache, dass Transaktionen in früher Zeit seltener schriftlich bestätigt wurden, aber auch aus dem Grund, dass sich diese am schlechtesten erhalten haben. Für die fremde Ritterschaft, die uns im Glogauer Gebiet seit der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts bekannt ist, kann als typisches Charakteristikum bemerkt werden, dass sie in ihrer Herrschaftszeit ihre alten Familiennamen beibehielt. Hierin scheint sich das Bewahren des Andenkens an die Herkunft widerzuspie-geln. Erst in den Urkunden aus der 2. Hälfte und besonders vom Ende des 14. Jahrhunderts traten fremde Ritter mit einer zusätzlichen Bezeichnung in attri-butiver Namensform des hiesigen Dorfes, in welchem sie ihre Güter besaßen, auf. Diese Tendenz ist eine typische Erscheinung und gilt im Wesentlichen für ganz Schlesien.9
Die Familie von Rechenberg gehörte zu den mächtigsten im mittelalterli-chen Schlesien, wovon vor allem das gewaltige Vermögen zeugt, das sie mei-stens auf dem Gebiet der Glogauer Provinz gesammelt hat (Abb. 1). Schon aus diesem Grund treten ihre Mitglieder in den schriftlichen Quellen sehr oft auf, meist wegen weiterer Verleihungen oder der Veräußerung allerlei Güter. Dies ermöglicht eine verhältnismäßig präzise Rekonstruktion der Grundherrschaft jener Familie auf dem Gebiet des Herzogtums seit dem Ende des 13. Jahrhun-derts bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts. In der Literatur zum schlesischen Rittertum wurde der Familie Rechenberg bereits viel Platz gewidmet10 und zu den wichtigeren Arbeiten zu diesem Thema muss die kürzlich veröffentlichte
7 Georg Steller, Grund- und Gutsherren im Fürstentum Sagan (1400-1940), Sagan 1940.8 Vor allem: Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Die Kreise Grünberg
und Freystadt (weiter als: Inv. Grünb.), hrsg. von Konrad Wutke, Breslau 1908 (CDS [wie Anm. 1], XXIV); Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis und Stadt Glogau (we-iter als: Inv. Glog.), hrsg. von Konrad Wutke, Breslau 1915 (CDS [wie Anm. 1], XXVIII); Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Sprottau (weiter als: Inv. Spr.), hrsg. von Erich Graber, Breslau 1925 (CDS [wie Anm. 1], XXXI); Die Inventare der nichtstaatlichen Archive Schlesiens. Kreis Sagan (weiter als: Inv. Sag.), hrsg. von Erich Graber, Breslau 1927 (CDS [wie Anm. 1], XXXII); Katalog dokumentów przechowywanych w archiwach państwowych Dolnego Śląska (weiter als: Kd), t. I-II, IV-V, VII, bearbeitet von Roman Stelmach; t. III, IX, bearbeitet von Rościsław Żerelik; t. VI, bearbeitet von Mieczysława Chmielewska; t. VIII, bearbeitet von Roman Stelmach und Rościsław Żerelik, Wrocław 1991-1998.
9 Jurek, Obce… (wie Anm. 4), S. 117-118.10 Ebd., S. 272-273; Tomasz Andrzejewski und Krzysztof Motyl, Siedziby rycerskie w księstwie
głogowskim. Zamki i dwory Rechenbergów i Schönaichów, Nowa Sól 2002.
230 Dominik Nowakowski
Monographie über die Geschichte der Familie gezählt werden, die sich aber grundsätzlich auf die Neuzeit bezieht.11 Trotzdem gibt es immer noch viele ungenügend erforschte, oft auch aus verschiedenen Gründen den Historikern unzugängliche, Probleme. Die auf dem Gebiet der so genannten historischen Archäologie tätigen Forscher haben mehrmals die Vorteile der Kombination von archäologischen und schriftlichen Quellen betont, indem sie auf ihren ge-genseitig ergänzenden Charakter aufmerksam machten.12
11 Tomasz Andrzejewski, Rechenbergowie w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogow-skiego w XVI-XVII wieku, Zielona Góra 2007 (dort eine umfangreiche Bibliographie).
12 Leszek Kajzer, Wstęp do archeologii historycznej w Polsce, Łódź 1996.
Abb. 1. Eigentum der Familie von Rechenberg in dem Herzogtum Glo-gau: 14. Jahrhundert (schwarz); 15. – 15/16. Jahrhunderts (weiß) (bear-beitet von Dominik Nowakowski).
231Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
Die Familie von Rechenberg im Licht der schriftlichen Quellen
Die Geschichte der aus dem Pleißenland stammenden Familie von Rechenberg kann uns viele der genannten Verhältnisse und Probleme veranschaulichen. Im Herzogtum Glogau trat Heinrich von Rechenberg, der im Jahr 1290 als Zeuge in einer Urkunde Herzog Heinrich III. von Glogau erwähnt wird, als erster Ver-treter seines Geschlechts auf.13 Dessen Nachfolger besaßen am Anfang des 14. Jahrhunderts bereits eigene Güter im Gebiet dieses Herzogtums. Es ist uns be-kannt, dass Gottfried (Gelfred) von Rechenberg dem Abt Rudolph von Leubus (poln. Lubiąż) seine beiden Fleischbänke in der Stadt Winzig (poln. Wińsko) verpfändete.14 Außerdem besaßen weitere Angehörige dieses Geschlechts, deren Vornamen uns unbekannt sind, ein Gut in dem Dorf Gossar (poln. Kosierz) südlich der Stadt Krossen (poln. Krosno Odrzańskie).15 Erhebliche Güter gewan-nen die von Rechenberg im Jahr 1323, als Herzog Heinrich IV. von Glogau einem ihm nachfolgenden Heinrich und dessen Erben dreizehn Hufen, die Schultisei (also das Bürgermeisteramt), sowie die Patronatsrechte im Dorf Nilbau (poln. Nielubia) bei Glogau verkaufte.16 Wahrscheinlich war derselbe Heinrich Besitzer des erwähnten Gutes bei Krossen, für welches im Jahr 1340 der Abt des Klosters von Leubus ebenfalls Rechtsansprüche erhob.17 Der oben erwähnte Gottfried (Gelfred) ging nach geraumer Zeit an den Piastenhof Liegnitz-Brieg (poln. Leg-nica-Brzeg). Seine Enkel, die Brüder Heinrich und Dietrich, besaßen zu diesem Zeitpunkt bereits eigene Güter bei Lüben (poln. Lubin). Im Jahr 1359 verlieh Herzog Ludwig I. von Brieg Heinrich und dessen Nachfolgern vier Zinshufen und drei Ruthen im Dorf Herzogswaldau (poln. Niemstów) im Kreise Lüben, die nach dem Tode des Reynczco genannt Abschaks an den Herzog gefallen waren.18 Sein Bruder Dietrich verschrieb im Jahr 1360 seiner Ehefrau Dorothea einen Wohnhof (curia habitationis) mit Vorwerk, fünf Hufen und Gärtnern im benachbarten Dorf Dittersbach (poln. Zwierzyniec) sowie weitere Güter im Dorf Petschkendorf (poln. Pieszków) als Leibgedinge.19 Die Brüder Heinrich und Dietrich von Dittersbach finden in zahlreichen Urkunden aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts Erwähnung, meistens in Zusammenhang mit dem Verkauf der
13 Schlesisches Urkundenbuch (weiter als: SUb), Bd. V, hrsg. von Winfried Irgang, Köln, Wien 1993, Nr. 459; Jurek, Obce… (wie Anm. 4), S. 272.
14 RS (wie Anm. 1), Nr. 3482.15 Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, hrsg. von Herman Markgraf und Josef Wil-
helm Schulte, Breslau 1889 (CDS [wie Anm. 1], XIV), S. 56.16 RS (wie Anm. 1), Nr. 4250.17 RS (wie Anm. 1), Nr. 6499.18 Urkunden Herzog Ludwig I. von Brieg (weiter als: UHLB), hrsg. von Robert Rößler, in:
Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens, VI, 1864, S. 22, Nr. 201.19 Archiwum Państwowe we Wrocławiu (weiter als: APW), Rep. 21, sygn. 1 A, 105; Regesty
śląskie, hrsg. von Wacław Korta, t. V, Wrocław 1990, Nr. 260.
232 Dominik Nowakowski
Lübener Güter.20 Im Laufe des 15. Jahrhunderts verkauften die von Rechenberg wohl ihre gesamten dortigen Güter, da für das Jahr 1491 bereits Nikolaus von Prittwitz von Dittersbach als Besitzer erwähnt wird und im Jahr 1507 Melchior Magnuz genannt Axleben in Herzogswaldau saß.21
Der nächste Vertreter der Glogauer Linie war Heinrich von Rechenberg, erwähnt in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts. Er hatte schon in jener Zeit eine bedeutsame Position inne. Davon zeugt, dass er die Burg Freudenburg (poln. Radosno) sowie das bei Waldenburg (poln. Wałbrzych) gelegene Städtchen Friedland (poln. Mieroszów) kaufte.22 Es ist nicht bekannt, unter welchen Um-ständen und wann genau Heinrich die Güter im Dorf Windisch Borau (poln. Borów Polski) bei Neustädtel (poln. Nowe Miasteczko) erhielt. Dies muss aber schon vor dem Jahr 1391 geschehen sein, da er in einer Urkunde diesen Jahres
20 UHLB (wie Anm. 18), nr 518, 780; Kd (wie Anm. 8), IV, Nr. 630; VI, Nr. 225, 226; IX, Nr. 11.21 APW (wie Anm. 19), Rep. 133, Dep. Nickisch-Rosenegk, Acc. 34/1901, sygn. 9; Inv. Glog.
(wie Anm. 8), S. 147.22 Jurek, Obce… (wie Anm. 4), S. 272.
Abb. 2. A – Siegel Heinrichs Rechenberg von Windisch Borau aus dem Jahr 1391 (nach Dominik Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księ-stwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008, S. 81); B – Sandste-intafel Georgs von Rechenberg von Windisch Borau mit Inschrift zum Burgenbau aus dem Jahr 1550 (nach Nowakowski, Siedziby książęce..., S. 173).
233Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
schon als Heinrich von Rechenberg zu Windischen Boraw auftritt (Abb. 2:A). Zehn Jahre zuvor hatte König Wenzel von Böhmen den königlichen Anteil der Stadt Beuthen (poln. Bytom Odrzański) und den Hof Tarnau (poln. Tarnów Jezierny) als Manneslehen an Nikolaus von Rechenberg wegen seiner treuen Dienste verliehen.23 1383 jedoch änderte der König diese Regelung und erklärte, dass diese Güter in den Besitz Nikolaus’ als Pfand übergehen sollen, da der König ihm eintausend Schock böhmischer Groschen schuldete.24 Ein sehr wich-tiges Dokument in Zusammenhang mit der Burg von Tarnau stammt aus dem Jahr 1399. Es ist uns bekannt, dass Herzog Ruprecht von Liegnitz (als Vormund der minderjährigen Herzöge von Glogau), den Gebrüder Nikolaus, Günther, Clemens und Heinrich von Rechenberg gestattete, einen Wall am königlichen Teil der Burg in Tarnau zu bauen, diese von Grund auf zu befestigen und zum Schutz des Landes im Glogauer Weichbild zu verbessern. Die Urkunde bestätig-te ebenfalls freies Öffnungsrecht für die Landesherren und das Recht, die Burg, die in das Eigentum der Brüder übergegangen war, jederzeit zu verkaufen.25 Im Jahr 1397 kauften die genannten Brüder von demselben Herzog Ruprecht für 1200 Prager Groschen Stadt, Haus und Land Primkenau (poln. Przemków) mit allen seinen dazugehörigen Besitzungen, die in dessen Weichbild lagen.26 Die Größe dieser Güter bezeugt eine Urkunde von 1407. Damals erteilte Her-zog Johann von Glogau und Sagan Franz von Warnsdorf und seinen Erben eine Lehnsanwartschaft auf Haus und Stadt Primkenau mit den Dörfern Lau-terbach (poln. Młynów), Langen (poln. Łężce), Wolfersdorf (poln. Wilkocin), Weißig (poln. Wysoka), Klein Heinzendorf (poln. Jędrzychówek), Krampf (poln. Krępa), Klein Gläsersdorf (poln. Szklarki) und die Hälfte von Haselbach (poln. Łakociny) für den Fall, dass die Gebrüder von Rechenberg ohne Nachkommen sterben würden.27 Im Jahr 1420 verlieh Nikolaus von Rechenberg mit der Zu-stimmung seiner Brüder dem Nikolaus Kücheler (Pfarrer zu Primkenau), und dessen Nachfolgern vier Mark jährlicher Zinsen im Dorf Jätschine (poln. Jac-zyn) im Glogauer Weichbild als Seelgeräte.28 Wahrscheinlich war es derselbe Nikolaus oder aber ein Namensvetter, der im Jahr 1439 den Brüdern Hantsche, Ludwig und Siegmund von Nostitz alle seine Rechte im Dorf Hertwigswaldau
23 Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter (weiter als: Lehns.), Bd. I, hrsg. von Colmar Grünhagen und Herman Markgraf, Leipzig 1881 (Pu-blicationen aus den königlichen preußischen Staatsarchiven, 7), S. 195; Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 108.
24 Inv. Glog. (wie Anm. 8), S. 4.25 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 106.26 Inv. Spr. (wie Anm. 8), S. 108.27 Inv. Spr. (wie Anm. 8), S. 108.28 Inv. Glog. (wie Anm. 8), S. 59.
234 Dominik Nowakowski
(poln. Chotków) und den Hof im Burglehn zum Sagan, diesseits des Eckersdorfer Tores gelegen, verkaufte.29
Ständiger Hauptsitz der Familie von Rechenberg war die Burg von Windisch Borau. Hier stifteten die Brüder Nikolaus, Heinrich, Günter und Klemens noch vor dem Jahr 1414 eine Kirche, die damals aus der Pfarrgemeinde Zölling (poln. Solniki) ausgeschlossen war.30 In dieser Zeit war die dortige Burg ein Zentrum der relativ kleinen Güter, die in den Dörfern Windisch Borau, Groß Borau (poln. Borów Wielki) und Lindenau (poln. Gołaszyn) lagen.31 Zur Linie Win-disch Borau gehörten wenigstens bis zum Jahr 1476 die Primkenauer Güter, wo-von eine Urkunde der Herzogin Barbara zeugt, in welcher sie die Zugehörigkeit dieser Güter zum Besitz Melchior Rechenbergs von Windisch Borau bestätigt.32 Die erste Aufteilung dieser Güter fand 1484 statt, in deren Ergebnis die Brü-der Melchior und Klemens das Dorf Windisch Borau mit dem Sitz (Hof), zwei Vorwerken und anderen Gütern erhielten. In dieser Urkunde ist auch vermerkt, dass die restlichen Güter, die bislang noch ungeteilt waren, unter den Brüdern auf der Hochzeit ihrer Schwester aufzuteilen seien.33 Die beschlossene Teilung der Güter erfolgte dann sicherlich am Ende des 15. Jahrhunderts oder am An-fang des 16. Jahrhunderts, da uns bekannt ist, dass im Jahr 1508 das Städtchen Primkenau mit seinem Sitz bereits an Kasper von Rechenberg von Klitschdorf (poln. Kliczków) gefallen war. Im Jahre 1528 wird Hans von Rechenberg erst-mals als auf Primkenau gesessen erwähnt.34
Weitere Güter, die meistens im nordöstlichen Teil des Herzogtums gelegen waren, erhielt die Familie von Rechenberg in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts sowie am Anfang des 16. Jahrhunderts. Im Jahre 1468 hatte Herzog Heinrich XI. von Glogau sein Städtchen Schlawa (poln. Sława) mit Schloss und Weichbild und allen Zugehörungen für 1000 Mark böhmischer Groschen mit der Opti-on auf Wiederkauf an Melchior von Rechenberg verkauft.35 Im Laufe der Zeit begannen nun die von Rechenberg in der Nähe des Städtchens Schlawa einen geschlossen Güterkomplex aufzubauen. 1470 verlieh Herzog Heinrich dem er-wähnten Melchior wegen seiner treuen Dienste alle herzoglichen Gefälle für das benachbarte Dorf Laubegast (poln. Lubogoszcz), das nach dem Tode Vlatschs
29 Regesten Saganer Lehnbriefe vor 1510, bearb. von Georg Steller, Kiew 1942 (Maschinen-schrift in der Universitätsbibliothek von Breslau), Nr. 195.
30 Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Dampf. Kol. Głog., 1414.09.03; Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 71.
31 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 76, 78.32 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 77.33 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 79.34 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 84.35 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 76.
235Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
von Kottwitz ohne Lehnserben geblieben war.36 Wir wissen auch, dass im Jahr 1477 das Dorf Rädchen (poln. Radzyń) zu den Gütern von Schlawa gehörte.37 Es ist jedoch nicht bekannt, wann genau der erste Vertreter der Familie sich nach Schlawa versetzen ließ, da der bereits erwähnte Melchior sich immer als von Windisch Borau bekannte. Erst in den Urkunden des Jahres 1497 treten erstma-lig Nikolaus Rechenberg zu der Slawe und Hans Rechenberg von der Slaw sowie in einer Urkunde zwei Jahre später beide Brüder als zur Slawhe gesessen auf.38
Im Jahr 1506 kauften die Brüder Hans und Nikolaus von Schlawa von Sieg-mund, dem damaligen Herzog Schlesiens und Glogaus, Sitz und Gut mit Vor-werken des Städtchens Neustädtel (poln. Nowe Miasteczko) und des Dorfes Poppschütz (poln. Popęszyce) sowie alles, was früher Hans Tauchsdorf innehat-te, als Lehen.39 Etwas später begrenzte Herzog Siegmund auf Bitten Hans von Rechenbergs diesem und seinen Brüdern die Dienste ihrer Güter in Schlawa auf die Bereitstellung von nur sechs Pferden (also Ritter). Zu diesen Gütern zähl-ten Dörfer Strunz (poln. Strącze), Rädchen, Laubegast, Windisch Borau, Lindau und Teile der Städte Neustädtel, Beuthen und Tarnau samt ihrer Zugehörig-keiten.40 Wahrscheinlich erwarb Baltazar von Rechenberg im Jahr 1507 oder früher den Sitz in Carolath (poln. Siedlisko), da er in dieser Zeit als Besitzer des Hause(s) Karlat erwähnt wird.41 Ein Jahr später kaufte der oben erwähnte Hans von Rechenberg von Christoph Odrowąż das Haus (Haus) in Glogau, welches sich zuvor im Besitz Ernst Tschammers befand.42 Im gleichen Jahr bestätigte Sigismund, König von Polen und Herzog von Glogau, Hans von Rechenberg von Windisch Borau, als Ritter auf der Schlawe gesessen, und dessen Brüdern Nikolaus, Balthasar und Klemens, ferner Kasper auf Klitschdorf und Primkenau und Georg von Windisch Borau erneut den Besitz aller ihrer Dörfer, Güter und Weichbilder in den Herzogtümern von Glogau und Freystadt (poln. Kożuchów), befreite sie von alle Diensten und Schuldigkeiten und belehnte sie zu gesamter Hand.43 Außer den bereits genannten Gütern gehörten zu diesen noch die Dör-fer Lippen (poln. Lipiny), Reinberg (poln. Runów), Lauterbach (poln. Młynów) und Parchau (poln. Parchów). Die Güter von Schlawa wurden im Jahr 1510 um einen Teil der Familie von Braun von Laubegast erweitert.44 Im Jahr 1523 verlieh
36 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 76.37 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 77.38 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 80.39 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 81.40 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 81.41 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 102.42 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 81.43 Lehns. (wie Anm. 23), I, S. 253-254; Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 108.44 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 82.
236 Dominik Nowakowski
König Ludwig von Ungarn Hans und Nickel von Rechenberg das Gut im be-nachbarten Merzdorf (poln. Marcinkowo – heute der westliche Teil des Dorfes Stare Strącze) mit den Gerichtsbarkeitsrechten sowie vier Hufen und drei Ruten Acker.45
Etwas früher, im Jahre 1516, kauften die Brüder Hans und Nickel von König Ladislaus II. von Ungarn den Rittersitz Deutsch Wartenberg (poln. Otyń) mit den Dörfern Erkelsdorf (poln. Zakęcie), Kunersdorf (poln. Konradowo), Zauche (poln. Sucha), Nittritz (poln. Niedoradz), Bobernig (poln. Bobrowniki), Klei-nitz (poln. Klenica), sowie je ein Viertel der Dörfer Moderitz (poln. Modrzyca) und Kusser (poln. Koserz – damals ein Teil der Nowa Sól) für 7000 ungarische Gulden.46 Und von einer Urkunde, die ein Jahr früher ausgestellt worden war, wissen wir, dass beiden Brüdern auch ein Anteil von Freistadt gehörte.47 1522 bestätigte König Ludwig II. von Ungarn Hans von Rechenberg den Besitz des Schlosses in Freistadt mit allen Zugehörungen zur lebenslangen Nutzung.48
Besitz und Bau von Güterkomplexen waren häufige Ursache von Streitig-keiten zwischen den jeweiligen Nachbarn. Eine solche Situation entstand im Jahr 1521, als sich Nikolaus von Rechenberg von Schlawa und Balthasar von Löben von Kontopp (poln. Konotop) um den Verlauf der Grenze ihrer beiden Güter stritten.49 Manchmal, besonders in Zeiten herrschaftlicher Schwäche, ent-wickelten sich hier blutige Fehden. Aus den Annales Glogovienses wissen wir zum Beispiel, dass im Jahre 1493 Klemens von Rechenberg von Windisch Bo-rau Christoph Glaubitz von Alt Gabel (poln. Stara Jabłona) unter nicht näher bekannten Umständen tötete.50
Rittersitze und Höfe der Familie von Rechenberg im Licht der archäologischen und architektonischen Quellen
Aus den oben genannten Quellen folgt, dass sich im Mittelalter (vom 14. Jahr-hundert bis zum 1. Viertel des 16. Jahrhunderts) auf dem Gebiet des Herzog-tums Glogau zehn bis elf Sitze und Höfe sowie zwei städtische Höfe in Sagan und Glogau im Besitz der Familie von Rechenberg befanden. Unter ihnen wa-ren auch solche, die erst von der Familie von Rechenberg gegründet (gestiftet) wurden (z. B. Dittersbach, Windisch Borau), aber auch solche, die bereits frü-her als herzogliche Burgen existierten (Polnisch Tarnau, Freistadt, Neustädtel,
45 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 84.46 Lehns. (wie Anm. 23), I, S. 261-262; Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 100.47 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 82.48 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 82.49 Inv. Grünb. (wie Anm. 8), S. 83.50 Annales Glogovienses bis zum Jahre 1493 nebst urkundlichen Beilagen, hrsg. von Herman
Markgraf, Breslau 1877 (Scriptores rerum Silesiacarum, 10), S. 66.
237Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
Abb. 3. Grundrisse der Burganlagen mit Bauchronologie und den wich-tigsten Grabungsbefunden: A – Polnisch Tarnau/Tarnów Jezierny (nach Dominik Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskie-go w średniowieczu, Wrocław 2008, S. 402); B – Windisch Borau/Borów Polski (nach Nowakowski, Siedziby książęce..., S. 425); C – Carolath/Sie-dlisko (nach Róża Kąsinowska, Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003, S. 185).
238 Dominik Nowakowski
Primkenau, Schlawa, Carolath, Deutsch Wartenberg). In dieser zweiten Gruppe kann man zum einen Sitze zusammenfassen, die im Mittelalter keine großen Umbauten oder Modernisierungen erfuhren (Polnisch Tarnau und wahrschein-lich auch Neustädtel, Primkenau und Schlawa), zum anderen solche, die von den Rechenbergs komplett umgebaut worden waren (z. B. Carolath, Deutsch Wartenberg).
Die Mehrheit der genannten Objekte unterlag in späterer Zeit einem erheb-lichen Umbau oder fiel sogar der totalen Zerstörung anheim. Die wenigen Bei-spiele der besser erhaltenen bekannten Sitze der Familie von Rechenberg sind die Gründungen von Dittersbach bei Lüben, Polnisch Tarnau, Windisch Borau und Carolath. Die erste der genannten Anlagen liegt auf einer sumpfigen Wie-se südwestlich des heutigen Dorfes. Ihr zentrales Element ist ein kegelförmiger Rundhügel, der einen Durchmesser von etwa 34 m und noch eine Höhe von ca. 2 m aufweist. Der Hügel ist von einem 10-15 m breiten Graben umgeben. Im südwestlichen Abschnitt des Grabens befindet sich eine Landbrücke, die wahr-scheinlich ein Relikt des ehemaligen Eingangs darstellt. Auf der Oberfläche wur-den zahlreiche helle und blaugraue Scherben gefunden, die sich ganz allgemein in das 14.-15. Jahrhundert datieren lassen. Wir können mit großer Wahrschein-lichkeit annehmen, dass es sich bei dem erhaltenen Objekt um den 1360 in den Schriftquellen erwähnten Hof (curia) handelt. Eine weitere erhaltene Verteidi-gungsanlage, die Burg von Polnisch Tarnau, besteht aus drei wesentlichen Ele-menten (Abb. 3:A). Die Hauptburg, ein kegelförmiger Erdhügel, gründet sich auf eine regelmäßig-ovale Basis und besitzt – mit einem Durchmesser von 45 m und einer Höhe von bis zu 6 m – noch enorme Ausmaße. Auf dem Plateau steht ein achtseitiges Gebäude des Jagdhofs aus dem 17. Jahrhundert. Der Hügel wird kom-plett von einem wasserführenden Graben sowie im Osten und Süden zusätzlich von einem äußeren Abschnittwall umgeben. Nördlich der Hauptburg liegt der zweite Erdhügel mit einem viereckigen Grundriss und einer Ausdehnung von 40 x 28 m. Ein weiteres Element der Anlage stellt ein flaches Areal dar, das zwischen Hauptburg, Unterburg und Seeufer gelegen ist. Die Nordgrenze dieses Verteidi-gungskomplexes ist in den Überresten eines ca. 20 m breiten Außengrabens noch erkennbar. Auf Grundlage der archäologischen Befunde konnten drei elementare Entwicklungsphasen der Burg festgestellt werden. Die herzogliche Burg bestand seit dem Ende des 13. Jahrhunderts und wurde in der ersten Hälfte des folgen-den Jahrhunderts umgebaut.51 Die späterhin teilweise zerstörte Anlage wurde an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert durch die Familie von Rechenberg wie-der aufgebaut. Nachweislich ist die Vorburg in jener Zeit an einer Stelle, wo man zwei Wirtschaftsgebäude errichtete, erhöht worden. Das erste Gebäude wurde ganz allgemein als Magazin genutzt, im zweiten befand sich eine Werkstatt zur
51 1295/96 – als Kastellanei bezeugt (SUb [wie Anm. 13], VI, Nr. 197, 244); 1331 – als castrum erwähnt (Lehns. [wie Anm. 23], I, S. 133).
239Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
Abb. 4. Polnisch Tarnau/Tarnów Jezierny. Kleinfunde aus der 1. Hälfte des 15. Jahrhunderts (nach Artur Boguszewicz, Dominik Nowakowski und Zbigniew Pozorski, Średniowieczne założenie obronne w Tarnowie Jeziernym w świetle badań z lat 1999-2000, in: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 2001, S. 403, 406).
240 Dominik Nowakowski
Abb. 5. Windisch Borau/Borów Polski. Kleinfunde aus dem 15. Jahrhun-dert (nach Dominik Nowakowski, Siedziby książęce i rycerskie księstwa głogowskiego w średniowieczu, Wrocław 2008, S. 427-430).
241Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
Buntmetallbearbeitung. Es ist möglich, dass man dort Schmuck herstellte, der auf dem örtlichen Markt verkauft wurde. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-derts ist diese Burg im Zuge einer Belagerung zerstört worden. Mit der jüngsten Nutzungsphase verbinden sich zahlreiche Funde wie Keramikbruchstücke, Bron-zebeschläge, Elemente der Bewaffnung (Abb. 4) sowie andere Gebrauchsartikel.52 Der größte Rittersitz des Herzogtums Glogau wurde in Windisch Borau errichtet. Dieser Sitz war ursprünglich ein zweiflügeliger, mit Feldsteinen gemauerter Hof, der auf dem Hang eines natürlichen, nicht allzu großen Hügels errichtet wurde (Abb. 3:B). Die Anlage hatte einen viereckigen, 29 x 22,5 m großen Grundriss mit einem Wohnhaus im östlichen Teil und einem parallel gelegenen Wirtschaftsge-bäude. Die archäologischen Untersuchungen weisen darauf hin, dass dieser aus Feldsteinen gebaute Hof genau an der Stelle eines in Holz-Lehm-Konstruktion
52 Artur Boguszewicz, Dominik Nowakowski und Zbigniew Pozorski, Średniowieczne zało-żenie obronne w Tarnowie Jeziernym w świetle badań z lat 1999-2000, in: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 43, 2001, S. 395-408; Nowakowski, Siedziby… (wie Anm. 6), S. 401-410.
Abb. 6. Karte des Herzogtums Glogau von 1772 mit der freien Herrschaft Carolath – Beuthen (rot) (Sammlungen des Nationalenbetriebs der Fa-milie Ossoliński in Breslau, Sygn. 654/B/II).
242 Dominik Nowakowski
errichteten Vorgängerbaus vom Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut worden war.53 Darüber hinaus wurden auf dem Hof ein steinerner Brunnen und eine Abfall-grube mit reichem archäologischem Material gefunden. Unter den Kleinfunden befinden sich Keramikscherben von Bierpokalen, Messer, ein Hackmesser sowie Erzeugnisse aus Knochen (Abb. 5).
Wahrscheinlich wurde auch der Rittersitz in Carolath auf dem Platz einer älteren herzoglichen Burg gebaut.54 Im ersten Drittel des 16. Jahrhunderts hat-ten die Rechenbergs einen regelmäßigen, einflügeligen 26 x 24,5 m großen Hof errichtet (Abb. 3:C).55 Aus der schriftlichen Überlieferung ist uns bekannt, dass der Rittersitz ursprünglich von einem Graben umgeben war, über den eine Zug-brücke führte.56 Seit der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts ist dieser relativ beschei-dene Sitz durch seine neuen Besitzer, die Familie von Schönaich, sukzessive ausgebaut worden. Das neue, mehrflügelige und prächtige Schloss entwickelte sich zum Zentrum und Hauptsitz der im 16. Jahrhundert entstandenen freien Herrschaft Carolath-Beuthen (Abb. 6).
Kulturhistorische Aspekte
Die Burgen, die von ihren Herren in den Zentren ihrer Privatgüter erbaut wurden, hatten eine symbolische Bedeutung im Sinne der Demonstration von Macht und gesellschaftlicher Position. Man kann sagen, dass Form und Gestalt der Burg die Ständezugehörigkeit des Stifters unterstrichen. Die Burg hatte also die Bedeutung eines Elements höfischer Kultur und galt darüber hinaus als ein Denkmal der Leistungen des Besitzers.57 Um ihren Familiennamen in der öf-fentlichen Erinnerung zu halten, ließen die Stifter der Burgen diese oftmals auf Stiftungstafeln und anderen architektonischen Details anbringen, wie z.B. in der Renaissance-Anlage von Windisch Borau (Abb. 2:B). Die Stiftung eines Stamm-sitzes im Zentrum des Güterkomplexes kann man auch als ein Element der sich an Ort und Stelle ausbildenden ritterlich-familiären Identität verstehen. Diesen Prozess der Identifizierung illustriert das bereits erwähnte Aufkommen neuer
53 1295 des Guts (allodium) im Dorf Borow Polonicali hatte Theodericus de Pesna, in dieser Zeit Kastellane von Freystadt (SUb [wie Anm. 13], VI, Nr. 196, 202).
54 1298 – erwähnte novo castro Sedlscho als Besitz des Herzogs Heinrich III. von Glogau (SUb [wie Anm. 13], VI, Nr. 367).
55 Róża Kąsinowska, Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003, S. 185, 191.
56 Christian David Klopsch, Geschichte des Geschlechts von Schönaich, Bd. I. Die Geschichte Stadt Beuthen und der dazu gehörigen Castellanei bis 1561, Glogau 1847, S. 46-48.
57 Stanisław Kołodziejski, Średniowieczne rezydencje obronne możnowładztwa na terenie wo-jewództwa krakowskiego, Kraków 1994, S. 84; Malte Bischoff, Die Burg als repräsentativer Wohn-sitz, in: Horst Wolfgang Böhme u.a., Hrsg., Burgen in Mitteleuropa, Stuttgart, 1999, Bd. II, S. 52.
243Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Fürstentum Glogau
Familiennamen der fremden Ritter. Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts findet sich, wie oben erwähnt, neben dem alten Namen zusätzlich derjenige des Dorfes, in dem sich der neue Stammsitz befand.
Ähnlich wie der Bau von Rittersitzen hatten auch Kirchenstiftungen eine symbolische Bedeutung (Abb. 7). Ein Kirchenbau kam der Errichtung einer Stammburg gleich – ein Element der Würde seines Stifters. Zeugen dieses Vor-gangs sind unter anderem architektonische Elemente der Kirchenräume, auf denen die Familienwappen angebracht wurden (z. B. auf Schlusssteinen oder Sakramentshäusern), sowie zahlreiche Grabsteine vorrangig aus der Zeit der Renaissance. Die Ritter konnten Patronatsrechte an Kirchen, welche diese be-reits durch ehemalige Stifter besaßen, nachträglich durch Kauf oder Verleihung erwerben. Das Kirchenpatronat, das in den schriftlichen Quellen oft als Kir-chenlehen bezeichnet wurde, galt in der Regel als Privateigentum und war so-mit Teil der Herrschaft. Für das Kirchenpatronat galten die allgemeinen Regeln der Veräußerung wie im Fall anderer verhandelbarer Rechte und Güter. Abge-sehen von der religiösen Bedeutung profitierte man mit dem Bau einer Kirche auch in finanzieller Hinsicht.58 In der Literatur findet sich zudem die Meinung,
58 Jerzy Mularczyk, Ze studiów nad prawem patronatu na Śląsku w wiekach średnich, in: Sobótka, XXXII, 2, 1977, S. 133-134; Cetwiński, Rycerstwo… (wie Anm. 2), cz. I, S. 103-107; Jan
Abb. 7. Pfarrkirche von Windisch Borau/Borów Polski. Stiftung der Fa-milie von Rechenberg vom Anfang des 15. Jahrhunderts (Foto Dominik Nowakowski 2007).
244 Dominik Nowakowski
dass der Pfarrkreis, der mit der neu gestifteten Kirche verbunden war, alle Gü-ter in sich vereinigte.59
Rittersitze und Höfe übten verschiedene Funktionen aus, wobei anfänglich die wichtigste von ihnen Schutz und Sicherheit der Familie des Stifters war. Im Laufe der Zeit wurden um die Sitze Komplexe von Landgütern gebildet und die Einkommen von diesen bildeten die hauptsächliche finanzielle Grundlage der Bewohner der Residenz und sicherten ihnen ein ihrem Stand entsprechendes Leben. Am Beispiel der in den schriftlichen Quellen häufig erwähnten Familie von Rechenberg konnten wir den Bildungsprozess eines ritterlichen Eigengutes im Glogauer Gebiet vorstellen. Im Zeitraum vom ersten Auftreten der Fami-lie am Ende des 13. Jahrhunderts bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts übte sie keinerlei herzogliche Ämter aus, häufte aber dank geschickter Politik rie-sige Güter an, die auch sechs Städtchen und über dreißig Dörfer umfassten. Emanzipatorische Bewegungen des Adels förderten die Entstehung erster freier Standesherrschaften. Die größte freie Herrschaft Carolath-Beuthen entstand auf Basis der Eigengüter der Familie von Rechenberg, die sich in der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts im zentral-östlichen Teil des Herzogtums Glogau ausbildete.
Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w średniowieczu. Zagadnienia społeczne i gospo-darcze, Poznań-Wrocław, 2001, S. 150, 158-162.
59 Dagmara Adamska, Fundacje dewocyjne rycerstwa księstwa świdnicko-jaworskiego w śre-dniowieczu, Wrocław 2005, S. 117.
![Page 1: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Grundherrschaft und Sozialstrukturen im mittelalterlichen Schlesien. Adelige Eigenwirtschaft im Herzogtum Glogau am Beispiel der Karriere der Ritterfamilie von Rechenberg, [w:] A.](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022212/6320785600d668140c0d09f0/html5/thumbnails/18.jpg)