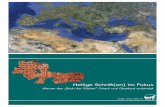Suburbanisierung im östlichen Europa im Zeitalter neoliberaler Stadtentwicklung
Kosten- und Entgelthöhe der kommunalen Abwasserbeseitigung im Fokus
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Kosten- und Entgelthöhe der kommunalen Abwasserbeseitigung im Fokus
Kosten- und Entgelthöhe der kommunalen Abwasserbeseitigung im Fokus
Robert Holländer, Sabine Lautenschläger und Jana Rüger (Leipzig), Thomas Abel und Marcel Fälsch
(Berlin)
Die Abwasserwirtschaft in Deutschland unterliegt einer Vielzahl regionalspezifischer Besonderheiten,
die sich in Kosten- und Entgeltunterschieden niederschlagen. Im Rahmen der hier vorgestellten Unter-
suchung der Universität Leipzig werden derartige Besonderheiten für den Abwassersektor systematisch
erfasst und kausale Wirkungszusammenhänge zwischen regionalspezifischen Rahmenbedingungen und
der Höhe von Entsorgungskosten beleuchtet. Auf diese Weise wird gezeigt, dass sich die anfallenden
Kosten unabhängig von der betrieblichen Effizienz von Entsorger zu Entsorger unterscheiden. Neben
dem Kostenanfall bestimmt die Kostenverteilung über das jeweilige Entgeltmodell die Höhe jährlich zu
entrichtender Abwasserentgelte. Angesichts unterschiedlicher Rahmenbedingungen einerseits und der
vorhandenen Tarifmodellheterogenität andererseits sind Entgeltunterschiede jedoch kritisch zu reflek-
tieren und es wird dargelegt, weshalb Entgeltvergleiche besonderer methodischer Sorgfalt bedürfen.
Schlagwörter: Abwasserbeseitigung, Entsorgungskosten, Entgeltvergleich, Rahmenbedingung, ex-
terne Einflussfaktoren, Tarifmodell
1 Hintergrund
Die Abwasserbeseitigung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ist ihrem Wesen nach standort-
gebunden, weshalb sich Aufgabenträger mit den regionalspezifischen Gegebenheiten vor Ort arran-
gieren müssen. Solche strukturellen Rahmenbedingungen können sich lokal jedoch stark unterschei-
den und sich dementsprechend günstig oder ungünstig auf die Kosten der Abwasserbeseitigung aus-
wirken. Die Debatte über die Angemessenheit von Abwasserentgelten zeigt, dass seitens der Öffent-
lichkeit von den Entsorgungsunternehmen erwartet wird, darlegen zu können, ob im Vergleich zu an-
deren Standorten (un)günstigere strukturelle Rahmenbedingungen vorliegen.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, in Anlehnung an die erarbeiteten Gutachten zur Trink-
wasserversorgung [2], [3] auch für den Abwasserbereich eine ähnliche Struktur relevanter Rahmen-
bedingungen zu erarbeiten. Dabei sind eine Reihe wesentlicher Unterschiede im Vergleich zur Trink-
wasserversorgung zu berücksichtigen und in ihrer Kostenrelevanz zu hinterfragen. Unterschiede er-
geben sich bereits aus der jeweils zu erbringenden Leistung. Während im Trinkwasserbereich für alle
Unternehmen die Aufgabe darin besteht, Haushalte mit Frischwasser in rechtlich festgelegter Trink-
wasserqualität zu versorgen, ist in der Abwasserwirtschaft kein einheitliches Produkt definiert, dass
alle Entsorger in gleicher Qualität zu erbringen haben. Zwar ist allen Abwasserentsorgern gemein,
dass Siedlungsabwässer abgeleitet und vor der Einleitung in Gewässer behandelt werden müssen.
Allerdings unterscheiden sich die naturräumlich oder nutzungsbedingt vorgegebenen Einleitungsbe-
dingungen von Entsorger zu Entsorger und damit auch die zu erbringende Reinigungsleistung. Wei-
tere Unterschiede zur Trinkwasserversorgung ergeben sich aus den abweichenden Prozessketten, die
zum einen andere Aufgabenfelder umschließen und zum anderen weniger linear verknüpft sind. Die
Trennung zwischen Misch- und Trennsystemen muss dabei genauso betrachtet werden, wie die An-
forderungen aus dem Regenwassermanagement und der Einfluss der deutlich heterogeneren Ta-
rifstruktur auf die Höhe der Entgelte.
2 Kostenrelevanz externer Einflüsse
Externe Einflussfaktoren wie anfallende Niederschlagsmengen, vorherrschende Bodenverhältnisse
oder der Umfang an Zuwendungen der öffentlichen Hand beeinflussen die betrieblichen Anlagen-
und Prozessstrukturen sowie kaufmännische Handlungsvorgänge der Unternehmen der Abwasserbe-
seitigung [vgl. Abbildung 1]. Daraus ergeben sich Wirkungen auf verschiedene Kostenstellen und -
größen.
Abbildung 1: Wirkungsebenen des Kosteneinflusses struktureller Rahmenbedingungen der Abwasserbeseiti-gung [1]
Zur Beschreibung der Kostenwirkung einzelner Faktoren ist zunächst die Relevanz der jeweiligen Rah-
menbedingung für die Abwasserbeseitigung zu prüfen, um die sich daraus ergebenden Auswirkungen
auf die technische und betriebliche Gestaltung (Mengengerüst) der Abwasserbeseitigung abschätzen
zu können. Konkret können strukturelle Rahmenbedingungen bewirken, dass für die Leistungserbrin-
gung mehr oder weniger Produktionsfaktoren eingesetzt werden und erforderliche Produktionsfakto-
ren teurer oder günstiger ausfallen. Daneben ergeben sich aus einigen strukturellen Rahmenbedin-
gungen direkte Einflüsse, die ohne Veränderungen des Mengengerüsts direkt auf die Höhe beispiels-
weise der spezifischen Entsorgungskosten je Einwohner oder der spezifischen Baukosten je Kilometer
Kanalnetz wirken. Derartige Kostenunterschiede werden über Abwasserentgelte letztlich an die End-
kunden weitergegeben, wobei in Abhängigkeit des lokal zur Anwendung kommenden Tarifgefüges
bestimmte Faktoren zusätzlich in geringerem oder stärkerem Ausmaß entgeltwirksam werden kön-
nen.
3 Systematische Erfassung struktureller Rahmenbedingung
Zur Erleichterung der transparenten Darstellung und Kommunikation wird eine Systematik der nach-
stehenden fünf externen Einflussfaktoren vorgestellt, denen jeweils zugehörige strukturelle Rahmen-
bedingungen untergeordnet werden.
(1) Naturräumliche Gegebenheiten;
(2) Siedlungsstrukturelle Gegebenheiten;
(3) Nutzungsbedingte Gegebenheiten und Marktumfeld;
(4) Rechtliche Anforderungen;
(5) Investitionstätigkeit & Ansatzmodalitäten für Kapitalkosten.
Jeder externe Einflussfaktor fasst somit bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen zusammen, die
jeweils einzeln einer genauen Analyse ihrer Kostenwirkung bedürfen und im Folgenden näher erläu-
tert werden.
Faktor 1: Naturräumliche Gegebenheiten
Aufgrund der engen Verknüpfung von Ort des Abwasseranfalls und Ort der Abwasserbehandlung, ist
es unumgänglich, die naturräumlichen Gegebenheiten bei der entsorgungsgebietsspezifischen Aus-
gestaltung der Dienstleistungserbringung zu berücksichtigen. Naturräumliche Gegebenheiten werden
in Form differierender meteorologischer, hydrologischer, geologischer und topographischer Verhält-
nisse im Entsorgungsgebiet (kosten-)wirksam.
Abbildung 2: Naturräumliche Einflussgrößen auf die Kosten der Abwasserbeseitigung [1]
Bei Betrachtung der in Abbildung 2 dargestellten Wirkungsebenen der naturräumlichen Einflussgröße
zeigt sich bereits, dass die unter den fünf Einflussfaktoren zusammengefassten Rahmenbedingungen
bei detaillierter Betrachtung einer hohen Komplexität unterliegen und sich in ihren Wirkungen über-
lagern, d.h. ausgleichen aber auch verstärken können. So leiten sich z. B. die baulichen Anforderun-
gen an die Gestaltung und Dimensionierung der Anlagen zur Abwasserableitung und -behandlung
maßgeblich vom Umfang des gebietsspezifischen Abwasseranfalls ab, welcher seinerseits durch me-
teorologische Verhältnissen wie dem spezifischen Niederschlags- und Fremdwasseraufkommen de-
terminiert wird. Geohydrologische und topographische Rahmenbedingungen beeinflussen hingegen
beispielsweise die Bau- und Verlegebedingungen. So variiert etwa die lokal vorhandene Gewässersi-
tuation räumlich stark und bedingt vielfach zusätzliche immissionsorientierte Anforderungen hin-
sichtlich der zu erbringenden Reinigungsleistung. Die Gewässersituation bestimmt ebenfalls mögliche
Einleitstellen für gereinigtes Abwasser und Niederschlagswasser. In Abhängigkeit der Verfügbarkeit
geeigneter Vorfluter ergeben sich Rückwirkungen auf notwendige Kanalnetzlängen und erforderliche
Beckenvolumen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung. In der Folge ergeben sich für jeden Entsor-
ger gebietsspezifische Vorgaben an Bau und Betrieb des Anlagenbestandes, um diesen naturräumlich
bedingten Anforderungen gerecht zu werden.
Faktor 2: Siedlungsstrukturelle Gegebenheiten
Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung weisen enge Wechselwirkungen zur Ausgestaltung der
Abwasserbeseitigung auf. Zunächst bestimmt die Siedlungsgröße die Dimensionierung der Kläran-
lage. Dabei wirken sich einerseits die mit der Größenklasse der Kläranlage verbundenen steigenden
Reinigungsanforderungen nach Abwasserverordnung kostenerhöhend aus, andererseits profitieren
große Anlagen von kostensenkenden Skaleneffekten. Die erforderliche Kanalnetzlänge zum Erreichen
der Kläranlagen des Entsorgungsgebietes wird ebenfalls durch die Größe und die Siedlungsstruktur
determiniert. Neben der Größe beeinflusst die Siedlungsdichte die Nachfragedichte und die spezifi-
sche Netzausstattung, wobei sich wiederum kostentreibende aber auch entlastende Effekte ergeben
können. Besonders in urban geprägten Gebieten stellen sich Kanalnetzausstattung und Kanalbau-
maßnahmen häufig als äußerst kostenintensiv und komplex dar: Hohe Abflussbeiwerte und hohe An-
forderungen an den Überflutungsschutz wirken sich auf die Bemessung von Kanälen, Regenbecken
und Pumpwerken aus. Hinzu kommen Umgehungsbauwerke und Querungen von Hindernissen wie
U-Bahnen etc., aus denen höhere Betriebskosten pro Meter Kanalnetz resultieren. Allerdings erge-
ben sich pro Einwohner im Gegensatz zu weniger dicht besiedelten Gebieten geringere Betriebskos-
ten aufgrund der geringen spezifischen Kanalnetzlänge in urbanen Gebieten.
Es reicht jedoch nicht aus, zum Verständnis der Kostenstruktur der Entsorgungsunternehmen allein
die statische Betrachtung von Größe und Struktur des Entsorgungsgebietes zu einem bestimmten
Zeitpunkt zu betrachten. Bau- und Erweiterungszeitpunkte des Anlagenbestandes der Siedlungsent-
wicklung beeinflussen über die Material- und Altersstruktur die Betriebs- und Kapitalkosten der Ent-
sorgungsunternehmen erheblich. Es bedarf somit zusätzlich der Berücksichtigung vergangener und
prognostizierter Entwicklungen.
Faktor 3: Nutzungsbedingte Gegebenheiten
In weiten Teilen Deutschlands haben nutzungsbedingte, strukturelle und demografische Wandlungs-
prozesse verbunden mit einem abnehmenden Pro-Kopf-Trinkwasserverbrauch seit Jahren zu einem
rückläufigen Schmutzwasseranfall geführt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass mit abnehmender
Schmutzwassermenge ebenfalls abnehmende Niederschlagsmengen einhergehen. Im Gegenteil ist zu
erwarten, dass die Anforderungen an das Regenwassermanagement sogar weiter ansteigen [4]. Dies
bedeutet insbesondere für Mischsysteme, in denen sich die Anlagenbemessung nach dem Nieder-
schlagswasseranfall richtet, dass abnehmende Schmutzwassermengen nicht zu einem verringerten
Anlagenbestand führen. Wie in Abbildung 2 exemplarisch dargestellt, hat ein abnehmender Abwas-
seranfall steigende spezifische Kosten je Kubikmeter zur Folge, da der Anteil der Fixkosten auch bei
abnehmender Abwassermenge zunächst konstant bleibt. Anpassungen an langfristige Veränderun-
gen des Abwasseranfalls können somit nur sehr langsam erfolgen. Andererseits stehen vom demo-
grafischen Wandel betroffene Gebiete teilweise in enger Nachbarschaft Regionen mit Bevölkerungs-
wachstum und gleichbleibendem Abwasseranfall gegenüber, so dass sich auch bei gleichen Kosten
die spezifische Entgelthöhe zweier Entsorgungsunternehmen stark unterscheiden kann.
Abbildung 3: Auswirkungen eines zurückgehenden Schmutzwasseranfalls auf die Abwasserbeseitigungskos-ten am Beispiel eines fiktiven Entsorgungsunternehmens [1]
Kostensteigerungen kann auch der bestehende oder angestrebte Anschlussgrad der Entsorgungsge-
biete herbeiführen, wenn entweder Randlagen kostenintensiv an das zentrale System angeschlossen
werden oder aber eine kostenintensive Entsorgungen des Klärschlamms dezentraler Behandlungsan-
lagen notwendig ist [5]. Die Nutzer des Entwässerungssystems beeinflussen ferner entscheidend die
Möglichkeiten und die Realisierung dezentraler Niederschlagswasserbewirtschaftung auf privaten
Grundstücken. Je nach ausgewählter Flächennutzungsform können darüber hinaus aufgrund einer
erhöhten stofflichen Belastung des, etwa von Metalldächern oder abflusswirksam versiegelten In-
dustrieflächen abfließenden, Niederschlagswassers kostenwirksam werden. Nicht zuletzt beeinflusst
das Marktumfeld über regional verschiedene Preise für Bauleistungen und die Reststoffentsorgung
die Kostenstruktur der Entsorgungsunternehmen, wobei zusätzlich zu beachten ist, dass nicht jedem
Entsorgungsunternehmen die gleichen Möglichkeiten zur Klärschlamm- und Reststoffentsorgung zur
Verfügung stehen.
Faktor 4: Rechtliche Anforderungen
Rechtliche Anforderungen, die sich regional aufgrund des föderalen Systems unterscheiden, beein-
flussen die Kosten- und Entgelthöhe auf verschiedene Weise. Zunächst steigen mit zunehmender
Größenklasse der Abwasserbehandlungsanlage bundesweit die Reinigungsanforderungen gemäß An-
hang 1 der Abwasserverordnung. Hinzu kommen je nach örtlicher Gewässersituation über diese An-
80%
90%
100%
110%
120%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Schmutzwasseranfall [m3] Gesamtkosten [€]
Niederschlagswasseranfall [m3] spezifische Kosten [€/m3]
rela
tive
En
twic
klu
ng
im z
eit
lich
en
forderungen hinausgehende immissionsorientierte Einleitbedingungen. Im Ergebnis kann jedes Ent-
sorgungsunternehmen mit gebietsspezifischen rechtlichen Vorgaben bezüglich der Einleitbedingun-
gen konfrontiert sein. Unterschiede bestehen auch hinsichtlich rechtlicher Vorgaben zur Ableitung
von Niederschlagswassers. Zum einen verfahren die Bundesländer hier nicht einheitlich, zum ande-
ren erfolgen durch die zuständigen Behörden auch hier je nach Bundesland immissionsorientierte
Einleitbegrenzungen, die sich auf stoffliche und/oder hydraulische Aspekte beziehen können. Unter-
schiedliche rechtliche Regelungen auf Landesebene resultieren in abweichenden Zuständigkeitsgren-
zen, unterschiedlichen Anforderungen an den Anlagenbetrieb und uneinheitlichen Möglichkeiten der
Klärschlammentsorgung mit entsprechenden Auswirkungen auf die Kostenstruktur der Entsorgungs-
unternehmen. Schließlich führen die divergierenden landesspezifischen Regelungen der Kommunal-
abgabengesetze zu den unter Faktor 5 beschriebenen unterschiedlichen Maßstäben bei der Kosten-
veranlagung.
Faktor 5: Investitionstätigkeit & Ansatzmodalitäten für Kapitalkosten
Die Höhe der für die Entgeltkalkulation ansatzfähigen spezifischen kalkulatorischen Kosten wird de-
terminiert durch den Ansatz einer Eigenkapitalverzinsung, der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer
und die Wahl der Bemessungsgrundlage für kalkulatorische Abschreibungen. Werden bei letzteren
WBZW als Bemessungsgrundlage, eine kurze Nutzungsdauer und eine Eigenkapitalverzinsung ge-
wählt, wirkt sich dies tendenziell erhöhend auf die Entgelte aus, während der Ansatz der Abschrei-
bungsbasis nach AHK, der Ansatz einer verhältnismäßig langen Nutzungsdauer und keine Verzinsung
des Eigenkapitals in tendenziell geringeren Entgeltsätze resultiert. Je nach Aktivierungspraxis geht
der Instandhaltungsaufwand eines Entsorgers in unterschiedlicher zeitlicher Verteilung und/oder un-
terschiedlicher Höhe in die kalkulatorischen Kapitalkosten ein. Nicht zu unterschätzende Folgen auf
die entgeltwirksam ansetzbaren Kosten ergeben sich ebenfalls in Abhängigkeit der ökonomischen
Nachhaltigkeit der Investitionstätigkeit. Eine, etwa aus kommunalpolitischen Erwägungen, vermin-
derte Investitionstätigkeit in den Erhalt des Anlagenbestands wirkt sich zwar in der Gegenwart kos-
tenmindernd aus, kann jedoch den Substanzerhalt und damit die Effektivität und Qualität der Aufga-
benerfüllung in der Zukunft beeinträchtigen. Überdies können sich aufgrund der langen Lebensdauer
des abwasserwirtschaftlichen Anlagenbestands, selbst in der Vergangenheit ausgereichte Fördermit-
tel und Zuschüsse der öffentlichen Hand, auf die gegenwärtige und zukünftige Kostensituation eines
Entsorgers auswirken und sind bei einschlägigen Unternehmensvergleichen im Hinterkopf zu behal-
ten.
Abbildung unternehmensspezifischer Rahmenbedingungen
Die anhand der fünf Faktoren aufgezeigten kausalen Wirkungszusammenhänge zwischen einer struk-
turellen Rahmenbedingungen im Einzelnen und den daraus resultierenden Auswirkungen müssen bei
Vergleichen der Kostenstruktur von Entsorgungsunternehmen für jeden Entsorger gesondert ermit-
telt werden. Neben der Erfassung relevanter struktureller Einflüsse sind für einen aussagekräftigen
Vergleich Kostenwirkungen anhand geeigneter Indikatoren abzubilden und zu quantifizieren. Zur un-
ternehmensspezifischen Abbildung der entsprechenden Zusammenhänge kann auf die Darstellungen
des Gutachtens aufgebaut und teilweise auf vorhandene Datenbestände bestehender wasserwirt-
schaftlicher Initiativen zur Darstellung der Leistungsfähigkeit im Abwassersektor, wie dem betriebli-
chen Benchmarking, zurückgegriffen werden. Für eine gezielte und umfassende Bewertung der struk-
turellen Rahmenbedingungen eines Abwasserentsorgers ist jedoch die Erfassung weiterer Indikato-
ren notwendig.
4 Vergleichbarkeit von Entgelten
Zumeist werden allerdings weniger Kosten- als vielmehr Entgeltunterschiede thematisiert, weshalb
ergänzend zu den Einflüssen auf die Kostenhöhe, die Gegenfinanzierung anfallender Kosten über Ent-
gelte zu betrachten ist. Neben der Refinanzierung über Zuwendungen der öffentlichen Hand werden
Kosten vor allem kreditfinanziert und über Abwasserentgelte auf die Nutzer umgelegt.
Vergleich heterogener Tarifmodelle
Wie sich bestimmte Kosten in Abwasserentgelten niederschlagen, wird über das jeweilige Tarifmo-
dell bestimmt. Dabei können sich sowohl zur Anwendung kommende Tarifbestandteile, die Auftei-
lung der Kostenumlage auf bestimmte Tarifkomponenten als auch die Höhe von Entgeltsätzen je Ent-
geltbestandteil unterscheiden. Folglich lassen sich einzelne Entgeltsätze mehrerer Entsorger nicht un-
mittelbar miteinander vergleichen. Entgeltvergleiche können somit nur dann aussagekräftige Ergeb-
nisse liefern, wenn die im Entsorgungsgebiet wirksamen Rahmenbedingungen einerseits und das in-
dividuelle Tarifmodell andererseits sowie die diesem Modell zugrundliegenden Annahmen umfas-
send berücksichtigt werden.
Verzerrungen durch Durchschnittsbetrachtungen
Das methodische Vorgehen bei Entgeltvergleichen kann ebenfalls zu unerwünschten Effekten führen.
Dies ist etwa der Fall, wenn behelfsmäßig mithilfe von Durchschnittswerten ein modellhafter Ein-
heitshaushalts gebildet wird, die Tarife der zu vergleichenden Abwasserentsorger auf diesen ange-
wandt und anschließend die sich ergebende jährliche Entgeltsumme verglichen wird. Der Vergleich
lediglich der jährlichen Belastung vernachlässigt einerseits die Kostenwirkung der in verschiedenen
Gebieten möglicherweise völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Andererseits lässt die Ent-
geltberechnung anhand eines konstruierten Modellhaushalts keine Aussage über die Höhe der tat-
sächlich entstehenden Entgeltausgaben der realen Nutzer vor Ort zu. Stattdessen werden fiktive Ab-
wasserentgelte für nicht repräsentative Modellhaushalte errechnet, die im betreffenden Entsor-
gungsgebiet in dieser Form möglicherweise nicht einmal existieren. Derartige Entgeltvergleiche wer-
fen bestenfalls die Frage nach der grundsätzlichen Vergleichbarkeit von Entgelten auf und können
keinesfalls als Argumentationsgrundlage für verlässliche Aussagen über die Effizienz der lokalen Ab-
wasserentsorger herangezogen werden.
5 Fazit
Die vorgestellte Untersuchung befasst sich in dieser Form erstmals umfassend mit den Unterschie-
den von Abwasserentgelten in Deutschland und liefert wesentliche Begründungsansätze für die vor-
handene Heterogenität. Es wurden die vielfältigen strukturellen Rahmenbedingungen aufgezeigt, die
sich auf die Kosten der Abwasserbeseitigung auswirken und vom Abwasserentsorger nicht oder nur
langfristig zu beeinflussen sind. Damit wird verdeutlicht, warum sich die Kosten der Abwasserbeseiti-
gung lokal aufgrund von Einflüssen auf betriebliche Prozesse und der Anlagenausstattung, die aus
den vorherrschenden strukturellen Rahmenbedingungen wie Bodenverhältnissen, anfallender Nie-
derschlagsmenge oder öffentlichen Subventionen resultieren, unterscheiden und sich auf die Entsor-
gungskosten auswirken.
In der Zusammenschau lässt sich festhalten, dass die Durchführung von Kosten- und Entgeltverglei-
chen keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Effizienz der Leistungserbringung erlaubt und ein Ver-
gleich methodisch schwierig ist. Erschwerend kommt hinzu, dass das Aufgabenspektrum und die
Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung im Abwassersektor komplexer und vielfältiger ausgestaltet
sind, als beispielsweise im Bereich der Wasserversorgung, wo Trinkwasser in definierter Qualität zur
Verfügung gestellt wird. Ein einheitliches Produkt gibt es im Abwassersektor nicht. Vielmehr gilt es
die Ableitung und Reinigung von Schmutz- und Niederschlagswasser unterschiedlichster Zusammen-
setzung und Verschmutzung unter Einsatz eines breiten Spektrums möglicher Reinigungsoptionen
am Standort sicher zu stellen. Der Berücksichtigung lokal vorherrschender Besonderheiten und struk-
tureller Rahmenbedingungen kommt folglich eine besonders große Bedeutung zu, um Kostenunter-
schiede richtig einordnen zu können. Ein Kosten- und Entgeltvergleich beispielsweise über standardi-
sierte Einheitshaushalte kann diesem Anspruch nur äußerst bedingt gerecht werden.
Danksagung
Der besondere Dank der Autoren und des VKUs gilt den Mitgliedern des Praxisbegleitkreises, deren
engagierte Mitarbeit und aktive Unterstützung sowie die Vielzahl nützlicher Hinweise wesentlich zu
einer praxisnahen Ausgestaltung der Ergebnisse beigetragen hat.
Literatur
[1] R. Holländer, S. Lautenschläger, J. Rüger, M. Fälsch: Abwasserentgelte in Deutschland –
Wie beeinflussen unterschiedliche Rahmenbedingungen die Kosten- und Entgeltstruktur der
Abwasserbeseitigung? Gutachten im Auftrag des VKU. Berlin, 2013.
[2] R. Holländer, C. Zenker, B. Ammermüller, S. Geyler, S. Lautenschläger: Trinkwasserpreise in
Deutschland – Welche Faktoren begründen regionale Unterschiede? Gutachten. Institut für
Infrastruktur und Ressourcenmanagement, Universität Leipzig, Leipzig, 2009.
[3] R. Holländer, M. Fälsch, S. Geyler, S. Lautenschläger: Trinkwasserpreise in Deutschland –
Wie lassen sich verschiedene Rahmenbedingungen für die Wasserversorgung anhand von
Indikatoren abbilden? Gutachten. Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement,
Universität Leipzig, Leipzig, 2009
[4] Siehe hierzu Abschnitt 3.2 in E. Gawel, R. Holländer, W. Köck, H. Schindler, J. Rüger, K.
Kern, K. Anlauf, C. Töpfer: Praktische Ausgestaltung einer fortzuentwickelnden Abwasser-
abgabe sowie mögliche Inhalte einer Regelung. Gutachten im Auftrag des UBA. Dessau-
Roßlau, 2014 (im Druck).
[5] DWA 2011
Autoren:
Prof. Dr.-Ing. Robert Holländer
Dipl.-Ing. Sabine Lautenschläger
Dipl.-Kffr. Jana Rüger
Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement
Universität Leipzig
Grimmaische Straße 12
04109 Leipzig
E-Mail: [email protected]
Thomas Abel
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Marcel Fälsch
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)
Invalidenstraße 91
10115 Berlin
E-Mail: [email protected]