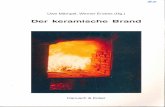Königinnen der Almen - Prähistorische Weidewirtschaft im Schnalstal
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Königinnen der Almen - Prähistorische Weidewirtschaft im Schnalstal
DER SCHLERN 4 11H
eft
Archäologie
Königinnen der AlmenPrähistorische Weidewirtschaft im Schnalstal
Von Andreas Putzer
Im Rahmen des Forschungsprojektes „The Neolithic Agricultural Regime in the Inner Alps“ (FWF-Projekt Nr. 211129-G19) – dass in Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Botanik der Universität Innsbruck und dem
Amt für Bodendenkmäler Bozen im Jahre 2009 initiiert wurde – gelang es einen außergewöhnlichen Fundort im Schnalstal (Südtirol/Italien) (Abb. 1) zu ergraben. Ziel des Forschungsprojektes ist anhand archäologischer bzw. botanischer Untersuchungen den Beginn der weidewirtschaftlichen Nutzung hochalpiner Seitentäler durch den Menschen zeitlich festzumachen.
Fundort und Fundgeschichte
Das Finailtal (Gem. Schnals) ist ein Seitental, des durch die wohl bekannteste archäologische Entdeckung des vorigen Jahrhunderts „Dem Mann aus
dem Eis“ bekannt gewordenen Schnalstals (Abb. 2). Das hochalpine Tal beginnt am Finailhof, oberhalb des Stausees in der Fraktion Vernagt auf 1.952 m. ü. M.,
Abb. 1 Schnalstal.
Ausarbeitung: A. Putzer
11H
eft DER SCHLERN 5
Archäologie
und verläuft in süd-nördliche Richtung. Das steil ansteigende Gelände und die erosionsbedingten Geröllformationen aus altkristallinen Schiefergneisen prägen das Bild dieses abgeschiedenen Tales. Den Talschluss bildet die Bergkette der Grawand (3.251 m. ü. M.). Das Tal ist Großteils unbewaldet und wird vom Jungbauer des Finailhofes1 als Weidegebiet für sein Vieh und das benachbarter Bauern genutzt. Ein Wanderweg verbindet das Tal mit dem nahegelegenen Skigebiet Kurzras, der in den Sommermonaten im Gegensatz zu den übrigen Wanderwegen im Schnalstal, aufgrund des mühsamen Aufstiegs wenig begangen ist. Der archäologische Fundort liegt auf halber Strecke zwischen Finailsee und Finailhof, in einer der wenigen Senken auf 2.460 m. ü. M. Mehrere neuzeitliche Strukturen zeugen von der Nutzung des Ortes als Weidefläche. Der Jungbauer vom Finailhof nutzt heute eine erst kürzlich errichtete Holzhütte2 als Salzlager, zum Salzen des Viehbestandes, der ausschließlich aus Schafen und Ziegen besteht. Die Senke wird im Volksmund als „Finailgrube“ oder als „Untere Grube“3 bezeichnet. Entdeckt wurde die Fundstelle bereits in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Hansi Platzgummer aus dem Schnalstal. An mehreren größeren und kleineren Steinblöcken vor Ort entdeckte er eingearbeitete Schalen unterschiedlicher Größe. 2001 wurden von Herrn Domenico Nisi Sondierungen am Fundort durchgeführt, und zwar direkt unterhalb einer der Schalensteinplatten, die dafür leider dem archäologischen Befund entrissen wurde. Die darunterliegende Kulturschicht interpretierte er als Feuerstellen, die angeblich Keramik4 enthielt. Eine durchgeführte C-14 Untersuchung5 datiert nach 1.624–1.420 v. Chr. (kal.), zwei weitere Radiokarbondatierungen von der Finailgrube – dessen genaue Entnahme allerdings nicht mehr auszumachen ist – datieren nach 1.687–1.502 v. Chr. (kal.) und 1.300–1.200 v. Chr.6 (kal.). Zu erwähnen gilt eine weitere archäologische Fundstelle am Finailsee auf 2.709 m. ü. M., wo obertägig Silexfunde aus der Mittelsteinzeit7 geborgen werden konnten.
Abb. 2 Lage der Finailgrube im Finailtal, Gemeinde Schnals.
Aufnahme: A. Putzer
DER SCHLERN 6 11H
eft
Archäologie
Die Finailgrube (Abb. 3) besteht aus zwei übereinanderliegenden Terrassen. Von der untersten Terrasse überblickt man den südlichen Teil des Tales. An
Strukturen finden sich ein verstürzter Steinbau sowie eine Viehtränke. Auf der etwas höher gelegenen Terrasse liegt ebenfalls ein verstürzter Steinbau, ein noch gut erhaltener Viehpferch, sowie die rezente Holzhütte zum Salzen des Viehs. Das archäologisch relevante Areal erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 200 m². Im Süden befindet sich eine Fläche mit ausgelegten Steinplatten, die zum Teil durch die Errichtung des Salzlagers gestört wurde. Im gestörten Bereich tritt zwischen den Steinplatten immer wieder eine Kulturschicht zum Vorschein. Etwas nördlich davon befindet sich obertägig eine Ansammlung großer Steinblöcke bzw. -platten, die teilweise vom Rasenboden überwachsen sind und von denen drei eingearbeitete Schalen tragen. Es handelt sich jeweils um Schalengruppen, eine Platte hat sieben
Der Befund
Abb. 3 Finailgrube.
Aufnahme: A. Putzer
Abb. 4 Schalensteinplatte, Finailgrube.
Aufnahme: A. Putzer
11H
eft DER SCHLERN 7
Archäologie
Schalen (Abb. 4), die zweite vier und der Steinblock drei. Erste Sondagen in unmittelbarer Umgebung ergaben auf Anhieb die Präsenz einer Kulturschicht und prähistorische Keramik. In Folge dieser ersten Ergebnisse wurde eine Fläche von 36 m² westlich der Steinansammlung untersucht. Nach Abnahme des Rasenbodens und einer darunterliegenden eingeschwemmten Schicht befand sich eine Abdeckung aus Steinplatten (Abb. 5), die direkt an der Kulturschicht auflag. Im Nordosten war die Steinabdeckung recht dicht, während sie im westlichen Bereich nur mehr lückenhaft erhalten war. Die fehlenden Steinplatten konnten teilweise noch im Negativ nachgewiesen werden. Die Kulturschicht war in den zentralen Feldern bis zu 20 cm stark und dünnte in alle Richtung hin aus. Im Norden war sie teilweise gar nicht vorhanden, im Osten wurde sie von großen Monolithen eingegrenzt, die teilweise noch in situ senkrecht eingetieft waren. Im Westen setzte sich die Schicht im Profil fort, während sie im Süden nicht an die Außengrenze des Schnittes reichte. In den Feldern mit der stärksten Konzentration traten unterhalb der Kulturschicht vier Gruben zutage. Drei Gruben waren knapp nebeneinander in einer Reihe angelegt. Grube 1 konnte nur teilweise freigelegt werden, da sie im Westen von einem großen Steinblock überlagert war. Sie war Nord-West ausgerichtet, 1 m lang, wobei der südliche Bereich gestört war und sich nur im Negativ erhalten hat. Die freigelegte Breite der Grube betrug 60 cm, die max. Tiefe 35 cm. Die Sohle der Grube war teilweise vom Feuer gerötet, die Wände hingegen stark. Die Grubenverfüllung bestand aus einer ca. 20 cm starken Schicht aus Holzkohlestücken, die aus Stamm- sowie Astholz bestand, eine Faserrichtung des Holzes konnte nicht beobachtet werden. Die Kohleschicht überlagerte eine Lage aus Steinen, die großteils hitzegesprengt waren. Die Grubenkante schloss direkt
Abb. 5 Abdeckung des Kultplatzes und Monolith in situ, Finailgrube. Aufnahme: A. Putzer
DER SCHLERN 8 11H
eft
Archäologie
an Grube 2 (Abb. 6) an, die eine kreisrunde bis ovale Form hatte. Der Durchmesser betrug 1 m, die Tiefe 45 cm. Im Gegensatz zu den übrigen Gruben war sie teilweise von Steinen eingefasst, die z. T. senkrecht eingetieft waren. Die Grubenverfüllung bestand ebenfalls aus einer unteren Schicht Holzkohlefragmenten und einer darüber liegenden Steinpackung. Auch bei dieser Grube zeugten vor allem die Grubenwände – besonders die Steineinfassung – von Feuereinwirkung. Grube 3 trennte die eben beschriebene Steinsetzung von Grube 2. Es war die kleinste der drei Gruben, die länglich ovale Form betrug 0,79 x 0,65 m. Der Aufbau und die Verfüllung entsprach jener der anderen Gruben, die Tiefe betrug nur etwa 20 cm. Im Gegensatz zu den Gruben 1+2 waren die Wände und die Sohle vom Feuer gerötet. Die enge Positionierung der Gruben spricht wohl für eine zeitgleiche Verwendung, auch wären durch einen nachträglichen Anbau Störungen zu beobachten gewesen. In den Gruben konnten trotz Schlemmens keine archäologischen Funde geborgen werden. Grube 4 fand sich südlich der Grubengruppe, die Ausrichtung war exakt Nord-Süd. Im Gegensatz zu den anderen Gruben fand sich in Grube 4 eine Steinlage an der Sohle. Die Tiefe betrug bis zu 35 cm. Die Verfüllung bestand auch hier aus Steinkohlefragmenten und einer Abdeckung derselben mit einer Steinpackung. Um und in unmittelbarer Nähe der Gruben fanden sich zahlreiche Pfostenlöcher unterschiedlicher Dimension und Konstruktion. Die Pfostenlöcher (Abb. 7) hatten vertikale Wände, die Sohle war nur bei den größeren horizontal (Abb. 7,PF 1; PF 11; PF 14; PF 2). Diese waren mit Keilsteinen zum Fixieren der Pfosten versehen. Die kleiner dimensionierten Pfostenlöcher (Abb. 7; PF 3; PF 4; PF 8; PF 9; PF 10; PF 6; PF 7; PF 8) verjüngten sich gegen die Sohle hin. Keines der Pfostenlöcher hatte
Abb. 6 Grube 2, Finailgrube.
Ausarbeitung: A. Putzer
11H
eft DER SCHLERN 9
Archäologie
eine Steinplatte als Unterleger für einen hölzernen Steher. Pfostenloch PF 5, PF 13, PF 16 und PF 15 können nicht mit Sicherheit diesem Fundtypus zugeordnet werden, da sie nur mehr wenige cm tief waren. Drei der größeren Pfostenlöcher liegen in einer Flucht zueinander und sind nordwestlich ausgerichtet. PF 2 verläuft parallel dazu und könnte Teil einer zweiten Pfostenreihe sein, die sich außerhalb des Schnittes fortsetzt. Die Funktion der Pfostenreihen kann aufgrund der partiellen Freilegung der Anlage nicht geklärt werden. Vergleichende Beispiele gibt es vom eisenzeitlichen Brandopferplatz Scuol-Russonch8 (Kt. Graubünden), wo zahlreiche
Abb. 7 Befunde des Fundortes, Finailgrube.
Ausarbeitung: A. Putzer
DER SCHLERN 10 11H
eft
Archäologie
Pfostenlöcher im Heiligtum freigelegt werden konnten und ebenfalls keine einheitlichen Strukturen erkennen lassen. Die kleinen Pfostenlöcher sind alle in unmittelbarer Nähe der Gruben angebracht. Vergleichende Befunde finden sich in Philippsburg-Rheinsheim9 (Lkr. Karlsruhe) und aus Singen10 (Lkr. Konstanz), wo ebenfalls kleine Pfostenlöcher in unmittelbarer Nähe oder sogar in der Grube freigelegt wurden. Vor allem rund um Grube 4 zeichnet sich eine Konzentration derselben ab. An beiden Längsseiten der Grube sind mehrere kleine Pfostenlöcher eingetieft worden. Die geringe Stärke der Pfosten ist für das Tragen einer Überdachung wohl nicht ausreichend, vielleicht handelt es sich um Stützpfosten zum Schichten des Opferfeuers oder um einen Windschutz. Die bei den Gruben festgestellte Feuereinwirkung konnte ebenso an der Geologie beobachtet werden. Das feuergerötete Sediment entsprach der Ausdehnung der fundführenden Kulturschicht. Im südlichen Bereich des Schnittes fand sich eine länglich-ovale „Herdstelle“ aus faustgroßen verbrannten Steinen (Abb. 8), die von größeren Steinplatten eingefasst war. Ein anstehender Felsblock trug eine eingearbeitete Schale. Die Feuereinwirkung betraf auch die darunterliegende lehmig-humose Erdschicht. Die „Herdstelle“ war nordwestlich ausgerichtet, hatte eine Länge von ca. 1,60 m und eine Breite von 1,20 m. Zwischen den Steinen fanden sich kalzinierte Knochen, Keramik sowie Bernstein- und Glasperlen. Es handelt sich wohl um die eigentliche Brand- bzw. Opferstätte. Auch hierzu findet sich ein Vergleich aus dem Engadin, und zwar aus dem mittel- bis spätbronzezeitlichen Kultplatz Scuol-Motta Sfondraz11 (Kt. Graubünden). Nach Abtiefen des Schotters kamen zwei weitere Gruben zum Vorschein. Grube 5 befand sich im östlichsten Bereich, hatte eine Länge von über 1 m, war 0,8 m breit und 0,45 m tief. Zwei senkrecht stehende Monolithen, die die Kulturschicht eingrenzten, waren in die Grube eingetieft. Aus der umliegenden Kulturschicht, die nur in den unmittelbar angrenzenden Feldern war, stammen nur wenige kalzinierte Knochen. Im Norden des Schnittes fand sich
Abb. 8 Altar, Finailgrube.
Aufnahme: A. Putzer
11H
eft DER SCHLERN 11
Archäologie
eine weitere Vertiefung, die ein anderes Erscheinungsbild aufwies. Sie war nicht mit Steinen abgedeckt, sondern bestand ausschließlich aus Holzkohlefragmenten. Die Grube 6 ist annähernd kreisrund mit einem Durchmesser von 50 cm und einer Tiefe von 30 cm. Die Sohle war konkav und nicht horizontal wie bei den Pfostenlöchern. Die Interpretation muss offen bleiben, die Faserrichtung des Holzes zeigte keine Ausrichtung, ebenso fehlten Steinkeile. Nach Putzen des Profils konnte eine weitere Grube im Westprofil nachgewiesen werden.
Keramik und Steinartefakte
Die Funde von der Finailgrube stammen fast ausschließlich aus der Kulturschicht. Neben kalzinierten Knochen – eine grobe Durchsicht ergab ausschließlich
Schaf oder Ziege – fanden sich Keramik, Steinartefakte (Abb. 9), 41 Glas- und Bernsteinperlen und die Reste einer Bronzespirale. Die Funde konzentrierten sich in den Bereichen um die Gruben und der Steinrollierung, während im nördlichen sowie im südlichen Bereich des Schnittes so gut wie keine Funde vorkamen. Die gefundenen Gefäßränder entsprechen den in der Spätbronzezeit (1.350–1.200 v. Chr.) geläufigen Gefäßtypen mit ausladendem Mundsaum (Abb. 9,1; 3–4) und mit kantig abgestrichenem Gefäßrand (Abb. 9,2) oder verdickter Lippe (Abb. 9,5). Die
Abb. 9 1–10 Keramik; 11–13 Stein, M 1:2.
Ausarbeitung: A. Putzer
DER SCHLERN 12 11H
eft
Archäologie
starke Fragmentierung erschwert eine genaue Formzuweisung, es wird sich wohl um die Ränder von Krügen handeln. Die geborgenen Böden (Abb. 9,6–7) entsprechen ebenfalls den in der Spätbronzezeit geläufigen Gefäßformen mit leicht abgesetztem Boden. Die Wandscherbe mit aufgelegter Leiste und Fingernageleindrücken ist ein für die Mittelbronzezeit (1.600–1.350 v. Chr.) geläufiger Dekor, kommt aber auch an Krügen aus der Spätbronzezeit vor, wie dies Horizont B von Savognin-Padnal12 (Kt. Graubünden) und ein Vergleichsfund von der Tuiflslammer in der Gemeinde Kaltern13 (Südtirol) aufzeigt. Bei den vorgefundenen Steingeräten handelt es sich um das Fragment eines Webgewichtes (Abb. 9,11), einen Wetzstein (Abb. 9,12) und einen Reibstein (Abb. 9,13). Das Rohmaterial des Wetzsteins stammt von einem Nachbartal. Unterhalb der Bergspitze Zerminiger im Penaudtal findet sich ein quarzreicher Glimmerschiefer mit eingelagertem feinkörnigem Granit14, der bis Mitte des vorigen Jahrhunderts von den Bauern als Rohmaterial für die Herstellung ihrer Wetzsteine verwendet wurde. Das Fragment der Bronzespirale konnte aufgrund der schlechten Erhaltung nicht zeichnerisch dokumentiert werden.
Außergewöhnlich für Südtirol, vor allem für den Fundort Finailgrube ist die Auffindung zahlreicher Bernsteinperlen (Abb. 10,1–35). Die rötliche, fast
rubinrote Farbe der Fundstücke beschränkt sich nur auf die äußere Schicht der Perlen und ist auf Oxidation durch Sauerstoff zurückzuführen15. Einige Perlen sind von einer bräunlichen Verwitterungsschicht überzogen. Die Herkunft des Bernsteins wurde zwar nicht bestimmt, es dürfte sich aber um den weit verbreiteten baltischen Bernstein (=Succinit) handeln, dessen eigentliche Farbe gelb ist. Durchgeführte Bestimmungen mit Hilfe der Infrarotspektroskopie an Bernsteinperlen aus der Schweiz16 und Italien17 haben gezeigt, dass der genutzte Bernstein großteils aus dem Baltikum stammt. Das Verbreitungsgebiet des baltischen Bernsteins erstreckt sich von der Ostküste Englands bis nach Russland an den Dnjepr18. Eine genauere Zuordnung der Lagerstätten ist mit der Hilfe der archäometrischen Untersuchungen zurzeit leider nicht möglich. Britischer Succinit scheint nach Beck und Shennan19 in der Bronzezeit nicht verhandelt worden zu sein. Dies schränkt das Herkunftsgebiet des in Mitteleuropa verbreiteten Succinits auf die west- und ostbaltischen Vorkommen ein. Auch scheinen die lokalen Lagerstätten im inneralpinen20 sowie mittel- und süditalienischen Raum21 kaum Beachtung gefunden zu haben. Die gefundenen Bernsteinperlen von der Finailgrube entsprechen den geläufigen Typen der Bronzezeit Europas. Im Formenspektrum finden sich ringförmige (Abb. 11,1–12), gedrückt kugelige (Abb. 11, 13–16), asymmetrische (Abb. 11,17–24), Perlen mit dreieckigem Querschnitt (Abb. 11,25–27), kugelige (Abb. 11,28–30), linsenförmige (Abb. 11,31–32) und doppelkonische (Abb. 11,34–35) Perlen. Der Durchmesser der 34 Bernsteinperlen liegt zwischen 0,4 bis 1,8 cm, die Dicke zwischen 0,3 bis 0,9 cm. Ringförmige Bernsteinperlen treten in Mitteleuropa vereinzelt bereits im Spätneolithikum der Sâone-Rhône-Kultur22 um 2.700 v. Chr. auf. Ab der Frühbronzezeit23 finden sie sich vermehrt in europäischen Gräberfeldern zusammen mit linsenförmigen, kugeligen oder gedrückt kugeligen Bernsteinperlen. Diese geläufigsten Typen sind weit verbreitet und kommen so gut wie in allen nachfolgenden Zeitstufen weiterhin als Glieder von Bernsteinkolliers vor. Die als asymmetrisch angesprochenen Bernsteinperlen von der Finailgrube fallen typologisch meist in die Gruppe der ringförmigen Perlen. Am Übergang von der Früh- zur Mittelbronzezeit steigt die Anzahl der Bernsteinfunde in Europa stark an. Das Formenspektrum ändert sich kaum, allgemein kann festgehalten werden, dass kleinere ringförmige oder linsenförmige Perlen meist aus Siedlungen stammen,
Die Bernsteinperlen
11H
eft DER SCHLERN 13
Archäologie
während dessen größere Exemplare, wie jene von der Finailgrube (Abb. 11, 15; 20; 33) meist als Beigabe in Gräberfeldern vorkommen. Im bronzezeitlichen Gräberfeld Olmo di Nogara24 (Prov. Verona) finden sich entsprechende Perlen in den Gräbern 30 und 85. Grab 30 datiert in die Phase BR I (Bz D1), Grab 85 in die Phase BM IIB (BZ B/C1). Die Gräber mit Bernsteinperlen aus Olmo di Nogara stammen ausschließlich aus reich ausgestatteten Frauengräbern, wo sie als Nadelhalter verwendet wurden, die mit ebenso reich ausgestatten männlichen Waffengräbern vergesellschaftet sind. Die geringe Anzahl der Bernsteinfunde im Gräberfeld und der soziale Rang der Bestatteten spricht für den hohen statusbezogenen Wert des Bernsteins25. Der Typus beschränkt sich nicht ausschließlich auf die norditalienischen Gräberfelder, sondern findet auch Vergleiche im Depotfund von Padnal-Savognin26, der nur allgemein von der ausgehenden Mittelbronzezeit bis
Abb. 10 1–35 Bernstein; 36–41 Glas, M 1:2.
Aufnahme: A. Putzer
DER SCHLERN 14 11H
eft
Archäologie
in die Spätbronzezeit datiert werden kann. Eine weitere Perlenform, die auf der Finailgrube angetroffen wurde, sind konische knopfförmige oder im Querschnitt dreieckige Perlen (Abb. 10, 25–27) mit horizontaler Bohrung. Der Typus tritt bereits in der Frühbronzezeit mit einer v-förmigen Durchbohrung auf und leitet sich von Vorgängerformen aus Knochen, Stein oder Horn ab.27 In Italien ist diese Perlenform mit dreieckigem Querschnitt und horizontaler Durchbohrung ab der beginnenden Mittelbronzezeit (Bronzo Medio 1) aus Glas28 bekannt. Vergleiche zu den Perlen aus dem Schnalstal finden sich ausschließlich in der Schweiz, und zwar im Gräberfeld Neftenbach II29 (Kt. Zürich) aus der Stufe BZ D1 und in Reinach Grab A 50630 (Kt. Aarau) ebenfalls aus der Stufe BZ D. Die Perlenform scheint mit Ausnahme der Funde von der Finailgrube in Italien nicht verbreitet zu sein. In Grab I von Neftenbach II ist die eben besprochene Perlenform mit
Abb. 11 1–35 Bernstein; 36–41 Glas.
Ausarbeitung: A. Putzer
11H
eft DER SCHLERN 15
Archäologie
doppelkonischen Perlen31 vergesellschaftet, die auch auf der Finailgrube (Abb. 10, 34–35) vorkommen. Vereinzelt finden sich Vergleiche südlich wie nördlich des Alpenhauptkammes ab der Stufe BZ D (Bronzo Recente). In Italien ist mir aus dieser Zeitstufe nur ein Exemplar aus der Siedlung Sabbionara di Veronella32 (Prov. Verona) bekannt. Nördlich des Alpenhauptkammes finden sich neben dem Fund aus Neftenbach II eine doppelkonische Perle in Grab 12 von Aschaffenburg-Strietwald33 (Bez. Unterfranken) und in Urberach34 (Lkr. Offenbach). Ab der Stufe HA A1 (Bronzo Finale) kommen die doppelkonischen Perlen häufiger in Grabinventaren vor. Für Italien sind Funde in den norditalienischen Gräberfeldern Narde bei Fratta di Polesine35 (Prov. Rovigo) und aus dem Campo Pianelli di Bismantova36 (Prov. Reggio Emilia) bekannt. In der Nordtiroler Urnenfelderkultur finden sich Vergleiche aus dieser Zeitstufe in Grab 1 von Mühlau37 und aus Sistrans38 (Bundesland Tirol). Vergleiche aus den bayrischen Gräberfeldern von Haunstetten I Grab 8 und Grab 4039 (Lkr. Pfaffenhofen), die in die Stufen HA A1 bzw. HA B1 datieren, belegen die Verbreitung des Typus auch für Süddeutschland. Leider lassen sich die einzelnen Formen nicht auf einen Befundtypus festmachen, allgemein kann nur festgehalten werden, dass der Großteil der Bernsteinfunde aus Gräberfeldern stammt40. Auch durch das Aufkommen der Brandbestattung ab der Spätbronzezeit in weiten Teilen Europas bricht die Verbreitung der leicht brennbaren Bernsteinfunde in Europa nicht ein, verzerrt allerdings das Verbreitungsbild sowie die Menge an Bernsteinperlen in Gräbern. Für Südtirol sind die Bernsteinfunde von der Finailgrube auf jeden Fall einzigartig, da es bis dato nur wenige Einzelfunde gibt, die meist aus latènezeitlichen Komplexen41 stammen. Eine bronzezeitliche Bernsteinperle stammt von der Siedlung am Albanbühel42 (Gem. Brixen), ein weiterer Fund ist vom Brandopferplatz in St. Walburg in Ulten bekannt43. Perlen mit dreieckigem Querschnitt und horizontaler Durchlochung, die Vergleiche nur in den schweizerischen Gräberfeldern finden, verweisen auf einen Import aus diesem Gebiet.
Glasperlen konnten sechs an der Zahl geborgen werden, die so wie die Bernsteinperlen unregelmäßig in den diversen Feldern verteilt waren. Die
häufigste Form sind gedrückt kugelige oder ringförmige Perlen mit D-förmigem Querschnitt (Abb. 11,36–41) unterschiedlicher Farbgebung. Der Durchmesser der Perlen liegt zwischen 0,8 und 1,2 cm, die Dicke zwischen 0,5 und 0,9 cm. Die Ringperlen ohne Dekor (Abb. 11,39–40) waren aus einem matten azur- oder grünlichblauen Glas. Die Verfärbung ist vermutlich auf die Feuereinwirkung zurückzuführen. Dieser Perlentyp tritt bereits am Übergang von der Mittelbronzezeit (BM 3) zur Stufe BZ D (BR) auf44. Hierfür gibt es Vergleiche aus Südtirol, und zwar aus einem BZ D-Horizont der Siedlung Sotćiastel45 im Gadertal und aus dem hallstattzeitlichen Kult- oder Bestattungsort in der Gem. Salurn „Cava Girardi“46, wo ca. 200 Perlen geborgen wurden. Im Gräberfeld von Haunstetten finden sich zahlreiche Glasperlen dieses Typus in Gräbern der Stufe HA A sowie am Beginn von HA B47. Die Perlenform findet sich auch in der Nordtiroler Urnenfelderkultur. Als Beigabe in Grab 35 von Mühlau, dass in die Stufe HA A1 datiert48. Verbreitet ist die Form auch in den östlichen Pfahlbausiedlungen, insbesonders aus den Schichten 5–3 von Hauterive Champreveyres49 (Kt. Neuenburg), die von 1050 bis 1030 v. Chr. datieren. Die restlichen Ringperlen (Abb. 11,36–38) sind dunkelblau bis schwarz und haben unterschiedlich angebrachte Dekore. Eine Perle hat einen umlaufenden weißen Glasfaden (Abb. 11,38), ein Exemplar hat einen spiralförmig angebrachten Glasfaden
Die Glasperlen
DER SCHLERN 16 11H
eft
Archäologie
(Abb. 10,37). Die dritte Ringperle (Abb. 11,36) hat keinen aufgelegten Glasfaden, sondern eine weiße Einlage aus Glas. Die Ringperlen mit umlaufendem Glasfaden sind in der Siedlung Fratta di Polesine bezeugt und werden von Bellintani50 dem Typ 10.22 zugeordnet und in die Phasen Bronzo Finale I und II (HA A1 und A2) datiert. Die Perle mit spiralförmig angebrachtem Glasfaden findet sich nicht in den Fundgruppen von Fratta di Polesine, das einzig bekannte Gegenstück stammt aus Salurn „Cava Girardi“51, wo sie nach HA A1 und A2 (Bronzo Finale 1+2) datiert. Die tonnenförmige Perle (Abb. 11,41) besteht aus einer schwarzglasigen Paste mit spiralförmiger Verzierung, in der sich noch teilweise eine weißliche Einlage erhalten hat. Die Länge der Perle beträgt 1,8 cm, der Durchmesser 0,9 cm. An der Außenseite ist die Glaspaste leicht ausgebrochen. Der älteste Nachweis dieser Perlenform stammt aus der Siedlung Poviglio52 (Prov. Reggio Emilia) und datiert dort an den Übergang von der Stufe BM 3 bis Bronzo Recente (BZ C/BZ D1). In Nordtirol findet sich der Perlentyp in Grab 1 von Mühlau53, aus der Stufe HA A1.
Das geborgene Fundmaterial datiert ausschließlich in die Spätbronzezeit (BZ D – HA A2). Die von Herrn Nisi getätigte Radiokarbondatierung bezeugt zudem
eine ältere mittelbronzezeitliche Nutzungsphase des Heiligtums, der einige Kleinfunde nur mit Vorbehalt zugeordnet werden können. Die Funde streuen fast im gesamten Schnitt, eine Fundkonzentration oder eine chronologisch bedingte Fundverteilung konnte nicht festgestellt werden. Horizontalstratigraphisch konnte nur Grube 5 einem älteren Zeithorizont zugewiesen werden, eine aus der Grube getätigte Radiokarbondatierung verweist nach 1.070–800 v. Chr. (kal.). Die vorgefundene „Herdstelle“, die von Feuereinwirkung zeugt und von großen Steinen eingefasst ist, wird wohl die eigentliche Verbrennungsstätte der Opfergaben sein. Die getätigten Funde und die starke Hitzeeinwirkung unterstreichen die Nutzung des Bereichs als „Altar“. Vergleiche finden sich in Graubünden, wo aus einem zeitgleichen Naturheiligtum auf Scuol-Motta Sfondraz54 ebenso eine Steinpflästerung als „Brandstätte“ gedient hat. Nördlich davon schließen vier Gruben an, die mit Holzkohle und Steinen verfüllt waren und dem Typus „Brenngruben“ nach Honeck55 entsprechen. Grube 2 und Grube 4 wurden beprobt und ergaben die Radiokarbondaten 1.310–980 v. Chr. (kal.) bzw. 1.320–1.020 v. Chr. (kal.). Man wird wohl davon ausgehen müssen, dass die Radiokarbondatierung nur Aufschluss über die letztmalige Verwendung der Grube gibt und das Datum somit auf das Auflassen des Heiligtums verweist. Die Kleinfunde fanden sich zum Großteil westlich und nördlich des „Altars“, wo vermutlich die Reste des Opferfeuers deponiert wurden. Nach Auflassen des Opferplatzes wurde die Kulturschicht planiert, da sie die Befunde überlagert und der Opferplatz wurde mit Steinplatten versiegelt. Einen Vergleich dazu gibt es am nahegelegenen Brandopferplatz auf dem Grubensee56 (Gem. Schlanders). Das Opferareal auf der Finailgrube war zusätzlich von kreisförmig bis oval gesetzten Monolithen – von denen einige noch in situ vorgefunden wurden – eingegrenzt. Begrenzungen des Opferareals sind auch aus anderen Opferplätzen bekannt – meist in Form von Mäuerchen – so unter anderem auf Scuol-Motta Sfondraz57 oder aus dem spätbronzezeitlichen Brandopferplatz von Grütze-Altenstadt58 (Vorarlberg). Brenngruben sind jüngst im Südtiroler Raum vermehrt aus hochalpinen Kultplätzen nachgewiesen. So konnten am Brandopferplatz am Schlern59 (Gem. Kastelruth) mehrere Gruben ergraben werden, ebenso auf der Gögealm60 (Gem. Ahrntal) in Verbindung mit einem Depotfund. Brenngruben finden sich nicht nur im Hochgebirge und beschränken sich auch nicht nur auf den Alpenraum, sondern sind in ganz Europa verbreitet61. Die inneralpinen Brandgruben stammen zum Großteil aus Gräberfeldern
Interpretation und Nutzung des Heiligtums
11H
eft DER SCHLERN 17
Archäologie
und datieren von der Frühbronzezeit bis in die Latènezeit62. Die Funktion der Brandgruben reicht von der Interpretation als Werkgruben, Kochgruben, Ustrinen bis hin zu Schwitzhütten. Haupt hat in Versuchen und mit Hilfe von ethnologischen Vergleichen63 gezeigt, dass eine Interpretation der Brenngruben als Kochgruben durchaus möglich scheint. Das Fehlen von Funden aus den Gruben auf der Finailgrube scheint auch diese als Kochgruben für Kultmahle auszuweisen, unterstrichen wird dies durch die Funde eines Reibsteines und eines Wetzsteines zum Zubereiten des Opfermahls. Die Keramik und die kalzinierten Knochen, wenn auch in geringer Anzahl, passen ins Bild eines Opferplatzes. Ebenso das vorgefundene Webgewicht, das indirekt mit der Weidewirtschaft in Verbindung steht und als Weihegabe für ein erfolgreiches Gelingen der Weidesaison und einer damit verbundenen üppigen Wollproduktion interpretiert werden kann. Die Weiterverarbeitung der Wolle scheint im Schnalstal einer langlebigen Tradition zu entspringen. Die Wolle der Schnalser Schafe war im 14. Jahrhundert aufgrund der hochwertigen Qualität sehr geschätzt und wurde zu „Graue Tuch“ (Loden) weiterverarbeitet. Dies bezeugt eine Urkunde aus dem Jahre 1354, in der Peter von Schennan, Burggraf von Tirol, den Schnalser Bauern das Privileg erteilt, das produzierte Tuch nach dem Meraner Ellenstab zu verkaufen64. Ebenso kann der einzige vergleichbare Fund vom Zunterkopf im Stubaital65 (Bundesland Tirol) in Zusammenhang mit Weidewirtschaft interpretiert werden. Welche Bedeutung die zahlreich vorgefundenen Schalensteine in den Kulthandlungen gespielt haben, muss offen bleiben. Die Zugehörigkeit zum Areal ist jedenfalls durch die Schichtabfolge gegeben. Bezeugt durch die eingearbeitete Schale an der Steineinfassung der Verbrennungsstätte und durch drei eingearbeitete Schalen in einem Steinblock, der das Areal eingrenzt. Ein weiterer im östlichen Bereich des Schnittes geborgener Monolith, der auf beiden Seiten Schalen trug, verweist auf die ehemals senkrechte Position. Dasselbe gilt für einen Schalenstein, außerhalb des Areals, der nebst einem künstlich errichteten Podium zu liegen kam. Eine vergleichbare Situation findet sich am nahegelegenen Pfitscherjöchl in der Texelgruppe66 (Gem. Partschins), wo ebenfalls Schalensteine im Verbund mit einer „Brandgrube“ vorgefunden wurden. Auch wenn die Ausgräber keinen direkten Bezug zur vorgefundenen Brandschicht herstellen konnten, zeugt der Neufund von der Finailgrube, dass durchaus ein Zusammenhang zwischen Schalensteinen und Opferstätten gegeben ist. Auf der Finailgrube fällt das Auffinden von Bernstein- und Glasperlen aus dem Rahmen. Bernsteinfunde sind aus Opfer- oder Kultplätzen nur aus Mechel Vallemporga67 (Prov. Trient), der nur mit Vorbehalt dieser Fundkategorie zugeordnet werden kann und aus St. Walburg/Ulten68 bekannt. Das Fehlen von Bernstein im Fundspektrum von Brandopferplätzen kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das leicht brennbare Material sich nicht erhält. Dasselbe müsste allerdings auch für die Funde der Finailgrube gelten, wo die Erhaltung zahlreicher Perlen uns eines Besseren belehrt. Auch wird man davon ausgehen müssen, dass das gefundene Perlenspektrum nur jenen Teil darstellt, der dem Feuer nicht zum Opfer fiel. Es könnte sich beim Perlenkomplex natürlich nur um ein einziges Kollier handeln, zahlreiche Vergleichsfunde zeugen von einer gemeinsamen Verwendung von Bernstein- und Glasperlen69. Die weite Streuung der Perlen im Schnitt und die diversen Typen – insbesondere die größeren Perlen – die auf eine diversifizierte Nutzung verweisen, sprechen eher dagegen. Die Interpretation des Fundortes als Kultstätte im Zuge einer betriebenen Weidewirtschaft im Finailtal, scheint durch den Fund des Webgewichtes und durch die geografische Lage durchaus plausibel. Perlen als Votivgaben für eine weidewirtschaftliche Nutzung zu interpretieren, fällt etwas schwerer. Augenscheinlich ist der ausschließlich weibliche Charakter der Weihegaben, auch wenn Weiss70 keine geschlechtsspezifischen Rituale an Opferplätzen festmachen
DER SCHLERN 18 11H
eft
Archäologie
will. Bernstein- und Glasperlen als Opfergaben zu nutzen, setzt voraus, dass die Gemeinschaft, die die Finailgrube für ihre Kulte nutzte, ausreichend über Rohstoffe oder Endprodukte verfügt, die zum Eintausch der importierten Perlen taugen. Ob dies rein landwirtschaftliche Produkte waren oder aber hochwertige Erzeugnisse aus Metall, sei dahingestellt. Hier wird wohl die Rolle des Vinschgaus als Kulturvermittler zwischen Nord- und Süd eine Rolle gespielt haben, wie dies die Herkunft der Glas- und Bernsteinperlen bezeugen71. In diesem Zusammenhang ist auf die Bedeutung der inneralpinen Erzlagerstätten und der weiträumigen Verteilung des Kupfererzes zu verweisen. Im nahegelegenen Penaud (Gem. Schnals) und am Mastaunjoch (Gem. Schnals) sind sulfidische Erze72 nachgewiesen. Spuren der Metallverarbeitung in Form einer Blasebalgdüse von Juval73 (Gem. Naturns) oder Schlackenfunde von St. Georg in Kortsch74 (Gem. Kortsch) verweisen auf die lokale Produktion von Bronzen. Bis dato fehlen allerdings Hinweise über bergmännische Aktivitäten. Dies kann natürlich auf eine Forschungslücke zurückzuführen sein, oder aber die Bevölkerung des Mittelvinschgaus nutzte die direkten Alpenübergänge des Schnalstals als Zugang zu den reichen Kupferrevieren des Inntaler Oberlandes. Die Grabinventare aus Narde Fratta di Polesine sprechen jedenfalls dafür, dass es sich um sozial höhergestellte Individuen gehandelt hat, die im Besitz von Bernstein- und Glasperlen waren. Dies stellt die Nutzung des Brandopferplatzes alleinig durch Hirten in Frage und impliziert die Frequentierung des Brandopferplatzes entweder von Seiten des „weiblichen“ Teiles einer nahegelegenen Dorfgemeinschaft, oder aber die Perlenfunde belegen die Sömmerung des Viehbestandes durch Hirtinnen. Noch heute sind zahlreiche Almen – vor allem jene wo Sekundärprodukte erzeugt werden – in der Hand von Sennerinnen. Dies war auch in der jüngeren Vergangenheit im Alpenraum nicht anders, auch wenn die katholische Kirche dies zu unterbinden versuchte. Dies ging sogar soweit, Verbote zu erheben, da vor allem bei unverheirateten Sennerinnen Unsittlichkeit befürchtet wurde75. Die Verbote hatten natürlich wenig Wirkung, wie die 1880 angelegte Statistik unter Graf Ludwig bezeugt: Unter den 7700 Almleuten im „Land der Gebirge“ sind 1075 Frauen76 verzeichnet. Eine weibliche Dominanz bezeugen ethnologische Vergleiche aus autark lebenden Gesellschaften im Himalaja. So ist bei einem Teil der Bevölkerung des Hunza-Tales im Karakoroum77 der Sömmerungsbetrieb ausschließlich in der Hand der Frauen. Männer helfen nur beim Viehauftrieb. Auf den Almen helfen Jugendliche bei der Betreuung des Galtviehs sowie des Transports der Milchprodukte, die regelmäßige ins Tal getragen werden. Die Männer verbleiben in der Talsiedlung und kümmern sich um die Bestellung der Äcker und um das Anlegen der Holzvorräte für den Winter. Ältere Männer empfinden die Arbeit des Hirten als ihrem Status nicht würdig, obwohl sie physisch durchaus dazu in der Lage wären. In den Alpgebieten wirtschafteten vor allem ältere Frauen von hohem sozialem Rang78. Die Kleinfunde von der Finailgrube bezeugen ebenso die Präsenz einer sozial höhergestellten weiblichen Gesellschaftsschicht und evtl. eine Dominanz der Frauen in der heimischen Weide- bzw. Milchwirtschaft während der Bronzezeit.
Aus dem Schnalstal selbst ist keine gesicherte Siedlung bekannt. In Katherinaberg (Gem. Schnals) (Abb. 12,1) konnte in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
eisenzeitliche Keramik und ein bronzezeitliches Sichelelement aus Silex geborgen werden79. Zu den nächstgelegenen Siedlungen zählt Juval (Abb. 12,2) – am Eingang des Schnalstals. Die bronzezeitlichen Siedlungsphasen reichen von der Früh- bis in die Spätbronzezeit80 und decken sich zum Teil mit der Nutzungsphase auf der Finailgrube. In Betracht zu ziehen sind zwei weitere Siedlungen aus der Gem. Kastelbell/Tschars (Abb. 12,3) und auf Schloss Annenberg (Gem. Latsch)
Das archäologische Einzugsgebiet
11H
eft DER SCHLERN 19
Archäologie
(Abb. 12,4), wo bei der Straßenerweiterung Strukturen und bronzezeitliche Keramik81 geborgen werden konnte. Die Siedlung bestand ab der frühen Bronzezeit und reichte bis in die frühe Eisenzeit82. Die Keramik beider Siedlungen zeugt vom Kontakt der Einwohner mit den Terramarensiedlungen Norditaliens, dasselbe gilt für die Glasperlen von der Finailgrube. Eine weitere Siedlung ist in der Gem. Kortsch bezeugt, wo sich spätbronzezeitliche Kleinfunde bei der St.-Laurentius-Kirche83 (Abb. 12,5) fanden. Die Nutzer der Finailgrube stammen vermutlich aus einer dieser Siedlungen. Innerhalb eines Tages ist es möglich, das Finailtal zu Fuß zu erreichen. Der Zugang ins Schnalstal ist für die Einwohner Kortschs über das Taschljöchl gegeben, während die Annenberger über das Niederjoch ins Penaudtal und dann weiter ins Schnalstal marschieren konnten. Denselben Übergang konnten die Bewohner von Kastelbell und Juval genutzt haben oder den direkten Zugang von Juval an der orographisch rechten Seite, wie dies der Altweg aus dem Atlas Tyrolensis aus dem Jahre 177484 nahelegt. Notwendig wäre der weite Marsch ins Finailtal zur saisonalen Beweidung für die diversen Bevölkerungsgruppen allerdings nicht. Auf dem Weg dorthin finden sich ausgedehnte Weidegründe im Maneid- und Schlandrauntal, in Penaud oder auf der Stierbergalm oberhalb von Juval, die den wohl eher kleinen bronzezeitlichen Viehbeständen ausreichend
Abb. 12 Einzugsgebiet der Finailgrube.
Karte: Autonome Provinz Bozen –
Südtirol – Amt für raumbezogene
und statische Informatik
Ausarbeitung: A. Putzer
DER SCHLERN 20 11H
eft
Archäologie
Futter lieferten. Die Penaudalm bietet heute noch über den Sommermonaten 700 Stück Vieh genügend Weidefläche. Auch wenn bis heute eindeutige Indizien für eine Besiedelung des Schnalstals in der Bronzezeit fehlen, so kann man es auch nicht ausschließen. Sondagen in der Nähe des heutigen Finailhofes (Abb. 12,7) ergaben eine Kulturschicht aus der bronzezeitliche Keramik (Abb. 9,6) geborgen wurde. Das Gelände eignet sich hervorragend zu Siedlungszwecken, sei sie nur saisonal oder über das ganze Jahr hinweg. Eine Kontinuität ist bis heute durch den Finailhof gegeben, wo bis in die 60er Jahre auf 1952 m. ü. M. Getreide angebaut wurde und nur aufgrund des Staudammbaus – der sich negativ auf das Mikroklima ausgewirkt hat – aufgegeben werden musste. Von einer saisonalen Besiedelung wird man wohl ausgehen müssen, einerseits zu weidewirtschaftlichen Zwecken und andererseits um die Übergänge am Niederjoch, Hochjoch und vielleicht auch am Finailjoch zu kontrollieren. Von welchem bronzezeitlichen Dorf aus das Schnalstal besiedelt oder genutzt wurde, kann anhand des Publikationsstandes der Kleinfunde aus den Siedlungen leider nicht befriedigend gelöst werden. Nicht auszuschließen ist eine Besiedelung des Hochtales ab der Bronzezeit. Ein im Jahre 2011 entdeckter Kultort im nahegelegenen Tisental85 (Abb. 12,9) erhärtet aufgrund der bestehenden Funddichte die Möglichkeit einer Besiedelung des hochalpinen Seitentales.
Der Name des Tales „Schnals“ leitet sich nach Tarneller86 von lat. „casinales“, zu dt. „Sennhütten“ ab. Die Erklärung scheint infolge der wirtschaftlichen
Nutzung des Tales durchaus gerechtfertigt und wurde von nachfolgenden Wissenschaftlern einstimmig übernommen. Rezentere Forschungen, die Christian Kollmann87 zu verdanken sind, bezeugen für den Namen Schnals vorrömische Sprachwurzeln. Er leitet den Namen Schnals von *snallo- „Einschnitt“88 oder „Einschnitt im Gelände?“ ab. Das romanische *senales scheint ein Konstrukt Tolomeis zu sein, dafür spricht die mundartliche Lautung des Namens: Schnål(t)s, Schnol(t)s. Ein romanisches *Senales hätte in der Mundart Schnōl(t)s mit langem o ergeben89. Der Tiroler Namensforschung hat sich allen voran Finsterwalder verschrieben, der in seinem Werk auch einige Schnalser Orts- und Hofnamen untersucht hat. Romanischen Ursprungs sind nach Finsterwalder90 die Namen: Penaud (lat. Pinûta, „Gegend mit Fichtenwald“), Lagaun (lat. lacûna, „Sumpf “), Lazaun (lat. Lozza, „Lache, Tümpel“), Mastaun (vielleicht sogar vorrömisch?) und Finail (lat. Fenile, „Stadel“). Bei den Ortsnamen mit Endung -aun ist auch an vorrömisches Namensgut zu denken, die Endung findet sich beispielsweise an etruskischen Ortsnamen, wie Pupluna (Populonia) oder Vatluna (Vetulonia)91, und somit könnte es sich bei den Schnalers Toponymen um rätisches oder vorrömisch-indogermanisches Sprachgut handeln. Vorrömisch ist nach Finsterwalder im Schnalstal nur der Namen „Tisen“92. Ebenso schätzt Kollmann den Namen Tisen vorrömisch ein, wobei er von *Tùsi-na93 ausgeht, dass sich mit dem etruskischen Wort tus „Sarg, Kline, Stelle (in einem Grab)“94 vergleichen lässt. Im Schlandrauntal zählt Finsterwalder Maneid (lat. Manedu, „Rastplatz für das Vieh“) zu den romanischen Namen, während der Name des Tales Schlandraun (*slrandr-<Schlanders- romanisches Suffix -one „größeres zu Schlanders gehöriges Gelände“) auf vorrömisches Sprachgut zurückgeht. Dasselbe gilt für die Talsiedlungen Kortsch (idg. *gherdh- ‚umschließen, umgürten‘)95, Schlanders (vorrömisch, nicht-idg. *As(k)lánder mit unklarer Bedeutung)96, Latsch (westidg. *laku-‚ Wasseransammlung in einer Grube, Lache, See)97 und Goldrain98, die sich in unserem Einzugsgebiet befinden. Kastelbell und Juval werden in
Zur historischen Erschließung des Schnalstales
11H
eft DER SCHLERN 21
Archäologie
Finsterwalders Übersichtskarte99 als romanisch eingestuft. Mit einzubeziehen ist auch das hinterste Ötztal, dass bis 1919 Teil des Schnalstals war. Vorrömisches Namensgut findet sich nur im äußeren Abschnitt des Tales, ansonsten handelt es sich überwiegend um deutsches Sprachgut100. Romanische Namen sind zahlreicher, finden sich aber nur im hinteren Abschnitt des Tales101. Von Interesse ist der Flurname Samoar unterhalb des Hochjoches auf Ötztaler Seite, der von lat. *samairu (Lasttier, Lastesel; Samoar war wohl ein Um- oder Abladeplatz für Saumtier?)102 abgeleitet wird und die Bedeutung und Nutzung dieses inneralpinen Übergangs unterstreicht. Das Namensgut des hintersten Ötztals bezeugt eine Aufsiedelung des Gebietes von Süden, verfolgt man die etymologische Entwicklung der Ortsnamen weiter, so findet man nur im Pitztal vorrömisches Namensgut. Im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal liegt die Ortschaft Piösmes103, die den ältesten Namen des Tales trägt. Am Ausgang des Pitztals sind dann zahlreiche vorrömische Ortsnamen wie Jerzens, Wenns, Arzl im Pitztal zu nennen104. Dies verleitet zur Annahme, dass nicht das Ötztal, sondern eher das Pitztal genutzt wurde, um ins Inntal zu gelangen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht wäre es im Laufe der Bronzezeit von Vorteil gewesen, über das Pitztal ins Inntal abzusteigen, weil es einen direkten Zugang zu den Kupfererzlagerstätten des Oberinntals105 darstellt. Die späte Aufsiedlung im 13. Jahrhundert des Ötztals und die durchwegs nur deutschsprachigen Ortsnamen unterstreichen dies. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vorrömischen Namen der Täler „Schlandraun“ und „Schnals“ auf vorgeschichtliche Nutzung verweisen, wie dies auch durch die Archäologie bestätigt werden konnte. Im Pitztal und im hintersten Ötztal fehlen bis heute – abgesehen von mesolithischen Fundstellen – archäologische Funde, was wohl auf eine Forschungslücke zurückzuführen ist. Die Besiedlung des Schnalstals in frühgeschichtlicher Zeit ist ebenfalls ungeklärt, romanische Hofnamen verweisen zwar darauf, könnten aber auch im Zuge der Besiedelung im 12./13. Jahrhundert von Seiten romanischer Bevölkerungsgruppen entstanden sein. Die zahlreichen deutschen Hofnamen deuten eher darauf hin, dass der Großteil der Höfe erst sehr spät entsteht, wenn auch die vorrömischen, wie romanischen Orts- und Hofnamen auf eine gewisse Kontinuität in der Nutzung und vielleicht sogar Besiedelung des Schnalstals verweisen.
Urkundliche Überlieferungen über die Besiedelung gibt es vom hinteren Schnalstal erst im 12./13. Jahrhundert106, als die Herrn von Wanga die Schwaighöfe Marchegg, Gamp, Gerstgras, Wies und Kofl haben anlegen lassen. Besiedelt wurden sie vermutlich über das Schlandrauntal, worauf der Ortsname Kurzras verweist. Finsterwalder107 leitet den Namen vom „Cortscher Raus“ ab, der in einer Urkunde aus dem Jahre 1300 Erwähnung108 findet. Kirchlich gehören die hinteren Schnalser Höfe zur Kirche St.-Martin in Göflan (8./9. Jh.)109. Aus Katherinaberg gibt es ältere Belege, oberhalb des heutigen Ortes besaßen die Welfen königliches Lehen bei „Witental“110, das ihnen 1077/78 enteignet wurde. Der äußere Teil um Katharinaberg gehörte kirchlich zur Pfarre Naturns, von wo aus die Aufsiedlung aller Wahrscheinlichkeit durch die Welfen stattgefunden hat, die ebenso in Naturns über Besitzungen verfügt haben111. Eine bedeutende Rolle für die Aufsiedlung des Schnalstals spielten die Herrn von Montalban, die mit großer Wahrscheinlichkeit Ministerialen der Welfen waren112. In der Urbare aus den Jahren zwischen 1270 und 1290 der Söhne Arnolds von Schnals113, die auf der Schnalsburg in Katharinaberg residierten, unterstehen ihnen nicht weniger als 18 Höfe im Schnalstal. Von wo aus die Höfe um Vernagt, Unser Frau und Vent aufgesiedelt wurden ist unklar. Zum Teil besaßen bereits die Herrn von Wanga neben den Schwaighöfen in Kurzras, auch die Höfe Rain, Au und Brugg in Unser
DER SCHLERN 22 11H
eft
Archäologie
Frau. Da das Adelsgeschlecht der Wanga Besitztümer, sei es in Kortsch wie in Goldrain, besaßen, kann die Aufsiedelung von beiden Ortschaften aus erfolgt sein. Die Montalbaner werden ihre Höfe wohl von Katharinaberg oder von Kastelbell aus aufgesiedelt haben. Die kirchliche Zugehörigkeit der Höfe in Vernagt, Unser Frau und Vent an die Kirche St. Martin in Tschars, die schriftlich erstmals 1183 erwähnt wird114, unterstreicht dies. Die kirchenrechtliche Abhängigkeit, könnte auf die Siedlungsentwicklung verweisen. Für die Gerichtsbarkeit des gesamten Schnalstales war das Gericht Kastelbell zuständig. Der hintere Teil des Tales scheint von Seiten der Herrn von Wanga von Kortsch aus aufgesiedelt worden zu sein. Der mittlere Abschnitt hingegen von Kastelbell/Tschars aus von den Herrn von Montalban, die 1218 von den Hohenstaufen die Vogtei in Tschars115 erhalten. Die vorrömischen Namen im Tal zeugen von einer vorgeschichtlichen Nutzung und von einer Kontinuität, leider fehlt bis dato der archäologische Beweis einer Siedlungskontinuität.
In der Folge soll versucht werden, den Ablauf einer prähistorischen Weidesaison in Bezug auf Viehbestände, Sekundärprodukte und soziokulturelle Gesichtspunkte
zu rekonstruieren. Historische, ethnologische und prähistorische Daten bilden dafür die Basis, wobei darauf verwiesen werden muss, dass es sich um ein hypothetisches Modell der Nutzung Schnalser Weidegebiete handelt.
Die klimatischen Bedingungen in Mitteleuropa im Laufe der Mittel- bis Spätbronzezeit, also in den Zeitperioden, in der der Opferplatz der Finailgrube genutzt wurde, variierte stark. Die Mittelbronzezeit (1550–1350 v. Chr.) ist im Wesentlichen von einer Kaltphase116 geprägt, die zu einem Rückgang der Waldgrenze und zu einem Vorstoß der Gletscher geführt hat. Am Beginn der Spätbronzezeit (1350–1200 v. Chr.) erwärmt sich das Klima wieder, was einen Anstieg der Waldgrenze bewirkt und somit zu einer vertikalen Verschiebung des zur Verfügung stehenden Weidegebietes führte. In beiden Klimaperioden war eine Beweidung des Schnalstals möglich. Größeren Einfluss wird während der Kaltphase das Klima auf die Dauer der Sömmerung des Viehs ausgeübt haben. Positiv hat sich sicher der vermehrte Niederschlag auf das Wachstum und die Ausbreitung hochalpiner Weideflächen ausgewirkt. Die Klimaerwärmung der Spätbronzezeit hat sicher dazu geführt, das Vieh über eine lange Zeitspanne weiden zu lassen. Das Schnalstal gehört sowie der gesamte Vinschgau zu den trockensten Regionen Südtirols; im Sommer 2010 (Juni–August) lag die Niederschlagsmenge zwischen min. 40 mm und max. 180 mm. Vor allem die Monate Juni und Juli waren sehr niederschlagsarm, und der Jungbauer vom Finailhof war besorgt, sein Vieh zusätzlich füttern zu müssen. Die Weidesaison im Finailtal beginnt heute Mitte bis Ende Mai, je nachdem wie stark die Schneefälle im Winter waren, und endet mit den ersten Schneefällen im Herbst (2010 stallte der Bauer vom Finailhof Ende Oktober das letzte Vieh ein). Heute wird das Tal von 16 Kühen, ca. 10 Kälbern, ca. 150 Schafen und ca. 60 Ziegen bestoßen, wobei die Kühe in der Nähe des Hofes gehalten werden, um sie täglich zu melken. Die Oviden befinden sich in den höher gelegenen Weiden, die Kälber beweiden die Flächen knapp oberhalb des Hofes. Almwirtschaft wird keine mehr betrieben, es gibt zwar eine jüngst errichtete Almhütte auf ca. 2.200 m. ü. M., die nur mehr von Sommerfrischlern genutzt wird. Die Kuhmilch wird an einen Milchhof geliefert, Schaf- und Ziegenmilch werden ausschließlich für die Aufzucht des Jungviehs verwendet. Die Wollproduktion spielt wirtschaftlich keine Rolle, die Schafe werden nur aus hygienischen Gründen geschoren. Einen Nebenverdienst erbringt der Ausschank am Finailhof.
Klima und heutige Weidewirtschaft
11H
eft DER SCHLERN 23
Archäologie
Die älteste Urkunde, die über die Weidewirtschaft im Schnalstal berichtet, stammt aus dem 14. Jahrhundert. In einem Vertrag und Spruchbrief von
1361 werden die Bauern vom Tüsener-, Vyneil-, Rofein-, Mayer- und Mastaunhof vom Richter von Kastelbell aufgefordert, mit ihrem Vieh „sollen in irem berg damit bleiben“117.
Über die Almbestoßung in historischer Zeit gibt eine Urkunde aus dem Jahre 1563118 Auskunft, in der 18 Höfe aufgelistet sind, die das Weiderecht im Niedertal auf der Ötztaler Seite hatten. Insgesamt durften die entsprechenden Höfe gegen Bezahlung 177 Ochsen und 1.037 Schafe ins Niedertal treiben. Bestoßungsziffern liegen auch von einer der größten Almen, der Penaudalm (ca. 1.322 ha) vor, wo nach dem Revers von 1584 von 166 Stück Hauptvieh (Kühe, Kälber, Pferde) die Rede ist119. Die hohen Stückzahlen scheinen realistisch und entsprechen der Bestoßung aus dem Jahre 1949: 82 Kühe, 67 Kalbinnen, 24 Pferde, 16 Schweine, 441 Schafe120.
Das hintere Ötztal spielte für die Schnalser Bauern eine bedeutende Rolle, vor allem um ihre eigenen talnahen Weidegründe zu schonen und weil zunehmend Vieh auch aus dem Vinschgau121 aufgenommen wurde. Im Besitz der Schnalser waren die Weidegebiete östlich der Venter Ache und des Niedertales122. Für das Schnalstal ist auch eine kleinregionale Transhumanz bezeugt. Im Frühjahr durften einige Höfe bis zu 400 Schafe nach Meran treiben123, um dort die Wiesen zu beweiden und damit zu düngen. Die Sommerung des Viehs in Mittelalter und Neuzeit war allgemein strengen Regeln unterworfen. Sie zeugt auf jeden Fall von der Bedeutung der Almweiden für den Fortbestand der Viehherden und der Wirtschaftlichkeit des Bauernstandes. Die hohen Bestoßungszahlen der diversen Weidegebiete im Schnalstal, erzwingen eine genossenschaftliche bzw. gemeinschaftliche Organisation der Almwirtschaft in Mittelalter und Neuzeit. Der hohe Aufwand für die Sömmerung des Viehs, das dabei eingegangene Risiko und der geringe Herdenbesatz lassen auch für die Bronzezeit eine über die Dorfgemeinschaft hinausreichende gemeinschaftliche Organisation der Beweidung vermuten.
Um die Beweidung im Hochgebirge während der Bronzezeit zu rekonstruieren, basieren die Berechnungen auf den Knochenuntersuchungen der
bronzezeitlichen Talsiedlung vom Ganglegg124 und der Bergsiedlung Sotćiastel125. In der Mittelbronzezeit überwiegen in der Siedlung Ganglegg die Rinder (49,7 %), die Oviden machen ca. 38,5 % des Viehbestandes aus, während Schweine (9 %) eine untergeordnete Rolle spielen126. In der End- bis Spätbronzezeit ändert sich das Gleichgewicht zugunsten der Oviden (48 %), wobei die Kleintierherde zu 2/3 aus Schafen besteht127. In der mittel- bis spätbronzezeitlichen Siedlung Sotćiastel überwiegen bereits in der Mittelbronzezeit die Oviden (53 %), Rind (42 %), Schweine (5 %) spielen so gut wie keine Rolle in der Herdenwirtschaft128. Der Grund für die unterschiedlichen Tierbestände in den mittel- bis spätbronzezeitlichen Siedlungen wird wohl in der Höhenlage zu suchen sein. Auf Ganglegg könnte sich der Klimawandel in der Spätbronzezeit zugunsten der weniger anspruchsvollen Oviden ausgewirkt haben. In beiden Siedlungen ist ein Übergewicht an weiblichen Tieren zu verzeichnen, daraus wird a priori auf Milchwirtschaft geschlossen. Eine hohe Anzahl an weiblichen Tieren ist aber auch von Nöten, wenn die wirtschaftliche Nutzung auf die Fleischproduktion ausgerichtet ist, da nur so ein Herdenwachstum und damit Fleischreserven garantiert sind. Die hohe Anzahl der Kastraten unter den Schafknochen vom Ganglegg129 unterstreichen die Bedeutung einer Wollproduktion, da männliche
Historische Weidewirtschaft im Schnalstal
Herdenstruktur in historischen und prähistorischen Siedlungen
DER SCHLERN 24 11H
eft
Archäologie
Tiere bis zu 1 kg Wolle mehr produzieren. Der geringe Anteil an Schweinen, die ja ausschließlich zur Fleischproduktion taugen, unterstreichen die Bedeutung der Oviden als Fleischlieferanten.
Als Vergleich sollen Viehbestände vom Ende des 14. Jahrhunderts von den Schwaighöfen aus dem Obervinschgau130 herangezogen werden. Die Herden der Schwaighöfe der Vögte von Matsch bestehen zu 94 % aus Oviden (fast ausschließlich Schafe), nur 4,7 % aus Rindern und 0,11 % aus Schweinen. Die ebenfalls verzeichneten Zinsabgaben für die Matscher Schwaighöfe bestehen ausschließlich in „Tuch“ (Loden) oder Fleisch. Um 1780 überwiegen dann wieder die Rinderherden in Matsch131. Die unterschiedlichen Viehbestände sind auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Schwaighöfe ausschließlich Viehhöfe waren und der Viehbestand teilweise von Seiten der Grundherren bestimmt wurde. Gleichzeitig ging die Veränderung in den Herdenbeständen des Obervinschgaus mit Klimaschwankungen einher. In Folge der mittelalterlichen Warmzeit um 1200/1300, wo die Temperaturen um 1–2 Celvin höher lagen als heute und die sich im trockenen Vinschgau vermutlich stark ausgewirkt hat, ist ein Anstieg der Oviden zu verzeichnen. Währenddessen nach einer Kaltphase, die allgemein als kleine Eiszeit bezeichnet wird und zwischen 1550–1750 auftrat, die Rinderherden zunehmen.
Eine sich selbst reproduzierende Herde sollte durchschnittlich 30 bis 50 Tiere umfassen132, um die Anzahl der Tiere stabil zu halten und um
wirtschaftlichen Nutzen, wie etwa die Milchgewinnung, überhaupt interessant zu machen. Den Viehbesatz anhand archaözoologischer Studien zu ermitteln, wurde erstmals von Ebersbach133 für die Rinderzucht im Neolithikum versucht. Die Ermittlung der Herdengröße basiert auf die MIZ (Mindestindividuenzahl) in Feuchtbodensiedlungen, wo sich das ausgegrabene Tierknochenmaterial relativ homogen über die Fläche verteilt. Die Berechnungsmethode134 soll in unserem Fall für die bronzezeitlichen Siedlungen Ganglegg und Sotćiastel angewandt werden, um so auf die Herdengröße zu schließen.
Ebersbach135 geht davon aus, dass ein nachgewiesenes Individuum einem Zehntel (natürliche Verluste) bzw. einem Fünftel (maximale zusätzliche Schlachtung) der lebenden Tiere entspricht, da ansonsten die demographische Stabilität einer Herde langfristig nicht gewährleistet ist. Wir haben für die mittel- bis spätbronzezeitliche Belegung am Ganglegg eine MIZ von 48 Rindern, 42 Schafen/Ziegen, 21 Schweinen136. Für Sotćiastel 69 Rinder, 138 Oviden und 14 Schweine137. Für die Berechnung wird die Siedlungsdauer berücksichtigt, die Mittelbronzezeit reicht von 1550–1350 v. Chr., die Spätbronzezeit von 1350–1200. Am Ganglegg ist mit der Besiedelung nach Steiner138 erst ab den Phasen Bz B2/C1 zu rechnen (ca. 1400 v. Chr.) und die berücksichtigte spätbronzezeitliche Schicht G 15 datiert früh. Das ergibt für die am Ganglegg errichteten Gebäude, großzügig gerechnet, eine Siedlungsdauer von 200 Jahren. Da die 12 ergrabenen Häuser 5 Phasen zugeordnet werden konnten und man davon ausgehen kann, dass ein bronzezeitliches Haus nach ca. 30 Jahren erneuert werden musste, reduziere ich für unsere Berechnung die Siedlungsdauer auf 150 Jahre. Das untersuchte Knochenmaterial von Sotćiastel wird von den Bearbeitern der Mittelbronzezeit zugeordnet, deshalb gehen wir in unserem Rechenmodell von einer Siedlungsdauer von 200 Jahren für Sotćiastel aus. Wenn man die Belegungsdauer der Siedlung durch die nachgewiesene MIZ teilt, erhält man die Anzahl der jährlich entnommenen Tiere durch den natürlichen Verlust und/oder Schlachtung (Tab. 1).
Bronzezeitliche Herdengrößen
11H
eft DER SCHLERN 25
Archäologie
MIZ Ganglegg
MIZ Sotćiastel
Jährliche Entnahme Ganglegg
Jährliche Entnahme Sotćiastel
Rind 48 69 0,32 0,35
Schaf/Ziege 42 138 0,28 0,69
Schwein 21 14 0,14 0,07
Viehbestand 111 221 0,74 1,11
Für beide Siedlungen ergeben sich geringe Herdengrößen: Bei einer Entnahme von 10 % durch natürlichen Verlust ergibt das fürs Ganglegg eine Herde von 7,4 Tieren, bei einer 20prozentigen Entnahme eine Herde von 3,7 Tieren. In der Siedlung Sotćiastel unterhielt man eine Herde von 11,1 bzw. 5,55 Tieren. Die errechneten Herdengrößen für beide Siedlungen fallen eher bescheiden aus. Am Ganglegg kann zudem das Knochenmaterial vom Opferplatz am „Hahnenhütterbödele“ mit einbezogen werden. Vom Opferlatz fehlen leider MIZ für die entsprechenden Zeitstufen, mit Ausnahme der mittelbronzezeitlichen Struktur, die das Bild139 (1 Rind, 2 Schaf/Ziege, 1 Schwein) aber nicht wesentlich verändert. Reale Herdengrößen erhält man, wenn man für das Ganglegg nur die spätbronzezeitliche Schicht G15 in und um Haus 12 berücksichtigt. Die Schicht konnte zwei Phasen G 15–1 und G 15–2 zugeordnet werden, deshalb nehmen wir eine Dauer von 30 Jahren pro Phase an, da dies der Haltungsdauer eines spätbronzezeitlichen Hauses entsprechen dürfte. Das geborgene Knochenmaterial ergab MIZ von 10 Rindern, 10 Schafen und 5 Schweinen. Das Areal wurde nur zu etwa 1/3 freigelegt, deshalb soll unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich in den säurehaltigen Böden des Alpenraumes das Knochenmaterial schlecht erhält, die MIZ verdreifacht sein (Tab. 2).
Ganglegg Schicht G 15
Jährliche Schlachtung Schicht G 15
Viehbestand (10%ige Entnahme)
Schicht G 15
Viehbestand (20%ige Entnahme)
Schicht G 15
Rind 30 0,5 5 2,5
Schaf/Ziege 30 0,5 5 2,5
Schwein 15 0,25 2,5 1,25
Viehbestand 75 1,25 12,5 6,25
Die neuerliche Berechnung würde nun eine Herde von 5 Rinder, 5 Schafe/Ziegen und 1,25 Schweinen bei einer 10-prozentigen Entnahme ergeben. Dies würde realistische Zahlen für die spätbronzezeitlichen Familien der Siedlung am Ganglegg ergeben.
Bei einer geschätzten Einwohnerzahl von 10 Personen für die beiden Phasen für das am Ganglegg ergrabene Haus 12140 – 5 Personen pro Phase – ergibt dies nach dem Rechenmodell von Ebersbach einen Viehbestand von 1,25 Tieren pro Kopf oder bei einer 20-prozentigen Entnahme von 0,63 Tieren pro Kopf. Für Sotćiastel geht Tecchiati141 von max. 5 Wohneinheiten aus, was einer Bevölkerung von 25 Personen entsprechen würde. Die Berechnung ergibt bei einer Herde von 11,1 Tieren 0,45 Tiere pro Kopf und bei einer Herde von 5,55 Tieren 0,22 pro Kopf. Zum
Tab. 1 Schlachtquoten der Mittel- und Spätbronzezeit.
Tab. 2 MIZ und Herdengröße der Siedlung Ganglegg in der Spätbronzezeit.
DER SCHLERN 26 11H
eft
Archäologie
Vergleich 1780 standen den 500 Einwohnern von Matsch pro Kopf 1,66 Tiere zur Verfügung. Ethnologische Vergleiche aus autarken kleinbäuerlichen Gesellschaften ergeben einen Durchschnitt von 0,81 Tieren pro Kopf142. Die errechneten Werte liegen in Sotćiastel unter dem Mittelwert kleinbäuerlicher Gesellschaften und am Ganglegg drüber. Zum Vergleich sollen die Viehbestände auf Basis des Mittelwertes von 0,81 für beide Siedlungen errechnet werden. Die 10 Einwohner der beiden Phasen von Haus 12 am Ganglegg hätten eine Herde von 8,1 Tieren und die 25 Einwohner von Sotćiastel würden über eine Herde von 20,25 Tieren verfügen(Tab. 3).
Ganglegg Haus 12 Sotćiastel Gericht
Matsch 1780Ganglegg
Haus12 nach Ebersbach
Sotćiastel nach
Ebersbach
Einwohner 10 25 500 10 25
Viehbestand 12,5 11,1 830 8,1 20,3
Pro Kopf 1,25 0,45 1,66 0,81 0,81
Der errechnete Fleischanteil pro Kopf für die Einwohner vom Ganglegg liegen höher als die von Ebersbach ermittelten Mittelwerte, jene von Sotćiastel liegen etwas darunter. Durch die Vergleichsdaten aus dem 18. Jahrhundert vom Gericht Matsch (Tab. 3) scheinen die aus der Berechnung nach Ebersbach resultierenden Viehbestände für beide bronzezeitlichen Siedlungen realistisch. Die Differenz zwischen Ganglegg und Sotćiastel ist vermutlich mit der Höhenlage zu erklären und auf das Problem der Winterfütterung zurückzuführen, dass sich sicher auf die Herdengröße ausgewirkt hat. Steiner geht am Ganglegg von jeweils 12–16 zeitgleichen Strukturen aus, das würde eine Einwohnerzahl von 60 bis 80 Personen ergeben. Nimmt man die für die Spätbronzezeit errechneten Viehbestände als Basis, würde die Herde in der Spätbronzezeit bei einer jährlichen Schlachtung von 1,25 Tieren auf dem Ganglegg aus 75 bzw. 100 Stück Vieh bestanden haben, pro Familie wären das 6,25 Tiere. Im Vergleich dazu lag der Viehbestand 1567 auf dem Pleifhof zu Burgeis bei 7 Kühen, 1 Paar Ochsen, 5 Kälbern, 16 Schafen und 5 Schweinen143, in Matsch lag 1780 die Anzahl der Tiere pro Bauernhof bei 15,38 Tieren144 (Tab. 4).
Ganglegg SotćiastelGericht Matsch
1780
Einwohner 60 25 500
Viehbestand 75 11,25 830
Pro Familie 6,25 2,25 15,38
Steiner145 hat für den Brandopferplatz am Hahnenhütterbödele den Viehbestand nach der von Zanier entwickelten Methodik berechnet. Für die besprochenen Zeitstufen ergab die Kalkulation eine jährliche Opferung von 34 Rindern, 45,4 Schafen/Ziegen. Das würde nach der Methode von Ebersbach eine Herde von 340 Rindern und 454 Schafen/Ziegen ergeben. Die dabei errechneten Stückzahlen
Tab. 3 Viehbestände pro Kopf im Vergleich.
Tab. 4 Herdengröße auf Sotćiastel und Ganglegg.
11H
eft DER SCHLERN 27
Archäologie
entsprechen in etwa der Anzahl der Tiere der 54 Bauernhöfe, die dem Gericht Matsch 1780146 unterstanden. Für die Mittel- bis Spätbronzezeit sind so große Herden wohl eher nicht anzunehmen, da es unmöglich scheint eine so große Herde über den Winter zu bringen. Man bedenke, dass eine Milchkuh im 18. Jahrhundert, während der Winterstallung am Tag 6,7 kg Heu und 3,4 kg Stroh benötigte147. Bei 160 Tagen Winterstallung ergibt das 1072 kg Heu und 380 kg Stroh. Schafe und Ziegen benötigen ca. 1/8 der für Rinder vorgesehenen Futtermenge. Bei einer Nutzung der Waldbestände durch Scheiteln und Wintergräser benötigte ein Rind 0,87 ha Wald148. Bei dem von Steiner errechneten Viehbestand für das Ganglegg würde die Futtermenge für Rinder 493.680 kg betragen und/oder die Nutzung einer Waldfläche von 295,8 ha.
Die nach dem Modell von Ebersbach errechneten Daten scheinen glaubwürdige Viehbestände für die Bronzezeit zu ergeben, zumal die Vergleichsdaten vom Gericht Matsch einen für das 18. Jahrhundert hohen Viehbestand (pro Kopf) für den Obervinschgau149 darstellen.
Prähistorische Almbestoßung
Die Auswertung der besprochenen Knochenfunde hat gezeigt, dass die Herdenstruktur der mittel- bis spätbronzezeitlichen Siedlungen im Südtiroler
Raum zum überwiegenden Teil aus Oviden besteht. Dies ließe sich durch weitere Siedlungsbefunde wie beispielsweise Pfatten150 ergänzen. Die damit verbundene Wirtschaftsweise zeugt von der Nutzung des Primärproduktes Milch und der Sekundärprodukte Wolle, Fleisch oder Milchprodukte. Der geringe Anteil an Schweinen ist wohl damit verbunden, dass in Südtirol die für die Schweinemast notwendigen Eichen- und Buchenwälder fehlen151. Primäres Ziel einer Almnutzung in der Bronzezeit ist so wie heute, die heimischen oder siedlungsnahen Weidegebiete den Sommer über zu schonen bzw. das anfallende Heu für die Winterfütterung zu verwenden. Der hohe Anteil von Stroh in den botanischen Überresten aus der Siedlung von Fiavè152 bezeugt die Nutzung und Lagerung von Heu für die Winterfütterung ab der Bronzezeit. Ob dies auch auf den hochalpinen Almen praktiziert wurde, ist fraglich. Funde von Sichelelementen wie beispielweise bei der Malga Vacil153 im Trentino könnten jedenfalls darauf hindeuten. Historische Quellen aus dem Südtiroler Raum bezeugen für das 15. Jahrhundert nur von der Seiseralm und der Nemesalm bei Innichen einen Heustadel mit den dazugehörigen Mähwiesen154.
Die Knochenuntersuchungen vom Brandopferplatz am Grubensee155 erlauben einen Einblick in die Herdenstruktur bronze- bis römerzeitlicher Almen. Es überwiegen die Knochen von Oviden – ebenso wie in den Siedlungen Rinderknochen fehlen. Dies kann vielleicht darauf zurückgeführt werden, dass der Entzug der gesamten Herde und der damit verbundene Milchentzug für die Siedlung ernährungsbedingt nicht tragbar war. Eine weitere Erklärung könnte in der Wirtschaftlichkeit liegen. Wenn Melkkühe gesömmert werden, muss die Milch weiterverarbeitet werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn die Stückzahl der Kühe dementsprechend hoch liegt. Nimmt man den errechneten Herdenbestand von 75 Tieren fürs Ganglegg als Basis und berücksichtigt den von Schmitzberger156 errechneten 40-prozentigen Anteil an Rindern in der Spätbronzezeit, so ergibt das ca. 30 Rinder, davon nur ein geringer Anteil an Melkkühen157. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es nicht sinnvoll, mit wenigen Melkkühen auf Almen Sekundärprodukte herzustellen. In die Zeit der Sömmerung fällt zudem die Aufzucht der Jungtiere, die einen Großteil der Muttermilch für sich beanspruchen.
DER SCHLERN 28 11H
eft
Archäologie
Die Knochenbefunde vom Grubensee zeigen, dass die prähistorischen Almen im Vinschgau nur von Oviden und Schweinen bestoßen wurden. Bei den Oviden handelt es sich in der Mehrzahl um Schafe. Die Gründe dafür sind wohl in der Wollgewinnung und der einfacheren Handhabung der Tiere zu suchen. Ob es auch zu einer Weiterverarbeitung der Milch auf den prähistorischen Almen kam, ist schwer zu belegen. Als Indikatoren für eine betriebene Produktion von Sekundärprodukten aus Schaf- oder Ziegenmilch könnten die Schweineknochen gelten, da im Hochgebirge als bedeutendste Futterquelle für Schweine die Abfallprodukte der Milchverarbeitung in Frage kommen. Nach den erfolgten Berechnungen (Tab. 4) kann also von einer Herde von ungefähr 45 Stück Vieh ausgegangen werden. Im Falle des Finailtals würden die Weidegründe weit mehr Vieh Platz und Nahrung bieten. Dies drängt die Frage auf, ob bereits in prähistorischer Zeit von genossenschaftlicher Bewirtschaftung der Weidegebiete ausgegangen werden kann oder muss. Soll die Milchverarbeitung am Berg wirtschaftlich interessant sein, so ist eine Mindestanzahl an Tieren notwendig. Die Milchverarbeitung ist mit ziemlich hohem Aufwand verbunden: Es ist eine Struktur notwendig, weniger für das Vieh, sondern für die Käseproduktion. Es braucht jede Menge Holz und ebenso Arbeitskräfte. Werden die Produkte vor Ort gelagert, so sind zudem Lagerräume notwendig. Wie komplex eine Alm aufgebaut sein kann, zeigt der Befund aus Bergeten bei Braunwald im Kanton Glarus aus dem 13.–14. Jahrhundert158. Neben Almhütten, die als Unterkunft und zur Milchverarbeitung dienten, konnten Strukturen für die Lagerung und sogar für die Konservierung der Milch freigelegt werden. Die geringen Herdenzahlen in den untersuchten Siedlungen machen bei betriebener Almwirtschaft eine Zusammenarbeit zwischen einzelnen Dorfgemeinschaften notwendig. Im Schnalstal wird heute Käse nur auf der Penaudalm produziert, die seit 1557159 der Alminteressentschaft der Bauern aus Tschars gehört. Die restlichen Almen sind im Privatbesitz, die nur von Schafen und Ziegen (z. T. auch Galtvieh) bestoßen werden, um die Hof nahen Weidegebiete zu schonen.
Die Untersuchungen der Knochenfunde vom Grubensee reichen alleinig nicht aus, um den bronzezeitlichen Herdenbesatz der Hochweiden zu ermitteln. Die prähistorische Almbestoßung und vor allem eine evtl. damit verbundene Milchverarbeitung entzieht sich der archäologischen Feldforschung – da die dafür verwendeten Gerätschaften zum Großteil aus Holz waren. Die einzige Möglichkeit besteht in einer gezielten Untersuchung des geborgenen Knochenmaterials im Hochgebirge und den Siedlungen und dem daraus resultierenden Herdenmanagement.
Zusammenfassung
Im Finailtal, einem Seitental des Schnalstals, konnte auf ca. 2.460 m. ü. M. ein Heiligtum aus der Bronzezeit ergraben werden. Die Kultstätte bestand aus einem
„Altar“ aus faustgroßen Steinen und „Opfergruben“, die für das Zubereiten der Speiseopfer Verwendung fanden. Eingegrenzt wird das Heiligtum von zum Teil in situ befindlichen Monolithen, die senkrecht in der Erde eingelassen waren. Die Funde datieren in die Spätbronzezeit und zeugen zum Teil von der Nutzung des Opferplatzes im Zuge einer im Tal betriebenen Weidewirtschaft. Außergewöhnlich sind zahlreiche Bernstein- und Glasperlenfunde, die vom hohen sozialen Rang der Benutzer des Heiligtums zeugen. Auffallend ist der ausschließlich weibliche Charakter der Kleinfunde, der entweder eine Dominanz der Frauen in der bronzezeitlichen Weide- bzw. Almwirtschaft bezeugt oder mit einer nahegelegenen noch unentdeckten Siedlung zu verbinden ist.
Anschrift:Mag. Andreas Putzer
Venedigerstraße 139100 Bozen
11H
eft DER SCHLERN 29
Archäologie
Anmerkungen
1 Erste urkundliche Nennung 1290: „Albertus dictus Vulpes curiam swaigalem in Vineil sol-vit libras XV pro caseis“ (Or. StA. Wien Rep. I), vgl. Tarneller, AöG. 100, 57.
2 An dieser Stelle danke ich dem Bauern Manfred Gurschler vom Finailhof für die Nutzung seines Salzlagers als Lager für unser Grabungsmate-rial und als Unterstand bei Schlechtwetterein-bruch.
3 Freundliche Auskunft von Johannes Ortner vom Landesarchiv der Provinz Südtirol, der zurzeit mit dem Erstellen einer Flurkarte beschäftigt ist.
4 Die keramischen Funde wurden bis heute nicht vorgelegt.
5 H. Nothdurfter/D. Nisi, The Iceman. Traces of long-term settlements of shepherds in the Simi-laun area. Hand-out zur Tagung anlässlich des 10. Jahrestages der Auffindung des Mannes aus dem Eis, Bozen 20.–22.9.2001, 23.
6 Eine durch den Autor durchgeführte Überprü-fung der Unterlagen zu den Radiokarbonda-tierungen hat ergeben, dass nur zwei Proben eindeutig der Finailgrube zugeordnet werden können. Die spätbronzezeitliche Datierung scheint nirgendwo auf. Die dritte Probe wird im Dokument unter „Finailspitze“ geführt und da-tiert 1.740–1.503 v. Chr. Für die Unterlagen dan-ke ich herzlichst Herrn Dr. Hubert Steiner vom Amt für Bodendenkmäler Bozen.
7 G. Niederwanger, Mesolithische Höhenfunde im Vinschgau. Reitia Archäologie-Forschung-Pro-jekte-Spurensuche, Arunda 51, 1999, 29.
8 J. Rageth, Ein eisenzeitlicher Kultplatz in Scuol-Russonch (Unterengadin GR). Jarb. Hist. Ges. Graubünden 1998, 5–59.
9 M. Honeck, Nichts als heiße Steine? Zur Deu-tung der Brenngruben der späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit in Deutschland. UPA 166 (Bonn 2009), 12, Taf. 26,6.
10 Honeck (Anm. 9), Taf. 30,1. 11 J. Rageth, Ein prähistorischer Kultplatz auf
Scuol-Motta Sfondraz. Archäologischer Dienst Graugründen – Denkmalpflege Graubünden Jahresbericht 1998, 37, Abb. 32.
12 J. Rageth, Die wichtigsten Resultate der Aus-grabungen in der bronzezeitlichen Siedlung auf dem Padnal bei Savognin (Oberhalbstein GR). JSGF 69, 1986, 81/82.
13 H. Steiner, Die befestigte Siedlung am Gangl- egg im Vinschgau – Forsch. zur Denkmalpflege in Südtirol 3 (Trento 2007), 184, Abb. 84,1.
14 H. Staffler/B. Baumgarten, Zerminiger Wetz-stein. Kulturwind, August 2007, 76–79.
15 C. Stahl, Mitteleuropäische Bernsteinfunde von der Frühbronzezeit- bis zur Frühlatènezeit. Würzburger Studien zur Sprache & Kultur 9 (Dettelbach 2006), 10.
16 C. W. Beck/J. A. Heider, Bronzezeitliche Bern-steinperlen aus Reinach (BL). In: C. Fischer/B. Kaufmann (Hrsg.), Bronze, Bernstein und Ke-ramik. Archäologie und Museum Heft 30, 1994, 64/65.
17 P. Bellintani, Bernsteinstraßen, Glasstraßen. In: Über die Alpen. Ausstellungskatalog Landes-museum Baden-Württemberg. Almanach 7/8, 2002, 40.
18 Stahl (Anm. 15), 12.
19 C. W. Beck/S. Shennan, Amber in Prehistoric Britain. Oxbow Monograph 8, 1991, 119.
20 Inneralpine Lagerstätten finden sich beispiels-weise in Münchenstein südlich von Basel (CH) oder aber bei Golling im Land Salzburg (A) und in den bellunesischen Dolomiten.
21 I. Angelini/P. Bellintani, Archaeological Ambers from Northern Italy: An FTIR-DRIFT Study of provenance by comparison with the geologi-cal Amber Database. Archaeometry 47, 2005, 445–447.
22 C. W. Beck/A. Bocquet, Eine neolitische balti-sche Bernsteinperle aus Südostfrankreich. AK 13, 1983, 315, Abb. 1.
23 Stahl (Anm. 15), 14–19. 24 L. Salzani, La Necropoli dell’età del Bronzo
all’Olmo di Nogara. Memorie del Museo Civi-co di Storia Naturale di Verona. – Sezione Sci-enze dell’Uomo 8 (Verona 2005), 334, Tav. IV, Tb 30,D; 339, Tav. IX, TB 85,E.
25 L. Salzani, Necropoli dell’Età del Bronzo finale alle Narde di Fratta Polesine. Padusa Anno XX-VI-XXVII, 1990/91, 145/146.
26 J. Rageth, Die bronzezeitliche Siedlung auf dem Padnal bei Savognin (Oberhalbstein GR), Grabungen 1971 und 1972. JSBF 59, 1976, 173, Abb. 41.
27 G. Bergonzi, L’ambra delle terramare nel con-testo europeo italiano ed europeo. In: M. B. Brea/A. Cardarelli/M. Cremaschi (Hrsg.), Le Ter-ramare (Milano 1997), 606.
28 P. Bellintani, I bottoni conici ed altri materiali vetrosi delle fasi non avanzate della media età del Bronzo dell’Italia settentrionale e centrale. Padusa XXXVI Nuove Serie, 2000, 95–110.
29 C. Fischer, Innovation und Tradition in der Mit-tel- und Spätbronzezeit. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 28 (Zürich und Egg 1997), Taf. 50, 217/218; Taf. 51, 219/220.
30 C. Fischer/B. Kaufmann, Bronze, Bernstein und Keramik. Urnengräber der Spätbronzezeit in Reinach BL. Archäologie und Museum Heft 30, 1994, Taf. 3, 9–12.
31 Fischer/Kaufmann (Anm. 30), T 51,222-223. 32 L. Salzani, Insediamento dell’Età del Bronzo al-
la Sabbionara di Veronella (VR). Padusa Anno XXVI–XXVII, 1990/91, 124, Fig. 21,13.
33 H. G. Rau, Das urnenfelderzeitliche Gräberfeld von Aschaffenburg-Strietwald. Materialh. Bayr. Vorgesch. Heft 26, 1972, Taf. 9,3.
34 W. Kubach, Die Stufe Wölfersheim im Rhein-Main-Gebiet. PBF XXI-1,1984, Taf. 26A, 3–17.
35 Salzani (Anm. 25), Fig. 14,14. 36 M. Catarsi/P. L. Dall’Aglio, La necropoli protovil-
lonoviana di campo Pianelli di Bismantova. Ca-taloghi dei Civici Musei 4 (Reggio Emilia 1978), Tav. XXI, 1.
37 K. H. Wagner, Nordtiroler Urnenfelder. Röm. Germ. Forsch. 15 (Frankfurt am Main 1943), Taf. 9,15a.
38 Wagner (Anm. 37), Taf. 1, 15. 39 S. Wirth, Grabfunde der späten Bronzezeit und
der Urnenfelderzeit. Augsb. Beitr. zur Arch. 1, 1998, Haunstetten I8, 3/4; Haunstetten I40; 30/31.
40 Stahl (Anm. 15), 185–189. 41 Aus einem latènezeitlichen Haus in Siebeneich:
R. Lunz, Eine Baulichkeit der jüngsten Eisen-zeit (1. Jh. v. Chr.) in Siebeneich. In: Umberto Tecchiati (Hg.), Der heilige Winkel, Schriften
DER SCHLERN 30 11H
eft
Archäologie
des Südtiroler Archäologiemuseums 2, 2002, 362. Ebenfalls Latènezeitlich ist der Fund einer Bernsteinperle von Zwingenstein: A. Putzer, Die Besiedelung des Burghügels Zwingenstein. Der Schlern 85, 2011, 29. Von der Leuchtenburg bei Pfatten: R. Lunz, Ur- und Frühgeschichte des Pfattener Raumes. Landschaft und Geschichte. In: G. Tengler (Hrsg.), Pfatten, Landschaft und Geschichte (Bozen 1991), Taf. XXV, 4.
42 Unpubliziert. Die Perle findet sich in den Aus-stellungsräumen des Südtiroler Archäologie-museums unter der Inv. Nr. M8.
43 H. Steiner, Alpine Brandopferplätze. Forsch. zur Denkmalpflege Südtirol V (Trento 2010), Taf. 31, 4/5.
44 P. Bellintani/G. Residori, Quali e quante con-terie: Perle ed altri materiali vetrosi dell’Italia settentrionale nel quadro dell’età del Bronzo Europea. Atti della XXXV Riunione scientifica I (Firenze 2003), 488–450.
45 U. Tecchiati, Sotćiastel – Un abitato fortificato dell‘età del bronzo in Val Badia (Leifers 1998), 267, Tav. 56.
46 Bellintani/Stefan (Anm. 44). 47 Wirth (Anm. 39), 102/103. 48 Wagner (Anm. 37), Taf. 15,7. 49 A. M. Rachner Faraggi, Hauterive-Champrévey-
res 9. Métal et parure au Bronze Final. Archéolo-gie neuchâteloise 17, 1991,12–14.
50 Bellintani/Stefan (Anm. 44), Tab. 2. 51 Bellintani/Stefan (Anm. 44), Fig. 3. 52 Bellintani (Anm. 17), 42. 53 Wagner (Anm. 37), Taf. 9, 15b–15c. 54 Rageth (Anm. 11), 44–46. 55 Honeck (Anm. 9), 10–15. 56 M. Mahlknecht, Der Brandopferplatz am Gru-
bensee. (Vintschgau-Südtirol). Prähistorische Weidewirtschaft in einem Hochtal. In: F. Mandl (Hrsg.) Alpen. Festschr. 25 Jahre ANISA. Mitt. Der ANISA 25/26 (Haus i. E. 2006), 92–121.
57 Rageth (Anm. 11), 37, Abb. 32. 58 B. Heeb, Feldkirch, Altenstadt-Grütze. Ein
Brandopferplatz der Urnenfelder- und Laugen-Melaun-Kultur. In: J. Zeisler/G. Tomedi (Hrsg.), Archaeo Tirol. Kleine Schriften 5 (Wattens 2006), 176, Abb. 1.
59 P. Haupt, Bronzezeitliche Erdöfen auf dem Schlern. Der Schlern 84, 2010, 4–16.
60 H. Steiner/A. Putzer/H. Oberrauch/A. Thurner/ K. Nicolussi, Vorgeschichtliche Moorfunde auf der Schöllberg-Göge in Weißenbach (Gde. Ahrntal/Südtirol). AK 39, 2009, 489 ff.
61 Honeck (Anm. 9) Taf. 1; Taf. 2; Taf. 3; I. Bauer, Landsiedlungen und Gräber der mittleren und späten Bronzezeit. Archäologische Monogra-phien 11, 1992, 33–55.
62 Honeck (Anm. 9), 19. 63 Haupt (Anm. 59), 63–72. 64 K. H. Werner, Die Almwirtschaft des Schnalsta-
les. Veröffentlichungen der Univ. Innsbruck 20, 1969, 25.
65 R.-M. Weiss, Prähistorische Brandopferplätze in Bayern. Int. Arch. 35 (Espelkamp 1997), 90, Abb. 30.
66 P. Gleirscher, Ein urzeitliches Bergheiligtum am Pfitscher Jöchl über Dorf Tirol? Der Schlern 67, 1993, 407–435.
67 I. Angelini/G. Artioli/P. Bellintani, Ambre e ma-teriali vetrosi protostorici della Valle Dell’Adige
nel quadro delle coeve attestazioni dell’Italia del Nord. Preistoria Alpina 39, 2003, 227–241.
68 Steiner (Anm. 43), 425. 69 Stahl (Anm. 15), 21/22. 70 Weiss (Anm. 65), 92. 71 Angelini/Artioli/Bellintani (Anm. 67), 237. 72 H. Nothdurfter, Archäologische Hinweise auf
Adel und Raumorganisation des 7. /8. Jahrhun-derts im westlichen Südtirol. In: R. Loose/L. Sön-ke (Hrsg.), König, Kirche, Adel (Lana 1999), 97.
73 U. Tecchiati, Zur Vor- und Frühgeschichte des Mittleren und Unteren Vinschgaues. Archäolo-gie und Kunstgeschichte in Kastelbell-Tschars und Umgebung (Trient 1995), 37.
74 Nothdurfter (Anm. 72), 97. 75 G. Jäger, Fernerluft und Kaaswasser. Innsbruck
2008, 117/118. 76 Jäger (Anm. 75), 108. 77 R. Ebersbach, Von Bauern und Rindern. Basler
Beitr. zur Archäologie 15, 2002, 85–87. 78 Ebersbach (Anm. 77), 82. 79 Freundliche Auskunft von Herrn Dr. Umberto
Tecchiati. 80 G. Kaufmann/A. Obex, Die spätbronzezeitli-
che Siedlung beim Hof Oberortl unterhalb von Schloß Juval. Der Schlern 74, 2000, 65, Tab. 2.
81 Tecchiati (Anm. 73), 61/62. 82 G. Kaufmann/H. Nothdurfter, Annenberg, In-
sediamento d’Altura dell’età del Bronzo in Val Venosta (BZ). Atti della XXXIII Riunione Scien-tifica (Firenze 2002), 385–387.
83 L. Dal Ri, Ausgrabungen des Denkmalamtes Bozen in Sankt Stephan ob Burgeis (Gemeinde Mals) und Sankt Laurentius in Kortsch (Gemein-de Schlanders). In: R. Loose (Hg.) Der Vinsch-gau und seine Nachbarräume (Bozen 1993), 57–59.
84 P. Anich/B. Hueber, Tyrolis sub Felici Regime Mariae Theresiae Rom. Imper. Aug. Choreogra-phice delineate. 1777, Blatt 12.
85 In Ausarbeitung, Andreas Putzer. 86 J. Tarneller, Die Hofnamen im Burggrafenamt
und in den angrenzenden Gemeinden. Archiv f. österr. Geschichte 100 (Wien 1910).
87 www.tiroul.info, Gemeinden, Schnals (Ort/Schnals), Etymologie.
88 J. Pokorny, Indogermanisches etymologi-sches Wörterbuch I (Tübingen und Basel 1959), 972/973.
89 Freundliche Auskunft von Herrn Dr. Christian Kollmann.
90 K. Finsterwalder, Tiroler Ortsnamen Kunde Band 3. Schlern-Schriften 286 (Innsbruck 1990), 1071–1090.
91 D. H. Steinbauer, Neues Handbuch des Etruski-schen I (St. Katharinen 1999), 121–124.
92 Finsterwalder (Anm. 90), 1, Kartenbeilage (1976 A), G5.
93 Freundliche Auskunft von Herrn Dr. Christian Kollmann.
94 Steinbauer (Anm. 91), 324. 95 Kollmann (Anm. 87), Gemeinden, Kortsch (Ort/
Kortsch), Etymologie. 96 Kollmann (Anm. 87), Gemeinden, Schlanders
(Ort/Schlanders), Etymologie. 97 Kollmann (Anm. 87), Gemeinden, Latsch (Ort/
Latsch), Etymologie. 98 K. Finsterwalder, Tiroler Ortsnamen Kunde
Band 1. Schlern-Schriften 286 (Innsbruck 1990), Kartenbeilage (1976 A), G5.
11H
eft DER SCHLERN 31
Archäologie
99 Finsterwalder (Anm. 90) 1, Kartenbeilage (1976 A), G5.
100 P. Anreiter/C. Chapman/G. Rampl, Die Gemein-denamen Tirols. Veröff. des Tiroler Landesar-chivs 17 (Innsbruck 2009), 63.
101 Anreiter/Chapman/Rampl (Anm. 100), 63. 102 Freundliche Auskunft von Dr. Johannes Ortner,
Landesarchiv der Provinz Bozen. 103 Anreiter/Chapman/Rampl (Anm. 100), 69–70. 104 Anreiter/Chapman/Rampl (Anm. 100), 33–85. 105 G. Tomedi, Der mittelbronzezeitliche Schatz-
fund vom Piller und seine überregionalen Bezü-ge. In: R. Loose (Hrsg.) Von der Via Claudia Au-gusta zum Oberen Weg. Schlern-Schriften 334 (Innsbruck 2005), 40, Abb. 6.
106 R. Loose, Siedlungsgenetische Studien im Vinschgau. In: R. Loose (Hrsg.) Der Vinschgau und seine Nachbarräume (Bozen 1993), 237.
107 K. Finsterwalder, Der Name Kurzras in ge-schichtlich-sprachlichem Zusammenhang. Der Schlern 23, 1949, 461/462.
108 F. Huter, Der Name Kurzras. Schlern-Schriften 57, 1924, 83/84.
109 G. Kaufmann, Welfen in Venusta Valle et in Lan-gobardia. In: J. Riedmann/R. Schober (Hrsg.) Tiroler Heimat 72 (Innsbruck 2008), 23/24.
110 Kaufmann (Anm. 109), 31. 111 Kaufmann (Anm. 109), 26. 112 F. Huter, Die Herren von Montalban. Zeitschrift
für bayerische Landesgeschichte 11, 1938, 342. 113 Huter (Anm. 112), 352. 114 Tiroler Urkundenbuch III, Innsbruck 1937,
Nr. 1095. 115 O. Stolz, Politisch historische Landesbeschrei-
bung von Südtirol. Schlern-Schriften 40, (Inns-bruck 1937/39), 111.
116 M. Magny/C. Maise/S. Jacomet/C. A. Burga, Klimaschwankungen im Verlauf der Bronzezeit. In: S. Hochuli/U. Niffeler/V. Rychner (Hrsg.) Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mit-telalter. Bronzezeit. JSGUF III (Basel 1998), 138.
117 Kopialbuch des Klosters Allerengelberg, liber secundus, Blatt 101, zitiert nach Werner (Anm. 64), 246/247.
118 Unterniederhof im Schnalstal, zitiert nach Wer-ner (Anm. 64), 271–273.
119 Werner (Anm. 64), 71. 120 Werner (Anm. 64), 71, Anm. 165. 121 R. Loose, Siedlungsgenese des oberen Vintsch-
gaus. Forsch. zur deut. Landeskunde 208, 1976, 160/161, Tab. 119.
122 F. Huter, Schnals und Innerötztal. Zeitschrift des deutschen Alpenvereins (München 1951), 28.
123 „gemain und nachperschafft deß Thalß Snalß von s. Gertruden tag in der vasten an unnz s. Görgen tag darnach“, Landesregierungsar-chiv Innsbruck, Handschrift Nr. 645, Blatt 761 bis 764, Abschrift aus der Mitte des 17. Jahr-hunderts (Orginal von 1581), zitiert nach Werner (Anm. 71), 274–279.
124 M. Schmitzberger, Archäozoologische Untersu-chungen an den Bronze-, Eisen- und römerzeitli-chen Tierknochen vom Ganglegg und vom Tart-scher Bichl. In: H. Steiner (Hrsg.) Die befestigte Siedlung am Ganglegg im Vinschgau –Forsch. zur Denkmalpflege in Südtirol 3 ( Trient 2007), 619–643.
125 Tecchiati (Anm. 47), 285–323. 126 Schmitzberger (Anm. 125), 625, Tab. 2. 127 Schmitzberger (Anm. 125), 639, Tab. 14.
128 L. Salvagno/U. Tecchiati, I resti faunisticfi del villaggio dell’età del Bronzo di Sotćiastel-Economia e vita di una comunità protostorica alpina. Ladinia monografica 03, 2011, 53, Fig. 14.
129 Schmitzberger (Anm. 125), 632. 130 Loose (Anm. 122), 208. 131 Loose (Anm. 122), 210, Tab. 22. 132 P. Bogucki, Foreest farmers and stockherders.
Early agriculture and its consequences in north-central Europe. New Studies in Archeology (Cambridge 1988), 87.
133 R. Ebersbach, Von Bauern und Rinder. Basler Beiträge zur Archäologie 15, 2002, 179–193.
134 Ebersbach (Anm. 77), 184. 135 Ebersbach (Anm. 77), 185. 136 Schmitzberger (Anm. 118), 620, Tab. 1. 137 Lavagno/Tecchiati (Anm. 128), 51, Fig. 13b. 138 Steiner (Anm. 14), 153. 139 Schmitzberger (Anm. 125), 650, Tab. 27. 140 Steiner (Anm. 14), 246. 141 Tecchiati (Anm. 47), 386. 142 Ebersbach (Anm. 77), 173. 143 AMbg (Archiv des Benediktinerstiftes Marien-
berg ob Burgeis/Vinschgau) 44,1, zitiert nach Loose (Anm. 124), 211, Anm. 407.
144 Loose (Anm. 122), 209. 145 Steiner (Anm. 14), 320–322. 146 Loose (Anm. 122), 210, Tab. 22. 147 J. E. Reider, Die landwirtschaftlichen Verhältnis-
se berechnet für das Königreich Baiern. (Hers-bruck 1819), zitiert nach Ebersbach 2002, 155.
148 Ebersbach (Anm. 77), 165. 149 Loose (Anm. 122), 210, Tab. 22. 150 A. Riedel, La fauna dell‘insediamento proto-
storico di Vadena. In: Umberto Tecchiati (Hrsg.) XC pubblicazione del Museo Civico di Rovereto, 2002, 63, Tab. 1.
151 Schmitzberger (Anm. 118), 683. 152 C. Gamble/R. Clark, The faunal remains from
Fiavè: pastoralism, nutrition and butchery. In: R. Perini (Hg.) Scavi archeologici nella zona palafitticola di Fiavè-Carrera, Parte II. Patr. Storico Art. del Trent. 9, 1987, 440/441.
153 F. Marzatico, La frequentazione dell’ambiente montano nel territorio atesino fra l’età del Bron-zo e del Ferro: alcune considerazioni sulla pas-torizia transumante e “l’economia di malga”. Preistoria Alpina 42, 2007, 173, Fig. 7.
154 N. Grass, Die Almwirtschaft in der Urzeit und im Mittelalter. In: H. Beck/D. Denecke/H. Jankuhn (Hg.), Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung, Sonderdruck der Akademie der Wiss. in Göttingen, Teil II (Göttingen 1980), 273.
155 M. Mahlknecht, Der Brandopferplatz am Gru-bensee (Vintschgau-Südtirol). Prähistorische Weidewirtschaft in einem Hochtal. In: F. Mandl (Hg.) Alpen. Archäologie-Geschichte-Gletscher-forschung. Festschrift: 25 Jahre Anisa (Haus i. E. 2005), 110–112.
156 Schmitzberger (Anm. 125), 625, Tab. 2. 157 Schmitzberger (Anm. 125), 629, Diagr. 1; Tab. 6. 158 M.-L. Boscardin/M. Gschwend/J. Hösli/S. Meier/
W. Meyer-Hofmann, Bergeten ob Braunwald – ein archäologischer Beitrag zur Geschichte des alpinen Hirtentums. Basel 1973, 21.
159 Landesregierungsarchiv Innsbruck, Prozeßak-ten II, Nr. 191, zitiert nach Werner (Anm. 64), 268–271.