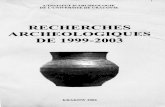Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal Südtirol/Vinschgau
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal Südtirol/Vinschgau
Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal, Südtirol/Vinschgau
Andreas Putzer
Abstract
A Prehistoric Alpine Cabin On Schwarzboden In Maneidtal, South Tyrol/Vinschgau. The area examined in the project “The Neolithic Agricultural Regime in the Inner Alps” is one of the major valleys in the South Tyrol (Italy) called the Vinschgau. The goal of the project is to date the chronological beginning of the transhumance pastoralism in the Inner Alps through archaeobotanical studies and archeological excavations. For this purpose we started the project in Schlandrauntal, a small valley that stretches from Vinschgau into the Ötztaler Alps. At the altitude of 2.150 m it was possible to excavate structures used for pastoralism, maybe for a pasture. In the excavated area three different structures have been found, all of them were in use during the Iron Age. The oldest one belongs in the Early Iron Age (8th century BC); it was possible to find postholes and two cavities laid out with stones. The second phase persists in the remains of a wall and a brash floor. Findings from this archeological level date in the 5th century BC. The last phase is obviously the best preserved. It was possible to excavate a part of a rectangular house whose walls have been build of slabs. The house had more than one room and so we think that the building could have been used for pasture activities, for which a room for stocking milk products is needed. The building was in use during the 2th century BC. In the Schlan draun Valley it was not possible to find verification for pastoralism older than the Iron Age. The Project will go on for another two years. The research is not limited to this part of Vinschgau, and we will also do surveys in Schnals Valley, where the iceman was found.
Keywords: prehistory, Iron age, La Tène culture, Italy, South Tyrol, transhumance.
Zusammenfassung
Das für das Projekt „The Neolithic Agricultural Regime in the Inner Alps“ untersuchte Gebiet ist der Vinschgau, eines der größten Täler in Südtirol (Italien). Projektziel ist die Datierung des Beginns der viehwirtschaftlichen Transhumanz im Alpenraum durch archäobotanische Studien und archäologische Ausgrabungen. Aus diesem Grund starteten wir das Projekt im Schlandrauntal, ein kleines Tal, das sich von Vinschgau bis in die Ötztaler Alpen erstreckt. Auf 2.150m Höhe war es möglich Strukturen, die im Zusammenhang mit Viehwirtschaft stehen, auszugraben. In dem Ausgrabungsareal wurden drei verschiedene Strukturen gefunden, alle davon waren während der Eisenzeit in Gebrauch. Die älteste Phase datiert in die frühe Eisenzeit (8. Jh. v. Chr.). Es war möglich, Pfostenlöcher und zwei mit Steinen ausgelegte Hohlräume zu finden. Die zweite Phase blieb mit Überresten einer Wand und einer Schotterschüttung erhalten. Funde aus dieser archäologischen Schicht datieren auf das 5. Jh. v. Chr. Die letzte Phase ist am besten erhalten. Es war möglich einen Teil eines rechteckigen Hauses, dessen Wände aus Steinplatten hergestellt waren, auszugraben. Das Haus hatte mehr als einen Raum. Daher nehmen wir an, dass das Gebäude im Rahmen der Viehwirtschaft genutzt wurde, da dafür ein weiterer Raum für die Lagerung von Milchprodukten benötigt wird. Das Gebäude wurde im Laufe des 2. Jh. v. Chr. verwendet. Im Schlandrauntal war es nicht möglich Viehwirtschaft zu verifizieren, die älter als eisenzeitlich datiert. Das Projekt wird noch zwei Jahre fortgeführt. Die Untersuchungen sind nicht auf diesen Teil des Vinschgaus beschränkt, wird werden auch Begehungen in Schnalstal machen, wo der „Mann im Eis“, gefunden wurde.
Schlüsselwörter: Urgeschichte, Eisenzeit, Latène, Italien, Südtirol, Almwirtschaft.
33ARCHAEOLOGIA AUSTRIACA, Band 93/2009, 33–43 © 2011 by Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Andreas Putzer34
1. Topografie und FundgeschichteDer Fundort liegt im Vinschgau, einem Seitental Südtirols,
das von Meran (Abb. 1) bis an die österreichische Grenze am Reschen reicht. Die Nordseite prägt der Vinschger Sonnenberg, der sich durch seine Trockenheit und steppenartige Vegetation auszeichnet. Der Schwarzboden ist eine ausgedehnte
Hochfläche im Maneidtal (Abb. 2), ein Seitental des Schlandrauntales, das von Schlanders im Mittelvinschgau Richtung Alpenhauptkamm verläuft. Der Boden liegt auf einer Meereshöhe von ca. 2.100 m, ist großteils unbewaldet und wird von einem Hochmoor geprägt, dessen schwarze Erde vermutlich namengebend war.
Das gesamte Maneidtal wird heute noch im Hochsommer als Weidegebiet für den Viehbestand der Schlanderser Bauern genutzt. Forschungsgeschichtlich stellt das Tal kein Neuland dar. Zahlreiche Begehungen und eine archäologische Ausgrabung wurden in den vergangenen Jahren von Markus Mahlknecht durchgeführt, der jahrelang als Hirte im Maneidtal tätig war.1
Die Grabungen fanden in den Jahren 2002 bis 2004 am Grubensee auf über 2.400 müA statt. Dabei konnte ein Brandopferplatz erforscht werden, der von der Endbronzezeit (13.–11. Jh. v. Chr.) bis in die mittlere römische Kaiserzeit (1.–Mitte 3. Jh. n. Chr.) reicht.2 Das Aufsuchen genau dieses Tales wurde von M. Mahlknecht mit der Weidewirtschaft begründet.3 2003 fanden im Rahmen der Ausgrabungen am Grubensee auch einige Sondagen auf dem Schwarzboden statt. Entlang des heutigen Fahrweges trat nach ergiebigem Niederschlag eine Kulturschicht zutage, aus der Keramik und Holzkohle geborgen wurden. Eine Radiokarbonuntersuchung datiert die Kulturschicht ins 7.–5. Jh. v. Chr. Eine weitere Sondage erfolgte unweit des Fahrweges am westlichen Ausläufer des Schwarzbodens, wo auf einer
1 Mahlknecht 2005, 4–21. 2 Mahlknecht 2006, 92–121.
Abb. 2. Lage des Schwarzbodens und Maneidtals.
Abb. 1. Lage des Fundortes im Vinschgau.
Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal, Südtirol/Vinschgau 35
Anhöhe ein Mauerzug sichtbar war. Die Sondierung des Areals war auf wenige Quadratmeter begrenzt und ergab eine kreisförmige Struktur mit einem lehmigen Gehhorizont, der eisenzeitliche Keramik4 enthielt. Unterhalb des Gehhorizontes fand sich eine Planierung aus Schotter, die ebenfalls Keramik und Holzkohle enthielt, die Datierung einer Holzkohlenprobe ergab ein Datum von 540–390 v. Chr.5
2. Die Grabungen im Jahre 2009Im Sommer 2009 fand eine Nachuntersu
chung auf dem Schwarzboden statt. Die Grabung wurde im Rahmen des Projektes „The Neolithic Agricultural Regime in the Inner Alps“6 durchgeführt. Ziel dieses Forschungsprojektes ist die zeitliche Eingrenzung der Anfänge der Transhumanz im Alpenraum. Anhand von Torfbohrungen an mehreren Hochmooren im Gebiet zwischen Schlandraun bzw. Schnalstal – entlang der dort vermuteten Transhumanzroute – soll versucht werden, den Beginn der Transhumanz im inneralpinen Raum zeitlich festzumachen. Archäologische Untersuchungen sollen eventuelle prähistorische Strukturen und deren Nutzung klären.
2.1 Die GrabungsbefundeUm die Arbeit des Hirten nicht zu stören, wurden zwei
Grabungskampagnen durchgeführt. Die Erste für zwei Wochen im Juni, bevor das Vieh auf die Hochalm ins Maneidtal getrieben wurde und eine Woche im September, nachdem es wieder auf die niedriger gelegene Schlanderser Alm abgetrieben wurde. Die Wahl des Standortes auf dem Schwarzboden (Abb. 3) kommt nicht von ungefähr. Das Gebäude wurde am bestmöglichen Platz errichtet. Einerseits schützt eine im Süden gelegene Kuppe das Gebäude vor Wind, zudem ist es der einzige lawinensichere Hang auf dem Schwarzboden. Der 2004 angelegte Suchschnitt wurde in alle Richtung erweitert, insgesamt konnte eine Fläche von 34 m² untersucht werden.
Phase IDie teilweise im Jahre 2004 untersuchte Nordmauer
(Abb. 4) bestand aus zwei Lagen großer Steinplatten, die zum Teil ins Innere des Gebäudes verstürzt waren. Im Westen konnte der Abschluss der Nordmauer erreicht werden, wo im
rechten Winkel die Westmauer ansetzte, die eine Länge von 4 m hatte. Die Südmauer war ebenfalls zweilagig und verlief parallel 8 m in Richtung Grabungsgrenze aus. Im Osten konnte kein Abschluss der beiden Mauern freigelegt werden, da es zeitlich nicht möglich war, den Schnitt zu erweitern. Die Mauern dürften eine Länge von 10 m besessen haben. Das Gebäude konnte auch in seiner Breite nicht vollständig erfasst werden. Im nördlichsten Suchschnitt fand sich ebenfalls der Gehhorizont (US 3) des Hauses. Die Struktur ergab somit einen rechteckigen Grundriss von 8 m x 4 m, wobei in der Länge sowie in der Breite mit weiteren 2 m zu rechnen sein wird. Das Haus bestand aus zwei Räumen – auch wenn die Außenmauern nicht alle ergraben werden konnten –, dessen Wohnfläche ca. 70 m² betrug und nicht nur für das Hochgebirge als groß zu werten ist. Der zum Haus gehörende Gehhorizont bestand aus einer lehmiggrauen Schicht (US 3), die sich nur teilweise erhalten hat. Er baut auf einer rotsandigen Schicht (US 4) auf. Die gefundenen Keramikfragmente gehören zu einem bauchigen Topf (Taf. 1/3) und zu einer Krugform mit plastischen Warzen. Beide Gefäßformen finden Vergleiche im mittellatènezeitlichen Haus am Tartscher Bichl.7 Zeitgleich ist der Fund einer Krebsschwanzfibel mit sechsschleifiger Spirale (Taf. 1/4) vom Typ XXV a2 nach AnneMarie Adam8 oder Typ Nomèsino nach Amei Lang9. Es handelt
3 Mahlknecht 2006, 117.4 Mahlknecht 2006, 114.5 Mahlknecht 2006, 114.6 FWFProjekt Nr. 211129G19 der Universität Innsbruck, Institut
für Botanik, unter der Leitung von ao. Univ.Prof. Dr. Mag. Klaus Oeggl. Das Projekt wird vom FWF – Fonds zur wissenschaftlichen Forschung in Österreich –finanziell getragen, dafür sei herzlich gedankt. Danksagungen gelten Dr. Hubert Steiner vom Amt für
Bodendenkmäler Bozen, der das Projekt wissenschaftlich betreut, sowie der Alminteressenschaft von Schlanders, im besonderen Leo Nolet und dem Hirten „Herbert“, die die Almhütte als Unterkunft zur Verfügung stellten.
7 Gamper 2002, Tafel 12/7; Tafel 13/29.8 Adam 1996, 194–215.9 Lang 1979, 7578.
Abb. 3. Schwarzboden im Maneidtal, Fundstelle. (Foto: A. Putzer)
Andreas Putzer36
sich bei den Krebsschwanzfibeln um eine sehr langlebige Fibelform, die vor allem in TrentinoSüdtirol, der Lombardei und im Tessin verbreitet war und als Bestandteil der Frauentracht gilt. Die Fibelform datiert von der ausgehenden Frühlatènezeit bis in die frühe Kaiserzeit. Für die latènezeitlichen Exemplare ist für die Datierung die Anzahl der Spiralwindungen ausschlaggebend.10 Vergleiche zu unserer Fibel finden sich in Castel Selva bei Levico,11 dessen Fibelspektrum nach A. Lang12 eindeutig der Stufe Lt C zuzuordnen ist. Nach A.M. Adam13 ist eine zeitliche Eingrenzung nach Lt C1 (ca. 250–180 v. Chr.) möglich. Paul Gleirscher14 beschränkt die Verbreitung der Krebsschwanzfibel mit sechs Schleifen auf das Trentino und die Gräber aus Introbio in der Lombardei. Die Neufunde vom Maneidtal, von der Siedlung am Ganglegg15
und der Altfund vom Col de Flam in Gröden16 bezeugen eine Verbreitung dieses Fibeltyps auch für Südtirol.
Phase II
Unter dem mittellatènezeitlichen Haus befand sich eine Planierung aus Schotter, die stark mit Holzkohle durchsetzt war. Im Westen betrug die Stärke der Schicht nur wenige Zentimeter, im Osten erreichte sie 80 cm und glich somit die natürliche Hangneigung des anstehenden Geländes aus. Im Westen des Schnittes konnten die Reste einer Mauer (Abb. 5) aus Steinplatten freigelegt werden. Die Ausrichtung des Gebäudes war NordSüd. Vom Gehhorizont stammen Keramikfunde (Taf. 1/6–10), die der Latènezeit zugeordnet werden können. Eine Radiokarbondatierung aus dem Jahre 2004
10 Lunz 1987, 29 mit Anm. 125.11 Lang 1979, Abb. 9/8.12 Lang 1979, 83.13 Adam 1996, 198.
14 Gleirscher, Nothdurfter, Schubert 2002, 53.15 Gamper 2006, 154, Abb. 82/15. Die Fibel vom Ganglegg stammt
aus einem spätlatènezeitlichen Kontext.16 PrinothFornwagner 1993, 102, Tav. 1/19.
Abb. 4. Schwarzboden im Maneidtal, Hausmauer der mittellatènezeitlichen Almhütte. 2 Fadenkreuze entsprechen 1 m. (Umzeichnung A. Putzer)
Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal, Südtirol/Vinschgau 37
ergab ein Datum von 540–390 v. Chr.,17 in das sich das Randstück einer sförmig profilierten Schale (Taf. 1/6) recht gut einfügt.
Phase III
Unterhalb der Schotterplanierung fanden sich drei Pfostenlöcher (Abb. 6), die zu einer weiteren Vorgängerstruktur gehören und mit Unterlagsplatten für die Steher versehen waren. Pfostenloch 2 hatte zudem eine senkrecht eingelassene Platte zum Fixieren der Holzkonstruktion. Der Durchmesser der Pfostenlöcher betrug 30–40 cm. Weiters fanden sich zwei Gruben, die mit Steinplatten ausgelegt waren. Sie enthielten keine Funde und waren mit demselben Schotter verfüllt, der auch die Pfostenlöcher abdeckte. Die Interpretation dieser Gruben
muss offenbleiben. Als Herdstellen scheinen sie nicht genutzt worden zu sein, da keine Knochen gefunden wurden. Der einzige Fund aus diesem Bereich ist die Wandscherbe eines doppelkonischen Topfes mit gegenständig angebrachten Strichbündeln (Taf. 1/9), die auf einer horizontal verlaufenden Rille aufliegen. Der Dekor findet sich im Gräberfeld von Pfatten an einem Beigefäß aus Grab 14918 und an einer doppelkonischen Urne19, die von Marzatico aufgrund der Form und des Dekors ins 9.–8. Jh. v. Chr. datiert wird.20 Eine aus diesem Bereich gezogene Holzkohle datiert zwischen 910–760 v. Chr. (kal.).
2.2 Diskussion und Interpretation der Befunde
Es handelt sich für den Südtiroler Raum um einen einzigartigen Befund, da erstmals mehrere Siedlungsphasen im
17 Mahlknecht 2006, 114. 18 Lunz 1991, 97, Tafel XV/12.
19 Marzatico 1997, 781, Fig. 325.20 Marzatico 1997, 791.
Abb. 5. Schwarzboden im Maneidtal, Mauerreste der frühlatènezeitlichen Hütte. 2 Fadenkreuze entsprechen 1 m. (Umzeichnung: A. Putzer)
Andreas Putzer38
Hochgebirge nachgewiesen werden konnten. Ansatzweise war dies bereits Reimo Lunz auf der Raschötz21 gelungen, allerdings hat sich dort nur die Kulturschicht des Hauses erhalten. Auf der Ulfaser Alm22 in der Gemeinde Moos im Passeier konnte ebenfalls nur der planierte Untergrund einer Struktur ergraben werden, die von der Endbronzezeit bis in die frühe Eisenzeit genutzt wurde. Vergleiche zu dem Befund auf dem Schwarzboden – wenn auch aus anderen Zeitstufen – finden sich vermehrt außerhalb Südtirols. Im Fimbertal (Unterengadin)23 wurde 2008 das rechteckige Fundament einer Hütte aus der Hallstattzeit teilweise untersucht. Weiters fand man am Königreich (Tiefkar) einen Hüttengrundriss aus der frühen Urnenfelderzeit,24 der ebenfalls einen rechteckigen Grundriss aufweist, allerdings einen zusätzlichen Vorbau mit Feuerstellen besitzt.
Das mittellatènezeitliche Gebäude bestand mit Sicherheit aus zwei, vielleicht aber auch aus mehr Räumen. Das Fehlen einer Herdstelle – im ergrabenen Sektor konnte keine entdeckt werden – lässt vermuten, dass der Wohnraum im nur teilweise ergrabenen Bereich im Norden lag. Die beiden Bronzefunde25 stammen ebenfalls aus diesem Bereich und man wird annehmen dürfen, dass ein Fibelfund auf einen Wohnraum hinweist. Der im Süden liegende Raum könnte als Stallung oder zur Weiterverarbeitung und Lagerung von Milchprodukten genutzt worden sein. Die beiden Vorgängerstrukturen lassen sich nicht eindeutig rekonstruieren. Vom frühlatènezeitlichen Haus lässt sich nur sagen, dass es vermutlich anders ausgerichtet war. Die Lage der Pfostenlöcher erlaubt leider keinen genauen Rekonstruktionsversuch.
21 Lunz 1987,152–158.22 Niederwanger, Oberrauch 2007, 317–319.23 Reitmeier 2009, 171–172.
24 Tiefengraber 2007, 97–109.25 2004 konnte eine Nähnadel aus Bronze geborgen werden.
Abb. 6. Pfostenlöcher der früheisenzeitlichen Struktur. 2 Fadenkreuze entsprechen 1 m. (Umzeichnung: A. Putzer)
Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal, Südtirol/Vinschgau 39
Tafel 1. Schwarzboden im Maneidtal, Funde. Keramik: 1–3, und 5–10 – Bronze: 4. M 1:2
Andreas Putzer40
3. Die Nutzung des Hochgebirges am Beispiel des Maneidtals
Es ist den intensiven Begehungen M. Mahlknechts zu verdanken, erstmals für Südtirol eine so hohe Anzahl an Fundplätzen26 in einem Hochgebirgstal vom Mesolithikum bis in die heutige Zeit nachgewiesen zu haben. Die Beweggründe im Mesolithikum, das Hochgebirge aufzusuchen, sind ausschließlich in der Jagd zu suchen. Komplexer werden die Ursachen in den späteren Zeitstufen. Im Falle des Maneidtals ist mit einem regelmäßigen Begehen ab der Endbronzezeit zu rechnen, wie dies der Beginn des Brandopferplatzes zeigt. Das Aufsuchen des Hochgebirges intensiviert sich zu einer Zeit (15.–12. Jh. v. Chr.), in der es zu einer Klimaverschlechterung und einem Vorstoß der Gletscher kommt. Was die Menschen dazu bewegt, genau in dieser Zeit das Hochgebirge vermehrt aufzusuchen, ist unklar. Das Absinken der Baumgrenze um 100–200 m hat zu einer Erweiterung von natürlich vorhandenen Grasflächen geführt, die eine Erschließung mittels Brandrodung im Hochgebirge somit überflüssig macht. Auch hat sich die vermehrte Niederschlagmenge positiv auf das Wachstum hochalpiner Weiden ausgewirkt. Ob die Erschließung des Maneidtals ausschließlich zur Nutzung als Weide und Almgebiet oder aufgrund anderer wirtschaftlicher Faktoren beruht, soll hier diskutiert werden.
Der Abbau von Metallvorkommen im Maneid bzw. Schlandrauntal ist auszuschließen. In geringen Mengen trifft man auf Fahlerze, am Taschljöchl kommt Eisenkarbonat vor, allerdings sind nirgendwo Spuren eines Abbaus nachzuweisen.27 Etwaige Indizien auf Metallverarbeitung hätten wohl auch die Kleinfunde (z. B. Schlacken) des Brandopferplatzes ergeben.
Archäologisch kann die Nutzung des Gebietes als Weidefläche ab dem 9. Jh. v. Chr. durch die Radiokarbondatierung eines Viehpferches auf dem Schartl28 nachgewiesen werden und zeugt von einer saisonalen Beweidung ab der frühen Eisenzeit. Von Almwirtschaft, die das Vorhandensein einer Struktur mit Stallung und/oder Vorratsräumen für die Weiterverarbeitung der Milch und deren Lagerung voraussetzt, kann erst ab der Mittellatènezeit ausgegangen werden, wie dies die Ausgrabungen der Almhütte auf dem Schwarzboden gezeigt haben. Endbronzezeitliche Strukturen für Hirten wie für das Vieh fehlen. Auch ein Nachweis für Almwirtschaft über die Kleinfunde der beiden Grabungen scheint schwierig. Durchlochte Wandscherben29 gelten häufig in der Fachliteratur als
Indiz für die Käseherstellung. Möglich ist aber auch die Verwendung als Räuchergefäß oder „Flammensturz“30 zum Aufbewahren von Glut. Vergleiche finden sich in Südtirol in der Siedlung EppanGamberoni31 oder auf dem Brandopferplatz auf dem Wallnereck32. Das Vorkommen dieser Gefäßform in Siedlungs wie Kultkomplexen macht eine eindeutige Interpretation ungleich schwieriger. Gegen die Verwendung als Gefäß für die Käseherstellung spricht die Tatsache, dass ein keramisches Gefäß dafür zu fragil wäre. Bei der Käseherstellung wird die geronnene Milch, nachdem sie in die Form gepackt wird, zusätzlich beschwert und gepresst, damit die Restmolke so schnell wie möglich abläuft. Ein keramisches Gefäß würde sich dazu nicht eignen, man wird für die Urgeschichte eher mit Formen aus organischem Material rechnen müssen. Römische Geschichtsquellen33 berichten über die Verwendung von Körben oder Holzformen für die Herstellung von Ziegenkäse. Bestätigung findet diese Hypothese durch Untersuchungen an 22 Siebgefäßen der Rössener Kultur aus der Siedlung Aldenhovener Platte.34 In keinem Keramikfragment konnten Butterfette nachgewiesen werden. Die in den Siebgefäßen enthaltenen Fettreste stammten von Haselnuss, Mohn, Eicheln oder Bucheckern.
Allgemein wird es schwer sein, anhand von Kleinfunden eindeutige Hinweise auf eine Weide bzw. Almwirtschaft zu finden. Glockenfunde für Leittiere, wie sie vom Pillersattel35 aus der Römerzeit bekannt sind, würde man sich als Votivgabe an einem Opferplatz, der dem Hirtenwesen bzw. Weidewirtschaft gewidmet ist, erwarten. Ein solcher Fund fehlt im römerzeitlichen Fundspektrum des Brandopferplatzes am Grubensee.
Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung des Maneidtals bzw. Schlandrauntales als Transitroute in Richtung Schnalstal und weiter ins Ötztal. Diese Route wird heute noch von den Laaser Bauern im Frühsommer begangen, um ihre Schafe auf die entlegenen Hochweiden des Ötztals zu bringen.36 M. Mahlknecht vermutet den Zugang ins Schlandrauntal über die Hänge des Sonnenberges bis nach Talatsch und von dort direkt ins Schlandrauntal.37 Wohl aber könnte der Zugang über das Kortscher Jöchl38 ins Maneidtal erfolgt sein und somit die zahlreichen Strukturen am Übergang erklären. Eine der Anlagen konnte mithilfe eines kalibrierten 14CWertes in die Frühlatènezeit (550–390 v. Chr.)39 datiert werden und entspricht somit einer der Nutzungsphasen des Brandopferplatzes und der Strukturen auf dem Schwarzboden. Der Zugang wäre
26 Mahlknecht 2007, 48–61.27 Nach freundlicher Auskunft von Dr. Benno Baumgarten.28 Mahlknecht 2006, 116, Abb. 19. 29 Mahlknecht 2006, 106, Taf. 6/15.30 Willvonseder 1932, 220.31 Leitner 1988, 27, Abb. 32/6.32 Unpubl. Grabung des Verfassers aus dem Jahre 2008.33 Flach 1990, 311.
34 Ebersbach 2002, 37.35 Tschurtschenthaler, Wein 2002, 660, Abb. 11/1,5.36 Bodini 1999, 133138. 37 Der heutige Weg führt dort entlang eines Waales ins Schlandraun
tal.38 Mahlknecht 2006, 115. 39 Mahlknecht 2007, 53.
Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal, Südtirol/Vinschgau 41
über diesen Wegverlauf ungefährlicher, da das Schlandrauntal heute noch stark lawinen und erdrutschgefährdet ist. Auch war ein Passieren der Talsohle des Schlandrauntals, aufgrund des Wasserlaufes, zur damaligen Zeit vermutlich nicht möglich. Bezeugt wird die Bedeutung prähistorischer Verkehrswege häufig durch die Niederlegung wertvoller Gegenstände. Höhen und Passfunde sind im inneralpinen Gebiet keine Seltenheit und seit der Jungsteinzeit bezeugt. Die Beweggründe der Niederlegung stehen vermutlich in Zusammenhang mit einem Bittgang für eine erfolgreiche Reise. Bestens in dieses Bild fügt sich der Depotfund von Talatsch40 auf 1.700 m aus dem 8.–7. Jh. v. Chr. Auch der Brandopferplatz vom Grubensee könnte in diesem Zusammenhang gesehen werden. Ein Brandopferplatz in der näheren Umgebung von Passübergängen oder Altwegen ist am Pillersattel41 bekannt, wo ab dem 14. Jh. v. Chr. bis ins 3.–4. Jh. n. Chr. die Darbringung von Opfergaben nachgewiesen ist und ein Zusammenhang mit der über die Pillerhöhe verlaufenden Wegtrasse besteht. Kleinfunde am Brandopferplatz und auf dem Schwarzboden, die eine überregionale Nutzung des Opferplatzes oder den Transit durch das Maneidtal bezeugen würden, fehlen. Einzige Ausnahme ist ein bemaltes Wandstück wohl keltischer Keramik,42 das aber auch von der lokalen Bevölkerung am Ganglegg stammen könnte, wo die Herstellung drehscheibengefertigter Ware43 aus lokalem Ton nachgewiesen wurde. Der Kleinfund bezeugt jedenfalls, dass der Brandopferplatz und das Weidegebiet nicht nur von den Einwohnern der nahegelegenen Siedlungen in Kortsch oder Schlanders,44 sondern auch von Einwohnern anderer Talschaften genutzt wurde. Gleichzeitig muss man sich die Frage stellen, wie groß das Einzugsgebiet einer prähistorischen Alm war. Wird ein Weide bzw. Almgebiet nur von einer Dorfgemeinschaft oder von mehreren gemeinsam genutzt?
4. Forschungsstand und Ausblick
Im Maneidtal gibt es keine Beweise dafür, dass bereits in der Jungsteinzeit oder Kupferzeit eine vertikale wie horizontale Transhumanz stattgefunden hat. Mit Ausnahme von Pollenprofilen aus dem Ötztal45 und Zillertal46, wo anscheinend eine Beweidung in der Jungsteinzeit stattfand, fehlen weitere Indizien für eine Migration der Haustierherden ins Hochgebirge. Auch für Südosteuropa fehlen bis heute Beweise für eine saisonale Weidewirtschaft.47 Im Alpenraum hat eine horizontale
Transhumanz wenig Sinn, da eine Migration in eine der vielen nahegelegenen Hochalmen günstiger erscheint. Eine saisonal bezogene Weidewirtschaft bedeutet für die Dorfgemeinschaft den Entzug eines wichtigen Wirtschaftszweiges, wie die Fleisch und Milchproduktion, zudem ein erhebliches Risiko durch Unfälle einen Teil der Herde zu verlieren. Ob die Herden der Jungstein bzw. Kupferzeit im inneralpinen Raum so groß waren, um auf einen wichtigen Wirtschaftszweig oder sogar einen Ausfall zu verkraften, bleibt fraglich. Zudem wird man annehmen dürfen, dass Rinder nicht ins Hochgebirge geführt wurden, sondern Schaf und Ziege wie dies auch das Knochenmaterial vom Brandopferplatz am Grubensee48 verdeutlicht.
Archäologisch findet in der Jungsteinzeit ein Rückgang an Höhenfunden im Alpenraum49 statt, erst in der Kupferzeit steigt die Anzahl der Höhenfunde wieder an. Der Mensch sucht dieselben Fundplätze auf, die bereits im Mesolithikum als Jagdstationen genutzt wurden.50 Das Fundspektrum beschränkt sich fast ausschließlich auf Pfeilspitzen.51 Die Jagd scheint wieder an Bedeutung zu gewinnen, wie dies auch das Ansteigen an Knochen von Wildtieren im kupferzeitlichen Siedlungshorizont von Isera la Torretta aufzeigt.52 Die vermehrte Migration ins Hochgebirge während der Kupferzeit scheint weniger mit der Transhumanz oder Weidewirtschaft in Zusammenhang zu stehen, sondern mit der Notwendigkeit Fleisch von Wildtieren zu erbeuten. Archäozoologische Untersuchungen in Arbon Bleiche 3 ergaben einen Rückgang der Knochen von Rind, Schaf und Ziege und eine Zunahme von Schwein und Wildtieren.53 Ursache scheint eine Klimaverschlechterung54 gewesen zu sein, die zu einer Kompensation rückgängiger Ernteerträge durch erhöhten Fleischkonsum führte. In diesen prähistorischen Zeitabschnitt fällt auch die intensivere Nutzung der Sekundärprodukte aus der Haustierhaltung, wie die Nutzung des Rindes als Zugtier, die durch Überlastungsanzeiger wie verbreiterte Phalangen oder abgeflachte Hornzapfen bezeugt ist.55 Auch die Erzeugung von Milchprodukten, wie Joghurt, Käse und Butter, konnte anhand von Fettanalysen aus Keramikbehältern in Arbon Bleiche 356 nachgewiesen werden. Fehlende Dungreste aus der Siedlung deuten auf eine Migration der Haustiere während der Sommermonate.57 Wie intensiv und wohin dieser Weideplatzwechsel geführt hat, konnte leider nicht überzeugend dargelegt werden. Die Verfasser deuten ihre Ergebnisse jedenfalls als Beleg für eine saisonale Transhumanz.
40 Lunz 1987, 185–191.41 Tschurtschenthaler, Wein 2002, 635–637. 42 Mahlknecht 2006, 106, Taf. 6/10. 43 Gamper 2006, 241.44 Bassetti Carlini, Dal Rì, Tecchiati 1995, 88–118.45 Bortenschlager 2000, 11–24. 46 Haas, Walde, Wild 2008, 191–247.47 Greenfield, 1999, 3–37.48 Mahlknecht 2006, 110.
49 Von Uslar 1991, 32–39.50 Bagolini, Pedrotti 1992, 359–362.51 Bagolini, Pedrotti 1992, 362–363.52 Riedel 1997, 137–138.53 Jacomet, Leuzinger, Schibler 2005, 231232.54 Jacomet, Leuzinger, Schibler 2005, 232.55 Ebersbach 2002, 203. 56 Jacomet, Leuzinger, Schibler 2005, 284–293.57 Jacomet, Leuzinger, Schibler 2005, 340–343.
Andreas Putzer42
Auch der Mann aus dem Eis muss immer wieder in der Literatur als Zeuge für die Transhumanz herhalten. Untersuchungen an der Fundstelle der Gletschermumie vom Similaun58 haben allerdings ergeben, dass es auch dort keine Indizien auf Weidewirtschaft gibt. Zudem gilt zu bedenken, dass der Mann aus dem Eis nicht aus dem Vinschgau stammt, wie dies die Untersuchungen an seinen Zähnen und Röhrenknochen59 ergeben haben. Wäre der Mann vom Similaun ein Hirte gewesen, so hätte er wohl eine Hochalm im nähergelegenen Etschtal aufgesucht, wo er beheimatet war.
Der Beginn der Transhumanz im Alpenraum lässt sich nur durch weitere interdisziplinäre Forschung zeitlich festmachen. Vor allem die Archäologie ist in den nächsten Jahren gefordert, da die Erforschung der Hochgebirge – nicht nur in Südtirol – leider hinterherhinkt.
5. LiteraturAdam 1996A.M. Adam, Le fibule di tipo celtico nel Trentino, Patr. Stor.
Art. del Trentino 19, Trento 1996, 1–306.
Bagolini, Pedrotti 1992B. Bagolini, A. Pedrotti, Vorgeschichtliche Höhenfunde im
TrentinoSüdtirol und im Dolomitenraum vom Spätpaläolithikum bis zu den Anfängen der Metallurgie. In: Höpfel, Platzer, Spindler (Hrsg.), Der Mann im Eis I, Innsbruck 1992, 359–378.
BassettiCarlini, Dal Rì, Tecchiati 1995P. BassettiCarlini, L. Dal Rì, U. Tecchiati, Archäologie und
Kunstgeschichte in KastelbellTschars und Umgebung, Trient 1995, 1–137.
Bodini 1999G. Bodini, Unterwegs auf der Straße der Wolle. Pässe, Über
gänge, Hospize, Lana 1999, 133–138.
Bortenschlager 2000S. Bortenschlager, The Iceman’s environment. In: S. Borten
schlager, K. Oeggl (Hrsg.), The Iceman and his Natural Environment – Palaeobotanical Results. The Man in the Ice 4, Wien 2000, 11–25.
Ebersbach 2002R. Ebersbach, Von Bauern und Rindern, Basler Beiträge zur
Archäologie 15, 2002, 1–263.
Flach 1990D. Flach, Römische Agrargeschichte, HAW III/9, 1990,
1–347.
Gleirscher, Nothdurfter, Schubert 2002P. Gleirscher, H. Nothdurfter, E. Schubert, Das Rungger
Egg, RGF 61, 2002, 1–264.
Gamper 2002P. Gamper, Archäologische Grabungen am Tarscher Bichl im
Jahr 2000, Der Schlern 76, 2002, 49–69.
Gamper 2006P. Gamper, Die latènezeitliche Besiedlung am Ganglegg in
Südtirol, IntArch 19, 2006, 1–415.
Greenfield 1999H. J. Greenfield, The advent of transhumant pastoralism in the
temperate southeast Europe: A zooarchaeolgical perspective from the Central Balkans, Archaeolingua Series Minor 11, 1999, 3–37.
Haas, Walde, Wild 2008J. N. Haas, Ch. Walde, V. Wild, Holozäne Schneelawinen und
prähistorische Almwirtschaft und ihr Einfluss auf die subalpine Flora und Vegetation der Schwarzensteinalm im Zemmgrund (Zillertal, Tirol, Österreich). In: R. Luzian, P Pindur (Hrsg.), MKQ 16, 2008, 191–247.
Jacomet, Leuzinger, Schibler 2005St. Jacomet, U. Leuzinger, J. Schibler, Die jungsteinzeitliche
Seeufersiedlung Arbon/Bleiche 3 – Umwelt und Wirtschaft, Archäologie im Thurgau 12, 2005, 1–458.
Lang 1979A. Lang, Krebsschwanzfibeln, Germania 57, 1979,75–97.
Leitner 1988W. Leitner, EppanSt. Pauls – eine Siedlung der späten Bron
zezeit, ArchA 72, 1988, 1–90.
Lunz 1987R. Lunz, Archäologie Südtirols 7, 1987, 1–411.
Lunz 1991R. Lunz, Ur und Frühgeschichte des Pfattner Raumes. Pfat
ten Landschaft und Geschichte, Pfatten 1991, 53–179.
Mahlknecht 2005M. Mahlknecht, Der alpine Brandopferplatz am Grubensee
im ManeidTal, Der Schlern 79, 2005, 4–21.
Mahlknecht 2006M. Mahlknecht, Der Brandopferplatz am Grubensee
(Vintschgau, Südtirol), Festschrift 25 Jahre ANISA, Haus in Enns 2006, 92–121.
Mahlknecht 2007M. Mahlknecht, Strukturen im Hochgebirge, Der Schlern 81,
2007, 48–61.
Marzatico 1997F. Marzatico, I materiali preromani della valle dell’Adige nel
castello del Buonconsiglio. Patrimonio Storico Artistico del Trentino 21/II, Trento 1997, 441–836.
58 Oeggl 2009, 45. 59 Müller et al. 2003, 75–91.
Eine prähistorische Almhütte auf dem Schwarzboden im Maneidtal, Südtirol/Vinschgau 43
Müller et al. 2003W. Müller, M. T. McCulloch, H. Fricke, A. N. Halliday,
Origin and Migration of the Neolithic Alpine Iceman: Constraints from Isotope Geochemistry. Die Gletschermumie aus der Kupferzeit 2, Schriften des Südtiroler Archäologiemuseums 3, 2003, 75–91.
Niederwagner, Oberrauch 2007G. Niederwanger, H. Oberrauch, Ulfaser Alm, Denkmal
pflege Jahresbericht 2005/2006, Lana 2007, 317–319.
Oeggl 2009K. Oeggl, Origin and seasonality of subfossil caprine dung
from the discovery site of the Iceman, Vegetation History and Archaeobotany 18/1, 2009, 37–46.
PrinothFornwagner 1993R. PrinothFornwagner, I reperti metallici del Col de Flam,
Archeologia nelle Dolomiti, Vigo di Fassa 1993, 95104.
Reitmeier 2009Th. Reitmeier, Rückwege – Archäologie im Silvrettagebirge.
Almen im Visier, Anisa, Haus i. Enns 2009, 167–177.
Riedel 1997A. Riedel, Esame archaeozoologico del deposito eneolitico di
Isera la Toretta e confronti con faune atesine coeve. In: Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche del Tren
tino (Hrsg.) Preistoria e Protostoria del TrentinoAlto Adige/Südtirol XXXIII, Trento 1997, 101–103.
Tiefengraber 2007St. Tiefengraber, Archäologische Untersuchungen in einer
prähistorischen Almhütte im Königreich – Tiefkar, Anisa, Haus i. Enns. 2007, 97109.
Tschurtschenthaler, Wein 2002M. Tschurtschenthaler, U. Wein, Das Heiligtum auf der Pil
lerhöhe. Kult der Vorzeit in den Alpen, Trient 2002, 635–673.
Von Uslar 1991R. von Uslar, Vorgeschichtliche Fundkarten der Alpen, RGF
48, 1991, 1–514.
Willvonseder 1932K. Willvonseder, Zur Verwendung der urzeitlichen „Siebge
fäße“, MAG 62, 1932, 217–222.
Andreas Putzer Vendigerstr. 1 I-39100 Bozen [email protected]