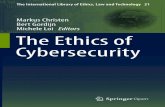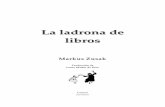Markus Raetz - Die Form auf dem Prüfstein
Transcript of Markus Raetz - Die Form auf dem Prüfstein
44 Kunstbulletin 9/201444
Markus Raetz — Die Form auf dem Prüfstein
Markus Raetz · SEE-SAW, 2014, Ausstellungsansicht Musée Jenisch, Blick in die Vitrinen mit den vom Künstler aufgeschlagenen ‹Carnets› © ProLitteris. Foto: Julien Gremaud
45FOKUS // MARKUS RAETZ
Markus Raetz — Die Form auf dem Prüfstein
Markus Raetz · SEE-SAW, 2014, Ausstellungsansicht Musée Jenisch, Blick in die Vitrinen mit den vom Künstler aufgeschlagenen ‹Carnets› © ProLitteris. Foto: Julien Gremaud
46 Kunstbulletin 9/201446
Vom Kunstmuseum Bern über das Musée Jenisch in Vevey in das Museo cantonale d’arte Lugano: Eine Auswahl der Druck-grafik von Markus Raetz reist zurzeit durch die verschiedenen Landesteile. Im Vorfeld hat Rainer Michael Mason den 1991 editierten Werkkatalog und Essayband wieder à jour gebracht – Anlass genug für ein Gespräch. Katharina Holderegger
Holderegger: Sie haben die druckgrafische Arbeit von Raetz über Jahrzehnte verfolgt und mit Sinn für den Zusammenhang des wachsenden Werks sowie mit einem Auge für das Detail nachgezeichnet. Wie sind Sie zu dieser Rolle gekommen?
Mason: Ich weiss nicht, was Kunst ist, und ich weiss auch nicht, was Kunstgeschichte ist. Aber ich glaube zu wissen, dass sich die praktischen und theoretischen Annä-herungen an die Kunst ständig wandeln. Was deshalb zählt, ist das Sammeln von Materialien und Dokumenten – solange wie möglich. Während meiner Leitung des Cabinet des Estampes in Genf habe ich mich deshalb darauf konzentriert, solche unabdingbaren Arbeiten für die Kunstschaffenden auszuführen. Dies war oft das einzige Mittel, um die hauseigene Sammlung auszubauen, denn als Gegenleistung haben mir die Künstler/innen wichtige Blätter überlassen. Mit Raetz gelangte dabei bereits 1969 ein Künstler in die Sammlung, bei dem sich im Bereich der Druckgrafik eine bedeutende Produktion ankündigte, an die ich möglichst breit gelangen wollte. 1991 hatte ich deshalb mit Juliane Cosandier, meiner damaligen Assistentin, einen ersten Werkkatalog und Essayband dazu herausgebracht. Aber wie dies bei solchen Projekten ist, einiges war darin nicht akkurat. Darüber hinaus hat Raetz die Druck-grafik stets weiterentwickelt. 2012 habe ich deshalb zu ihm gesagt: «Il faut remettre l’ouvrage sur le métier.» Und da das Kunstmuseum Bern zu seinem 70. Geburtstag eine Ausstellung machen wollte, haben wir mit diesem sowie dem Musée Jenisch und dem Museo cantonale d’arte Partner für eine aktualisierte Fassung gefunden, gestaltet von Trix Wetter – so wie es sich Raetz gewünscht hat.
Holderegger: Dieses zu einem grossen editorischen und kuratorischen Unternehmen ausgewachsene Projekt bot Ihnen Gelegenheit, mit einer jüngeren Generation von Spezialist/innen zusammenzuarbeiten. Was war das für eine Erfahrung?
Mason: Einer meiner Lebenslehrer, der Schriftsteller Ludwig Hohl,hat gesagt: «Arbei-ten ist nichts anderes, als aus dem Sterblichen übersetzen in das, was weitergeht.» Es war mir deshalb zentral, Visionen jüngerer Kolleg/innen einzubeziehen, denn ein Werk kann nur bestehen, wenn eine zweite und dritte Generation von Rezipienten auf den Plan tritt. So war ich beispielsweise mit dem Plastiker Robert Müller sehr verbunden. Nach seinem Tod 2003 drohte sein ganzer Nachlass unterzugehen. Erst jetzt zeigen sich neue Möglichkeiten, vor allem dank der Initiative von Stephan Kunz, früher Konservator im Aargauer Kunsthaus, heute Direktor des Kunstmuseums Chur. Es ist eine wichtige Aufgabe der Museumsleute, sich der Kunst anzunehmen, die «in das Fegefeuer der Geschichte» gefallen ist, wie es die Franzosen ausdrücken.
47FOKUS // MARKUS RAETZ
SEE-SAW, 2014, Ausstellungsansicht Musée Jenisch © ProLitteris. Foto: Julien Gremaud
48 Kunstbulletin 9/201448
Auge, 1975, Kaltnadel, 59 x 78 mm © ProLitteris
Holderegger: Die Druckgrafik war so etwas wie das Initiationsmedium von Raetz. Zentrale Aspekte wie Symmetrie versus Inkongruenz sowie die Überblendung von Bildern lassen sich aus der Konzeption und Realisation dieses Mediums ableiten.
Druckgrafik als Initiationsmedium
Mason: Die Druckgrafik gelangte zunächst generationenbedingt in das Werk von Raetz. In den Fünfziger-, Sechzigerjahren geisterte überall die Idee herum, den teuren Ge-mälden und Plastiken vervielfältigte Bilder zur Seite zu stellen. Wenn Raetz nun aber bei der stark technikgebundenen Druckgrafik geblieben ist, dann weil sein Schaffen auf drei Füssen steht. Er bringt nicht nur das Intellektuelle und das Visuelle in Ver-bindung. Bei ihm gesellt sich immer auch das Machen dazu. Raetz ist ein Mensch, der sich sehr gemächlich, fast träumerisch in der taktilen Materialisation inkarniert. Bei diesen beiden Figuren etwa sehe ich von hier einen Mann und von dort eine Frau. Ein Computer könnte ein solches Skulpturenpaar innert Sekunden errechnen; Raetz aber brauchte ein Jahr, um zu erfassen, wie er die Linien formen muss, damit aus einem Mann eine Frau wird und umgekehrt. Solche Dinge sind bei ihm aber nie nur Spielerei. Die Suche ist immer auch philosophischer Natur. Im Grunde sind die Unter-schiede zwischen Mann und Frau ja minim. Wie ein Kind muss Raetz mit seinen Hän-den ertasten, dass «dieses» gleichzeitig «jenes» ist – und erfahren: «Geht es dabei weiter? Geht es dabei tiefer?» Auch das Möbiusband, dieser Ring, der auf einer Ober-fläche zwei Seiten hat, ist ein Bild für das Gleiche, das dennoch so andersartig ist.
Holderegger: Claudine Metzger hat die Druckgrafik von Raetz in Bern mit seiner Plastik konfrontiert; Julie Enckell Julliard zeigt sie in Vevey zwischen einer Aus-wahl von «Carnets» und Skulpturen; Marco Francioli wird für die Blätter in Lugano einen thematischen Rahmen schaffen, der um das Gesicht kreist. Wie sehen Sie das Verhältnis der Druckgrafik von Raetz zu anderen Aspekten seines Werks?
Mason: Bei Raetz gibt es diese ausserordentlich sensible und intelligente Beziehung zwischen der reinen Technik sowie dem Denken einerseits – «wo geht es hin, wenn man weiter denkt?» – und der Form andrerseits – «wie hat die Form das irgendwie
49FOKUS // MARKUS RAETZ
aufzunehmen?» Denn die Form ist alles in der Kunst. Die Druckgrafik fungiert bei ihm gleichsam als Prüfstein: Wenn er zu diesem Medium greift, versucht er, eine Form nochmals auf den Punkt zu bringen, eingedenk aller Möglichkeiten, die er in den ‹Carnets› zuvor oft hundertfach durchdacht und erforscht hat. Diese Hefte enthalten inzwischen um die 37’500 Skizzen. Das druckgrafische Werk wird so zu einem Kom-pendium der Formen, die dann auch in der Plastik, der Malerei und der Fotografie wieder auftauchen können. Raetz benutzt die Druckgrafik dazu, das Potenzial einer Form auszuloten, ohne diese gleichzeitig für immer und ewig als bindend zu erklären. Darin liegt, glaube ich, die doppelte Relevanz seines druckgrafischen Werks.
Holderegger: Das Tüfteln, die Akribie und die Präzision werden oft als schweizeri-scher Zug des Werks von Raetz beschrieben. Wie sehen Sie das?
Mason: Dies ist eine interessante Frage: Gibt es einen schweizerischen Parameter der Kunst – abgesehen vom Hodlerianismus? Eine Ausstellung übrigens, die noch zu ma-chen wäre. Viele Schweizer Künstler haben es nicht für nötig gehalten, sich einer Be-wegung anzuschliessen – darin sehe ich etwas spezifisch Schweizerisches. Oft kann man deshalb nicht gleich erkennen, inwiefern das, was sie machen, Kunst ist. Das Werk von Raetz ist insofern typisch für die Kunst unseres Landes. Obwohl er ein wa-cher Zeitgenosse ist und stets mit anderen Künstlern freundschaftliche Beziehun-gen gepflegt hat, ist sein Werk hermetisch geblieben. Vielleicht noch entscheidender ist jedoch, dass Raetz nie definitive Antworten gibt: «So ist es.» Oder: «So hat es zu sein.» Seine Arbeiten zeigen vielmehr, wie es sein könnte. Es gibt bei ihm immer ei-ne unabdingbare Beteiligung des Publikums. Er ist einverstanden, dass seinem Werk etwas hinzufügt wird. Raetz gibt ja auch kaum Interviews, und selbst wenn man ihm einen Text zu seinen Arbeiten vorlegt, greift er nur sachte ein.
Holderegger: Sie würden also sagen, dass die Zurückhaltung in seinem Werk etwas mit den demokratischen, föderalistischen Strukturen unseres Landes zu tun hat?
Mason: Ja, genau, es muss uns gelingen, miteinander zu sprechen; wir können einan-der nicht platt walzen. Ich hänge effektiv sehr an diesen schweizerischen Traditio-nen. Sie sind ausserordentlich – wenn wir uns auch hin und wieder darin täuschen, dass wir glauben, wir hätten die anderen nicht nötig, so wie in der Abstimmung am 9. Februar. Aber das wird vorbeigehen.Das Gespräch fand am 10.4.2014 in der Brasserie Bagatelle in Genf statt.
Katharina Holderegger, Kunsthistorikerin, lebt mit ihrer Familie am Genfersee. [email protected]
Rainer Michael Mason (*1943, Hamburg) lebt in Genf; 1969–1974 Kritiker der Tribune de Genève, 1971–1979
Assistent am Cabinet des Estampes Genf und 1979–2005 Leiter des Cabinet des Estampes. 1973–1994
Engagement zur Auflgleisung des MAMCO, seit 2005 publizistische Aktivität.
→ Markus Raetz, ‹Die Druckgrafik 1951–2013›, hg. von R.M. Mason und C. Metzger, Bd. 1 Catalogue raisonné, aktualisierte von Trix Wetter neu gestaltete Ausgabe; Bd. 2: mit Beiträgen von J. Cosandier, J. Helfenstein, J. Enckell Julliard und L. Laz, R. M. Mason u.a., Scheidegger und Spiess, 2013 → ‹Saw See›, bis 5.10.; Musée Jenisch, Vevey, mit Publikation von R. M. Mason, ‹Le hasard et l’expérience: La gravure selon Markus Raetz›, Vorwort von J. E. Julliard, Musée Jenisch, 2014 ↗ www.muséejenisch.ch ↗ www.kunstmuseumbern.ch ↗ www.museo-cantonale-arte.ch