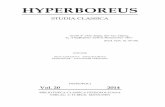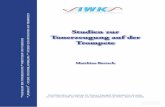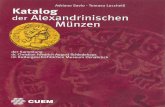Konjunktur 2006: Robuste Weltwirtschaft -- Deutschland holt auf
Die Münzen (römischer Rundtempel auf dem Grossen Hafner im Zürichsee)
-
Upload
niedersachsen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die Münzen (römischer Rundtempel auf dem Grossen Hafner im Zürichsee)
nach Killwangen AG. In den danach folgenden etappiertenRückzugsstadien des Spätglazials kam es zur Ausbildung ver-schiedener Wallmoränen1. Während eines dieser Regressi-onsstadien befand sich im Vorfeld der Gletscherstirn, bei derheutigen Stadt Zürich, ein früher See. Die Zungenbeckensolcher Seen bilden sehr oft eine Art Falle, worin die vomGletscher und den Schmelzwassern zugeführten Sedimentegefangen werden. Charakteristisch für solche Ablagerungenvon grossen Mengen an Lockergesteinsedimenten sind ihreWechselhaftigkeit und somit auch ihre unberechenbare,höckerige Oberfläche.
Im Bereich der zurückweichenden Eisfront erhielt auchder Grund des heutigen untersten Seebeckens eine solch un-ruhige Oberfläche. Die zwei grössten der dabei entstandenenBuckel blieben später – abhängig vom jeweiligen Seespiegel-stand – als Inseln oder zumindest als sich deutlich abzeich-nende Untiefen sichtbar: Der Grosse Hafner mitten im Seeund der Kleine Hafner nahe dem rechten Ufer und unweitdes Limmatausflusses2 (Abb. 1).
Der Grosse Hafner befindet sich aktuell etwa 200 m vonder heutigen Ufermauer des Zürcher Utoquais entfernt. VomUfer von 1868 war die Untiefe etwa 270 m und von der nochälteren, unscharfen Trennlinie zwischen See und Sumpfge-biet etwa 330 m entfernt3. Die Distanz zum ursprünglichenLimmataufluss unterhalb der barocken Bauschanze beträgtgut 400 m. Eine Landverbindung hat selbst bei tiefemWasserstand sicher nie bestanden, denn zwischen der Untiefebzw. ehemaligen Insel und dem Festland ist der See überallzwischen 10 und 12 m tief.
Grob umschrieben handelt es sich um eine in ihremUmriss ziemlich ovale Untiefe von rund 150 m Länge und45 m Breite, die in ihrem Zentrum heute etwa 3,5–4 m unterWasser liegt und gegen ihre Ränder hin nicht sehr steil weiterabfällt.
ZÜRICH, RIESBACH, GROSSER HAFNERKoord. 683450/246380. Höhe 402Römischer Rundtempel aus HolzTauchgrabung 1998.111; 27.01.–13.02.1998; 28.02.–09.03.2000;08.01.–23.03.2001Verantwortlich: Beat Eberschweiler, Robert auf der Maur,Daniel Käch
Inhalt1 Einleitung1.1 Entstehung, Lage und Topographie der Untiefe1.2 Ein kurzer historischer Abriss1.2.1 Entdeckung1.2.2 Ein städtebauliches Grossprojekt – Die Quaianlagen1.2.3 Die Baggertätigkeit des 19. Jh.1.2.4 Die verschwundene Insel – Rekonstruktion der ur-
sprünglichen Situation1.2.5 Unterwasserarchäologische Untersuchungen 1961–19802 Befunde2.1 Die archäologischen Untersuchungen in jüngster Zeit2.1.1 Entdeckung und erste Aufnahmen im Winter 19982.1.2 Erste Oberflächenaufnahme im Winter 20002.1.3 Die Oberflächenaufnahmen von 20012.2 Der Rundbau2.2.1 Überblick2.2.2 Die erhaltenen Bauhölzer2.2.3 Die verfüllten Pfahllöcher2.2.4 Dendrochronologische Datierung2.2.5 Rekonstruktion des Baus2.2.6 Der Rundbau – ein Heiligtum?2.2.7 Der Rundtempel als gallorömische Bauform2.2.8 Gallorömische Tempel in Insel- bzw. Halbinsellage2.2.9 Verehrte Gottheit2.3 Weitere römische Bautätigkeit auf dem Grossen Hafner3 Die römischen Funde3.1 Keramik3.2 Glas3.3 Metall3.3.1 Die Münzen (Luisa Bertolaccini und Ulrich Werz)3.3.2 Eisen und Buntmetall3.4 Ziegel3.5 Zusammenfassende Datierung der Funde4 Zusammenfassung – Résumé – Riassunto – Summary5 Anmerkungen6 Abgekürzt zitierte Literatur7 Katalog
1 EINLEITUNG
1.1 Entstehung, Lage und Topographie der Untiefe
Der Zürichsee verdankt wie die umliegenden Nachbarseenseine Existenz den Gletschern, die das Gebiet in der Würm-eiszeit während gut 70 000 Jahren bedeckt hielten. Währenddieser letzten Eiszeit reichte der Limmattal-Lappen desLinth-Rhein-Gletschers in seiner grössten Ausdehnung bis
247
EIN RÖMISCHER RUNDTEMPEL AUF DEM GROSSEN HAFNERIM ZÜRICHSEE(Beat Eberschweiler und Daniel Käch, mit einem Beitrag von Luisa Bertolaccini und Ulrich Werz)
Abb. 1. Zürich. Luftaufnahme des unteren Zürichseebeckens mitLimmatausfluss und den deutlich erkennbaren seichten Strand-platten und Untiefen, soweit sie nicht durch die Aufschüttungen des19. Jh. überdeckt worden sind.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 247
ein «Projekt für Quai- und Quartieranlagen am rechten See-ufer, in Stadelhofen und im Seefeld». Diese Projektskizzebildete die Grundlage für die Ausarbeitung des definitivenKonzepts, das sich 1881 im «Situationsplan der projectirtenQuaianlagen in Zürich» niederschlug. Der entsprechendeVertrag zur Ausführung der Quaibauten an beiden Seeufernnebst einer verbindenden Brücke über die Limmat alsgemeinsame Unternehmung der Stadt Zürich und der bei-den Gemeinden Enge und Riesbach wurde am 4. September1881 mit grossem Mehr angenommen. Ziel dieses gemeinsa-men Grossprojektes war es, die Vorteile der Lage der Stadtund der beiden Aussengemeinden am Seeufer hinsichtlichdes Verkehrs wie der Schönheit der Gegend zur vollen Gel-tung zu bringen11. Bürkli legte sein Amt bei der Stadt niederund übernahm im Februar 1882 als leitender Ingenieur dieQuai-Unternehmungen.
Der Vergleich zwischen Projekt und Ausführung ergibtzwar nur wenige geringfügige, aber für die hier behandelteFundstelle dennoch entscheidende Unterschiede: Die Un-tiefe des Grossen Hafners wäre nach Bürklis ursprünglicherIdee nämlich zur Parkinsel aufgeschüttet und mit einergrossen Badeanstalt (Ersatz für jene bei der Stadthausanlage)und einem Teehaus/Tanzsaal ausgestattet worden (Abb. 2).Weder diese am Grossen Hafner aufzuschüttende Insel nochihre später geplante Ersatzbaute, eine ans Engemer Ufer ver-legte Halbinsel, wurden aber je realisiert.
1.2.3 Die Baggertätigkeit des 19. Jh.
Die Quaibehörden hatten entschieden, bei der Vergebungder Aufschüttungsarbeiten der billigeren Offerte den Vorzugzu geben, wonach die Zufuhr von Auffüllmaterial – imDurchschnitt zwei Drittel Schlamm und ein Drittel Steine –mittels Schiffen erfolgen solle12. Die genehmigten Bezugs-quellen für den Schlamm waren vorerst die Untiefen desGrossen Hafners und danach diejenige des Haumesser-Grun-des bei Wollishofen. Im Verlauf der Bauzeit steigerte sichjedoch der Bedarf an steinigem Material. Auch auf Druck derÖffentlichkeit13 wurden im Mai 1885 die Schlammbaggerun-gen in Wollishofen eingestellt und ab da im Wesentlichennur noch steiniges Material geliefert14. Die Qualität des aufdem Grossen Hafner und bei Wollishofen gewonnenen Ma-terials war nicht optimal: Wegen des grossen Wassergehaltslag der effektive Bedarf um 150% über dem ursprünglich vor-gesehenen und berechneten Quantum. Der Schlamm warüberdies derart flüssig, dass er im Wasser schwebte, die Ein-bringung hinter die Wälle also nur durch Schwemmung zubewerkstelligen war. Das homogen sandige Material von derBächau und später aus dem Schuttkegel der Wäggitaler Aawar ungleich geeigneter15.
Es wurden gemäss Aufstellung des durch die Werküber-nehmer gelieferten Auffüllmaterials im März und April desJahres 1883 gegen 13 000 m3 und im Juni darauf noch einmaletwa 5000 m3 von der Untiefe des Grossen Hafners ab-geführt16. Obwohl dabei auf dem grössten Teil der Untiefesämtliche Fundschichten wegbefördert wurden, blieb dieZahl der geretteten Altertümer recht bescheiden. Es wurdezwar im Übernahmevertrag mit den Bauunternehmern be-stimmt, dass sämtliche Gegenstände von naturhistorischemund antiquarischem, überhaupt wissenschaftlichem Wert, diebei Bauarbeiten im Schlamm entdeckt werden, der Bau-leitung zu Handen der öffentlichen Sammlungen abzuliefernseien. Trotz der Auszahlung einer Entschädigung seitens derAntiquarischen Gesellschaft an die Arbeiter für die Bemü-
1.2 Ein kurzer historischer Abriss
1.2.1 Entdeckung
Schon Adolphe Morlot schrieb am 14. Januar 1855, dass manauch in Zürich Pfahlbauten finden müsse und wies dabei spe-ziell auf den Grossen Hafner hin4. Die Entdeckung derFundstelle erfolgte wenig später: Ferdinand Keller unter-suchte den Grossen Hafner anscheinend im Jahr 1860 (?), alsdas Wasser nur 1–2’ (also 30–60 cm) über der Untiefe gestan-den und einzelne Steine sogar über das Wasser geragt habensollen5. Weil alles mit einer dicken Kalkkruste überzogenwar, führten die Untersuchungen anscheinend noch zu kei-nem Resultat6. Zur Abklärung der Beschaffenheit des Bodenswurden zuerst 1868 für zwei Tage und 1879 noch einmal fürkurze Zeit Baggerungen durchgeführt7. Ab 1870 sammelteman anscheinend auch mittels Zangen Artefakte in den Fur-chen auf der Untiefe8.
Die Namensgebung wird seit dem 19. Jh. diskutiert: «DerName Hafner hat schon zu verschiedenen Deutungen Anlassgegeben. Mittelalterliche und neuere Töpferprodukte sindverhältnismässig selten auf diesen Untiefen, daher es unzu-lässig ist, den Namen davon abzuleiten, dass im Mittelalterdieselben als Ablageplätze verdorbenen Geschirrs der Hafnerund Töpfer der Stadt gedient hätten. Indessen mögen schonbei früheren Erdbewegungen oder aussergewöhnlich tiefemSeestande prähistorische Töpferwaaren zum Vorschein ge-kommen sein, woran vielleicht diese Benennung anzu-knüpfen wäre.»9
1.2.2 Ein städtebauliches Grossprojekt – Die Quaianlagen
Zwischen 1860 und 1889 veränderte sich das Bild der StadtZürich in vielfältiger Weise: Es wurden zwei neue Brückenüber die Limmat geschlagen, der See wurde mit prachtvol-len Quaianlagen umsäumt, die Wasserversorgung konntesichergestellt und die Kloakenreform durchgesetzt werden.Treibende Kraft dieses «Baubooms» war Arnold Bürkli, derbereits im Alter von 28 Jahren zum Stadtingenieur berufenworden war10. Zusammen mit dem Riesbacher BauvorstandPeter Emil Huber-Werdmüller verfasste er im Frühjahr 1872
248
Abb. 2. Zürich. Riesbach. Projektidee von 1872: Der Grosse Hafnerals öffentliche Anlage mit Badeanstalt und Teehaus/Tanzsaal.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 248
5. Der Seespiegel in römischer Zeit lässt sich ungefähr rekon-struieren. Einen ersten Anhaltspunkt liefern die Untersu-chungen bei den Thermen. Dort wurde beobachtet, dassder flache Ufersaum, der «normalerweise nicht viel höherals der Wasserspiegel» reichte, auf 406,60 m ü.M. lag29. DieUntersuchungen von links- und rechtsufrigen Befundensowie im Bereich des Sihldeltas/Münsterhofs ergaben,dass sich die Uferlinie in römischer Zeit auf 406,00–406,50m ü.M. befand30. Der Wasserstand lag damit in römischerZeit etwa auf dem heutigen Niveau oder aber vielleichtsogar noch etwas höher.
Da mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werdenkann, dass der aus vergänglichem Material errichtete Rund-bau im Wasser gestanden hat, ist mit Schichtsetzungen undErosion zu rechnen. Diese Setzungen sowie nachträglichdurch die Baggerungen verursachte Verschiebungen könntenauch den heute nicht ganz exakten kreisförmigen Grundrisserklären.
Es ist also davon auszugehen, dass in römischer Zeit selbstbei höheren Wasserständen eine Insel, wenn auch eine eherkleine, bestanden hat. Die Suche nach einer solchen Inselim unteren Seebecken auf alten Ansichten und frühemKartenmaterial verlief ergebnislos.
Auf der 1576 erstellten Chronik von Christoff Silberysen(und auf weiteren, jüngeren Stadtansichten) erscheint im Seedraussen eine Art Turm, der von einem Pfostenring eingefasstwird31 (Abb. 3). Es handelt sich dabei aber sicher nicht umden Grossen Hafner, sondern um eine von mehreren «Kreuz-marken», die im mittelalterlichen Zürich den Geltungsbe-reich eines Wirtschafts- und Rechtsgebietes räumlich de-finierten. Im besagten Bild ist die sog. «Klausstud» (auch:St.-Nikolaus-Stud) festgehalten, die über 100 m vom Uferentfernt auf einem Findling im See draussen errichtet wordenwar und bei Hochwasser nicht sichtbar war. Die im 19. Jh.als Ersatz dafür errichtete Steinsäule unweit des Hafens vonRiesbach steht noch heute am selben Ort, seit der Auf-schüttung der Quaianlagen allerdings auf festem Boden.
hungen beim Auslesen und für ehrliche Ablieferung wurdendennoch viele Gegenstände durch die Arbeiter anderweitigveräussert17. Heierli beklagte denn auch: «Das Meiste wurdeverschleppt, nur von Wenigem haben wir genaue Kunde.»18
Auf dem Grossen Hafner waren steinzeitliche Funde ge-genüber den reichen Funden aus der Bronzezeit deutlichschwächer vertreten. Von besonderer Bedeutung ist, dass da-mals auch römische Funde erwähnt wurden: «eigenthümli-cherweise wurde hier (…) auch eine nicht unbeträchtlicheAnzahl römischer Überreste gefunden. Neben Bruchstückenvon römischen Leistenziegeln, ornamentirten Topfscherbenaus Terra sigillata etc. sind es besonders römische Kupfer-münzen (...), die unser Interesse auf sich ziehen.»19
1.2.4 Die verschwundene Insel – Rekonstruktion der ur-sprünglichen Situation
Die ovale Form ist unbestritten und nach wie vor erkennbar(Abb. 1–2), aber es sind nur wenige und sich nur bedingtergänzende Informationen zur ursprünglichen Höhe derKuppe vor den umfangreichen Abbaggerungen vorhanden20.Es gibt verschiedene, unterschiedlich verlässliche Berech-nungsmöglichkeiten:1. Bekannt ist, dass die Fundstelle von den Anhöhen noch
kurz vor den massiven Materialabtragungen wegen derweisslichen Farbe21 und eines Schifferzeichens (Boje) gutzu bemerken war22. Dies sagt nur bedingt etwas über dieHöhe der Wasserüberdeckung aus, viel mehr als 2 m dürftesie demnach aber kaum betragen haben.
2. Am zutreffendsten scheinen die Aussagen von F. Keller zusein, der schrieb, dass der Grosse Hafner 5–6’ (also etwa1,5–1,8 m) unter dem mittleren Seespiegel liegt23.
3. War es tatsächlich das Jahr 1860, als Keller mit H. Rungedie Untiefe besuchte und anscheinend nur mehr 1–2’ (=Fuss) Wasser über der Untiefe stand? Es ist wohl anzu-nehmen, dass seine Entdeckung im Winter bei niedrigemWasserstand erfolgte. Der tiefste Wasserstand ist 1860 fürden Februar dokumentiert24. Er betrug 19 Zoll25 über demalten Nullpegel bei der Bauschanze. Daraus lässt sich eineungefähre Höhenangabe gewinnen, da dieser Pegel nachK. Wetli einer Höhe von 408,45 m ü.M. entspricht26, wo-von wegen der späteren Präzisierung der Kote beim Pierredu Niton 3,26 m abzuziehen sind (= 405,19 m ü.M.). Diehöchsten Stellen der Untiefe befanden sich also bei 11,5Zoll tieferem Wasserstand als üblich noch 1–2 Fuss unterWasser. Der mittlere Wasserstand wird mit 30,47 Zoll ange-geben, was einer Kote von 405,98 m ü.M. entspricht.Einige besonders exponierte Stellen auf der Untiefe befan-den sich also, wenn man den Angaben trauen will, nurwenig mehr als einen halben Meter unter der mittlerenWasserlinie. Ein Besuch zwei Jahre zuvor wäre übrigensnoch Erfolg versprechender gewesen, denn 1858 wurdenim Februar/März 3,5 Zoll als niedrigster Wasserstand ver-merkt, also noch einmal 40 cm tiefer als 1860.
4. Heute beträgt die mittlere Wassertiefe auf dem abgebag-gerten Plateau im Schnitt um die vier Meter27, was einerdurchschnittlichen Höhe im Zentrum von etwa 402,10 mü.M. entspricht. Geht man vom abgebauten Volumen von18 000 m3 aus, dann musste dafür das Inselplateau auf sei-ner ganzen Länge von 150 m und der gesamten Breite von45 m um etwa 2,5 m abgebaggert worden sein. Darausergäbe sich eine ursprüngliche mittlere Höhe des GrossenHafners bei etwa 404,50 m ü.M., was die obgenanntenAngaben bestätigt28.
249
Abb. 3. Zürich. Riesbach. Etwa 120 m vom damaligen Ufer desZürcher Seefelds entfernt stand im See die Klausstud (St. Niclaus),eine Säule mit kreisförmiger Pfahlsetzung als Einfassung. Ausschnittaus einem Panorama in drei Teilen, Zürich, entstanden zwischen1730 und (eher) 1780.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 249
Sondage durchgeführt33, und zwar in der Verlängerung, Rich-tung östliche Halde. Dabei kamen unterschiedlich gut erhal-tene und gegen aussen stark abfallende Schichten der Spät-bronzezeit sowie der Horgener und der Cortaillod-Kultur zuTage. Die Schiefstellung der ursprünglich senkrecht stehen-den Pfähle ist am Rand der Untiefe auf Kriecherscheinungenzurückzuführen. Sie ist die Folge einer allzu steilen Bö-schung für die Seekreide am Rande des Hügels. Kriech-erscheinungen erbringen neben vertikalen auch radial gerich-tete horizontale Bewegungen. Naturgemäss klingen sie gegendie höchste Hügelkuppe hin ab.
Im südlichen Teil der Untiefe wurde im Winter 1980 aufeiner Fläche von 50 × 50 m die abgebaggerte Fläche mit denzufällig stehen gelassenen «Zeugenbergen» mit Schichtresten(Abb. 4) und Pfahlfeld eingemessen sowie frei gespülte Fundevon der zerfurchten Oberfläche geborgen. Bei all diesenUnternehmungen wurden nirgends irgendwelche Hinweiseauf römische Funde gemacht, zumindest haben sie keinenNiederschlag in den Grabungsdokumentationen oder in denFundzetteln gefunden.
2 BEFUNDE
2.1 Die archäologischen Untersuchungen in jüngster Zeit
2.1.1 Entdeckung und erste Aufnahmen im Winter 1998
Nachdem beinahe 20 Jahre seit der letzten archäologischenUntersuchung vergangen waren, wurde im Winter 1998 einezweiwöchige Tauchaktion auf dem Grossen Hafner durchge-führt34. Diese hatte zum Ziel, die Fundstelle an möglichstvielen verschiedenen Stellen auf ihren Zustand hin zu kon-trollieren und gegebenenfalls besonders problematische Be-reiche zu definieren, wo aufwändigere Oberflächenaufnah-men und Bergungen zwingend nötig wären. Der Kurs derzahlreichen grossen Ausflugschiffe der «Zürichsee-Schiff-fahrtsgesellschaft» führte und führt nämlich vom Anlegestegbeim Bürkliplatz direkt über die Untiefe hinweg.
Bei der Dokumentation von Seegrundprofilen quer undlängs über die Untiefe wurden vielerorts bedenklich starkerodierte spätbronzezeitliche Baureste gesichtet (Abb. 5).Vie-le Pfähle, teils mehr als 1 m über den Grund ragend, stehenin Gruppen beisammen. Im Schlick liegen etliche frei ge-schwemmte Pfahlschuhe. Völlig überraschend kam an einer
1.2.5 Unterwasserarchäologische Untersuchungen 1961–1980
Mit den Aufsammlungen von neolithischen und spätbron-zezeitlichen Artefakten durch den Sporttaucher Robert Gin-zig im Zeitraum zwischen Winter 1961/62 und dem Sommer1963 rückte der Grosse Hafner erstmals seit F. Keller wiederins wissenschaftliche Blickfeld32.
250
Abb. 4. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Unterwasseraufnahme von1979. Isolierter Zeugenberg mit dünner prähistorischer Schicht (imVordergrund, unten) und deutlich frei gewittertem Pfahlfeld.
Abb. 5. Zürich. Riesbach. Vereinfachtes Querprofil über die Untiefe «Grosser Hafner». An verschiedenen Stellen sind Konzentrationen vondeutlich frei gespülten Pfählen vorhanden. An den Rändern der Untiefe (um m’ 200–210 resp. 260–270) treten prähistorische Kulturschichtenan die Oberfläche.
In den darauf folgenden Jahren wurden verschiedentlichTauchfunde durch archäologisch interessierte Gerätetaucher,zusammengefasst im Verein «Turi-Sub», an die amtlichenStellen abgegeben. Im Winter 1969/70 dann konnte ein Son-dierschnitt wenig nördlich des Zentrums der Untiefe angelegtwerden. In einer nächsten Tauchgrabung wurde im Winter1978/79, direkt anschliessend an den Schnitt, eine weitere
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 250
2.1.2 Erste Oberflächenaufnahme im Winter 2000
Zwei Jahre später wurden dann, ausgehend von jener Stelle,ein 43 m langer und 1 m breiter Streifen in Längsachse zurUntiefe und daran anschliessend weitere kleine Teilflächen(insgesamt 73 m2) oberflächlich vom Schlick gereinigt undalle Funde geborgen. Die Fundverteilung zeigte, dass mit denTauchgängen von 1998 das Zentrum der römischen Fund-streuung recht gut erfasst worden war. Es wurden wiederumdeutlich am Grund erkennbare Baggerverfüllungen beob-achtet und diese punktuell auch ausgenommen. Das darineingelagerte Fundmaterial war bunt durchmischt: Neben wei-teren römischen Funden kamen zur Hauptsache bronzezeit-liche und neolithische Siedlungsfunde zu Tage. In einer Bag-gerstörung fanden sich zwei mächtige Stammabschnitte vonErlen mit Durchmessern von 27 cm resp. 34 cm und erhal-tenen Längen von 80 cm resp. 100 cm. Sie wiesen beide par-tiell Bearbeitungsspuren wegen der Entrindung auf. AufGrund der für prähistorische Verhältnisse atypischen Dimen-sionen und auch wegen der noch beträchtlichen Härte desHolzes schien eine römische oder jüngere Datierung wahr-scheinlich. Etwa 30 m davon entfernt kam ein noch im See-boden steckender mächtiger Eichenpfahl mit einer Kanten-länge vom 20 × 17 cm zum Vorschein. Eine Analyse allerBeobachtungen ergab, dass es durchaus möglich war, dass,trotz der Ausbaggerungen von 1883 und trotz des regenmodernen Schiffsverkehrs direkt über die Untiefe hinweg,doch noch allerletzte Relikte römischer oder jüngererBautätigkeit unter dem Schlick verborgen sein könnten.
2.1.3 Die Oberflächenaufnahmen von 2001
Bereits im darauf folgenden Winter wurde die detaillierteUntersuchung des fraglichen Areals vorgenommen35. Unge-fähr im Zentrum der Untiefe wurde auf einem Areal von 20 × 30 m der Seegrund vom deckenden Schlick gereinigt.Wegen der meist von Süden nach Norden zum Limmataus-fluss hin verlaufenden Strömung wurde in Gegenrichtung,also von Norden nach Süden, gearbeitet. So konnte vorerstauf die Installation von Strahlrohren, die künstliche Strö-mung produzierten, verzichtet werden. Diese kamen erstgegen Schluss der Aktion zum Einsatz, als es um das Aus-graben von Pfählen und verfüllten Pfostenlöchern ging. Aufeine Planaufnahme der unzähligen prähistorischen Pfählewurde bereits nach dem ersten gereinigten Meterstreifen auszeitlichen Überlegungen verzichtet. Auch bezüglich der Ber-gung des am Seegrund frei gespülten Fundmaterials wurdeselektiv vorgegangen: Es wurden ohne Ausnahme alle römi-schen und jüngeren Objekte gehoben, beim prähistorischenMaterial beschränkte man sich bewusst auf aussagekräftigeStücke. Nur so konnte das ehrgeizige Ziel, innert kurzer Zeiteine möglichst grosse Fläche einsehen und beurteilen zukönnen, erreicht werden.
Zusätzlich zu den bereits früher erstellten Seegrundpro-filen wurden nun auch Baggerstörungen in ihrem Verlauf inder Fläche und teilweise auch in kleinen Profilen dokumen-tiert (Abb. 8–9). Darüber hinaus wurde von jedem Quadrat-meter die absolute Höhe notiert. Das untersuchte Arbeitsfeldist ziemlich eben, von einigen wenigen leicht erhöhten Flä-chen abgesehen. Diese dürften die letzten Reste von unter-dessen ebenfalls schon stark zurückgewitterten Zeugenbergenrepräsentieren. Des weiteren wurden alle offensichtlich nach-bronzezeitlichen Pfähle und verfüllten Pfahllöcher einge-messen, geschnitten und allfällige Holzreste geborgen. Man-
Stelle zwischen Pfählen, Steinen und stehen gebliebenenZeugenbergen, ungefähr im Zentrum der Untiefe, römischesFundmaterial zum Vorschein (Abb. 6–7). Es handelte sichzur Hauptsache um mehrere Fragmente von Leistenziegeln,einige wenige Keramikscherben und insgesamt 14 Münzen.Das ganze schien sich vorerst auf eine Fläche von – grobgeschätzt – ungefähr 9 × 15 m eingrenzen zu lassen.
251
Abb. 6. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Der archäologischeTaucher befindet sich über einer wieder verfüllten Baggerstörung,worin sich direkt unter einem grossen Stein ein gut erhaltenerLeistenziegel abzeichnet.
Abb. 7. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Bei der Entfernung desdeckenden Schlickes kam an der Seegrundoberfläche eine römischeMünze zum Vorschein. Im Hintergrund zeichnet sich ein spät-bronzezeitliches Bauholz ab (hochgestellter Pfahlschuh?).
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 251
gels Schichten konnte auf Profilaufnahmen verzichtet wer-den. Überrascht hat immer wieder die recht komplexe undnatürlich wirkende Abfolge von wieder eingelagerten Schich-ten in den Baggerstörungen.
2.2 Der Rundbau
2.2.1 Überblick
Nach Abschluss der Oberflächenaufnahme liess sich ein un-gefähr kreisrunder Grundriss erkennen, der sich aus folgen-den Elementen zusammensetzt (in Klammern: Holz-Nr.):In situ– Zwei Pfahlspitzen, d.h. noch im Grundriss stehend (119,
157)– Zwei weitere verfüllte Pfahllöcher mit grösseren Holzsplit-
tern darin (134, 240)– Weitere 13 verfüllte Pfahllöcher ohne Holzreste (136, 146,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 239, 241, 242, 243)
252
Abb. 8. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Schnitt durch eines derzahllosen, wiederverfüllten Baggergräbchen. Es hebt sich wegen derdunkelbraunen organischen Kulturschichtreste deutlich von dersterilen hellen Seekreide ab.
Abb. 9. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Übersichtsplan mit denkreuz und quer verlaufenden Baggerstörungen, den Pfählen undPfahllöchern des Rundbaus sowie den daneben liegenden Pfahl-resten. M. 1:200.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 252
Enden stark erodiertes Stück weist seitlich eine Aussparung(eine Art kantigen Ausschnitt) auf.
Diese Bauteile wurden vermutlich, wie Schicht- undFundmaterial, bei den Baggerungen herausgerissen, fielendann aber von den Schaufeln und kamen wieder amSeegrund zu liegen. Die Objekte sind von der Form herund/oder dendrochronologisch einwandfrei dem rundenGrundriss zuzuordnen.
2.2.3 Die verfüllten Pfahllöcher
Von allen verfüllten Pfahllöchern wurden die Querschnittedokumentiert. In der Regel handelt es sich um rechteckigeFormen, die durchwegs grösser als bronzezeitliche Pfähledimensioniert sind. In einem Fall (Nr. 243) ist der Quer-schnitt mehrseitig bearbeitet und auch die Kantenlänge istkleiner als üblich. Hier dürfte man sich schon im unterenSpitzenbereich des Pfahllochs befinden. Die Verfüllungenwurden teilweise ausgenommen, oder es wurde mittels einerEisenstange sondiert (Kriterium: Materialwiderstand), um dieSpitze der Pfahllöcher ungefähr abschätzen zu können. Inallen Fällen dürften die Pfähle ursprünglich unter die Kote402,00 m ü.M. eingerammt worden sein (Abb. 13). Die weni-gen immer noch bestehenden Lücken im ansonsten rechtregelhaften Rund sind vielleicht darauf zurückzuführen, dasseinzelne Pfähle weniger tief als der aktuelle Seegrund (um402,30 m ü.M.) eingerammt worden waren.
2.2.4 Dendrochronologische Datierung36
Von den neun geborgenen Hölzern konnten sechs in einerMittelkurve zusammengefasst werden. Interessanterweise er-gaben sich sowohl optisch wie rechnerisch zwei beinahegleichwertige Möglichkeiten, nämlich einerseits für die Spät-bronzezeit wie andererseits für die römische Epoche. Ob-wohl auf Grund der grossen Querschnitte eine prähistorische
Ohne Kontext– Fünf gezogene, im Umfeld des Grundrisses liegende Bau-
hölzer (137, 141, 189, 234, 235).
Die annähernd kreisrunde Struktur von etwa 6,9–7,3 m Dm.war während der Oberflächenaufnahme nicht sofort ersicht-lich. Als Erstes fielen natürlich die in situ erhaltenen Eichen-pfähle auf, weil sie wenig über den Seegrund ragten. Einigeverfüllte Pfahllöcher konnten ebenfalls schon dokumentiertwerden, weil sie sich dank dunklerem Verfüllmaterial gut vonder umliegenden hellen Seekreide abhoben. Damit war dieungefähre Struktur der Anlage zwar klar, es verblieben aberdoch noch einige Lücken. Deshalb wurde am Schluss derAktion noch einmal der gesamte Seegrund an dieser Stellegründlich abgewedelt und untersucht, teilweise wurden auchkleine Schnitte angelegt. Damit sollte sichergestellt werden,dass sich farblich nicht von der Umgebung abhebendePfahllöcher nicht übersehen worden waren. Es gelang aufdiese Weise tatsächlich der Nachweis weiterer Strukturen, diesich allerdings bloss auf Grund der unterschiedlichen Härtegleichfarbiger Seekreiden nachweisen liessen (Abb. 9, Pfos-tenlöcher).
2.2.2 Die erhaltenen Bauhölzer
Auf der untersuchten Fläche wurden neben noch im Bodensteckenden Pfahlspitzen (Abb. 9, Eichenpfahl; Abb. 10–11)überdies fünf weitere im Faulschlamm liegende Eichenhöl-zer dokumentiert (Abb. 9, liegendes Eichenholz; Abb. 12).In drei Fällen handelt es sich zweifelsfrei um gezogene Pfahl-spitzen: Der längste Pfahl mass noch 276 cm (Nr. 189), einanderer 143 cm (Nr. 137), der dritte noch gut 80 cm (Nr. 141).Ein weiteres Eichenholz mit rechteckigem Querschnitt(12 × 17 cm) ist derart stark erodiert, so dass es nicht weiterbestimmbar ist (Nr. 235). Ein weiteres rundum und an den
253
Abb. 10. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Reste einer bereits be-probten und nun ganz frei gelegten römischen Pfahlspitze im sterilenSeekreideboden.
a b
148
cm
Abb. 11. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Umzeichnungen der in situ erhaltenen römischen Pfahlspitzen. a Pfahlspitze 119; b. Pfahlspitze 157. M. 1:20.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 253
254
a b c
Abb. 12. Zürich. Riesbach.Grosser Hafner. Umzeich-nung von am Seegrundliegenden römischen Höl-zern. a Pfahlspitze 189; b Pfahlspitze 137; c Pfahl-abschnitt mit Kerbe 234.M. 1:20.
Abb. 13. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Zeichnerische Zusammenfassung der vorgefundenen Situation mit den in der Regel wenig tiefenBaggergräbchen, den Pfählen in situ (119, 157) sowie den unterschiedlich tief vorhandenen, verfüllten Pfahllöchern des Rundbaus.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 254
erhaltenen 17 Stützen jene in den grösseren Lücken – eswären dies deren 738, so ergibt sich eine Mindestzahl von 24.Der kleinste Abstand (mit Korrektur) beträgt 60 cm – kleinerwird er sicher nicht gewesen sein. Mit diesem Abstand wären26 Stützen zu erwarten. Die Zahl der Stützen muss alsozwischen 24 und 26 liegen. Rekonstruktionsversuche mitdiesen Pfahlzahlen blieben insgesamt aber unbefriedigend,da sich nur eine teilweise Deckung mit den rekonstruiertenStellungen der Stützen ergab – am besten ist noch dieErgänzung mit 24 Pfählen.
Mit dem erhaltenen Niveau befinden wir uns sicher imFundamentbereich. Dies geht nicht nur daraus hervor, dassdie Pfähle auf dieser Höhe nur noch maximal 1 m in denGrund reichen39 – sicher zu wenig, um den Bau sicher zuverankern –, sondern auch daraus, dass das Bodenniveau desGebäudes nicht mehr vorhanden war und stattdessen dieSeekreide des Untergrunds sichtbar ist.
Es ist wohl nicht davon auszugehen, dass die Pfähle nurbis zur Oberfläche der einstigen Insel gereicht haben unddarauf ein andersartiger Aufbau ruhte – mit anderen Worten,die massiven Eichenpfähle nur zur Verankerung des Ge-bäudes im Untergrund dienten. Denn in diesem Fall wärenwohl im Innern des Gebäudes weitere Ständer zur Stabili-sierung des Untergrunds angebracht worden, im Sinne einesPfahlrosts. Es ist eher davon auszugehen, dass die Pfähle, dietief in den Untergrund gerammt wurden, auch das Gerüstdes Oberbaus bildeten. Damit müssten die Eichenpfähle 8,wenn nicht sogar 9 m lang gewesen sein40.
Wie aber sah dieser Oberbau aus? Man darf vermuten,dass die Pfähle des Rundbaus mit Wänden aus vergängli-chem Material – Flechtwerk mit Lehmverstrich, Bohlenwän-de oder dergleichen – miteinander verbunden waren. Einhölzernes Gebäude war auf Seesedimenten sicher optimalerals ein Steinbau. Für einen solchen ist die Fundamentierungin Form der erwähnten Eichenpfähle sicher zu schwach. Wiegross der Aufwand war, den man betrieb, um einen relativ
Datierung eher ausser Betracht fiel, wurden wegen derBedeutung des Befundes an drei Hölzern C14-Proben ent-nommen (Abb. 14). Die Ergebnisse erlauben nun eine ein-wandfreie Datierung der Mittelkurve 2364 (Abb. 15). Zweider darin integrierten Hölzer weisen eine sichere Waldkanteauf, die entsprechenden Bäume wurden 121 und 122 n.Chr.gefällt. Die Splintdaten der übrigen Proben gehören allerWahrscheinlichkeit nach zur selben Schlagphase.
2.2.5 Rekonstruktion des Baus
Der Kreis, den die Pfähle beschreiben, schliesst sich wieerwähnt nicht vollkommen – im Südwesten des Baus befin-det sich eine Lücke. Die teilweise tief greifenden neuzeitli-chen Baggereingriffe können nicht der Grund dafür sein, dadiese hier nicht besonders tief reichten. Es ist allerdingsdenkbar, dass die Pfähle an dieser Stelle nicht beobachtetwerden konnten, weil sich der aktuelle Seegrund unter demNiveau von einzelnen Pfahlspitzen befindet37, oder aber weilsich die Verfüllungen der Pfahllöcher kaum vom Umge-bungsmaterial abheben und daher unsichtbar blieben. Einzentraler Pfahl oder eine Grube im Zentrum des Baus konntetrotz gezielter Suche nicht gefunden werden.
Wie eingangs erwähnt, sind 17 Pfähle bzw. Pfahlnegativenachgewiesen. Ursprünglich waren es sicher mehr. DieAbstände messen heute zwischen 0,6 und 2,4 m. Legt mandie verschobenen Pfähle radial an den vermuteten Durch-messer von ca. 7 m, so variieren die Abstände zwischen 0,6und 2,25 m. Wichtig ist dabei, dass sich kein gemeinsamerNenner findet: die Pfähle 155, 157, 240, 241, 242 und 243,die vermutlich eine geschlossene Sequenz darstellen, weisenAbstände von 60, 75, 79 und 94 cm auf. Und auch die Pfähle119, 134 und 150–153 zeigen unterschiedliche Abstände (60,75, 86 und 90 cm). Solch grosse Unterschiede waren bei derBauausführung sicher nicht vorhanden. Zählt man zu den
255
���������� �� �������������� ����� ��������� ������ ������� �� !�"#Pfahl, Eiche, in situ 119 / 20081 Ringe 94–104 (= äusserste Sequenz Splint/Waldkante) ETH 24183 2005±50 BP 151 BC – 121 AD cal Pfahl, Eiche, ohne Kontext 189 / 20093 Ringe 9–19 (= innere, marknahe Sequenz) ETH 24184 1950±45 BP 40 BC – 196 AD cal Pfahlsplitter Eiche, in situ 134 / 20089 Ringe 9–19 (= Sequenz nicht lokalisierbar ) ETH 24185 2060±45 BP 176 BC – 55 AD cal
50 10044 69 20100.0 240
20 84 20097.0 23518 98 20096.0 234
21 9 18 20093.0 18910 4 20 20092.0 157
18 9 21 20081.0 11924 99 22 20099.0 141
10 22 2364.0 Mittelkurve
0
Abb. 14. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Zusammenstellung der C14-Daten.
Abb. 15. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Balkendiagramm aller datierten römischen Pfahlproben in MK 2364 (mit Angabe des jeweiligenEndjahrs, der Labor-Nr. und der Holz-Nr.).
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 255
ebenfalls wenig wahrscheinlich. Wohnbauten konnten in rö-mischer Zeit zwar ausnahmsweise rund sein44 – eine solcheInterpretation kommt aber auf Grund der Lage wohl eben-falls kaum in Frage. Hingegen sind Heiligtümer in Rundformsowohl im gallorömischen als auch im mediterranen Umfelddurchaus geläufig, auch wenn sie gegenüber den Rechteck-bauten in der Minderzahl sind (s. S. 257f.).
Das beste Argument für eine Interpretation als Tempelliefern die Funde, allem voran die grosse Zahl an Münzen(s. unten S. 263). Aus den Tauchgrabungen von 1998, 2000und 2001 stammen 46 Münzen. Bei 40 weiteren Stückenhandelt es sich um Altfunde. Es sind also insgesamt 86 Mün-zen mit Herkunft «Grosser Hafner» bekannt. Eine solch ho-he Zahl an Münzen ist ein deutlicher Hinweis auf ein gallo-römisches Heiligtum45. Hinzu kommen drei Exemplare, beiwelchen die Zuweisung nicht ganz klar ist (Kat. 136–138).
Das Fragment eines Räucherkelchs (Abb. 22; Kat. 23) un-termauert diese Interpretation, auch wenn solche Gefässenicht nur in Heiligtümern46 vorkommen. Auch in Gräbernsind sie vielfach belegt. Eine allgemeine Sitte, Räucherkelcheim Grabritus zu verwenden, scheint es allerdings nicht ge-geben zu haben47. Da solche Gefässe auch in Wohnhäuserngefunden werden48, sind Räucherkelche zwar ein Indikatorfür kultische Handlungen, nicht aber ein eigentlicher Beweisfür ein Heiligtum. Wir können daraus jedoch folgern, dassder Rundbau auf dem Grossen Hafner für kultische Hand-lungen verwendet wurde. Da ein Wohnbau und ein Grabmalwohl auszuschliessen sind, unterstützt dieser Fund die Inter-pretation als Heiligtum.
Dafür spricht vermutlich auch der Eisenstift mit abgeflach-tem, rhombenförmigem Ende (Abb. 17; Kat. 139), welchermöglicherweise als Teil einer Miniaturwaffe angesprochenwerden kann. Vergleichbar ist etwa eine kleine, 15 cm langeBronzelanze aus Baâlons-Bouvellement (F), die sich zusam-men mit anderen Miniaturwaffen aus Eisen und Bronzefand49.
Ob auch ein kleines Votivbeilchen dem Grossen Hafnerzugeordnet werden kann, ist leider nicht mehr zweifelsfreizu entscheiden. R. Forrer, der das Stück erwähnt, meint, dasses vermutlich in der Limmat bei der Gemüsebrücke gefun-
sicheren Baugrund für ein Steingebäude zu erhalten, kannman etwa beim vermeintlichen Tempel von Hüttenböschen(Mollis, GL) ersehen. Dort ruht eine «Fundamentplatte» aufeinem eigentlichen Pfahlrost, der als Anker diente.
Zwar wurden im untersuchten Bereich hunderte von römi-schen Flach- und Rundziegelfragmenten geborgen. Ob dieFlachziegel jedoch geeignet waren, einen Rundbau ohneallzu grossen Aufwand überhaupt zu decken, muss dochstark angezweifelt werden. Das Decken eines Rundbaus istwohl nur mit grossem Aufwand bei der Produktion dieserArt Ziegel denkbar. Da das Abfliessen des Meteorwassers nurgarantiert war, wenn die Fugen zweier nebeneinander liegen-der Flachziegel nach oben und unten in einer Flucht liegen– und nicht versetzt zueinander –, müsste jede Reihe vonFlachziegeln unterschiedlich breit sein; die untersten ambreitesten, die obersten am schmalsten, so dass die letzteLage an der Spitze sogar dreieckig wäre. Ob dieser enormeAufwand betrieben wurde, darf bezweifelt werden, da es sichum eigentliche Massanfertigungen handeln würde41. Einfa-cher wäre es, einen Rundbau – oder auch eine halbkreisför-mige Apsis – mit gegeneinander gestellten Rundziegeln zudecken, wie man es im Mittelmeergebiet teilweise heutenoch macht, doch sind die aufgefundenen Fragmente vonRundziegeln dafür zu gering. Der Rundbau war dahervermutlich mit vergänglichem Material gedeckt42.
2.2.6 Der Rundbau – ein Heiligtum?
Die Funktion des Rundbaus lässt sich über eine Kombina-tion von Form, Lage (Abb. 16) und Funden mit einiger Si-cherheit bestimmen. Die runde Form schränkt die Verwen-dungsmöglichkeiten bereits deutlich ein. Denkbar wäre etwaein Brunnen, ein Mausoleum, ein Siegesdenkmal, oder aberein hölzerner Wacht- oder Leuchtturm43, der den Schiffernden Weg in den sicheren Hafen wies.
Die Insellage macht einen Brunnen von vornherein sinn-los, ausserdem müsste in diesem Fall der Brunnenschachtgefunden worden sein. Die anderen Möglichkeiten könnenzwar nicht gänzlich ausgeschlossen werden, sind jedoch
256
Abb. 16. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Die Lage des römischenRundbaus wurde mit Hilfe von gelben Bojen an die Wasser-oberfläche hinauf projiziert. Im Hintergrund, ungefähr dort, wo sichdie Kirchtürme in der Altstadt abzeichnen, befand sich der römischeVicus Turicum.
Abb. 17. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Teil einer eisernenMiniaturlanze? (Kat. 139).
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 256
Moûtiers [F], Sablé [F] und Pfünz [D]) – manchmal miteiner Vorhalle versehen (Barzan, Beaumont-le-Roger, Péri-gueux, Tours [alle F]). Eine Abweichung von diesem Grund-schema zeigt etwa der Rundtempel von Montreuil-Bellay (F).
Eine ganze Reihe von Beispielen zeigt eine runde Cella ineinem rechteckigen oder polygonalen Umgang (Allonnes-La Tour aux Fées [F], Saint-Gervais [F] etc.). Der rundeCellaraum des Tempels von Aurillac (F)57 ist aussen alsPolygon mit 16 Ecken gestaltet, die mit den 16 Säulen imUmgang korrespondieren. Und auch der Umgangstempelvon Champallement (F)58 zeigt eine Cella, deren Innenwandrund ist, während die Aussenwand wie der Umgang alsOktogon gebildet ist. Daneben finden sich nach I. Fauduetfünf Rundtempel, die ohne Umgang geblieben sind, und andessen Stelle eine Einfriedung die Cella umgibt59.
Dass beim Rundtempel auf dem Grossen Hafner keinUmgang gefunden wurde, muss nicht zwingend heissen, dassdie Anlage keinen solchen besass. Es ist durchaus möglich,dass die Pfähle, die den Umgang trugen, weniger tief ein-gerammt waren als die Stützen der Cella, so dass sie auf demangetroffenen Niveau gar nicht mehr vorhanden waren.
Falls die Cella mit einem Umgang umgeben war, lässt sichdessen Grösse nicht mehr rekonstruieren, da der Cella-Durchmesser in keinem festgelegten Verhältnis zur Breite desUmgangs steht. In Craon etwa verhält sich der Cella-Durchmesser zu Weite des Umgangs wie 1:3,7, in Moûtierswie 1:1,6. Es zeigt sich allerdings, dass die Weite desUmgangs bei weiträumigen Cellen in der Regel kaum grösserwird als bei Bauten mit kleiner Cella. Nimmt man dieBauten von Faye l’Abbesse und Moûtiers, die mit ihren 6,5bzw. 6,4 m Innendurchmesser der Cella nur unwesentlichkleiner sind als jener vom Grossen Hafner, so ergäbe sich fürunseren Bau ein Umgangsdurchmesser von 12–15 m60.
Natürlich konnte die Cella auch von einem rechteckigenoder polygonalen Umgang umgeben sein. Auszuschliessenist ebenso wenig, dass die runde Cella ohne Umgang ineinem Temenos eingebettet war, wie dies etwa in Entrains (F)oder Hayling Island (GB) (Abb. 18) beobachtet wurde61.
Die oben erläuterte Bandbreite (S. 257), in welcher gallo-römische Rundbauten vorkommen, und der insgesamtschlechte Erhaltungszustand des Gebäudes auf dem Grossen
den wurde50. Er beruft sich dabei auf die Erstpublikation51,dessen Autor J. Rubli das Beilchen in den 1880er-Jahreneinem Arbeiter abgekauft habe, der dieses während der Ar-beiten beim Umbau der Rathausbrücke gefunden habe. DasStück wurde gemäss den Untersuchungen Forrers später demSchweizerischen Landesmuseum geschenkt, wo das Originalmit «Grosser Hafner» beschriftet wurde. Wie sich der Wech-sel des Fundorts vollzogen hat, konnte bereits Forrer nichtmehr erklären. Aus diesem Grund muss der Herkunftsort desBeilchens letztlich leider offen bleiben. Solche Votivbeilchensind jedenfalls in Heiligtümern recht häufig deponiertworden.
Die restlichen Objekte aus dem Umfeld des Rundbaussind nicht aussagekräftig, da sie sowohl im profanen als auchim sakralen Bereich vorkommen können52. Es handelt sichdabei um Terra Sigillata, Glanztongefässe, Reibschüsseln,Krüge, Amphoren, Töpfe – alles Gefässgattungen, die auchsonst für gallorömische Heiligtümer gestiftet wurden. Amhäufigsten sind auf dem Grossen Hafner Wandscherben vongeschlossenen helltonigen Gefässen, vermutlich meist Krü-gen, die sich zeitlich nicht genauer einordnen lassen. Unsi-cher ist die Deutung eines kleinen orangetonigen Fragments,das entweder als Bruchstück einer Lampe (Kat. 48) oder aberals verwaschener Ziegelsplitter anzusprechen ist. Hinzu kom-men diverse Metallfunde, vor allem Nägel, sowie ein ver-mutlich römisches Glasfragment.
Die Funde, die beim Heiligtum auf dem Grossen Hafnergefunden wurden, bewegen sich im Rahmen des Üblichen,ohne dass jedoch jede Gattung überall und in gleich grosserZahl belegt wäre. Dies beweist einmal mehr, dass die Votivenicht «standardisiert» waren. Was im Heiligtum auf demGrossen Hafner nicht vorkommt, sind beispielsweise Minia-turgefässe, Tonrundel und Metallrädchen. Ob sich Knochenvon Opfertieren oder Opfermahlzeiten im Wasser nichterhalten haben, muss unbeantwortet bleiben. Doch kommendiese Gattungen nicht in jedem Heiligtum immer und ingleich grosser Zahl vor.
Stellvertretend für die Funde aus gallorömischen Tempelnin der Schweiz seien hier jene aus dem Umgangstempel vonder Insel Ufenau kurz erwähnt. Dort fanden sich neben TS-und Glanztongefässen Kochgeschirr und Reibschüsseln. AnEisengeräten sind dort eine Pfeilspitze und eine Scherenachgewiesen53.
Der Eingang ins Gebäude befand sich möglicherweise imOsten. Dass der Eingang hier, gegen das rechte Zürichseeuferhin, lag, kann zwar nicht bewiesen werden, doch scheint dieMehrzahl der gallorömischen Umgangstempel nach Osten(bzw. Südosten und Nordosten) hin orientiert gewesen zusein; nach Westen ausgerichtete Bauten bleiben dagegenvereinzelt54. Ob der Zugang zwei Joch breit war, muss un-beantwortet bleiben. Im Osten des Gebäudes ist zwischenStütze 119 und 146 jedenfalls eine Lücke auszumachen.
2.2.7 Der Rundtempel als gallorömische Bauform
Es soll hier nicht der Versuch unternommen werden, dieUmgangstempel mit rundem Grundriss aufzuarbeiten. Diesist im Rahmen von umfassenden Untersuchungen zu dengallorömischen Tempeln bereits mehrfach geschehen55. Hiersoll nur darauf hingewiesen werden, dass der Rundtempel,der deutlich seltener anzutreffen ist als sein rechteckiger Ver-wandter, in verschiedenen Ausbildungen auftritt56. Es sindzu nennen die Beispiele mit runder Cella und rundemUmgang (so etwa Craon [F], Crozon [F], Faye-l’Abbesse [F],
257
Abb. 18. Rekonstruktion der beiden Heiligtümer von Hayling Island(GB). Links das eisenzeitliche Heiligtum (1. Hälfte 1. Jh. v.Chr. bis60 n.Chr.), rechts jenes aus der frühen Kaiserzeit. Die beiden Bautenweisen keinen Umgang auf, dafür eine Umfassung.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 257
Lage an und auf der Strasse vor allem auch durch dieEinbeziehung des Findlings, den das Fundament umgibt,erschlossen. Kultsteine sind auch sonst in gallorömischenTempeln belegt, so etwa in Triguères (F), wo von einem«triple menhir» die Rede ist66. Die Errichtung des Baus ander Storchengasse 8–13 wird vermutungsweise in die zweiteHälfte des 1. Jh. datiert. Die Münzen reichen dort vom 1. bis ins frühe 4. Jh.
2.2.8 Gallorömische Tempel in Insel- bzw. Halbinsellage
Die Lage, die Bauform und vor allem einige spezielle Fundebzw. Fundgattungen deuten, wie oben (S. 256f.) gezeigt, aufein Heiligtum auf dem Grossen Hafner hin. Die Lage istnicht einzigartig – in der Schweiz lassen sich mehrere mehroder weniger sicher als gallorömische Heiligtümer anzuspre-chende Gebäude auf einer Insel bzw. Halbinsel anführen.Eine der besten Parallelen bietet der gallorömische Tempelauf der Insel Ufenau SZ, ebenfalls im Zürichsee gelegen67.Ein Tempel wurde hier bereits von F. Keller vermutet, docherst 1958 durch eine Ausgrabung nachgewiesen. Die Fund-stelle liegt im Westen der Insel unter der Kirche St. Peter undPaul. Die Cella misst aussen 7,3 × 7,3 m, der Umgang aussen17,9 × 17,9 m, d.h. 60 römische Fuss. Die Gottheit, die hierverehrt wurde, ist nicht bekannt, doch denkt B. Frei an Kauf-leute und Schiffer als Stifter, die sich gegen die «Tücken desSees» schützen wollten.
Daneben gibt es den bereits erwähnten Umgangstempelin Hüttenböschen (Mollis, GL), dessen Deutung als Um-gangstempel allerdings nicht als gesichert gelten darf68. Dieheute 1,5 m hohe Erhebung von etwa 50 m Dm. – etwa100 m vom Westende des Walensees entfernt – war in römi-scher Zeit eine Art Halbinsel, deren Verbindung mit demLand bei Hochwasser überschwemmt war69. Die Ausgrabun-gen aus den Jahren 1961–64 förderten eine «Fundamentplat-te» zu Tage. Diese bestand aus Kalksteinen und einzelnenNagelfluhbrocken, die sehr dicht und mit Mörtel gebundenwaren. Dieses Fundament, das klare Fluchten aufweist und12 × 13,5 m misst, ruhte offensichtlich in seiner ganzen Aus-dehnung auf einer Pfählung. 1961 waren davon im Nordendes Gebäudes vier Eichenholzpfähle beobachtet worden, diemindestens 2 m in den Sand hinunterreichten. An mehrerenStellen wurde nach aussen gestürztes Mauerwerk gefunden –das Gebäude war also offensichtlich aus Stein erbaut.
Im Gebiet um das Gebäude herum wurde eine Konzen-tration von Flach- und Rundziegeln festgestellt, die vomDach stammen müssen. Die Ausgräber F. Legler und R. Laur-Belart vermuten, dass sich auf der Fundamentplatte die Cellaund der Umgang eines gallorömischen Tempels befundenhaben. Auch wenn die Deutung – «eine Lände [Landestelle]als auch eine kleine Villa fallen wegen der Lage imÜberschwemmungsgebiet ausser Betracht» – nicht überzeugt,so kann es sich durchaus um ein solches Heiligtum handeln.Der Untergrund wurde offensichtlich mit dem Pfahlrostverstärkt, damit ein Absinken des Fundaments verhindertwerden sollte. Laur-Belart vermutete, dass der Bau wegen derÜberschwemmungsgefahr auf einem hohen Podium ruhte,das mindestens 1 m hoch war, eher jedoch 2 m.
An Funden wurden ausser etwas Eisen und dem Fragmenteines Lavez-Bechers aus dem 4. Jh. etwa 100 Knochen undKnochenbruchstücke gefunden70. Hinzu kommen zweischon im 19. Jh. entdeckte Münzen des Traian und desHadrian, sowie das Randfragment eines TS-Tellers Drag. 18aus dem 2. Jh. Der Bau wurde von Laur-Belart auf Grund
Hafner machen eine detaillierte Rekonstruktion unmöglich.Was sich einzig sagen lässt, ist, dass es sich bei diesemRundbau um die Cella eines gallorömischen Heiligtums mitetwa 7 m Dm. handelt, dessen (24?) Eichenstützen mitWänden aus vergänglichem Material geschlossen wurden.Der Zugang wird sich, wie bei den meisten gallorömischenTempeln, im Osten befunden haben.
Interessant ist, dass der Bau auf dem Grossen Hafner,obwohl in hadrianischer Zeit angelegt, aus Holz und nichtaus Stein errichtet wurde. Der überwiegende Teil der vonI. Fauduet untersuchten gallorömischen Tempel aus jenerZeit waren in Stein ausgeführt worden – nur wenige hingegenin Leichtbauweise. Letztere seien mit wenigen Ausnahmennur einfache Tempel ohne Umgang und Gebäude, die vordem 2. Jh. entstanden waren62. Es lassen sich dabei verschie-dene Kombinationen beobachten: Lehmmauer für Umgang,Holz für Cella; Umgang aus Stein mit Cella aus Lehm; ge-mauerte Cella mit hölzernem Umgang. Es kam aber häufigervor, dass die Cella solider gebaut wurde als der Umgang.
Es lässt sich generell feststellen, dass die Cella ab der Mittedes 1. Jh. meist aus Stein errichtet wurde63. Weshalb derTempel beim Grossen Hafner nicht auch aus Stein gebautwurde, kann nur vermutet werden. Das beste Argument,welches oben bereits angeführt wurde (S. 255f.), ist der wenigfeste Untergrund, der einen massiven Steinbau nur mit eineraufwändigen Fundamentierung wie in Hüttenböschen sichergetragen haben würde.
In der Schweiz sind runde Kultbauten aus römischer Zeitbisher nur selten belegt. Zu nennen ist hier der Rundtempelaus Avenches, Avenue Jomini 12–14 (Abb. 19), der 1992 ent-deckt wurde und ins 1. Jh. n.Chr. datiert64.
Als Rundtempel anzusprechen ist auch das Steingebäudean der Storchengasse 8–1365 in der Altstadt von Zürich. DerRundbau mit knapp 4 m Innendurchmesser ist aus kleinenquaderförmigen Steinen mit Fugenstrich erbaut. Im und umden Bau fanden sich 70 Münzen, im Turicum-Heft (Schnei-der/Gutscher 1980) ist sogar von gegen 100 die Rede. DieDeutung als Kultbau wird ausser den Münzfunden sowie der
258
Abb. 19. Der Rundtempel in Avenches, Avenue Jomini 12–14, ausdem 1. Jh. n.Chr.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 258
Bauten: Die Cella hätte einen Innendurchmesser von knapp50 m, der Umgang gar von über 63 m. Dies ist ganz und garunwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass die Fundamente desinnersten und des zweiten Mauerkreises deutlich mächtigersind als die anderen beiden – die hohen, tragenden Mauernmüssen also auf den inneren beiden Fundamenten geruhthaben.
Zwar finden sich andere ineinander geschachtelte Bautenmit mehr als zwei Mauerringen, beispielsweise der quadra-tische Bau von Champigny-les-Langres (F)79, wo die beidenMauerzüge im Umgang als Unterlage für die Weihegabeninterpretiert werden80, doch wird dadurch das Problem derenormen Grösse von Umgang und Cella nicht gelöst.
In Frage käme nur noch, und dies ist meiner Ansicht nach– bei der Deutung als Rundtempel – die wahrscheinlichsteAnnahme, dass der äusserste Mauerkreis nicht eine aufge-hende Mauer trug, sondern der Terrassierung diente, was beider Lage des Gebäudes auf einer von Überschwemmungengefährdeten Insel nicht ganz unwahrscheinlich ist. Stehlinhatte bei seiner Rekonstruktion als Mausoleum in die glei-che Richtung argumentiert (Abb. 20). Damit wäre der dritteMauerring als niedrige Temenos-Mauer anzusprechen undder zweitinnerste und der innerste Ring als Umgangs- bzw.Cellamauer zu interpretieren. Damit wäre der leider längstzerstörte Rundbau mitten im Rhein um eine Interpretationreicher.
Ob auch auf der Wasserkirchen-Insel in der Limmat inZürich eine kleine Kultanlage lag, «wie römische Fundeunterschiedlicher Zeitstellung deutlich machten»81, mussschliesslich gänzlich blosse Hypothese bleiben.
2.2.9 Verehrte Gottheit
Da sich das Heiligtum nicht direkt am Landweg, der zumVicus führte, befand, lässt vermuten, dass es sich beim römi-schen Rundbau beim Grossen Hafner nicht um ein eigentli-ches «Vicus-Heiligtum» handelt, sondern dass dieses viel-mehr mit dem Wasserweg zusammenhängt. Die Strasse, diedurch den Vicus führte, hat vermutlich nichts mit dem Hei-ligtum zu tun. Die Lage auf einer Insel ist als «Weg-Heilig-tum» wenig geeignet, da dieses nicht direkt erreichbar war.Ein Steg, welcher das Ufer direkt mit dem Heiligtum ver-band, kommt wegen der recht grossen Wassertiefe zwischendem Ufer und der Insel nicht in Frage. Der Besucher hättealso mit einem Boot übersetzen müssen. Da ein solcher«Fährdienst» kaum wahrscheinlich ist, kann wohl ausge-schlossen werden, dass es sich um ein zum Landweg gehöri-ges Heiligtum handelte. Viel wahrscheinlicher ist hingegen,
der Ziegel in die Zeit zwischen 50 und 150 n.Chr. datiert,was allerdings zu überprüfen wäre. Sowohl der Tempel vonHüttenböschen als auch jener von der Ufenau liegen, wieschon Laur-Belart bemerkte, an der Walenseeroute, die vonAugst über Zürich nach Chur und dann weiter über denJulierpass nach Italien führte.
Den Zweck dieser beiden Umgangstempel beschreibtLaur-Belart dahingehend, dass auf den Seen die «Reisenden(…) bei Sturm und Gewitter mit mancherlei Gefahren»bedroht wurden, weshalb sie sich «unter den besonderenSchutz der gallorömischen Götter» stellten71. «Dem Reisen-den, der in Walenstadt das Schiff bestieg, diente er [derTempel von Hüttenböschen] als winkendes Ziel und alströstliche Hoffnung, dass der Schrecken der Gebirgsweltendgültig überwunden seien. Wer umgekehrt nach Südenzog, der schloss hier mit der Gottheit durch ein sanftes Opfereine Reiseversicherung pro itu et reditu ab», so Laur-Belart.
Ein weiteres Heiligtum auf einer (Halb-)Insel befindet sichauf der Petersinsel im Bielersee72. Hier befinden sich südlichdes Klostergebäudes Mauern von drei Tempeln, die auf die«Existenz eines ausgedehnten Sakralbereichs» hindeuten.Drack/Fellmann halten diese Bauten für einheimische Tem-pel. Man könnte sich vielleicht eine Anlage wie in Studen/Petinesca BE vorstellen.
Schliesslich sei hier auf den zerstörten Rundbau im Rheinbei Augst hingewiesen, dessen Deutung wenig klar ist. Leiderist von diesem Gebäude auf einer ehemaligen Rheininselnichts mehr vorhanden – die letzten Reste sind zu Beginndes 19. Jh. weggespült worden. Eine Untersuchung der Resteim Jahr 1750 durch D. Bruckner und E. Büchel ergab, dassder Rundbau im äussersten Mauerkreis einen Durchmesservon etwa 65 m (200 französische Schuh) aufwies73. Offenbarkonnten in dieser Zeit noch einige wenige «Ziegelstücker wiezu Augst» beobachtet werden. Stehlin lehnte die von Bruck-ner und anderen vorgeschlagene Deutung als Wehrturm ab,da er zu Recht bemerkte, dass die beiden äusseren Mauer-ringe eine viel geringere Dicke aufwiesen als die inneren (vonaussen nach innen: 3, 2,5, 6 und 7 Schuh, d.h. 0,975 m,0,8125 m, 1,95 m und 2,275 m)74. Stehlin gewann den Ein-druck, «als ob sie [die Mauern] von einem verhältnismässigniedrigen Umgange um das auf beiden inneren Ringen sicherhebende Hauptgebäude herrührten»75. Er kam zum Schluss,dass es sich um ein monumentales Grabmal handeln müsse(Abb. 20). Laur-Belart interpretierte den Bau hingegen alsSiegesmonument76.
Man kann sich nun fragen, ob es sich nicht auch um einenmonumentalen Umgangstempel gehandelt haben könnte.Die runde Form bereitet keine Schwierigkeiten, was für dieimmense Grösse und die vier konzentrischen Mauerkreisenicht gilt. Wenn wir den innersten Mauerring als Cellamaueransehen würden, hätte diese einen Innendurchmesser vonetwa 3,5 m. Der beispiellos breite Umgang würde aussendann einen Durchmesser von gut 34 m aufweisen77. DieAnlage würde somit zu den grössten ihrer Art gehören78. Wasaber haben die beiden äusseren Ringe dann für eine Funk-tion, wenn sie ausserhalb des eigentlichen Gebäudes liegen?Eine Mauer könnte man eventuell als relativ eng anliegendeTemenos-Mauer erklären; was aber wäre in diesem Fall derandere, äusserste Mauerring?
Wenn man umgekehrt den äussersten Mauerring alsUmfassungsmauer interpretiert und die zweite und dritte alsUmgangs- bzw. Cellamauer, so müsste der innerste Mauer-ring als Zentrum des Gebäudes angesehen werden. In diesemFall würde das Gebäude allerdings gigantische Ausmasseannehmen und wäre deutlich grösser als alle vergleichbaren
259
Abb. 20. Rekonstruktion des Rundbaus auf der Rheininsel bei Augst.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 259
bis auf Vespasian und Nerva zum Vorschein gekommenseien87. Forrer berichtete zu den Fundumständen88: «Bei denhier vorgenommenen Quaibauten wurden verschiedene Un-tiefen am Ausflusse des Zürichsees abgetragen und andern-orts als Auffüllungsmaterial verwendet. Bei diesem Anlassewurden durch die Baggermaschine mehrere Stellen, aufdenen früher Pfahlbauten gestanden, angebrochen und eineMenge von Pfahlbauartefakten gehoben – durch das sofor-tige Versenken an anderer Stelle aber der grösste Theil wie-der unerreichbar gemacht.» In diesem Zusammenhang wur-den auch die erwähnten römischen Münzen geborgen. For-rer hielt gleichzeitig fest, dass die römischen Funde beimGrossen Hafner wegen des Charakters und der Erhaltungnicht hierher geschwemmt worden sein können. Ausser denMünzen werden mehrfach Fragmente von Terra-Sigillata-Gefässen und römische Ziegel erwähnt, ausserdem das Frag-ment einer aus Ringen geflochtenen Kette. Auf das mögli-cherweise vom Grossen Hafner stammende Votivbeilchenwurde bereits oben bei der Interpretation des Baus einge-gangen (S. 256f.).
An Altfunden mit Herkunft «Grosser Hafner» lassen sichnur gerade drei Scherben anführen, die sich alle im Schwei-zerischen Landesmuseum befinden (Abb. 21)89: Es handeltsich dabei um zwei Randscherben von Schüsseln Drag. 37sowie um ein grautoniges Randfragment einer Knickwand-schüssel (TS-Imitation). Das Stück SLM-Nr. 3717.1 trägt dieAufschrift: ‹Gr. Hafner. Zürichsee; von Herrn R. Breitinger›und ist wohl mit einer Nachricht im 27. Bericht der Anti-quarischen Gesellschaft zu verbinden90. Die Schüssel SLM-Nr. 30030.1 ist mit der Aufschrift ‹Gr. Hafner. 1883/1884›versehen und wurde daher vermutlich während der von R. Forrer erwähnten Baggerarbeiten geborgen. Dasselbe giltwohl auch für SLM-Nr. 3717, das die Aufschrift ‹Zürichsee(Grosser Hafner)›, sowie den handschriftlichen Vermerk‹1883› trägt. Die Ziegelbruchstücke sowie die Kette sindleider unauffindbar.
Durch die Tauchgänge von 1998, 2000 und 2001 konntedas bisher geborgene Material deutlich vermehrt werden.Wie bereits erwähnt, wurden keinerlei Schichten angetroffen– alle Funde lagen frei gespült auf dem Seegrund, stammen
dass Personen, die auf Schiffen reisten, hier anlegten und dasHeiligtum besuchten.
Welche Gottheit wurde aber dort verehrt? King und Soffevermuten82, dass Rundbauten allgemein Mars geweiht waren.In Allonnes etwa, einem Bau mit runder Cella und quadra-tischem Umgang, fanden sich Waffen aus der Zeit vor derErrichtung des erhaltenen Gebäudes. Ebenso sind mehrereAltäre für Augustus und Mars Mullo erhalten. Mars Mullowird auch in einer Inschrift und Graffiti im Rundtempel vonCraon genannt. Die Basis für die Annahme, dass Rundbau-ten immer Mars geweiht waren, scheint mir jedoch zuschwach.
Wie eben gezeigt wurde, ist das Heiligtum vermutlich imZusammenhang mit der Benutzung der Wasserwegeaufgesucht worden. Man könnte an Schiffer und Kaufleutedenken, die als Dank für eine sichere Ankunft oder bei derAbfahrt aus dem Hafen eine Spende darbrachten. EineFunktion als Abwehr von allerlei Gefahren auf dem See hatteLaur-Belart bereits bei den Heiligtümern von der Ufenauund Hüttenböschen angenommen (s. S. 259). Es ist nichtunwahrscheinlich, dass es sich dabei um eine Gottheit han-delte, die den Wind und die Wellen des Sees zähmen konnte,eine, die den Weihenden auf der Reise begleiten oder ihnsicher zum Ziel führen sollte. Am nahe liegendsten sinddabei Neptun bzw. Merkur: Merkur fungiert unter anderemals Wegbegleiter, wird aber bekanntlich auch von den Händ-lern verehrt. Er ist in einer Vielzahl von Inschriften undfigürlichen Darstellungen83 überliefert, und wenn Caesarschreibt, dass Merkur bei den Galliern von allen Göttern derbeliebteste sei (bellum gallicum VI 17: Deum maximeMercurium colunt), so liegt er damit sicher nicht allzu falsch.Merkur kann damit als verehrte Gottheit im Heiligtum aufdem Grossen Hafner durchaus zutreffen.
In Frage käme natürlich auch Neptun, den unter anderemdie Schiffer in Lausanne verehrten84. Von diesen wurde ver-mutlich zusammen mit Neptun auch Merkur verehrt85. Auchwenn sowohl Merkur als auch Neptun in Frage kommen, soist doch Merkur wegen der allgemeinen Beliebtheit Neptunvorzuziehen. Denkbar wäre auch, dass beide Gottheiten ge-meinsam verehrt wurden.
2.3 Weitere römische Bautätigkeit auf dem Grossen Hafner
Anlässlich der verschiedenen Abschwimmaktionen in denvergangenen Wintern hat sich gezeigt, dass wohl auf derganzen Untiefe römische Einzelfunde erwartet werden kön-nen. Trotz der starken Erosion ist aber keine derart grosseFundverlagerung querbeet über die ganze Untiefe hinweganzunehmen. Es stellt sich somit die Frage, ob nicht nochweitere römische, womöglich zeitgleiche Gebäude auf demGrossen Hafner gestanden haben könnten. Die angetroffe-nen römischen Ziegelfragmente lassen kaum eine andereInterpretation zu (s. S. 256). Eine systematische Bestandes-aufnahme der ganzen Untiefe steht jedenfalls immer nochaus.
3 DIE RÖMISCHEN FUNDE86
Bereits im 19. Jh. wurde eine beachtliche Anzahl von römi-schen Funden beim Grossen Hafner geborgen. Es handeltsich in erster Linie um Münzen, die leider oft nicht genauerbestimmt wurden. Forrer erwähnt allerdings, dass beim Gros-sen Hafner Münzen aus der Zeit von Augustus, Tiberius etc.
260
Abb. 21. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Altfunde. Zwei Rand-scherben von Schüsseln Drag. 37 (SLM-Nr. 3717 und 3717.1) sowiedas Randfragment einer grautonigen Knickwandschüssel (SLM- Nr. 30030.1).
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 260
einfache T-förmige Pfeiler – möglicherweise mit tordiertemSchaft –, auf dem die Arkaden aufliegen, findet hierhingegen keinen Vergleich. Man darf das Fragment wohl indie erste Hälfte des 3. Jh. datieren.
Das andere Fragment einer Drag. 37-Schüssel (Kat. 3*)gehört möglicherweise zum gleichen Gefäss, sicher jedochzur gleichen Produktion. Kat. 4* schliesslich zeigt Glasschliffund gehört wohl zu einem Becher – diese Dekorationsartverweist auf das späte 2. und das 3. Jh. Die übrigen TS-Frag-mente sind klein fragmentiert und lassen keine Zuweisungzu.
Schwierig zuzuordnen, chronologisch jedoch besondersaussagekräftig ist Kat. 5 (Abb. 23). Die drei Randfragmentestammen vom gleichen Gefäss, auch wenn ihre Fundorteziemlich weit auseinander liegen96. Das Gefäss war einstvollständig mit einem orangebraunen, matten und nur dünnaufgetragenen Überzug versehen. Die Randbildung mit demvertikalen Kragen lässt keine Zweifel daran, dass sich dieseSchüssel an der TS-Form Drag. 43 orientiert, weshalb sievermutlich als TS-Imitation anzusprechen ist. Ob es sichdabei – wie beim TS-Vorbild – um eine Reibschüssel handelt,muss unbeantwortet bleiben, da die Wand unmittelbarunterhalb des Randes abgebrochen ist.
Das Randfragment Kat. 6 vertritt die gleiche Form, mussaber wegen dem etwas massiveren, breiteren Rand und demdunkelbraunen Überzug von einem zweiten Gefäss stam-men.
jedoch aus vor Ort gebildeten Schichten und können nichtdurch Umlagerungen im Uferbereich hierher gelangt sein91.Dagegen spricht nicht nur die Distanz zur Uferzone, sondernauch, dass zwischen dem Ufer und der Untiefe ein mehrereMeter tiefer Graben liegt, so dass Material nicht darüberhinweg auf die Untiefe gelangt sein kann. Wenn sich dieFunde überhaupt vom Ufer weg verlagert haben, dann sinddiese sicher im Graben liegen geblieben.
Will man für die Schlacken, Ofenkacheln, neuzeitlichenDachziegel und Bodenplatten sowie die Pfeifenfragmentenicht eine Verwendung vor Ort postulieren, so ist anzuneh-men, das sie auf dem Grossen Hafner planmässig entsorgtwurden – die Untiefe in der Neuzeit also als Abfallhaldebenutzt wurde.
Die im Folgenden besprochenen Funde stammen alle ausden Tauchgängen von 1998, 2000 und 200192.
3.1 Keramik
Vorausschickend sei bemerkt, dass ein kleiner Teil der Kera-mik Brandspuren aufweist. Das Erkennen derselben ist oftnicht einfach, da Ablagerungen aus dem Wasser sich oftnicht von Brandspuren unterscheiden lassen; zudem ist dieOberfläche von einem Grossteil der Scherben angegriffenund abgerieben.
Von den rund 230 Keramikfragmenten, die als römischerkannt wurden, stammen deren zehn von Terra-Sigillata-Gefässen – eine Boden- und neun Wandscherben (Kat. 1–4).Die Bodenscherbe Kat. 1 lässt sich der Form Drag. 18/31zuordnen. Die relative Dickwandigkeit des Stücks erlaubteine Datierung ins 2. oder 3. Jh.93
Zwei Wandscherben stammen von Schüsseln Drag. 37 undzeigen Reliefdekor (Kat. 2–3*)94. Dargestellt ist bei Kat. 2unter einem Arkadenboden ein nach links stehender Mannmit einem vorgestreckten Arm. Darüber findet sich ein Eier-stab mit links angelehnten, speziell langen Zwischenstäben,wobei der «Notenknopf» auf Höhe der Führungslinie liegt.Es handelt sich mit einiger Sicherheit um ein helvetischesStück. Der als Ringer gedeutete Mann95 ist in unserem Falljedoch nicht mit dem sonst üblichen Eierstab E 1 sondernmit E 2 kombiniert. Der Kreisbogen findet im Motiv KB 3ebenfalls eine gute Parallele bei helvetischen Stücken. Der
261
Abb. 22. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Fragment des Räucher-kelchs (Kat. 23).
Abb. 23. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Randfragmente einerSchüssel, vermutlich Imitation Drag. 43 (Kat. 5).
��������� ������ ��� ��������������Terra Sigillata 77 2,6 TS-Imitationen 228 7,8 Glanztonkeramik 172 5,9 Helltonige Gebrauchskeramik 1264 43,2 Grautonige Gebrauchskeramik 276 9,4 Grobkeramik 212 7,2 Reibschüsseln 292 10,0 Dolien 122 4,2 Amphoren 284 9,7 Lampen? 1 0,0 ������ ����� ������
Abb. 24. Zürich. Riesbach. Gewichtsverteilung der Keramik vomGrossen Hafner (1998, 2000, 2001, ohne Altfunde).
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 261
Schmidmatt (Kaiseraugst)104. Der Henkel unseres Stückssetzt oberhalb des maximalen Körperdurchmessers an, istjedoch vom (fehlenden) Rand noch weit entfernt. Randstän-dige Henkel, wie sie beispielsweise in Stutheien und Nieder-bieber auftreten105, sind nicht unbedingt ein Zeichen fürspäte Gefässe; in Buchs etwa sind sie um die Mitte des 3. Jh.noch weit vom Rand entfernt106.
Besonders interessant ist das Fragment einesRäucherkelchs (Kat. 23; Abb. 22). Auf die Bedeutung dieserGefässe wurde bereits oben eingegangen (S. 256). Der Wand-knick des Bruchstücks vom Grossen Hafner wird durch eineFingertupfenleiste akzentuiert. Auf dem darunter anschlies-senden, relativ steil ansteigenden Wandbereich findet sicheine vertikale Delle, ähnlich den Faltenbechern. Mit einemDurchmesser beim Wandknick von etwa 20 bis 21 cm, gehörtdas Stück vom Grossen Hafner zu den grössten seinerGattung107.
Die Gefässform kommt im frühen 1. Jh. auf, bleibtanfänglich auf militärische Kontexte beschränkt und wirderst in der mittleren Kaiserzeit auch in Zivilsiedlungenhäufiger. Während S. Martin-Kilcher108 die Ausladung desGefässes als Datierungsgrundlage nimmt, sieht T. Spitzingkeine Möglichkeit für eine zuverlässige Chronologie, womitsie Oelmann folgt109.
Die besten Parallelen für unser Stück finden sich inStraubing, wobei ähnlich steil ansteigende Räucherkelche110
Ende 1./2. Jh. bzw. 2./3. Jh. datiert werden. Die genauereDatierung dieses Stücks ist also nicht möglich.
Die grautonigen Fragmente innerhalb der Gebrauchskera-mik sind gegenüber den helltonigen deutlich in der Unter-zahl (Abb. 24). Das grautonige Bodenfragment Kat. 28*, dasaussen einen teilweise abgeriebenen, metallisch glänzendenÜberzug aufweist, stammt vermutlich von einem Schulter-topf. Die beiden grautonigen Wandscherben Kat. 29* und30* zeigen aussen ebenfalls eine schwarze, metallisch glän-zende Oberfläche sowie Rollstempeldekor. Ausserdem fin-den sich unterschiedlich breite, nur wenig eingetiefte, feineRillen. Sie dürften ebenfalls von Schultertöpfen stammen.Ähnliche Dekorelemente finden sich beispielsweise inDietikon111. Man kann die beiden Stücke wohl in die zweiteHälfte des 1. Jh. datieren. Das grautonige Schulterfragmentmit drei horizontalen Rillen auf der Schulter (Kat. 31*)stammt von einem Topf mit Trichterrand. Das Stück lässtsich nicht genauer einordnen, könnte aber noch ins 1. Jh.gehören112.
Der Grobkeramik lassen sich vier Fragmente zuweisen:Die Randscherbe eines grossen, grob gemagerten Koch-tellers, der vermutlich von Hand geformt und auf derScheibe überdreht wurde (Kat. 32), lässt sich vermutlich insmittlere 3. Jh. datieren113, doch sind ähnliche Formen auchaus dem 1. und 2. Jh. belegt114. Weiter sind zu nennen dasBodenfragment Kat. 34*, das von einem grob gemagerten,grautonigen Kochtopf stammt und dessen Zeitstellung offenbleibt, sowie die Wandscherbe Kat. 35*.
Das Bodenfragment einer pompejanisch roten Platte(Kat. 33) weist zwei niedrige, jeweils durch eine feine Rillegegliederte Standringe auf. Vom braunen Überzug sindinnen nur noch geringe Reste erhalten. Die Innenseite weistzwei feine konzentrische Rillen auf, der Bereich dazwischenist mit einem Ratterblechband verziert. Der braunbeige, starkglimmerhaltige Ton ist charakteristisch für mittelgallischeFabrikate115. Solche Stücke, mit identischem Dekor, findensich etwa in Avenches, wobei die Stücke dort kleiner sind –der Rand variiert im Durchmesser zwischen 13 und 34 cm;bei unserem Stück beträgt der erhaltene Durchmesser gegen
Die Datierung dieser beiden Schüsseln muss über die TS-Form erfolgen, die sicherlich als Vorbild gedient hat. DieForm Drag. 43 tritt im späten 2. Jh. auf und ist im letztenDrittel des 3. Jh. bereits kaum mehr vertreten97. Man wirdwohl nicht fehl gehen in der Annahme, die beiden Schüsseln(Kat. 5–6) ins 3. Jh., möglicherweise in dessen Mitte, zudatieren.
Der Glanztonkeramik sind 26 Bruchstücke zuzuweisen,davon nur gerade drei Randstücke, die allesamt von Bechernder Form Niederbieber 33 stammen (Kat. 7–9). Kat. 7 kannwegen seiner Dünnwandigkeit, dem hartem Brand und demschwarzen, dicken Überzug wohl als Import aus dem Rhein-land angesehen werden. Kat. 9 zeigt eine relativ lange undgerade Halspartie. Diese wird im Lauf der Zeit bekanntlichimmer höher. Ähnlich hohe Halspartien wie bei diesemStück sind bei Exemplaren des mittleren 3. Jh. vorhanden98,doch ist eine spätere Datierung nicht auszuschliessen.
Vier Bodenfragmente stammen von Bechern, ohne dassdie Form genauer bestimmt werden könnte. Und auch dieWandscherben lassen sich wegen der Kleinfragmentierungnicht genauer zuweisen. In der Mehrzahl scheint es sich aberum Becher zu handeln.
Der häufigste Dekor ist das Ratterblech, das sich auf sechsoder sieben Fragmenten findet (Kat. 10*–16*, evtl. Kat. 17*);bei Kat. 11*, 13* und 15* ist das Ratterblechband mit Faltenkombiniert99. In einem Fall ist Barbotinedekor in Blattformbelegt (Kat. 17*) und einmal Glasschliff (Kat. 18*).
Bei der helltonigen Gebrauchskeramik sind leider kaumRand- oder Bodenscherben erhalten. Die wenigen Stückelassen sich zudem bis auf einige Ausnahmen zeitlich nichtgenauer einordnen. Eine Datierung ins 3. Jh. liefert dieRandscherbe eines Honigtopfs (Kat. 19)100. Eine genauereEinordnung ist nicht möglich. Bei Kat. 20 handelt es sichvermutlich um einen Krug oder einen Topf, der sich zeitlichnicht genauer einordnen lässt, was auch für Kat. 22 gilt,dessen Wandung aussen durch mindestens drei horizontaleRillen gegliedert ist. Die Schüssel Kat. 21 kann ins 3. Jh.datiert werden101.
Die Bodenscherben Kat. 24* und 25* stammen vongeschlossenen Gefässen. Bei Kat. 24* handelt es sich umeinen Krug mit niedrigem Standring. Und auch bei Kat. 25*dürfte es sich um einen Krug handeln. Hier allerdings ist derauf der Unterseite flache, leicht eingezogene Fuss nur durcheine feine Rille von der Wandung abgesetzt102.
Die helltonigen Wandscherben lassen sich in der Regelnicht genauer zuweisen. Es handelt sich jedoch meist umScherben von geschlossenen Gefässen, wohl vor allem vonKrügen. In verschiedenen Fällen lassen sich mehrereScherben zu einzelnen Gefässen zusammenfassen, so etwaKat. 26*. Die Anzahl der Gefässe dürfte also deutlich tieferliegen als die Zahl der Wandfragmente.
Die Wandscherbe Kat. 27* mit ihrem vertikalen, zwei-stabigen Henkel ist als Teil eines Honigtopfs (urceus) zuinterpretieren. Unser Fragment zeigt einen lachsfarbenenTon mit einem dichten matten, orangen Überzug. SolcheÜberzüge scheinen bei den Honigtöpfen die Ausnahmedarzustellen103. Unterhalb des unteren Henkelansatzes findetsich eine umlaufende Rille, die durch den Ansatz etwasverdeckt wurde; eine im Bereich des oberen Ansatzesanzunehmende Rille wurde ganz überdeckt. Die zwei Rillenim Bereich der Henkelansätze sind durchaus üblich;bisweilen ist es nur eine, manchmal auch deren drei.
Honigtöpfe setzen in augusteischer Zeit ein, nehmen im2. Jh. zahlenmässig ab, sind jedoch noch im 3. Jh. vorhan-den, so etwa in Stutheien und im Geschirrdepot in der
262
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 262
Zusammensetzung der Alt- und Neufunde
Insgesamt sind bislang 89 Münzen belegt, die im Bereich desGrossen Hafners gefunden wurden (Kat. 50–138). 40 Ge-präge stammen aus Altfunden, 38 von ihnen werden heuteim Schweizerischen Landesmuseum aufbewahrt. Zwei Stückesind in die Sammlung des Münzkabinetts der Stadt Win-terthur integriert. Die Altfunde wurden in der Zeit zwischenden 1880er-Jahren und 1927 geborgen. Da sie bei Ausbag-gerarbeiten entdeckt wurden, war ihre Bergung eher zufällig.Daher liegen auch keinerlei Angaben zum genauen Fund-punkt vor. So ist bei einem Stück (Kat. 136) die Zuweisungunsicher. Zwei weitere Gepräge (Kat. 137 und 138) könnenentweder dem Grossen oder dem Kleinen Hafner zuge-schrieben werden.
Die Neufunde stammen aus Tauchgrabungen im Zürich-see der Jahre 1998–2001. 46 Prägungen konnten bislanggefunden und ihre Verteilung auf dem Seegrund dokumen-tiert werden (Abb. 25).
Die Kartierung zeigt, dass es Münzfunde inner- undausserhalb des römischen Rundtempels gab. Die gefundenenGepräge bilden scheinbar mehrere Gruppen. Ihre Zusam-mensetzung und Anhäufung ist aber auf Grund der voraus-gegangenen Aushubarbeiten eher zufällig.
Innerhalb der Zusammensetzung der Alt- und Neufundefällt beide Male der hohe Anteil an Imitationen auf (Abb.26a–b). Im Unterschied zu den Altfunden beinhalten dieNeufunde wesentlich mehr Prägungen, die ins 2. Jh. datieren.Diese späten Prägungen fehlen im Material der Altfundehingegen völlig.
Reguläre Prägungen
Um die Münzreihe in ihrer Zusammensetzung einzuordnen,soll sie mit weiteren Funden verglichen werden. Herangezo-gen werden die Fundmünzen aus Villeneuve-au-Châtelot,Augusta Raurica, Vindonissa und Hofheim.
Der Münzfund aus dem Heiligtum von Villeneuve-au-Châtelot122 wurde zu Beginn des ersten nachchristlichenJahrhunderts verborgen. Diese Datierung ergibt sich aus demFehlen von Prägungen der sog. zweiten Lyoner Altarserie.Der eigentliche Siedlungsbeginn von Augusta Raurica fällt indie Zeit um 15/10 v.Chr. Die Anwesenheit von Militär istmehrmals belegt. Das wohl früheste Lager fand sich in derheutigen Unterstadt von Kaiseraugst, wurde wohl in tiberi-scher Zeit errichtet und unter der Regierung des Claudiusoffen gelassen123. Die Anlage des Kleinen Tempels auf demSchönbühl fällt in augusteische Zeit. Der Grosse Tempel wur-de um die Mitte des 1. Jh. errichtet. Die Tempel 1 und 3 aufSichelen sind vorflavisch, der Tempel 2 ist in nachflavischerZeit erbaut worden124. Das Legionslager in Vindonissa wur-de in den Jahren 16/17 angelegt125. Die militärische Anlagevon Hofheim ist eine caliguläische Gründung der Jahre um40 n.Chr.126
Die Aes-Münzen der frühen Kaiserzeit beschränken sichauf relativ wenige Typen. Die zeitliche Einordnung dieserPrägungen, die in ihrer Legende meist keinen datierendenHinweis haben, erfolgt durch stilistische Vergleiche zu datier-ten Prägungen, Ergebnissen aus Metallanalysen und Münz-fundauswertungen.
Augusteische Prägungen. Die Münzen von Nemausus tragenauf der Vorderseite das Bild des Augustus und des Agrippamit der Legende IMP DIVI F. Auf der Rückseite findet sich
40 cm, ohne dass der Ansatz der Wand erkennbar wäre. Einegenaue Datierung ist nicht möglich; diese Platten scheinenjedoch in flavischer Zeit aufgekommen und bis ins 2. Jh.hergestellt worden zu sein116.
Von den insgesamt neun Fragmenten von Reibschüsseln(Kat. 36–44*) lassen sich die beiden Randscherben Kat. 36und 38* und die beiden Wandscherben Kat. 43* und 44*den rätischen Reibschüsseln zuordnen. Kat. 38*, dessenKragen aussen abgebrochen ist, dürfte – soweit es die starkeOberflächenzerstörung noch erkennen lässt – vom gleichenGefäss wie Kat. 36 stammen. Die rottonigen WandfragmenteKat. 43* und 44* sind möglicherweise ebenfalls zusammen-gehörig. Die rätischen Reibschüsseln, die im späten 2. Jh.einsetzen, kommen noch in Kontexten des 4. Jh. vor117. Einegenauere Datierung unserer Stücke ist nicht möglich. DieRandscherbe Kat. 39* lässt sich wie die WandscherbeKat. 42*, die wegen ihrer Körnung von einer beigetonigenReibschüssel stammen muss, nicht genauer zuweisen. Kat. 37stammt von einer beigetonigen Reibschüssel und könntenoch ins 1. Jh. gehören.
Möglicherweise kann auch ein orangebeiges Bodenfrag-ment mit flachem, nicht von der Wandung abgesetztem Fuss(Kat. 40*) als Reibschüssel angesprochen werden – eineKörnung scheint allerdings zu fehlen.
Die Wandscherbe Kat. 45* mit kantig ausgeprägter Schul-ter und zwei Rillen unmittelbar darunter, könnte von einemDolium stammen118. Auch wenn der graue Ton auf denersten Blick erstaunen mag, so sind doch andere Exemplaremit dieser Tonfarbe belegt119 Auch wenn die Schultergestal-tung keine genaue Parallele findet, so lassen sich doch einigeVergleiche anführen, vor allem aus Laufen-Müschhag120.Einige der Stücke werden dort auf Grund der typologischenVergleiche mit anderen Gefässgattungen ins späte 2. und3. Jh. datiert121. Nicht nur das Fehlen des Randes, auch dieChronologie der Dolien an sich macht es unmöglich, dasWandfragment vom Grossen Hafner genauer zu datieren –die Datierungsspanne reicht vom 1. bis ins 3. Jh.
Drei Wandscherben schliesslich stammen wegen ihrerDickwandigkeit und ihres sandigen Tons von Amphoren. Eshandelt sich dabei sicher um zwei verschiedene Gefässe(Kat. 46* und 47*). Während erstere wohl von einemÖlbehälter stammen (Dressel 20), gehört Kat. 47* zu einergrossen steilwandigen Wein- oder einer Fischsaucenamphore,ohne dass der Typ genauer bestimmt werden könnte.
3.2 Glas
Von den vier anlässlich der Tauchgrabungen gefundenenGlasfragmenten sind deren drei sicherlich neuzeitlich; dasvierte, ein Teil eines bandförmigen Henkels, ist vermutlich alsTeil eines grossen römischen Glasgefässes anzusehen (Kat. 49).
3.3 Metall
3.3.1 Die Münzen
Vorrangiges Ziel dieser Arbeit ist die vollständige Dokumen-tation aller im Bereich des Grossen Hafners gefundenenMünzen. In einem zweiten Schritt soll eine erste Auswertungvorgelegt werden.
263
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 263
Serie ist Augustus barhäuptig wiedergegeben, auf der zwei-ten trägt er einen Lorbeerkranz.
Für die Datierung der ersten und zweiten Serie von Ne-mausus kommt den Münzfunden aus dem Lager Oberadeneine wichtige Bedeutung zu. Es wurde im Jahre 11 v.Chr.erbaut und 8/7 v.Chr. offen gelassen128. Diese Datierung
ein Krokodil dargestellt, das mit einer Kette an einen Palm-baum gefesselt ist. Durch die Palme getrennt erscheint dieLegende COL NEM. K. Kraft unterteilte diese Münzen aufGrund von Unterschieden im Motiv und in der Legende indrei Serien127. Nur die ersten beiden Serien spielen im Münz-umlauf im Rheingebiet eine grössere Rolle. Auf der ersten
264
635 640 645 650 655 660
A
B
C
665
225
230
235
240
245
N
Abb. 25. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Kartierung der Münzen, die anlässlich der Tauchgrabungen 1998–2001 gefunden wurden.A: Prägungen Augustus bis Trajanus; B: Übergangszeit bis Claudius; C: Tiberius bis Mitte 3. Jh.
0
10
20
30
Übe
rgan
gsze
it
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Calig
ula
Clau
dius
Ner
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
n
Titu
s
Dom
itia
n
Trai
an
Had
rian
Mar
c A
urel
Com
mod
us
Gor
dian
us II
I.
Clau
dius
II.
Div
o Cl
audi
o
%
Reguläre Prägungen Imitationen
Übe
rgan
gsze
it
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Calig
ula
Clau
dius
Ner
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
n
Titu
s
Dom
itia
n
Trai
an
Had
rian
Mar
c A
urel
Com
mod
us
Gor
dian
us II
I.
Clau
dius
II.
Div
o Cl
audi
o
0
10
20
30
%
Reguläre Prägungen Imitationen
Abb. 26. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Münzen. a Anteile einzelner Kaiser bei den Altfunden (links); b Anteile einzelner Kaiser bei denNeufunden (rechts).
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 264
verbindungen und Zusammenhänge durch Stempel dersel-ben Graveure legen nahe, dass alle Münztypen mit PP ineinem einzigen Emissionszusammenhang stehen.»137
Anteil der Prägungen in den Vergleichsfunden. Neben der Anzahlder Prägungen wurde bei der graphischen Umsetzung auchdie Dauer der Regierungszeit der einzelnen Kaiser berück-sichtigt138. So regierte beispielsweise Augustus 41, Caligulahingegen nur vier Jahre.
Bei den Fundmünzen der oben genannten Orte, derenGründung in die nachaugusteische Zeit fällt, ist auffällig,dass der Anteil der caliguläischen Prägungen, im Vergleichmit den übrigen Geprägen der iulisch-claudischen Zeit,überall am höchsten ist (Abb. 27b–h). Eine Ausnahme bildethier nur der Grosse Tempel auf dem Schönbühl (Abb. 27d)in Augusta Raurica.
Da sich dieser hohe Anteil caliguläischer Gepräge glei-chermassen in Heiligtümern und militärisch geprägten Plät-zen findet, handelt es sich um ein zeittypisches Phänomen,das unabhängig von der Funktion des Ortes ist.
Werden die Münztypen zusätzlich berücksichtigt, so fälltauf, dass in den Funden vom Grossen Hafner die auguste-ischen Münzmeisterprägungen wie auch die Vesta- und Ger-manicus-Asse aus der Zeit des Caligula fehlen. Zu bedenkenist auch, dass eine Gesamtvorlage der Münzen aus Turicumnoch aussteht. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt nochnicht entschieden werden, ob dies eine Eigenheit desFundplatzes «Grosser Hafner» ist oder ob diese Münztypengenerell in Zürich selten oder gar nicht vorhanden sind.
Imitationen
Auffällig ist der hohe Anteil an Imitationen im Fundgut vomGrossen Hafner. Die Nachahmungen machen etwa zweiDrittel der Prägungen von Augustus bis Claudius aus. DasProblem der Zuweisung von Imitationen besteht darin, dassdie Grenze zwischen regulären und imitierten Prägungenfliessend ist und nicht von jedem Betrachter bzw. Bearbeitergleich gezogen wird. Es gibt keine einheitliche Definition,die allgemein angewendet werden kann. Da deskriptivenDarstellungen von vorne herein Grenzen gesetzt sind139, for-derte etwa V. Zedelius «Mass- und Gewichtsangaben» als«objektive Daten»140 für die Differenzierung zwischen regu-lären und imitierten Prägungen einzusetzen.
Das Gewicht und die Dicke des Schrötlings sind abernicht immer ein Kriterium, um zu entscheiden, ob es sichum eine Imitation handelt. So finden sich unter den Fund-münzen der militärisch oder zivil genutzten Plätze immerwieder Prägungen guten Stils, aber mit deutlich reduziertemGewicht141 und dünnem Schrötling.
Nachgeahmt wird, was umläuft und somit bekannt ist. Fürdie zeitliche Einordnung der Imitationen kommt den Fun-den von Villeneuve-au-Châtelot und Hofheim besondere Be-deutung zu. Der Vergleich beider Münzreihen ergibt imHinblick auf die Imitationen daher einen ersten Hinweis aufderen Anteil am augusteischen bzw. claudischen Münzum-lauf.
Imitationen begegnen wir bereits unter der Herrschaft desAugustus. Sie sind wohl zeitgleich oder wenig später als ihreVorbilder entstanden. Der Anteil dieser frühen Imitationenim Fundgut ist aber allgemein gering. Dies zeigt deutlich derFund von Villeneuve-au-Châtelot (Abb. 27a), der noch inaugusteischer Zeit zu Beginn des ersten nachchristlichenJahrhunderts verborgen wurde.
ergibt sich auf Grund historischer Überlegungen und natur-wissenschaftlicher Untersuchungsergebnisse. Da an diesemOrt nur Prägungen der ersten und nicht der zweiten Seriebelegt sind, muss der Prägebeginn dieser zweiten Serie in dieJahre nach 8/7 v.Chr. fallen.
Prägungen der ersten Lyoner Altarserie haben auf derVorderseite das Bild des Augustus mit der UmschriftCAESAR PONT MAX, auf der Rückseite ist die Umfriedungdes Altars für Roma und Augustus wiedergegeben, daruntererscheint die Legende ROM ET AVG. Für ihre Datierungspielen die Münzfunde aus Oberaden ebenfalls eine Rolle.Da sich hier keinerlei Münzen der ersten Altarserie gefundenhaben, postuliert J. van Heesch den Beginn der Prägungenin das Jahr 7 v.Chr.129 Die Prägezeit dieser Münzen dauertebis zum Jahr 3/2 v.Chr. Im Jahr 2 v.Chr. erhielt Augustusnämlich den Titel «Pater Patriae». Da er in der Legende nichtgenannt wird, muss die Prägung dieser Stücke vorhereingestellt worden sein. Die Münzen der zweiten LyonerAltarserie zeigen auf der Rückseite wiederum die Altar-umfriedung mit der Legende ROM ET AVG. Auf derVorderseite ist das Porträt des Tiberius dargestellt. In derentsprechenden Legende wird sein Name genannt TICAESAR AVGVST F mit dem Hinweis auf die V, VI oderVII imperatorische Akklamation. Die Münzen dieser Seriewurden in der Zeit von 9–14 n.Chr. geschlagen130.
Die Gliederung der Münzmeisterprägungen in fünf Serienfolgt wiederum K. Kraft131. Während der Anteil der Sesterzeund Dupondien im Rheingebiet in der frühen Kaiserzeit vonuntergeordneter Rolle war, gelangten die Münzmeisterasseüber gezielte Beschickung in grosser Zahl erst mit demRegierungsantritt des Tiberius ins Rheingebiet.
Tiberische Prägungen. Die Providentia-Asse wurden unter Tibe-rius geprägt. Auf der Vorderseite ist das Bild des vergöttlich-ten Augustus mit Strahlenkrone und der Umschrift DIVVSAVGVSTVS PATER dargestellt. C.H.V. Sutherland gelangteauf Grund stilistischer Übereinstimmungen mit datierten Prä-gungen zu einer Zuweisung in die Jahre um 22/23 n.Chr.132
Metallurgische Untersuchungen, die H.-M. von Kaenel undS. Klein an Fundmünzen durchführten, zeigten zudem, dassdie Metallzusammensetzung dieser Münzen denen der Prä-gungen der Jahre 22/23 n.Chr. entspricht und sie somit wohlzeitgleich sind133.
Caliguläische Prägungen. Das Bild des Agrippa mit der Le-gende AGRIPPA L F COS III auf dem Avers und die Dar-stellung des Neptun mit Dreizack und Delphin auf demRevers zeigen die sog. Agrippa-Asse. Mit ihnen beschäftigtesich J. Nicols134 ausführlich und konnte deren Beginn mitguten Argumenten in die Zeit des Caligula datieren135. DiePrägungen des Caligula und die der Agrippa-Asse weisenÜbereinstimmungen in der Metallzusammensetzung auf136.Dies spricht für eine zeitgleiche Ausprägung.
Neben diesen Prägungen sind noch die sog. Vesta- und dieGermanicus-Asse verbreitete Typen.
Prägungen des Claudius. Innerhalb der Prägung des Claudiuswerden Typen, die in der Vorderseitenlegende P(ater)P(atriae) nennen, von denen ohne P(ater) P(atriae) geschie-den. Dieser Ehrentitel wurde Claudius zu Beginn des Jahres42 n.Chr. vom Senat verliehen. In seiner Untersuchung überdie Münzprägung und das Münzbildnis des Claudius konnteH.-M. von Kaenel darlegen, dass die Prägungen des Clau-dius ohne PP in die Jahre 41/42 n.Chr. datieren. Prägungenmit PP gehören dem Jahr 42/43 n.Chr. an, denn «Stempel-
265
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 265
266
0
20
40
60 A
ugus
tus
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
0
20
40
60
a Villeneuve - au - Châtelot; n = 988 b Hofheim; n = 817
0
20
40
60
0
20
40
60
c Augusta Raurica; n = 2245 d Augusta Raurica, Schönbühl, Grosser Tempel; n = 170
0
20
40
60
0
20
40
60
e Augusta Raurica, Schönbühl, Kleiner Tempel; n = 20 f Augusta Raurica, Sichelen; n = 45
0
20
40
60
0
20
40
60
g Turicum, Grosser Hafner; n = 72 h Vindonissa; n = 4254
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Aug
ustu
s
Tibe
rius
Caiu
s
Clau
dius
Ner
o
Gal
ba
Oth
o
Vit
elliu
s
Vesp
asia
nus
Titu
s
Dom
itia
nus
Abb. 27. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Vergleichsfunde von ausgewählten Fundorten.
Reguläre Prägungen Imitationen
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 266
der Anteil an Nachahmungen nach Vorbildern der erstenund zweiten Altarserie am geringsten ist. Der Grund für dieseAbweichung lässt sich bislang nicht hinreichend erklären.
Münzen mit Brandspuren
Während eine Münze sicher verbrannt ist (Kat. 51), weisenzwei weitere Stücke sehr wahrscheinlich Brandspuren auf(Kat. 60 und 87). Ob es sich hier ursprünglich um ein iso-liertes Feuer handelte oder um einen grösseren Flächen-brand, der einen Teil der Anlage zerstörte, kann allein aufnumismatischer Grundlage nicht entschieden werden.
Zeitliche Einordnung der Münzen in den Befund
Der Schwerpunkt der überlieferten Münzreihe vom GrossenHafner liegt in der Mitte des 1. Jh. Dabei reicht die Spanneder Prägungen von Augustus bis Domitian. Die Prägungenspäterer Kaiser spielen im Vergleich hierzu nur eine unter-geordnete Rolle.
Die zeitliche Einordnung der Mehrzahl der Fundmünzenwiderspricht dem archäologisch-dendrochronologischen Be-fund, der die Anlage in die Regierungszeit des Hadrian weist.Zwar laufen die Prägungen des Domitian teilweise noch weitbis über die Mitte des 2. Jh. um145, aber für diese Zeit liegtkeine geschlossene Münzreihe im Fundgut mehr vor. Dernumismatische Befund erlaubt daher, mit der gebotenenVorsicht, die Annahme einer zeitlich früher anzusetzendenNutzung des Areals.
Unter der Herrschaft des Claudius erhöht sich die Zahlder Imitationen in den nordwestlichen Provinzen schlag-artig142. Es werden nicht nur die Münzen des Claudius,sondern auch die seiner Vorgänger imitiert. Dass diese zeit-gleich und nicht früher anzusetzen sind, ergeben hybrideStempelkopplungen143. Nach der Einstellung der Prägungenim Jahr 43 war die Kleingeldversorgung für den alltäglichenBedarf nicht mehr ausreichend gewährleistet. Die Imitatio-nen sind daher als Reaktion auf einen Kleingeldmangel zusehen und eine von offizieller Seite geduldete Massnahme144.
Eine Vorstellung vom Anteil der Nachahmungen geben dieFunde von Hofheim (Abb. 27b). Fast die Hälfte der hier gefundenen Münzen, die unter der Regierung desClaudius geschlagen wurden, sind Imitationen. Ein Viertel bisein Drittel der Prägungen früherer Kaiser besteht ebenfalls ausImitationen. Im Vergleich zwischen dem Grossen Hafner(Abb. 27g) und Hofheim sind diese Anteile sehr ähnlich.
Dieser relativ hohe Anteil an Nachahmungen im Fundgutist also kein Kennzeichen für ein Heiligtum, sondern ist eingeographisch und funktionell unabhängiges Kennzeichen fürden Münzumlauf während der Mitte des 1. Jh.
In einem zweiten Schritt soll geklärt werden, welcher deroben behandelten Münztypen am häufigsten als Imitationinnerhalb der bereits behandelten Orte auftritt.
In Hofheim, Augusta Raurica und Vindonissa zeigt sichdas gleiche Bild (Abb. 28b–d). Der Anteil an Imitationennach Vorbildern der ersten und zweiten Lyoner Altarserieüberwiegt. Der Anteil der Agrippa-Asse ist am geringsten.Dazwischen liegen die Minerva- und Providentia-Asse.
Anders sind die Verhältnisse am Fundort Grosser Hafner(Abb. 28a). Hier überwiegen die Providentia-Asse, während
267
0
25
50 N
emau
sus
1/2
Lyon
I/I
I
Prov
iden
tia
Agr
ippa
Min
erva
Sons
tige
%
0
25
50
Nem
ausu
s 1/
2
Lyon
I/I
I
Prov
iden
tia
Agr
ippa
Min
erva
Sons
tige
%
a Turicum, Grosser Hafner; n = 23 b Hofheim; n = 213
0
25
50
Nem
ausu
s 1/
2
Lyon
I/I
I
Prov
iden
tia
Agr
ippa
Min
erva
Sons
tige
%
0
25
50
Nem
ausu
s 1/
2
Lyon
I/I
I
Prov
iden
tia
Agr
ippa
Min
erva
Sons
tige
%
c Augusta Raurica; n = 312 d Vindonissa; n = 223
Abb. 28. Zürich. Riesbach. Grosser Hafner. Münzen. Verteilung der Imitationen nach Typen von ausgewählten Fundorten.
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 267
thur153 erinnert und damit möglicherweise als römischesBleigewicht angesprochen werden kann. Das Stück wiegt13 g, was etwa dem Gewicht einer semiuncia entsprechenwürde154. Da es sich aber um einen Gewässerfund handelt,ist die Deutung als (neuzeitlicher?) Netzbeschwerer jedochnahe liegender.
Die rund 50 geborgenen Schlackestücke finden sich nurim Norden des untersuchten Gebiets und dort vor allem imNE- und NW-Bereich. Innerhalb des Rundbaus sind nur dreiSchlackestücke beobachtet worden. Die Fragen nach Zeitstel-lung und Art der Schlacken müssen unbeantwortet bleiben.Ob diese Stücke auf dem Grossen Hafner entstanden sindoder ob sie hier als Abfälle deponiert wurden, kann nichtmehr entschieden werden. Die gleiche Problematik weisenauch die vereinzelten grün glasierten Ofenkacheln155 und dievereinzelten Pfeifenfragmente156 auf.
3.4 Ziegel
Die Ziegel machen zahlen- wie gewichtsmässig mit Abstanddas meiste Fundgut aus. Die Besprechung dieser Fundgat-tung erfolgt summarisch und ohne Auflistung im Katalog,da sich im Laufe der Bearbeitung gezeigt hat, dass längstnicht alle Fragmente, die manchmal nicht mehr sind alsSplitter, von römischen Ziegeln stammen. Daher wurde auchauf eine detaillierte Besprechung und eine Kartierung derBruchstücke verzichtet.
Die Ziegel sind im Allgemeinen stark verwaschen undverrieben; zudem ist eine grosse Zahl von Splittern (3–4 cm2)belegt. Stücke, die grösser sind als handtellergross, sind eherselten. Sichere Brandspuren finden sich nur ganz selten.
Leistenziegel sind nur in römischer Zeit belegt, die rundenDeckziegel hingegen kommen bisweilen noch bis in dieGegenwart vor. Gefunden wurden auch einige Fragmentevon neuzeitlichen Biberschwanzziegeln. Gelbtonige Ziegel-stücke bleiben die Ausnahme, der weitaus grösste Teil derZiegelfragmente ist orange- und rottonig. Die gelbtonigenBruchstücke sind vermutlich alle neuzeitlich zu datieren.
Auch wenn die gelbtonigen Rundziegel mit einigerSicherheit als neuzeitliche Fabrikate ausgeschieden werdenkönnen, so bleibt die Datierung ihrer orangetonigen Ver-wandten157 letztlich offen. Die Besprechung der Ziegel musssich somit auf die Leistenziegelfragmente beschränken. Dierömischen Flachziegel vom Grossen Hafner sind wie üblichorange oder rottonig, manchmal auch braun. Eine Grösseoder eine spezielle Zurichtung – in Hinblick auf dieProblematik der Bedachung des Rundbaus (s. S. 256) – liesssich nicht feststellen. Bei FN 559 ist die Länge bekannt, sieliegt mit etwa 49 cm im Rahmen des Üblichen, ebenso wiedie Breite von ca. 35 cm bei FN 98158.
Stempel sind keine belegt. Einige Fragmente zeigen Wisch-zeichen auf dem unteren Ende der Ziegeloberseite: FN 241und FN 332 zeigen einen einfachen, FN 148 einen doppel-ten Halbkreis. FN 198 weist zwei sich teilweise überlagerndeWellen auf, die mit einem kammartigen Gegenstand einge-tieft wurden159.
3.5 Zusammenfassende Datierung der Funde
Abschliessend lässt sich zur Datierung des Fundmaterialsfesthalten, dass sich abgesehen von den Münzen und derKeramik keine Anhaltspunkte für die Datierung des Rund-tempels ergeben. Bei der Keramik lässt sich die Mehrzahl der
3.3.2 Eisen und Buntmetall
Bei Kat. 140 handelt es sich möglicherweise um einen abge-brochenen Stilus. Jedenfalls zeigt er auf einer Seite ein fla-ches Ende, wie es für Schreibgriffel üblich ist. Die erhalteneLänge beträgt etwa 8 cm, doch muss der Stift wegen des Feh-lens einer Spitze einst mindestens 10 cm gemessen haben.
Bei Kat. 141 dürfte es sich um eine Nadel handeln, diezum Knüpfen von Netzen verwendet wurde. Die römischeZeitstellung ist allerdings nicht gesichert. Auf die vermeint-liche eiserne Miniaturlanze (Kat. 139) wurde bereits oben beider Interpretation hingewiesen (S. 256).
Abgesehen von diesen drei Objekten finden sich vor-wiegend eiserne Nägel und Nagelschäfte, die sich zeitlichmeist nicht einordnen lassen. Einige sind sicher nachrömischzu datieren. Die handgeschmiedeten Nägel haben immereinen vierkantigen Querschnitt, was sie von den modernenmaschinell hergestellten Nägeln mit rundem Schaftquer-schnitt unterscheidet146. Damit sind einige Nägel147 alsmodern auszuscheiden. Doch auch einzelne Nägel mitvierkantigem Querschnitt sind neuzeitlich. So beispielsweiseder Nagel FN 738, der am Schaftende, nahe dem Kopf einefeine Rillung aufweist, was den Halt im Holz verbessernsollte. Solche Rillen oder Rippen sind heute noch bei Nägelnüblich. Da solche bei römischen Nägeln sonst unbekanntsind, ist auch dieses Stück als nachrömisch auszuscheiden.
Die anderen Nägel finden zwar Parallelen bei den Nägelnaus römischer Zeit, doch sind diese, wegen ihrer funk-tionalen Einfachheit sicher auch noch in späteren Zeitenhergestellt worden. Da sie jedoch zum römischen Baugehören könnten, werden sie im Katalog aufgelistet148.
Unter den Funden ist auch die Schraube FN 1078, derenKerbe auf der Oberseite gut sichtbar, deren Gewindeallerdings nicht mehr erkennbar ist. Schrauben und Gewindewurden zwar bereits in der Antike verwendet, doch sind nach V. Schaltenbrand Obrecht keine eisernen Schrauben aus rö-mischer Zeit bekannt149.
Die eiserne Klammer FN 613 diente zum Fixieren vongrösseren Holzelementen. Solche Klammern wurden nichtnur in römischer Zeit sondern auch im Mittelalter150 ver-wendet, und noch heute bedient man sich ihrer. Der quadra-tische Querschnitt ist für römische Stücke gesichert151. Obdie Länge von etwa 26 cm gegen eine Datierung in römischeZeit spricht, kann nicht entschieden werden – die römer-zeitlichen Stücke scheinen allenfalls kleiner gewesen zu sein.Die nur wenig fortgeschrittene Korrosion des Stücks könnteauf eine neuzeitliche Datierung schliessen lassen, weshalbdas Stück im Katalog weggelassen wird.
Neuzeitlich sind sicher die Angelhaken FN 314, 599, 600,925, 1034, die vermutlich alle von Stücken stammen, bei de-nen drei mit einem Widerhaken versehenen Arme, in einemWinkel von je 120° zueinander stehen. Da Angelhaken imLauf der Zeit kaum typologische Veränderungen durchmach-ten, sind sie schwer zu datieren. Es scheint jedoch, dassmehrarmige Haken in römischer Zeit nicht belegt sind. DieAngelhaken der römischen Zeit sind nicht einheitlichgeformt. Während beispielsweise die Eisen- und Bronze-haken aus Dietikon und Neftenbach in einer flachen rhom-boiden Platte enden, scheinen die beiden bronzenen Stückeaus dem Donaukastell Straubing-Sorviodurum mit einer Öseversehen zu sein152.
Die meisten anderen Metallobjekte lassen keine Datierungzu und werden daher hier weggelassen. Erwähnenswert istallerdings noch eine runde Bleischeibe mit zentralem Loch(Kat. 53), die an ein etwas grösseres Stück aus Oberwinter-
268
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 268
4 ZUSAMMENFASSUNG – RÉSUMÉ –RIASSUNTO – SUMMARY
Zusammenfassung. In hadrianischer Zeit wurde auf dem Gros-sen Hafner im Zürichsee ein Rundtempel aus Holz errichtet.Der gemäss dendrochronologischer Datierung der Bauhölzerim Jahr 122 n.Chr. errichtete Bau bestand aus tief in den See-grund eingerammten Eichenpfähle, deren Wände vermutlichmit vergänglichem Material geschlossen waren. Die Pfähle bil-den einen Kreis von rund 7 m Dm. Ein Umgang konnte nichtnachgewiesen werden, so dass offen bleiben muss, ob ein sol-cher je vorhanden war, oder ob dieser – weil möglicherweiseweniger tief fundamentiert als die Cella – den Abbaggerungenim 19. Jh. zum Opfer fiel. Das zu diesem Rundbau gehörigeMaterial deutet darauf hin, dass dieser sicher bis ins 3., evtl.sogar bis ins 4. Jh. genutzt wurde.
Die Deutung als Tempel beruht einerseits auf der Insellageund der Bauform, andererseits auf den zahlreichen Münz-funden. Die Mehrheit der knapp 90 Münzen gehört aller-dings vermutlich zu einem sonst nicht nachgewiesenen, wohlebenfalls runden Vorgängerbau. Der Vorgängerbau, der sichvor allem auf Grund der Münzen fassen lässt, lässt sich ver-mutungsweise ins dritte Viertel des 1. Jh. datieren. Kerami-sches Material aus dieser Zeit ist hingegen kaum vorhanden.
Auf dem Grossen Hafner ist durch die Leistenziegel-fragmente ein weiterer römischer Bau nachgewiesen, dessenStandort, Aussehen und Datierung allerdings völlig unklarist.
Résumé. Sous Hadrien, sur le lac de Zurich, au lieu-dit «Gros-ser Hafner», un temple circulaire en bois fut érigé. Les data-tions dendrochronologiques des bois de construction four-nissent la date de 122 apr. J.-C. Le bâtiment se constituait depieux de chêne profondément enfoncés dans le fond lacustre;les parois étaient sans doute en matières périssables. Les pieuxdessinent un cercle de 7 m de diamètre environ. On n’a paspu attester la présence d’un péribole, et on ignore donc si lecomplexe en disposait ou si, reposant peut-être sur des fon-dations moins profondes que la cella, il fut victime des tra-vaux à la pelle mécanique menés au 19e s. Le mobilier appar-tenant à ce bâtiment circulaire indique qu’il fut certainementutilisé jusqu’au 3e s., peut-être même jusqu’au 4e s.
C’est sa situation d’îlot et sa forme architecturale qui per-mettent d’avancer une interprétation comme temple, ainsique les nombreuses trouvailles monétaires. La majoritéd’entre elles, au nombre de 90, se rattachent sans doute à unbâtiment antérieur, de forme également circulaire, dont onne peut plus attester la présence. Il daterait du 3e quart du1er s. On n’a quasiment pas retrouvé de mobilier céramiquedatant de cette époque.
Au lieu-dit «Grosser Hafner», des fragments de tegulaattestent la présence d’un autre édifice romain, dont l’em-placement, l’aspect et l’insertion chronologique demeurentcependant inconnus.Traduction Catherine Leuzinger-Piccand
Riassunto. Sul lago di Zurigo, in località Grosser Hafner, sorsein epoca adrianea un tempio ligneo ad impianto circolare.Datazioni dendrocronologiche del legname da costruzioneconsentono di fissare l’edificazione della struttura all’anno122 d.C. Essa consisteva in pali impiantati profondamentenel fondale lacustre, con le pareti costruite verosimilmentein materiale organico. I pali delimitano un perimetro circo-lare di ca. 7 m di diametro. Non è stato possibile identifi-care sul terreno un peribolo. Rimane pertanto incerto se tale
Fragmente nicht genauer datieren. Trotzdem lassen typolo-gische Kriterien oder Dekorationsschemata bei einigenStücken eine chronologische Einordnung zu. Die Relief-schüsselfragmente Kat. 2 und 3* sind wohl in die erste Hälftedes 3. Jh. zu datieren. Das TS-Wandstück Kat. 4* kann aufGrund seiner Dekoration mit Glasschliff wohl ins spätere 2.oder 3. Jh. gesetzt werden. Das Bodenstück eines TellersDrag. 18/31 (Kat. 1) stammt aus dem 2./3. Jh. Die beidenImitationen von Reibschüsseln Drag. 43 (Kat. 5–6) lassensich in die erste Hälfte des 3. Jh. datieren.
Bei der Glanztonkeramik vertreten die Becher Kat. 7–9 dieForm Niederbieber 33, was einen Ansatz in der ersten Hälftedes 3. Jh. ergibt. Kat. 9 könnte auf Grund des gelängtenHalses erst um die Mitte des Jahrhunderts oder gar erst im4. Jh. entstanden sein. Ratterblechbänder kommen zwar seitdem beginnenden 2. Jh. auf Glanztonkeramik vor160, dochtreten diese erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ver-mehrt auf. In Verbindung mit den Falten sind Ratterblech-bänder auf Bechern erst seit dem Ende des 2. Jh. belegt161.Überhaupt sind die Faltenbecher, wozu sicher Kat. 11*, 13*und 16* gehören, als Leitformen des späten 2. bis mittleren3. Jh. anzusehen.
Der Glasschliffdekor, wie er auf Kat. 18* auftritt, findetseit dem letzten Viertel des 2. Jh. grössere Verbreitung162, undder Barbotinedekor in Blattform von Kat. 17* findet etwa inWiesendangen Parallelen.
Die hell- und grautonige Gebrauchskeramik lässt sichzeitlich kaum genauer eingrenzen. Ins 3. Jh. gehört wohlKat. 19. Das grautonige Bodenfragment Kat. 28* und diebeiden Wandscherben Kat. 29* und 30*, stammen hingegenwohl aus der zweiten Hälfte des 1. Jh. Ins 1. Jh. könnte auchdas Schulterfragment eines grautonigen Topfs gehören (Kat.31*). Die Fragmente von rätischen Reibschüsseln (Kat. 36,38*, 43* und 44*) sind frühestens ins späte 2. Jh. zu datieren.
Damit liefert die Keramik vom Grossen Hafner folgendesBild: Sicher datierbare Stücke aus dem 1. Jh. sind – imGegensatz zu den Münzen – kaum nachgewiesen. Aus derErbauungszeit des Rundbaus, 122 n. Chr., könnten einigewenige Erzeugnisse stammen. Eine Massierung ist hingegenim späten 2. und der ersten Hälfte des 3. Jh. zu beobachten.Insbesondere das Randfragment eines Bechers Niederbieber33 mit gelängtem Hals (Kat. 9) könnte um die Mitte des3. Jh. oder gar erst im 4. Jh. entstanden sein.
Die zeitliche Verteilung der Münzen ist dagegen ganzunterschiedlich: Hier stammt die Mehrzahl aus dem 1. Jh.;dem 2. und 3. Jh. sind nur relativ wenige Stücke zuzuweisen.
Diese Verteilung der Münzen lässt darauf schliessen, dassder in hadrianischer Zeit angelegte Rundtempel einenVorgänger besass, der vermutlich in die erste Hälfte des 1. Jh.zu datieren wäre. Dass die Leistenziegel zu einem (recht-eckigen) Vorgängerbau gehören, wäre denkbar, doch müsstedieser dann vermutlich aus Stein errichtet worden sein. Dannmüsste jedoch davon ausgegangen werden, dass der Steinbauaus dem 1. Jh. in hadrianischer Zeit durch einen hölzernenNachfolger ersetzt worden wäre. Möglicherweise war derUntergrund zu wenig stabil, um einen Steinbau zu tragen,weshalb man den Nachfolger aus Holz errichtet hat. Ob esdenkbar ist, dass ein postulierter rechteckiger Vorgängerbaudurch einen Rundbau abgelöst werden kann, müsste genaueruntersucht werden.
Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass die Ziegel zu einemanderen, mit dem Rundbau zeitgleichen Gebäude gehörthaben, das auf Grund der Deckung mit Leistenziegeln mitgrosser Wahrscheinlichkeit rechteckig sein müsste. In diesemFall wäre an eine Anlage wie auf der Petersinsel zu denken.
269
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 269
5 Wie Anm. 4. Angeblich schreibt F. Keller 1872, dass er mit Rungeim Jahr 1840 (sollte heissen 1860) den Grossen Hafner untersuchthabe und in ihm einen Steinberg vermute.
6 Keller 1872, 353.7 Brief vom 8. Januar 1879 von F. Keller an J. Messikommer (Nr. 415)
sowie Keller 1880, 25.8 Materialien Heierli, Notizbüchlein Heierli V (1889) 49–53.9 Heierli 1888, 50.10 W. Baumann, Arnold Bürkli (1833–1894). Aufbruch in eine neue
Zeit (Meilen 1994). Verein für wirtschaftshistorische Studien(Hrsg.), Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik 60.
11 Direktion der Quaibauten (1889) 19.12 Direktion der Quaibauten (1889) 39f.13 Im Frühjahr 1884 kam es in Zürich zu einer Typhusepidemie.14 Direktion der Quaibauten (1889) 47. 15 Direktion der Quaibauten (1889) 50–52.16 Direktion der Quaibauten (1889), Tafel IX. Bei den eingesetzten
Baggermaschinen handelte es sich um Eimerkettenbagger.17 Direktion der Quaibauten (1889) 24.18 Heierli 1888, 50.19 Forrer 1883, 463. Dazu auch Heierli 1888, 51: «Neben Pfahlbau-
Alterthümern brachte der Bagger auch noch jüngere Gegenständezu tage, z.B. römische Scherben aus terra sigillata und eherneMünzen von Augustus bis Vespasian.»
20 Extremereignisse, also bemerkenswerte Tiefststände, sind in ver-schiedenen Quellentexten und Messreihen zu finden, ihre Aus-wertung und Anbindung an aktuelle Höhenangaben steht abervorderhand noch aus. Im Auftrag des Amtes für Städtebau derStadt Zürich (Unterwasserarchäologie) wurden durch den Histo-riker Thomas Specker zwei vorderhand unpublizierte Berichte ver-fasst: «Rekonstruktion historischer Seespiegelstände des Zürich-sees vor 1810» (Zürich 2002) sowie «Die Pegelmessungen an derLimmat von Hans Caspar Hirzel zwischen 1761 und 1772. Teil-ergebnisse zur Rekonstruktion historischer Seespiegelstände desZürichsees im 18. Jahrhundert» (Zürich 2003).
21 Bedingt durch das an dieser Stelle untiefe Wasser.22 Keller 1880, 25.23 Keller 1872, 353; Keller 1879, 10.24 Wetli 1885, Tab. IV b.25 Ein Fuss wird mit 0,314 m eingesetzt und mit 12 Zoll zu 0,026 m
umgerechnet.26 Wetli 1885, 11 (Anmerkung).27 Seegrundaufnahmen längs und quer über die Untiefe anlässlich
der Aktion von 1998.28 Eine im Rahmen des vorliegenden Aufsatzes nicht zu klärende
Unstimmigkeit sei noch genannt: Auf dem Projektplan von Bürkliaus dem Jahr 1872 (Abb. 2) wird die geplante, aufzuschüttendeInsel mit ihren Aufbauten zusammen mit den aktuellen Höhen-kurven abgebildet. Es finden sich im Zentrum der Untiefe Höhen-koten um 406,70–406,90 m ü.M., was bei entsprechender Korrek-tur des Nivellements des Pierre du Niton viel zu tiefe Werte um403,40–403,60 m ü.M. ergibt, also noch vor den BaggerungenWassertiefen von über 3 m.
29 D. Wild, D. Krebs, Die römischen Bäder von Zürich (Zürich undEgg 1993) 25; s. auch S. 23.
30 Freundliche Mitteilung Petra Ohnsorg, Archäologie und Denk-malpflege (Amt für Städtebau der Stadt Zürich), welche sich 2005mit diesem Problem auseinandergesetzt hat.
31 In Nahansicht auf dem «Prospect der Stadt Zürich. Von derMittagsseiten auf dem See bey der Claus-Stud anzusehen (La Statue de St. Nicolas). J. Jac. Koller gez. / J.R. Holzhalber,Zürich 1778. Original im Wohnmuseum Bärengasse, Zürich.
32 Ber.ZD 1962/63 (1967).33 M. Primas, U. Ruoff, Die urnenfelderzeitliche Inselsiedlung «Gros-
ser Hafner» im Zürichsee (Schweiz). Tauchausgrabungen 1978–1979. Germania 59 (1981) Heft 1, 31–50.
34 Dauer der Aktion vom 27.01.–13.02.1998. Robert Auf der Maur,Thomas Oertle, Thomas Pinzl, Beat Eberschweiler und PeterRiethmann.
35 Dauer der Aktion vom 8.01.–23.03.2001. Örtliche Grabungslei-tung: Robert Auf der Maur. Beteiligte TaucherInnen: Thomas
struttura sia mai esistita oppure se, edificata con pali confic-cati meno profondamente nel fondale, essa fu obliterata dalavori di dragatura del XIX sec. I materiali archeologici pro-venienti dall’edificio circolare indicano che il tempio fu fre-quentato di sicuro fino al III, forse fino al IV sec.
L’interpretazione dell’edificio come tempio deriva da unlato dalla sua posizione su di un’isola e dal tipo d’architettura,dall’altra dalla presenza di numerosi reperti monetali. La mag-gior parte delle quasi 90 monete sembra tuttavia apparteneread una fase d’edificazione precedente, non identificata sul ter-reno, probabilmente anch’essa di forma circolare. Tale fase,evidenziata appunto soprattutto dai reperti monetali, risaleprobabilmente al terzo quarto del I sec. Non vi sono per con-tro reperti ceramici attribuibili a questo periodo.
Nella stessa località, frammenti di tegoloni consentono d’ipotizzare l’esistenza di un altro edificio d’epoca romana.La posizione precisa, l’aspetto e la datazione di questa strut-tura rimangono tuttavia ad oggi sconosciuti.Traduzione Rosanna Janke
Summary. In the Hadrianic period a timber round temple wasbuilt on the Grosser Hafner, an island situated in the lake ofZurich. According to the dendrochronological dating of theconstruction timbers, the building was erected in AD 122and it consisted of oak piles that were driven deep into thebed of the lake. Its walls were probably made of a perisha-ble material and the piles formed a circle with a 7 m dia-meter. An ambulatory could not be identified, and it remainsunknown whether the temple ever had one or whether it fellvictim to the excavation work undertaken during the 19thcentury because its foundations may have been shallowerthan those of the cella. The finds associated with this roundstructure indicate that it was definitely used into the 3rd, pos-sibly even into the 4th century.
The interpretation as a temple is based on one hand onits island location and type of construction and on the otheron its numerous coin finds. However, most of the almost 90 coins recovered probably belonged to its predecessor,which was probably also circular, but of which no structuralevidence has survived. This earlier building, which is repre-sented mainly by the coins, presumably dated from the thirdquarter of the 1st century. However, hardly any pottery findsfrom this period have been recovered.
Fragments of flanged tiles provide evidence of anotherRoman building on the Grosser Hafner. However, its loca-tion, appearance and dating remain entirely unknown. Translation Sandy Hämmerle
5 ANMERKUNGEN
1 H. Jäckli, Geologie von Zürich. Von der Entstehung der Land-schaft bis zum Eingriff des Menschen (Zürich 1989) 61–73: DieZeit der letzten Vergletscherung, Moränen; R. Hantke, Eiszeitalter1. Die jüngste Erdgeschichte der Schweiz und ihrer Nachbarge-biete (Thun 1978) 366–391: Die Würm-Eiszeit und das Holozän(Überblick).
2 C. Schindler, Zur spät- und postglazialen Geologie des unterenZürichseebeckens, in: Vierteljahresschr. Naturforsch. Ges. Zürich116 (1971) 284–315. Die Oberfläche der im Postglazial gebildetenSeekreide kopiert quasi in diffuser Art und Weise jene der eiszeit-lichen Ablagerungen.
3 Keller 1879, 10.4 Dokumentation Schweiz. Landesmuseum Zürich, Materialien
Heierli, Notizbüchlein Heierli V (1889) 49–53, mit Nennung derQuelle: Corr. AGZ XI, 178.
270
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 270
67 Frei 1968. Vgl. dazu neuerdings auch G. Matter, Die Römer-siedlung Kempraten und ihre Umgebung. Archäologische Führerder Schweiz 35 (Jona, Rapperswil 2003) 47–49.
68 Laur-Belart 1963; Schmid 1966, 35–41; JbSGUF 53 (1966/67),145–147 mit Abb. 30f.
69 Schmid 1966, 35.70 Vor allem Schmid 1966. Nachgewiesen sind Pferd und Rind, Elch,
Hirsch, Reh, Adler und Bär.71 Laur-Belart 1963, 23.72 D. Gutscher, JbSGUF 69 (1986) 278–280; ders., JbSGUF 70 (1987)
238–240. Vgl. auch W. Drack, R. Fellmann, Die Römer in derSchweiz (Stuttgart 1988) 234, die von einem «wahrscheinlichmonumental ausgestalteten Heiligtum» sprechen.
73 Für den Rundbau vgl. Stehlin 1910, 66–76 (mit älterer Literatur).74 Es handelt sich dabei um die Fundamente des Gebäudes.75 Stehlin 1910, 74.76 R. Laur-Belart, Führer durch Augusta Raurica (bearb. durch
L. Berger) (Basel 19665) 15.77 Während alle anderen Abstände und Mauerdicken angegeben
sind, muss der Abstand zwischen dem innersten und zweit-innersten Mauerkreis aus dem angegebenen Gesamtdurchmessererrechnet werden.
78 An Bauten mit runder Cella und rundem Umgang sind zunennen: Pfünz (Aussenmasse Umgang: 16,8 m); Faye-l’Abbesse(Aussenmasse Umgang: 15,3 m); Moûtiers (Aussenmasse Umgang:18,5 m); Crozon (Aussenmasse Umgang: 29 m); Craon (Aus-senmasse Umgang: 23 m). Der Rundtempel von Barzan/Talmont,welcher eine Vorhalle aufweist, wäre mit 36 m Dm. etwa gleichgross wie der Bau auf der ehemaligen Insel Gwerd. Für die Bautenvgl. H. Koethe, Die keltischen Rund- und Vielecktempel derKaiserzeit. Ber. RGK 23 (1933) 10–108; Horne/King 1980; Fauduet1993a; Fauduet 1993b. Zu nennen ist auch der erst seit kurzembekannte Tempel in Cohors (F), der einen Dm. von 38 maufweist; vgl. dazu I. Fauduet, L’archéologue 61 (2002) 23f. mitAbbildungen.
79 Fauduet 1993a, Abb. S. 83.80 A. Grenier, Manuel d’archéologie gallo-romaine IV. Les monu-
ments des eaux (Paris 1960) 704.81 Guyan et al. 1985, 104.82 King/Soffe 1994, 41f.83 Dies zeigt beispielsweise die Untersuchung von A. Kaufmann-
Heinimann, welche die in situ angetroffenen Lararien zusammen-gestellt hat. Es zeigt sich hierbei, dass Merkur in Gallien/Ger-manien an der Spitze der dargestellten Götter steht, noch vorJupiter; vgl. dazu A. Kaufmann-Heinimann, Götter und Lararienaus Augusta Raurica. Forsch. Augst 26 (Augst 1998) 192 undAbb.138.
84 G. Walser. Römische Inschriften in der Schweiz I. Westschweiz(Bern 1979) 116 Nr. 54. Gestiftet von der Schiffergilde vomGenfersee, die ihren Sitz im römischen Lausanne hatte.
85 W. van Andringa, La religion en Gaule Romaine. Piété et politique(Ier–IIIe siècle apr. J.C.) (Paris 2000) 274 mit Anm. 83.
86 Neben den römischen Funden wurden bei den Tauchuntersu-chungen auch prähistorische und neuzeitliche Objekte geborgen.Diese werden hier nicht besprochen. Funde, deren Zeitstellungunklar ist, werden nur ausnahmsweise besprochen – insbesonderebeim Metall.
87 Forrer 1883, 464. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dassMünzen des Vespasian «auffallend häufig vorkommen». Zu denMünzen vgl. auch Heierli 1888, 51. Viollier 1930, 303, berichtet,dass sich eine der Münzen im Münzkabinett Winterthur befindet.
88 Zu den Fundumständen vgl. S. 248f.89 SLM-Nr. 3717, 3717.1 und 30030.1.90 27. Ber. AGZ 1871–74, 3: «Gefässscherben aus terra sigillata von
Windisch und vom grossen Hafner (Herren Dr. Meyer und R. Brei-tinger)».
91 Vgl. oben und Heierli 1888, 50.92 Das ebenfalls vorhandene prähistorische und neuzeitliche
Material werden bei der Besprechung weggelassen.93 Vergleichbare Stücke etwa Laufen-Müschhag (Martin-Kilcher 1980,
Taf. 4,8) und Wiesendangen (Schucany et al. 1999, Taf. 127,1).
Oertle, David Pazmino, Leonora Thofte, Teileinsätze von PeterRiethmann und Beat Eberschweiler.
36 Dendrolabor der Stadt Zürich, Kurt Wyprächtiger, Bericht Nr.111.37 Die Pfähle sind, wie bereits erwähnt, unterschiedlich stark
eingetieft worden.38 Zwischen Stütze 239 und 240: 2, zwischen 136 und 156: 2,
zwischen 136 und 150: 1, zwischen 119 und 146: 1 und zwischen146 und 154: 1.
39 Pfahlloch 154 reichte nur noch 25 cm in den Grund.40 UK der angetroffenen Pfahlspitze ca. 401 m ü.M., Wasserober-
fläche in römischer Zeit ca. 406,50 m ü.M. Hinzu kommt nochdie Höhe des Oberbaus.
41 Jeder unterschiedlich grosse Rundbau würde ausserdem eigensdafür gefertigte Ziegel bedingen.
42 Für die Deutung der Ziegel s. unten S. 268.43 Dies die These von Viollier 1930, S. 303 Nr. 24: «...un tour en
bois servant de phare?», mit älterer Literatur.44 So etwa eine Reihe von Rundhäusern in London aus dem
mittleren 1. Jh. n.Chr., vgl. dazu etwa G. Milne, Book of RomanLondon. Urban archaeology in the nations’ capital (London 1995)44f. mit Abb. 21f.; D. Perring, Roman London (London 1991) 15(«built in British rather than Roman fashion») und neuerdingsauch Antike Welt 32, Heft 6 (2001), 461 (Nachrichten).
45 Zu den Münzfunden in gallorömischen Heiligtümern vgl. etwaG. Aubin, J. Meissonnier, L’usage de la monnaie sur les sites desanctuaires de l’ouest de la Gaule et de la Bourgogne. In:Goudineau et al. 1994, 143–152. Häufig Stückung der Münzen(halbiert etc.). Es wird hervorgehoben, dass verletzte Münzen(Schlagspuren etc.) ein gutes Indiz für ein Heiligtum seien. Siesollten dadurch dem richtigen Leben entrissen werden und alsWeihung sichtbar sein. Vgl. dazu Tuffreau-Libre 1994, 131.
46 Für Räucherkelche in gallorömischen Heiligtümern vgl. etwaFischer 1990, 339 Nr. 114 Taf. 228.
47 Fischer 1990, 69.48 Es ist dabei an Hausaltäre oder dergleichen zu denken, wie sie
etwa in Pompeji vorkommen. Von den Räucherkelchen aus demUmland von Regensburg sind 19 Grabfunde und 12 Siedlungs-funde, vgl. Fischer 1990, 69.
49 B. Squévin, Les armes miniatures des centres culturels de Baâlons-Bouvellemont. In: Goudineau et al. 1994, 140 mit Abb. 9.
50 R. Forrer, Die helvetischen und helveto-römischen Votivbeilchender Schweiz (Basel 1948) 37f. mit Anm. 78 und Taf. 4,4 (Kat. 20).Diesen Hinweis verdanke ich Margrit Balmer. Das Stück trägt imSLM die Nr. P 12202 mit Fundort Grosser Hafner.
51 J. Rubli, Römisches Votivbeil aus der Limmat. Antiqua 1887, Nr. 3–4.
52 Für das sich kaum unterscheidende Inventar in Heiligtümern undWohnbauten vgl. etwa Tuffreau-Libre 1994, 129.
53 Frei 1968, 314f.54 Fauduet 1993a, 112.55 Vgl. unten Anm. 78.56 Fauduet 1993a, 109 Abb. unten rechts.57 Fauduet 1993a, Nr. 360 Abb. S. 71; Horne/King 1980, 379.58 Fauduet 1993a, Nr. 461 Abb. S. 79.59 Fauduet 1993a, 110.60 Die genannten Bauten haben eine Umgangstiefe von 2,5 bzw.
3,9 m; der äussere Durchmesser beträgt 15,3 bzw. 18,3 m. Die Dif-ferenz rührt von der unterschiedlichen Wanddicke her; dieCellamauern von Faye l’Abesse und Moûtiers sind 0,9 bzw. 1,6 mdick, jene des Umgangs 1 m. Der hölzerne Rundtempel vomGrossen Hafner weist sicher deutlich dünnere Wände auf – mehrals 20 cm werden sie kaum betragen haben.
61 Entrains: Fauduet 1993b, 58–60; Hayling Island: King/Soffe 1994.Eine runde Cella ohne Umgang ist wohl auch in Annoire undevtl. in Juvincourt anzunehmen.
62 Fauduet 1993a, 113.63 Fauduet 1993a, 114.64 Bulletin de l’Association pro Aventico 34 (1992) 31–44.65 Guyan et al. 1985, 128–130 mit Abb. 2.43 S. 103 und 2.69 S. 129;
Schneider/Gutscher 1980, 42.66 Horne/King 1980, 483 (Gebäude B).
271
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 271
F.E. Koenig, S. Rebetez, Arculiana, recueil d’hommages offerts àHans Bögli (Avenches 1995) 303ff.
125 M. Hartmann, Vindonissa. Oppidum – Legionslager – Castrum(Windisch 1986) 30; M. Hartmann, M.A. Speidel, Die Hilfs-truppen des Windischer Heeresverbandes. Zur Besatzungsge-schichte von Vindonissa im 1. Jahrhundert n. Chr., Jahresber.GPV 1991, 3ff.; A. Hagedorn, Neues zum Lagerzentrum vonVindonissa – Ausgrabungen in der Breite 1996–1998, Jahresber.GPV 1998, 23ff.
126 H.-U. Nuber, Hofheim am Taunus. In: B. Baatz (Hrsg.), Die Rö-mer in Hessen (Stuttgart 1982) 350ff.; ders., Römisches Stein-kastell Hofheim, Main-Taunus-Kreis. Vorbericht über die Grabun-gen 1969–1970, Fundber. Hessen 14 (1974) 227ff.
127 Kraft 1955/56, 95.128 J.-S. Kühlborn, Das Römerlager Oberaden. In: J.-S. Kühlborn
(Hrsg.), Germaniam pacavi – Germanien habe ich befriedet.Archäologische Stätten augusteischer Okkupation (Münster 1995)103ff.; S. von Schnurbein, Zur Datierung der augusteischen Mi-litärlager. In: B. Trier (Hrsg.), Die römische Okkupation nördlichder Alpen zur Zeit des Augustus. Kolloquium Bergkamen 1989.Vorträge (Münster 1991) 1f.
129 J. van Heesch, Proposition d’une nouvelle datation des monnaiesen bronze à l’autel de Lyon frappé sous Auguste. Bull. Soc.Française Num. 48 (1993) 535ff.
130 D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischenKaiserchronologie (Darmstadt 1990) 78; R. Syme, Some ImperialSolutions. Phoenix 33 (1979) 316 mit Anm. 40f.
131 Kraft 1955/56, 95f.132 C.H.V. Sutherland, Divus Augustus Pater. A Study in the Aes
Coinage of Tiberius. Num. Chronicle 1 (1941) 97ff.133 S. Klein, H.-M. von Kaenel, The Early Roman Imperial Aes
Coinage: Metal Analysis and Numismatic Studies. Part 1, TheChemical Profile of Copper Coins of the Rome Mint fromAugustus to Claudius. Schweizer. Num. Rundschau 79 (2000) 78ff.
134 J. Nicols, The Chronology and the Significance of the M. AgrippaAsses. American Numismatic Society Museum Notes 19 (1974)65ff.
135 H.-M. von Kaenel, Die Organisation der Münzprägung Caligulas.Schweizer Münzbl. 66 (1987) 152; F.E. Koenig, Roma – Monetedal Tevere. L’imperatore Gaio (Caligola), Bollettino di Numis-matica di Roma 10 (1988) 35ff.
136 M. Metcalf, The Dating of the Agrippa-Asses. Num. Chronicle1988, 145 ff.
137 H.-M. von Kaenel, Münzprägung und Münzbildnis des Claudius.Antike Münzen und geschnittene Steine 9 (Berlin 1986) 252;R.Wolters, Die Organisation der Münzprägung in iulisch-claudi-scher Zeit, Num. Zeitschr. 106/107 (1999) 87; ders., Nummisignati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geld-wirtschaft. Vestigia 49 (München 1999) 61ff.
138 Die Formel hierfür lautet:
139 Subjektive Beschreibungen wie «leicht barbarisiert» oder «halb-barbarisch» verdeutlichen die Problematik.
140 V. Zedelius, Bemerkungen zu den so genannten Barbarisierungen.In: M. R.-Alföldi (Hrsg.), Ergebnisse des FMRD-Colloquiumsvom 8.–13. Februar 1976 in Frankfurt a.M. und in Bad Homburgv.d.H. SFMA 1 (Berlin 1979) 289ff.
141 In Vindonissa sind diese Stücke von Kraay 1962, Nr. 3142ff.,teilweise unter den Imitationen aufgeführt. Da dieses Phänomenbislang meines Wissens nicht in grösserem Mass untersucht wurdeund Arbeiten über Stempelkopplungen derartiger Münzen nichtvorliegen, kann auf Grund dieser schwachen Basis nicht ent-schieden werden, ob es sich um eine eigene Gruppe handelt oderob sich dies aus der Prägung al marco erklärt.
142 Wigg 1996. In: King/Wigg 1996, 415ff.; C.E. King, RomanCopies. In: King/Wigg 1996, 237ff.
143 Wigg 1996, Taf. 1 und 2. In: King/Wigg 1996, 415ff.; Kraay 1962,Nr. 4245, 4253, 4944–4951.
144 Anders: P.-A. Besombes. La monnayage d’imitation de bronze de
94 Nicht abgebildete Objekte sind im Katalog mit einem * versehen.95 E. Ettlinger, K. Roth-Rubi, Helvetische Reliefsigillaten und die
Rolle der Werkstatt Bern-Enge. Acta Bernensia 8 (Bern 1979)Motiv M 8.
96 Der Abstand zwischen den Fundorten beträgt etwa 14 m.97 In den Theaterschichten von Augst tritt die Form erst ab Schicht
19 auf (spätes 2., sowie 1. Drittel 3. Jh. bis 240/50). Zur Chrono-logie von Drag. 43 vgl. Furger 1989, 261 Anm. 28–37.
98 Ebnöther 1995, Taf. 46,901, jedoch weniger steil und grautonig.99 Vgl. etwa Roth-Rubi 1986, Taf. 8,151.100 Als Parallele sei nur Horisberger 2004, Nr. 270, erwähnt (Gebäude
F, Brandschutt Mitte 3. Jh.; vgl. ebenda S. 127–129). 101 Etwa Ebnöther 1995, Taf. 37,709 (frühestens 1. Hälfte 3. Jh., vgl.
S. 102).102 Vgl. etwa Roth-Rubi 1986, Taf. 13,261, dort steigt die Wand jedoch
etwas weniger steil an.103 Ein weisser Überzug findet sich etwa beim Exemplar aus dem
Geschirrdepot in Kaiseraugst-Schmidmatt; vgl. Furger 1989, 240mit Abb. 89. Ein bräunlichgrauer Überzug in Triengen-Murhubel,vgl. Fetz/Meyer-Freuler 1997, 140f. Nr. 564.
104 Roth-Rubi 1986, Taf. 13,283–295; Furger 1989, 240 mit Abb. 89= Schucany et al. 1999, 147 Abb. 38,4. Für die Abnahme im 2. Jh.vgl. Furger 1989, 262f.
105 Oelmann 1976, 66f. (Typ 69) und Taf. 3,79A. Für die Beispiele ausStutheien vgl. Anm. 104.
106 Horisberger 2004, Nr. 268f. Zur Datierung der Schicht vgl. Anm. 100.
107 Ähnlich monumentale Räucherkelche finden sich jedoch etwa inStraubing; vgl. Walke 1965, Taf. 73,2.
108 Martin-Kilcher 1980, 56 mit Taf. 51,1. Ebenfalls abgebildet inSchucany et al. 1999, 147 Abb. 38,5. Das Fragment wird dort ins2./3. Jh. datiert.
109 T. Spitzing, Die römische Villa von Lauffen a. N. (Kr. Heilbronn).Materialhefte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg12 (Stuttgart 1988) 103 Taf. 15,5; 44 A1; 48,11; Oelmann 1976, 68(Typ 82).
110 Walke 1965, Taf. 73,3.5; Nr. 4 lässt sich wegen seiner konkavenWandbildung nicht direkt vergleichen.
111 Ebnöther 1995, Taf. 14,217; 27,467; 29,503 etc.112 Vgl. etwa Ebnöther 1995, Taf. 4,64 (steiler und stärker umbie-
gender Rand. PU 1.1). Vgl. auch Fetz/Meyer-Freuler 1997, 126f.Nr. 470 (mit zwei Rillen).
113 Etwa Ebnöther 1995, Taf. 24,413; 25,438; Roth-Rubi 1986,Taf. 28,559.
114 Ebnöther 1995, 98f. Taf. 29,532 (um die Mitte 1. Jh.) undTaf. 41,797 (frühes 2. Jh.).
115 M.-F. Meylan Krause, Détermination de la provenance d’un grou-pe de céramiques à engobe interne «rouge pompéien» d‘Aventi-cum (Avenches, Suisse). S.F.E.C.A.G. Actes du congrès de Rouen1995 (Marseille 1995) 171–175.
116 Ebd.117 A.R. Furger, S. Deschler-Erb, Das Fundmaterial aus der Schich-
tenfolge beim Augster Theater. Forsch. Augst 15 (Augst 1992) 93;Martin-Kilcher 1980, 48: späteres 2. bis spätes 3. Jh.; Roth-Rubi1986, 36: 1. Hälfte 2. Jh.–1. Hälfte 4. Jh.
118 In Frage käme allerdings auch ein grautoniger Topf, wie er etwain Windisch aus augusteischer Zeit belegt ist; vgl. Schucany et al.1999, Taf. 85,20.
119 So etwa Kunnert 2001, Taf. 16,327; Roth-Rubi 1986, Taf. 18,396.Vgl. auch Martin-Kilcher 1980, 48.
120 Martin-Kilcher 1980, 48 Taf. 45,5–7 (= Abb. 29,30–31). 121 Martin-Kilcher 1980, 48 (Taf. 45,5). Die anderen Dolien (Taf.
45,6–7) stammen aus der gutshofeigenen Töpferwerkstatt undsind in das letzte Drittel des 1. Jh. datiert. Nach Schucany et al.1999, 77 fehlen seit dem späteren 2. Jh. Dolien in den Komplexen.
122 H. Zehnacker, La trouvaille de la Villeneuve-au-Châtelot (Aube).Trésors monétaires 6 (1984) 9ff.
123 E. Deschler-Erb, M. Peter, S. Deschler-Erb, Das frühkaiserzeit-liche Militärlager in der Kaiseraugster Unterstadt (Augst 1991).
124 C. Bossert-Radtke, Überlegungen zur Ausgrabung des gallo-römischen Tempels Sichelen 2 im Süden von Augusta Raurica. In:
272
Münzen pro Periode/Regierungszeit
Länge der Periode/Regierungszeit
1000x
Gesamtzahl aller Münzen
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 272
FISCHER 1990 – Th. Fischer, Das Umland des römischenRegensburg. Münchner Beiträge Vor- und Frühgesch. 42(München 1990).FORRER 1883 – R. Forrer, Die Pfahlbaute auf dem «Gros-sen Hafner» bei Zürich. ASA 16, 1883, 463–465.FREI 1968 – B. Frei, Der gallorömische Tempel auf derUfenau im Zürichsee. In: Provincialia. FS R. Laur-Belart(Basel und Stuttgart 1968) 299–316.FURGER 1989 – A. Furger, Der Inhalt eines Geschirr- oderVorratsschrankes aus dem 3. Jahrhundert von Kaiseraugst-Schmidmatt. JbAK 10, 1989, 213–268.GOUDINEAU ET AL. 1994 – Ch. Goudineau, I. Fauduet,G. Coulon (Hrsg.), Les sanctuaires de tradition indigène enGaule romaine. Actes du colloque d’Argentomagus 1992(Paris 1994).GUYAN ET AL. 1985 – W.U. Guyan, J.E. Schneider, A. Zür-cher, Turicum – Vitudurum – Iuliomagus. Drei Vici in derOstschweiz. FS Otto Coninx (Zürich 1985).HEDINGER ET AL. 2001 – B. Hedinger et al., Beiträge zumrömischen Oberwinterthur – Vitudurum 9. Ausgrabungenauf dem Kirchhügel und im Nordosten des Vicus 1988–1998.Monogr. KA Zürich 35 (Zürich und Egg 2001).HEIERLI 1888 – J. Heierli, Pfahlbauten. 9. Bericht. MAGZ22, 2, 1888.HORISBERGER 2004 – B. Horisberger, Der Gutshof inBuchs und die römische Besiedlung im Furttal. Monogr. KAZürich 37 (Zürich und Egg 2004).HORNE/KING 1980 – P.D. Horne, A.C. King, Romano-Celtic temples in continental Europe. In: W. Rodwell(Hrsg.), Temples, churches and religion: Recent Research inRoman Britain 2 (BAR British Ser. 77) (Oxford 1980)369–555.KELLER 1872 – F. Keller, Die Pfahlbauten in und umZürich, B. Der grosse Hafner. ASA 5, 1872.KELLER 1879 – F. Keller, Pfahlbauten. 8. Bericht. MAGZ20, 3, 1879.KELLER 1880 – F. Keller, Funde auf dem Grossen Hafner.ASA 13, 1880.KING/SOFFE 1994 – A. King, G. Soffe, Recherches récen-tes sur les temples romano-celtiques de Grande-Bretagne.L’exemple de Hayling Island. In: Ch. Goudineau, I. Fauduet,G. Coulon (Hrsg.), Les sanctuaires de tradition indigène enGaule romaine. Actes du colloque d’Argentomagus 1992(Paris 1994) 33–48.KING/WIGG 1996 – C.E. King, D.G. Wigg (Hrsg.), CoinFinds and Coin Use in the Roman World. The ThirteenthOxford Symposium on Coinage and Monetary History25.–27.3.1993. A NATO advanced Research Workshop.SFMA 10 (Berlin 1996).KRAAY 1962 – C.M. Kraay, Die Münzfunde von Vindonissa(bis Trajan). Veröff.GPV 5 (Basel 1962).KRAFT 1955/56 – K. Kraft, Das Enddatum des Legionsla-gers Haltern. Bonner Jahrb. 155/156, 1955/56, 95–111.KUNNERT 2001 – U. Kunnert, Urdorf-Heidenkeller. ZA 5,Römische Gutshöfe (Zürich und Egg 2001).LAUR-BELART 1963 – R. Laur-Belart, Hüttenböschen. Eingallorömischer Vierecktempel am unteren Ende des Walen-sees. Jahrb. Hist. Verein Kanton Glarus 60, 1963, 5–24.MARTIN-KILCHER 1980 – S. Martin-Kilcher, Die Fundeaus dem römischen Gutshof von Laufen-Müschhag. Ein Bei-trag zur Siedlungsgeschichte des nordwestschweizerischenJura (Bern 1980).OELMANN 1976 – F. Oelmann, Die Keramik des KastellsNiederbieber. Materialien zur röm.-germ. Keramik 1 (Frank-furt a. M. 1914, Nachdruck Bonn 1976).
Claude Ier. In: A.-F. Auberson, H.R. Derschka, S. Frey-Kupper(Hrsg.), Fälschungen – Beischläge – Imitationen. Sitzungsberichtdes vierten internationalen Kolloquiums der SchweizerischenArbeitsgemeinschaft für Fundmünzen (Martigny, 1.–2. März 2002)(Lausanne 2004) 31ff.
145 S. Frey-Kupper, Rüttenen/Martinsflue. Ein Ensemble von vierSesterzen aus dem späten 2. oder frühen 3. Jahrhundert n.Chr.:Zufallsverlust oder Votivgabe? Archäologie und Denkmalpflegeim Kanton Solothurn 8 (2003) 36.
146 Deschler-Erb et al. 1996, 181.147 Es handelt sich um FN 463, 702 und 1153.148 Die Schäfte FN 139, 411, 422, 522, 822, 863, 911, 1017, 1146, 1187
werden dagegen nicht aufgeführt.149 Deschler-Erb et al. 1996, 181 Anm. 1255. Zur Verwendung der
Schraube in der Antike vgl. B. Deppert-Lippitz et al., DieSchraube zwischen Macht und Pracht. Das Gewinde in der Antike(Sigmaringen 1995).
150 Vgl etwa Deschler-Erb et al. 1996, 189 mit Abb. 175.151 Deschler-Erb et al. 1996, E 854–855 und 859–861.152 Walke 1965, Taf. 120,12–13; Ebnöther 1995, Taf. 19,325 (aus
Bronze); J. Rychener, Der römische Gutshof in Neftenbach.Monogr. KA Zürich 31/1–2 (Zürich und Egg 1999) Taf. 104,3093(Bronze) und Taf. 137,4086 (Eisen).
153 Römerstrasse 213/215, vgl. Hedinger et al. 2001, 138 Abb. 163Kat. 61 (Dm. 28 mm, 45 g).
154 13,64 Gramm, vgl. A. Mutz, Römische Waagen und Gewichte ausAugst und Kaiseraugst. Augster Museumsheft (Augst 1983) Tab. 2S. 7.
155 Es sind sechs Fragmente nachgewiesen: FN 429, 575, 581, 759,1002, 1031.
156 FN 938, 1061, 1109, 1142.157 Die orangetonigen Stücke überwiegen deutlich.158 Zur Grösse vgl. Fetz/Meyer-Freuler 1997, 374.159 Weitere Stücke, die auf diese Weise angebracht wurden
(Schlaufen?/Wellen?): FN 368, 433, 811, 865.160 Hedinger et al. 2001, 159 Taf. 39,138 (riefelverzierter Becher, spätes
1. oder beginnendes 2. Jh.); Martin-Kilcher 1980, 22, mit Verweisauf Windisch-Schutthügel (Beginn 2. Jh.).
161 Kunnert 2001, 57. Auch Falten treten seit dem späten 1. Jh. auf,vgl. etwa (Schucany et al. 1999, 152 D.5: Augst, 70–90; Falten-becher begriesst mit Barbotine-Lunulae).
162 M. Pavlinec, Zur Datierung römischzeitlicher Keramik in derSchweiz. JbSGUF 78 (1995) 70 (175/200–225/250); Kunnert 2001,58 Nr. 94–96 (Glasschliff nicht vor Ende 2. Jh.) mit Verweis aufG. Kaenel, Aventicum I (Avenches 1974) 19 Taf. 33f.
6 ABGEKÜRZT ZITIERTE LITERATUR
DESCHLER-ERB ET AL. 1996 – E. Deschler-Erb, V. Schal-tenbrand Obrecht, Chr. Ebnöther, A. Kaufmann-Heini-mann, Die Funde aus Metall. Ein Schrank mit Lararium des3. Jahrhunderts. Ausgrabungen im Unteren Bühl. Beiträgezum römischen Oberwinterthur – Vitudurum 7. Monogr. KAZürich 27 (Zürich und Egg 1996).DIREKTION DER QUAIBAUTEN 1889 – Bericht über dieAusführung des Zürcherischen Quaiunternehmens in denJahren 1881–1888, erstattet dem Verwaltungsausschusse derUnternehmung von der Direktion der Quaibauten (Zürich1889).EBNÖTHER 1995 – Chr. Ebnöther, Der römische Gutshofin Dietikon. Monogr. KA Zürich 25 (Zürich 1995).FAUDUET 1993a – I. Fauduet, Atlas des sanctuairesromano-celtiques de Gaule. Les fanums (Paris 1993).FAUDUET 1993b – I. Fauduet, Les temples de tradition cel-tique en Gaule romaine (Paris 1993).FETZ/MEYER-FREULER 1997 – H. Fetz, Chr. Meyer-Freu-ler, Triengen, Murhubel. Ein römischer Gutshof im Suretal.Arch. Schr. Luzern 7 (Luzern 1997).
273
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 273
Fundmünzenbearbeitungsstelle des Kantons Zürich am Münz-kabinett Winterthur; Code des Schweizer Fundmünzinventar (SFI-Code, vgl. IFS 1 [Lausanne 1993] 20f.); in Klammern jeweilsfrüherer SFI-Code.
TS1 1 BS Drag. 18/31. Verbrannt. Mittel- oder ostgallisch. FN 458.2 1 WS Drag. 37. Helvetisch. FN 190.3* 1 WS Drag. 37. Evtl. zu Kat. 2 gehörig. FN 741.4* 1 WS Becher mit Glasschliff. Oberfläche innen abgeplatzt. FN 444.
Nicht besprochen:1 WS Drag. 18/31? Oberfläche aussen abgeplatzt. Innen deutlicherWandknick, durch Rille betont. FN 527.1 WS Teller. FN 808.1 WS Teller? Oberfläche innen abgeplatzt. FN 645.1 WS Teller? Oberfläche beidseitig praktisch vollständig abgeplatzt.FN 700.1 WS. Oberfläche innen abgeplatzt. FN 541.1 WS. Oberfläche innen abgeplatzt. FN 1085.
TS-Imitation5 3 RS Imitation Drag. 43. Oranger Ton, orangebrauner, dünn auf-getragener matter Überzug, teilweise abgerieben. FN 147; 560; 1089.6 1 RS Imitation Drag. 43. Brauner Ton, dunkelbrauner Überzug.FN 648.
Glanztonkeramik7 1 RS Becher Niederbieber 33. Harter, grauer, im Kern rotbraunerTon, dichter schwarzer Überzug. FN 99.8 1 RS Becher Niederbieber 33. Grauer Ton, grauer Überzug. FN 99.9 1 RS Becher Niederbieber 33. Orangebeiger Ton, beidseitig Restevon braunem Überzug. FN 607.10* 1 WS Becher. Oranger Ton, beidseitig oranger Überzug. Ratter-blechband. FN 351.11* 1 WS Becher. Orangebeiger Ton, beidseitig brauner bzw. schwar-zer Überzug. Ratterblechband mit Falte. FN 749.12* 1 WS Becher? Orangebeiger Ton, beidseitig brauner bzw. schwar-zer Überzug. Ratterblechband. Evtl. zu Kat. 11 gehörig. FN 471.13* 1 WS Becher. Orangebeige, innen Reste von schwarzem Über-zug. Oberfläche aussen teilweise abgeplatzt. Ratterblechband mit An-satz von Falte. FN 548.14* 1 WS Becher. Oranger Ton, aussen beige. Aussen, mit Abstandzur Rille, orangebrauner Überzug mit braunschwarzer Begrenzungs-linie. Innen oranger Überzug. Ratterblechband durch Rille begrenzt.FN 556.15* 1 WS Becher. Oranger Ton, beidseitig brauner Überzug. Ratter-blechband mit Falte. FN 825.16* 1 WS Becher? Rotbrauner Ton, aussen Reste von braunem Über-zug. Aussen zwei feine horizontale Rillen, daneben evtl. Ratterblech-band. FN 628.17* 1 WS Becher. Beiger Ton. Beidseitig Reste von orangebraunembzw. braunem Überzug. Verbrannt? Barbotineblättchen. FN 986.18* 1 WS Becher. Orangeroter Ton, beidseitig orangeroter dickerÜberzug. Glasschliffdekor. FN 698.
Nicht besprochen:1 BS Becher. Oranger Ton, innen Glanztonüberzug. Verbrannt. FN 810.1 BS Becher. Orangebrauner Ton, beidseitig dunkelbrauner Über-zug, teilweise abgerieben. FN 828.1 BS Becher. Brauner, teilweise grauer Ton. Verbrannt. Auf derBodenunterseite Reste von braunem Überzug. FN 147.1 BS Becher. Lachsfarbener Ton, orangeroter Überzug, Boden-unterseite ausgespart. FN 1077.1 WS Becher? Orangebrauner Ton, aussen Reste von braunemÜberzug. Aussen zwei feine horizontale Rillen. FN 826.7 WS Becher? Lachsfarbener Ton, aussen orangebrauner, teilweiseoranger Überzug. FN 99; 641; 686; 720; 847; 1041.1 WS Becher? Orangebrauner Ton, beidseitig brauner Überzug. FN 686.
ROTH-RUBI 1986 – K. Roth-Rubi, Die Villa von Stut-heien/Hüttwilen TG. Ein Gutshof aus der mittleren Kaiser-zeit. Antiqua 14 (Basel 1986).SCHMID 1966 – E. Schmid, Ergebnisse der Ausgrabung1964 beim gallo-römischen Tempel auf Hüttenböschen (Mol-lis). Jahrb. Hist. Verein Kanton Glarus 61, 1966, 35–41.SCHNEIDER/GUTSCHER 1980 – J. Schneider, D. Gut-scher, Turicum. Zürich in römischer Zeit. Turicum Winter1980, 22–43.SCHUCANY ET AL. 1999 – C. Schucany et al., RömischeKeramik in der Schweiz. Antiqua 31 (Basel 1999).STEHLIN 1910 – K. Stehlin, Über den Rundbau im Rheinebei Augst. Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertums-kunde 9, 1910, 66–76.TUFFREAU-LIBRE 1994 – M. Tuffreau-Libre, La céramiquedans les sanctuaires gallo-romains. In: Ch. Goudineau,I. Fauduet, G. Coulon (Hrsg.), Les sanctuaires de traditionindigène en Gaule romaine. Actes du colloque d’Argento-magus 1992 (Paris 1994) 128–137.VIOLLIER 1930 – D. Viollier, Les civilisations préhistori-ques et les groupements de trouvailles dans le canton deZurich (ohne Jahr, um 1930). [Unpubliziertes Manuskript zueiner nicht veröffentlichten archäologischen Karte des Kan-tons Zürich, im SLM].WALKE 1965 – N. Walke, Das römische Donaukastell Strau-bing – Sorviodurum. Limesforschung 3 (Berlin 1965).WETLI 1885 – K. Wetli, Die Bewegung des Wasserstandesdes Zürichsees während 70 Jahren und Mittel zur Senkungseiner Hochwasser. Bericht an die Tit. Direktion der öffent-lichen Arbeiten des Kantons Zürich (Zürich 1885).WIGG 1996 – D.G. Wigg, The Function of the Last CelticCoinage. In: C.E. King, D.G. Wigg (Hrsg.), Coin Finds andCoin Use in the Roman World. The Thirteenth Oxford Sym-posium on Coinage and Monetary History 25.–27.3.1993.A NATO advanced Research Workshop. SFMA 10 (Berlin1996) 415–436.
7 KATALOG
In den Katalog sind nur diejenigen Funde aufgenommen worden,die sich mit einiger Sicherheit der römischen Zeit zuweisen lassen.Die Ziegel, die Hüttenlehmbrocken sowie die Schlacken wurden beider Besprechung ausgeklammert.Alle im Text erwähnten Objekte sind mit einer Katalognummerversehen. Stücke, die besprochen, jedoch nicht abgebildet werden,sind mit einem * versehen. Anschliessend folgen die Objekte, die imText nicht behandelt wurden, der Vollständigkeit halber jedochaufgeführt wurden.Schrägstrich zwischen den FN bedeutet, dass die Fragmenteanpassen.
Vorbemerkungen zum Münzkatalog (Kat. 50–138)Der Katalog enthält folgende Angaben:– Prägeherr; Münzstätte; Nominal; Datierung (bei den Imitationen
entfällt die Datierung).– Beschreibung Vs./Rs.– Referenzzitat(e).– Katalognummer; Gewicht; kleinster und grösster Durchmesser;
Schrötlingsdicke; Stempelstellung in ° (auf Kreis von 360° über-tragen); Abnutzungs- und Korrosionsgrad (Erhaltung A und K,nach den Richtlinien des Inventars der Fundmünzen der Schweiz,siehe Bulletin IFS 2 Supplement, 1995, 10f. 18f.).
– Bemerkungen.– Angaben zur Auffindung/Position (bei Neufunden).– Art des Fundes (Neu-/Altfund); Funddatum; Laufnummer der
274
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 274
1 WS Topf. Grauer Ton, aussen stellenweise braun (verbrannt). FN 606.1 WS Topf. Grauer Ton. Innen Brandspuren (schwarzer Belag). FN 129.1 WS Tonne? Grauer Ton, dickwandig (ca. 9 mm). Aussenunregelmässiger Brand oder verbrannt. FN 491.
Grobkeramik32 1 RS Kochteller. Dunkelroter, teilweise dunkelbrauner, grobgemagerter Ton. Brandspuren. Auf einfacher Scheibe oder von Handhergestellt. FN 842.33 1 BS pompeianisch rote Platte. Braunbeiger, stark glimmer-haltiger Ton. Innen Reste von braunem Überzug. Innen zwei feinekonzentrische Rillen, dazwischen Ratterblechband. FN 1084.34* 1 BS Kochtopf. Grauer Ton. FN 190.35* 1 WS Kochtopf. Grauer Ton, aussen hellgrau bzw. stellenweisebraungrau. Innen und auf den Bruchkanten teilweise Brandspuren.FN 201.
Reibschüsseln36 1 RS rätische Reibschüssel. Orangebeiger Ton, beidseitig Restevon orangem Überzug. Verbrannt. Innen relativ grobe Körnungunterhalb der Hohlkehle. FN 698/FN 250.37 1 RS Reibschüssel. Beiger Ton, im Kern teilweise gelblich. Innenbis zum Kragen grobe Körnung. FN 830.38* 1 RS rätische Reibschüssel. Rand aussen abgebrochen. Orange-beiger Ton, Oberfläche stark verwaschen. Reste von orangem Über-zug. Innen relativ grobe Körnung unterhalb der Hohlkehle. Evtl.zugehörig zu Kat. 36. FN 234.39* 1 RS Reibschüssel mit Kragenrand (nur Kragen erhalten).Oranger, mit orangebraunen Partikeln gemagerter Ton. FN 686.40* 1 BS Reibschüssel? Orangebeiger Ton. Flacher nicht abgesetzterFuss. Evtl. gleiches Gefäss wie Kat. 36 und 38, jedoch ohne Körnung.Sicher gleiches Fabrikat. FN 147/1117.41* 1 WS Reibschüssel? Orangebeiger Ton, ohne Körnung. Evtl.gleiches Gefäss wie Kat. 40. FN 1075.42* 1 WS Reibschüssel. Beiger Ton. Innen feine Körnung. FN 578.43* 1 WS rätische Reibschüssel. Dunkelroter, im Kern braungrauerTon, rotbrauner Überzug. Innen, bis zum Ansatz der Hohlkehle,grobe Körnung. FN 618.44* 1 WS rätische Reibschüssel. Dunkelroter, im Kern braungrauerTon, rotbrauner Überzug. Innen grobe Körnung, aussen braunerÜberzug. Evtl. gleiches Gefäss wie Kat. 43. FN 812.
Dolien45* 1 WS Dolium. Grauer Ton. Verbrannt. FN 319.
Amphoren46* 2 WS Amphore Dressel 20. Hellbeiger, sandiger Ton, im Kernorange. FN 147; 596.47* 1 WS Amphore (Wein- oder Fischsaucenamphore). Gelbgrauer,im Kern oranger Ton, kompakt, aussen gelber Überzug. FN 144.
Nicht besprochen:1 WS Amphore? Weisslichgelber Ton. Splitter. Oberfläche aussenabgeplatzt. FN 556.
Lampen48* 1 WS Presslampe? (oder Splitter von einem verwaschenenZiegel?). Oranger, ziegelähnlicher Ton. Schnauzenansatz? FN 304.
Glas49 1 Henkelfragm. Bandförmig. Grünliches Glas, durchsichtig. FN 138.
Metall
Münzen
1 Grosser Hafner
1 WS Becher? Oranger Ton, beidseitig Reste von orangebraunemÜberzug. FN 677.1 WS Becher? Beiger, aussen oranger Ton, beidseitig Reste vonbraunem Überzug. FN 251.1 WS Becher? Oranger Ton, innen Reste von braunem Überzug.FN 391.1 WS Becher. Oranger Ton, innen oranger Überzug. FN 1022.1 WS Becher? Orangebeiger Ton, aussen hellbrauner Überzug. FN 683.1 WS Becher? Oranger Ton, aussen hellbrauner Überzug. FN 205.1 WS. Oranger Ton, aussen Reste von braunem Überzug. FN 1053.
Helltonige Gebrauchskeramik19 1 RS Honigtopf. Beiger, teilweise orangebeiger und grauer Ton.Verbrannt? FN 99.20 1 RS Krug oder Topf. Orange, stellenweise grau, Reste vongelbweissem Überzug? Verbrannt? FN 222.21 1 RS, 1 WS Schüssel. Brauner sandiger Ton, teilweise relativgrobe Magerungspartikel. FN 677; 659.22 1 RS Schüssel? Oranger Ton, aussen orangebeige. FN 876.23 1 WS Räucherkelch. Gelbbeiger, im Kern oranger Ton, glimmer-haltig. Wandknick mit Fingertupfenleiste, darunter vertikale, läng-liche Delle. FN 227.24* 1 BS Krug. Gelbbeiger Ton. Verbrannt? FN 167.25* 1 BS Krug? Orangebeiger Ton. FN 237/FN 622.26* 12 WS Krug. Graubeiger, aussen randlich oranger Ton. FN 238;658; 677; 716; 718; 772; 775; 812; 840; 895; 969.27* 1 WS Honigtopf. Lachsfarbener Ton. Aussen dicker matter,oranger Überzug. Innen einzelne Tropfen davon. Zweistabiger,vertikaler Henkel setzt oberhalb des maximalen Körperdurchmessersan. FN 222.
Nicht besprochen:1 WS Krug? Brauner, glimmerhaltiger Ton. Innen Tropfen vonbraunem, mattem Überzug (aussen abgerieben?). FN 683.1 WS geschlossenes Gefäss (Krug?). Orangebrauner Ton, aussenpolierte Oberfläche. FN 1194.24 WS Krug. Oranger, teilweise orangebrauner Ton, orangebrauneMagerungspartikel. Verbrannt. FN 489; 532; 539; 556; 564; 617; 645;686; 689; 696; 716; 723; 724; 982; 1007; 1035; 1085; 1089; 1090.1 WS Krug? Oranger Ton. FN 959/1019.1 WS Krug? Oranger, aussen orangebeiger Ton. FN 957/1089.67 WS, v.a. geschlossene Gefässe. Oranger, orangebrauner undbrauner Ton. Davon FN 147; 201; 238; 525; 557; 570; 677; 689; 713;766; 932 und 1115 verbrannt. FN 99; 147; 201; 205; 238; 239; 251;325; 440; 483; 489; 525; 529; 534; 557; 564; 567; 570; 579; 584; 641;653; 658; 670; 677; 681; 686; 689; 695; 713; 716; 724; 729; 744; 754;760; 766; 814; 826; 840; 843; 867; 881; 923; 932; 937; 957; 962; 969;990; 1007; 1019; 1040; 1115; 1117; 1144; 1156.3 WS geschlossene Gefässe. Weisslichgelber Ton. FN 277; 1024; 1166.
Grautonige Gebrauchskeramik28* 1 BS Schultertopf. Grauer Ton, aussen schwarze, metallisch glän-zende Oberfläche. FN 123.29* 1 WS Schultertopf. Grauer Ton, aussen schwarze, metallischglänzende Oberfläche. 2 Bänder mit Rollstempeldekor, dazwischenzwei feine horizontale Rillen. Eines der Rollstempelbänder auf deranderen Seite durch weitere Rille begrenzt. FN 440.30* 1 WS Schultertopf. Grauer Ton, aussen metallisch glänzendeOberfläche. Aussen mehrere Reifen von Rollstempel mit drei feinen,umlaufenden Rillen. FN 852.31* 1 WS Topf. Grauer Ton. Verbrannt (auch auf Bruchstelle).FN 147.
Nicht besprochen:1 WS Topf. Grauer Ton. Aussen dicker, schwarzer Überzug, teilweiseabgeplatzt, evtl. durch Politur entstanden. Römisch? FN 1040.1 WS Topf. Grauer Ton. Brandspuren. Aussen zwei feine horizontaleRillen. FN 956.1 WS Topf. Grauer Ton. Verbrannt. Zwei feine vertikale Rillen.FN 344.
275
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 275
Rs. ROM ET AVG; Altarumfriedung.RIC I2, S. 58, Nr. 246.58 AE; 6,687 g; 21,9/22,9 mm; 2,5 mm; 300°. A 3/3 K 1/1.Lage 643/240; Schicht 0.0.Neufund 12.02.1998; FmZH, LNr. 4541; SFI 261-53.03:1.
Augustus oder Augustus für Tiberius
Lugdunum, As, nach 7 v.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf n.r.Rs. ROM ET AVG; Altarumfriedung.RIC I2, S. 57, Nr. 230 Typ.59 AE; 4,53 g; 21,7/25,4 mm; 2,2 mm; ?°. A 4/4 K 4/4.Bemerkung: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt); verschliffenerAusbruch am Rand.Altfund 1911; SLM AG R 3215; SFI 261-53.01:4 (= 261-0053.02:12).60 AE; 8,64 g; 24,9/25,8 mm; 2,6 mm; 315°. A 4/3 K 3/3.Bemerkung: Brandspuren?Altfund 1911; SLM AG R 3209; SFI 261-53.01:5 (= 261-53.02:34).
Tiberius
Roma, As, 14–21 n.Chr.Vs. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VII; Kopf des Tiberiusn.l.Rs. PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVII S-C; Livia sitzendn.r.RIC I2, S. 96, Nr. 34.61 AE; 8,091 g; 27,4/27,0 mm; 2,1 mm; 360°. A 3/3 K 2/2.Lage 640/239; Schicht 0.0.Neufund 27.02.2001; FmZH, LNr. 4571; SFI 261-53.05:5.
Roma, As, 34–36 n.Chr.Vs. TI CAESAR DIVI F AVGVST IMP VIII; Kopf des Tiberius mitLorbeer n.l.Rs. PONTIF MAX TR POT XXXVII S-C; Globus und Ruder.RIC I2, S. 98, Nr. 58.62 AE; 9,123 g; 25,1/26,9 mm; 2,90 mm; 30°. A 3/3 K 2/2.Lage 640/241; Schicht 0.0.Neufund 27.02.2001; FmZH, LNr. 4570; SFI 261-53.05:6.
Roma, As, 34–36 n.Chr.Vs. TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VIII; Kopf des Tiberiusmit Lorbeer n.l.Rs. PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XXXVI; geflügelter Ca-duceus.RIC I2, S. 98, Nr. 53.63 AE; 5,372 g; 22,2/22,9 mm; 2,8 mm; 210°. A 4/4 K 2/2.Bemerkung: kleiner Schrötling.Lage 648.0–650.0/236.0–239.0; Schicht 0.0.Neufund 03.02.1998; FmZH, LNr. 4531; SFI 261-53.03:2.64 AE; 8,175 g; 26,0/27,3 mm; 2,3 mm; 30°. A 4/4 K 3/3.Lage 643/229; Schicht 0.0.Neufund 23.02.2001; FmZH, LNr. 4566; SFI 261-53.05:7.
Tiberius für Divus Augustus
Roma, As, 14–15 n.Chr.Vs. DIVVS AVGVSTVS PATER, Kopf des Augustus n.l.Rs. S-C; Livia sitzend n.r., hält Szepter und Patera.RIC I2, S. 99, Nr. 71–72.65 AE; 7,154 g; 25,1/25,5 mm; 2,1 mm; 270°. A 4/4 K 1/1.Lage 646/238; Schicht 0.0.Neufund 29.02.2000; FmZH, LNr. 4544; SFI 261-53.04:2.
Roma, As, 22/23 n.Chr.Vs. DIVVS AVGVSTVS PATER; Kopf des Augustus mitStrahlenkrone n.l.
Übergangszeit
Unbestimmte Münzstätte, As, 44–31 v.Chr.Vs. [ --- ]; ?Rs. [ --- ]; ?50 AE; 13,769 g; 27,2/29,5 mm; 3,5 mm; ?°. A 5/5 K 4/4.Bemerkung: gegossener Schrötling; gelocht.Lage 659/231; Schicht Stö Bg.Neufund 29.01.2001; FmZH, LNr. 4557; SFI 261-53.05:2.
Übergangszeit oder Kaiserzeit
Unbestimmte Münzstätte, Denar (Anima).Vs. [ --- ]; ?Rs. [ stehende weibliche Figur mit Füllhorn ]; ?51 AE; 0,893 g; 14,9/16,4 mm; 1,7 mm; ?°. A 0/0 K 0/0.Bemerkung: verbrannt.Lage 639/241; Schicht 0.0.Neufund 28.02.2001; FmZH, LNr. 4573; SFI 261-53.05:1.
Kaiserzeit
Augustus
Nemausus, As, 12–8 v.Chr.Vs. IMP DIVI F; Kopf des Agrippa mit Schiffskrone und Kopf desAugustus.Rs. COL NEM; Krokodil an Palmbaum gefesselt.RIC I2, S. 51, Nr. 155.52 AE; 11,356 g; 23,9/24,6 mm; 3,5 mm; 165°. A 4/4 K 2/2.Lage 646/238; Schicht 0.0.Neufund 29.02.2000; FmZH, LNr. 4546; SFI 261-54.04:1.53 AE; 12,582 g; 24,7/25,7 mm; 3,5 mm; 210°. A 3/3 K 2/2.Lage 644/228; Schicht 0.0.Neufund 22.02.2001; FmZH, LNr. 4562; SFI 261-53.05:3.
Lugdunum, As, 7–3/2 v.Chr.Vs. CAESAR PONT MAX; Kopf des Augustus n.r.Rs. ROM ET AVG; Altarumfriedung.RIC I2, S. 57, Nr. 230.54 AE; 9,829 g; 24,2/25,5 mm; 2,9 mm; 210°. A 3/3 K 2/2.Altfund; MKWt R 3869; SFI 261-53.08:1.55 AE; 9,937 g; 25,7/26,3 mm; 2,9 mm; 210°. A 3/3 K 2/2.Lage 657.40/233.40; Schicht 0.0.Neufund 29.01.2001; FmZH, LNr. 4558; SFI 261-53.05:4.
Augustus für Tiberius
Lugdunum, As, 9–10 n.Chr.Vs. TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V; Kopf des Tiberius mitLorbeer n.l.Rs. ROM ET AVG; Altarumfriedung.RIC I2, S. 58, Nr. 237 oder 238b.56 AE; 7,87 g; 23,5/25,0 mm; 2,9 mm; 210°. A 2/2 K 4/4.Bemerkung: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt).Altfund 1911; SLM AG R 3213; SFI 261-53.01:2 (= 261-53.02:10).
Lugdunum, As, 9–14 n.Chr.Vs. TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V[ --- ]; Kopf des Tiberiusmit Lorbeer n.l.Rs. ROM ET AVG; Altarumfriedung.RIC I2, S. 58, Nr. 238a oder 245.57 AE; 10,08 g; 23,8/24,4 mm; 6,7 mm; 150°. A 3/3 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3218; SFI 261-53.01:3 (= 261-53.02:15).
Lugdunum, Semis, 10–11 n.Chr.Vs. TI CAESAR AVGVST IMPERATOR V[ --- ]; Kopf des Tiberiusmit Lorbeer n.r.
276
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 276
Lage 646/238; Schicht 0.0.Neufund 29.02.2000; FmZH, LNr. 4545; SFI 261-53.04:3.79 AE; 7,802 g; 26,9/28,0 mm; 2,3 mm; 210°. A 4/4 K 3/3.Lage 643/241; Schicht 0.0.Neufund 23.02.2001; FmZH, LNr. 4565; SFI 261-53.05:12.
Roma, As, 42–43 n.Chr.Vs. TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P; Kopf desClaudius n.l.Rs. S-C; Minerva gehend n.r., hält Schild und Lanze.RIC I2, S. 130, Nr. 116.80 AE; 10,042 g; 24,6/27,1 mm; 3,3 mm; 180°. A 4/4 K 2/2.Lage 650/241; Schicht 0.0.Neufund 03.02.1998; FmZH, LNr. 4530; SFI 261-53.03:7.
Roma, As, 41–43 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf des Claudius n.l.Rs. [ --- ]; S-C; sitzende Figur n.l.81 AE; 9,27 g; 25,2/26,1 mm; 180°. A 3/2 K 4/4.Bemerkung: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt).Altfund 1911; SLM AG R 3219; SFI 261-53.01:10 (= 261-53.02:16).
Regierungszeit des Claudius
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [CAESAR PONT MAX]; Kopf des Augustus n.r.Rs. [ROM ET AVG]; Altarumfriedung.RIC I2, S. 57, Nr. 230.82 AE; 3,369 g; 22,2/23,3 mm; 1,7 mm; 210°. A 4/4 K 2/2.Lage 649/237; Schicht 0.0.Neufund 03.03.2000; FmZH, LNr. 4549; SFI 261-53.04:4.
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [TI CAESAR AVGVST F IMPERAT V]; Kopf des Tiberius mitLorbeer n.l.Rs. [ROM ET AVG]; Altarumfriedung.83 AE; 6,68 g; 22,8/25,1 mm; 2,3 mm; 180°. A 3/3 K 3/3.RIC I2, S. 58, Nr. 238b.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Vs.); ausgebrochen (mehr als 3/4intakt); kleiner Schrötling.Altfund 1911; SLM AG R 3212; SFI 261.53.01:11 (= 261-53.02:9).
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [ --- ]; Kopf n.r.Rs. ROM ET AVG; Altarumfriedung.RIC I2, S. 58, Nr. 237 Typ.84 AE; 4,82 g; 25,7/26,7 mm; 1,8 mm; 105°. A 4/3 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Rs.).Altfund 1911; SLM AG R 3216; SFI 261.53.01:12 (= 261-53.02:13).
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [DIVVS AVGVSTVS PATER]; Kopf des Augustus mitStrahlenkrone n.l.Rs. [PROVIDENTIA S-C]; Altar.RIC I2, S. 99, Nr. 81.85 AE; 4,333 g; 22,5/22,8 mm; 1,6 mm; 30°. A 4/4 K 2/2.Lage 641/237; Schicht 0.0.Neufund 06.03.2000; FmZH, LNr. 4552; SFI 261-53.04:5.86 AE; 5,73 g; 25,9/27,5 mm; 2,0 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Rs.); ausgebrochen (mehr als 3/4intakt); Einhieb (Rs.), feine Kerbe über dem S; Kerbrisse und kleinereAusbrüche entlang des Randes.Altfund 1911; SLM AG R 3210; SFI 261-53.01:13 (= 261-53.02:35).87 AE; 6,83 g; 25,2/26,7 mm; 1,9 mm; 360°. A 4/3 K 4/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Rs.); ausgebrochen (mehr als 3/4intakt); Brandspuren?Altfund 1911; SLM AG R 3211; SFI 261-53.01:13 (= 261-53.02:8).88 AE; 7,17 g; 24,2/25,8 mm; 2,2 mm; 255°. A 3/4 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Vs. und Rs.); kleiner Schrötling.Altfund 1911; SLM AG R 3203; SFI 261-53.01:14 (= 261-53.02:2).
Rs. PROVIDENTIA S-C; Altar.RIC I2, S. 99, Nr. 81.66 AE; 6,87 g; 24,8/26,8 mm; 180°. A 4/3 K 4/3.Altfund 1911; SLM AG R 3207; SFI 261-53.01:6 (= 261-53.02:6).67 AE; 8,64 g; 27,7/29,5 mm; 2,2 mm; 15°. A 3/4 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Vs.).Altfund vor 1913; SLM LM A 979; SFI 261-53.01:9 (= 261-135:1).68 AE; 9,42 g; 25,8/28,5 mm; 2,8 mm; 285°. A 3/3 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3202; SFI 261-53.01:7 (= 261-53.02:1).69 AE; 9,63 g; 27,3/29,9 mm; 2,4 mm; 300°. A 0/3 K 0/1.Lage 655/238; Schicht 0.0.Neufund 10.02.1998; FmZH, LNr. 4534; SFI 261-53.03:3.
Caligula
Roma, As, 37–41 n.Chr.Vs. M AGRIPPA L F COS III; Kopf des Agrippa mit Schiffskronen.l.Rs. S-C; Neptun stehend n.l.RIC I2, S. 112, Nr. 58.70 AE; 8,124 g; 26,2/27,7 mm; 2,4 mm; 180°. A 4/4 K 2/2.Lage 658.80/237.90; Schicht Stö.Neufund 29.01.2001; FmZH, LNr. 4556; SFI 261-53.05:9.71 AE; 8,194 g; 25,5/25,9 mm; 2,7 mm; 210°. A 3/3 K 2/2.Lage 644/235; Schicht 0.0.Neufund 22.02.2001; FmZH, LNr. 4563; SFI 261-53.05:10.72 AE; 8,317 g; 25,6/26,9 mm; 2,6 mm; 210°. A 3/3 K 1/1.Lage 653/243; Schicht 0.0.Neufund 10.02.1998; FmZH, LNr. 4536; SFI 261-53.03:4.73 AE; 8,67 g; 27,4/29,5 mm; 2,8 mm; 180°. A 3/3 K 3/3.Bemerkung: tiefer Kratzer; dezentrierte Prägung (Rs.); auf beidenSeiten Russspuren.Altfund 1911; SLM AG R 3217; SFI 261.53.01:8 (= 261-53.02:14).74 AE; 9,442 g; 26,7/28,8 mm; 2,8 mm; 180°. A 3/3 K 2/2.Lage 659.38/234.25; Schicht 0.0.Neufund 25.01.2001; FmZH, LNr. 4555; SFI 261-53.05:11.
Caligula für Divus Augustus
Roma, Dupondius, 37–41 n.Chr.Vs. DIVVS AVGVSTVS S-C; Kopf des Augustus n.l.Rs. CONSENSV SENAT ET EQ ORDIN P Q R; Augustus sitzendn.l. hält r. Olivenzweig, Linke auf Armlehne.RIC I2, S. 112, Nr. 56.75 AE; 9,137 g; 26,4/26,9 mm; 2,6 mm; 195°. A 3/3 K 1/1.Bemerkung: Gegenstempel Rs. TIAV.Lage 655/238; Schicht 0.0.Neufund 10.02.1998; FmZH, LNr. 4533; SFI 261-53.03:5.
Claudius
Roma, As, 41–42 n.Chr.Vs. TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP; Kopf desClaudius n.l.Rs. S-C; Minerva gehend n.r., hält Schild und Lanze.RIC I2, S. 128, Nr. 100.76 AE; 8,921 g; 26,1/28,2 mm, 2,4 mm; 110°. A 3/3 K 1/1.Lage 643/240; Schicht 0.0.Neufund 12.02.1998; FmZH, LNr. 4543; SFI 261-53.03:6.
Roma, As, 41–42 n.Chr.Vs. TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP; Kopf desClaudius n.l.Rs. LIBERTAS AVGVSTA S-C; Libertas stehend n.r.RIC I2, S. 128, Nr. 97.77 AE; 8,97 g; 25,9/26,5 mm; 2,9 mm; 135°. A 3/3 K 3/3.Altfund vor 1913; SLM LM A 980; SFI 261-53.01:9 (= 261-135:2).78 AE; 9,512 g; 26,3/28,3 mm; 3,2 mm; 180°. A 2/2 K 1/1.
277
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 277
Lage 656/236; Schicht Stö SE.Neufund 16.03.2001; FmZH, LNr. 4575; SFI 261-53.05:17.
Unbestimmte Münzstätte, Dupondius, Imitation.Vs. [ --- ]; Kopf n.l.Rs. [ --- ]; ?104 AE; 4,571 g; 22,2/23,9 mm; 2,4 mm; ?°. A 0/0 K 3/3.Lage 639/234; Schicht 0.0.Neufund 28.02.2001; FmZH, LNr. 4574; SFI 261-53.05:18.
Unbestimmte Münzstätte, Sesterz, Imitation.Vs. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP]; Kopf desClaudius mit Lorbeer n.r.Rs. [SPES AVGVSTA S-C]; Spes gehend n.l.RIC I2, S. 128, Nr. 99 oder S. 130, Nr. 115.105 AE; 4,25 g; 24,3/25,8 mm; 2,0 mm; 105°. A 4/4 K 2/2.Bemerkung: Metallausbrüche (Vs.).Lage 655/235; Schicht 0.0.Neufund 08.03.2000; FmZH, LNr. 4553; SFI 261-53.04:9.
Nero
Lugdunum, As, 64–66 n.Chr.Vs. IMP NERO CAESAR AVG P MAX TR P P P; Kopf des Neron.l.Rs. S-C; schwebende Victoria n.l. mit Schild, darauf SPQR.RIC I2, S. 182, Nr. 544 oder S. 185, Nr. 606.106 AE; 9,31 g; 27,2/29,3 mm; 2,5 mm; 210°. A 3/4 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3225; SFI 261-53.01:21 (= 261-53.02:22).
Lugdunum, As, 64–67 n.Chr.Vs. NERO CLAVD CAESAR AVG GERMANICVS; Kopf des Neron.r.Rs. PONTIF MAX TR POT IMP P P S-C; Apollo stehend n.r.RIC I2, S. 176, Nr. 416.107 AE; 8,34 g; 28,6/30,8 mm; 2,8 mm; 180°; A 2/2 K 3/3.Bemerkung: Kratzer (Vs.); Russspuren?; auf Münzkarton istverzeichnet: «Pfahlbaustation Gr. Hafner, Mittelbronze 1927».Altfund 1927; SLM LM ant 1093; SFI 261-53.02:1 (= 261-119:1).
Galba?
Unbestimmte Münzstätte, As, 69 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf des Galba? n.r.Rs. [ --- ]; stehende Figur.108 AE; 9,97 g; 25,2/26,8 mm; 3,2 mm; 210°. A 3/4 K 3/3.Bemerkung: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt).Altfund 1911; SLM AG R 3221; SFI 253-53.01:22 (= 261-53.02:18).
Vitellius
Roma, As, 69 n.Chr.Vs. A VITELLIVS GERMAN IMP AVG P M TR P; Büste desVitellius mit Lorbeer n.r.Rs. PROVIDENT S-C; Altar.RIC I2, S. 275, Nr. 150?109 AE; 6,64 g; 25,4/27,3 mm; 2,3 mm; 195°. A 3/3 K 4/3.Altfund 1911; SLM Inv. AG R 3208; SFI 261-53.01:23 (= 261-53.02:7).
Vespasianus
Lugdunum, As, 77–78 n.Chr.Vs. IMP CAES VESPASIAN AVG COS VIII P P; Kopf desVespasianus mit Lorbeer n.r.Rs. PROVIDENT S-C; Altar.RIC II, S. 104, Nr. 763.
89 AE; 7,73 g; 26,6/29,1 mm; 2,2 mm; 15°. A 3/3 K 4/4.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Rs.).Altfund 1911; SLM AG R 3204; SFI 261-53.01:15 (= 261-53.02:3).90 AE; 7,95 g; 26,6/28,8 mm; 2,1 mm; 135°. A 4/3 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Vs.); Russspuren?Altfund 1911; SLM AG R 3206; SFI 261-53.01:16 (= 261-53.02:5).91 AE; 9,37 g; 27,2/28,1 mm; 2,5 mm; 240°. A 2/2 K 4/4.Altfund 1911; SLM AG R 3205; SFI 261-53.01:17 (= 261-53.02:4).
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP VI ---] Kopf desTiberius mit Lorbeer n.l.Rs. [PONTIF MAX TR POT ---] S-C; Ruder vor Globus.RIC I2, S. 96, Nr. 34 oder S. 98, Nr. 58.92 AE; 4,9 g; 24,2/25,5 mm; 1,8 mm; 330°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Rs.).Altfund 1911; SLM AG R 3214; SFI 261-53.01:18 (= 261-53.02:11).
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [M AGRIPPA L F COS III]; Kopf des Agrippa mit Schiffskronen.l.Rs. [S-C]; Neptun stehend n.l.RIC I2, S. 112, Nr. 58.93 AE; 3,2 g; 22,6/24,5 mm; 1,6 mm; ?°. A 4/5 K 3/3.Bemerkung: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt); verschliffenerAusbruch am Rand.Altfund 1911; SLM AG R 3232; SFI 261-53:01.19 (= 261-53.02:29).94 AE; 7,468 g; 27,1/27,9 mm; 2,5 mm; 180°. A 3/3 K 2/2.Lage 642/228; Schicht 0.0.Neufund 26.02.2001; FmZH, LNr. 4567; SFI 261-53.05:13.95 AE; 8,164 g; 23,6/24,2 mm, 3,0 mm; 30°. A 3/3 K 2/2.Lage 646/228; Schicht 0.0.Neufund 20.02.2001; FmZH, LNr. 4561; SFI 261-53.05:14.96 AE; 8,705 g; 26,1/27,1 mm; 2,5 mm; 105°. A 3/3 K 2/2.Lage 643/242; Schicht 0.0.Neufund 23.02.2001; FmZH, LNr. 4564; SFI 261-53.05:15.
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P]; Kopf desClaudius n.l.Rs. [S-C]; Minerva gehend n.r., hält Schild und Lanze.RIC I2, S. 128, Nr. 100 oder S. 130, Nr. 116.97 AE; 1,856 g; 19,5/21,2 mm, 1,7 mm; ?°. A 4/4 K 1/1.Lage 648/236; Schicht Stö.Neufund 06.03.2000; FmZH, LNr. 4551; SFI 261-53.04:6.98 AE; 3,74 g; 21,7/23,1 mm; 1,9 mm; 30°. A 4/4 K 1/1.Lage 647/237; Schicht 0.0.Neufund 02.03.2000; FmZH, LNr. 4547; SFI 261-53.04:7.99 AE; 4,14 g; 22,5/23,5 mm; 1,7 mm; 150°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Vs.); ausgebrochen (mehr als 3/4intakt).Altfund 1911; SLM AG R 3220; SFI 261-53.01:19. (= 261-53.02:17).100 AE; 4,288 g; 22,4/24,0 mm; 1,8 mm; 30°. A 4/4 K 1/1.Lage 635/237; Schicht 0.0.Neufund 02.03.2000; FmZH, LNr. 4548; SFI 261-53.04:8.101 AE; 4,698 g; 24,2/25,8 mm; 2,0 mm; 195°. A 3/3 K 1/1.Lage 659.10/238.13; Schicht 0.0.Neufund 24.01.2001; FmZH, LNr. 4554; SFI 261-53.05:16.
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [ --- ]; Kopf des Claudius mit Lorbeer n.l.Rs. [ --- ] S-C; Gestalt n.r. (Minerva ?).102 AE; 2,8 g; 20,9/23,0 mm; 1,7 mm; 135°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: dezentrierte Prägung (Vs. und Rs.); ausgebrochen (mehrals 3/4 intakt); verschliffene Ausbrüche entlang des Randes.Altfund 1911; SLM AG R 3230; SFI 261-53.01:20 (= 261-53.02:27).
Unbestimmte Münzstätte, As, Imitation.Vs. [ --- ]; ?Rs. [ --- ]; ?103 AE; 1,166 g; 17,3/19,3 mm; 1,1 mm; ?°. A 0/0 K 2/2.
278
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 278
Roma, As, 85–96 n.Chr.Vs. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XII CENS PER P P;Büste des Domitianus mit Lorbeer n.r.Rs. FORTVNAE AVGVSTI S-C; Fortuna stehend n.l. hält Füllhornund Ruder.RIC II, S. 196, Nr. 333.118 AE; 8,589 g; 26,9/28,3 mm; 2,7 mm; 150°. A 3/3 K 1/1.Lage 643/240; Schicht 0.0.Neufund 12.02.1998; FmZH, LNr. 4539; SFI 261-53.03:9.
Roma, As, 90–91 n.Chr.Vs. IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS PER P P;Kopf des Domitianus mit Lorbeer n.r.Rs. VIRTVTI AVGVSTI S-C; Virtus stehend n.r. hält Parazoniumund Speer.RIC II, S. 203, Nr. 397.119 AE; 8,115 g; 24,6/26,3 mm; 2,6 mm; 175°. A 3/3 K 1/1.Lage 643/240; Schicht 0.0.Neufund 12.02.1998; FmZH, LNr. 4542; SFI 261-53.03:10.
Roma, As, 81–96 n.Chr.Vs. IMP CA[ --- ]; Kopf mit Lorbeer n.r.Rs. [ --- ]; stehende Gestalt mit Füllhorn.120 AE; 5,29 g; 25,2/26,4 mm; 2,1 mm; 180°. A 3/4 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3233; SFI 261-53.01:29 (= 261-53.02:30).
Roma, As, 81–96 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf mit Lorbeer n.r.Rs. [ --- ] S-C; stehende Gestalt n.l.121 AE; 3,43 g; 22,3/25,0 mm; 2,3 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: Russspuren.Altfund 1911; SLM AG R 3234; SFI 261-53.01:30 (= 261-53.02:31).
Roma, Dupondius, 81–96 n.ChrVs. [ --- ]; Kopf des Domitianus n.r.Rs. [ --- ]; stehende Figur n.l.122 AE; 10,3 g; 25,7/27,1 mm; 2,8 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3224; SFI 261-53.01:31 (= 261-53.02:21).
Flavisch
Unbestimmte Münzstätte, As, 69–96 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf n.r.Rs. [ --- ]; ?123 AE; 4,88 g; 22,7/25,5 mm; 2,1 mm; ?°. A 4/5 K 4/4.Aufsicht: quadratisch/rund.Bemerkung: verrundeter Ausbruch am Rand; ausgebrochen (mehr als3/4 intakt); Russspuren; auf Münzkarton ist verzeichnet: «ZürichPfahlbaustation, Gr. Hafner».Altfund 1927; SLM LM (antik) 1092; SFI 261-53.02:2 (= 261-119:2).
Traianus
Roma, As, 103–111 n.Chr.Vs. IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR PCOS V P P; Kopf des Traianus mit Lorbeer n.r.Rs. SPQR OPTIMO PRINCIPI S-C; Ceres stehend n.l.RIC II, S. 279, Nr. 479.124 AE; 10,7 g; 26,2/26,9 mm; 2,7 mm; 210°. A 3/3 K 1/1.Lage 643/240; Schicht 0.0.Neufund 12.02.1998; FmZH, LNr. 4538; SFI 261-53.03:11.
Hadrianus
Roma, Dupondius, 117–138 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf des Hadrianus n.r.Rs. [ --- ] S-C; stehende Figur n.l.125 AE; 11,49 g; 26,6/27,9 mm; 3,0 mm; 165°. A 4/4 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3226; SFI 261-53.01:32 (= 261-53.02:23).
110 AE; 10,27 g; 26,9/28,2 mm; 3,3 mm; 180°. A 2/2 K 2/2.Altfund vor 1916; SLM LM R 1005; SFI 261-53.01:24 (= 261-135:3).
Roma, As, 71 n.Chr.Vs. IMP CAES VESPASIAN AVG COS III; Büste des Vespasianusmit Lorbeer n.r.Rs. VICTORIA AVGVSTI S-C; Victoria schreitend n.l., hält Kranzund Palmzweig.RIC II, S. 75, Nr. 502.111 AE; 8,663 g; 27,2/28,0 mm; 2,5 mm; 180°. A 3/3 K 1/1.Lage 643/240; Schicht 0.0.Neufund 12.02.1998; FmZH, LNr. 4540; SFI 261-53.03:8.
Roma, Lugdunum oder Tarraco?, As, 71 n.Chr.Vs. IMP CAES VESPASIAN AVG COS III; Büste des Vespasianusmit Lorbeer n.r.Rs. SECVRITAS AVGVSTI S-C; Securitas sitzend n.l.RIC II, S. 74, Nr. 500.112 AE; 8,849 g; 27,5/28,7 mm; 2,8 mm; 180°. A 3/3 K 1/1.Lage 655/239; Schicht 0.0.Neufund 10.02.1998; FmZH, LNr. 4535; SFI 261-53.03:9.
Unbestimmte Münzstätte, As, 71–77 n.Chr.Vs. IMP CAES VESPASIAN AVG COS [ --- ]; Kopf des Vespasianusmit Lorbeer n.r.Rs. [ --- ] S-C; Adler n.r.RIC II, S. 74, Nr. 497, S. 77, Nr. 528a, S. 102, Nr. 747 oder S. 104,Nr. 764a.113 AE; 5,26 g; 25,2/26,7 mm; 2,3 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3223; SFI 261-53.01:25 (= 261-53.02:20).
Unbestimmte Münzstätte, As, 69–79 n.Chr.Vs. [ --- ] ASIANVS [ --- ]; Kopf des Vespasianus n.r.Rs. [ --- ]; ?.114 AE; 7,9 g; 24,9/26,4 mm; 2,7 mm; ?°. A 4/5 K 3/3.Bemerkung: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt).Altfund 1911; SLM AG R 3222; SFI 261-53.01:26 (= 261-53.02:18).
Titus für Domitian
Roma, As, 80–81 n.Chr.Vs. CAESAR DIVI VESP F DOMITIAN COS VII; Kopf desDomitianus mit Lorbeer n.r.Rs. S-C; Minerva schreitend n.rRIC II, S. 138, Nr. 170a.115 AE; 7,87 g; 25,8/23,7 mm; 3,0 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: Russspuren.Altfund 1911; SLM AG R 3228; SFI 261-53.01:27 (= 261-53.02:25).
Domitianus
Roma, As, 80–81 n.Chr.Vs. CAES DIVI VESP F DOMITIAN COS VII; Kopf des Titus mitLorbeer n.r.Rs. S-C; Minerva stehend n.r., hält Schild und Lanze.RIC II, S. 138, Nr. 170a.116 AE; 7,267 g; 25,1/27,4 mm; 2,6 mm; 210°. A 3/3 K 2/2.Lage 640/239; Schicht 0.0.Neufund 27.02.2001; FmZH, LNr. 4572; SFI 261-53.05:19.
Roma, As, 81 n.Chr.Vs. IMP CAES DIVI VESP F DOMITIAN AVG P M; Kopf desDomitianus mit Lorbeer n.l.Rs. TR P COS VII DES VIII P P S-C; Nike n.l. mit Blitzbündel undSpeer.RIC II, S. 183, Nr. 238b.117 AE; 4,83 g; 22,2/25,6 mm; 2,1 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Altfund 1911; SLM AG R 3235; SFI 261-53.01:28 (= 261-53.02:32).
279
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 279
Mitte 3. Jh. n.Chr.
Unbestimmte Münzstätte, Antoninian, Imitation.Vs. [ --- ]; ?Rs. [ --- ]; ?133 AE; 1,04 g; 14,6/15,6 mm; 1,3 mm; ?°. A 4/5 K 3/3.Lage 653.50/236.45; Schicht PL.Neufund 07.02.2001; FmZH, LNr. 4560; SFI 261-53.05:23.
Claudius II.
Unbestimmte Münzstätte, Antoninian, Imitation, 268–270 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf mit Strahlenkrone n.r.Rs. [ --- ]; ?.134 AE; 3,313 g; 17,5/18,7 mm; 1,6 mm; ?°. A 4/4 K 2/2.Lage 641/237; Schicht 0.0.Neufund 03.03.2000; FmZH, LNr. 4550; SFI 261-53.04:10.
Aurelian für Claudius II.
Unbestimmte Münzstätte, Antoninian, 271 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf des Claudius II. mit Strahlenkrone n.r.Rs. CONSECRATIO; Altar.135 AE; 1,592 g; 17,9/18,5 mm; 1,8 mm; ?°. A 4/4 K 3/3.Lage 648.0–650.0/236./0–239.0; Schicht 0.0.Neufund 03.02.1998; FmZH, LNr. 4532; SFI 261-53.03:12.
2 Grosser Hafner, unsichere Zuweisung
Kaiserzeit
Constantinus I. für Crispus
Londinium, Aes 3, 323–324 n.Chr.Vs. CRISPV-S NOBIL C; Büste des Crispus gepanzert mit Helmn.l.Rs. BEAT TRANQVILITAS - VOT/IS/XX//PLON; Altar.RIC VII, S. 114, Nr. 275 vgl.136 AE; 2,85 g; 17,6/19,1 mm; 180°; A2/2 K2/2.Bemerkung: gelocht.Altfund 1911; SLM AG R 3229; SFI 261-53.06:1 (= 261-53.02:26).
3 Grosser oder Kleiner Hafner
Kaiserzeit
Antoninus Pius
Roma, Sesterz, 149–150 n.Chr.Vs.: ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIII; Kopf des AntoninusPius mit Lorbeer n.r.Rs.: [ --- ] S-C; stehende weibliche Figur mit Füllhorn n.l.137 AE; 20,74 g; 29,5/31,5 mm; 4,0 mm; 360°; A2/3 K3/3.Bemerkung: Oberfläche stark verschliffen, v.a. im Randbereich (Rs.).Altfund 1911; SLM AG R 3243; SFI 261-53.07:1 (= 261-138:1).
Roma, 138–161 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf des Antoninus Pius mit Lorbeer n.r.Rs. [ --- ] S-C; stehende weibliche Figur n.l.138 AE; 22,37 g; 28,5/30,4,0 mm; 360°; A4/4 K2/2.Bemerkung: Russspuren; Schrötling quadratisch rund; Fundort-angabe auf Unterlagskarton: «Auf dem Hafner Zürichsee».Altfund 1911; SLM AG R 3227; SFI 261-53.07:2 (= 261-53.02:24).
Hadrianus?
Roma, As, 117–138 n.Chr.Vs. [ --- ]; Büste drapiert n.r.Rs. [ --- ]; S-C; stehende weibliche Gestalt n.l.126 AE; 5,25 g; 23,3/24,3 mm; 2,6 mm; 180°. A 4/4 K 3/3.Bemerkungen: ausgebrochen (mehr als 3/4 intakt); kleine Ausbrücheam Rand.Altfund 1911; SLM AG R 3231; SFI 261-53.01:33 (= 261-53.02:28).
Marcus Aurelius
Roma, Sesterz, 161–180 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf n.r.Rs. [ --- ]; stehende weibliche Gestalt.127 AE; 15,55 g; 26,6/28,0 mm; 3,4 mm; 150°. A 3/3 K 0/0.Lage 652/243; Schicht 0.0.Neufund 10.02.1998; FmZH, LNr. 4537; SFI 261-53.03:12.
Commodus
Roma, Sesterz, 180–192 n.Chr.Vs. [ --- ]; Kopf des Commodus n.r.Rs. [ --- ]; sitzende Figur n.l.128 AE; 19,998 g; 26,9/29,4 mm; 4,2 mm; 315°; A 0/0 K 0/0.Lage 641/242; Schicht 0.0.Neufund 27.02.2001; FmZH, LNr. 4568; SFI 261-53.05:20.
1./2. Jh. n.Chr.
Unbestimmte Münzstätte, As.Vs. [ --- ]; Kopf n.r.Rs. [ --- ]; Altar.129 AE; 4,22 g; 21,5/25,7 mm; 2,7 mm; ?°. A 4/4 K 3/3.Bemerkung: Einhieb (Vs.); tiefer Kratzer.Altfund 1911; SLM AG R 3236; SFI 261-53.01:1 (= 261-53.02:33).
Unbestimmte Münzstätte, Sesterz.Vs. [ --- ]; ?Rs. [ --- ]; ?130 AE; 18,201 g; 31,1/32,4 mm; -°. A0/0 K 4/4.Altfund; MKWt R 3870; SFI 261-53.08:2.
2. Jh. n.Chr.
Unbestimmte Münzstätte, Sesterz.Vs. [ --- ]; ?Rs. [ --- ]; stehende weibliche Gestalt.131 AE; 15,211 g; 26,7/27,2 mm; 3,9 mm; ?°. A 5/5 K 2/2.Lage 655/231; Schicht 0.0.Neufund 05.04.2001; FmZH, LNr. 4559; SFI 261-53.05:21.
Gordianus III.
Roma, Sesterz, 238–239 n.Chr.Vs. IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG; Kopf des GordianusIII. mit Lorbeer n.r.Rs. SALVS AVG SC; Salus sitzend n.l. füttert Schlange, die sich umAltar ringelt.RIC IV.3, S. 44, Nr. 261a.132 AE; 15,854 g; 26,7/29,1 mm; 3,4 mm; 360°. A 3/3 K 2/2.Lage 641/239; Schicht 0.0.Neufund 27.02.2001; FmZH, LNr. 4569; SFI 261-53.05:22.
280
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 280
Eisen139 1 Teil einer Miniaturlanze? Runder Schaft mit abgeflachtem,rhombenförmigem Ende. FN 1172.140 1 Stilus? (2 Fragm.). Runder Schaft, abgebrochen, mit abge-flachtem Ende. FN 102.141 1 Nadel. Runder Schaftquerschnitt, in einer (nicht vollständigerhaltenen) Öse endend. Die beiden Enden der Gabelung etwasabgeflacht. Römisch? FN 403.
Nicht besprochen:1 Scheibenkopfnagel. L. 65 mm. FN 977.1 Scheibenkopfnagel. L. 30 mm. FN 1044.1 Scheibenkopfnagel. Kopf teilweise abgebrochen. L. 60 mm. FN 196.1 Scheibenkopfnagel. Kopf teilweise abgebrochen. L. 48 mm. FN 207.1 Scheibenkopfnagel. Kopf teilweise abgebrochen. L. 55 mm. FN 248.1 Scheibenkopfnagel (2 Fragm.). Abgebrochen. Erh. L. 45 mm. FN 267.1 Scheibenkopfnagel, abgebrochen. Erh. L. 15 mm. FN 737.1 Scheibenkopfnagel, abgebrochen. Kopf teilweise abgebrochen. Erh.L. 52 mm. FN 202.1 Scheibenkopfnagel, abgebrochen. Kopf teilweise abgebrochen. Erh.L. 23 mm. FN 514.1 Scheibenkopfnagel, abgebrochen. Kopf teilweise abgebrochen. Erh.L. 30 mm. FN 823.1 Nagel mit quadratischem Kopf. L. 69 mm (verbogen; rekonstruiertca. 95 mm). FN 1038.1 Nagel mit quadratischem Kopf, abgebrochen. FN 996.1 Nagel mit rechteckigem Kopf. L. 61 mm (verbogen; rekonstruiert ca.85 mm). FN 1155.1 Nagel mit konischem, rechteckigem Kopf. L. 80 mm. FN 906.1 Nagel mit gestauchtem Kopf, massiv. Vierkantiger Schaft,abgebrochen. Erh. L. 57 mm. FN 346.1 Nagel mit halbkugeligem Kopf. L. 78 mm. FN 328.
Blei142 1 runde Bleischeibe mit zentralem Loch (römischesBleigewicht?). Dm. 24 mm, 13 g. FN 179.
Nicht besprochen:1 Stück geschmolzenes Blei mit einzelnen Holzkohleeinschlüssen.Erh. L. 74 mm. FN 769.
281
P51291_KDMZ_S.247-281 15.12.2006 8:03 Uhr Seite 281
Tafel 1
Zürich. Riesbach, Grosser Hafner. 1–37 Keramik. M. 1:3; 49 Glas; 139–141 Eisen; 142 Blei. M. 2:3.
20
21
22
2332
33
37
1
2 6 7
8
9
19
49 140 141142
5
36
139
P51291_KDMZ_S.282-288 15.12.2006 8:05 Uhr Seite 282
Tafel 2
Zürich. Riesbach, Grosser Hafner. 50–70 Münzen. M. 1:1.
50 51 52
53 54
56 5857
59 60 61
55
62 63 64
66 6765
68 69 70
P51291_KDMZ_S.282-288 15.12.2006 8:05 Uhr Seite 283
Tafel 3
Zürich. Riesbach, Grosser Hafner. 71–90 Münzen. M. 1:1.
71 7372
74
77 78 79
80 81
858483
86 87 88
89 90
82
7675
P51291_KDMZ_S.282-288 15.12.2006 8:05 Uhr Seite 284
Tafel 4
Zürich. Riesbach, Grosser Hafner. 91–110 Münzen. M. 1:1.
91
96
92 93
94 95
97 98 99
100 101 102
103 104 105
107106
108 110109
P51291_KDMZ_S.282-288 15.12.2006 8:05 Uhr Seite 285
Tafel 5
Zürich. Riesbach, Grosser Hafner. 111–129 Münzen. M. 1:1.
112
113
111
115
118
114
117116
122 123
120 121
124
127126
128 129
125
119
P51291_KDMZ_S.282-288 15.12.2006 8:05 Uhr Seite 286
Tafel 6
Zürich. Riesbach, Grosser Hafner. 130–138 Münzen. M. 1:1.
130
132
131
133 134
135
136
138137
P51291_KDMZ_S.282-288 15.12.2006 8:05 Uhr Seite 287