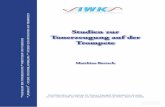Anmerkungen zur Grabungsmethodik auf montanarchäologischen Fundplätzen
-
Upload
uni-bamberg -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Anmerkungen zur Grabungsmethodik auf montanarchäologischen Fundplätzen
Band 87 / Heft 2 2010
BLÄTTER DES SIEGERLÄNDER HEIMAT- UND GESCHICHTSVEREINS e. V.
Sonderheft
„Frühes Eisen im
Mittelgebirgsraum“
959595
Postverlagsort 57005 SiegenPostfach 10 0541Dezember 2010
Schriftleitung:Dr. Andreas Bingener
Redaktionsbeirat:Dr. Helmut BuschGerhard MoiselManuel Zeiler M.A.
Verantwortlich für den Anzeigenteil:Verlagsabteilung VorländerObergraben 3957072 SiegenTelefon (02 71) 5 94 03 38
Die vom Siegerländer Heimat- undGeschichtsverein e. V.herausgegebene Zeitschrift Siegerlanderscheint in zwangloser Folge.Sie wird den Vereinsmitgliedernunentgeltlich zugestellt.
Die in den einzelnen Beiträgengeäußerten Ansichten decken sich nichtimmer mit denen der Redaktion.
Redaktionsschluss für das 1. Heft:15. April 2011
ISSN 1435-7364
Band 87 / Heft 2 2010
BLÄTTER DES SIEGERLÄNDER HEIMAT- UND GESCHICHTSVEREINS e.V.
INHALT SeiteFrühes Eisen im Mittelgebirgsraum:Vorwortvon Thomas Stöllner und Manuel Zeiler 97Rohstoffgewinnung imrechtsrheinischen Mittelgebirgevon Thomas Stöllner 101Montanarchäologische Forschungenim Siegerlandvon Manuel Zeiler 133Archäometallurgische Untersuchungenzur Primärproduktion des Eisensim Siegerlandvon Guntram Gassmann, Ünsal Yalçınund Moritz Jansen 161Der Siegerländer Kuppelofenim europäischen Vergleichvon Jennifer Garner 174Frühe Eisengewinnung im Lahn-Dill-Gebietund Siegerland: Benachbarte Montanreviere– unterschiedliche Technologien?von Andreas Kronz 198Anmerkungen zur Grabungsmethodik aufmontanarchäologischen Fundplätzenvon Andreas Schäfer 212Siedlungsdynamische Prozesseim hessisch-westfälischen Berglandwährend der Eisenzeitvon Frank Verse 221Grundlagen zur Geschichte von Eisen-erzeugung und -verarbeitung imMärkischen Sauerland zur Zeit derRenn- und Floßofenverhüttungvon Hans Ludwig Knau 241Frühe Eisenerzeugung im Westerwald:Forschungsstand und Perspektiven derMontanarchäologievon Hans-Peter Kuhnen 263
Titelbild: Ausgrabung des jüngereisenzeitlichen Verhüttungsplatzes Gerhardsseifen/Siegen-Niederschelden (Foto: Manuel Zeiler). Kleines Foto: Plastisch verzierter Gürtelhaken derjüngeren Eisenzeit aus dem Verhüttungsplatz Wartestraße/Siegen-Niederschelden (Foto:Westfälisches Museum für Archäologie/Außenstelle Olpe).
212
zelfundeinmessung die nötige räumlicheAuflösung erbringen können. PragmatischeGesichtspunkte oder äußere Zwänge, wieGrabungsgröße, generelle Fundmenge so-wie der zeitliche und finanzielle Rahmender Untersuchungen bilden meist die aus-schlaggebenden Parameter.
Neben stratigrafischen Beobachtungenund der allgemeinen Fundverteilung ermög-licht insbesondere das Verteilungsbild ur-sprünglich zusammengehöriger Funde übersystematischeAnpassungsversuchewichtigeRückschlüsse auf taphonomische Verände-rungen am Fundplatz. Was bei paläolithi-schen Fundplätzen mit Stein- bzw. Silexan-passungen längst gang und gäbe ist undeinen zentralen Bestandteil jeder modernenurgeschichtlichen Untersuchung bildet3, hatbei Schlacken undOfenwandmaterial aufme-tallurgischen Plätzen bisher kaum jemalsAn-wendung gefunden. Die über systematischeAnpassungsversuche an einem metallurgi-schen Fundort erschließbaren Aktivitätenkönnen aber vergleichbar gute Ergebnisseliefern und maßgeblich zur Entschlüsselungmetallurgischer Prozessabläufe beitragenoder zur Rekonstruktion der ursprünglichenOfen- oder Herdinstallationen führen4.
Seit 2006 wird im Lahntal bei Wetzlar-Dalheim (Lahn-Dill-Kreis, Hessen) im Rah-men eines montanarchäologischen For-schungsprojekts ein Fundplatz der spätenLa-Tène-Zeit und frühen römischen Kaiser-zeit systematisch untersucht5. Zum Einsatzkommt dort ein Methodenbündel aus Geo-physik (Geomagnetik, Georadar, Suszep-tibilitätsmessung), Einzelfundeinmessung
Untersuchungen an montanarchäologi-schen Fundplätzen1 stellen besondere An-forderungen an Grabungsmethodik, -doku-mentation und -auswertung. Die primäreAufmerksamkeit gilt der Taphonomie desFundplatzes, d.h. der Klärung der Entste-hung des spezifischen Fundanfalles undseiner Verteilung, steht doch die Rekons-truktion der verschiedenen Prozessschritte(chaîne d’opératoire) und der antiken Ar-beitsabläufe am Fundplatz selbst im Vorder-grund des Interesses. Neben den primärenVerteilungs- und Ablagerungsmustern, dieHinweise auf die ursprünglichen Prozess-schritte liefern können, gehören dazu auchalle späteren Veränderungen am Fundplatz.Sie können von natürlichen Überprägungenwie Erosions- und Akkumulationsereignis-sen herrühren oder anthropogen bedingtsein, wie es etwa durch Besiedlungsüber-lagerungen und Zerstörungen durch Acker-tätigkeit oder jüngere Abbautätigkeiten derFall sein kann.
Der Dokumentation der Verteilung vonFunden und Befunden auf der Grabung undder Erhellung räumlicher Bezüge in derAus-wertungsphase kommt daher allergrößteBedeutung zu. Sie können im Idealfall zueiner Entschlüsselung der ursprünglichenArbeitsabläufe am Fundort führen. Je nachFragestellung kommen verschiedene Ge-nauigkeitsstufen zur Erfassung der Fund-verteilung infrage. Kann im einen Fall eineschnittgenaue Zuweisung des einzelnenFundstückes innerhalb eines (regelmäßi-gen) Grabungsschnittsystems ausreichendsein2, so wird im anderen Fall nur eine Ein-
Anmerkungen zur Grabungsmethodikauf montanarchäologischen Fundplätzen
von Andreas S c h ä f e r
213
Durch Veränderung der Punktgrößen undFormen lässt er sich gegebenenfalls ver-stärken oder abschwächen6. Mit der Be-rechnung von Funddichten (Fundanzahl proFlächeneinheit) kann er dagegen quantifi-ziert und in vergleichbare Zahlenwerte um-gesetzt werden. Diese Berechnungen wur-den auf Abb. 4 für die gesamte Fundmengeje Quadratmeter durchgeführt und in eineIsoliniendarstellung umgesetzt7. Auf dieserBasis lassen sich nun weitere Verteilungs-muster hinzukartieren und bewerten, wieanhand der nach ihrem Gewicht kartiertenSchlackenklötze beispielhaft verdeutlicht sei(Abb. 4). In der Zusammenschau kann da-mit, zum gegenwärtigen Stand von Aus-grabung und Auswertung, eine erste Hypo-these zum antiken Arbeitsablauf in derEisenproduktionsanlage inWetzlar-Dalheimformuliert werden: Die leichte Überschnei-dung zweier Öfen im Nordteil belegtzunächst, dass sie nicht alle gleichzeitig,sondern zumindest teilweise nacheinanderbetrieben worden seinmüssen. Die Öfen derSüd- und Ostseite dürften dabei zuerst imEinsatz gewesen sein. Nach ihrer Auflas-sung wurde der Bereich zur Ablagerungkleinteiliger metallurgischer Abfälle genutzt,die die Ofenstümpfe überlagern. Die Nord-westecke der Anlage hielt man dagegen bis
und 3-D-Befunddokumentation. Mit der kon-sequenten dreidimensionalen Einmessungsämtlicher Fundstücke werden in der vor-handenen Größenordnung neue Wege be-schritten (Abb. 1). Die Güte des montanar-chäologischen Befundes, seine zeitliche undfunktionale Geschlossenheit sowie seinekulturhistorische Bedeutung im regionalenund überregionalen Kontext rechtfertigenden hohen logistischen und zeitlichen Auf-wand. Die Untersuchungen zeigen modell-haft das Erkenntnispotenzial auf, das mon-tanarchäologische Forschung heute untergünstigen Rahmenbedingungen bietenkann. Hier seien einige dieser Ansätze beimgegenwärtigen Stand vonGrabung undAus-wertung exemplarisch vorgestellt.
Im Bereich einer alten Geländerinne hatsich am Fundplatz C86 „Unterbodenfeld“ inWetzlar-Dalheim ein bemerkenswerter Be-fund zur frühen Eisenmetallurgie erhalten.Der Kernbefund mit einem Dutzend Renn-feueröfen (Abb. 2; s. S. 216) in einem Arealvon ca. 4,5 x 5 m ließ sich zunächst nicht alsabgrenzbare Bodenverfärbung imGrabungs-befund greifen. Erst die Kartierung der Fund-verteilung macht die nahezu quadratischeFormder in die Rinnenfüllung eingetieftenAn-lage sichtbar (Abb. 3A). Die Differenzierungnach verschiedenen Fundgattungen erlaubtweiterführende Einsichten in die Verfüllungs-geschichte der Befundstruktur. Herausgegrif-fen seien mit Schlacken- und Keramikfundendie jeweils umfangreichsten Fundgattungenaus den Funktionsbereichen „Metallurgie“bzw. „Siedlung“ (Abb. 3C–D). Ihre Gegen-überstellung lässt Kongruenzen, aber auchkontrastierende Schwerpunktbildungen er-kennen, die sich bei Hinzunahme andererFundgattungen (verschlackteOfenwand, Dü-senziegel; Abb. 3B) weiter verdichten lassen:Metallurgisches Fundmaterial findet sich ver-stärkt entlang der Ost- und Südseite derWerkstattgrube, während im Nordwestteileine klare Abreicherung zu erkennen ist(Abb. 3B). Dort lässt sich dagegen eine An-reicherung vonKeramik feststellen (Abb. 3D).
Auf Abb. 3 basieren alle Erkenntnisse aufdem visuellen Eindruck der Fundverteilung.
Abb. 1: Wetzlar-Dalheim, Lahn-Dill-Kreis,Fundplatz C86 „Unterbodenfeld“. Fundsta-tistik nach Anzahl.
214
Abb. 3: Wetzlar-Dalheim, Lahn-Dill-Kreis, Fundplatz C86 „Unterbodenfeld“. Ausschnittaus dem Grabungsgesamtplan mit Kartierung ausgewählter Fundgruppen (Stand 2008;Grafik: A. Schäfer).
215
Abb. 4: Wetzlar-Dalheim C86. Kartierung der Schlackenklötze (schwarz; n = 43) vor demHintergrund der Gesamtfundverteilung (n = 17.108) und den schematisiert angegebenenOfenstandorten (helle Kreise). Signaturgröße der Schlackenklötze proportional dem Ge-wicht von 2–38 kg. Funddichteberechnung pro Quadratmeter (Farbskala). Grabungsstand2008 (Grafik: R. Hesse / A. Schäfer).
216
im Anschluss mit Kulturschichtmaterial ausdem westlich anschließenden Siedlungsbe-reich verfüllt, was die in diesem Areal beob-achteteAnreicherung von Siedlungsabfällen(Keramik) erklären würde. Dies könnte zu-letzt als Hinweis darauf gewertet werden,dass dieAnlage planmäßig aufgelassen undgeräumt wurde.Die Fundverteilungen in der Fläche wer-
den sich durch die dreidimensionale Erfas-sung der einzelnen Funde auch in der Verti-
zum Ende weitgehend frei vonAbraum. Hierwurden die letzten Öfen betrieben, derenSchlackenklötze man zum Ende der Nut-zung nicht mehr aus der Anlage entfernte,sondern unmittelbar vor den Öfen zurück-ließ. Im Einzelfall scheint es dabei sogarmöglich, die herausgeräumten Schlacken-klötze den jeweiligen Öfen zuzuordnen, indenen sie entstanden waren. Dieser letzteNutzungsbereich der in den Boden einge-tieften Rennofenwerkstatt wurde offenbar
Abb. 2: Wetzlar-Dalheim, Lahn-Dill-Kreis, Fundplatz C86 „Unterbodenfeld“. Senkrechtauf-nahme der Verhüttungsanlage im Sommer 2009 (Foto: B. Schroth).
217
Abb. 5: Wetzlar-Dalheim C86. Magnetische Suszeptibilität (volumenspezifisch) des Ofen-grubenprofils 10040/10048. – A: Profilzeichnung mit Angabe der Messpunkte und Mess-werte. – B: Grafische Umsetzung der Messergebnisse (Grafik: B. Schroth / A. Schäfer).
218
führende Erkenntnisse gewinnen (Abb. 5)8.Die Ofengrube 10040 greift noch rund 40 cmin den anstehenden Lösslehm ein, der anihren Rändern durch die Hitze rot verziegeltist (Abb. 5A). Sie wurde nach ihrer Nutzungoffensichtlich mit Wandungsfragmenten ei-nes abgerissenen Ofens und mit kleinteili-gen Schlacken verfüllt (10048). Über denaufgelassenen Ofenstumpf zieht sich dieschräge Abfallschicht eines späteren Ver-hüttungsvorganges von einem der benach-barten Öfen. Auf der Grubensohle selbstblieb aber eine homogene schwarze Abla-gerung erhalten, die noch mit dem letztenOfengang in Verbindung stehen dürfte undzunächst als holzkohlehaltige Basisschichtangesprochen wurde. Die Suszeptibilitäts-messung macht nun deutlich, dass es sichbei dem sandig-körnigen Grus um in höchs-tem Maße magnetisierbares Material han-delt, das bis zu dreimal höhere Suszeptibi-litätswerte erbringt, als selbst die großenEisenschlackenbrocken und gebranntenOfenschachtteile (Abb. 5B). Es liegt nahe,die Basisschicht als Magnetit, d.h. als teil-reduziertes Erz anzusprechen, für den ver-gleichbare Werte aus der Literatur vorlie-gen9. Seine kompakte Lage auf der Sohleder Schlackengrube deutet darauf hin, dassder letzte Ofengang nicht zu Ende geführt,sondern aus unbekannten Gründen vorzei-tig abgebrochen wurde, sodass lediglich an-reduziertes Erz durch den Reaktor bis zurSohle absacken konnte. Das Beispiel zeigtauf, wie eine gezielte Integration geophy-sikalischer Untersuchungen in den Gra-bungsverlauf es vermag, wesentliche Er-kenntnisse zum Verständnis der Funktionbzw. Fehlfunktion metallurgischer Befundebeizusteuern. Ebenso wie Halbfabrikate undFehlprodukte bei der Metallverarbeitung(Schmieden/Guss) können also auch miss-glückte Produktionsvorgänge bei der Erfor-schung der Primärgewinnung besondersaufschlussreiche Ergebnisse erbringen.
Kehren wir abschließend zu den Er-kenntnismöglichkeiten detaillierter Fundver-teilungsanalysen zurück. Ihr Potenzial imRahmenmontanarchäologischer Forschung
kalen überprüfen lassen. Mit einem indivi-duell wählbaren Erfassungsbereich könnenan beliebigen Stellen nachträglich virtuelleProfile erstellt werden, durch Herausrech-nen der Hangneigung lassen sich Schichtenoder Fundkonzentrationen auch über größe-re Distanzen miteinander in Bezug setzenbzw. vergleichen. Statistische Verfahrenwerden es zudem erlauben, darüber hin-ausgehende Datenbezüge im dreidimensio-nalen Raum der archäologischen Ablage-rungen zu erkennen und einer Bewertungund Interpretation zuzuführen.
Wendet man sich den einzelnen Installa-tionen, d.h. den Öfen selbst zu, so spieltauch hier die Entschlüsselung ihrer Nut-zungsweise, das heißt, der antike Produkti-onsablauf im und unmittelbar um den Ofendie wichtigste Rolle. Konstruktion, Aufbauund Abmessungen des Ofens, Art, Dauerund Zahl der in einem Ofenindividuumdurchgeführten Verhüttungsvorgänge, diegefahrenen Temperaturen, die Bildung derProduktionsabfälle und ihre ursprünglicheLage im Befund bzw. ihre spätere Verlage-rung/Entsorgung sind ebenso interessantwie Fragen der Effizienz, des Materialver-brauchs und letztlich der Quantität und Qua-lität der hergestellten Produkte. Lassen sichOfenkonstruktion und Fundverteilung durchherkömmlicheGrabungsmethoden erfassensowie zeichnerisch und fotografisch doku-mentieren, d.h. sie haben das äußere Er-scheinungsbild zum Gegenstand der Doku-mentation, bleiben andere Fragenkreisespäteren naturwissenschaftlichen Untersu-chungen ausgewählter Proben im Labor vor-behalten. Sie zielen auf den inneren Aufbaubzw. materialspezifische Eigenschaften.Nun kann es notwendig und sinnvoll sein,beide Dokumentationsarten bereits vor Ortmiteinander zu verknüpfen. Beim Einsatzgeophysikalischer Methoden in der Archäo-logie, etwa bei der flächenhaften Kartierungspezifischer Materialeigenschaften wie Ma-gnetisierung oder elektrischer Leitfähigkeit,geschieht dies bereits seit Langem. Dochauch in der Vertikalen lassen sich geradebei metallurgischen Befunden damit weiter-
219
Plumettaz 2007N. Plumettaz, Le site magdalénien de Mon-ruz 2. Étude des foyers à partir de l’analysedes pierres et des remontages. Arch.Neuchâteloise 38 (Neuchâtel 2007).
Serneels 1995V. Seerneels, Du minérai à l’objet: un villagede sidérurgistes du IXe au XIIe siècle àLiestal_Röserntal BL. In: M. Schmaedecke(Hrsg.), Ländliche Siedlungen zwischenSpätantike und Mittelalter. Arch. u. Museum33 (Liestal 1995), 35–43.
Schäfer 2003A. Schäfer, Produktionsstandort Wetzlar-Dalheim: 2000 Jahre Eisengewinnung amOstrand des Rheinischen Schiefergebirges.Ber. Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 7,2002/2003 (2003), 195–207.
Ders. 2007A. Schäfer, Erzrevier an der Lahn. Jahrtau-sende in Eisen.Arch. in Deutschland 1/2007,6–11.
Ders. 2009A. Schäfer, Frühe Eisenproduktion im Mit-telgebirgsraum. Regionale Fallstudien vonder Latènezeit bis zum Frühmittelalter zwi-schen Luxemburg und Bayern. Habilitations-schrift Friedrich-Schiller-Univ. Jena 2009.
Ders. im Druck aA. Schäfer, Zur Erforschung der frühen Ei-senproduktion an der mittleren Lahn. In:A. Abegg / S. Biegert / D. Walter / S. v.Schnurbein (Hrsg.), Die Germanen und derLimes. Ausgrabungen im Vorfeld des Wet-terau-Limes im Raum Wetzlar-Gießen.Röm.-German. Forsch. 66 (im Druck).
Ders. im Druck bA. Schäfer, Early Iron Production in the Cen-tral German Highlands. Current Research inthe Lahn Valley at Wetzlar-Dalheim (Lahn-Dill-District, Hesse). In: B. Cech (Hrsg.), Ear-ly Iron in Europe – Prehistoric and RomanIron Production. Proceedings of the internat.Conference in Hüttenberg, Carinthia 8th – 11th
Sept. 2008 (im Druck).
ließ sich oben am Fundplatz C86 in Wetzlar-Dalheim beispielhaft vorAugen führen. Dassdie geschilderte Vorgehensweise an urge-schichtliche Grabungs- und Forschungs-ansätze anknüpft, bei denen die Taphono-mie des Fundplatzes und die Rekonstruktionvon Prozessketten anhand räumlicher Ver-teilungsmuster bereits seit Langem höchs-ten Stellenwert besitzen, sollte ermutigen,derartige Wege auch in der Montanarchäo-logie systematisch zu beschreiten und aus-zubauen.
Literaturverzeichnis:
De Bie/Caspar 2000
M. De Bie / J.-P. Caspar, Rekem. A Feder-messer Camp on the Meuse River Bank.2 vols. Acta Arch. Lovaniensia Monogr. 10(Leuven 2000).
Cziesla 1990
E. Cziesla, Siedlungsdynamik auf steinzeit-lichen Fundplätzen. Methodische Aspektezur Analyse latenter Strukturen. Stud. Mo-dern Arch. 2 (Bonn 1990).
Gruat u.a. 2007
Ph. Gruat / Ph. Abraham / C. Mahé-Le Car-lier / A. Ploquin, L’artisanat du fer en milieucaussenard: l’exemple de l’enceinte duPuech de Mus à Sainte-Eulalie-de-Cernon(Aveyron) aux Ve et IVe s. a.C. In: P.-Y.Milcent (Hrsg.), L’économie du fer proto-historique: de la production à la consomma-tion du métal. XXVIIIe colloque de l’AFEAF,Toulouse, 20–23 mai 2004. Aquitania Suppl.14/2 (Bordeaux 2007), 177–212.
Jockenhövel/Willms 2005
A. Jockenhövel/Ch. Willms, Das Dietzhölze-tal-Projekt. Archäometallurgische Untersu-chungen zur Geschichte und Struktur dermittelalterlichen Eisengewinnung im Lahn-Dill-Gebiet (Hessen). Münstersche Beitr. Ur-u. Frühgesch.Arch. 1 (Rahden/Westf. 2005).
220
Weisgerber 1995G.Weisgerber,Aufgaben der Montanarchäo-logie. Arch. Österreich 6/2, 1995, 23–29.
Ders. 2002G. Weisgerber, s.v. Montanarchäologie. In:Hoops Reallexikon der GermanischenAlter-tumskde. 2. Aufl., Bd. 20 (Berlin u. New York2002), 180–199.
Anmerkungen:1 Zur Definition von Montanarchäologie s. Weisgerber
1995/2002.2 Vgl. etwa Serneels 1995, 36 Fig. 2 (Angaben von
Schlackenmengen in kg/m2 bei wechselnder Schnitt-größe), Jockenhövel/Willms 2005, 109 ff. (2,5 m x2,5 m bzw. 1,25 m x 1,25 m Schnittgröße); Gruat u.a.2007, 194 Fig. 14 (2 m x 2 m Schnittgröße); Schäferim Druck c (10 m x 10 m Schnittgröße).
3 Vgl. De Bie/Caspar 2000/II, 145 ff., bes. 146 Map 27;Plumettaz 2007, z.B. 139 Fig. 245.
4 Vgl. vorläufig Schäfer 2007, 10 f.; ders. 2009, 99–119(Wetzlar-Dalheim C32).
5 Besonderer Dank gebührt B. Schroth M.A., dem Lei-ter des Grabungsteams der Univ. Jena, sowie derDeutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für dieFinanzierung. Vgl. Schäfer 2007; Schäfer im Drucka/b; Schäfer/Schroth 2006/2007/2008; zum Vorpro-jekt seit 1999 s. Schäfer/Stöllner 2000/2001; Schäfer2003.
6 Vgl. dazu grundlegend Cziesla 1990, 8 ff. bzw. 43 ff.7 Dank gebührt hierfür Dr. R. Hesse, ehemals Geo-
graphisches Institut der Friedrich-Schiller-UniversitätJena.
8 Für die gute Zusammenarbeit sei der Firma Posseltund Zickgraf Prospektionen, Marburg (B. ZickgrafM.A., N. Buthmann M.A.) herzlich gedankt, die auchein Messgerät der Marke Bartington MS2 für die Sus-zeptibilitätsmessungen zur Verfügung stellte.
9 Telford u. a. 1990, 72 ff. mit Tab. 3.1.
Ders. im Druck cA. Schäfer, Zur Eisenverarbeitung im Oppi-dum von Manching. Schlacken und Herd-fragmente der Grabung „Altenfeld 1996–1999“. In: S. Sievers (Hrsg.), Die Grabungenin Manching „Altenfeld 1996–1999“. Ausgr.Manching (im Druck).
Schäfer/Schroth 2006A. Schäfer / B. Schroth, Ein neuer Fundplatzder „Gießener Gruppe“ aus der älterenrömischen Kaiserzeit. HessenArch. 2006,86–89.
Dies. 2007A. Schäfer / B. Schroth, Verhüttungsöfen insitu im Eisenrevier bei Wetzlar-Dalheim,Lahn-Dill-Kreis. HessenArch. 2007, 76–78.
Dies. 2008A. Schäfer / B. Schroth, Das Fragment einervergoldeten Großplastik aus Wetzlar-Dal-heim, Lahn-Dill-Kreis. HessenArch. 2008,71–73.
Schäfer/Stöllner 2000/2001A. Schäfer / Th. Stöllner, Frühe Metallge-winnung im mittleren Lahntal. Vorberichtüber die Forschungen der Jahre 1999–2001.Mit Beiträgen von N. Buthmann/B. Zickgraf,G. Gassmann, A. Kreuz und K. Röttger. Ber.Komm. Arch. Landesforsch. Hessen 6,2000/2001, 83–111.
Telford u. a. 1990W. M. Telford, L. P. Geldart, R. E. Sheriff,Applied Geophysics. Second Edition (Cam-bridge 1990).