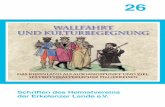Ein Rollsiegel aus Baktrien und seine Hinweise auf Fernhandel
Meroe und Nubien auf Banknoten
Transcript of Meroe und Nubien auf Banknoten
Die in den Beiträgen vorgebrachten Inhalte und Aussagen unterliegen ausschließlich der Verantwortung der jeweiligen AutorInnen und müssen nicht den Ansichten des Herausgebers entsprechen. Es wird vorausgesetzt, dass alle AutorInnen die Genehmigung zur Publikation von Objekten und Fotografien besitzen. Gedruckt mit Unterstützung der philologisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien Umschlagbild: Felsbilder am Jebel Shigrib ISSN: 1010-9072 Medieninhaber und Herausgeber: Verein der Förderer der Sudanforschung, Redaktion: Michael H. Zach, Institut für Afrikawissenschaften der Universität, Universitätscampus AAKH, Spitalgasse 2, Hof 5.1, A-1090 Wien, Österreich Hersteller: Citypress, Hormayrgasse 53, A-1170 Wien, Österreich
155
MEROE UND NUBIEN AUF BANKNOTEN
Michael H. Zach (Wien)
Vor einigen Jahren stellte Steffen Wenig jene Briefmarken vor, deren Motive Sujets des antiken und mittelalterlichen Sudan wiedergeben.1 Naturgemäß handelt es sich hierbei vor allem um sudanesische Emissionen, aber auch um Sondermarkensätze der DDR und Polens, welche die jeweiligen sudanarchäologischen Aktivitäten sowie relevante museale Bestände aufzeigen. Über den rein philatelistischen Befund hinausgehend dokumentiert er damit ein Segment der historischen Rezeption mittels eines spezifischen Mediums, das eine offizielle Sichtweise der jeweils verantwortlichen Behörden reflektiert. Wiewohl vordergründig für den postalischen Gebrauch gedacht, muß jedoch eingeschränkt werden, daß die Ausgaben Polens und der DDR nur zu einem geringen Maße in Umlauf gelangten, überwiegend jedoch (maschinell abgestempelt) zum Zwecke der Devisenbeschaffung dem internationalen philatelistischen Handel zugeführt wurden.2 Wenngleich Wenig seinen Beitrag fast ausschließlich mit postfrischen Marken illustriert, zeigen doch die Abbildungen 12 und 28 keine echt gelaufenen Stücke, sondern vielmehr solche, die für Sammlerzwecke mit Ersttagsstempel („Gefälligkeitsabstempelungen“) versehen sind. Somit blieben sie lediglich einem begrenzten Publikum vorbehalten – dem überwiegend die dargestellten Motive fremd waren – und reflektiert nur im Kontext der sudanesischen Ausgaben einen Beitrag zur nationalen Identitätsstiftung.
Anders verhält es sich jedoch mit Geld in Münz- oder Banknotenform, das grundsätzlich für den Umlauf innerhalb eines Staates bestimmt ist. Unbestreitbar existiert mittlerweile auch hierfür ein wachsender internationaler Sammlermarkt, doch ist dieser infolge der andersartigen Wertigkeit bzw. inhärenten Kaufkraft als Zahlungsmittel verglichen mit Briefmarken noch nicht so ausgeprägt. Demzufolge stehen aufgrund der lokalen Distribution bei der Motivauswahl andere Prioritäten im Vordergrund, die jedenfalls eine gesamtstaatliche Identität vermitteln und einen nicht unwesentlichen Beitrag zum nationalen Selbstverständnis leisten.3 In diesem
1 S. Wenig, Der antike Sudan auf Briefmarken, MittSAG 7 (1997) 70-74. 2 So war es etwa bei den Sondermarkensätzen der DDR üblich, eine der Wertstufen willkürlich als „Sperrwert“ in einer wesentlich geringeren Auflage als die weiteren Werte aufzulegen, um damit den Satzpreis künstlich in die Höhe zu treiben. 3 Selbst in der 2002 geschaffenen Euro-Zone zeigen trotz einheitlicher Gestaltung der Banknoten sowie Münzaversen deren Reversen nationale Charakteristika wie beispielsweise Porträts der jeweiligen Monarchen oder sonstiger prominenter Persönlichkeiten, lokale Motive aus den Bereichen Architektur, Flora und Fauna oder (althergebrachte) Symbole wie z.B. die irische Harfe, die französische Marianne oder das deutsche Eichenlaub als offensichtliches Zugeständnis an nationale Befindlichkeiten. Eine besondere Rolle nimmt hierbei Griechenland ein, indem es als einzige zugehörige Nation für seine niederen Münznominalen anstatt „Cent“ weiterhin die alte Währungsbezeichnung „Lepta“ verwendet.
156
Zusammenhang kann eine gezielte Ikonographie darüber hinausgehend durch Vermittlung politischer Ideologien oder Programme, die vor allem der eigenen Bevölkerung verständlich sind, zusätzliche Bedeutung erlangen. Somit weist auch die sudanesische Währung bewußt Motive auf, die in ihrer wechselnden Form das aktuelle Selbstverständnis des Staates aufgrund der den jeweiligen politischen Machthabern bzw. Fraktionen zugrundeliegenden Ideologien reflektieren. Unter dieser Prämisse liegt auch der Darstellung archäologischer Monumente bzw. Relikte die Intention der staatlichen Autoritäten zugrunde, um gemäß der von ihnen vertretenen Werte innerhalb definierter Rahmenbedingungen zu einer gesteuerten nationalen Identitätsbildung beizutragen. Als Faktoren sind hierfür beispielsweise ethnische oder religiöse Gesichtspunkte zu nennen, wie etwa im Fall des Sudan die auf bestimmte Emissionen beschränkte Inkludierung von Motiven der vorislamischen Zeit.
Erstmals begegnen uns Antiken auf einer sudanesischen Banknote mit der Nominale von einem Pfund innerhalb eines von 25 Piastern bis 10 Pfund reichenden fünfteiligen Satzes, der in drei Typen mit zwei unterschiedlichen Wasserzeichen (Nilpferd und Sekretärsvogel) zwischen Jänner 1970 und 2. Jänner 1980 emittiert wurde (Abb. 1).4 Ihre Vorderseite zeigt als Zentralmotiv in Südansicht den sog. „Römischen Kiosk“ von Naqa, der gegenwärtig im Mittelpunkt der archäologischen Aktivitäten des Ägyptischen Museums in Berlin steht und dessen funktionale Bedeutung möglicherweise mit dem Kult der Hathor in Verbindung gebracht werden kann.5 Am rechten Rand befindet sich die Frontaldarstellung des knienden Taharqo (690-664), der in seinen vor dem Körper abgewinkelten Armen zwei kugelförmige Opfergefäße hält (dasselbe Motiv zeigen übrigens auch drei am 1. März 1961 von der sudanesischen Postverwaltung herausgegebene Briefmarken und ein Block).6 Ihr liegt eine aus Bronze gefertigte Statuette unbekannter Provenienz zugrunde, die aus einer Gesamtkonzeption (Taharqo in Anbetung des ihm zugewandten Falkengottes Hemen, des Schutzherrn der oberägyptischen Stadt el-Moalla) herausgelöst wurde. Das rundplastisch ausgeführte Objekt befindet sich seit 1952 unter der Inventarnummer E 25276 im Pariser Louvre.7 Die möglicherweise aus vergleichbarem Kontext
4 G.S. Cuhaj (ed.), Standard Catalogue of World Paper Money. Volume 3. Modern Issues 1961 – Date, 10th edition, Iola 2004, 778 Cat. 13. 5 So D. Wildung, Am Ende der hellenistischen Welt. Der Römische Kiosk in Naga, aMun 18 (2003) 16-20. Bemerkenswerterweise sind trotz seiner Einzigartigkeit bislang nur zwei Untersuchungen einer umfassenden Diskussion des Bauwerks gewidmet: T. Kraus, Der Kiosk von Naqa, Archäologischer Anzeiger (1964) 834-868 und L. Török, Zur Datierung des sogenannten römischen Kiosks in Naqa/Sudan, Archäologischer Anzeiger (1984) 145-159. 6 Wenig, Der antike Sudan, 70 f. und Abb. 1. 7 G. Andreu, M.-H. Rutschowscaya, C. Ziegler, Ancient Egypt at the Louvre, Paris 1997, 183 f. und Abb. 91 ; vgl. auch z.B. J. Vandier, Hémen et Taharqa, Revue d’Égyptologie 10 (1955) 73-79 und Pl. 5; J. Leclant, Ägypten. Dritter Band. Spätzeit und Hellenismus. 1070 v.Chr. bis 4. Jahrhundert n.Chr., München 1981, 7 Abb. 3 und 237 Abb. 224; J. Vercoutter, J. Leclant, F.M. Snowden Jr., J. Desanges, L’image du noir dans l’art occidental. I. Des pharaons a la chute de l’empire romain, Paris 1991, 100 f. und Abb. 83 f.
157
stammende nahezu identische Bronzestatuette eines anonymen Königs der 25. Dynastie (Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek ÆIN 605) ist aufgrund ihres schlechteren Erhaltungszustands und der unregelmäßig abgewinkelten Arme als Vorlage auszuschließen.8
Nach fünfjähriger Pause finden sich erneut ein antikes sowie erstmals ein mittelalterliches Motiv auf zwei Nominalen eines sudanesischen Banknotensatzes, der – unter Auslassung bzw. Hinzufügung bestimmter Wertstufen – in drei Typen (deren spätester sich auch durch farbliche Variation von den vorhergehenden unterscheidet) zwischen 1985 und 1991 herausgegeben wurde.9 Sie alle zeigen im Zentrum der Vorderseite die von Lorbeerzweigen und Ähren umgebene Landkarte des Sudan innerhalb unterschiedlicher Umrahmungen sowie in der linken Hälfte jeweils ein landestypisches Sujet, während die rechte (mit Ausnahme der Wertstufen von 25 und 50 Piastern der Ausgaben 1985 und 1987-1990) ein rundes Leerfeld zur besseren Kenntlichmachung des Wasserzeichens aufweist.
Zunächst ist hier die Nominale von 10 Pfund mit der Darstellung des Stadttors von Suakin zu nennen, deren Zentralmotiv von zwei traditionellen Schrifttafeln flankiert ist (Abb. 2).10 Sie beinhalten jeweils ein Alphabet, wobei das arabische dem meroitischen gegenübergestellt wird. Letzteres zeigt den in vertikalen Kolonnen angeordneten Graphembestand der Kursiva (inklusive des Morphemtrenners), der paläographisch eine Mischung von archaischen bis späten Formen umfaßt.11 Dabei unterlief dem Entwerfer der Banknote jedoch ein Fehler, indem er das Graphem für n (n) doppelt, nämlich je einmal in den Kolonnen 2 und 4 aufführt.
Abgesehen von diesem Kuriosum ist jedoch vor allem bemerkenswert, daß hier Schriftsysteme zweier zwar nicht lokal aber zeitlich voneinander getrennter Kulturen, die unterschiedliche Ideologien sowie insbesondere Religionen reflektieren, für die nationale Identitätsstiftung eines (weitgehend) islamischen Staates herangezogen werden. Die einzige vergleichbare Parallele findet sich auf einer von 1966 bis 1971 kursierenden Banknote zu 10 Buqsha der Arabischen Republik Jemen,
t8 Vercoutter e al., L’image du noir, 114 und Abb. 109.
9 Die Ausgabe von 1985 umfaßt sieben von 25 Piastern bis 50 Pfund reichende Wertstufen und erfuhr in der zweiten Emissionsphase der Jahre 1987 bis 1990 eine Erweiterung auf acht unter Hinzufügung der Nominale von 100 Pfund. Letztlich sieht der 1991 emittierte Satz infolge der inflationsbedingten Auslassung der drei niedrigsten Werte (25 Piaster bis 1 Pfund) eine Reduktion auf fünf, wobei jedoch die 100 Pfund-Banknote in zwei unterschiedlichen Farbgebungen gedruckt wurde. 10 Cuhaj (ed.), Standard Catalogue, 778 f., Cat. 34, 41 und 46. 11 Vgl. die paläographischen Tabellen bei F. Hintze, Studien zur meroitischen Chronologie und zu den Opfertafeln aus den Pyramiden von Meroe, Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst. Jahrgang 1959, Nr. 2, Berlin 1959, Tfl. I; K.-H. Priese, Zur Entstehung der meroitischen Schrift, in: F. Hintze (ed.), Sudan im Altertum. 1. Internationale Tagung für meroitistische Forschungen in Berlin 1971, Meroitica 1, Berlin 1973, 300 ff., Tab. I a-d; I. Hofmann, Steine für die Ewigkeit. Meroitische Opfertafeln und Totenstelen, Beiträge zur Sudanforschung. Beiheft 6, Wien-Mödling 1991, 127 Tab. 1.
158
die im Revers eine sabäische Weiheinschrift aus Ma’rib zeigt.12 Antike Schriften stünden im islamischen Raum jedenfalls genügend zur Verfügung, so beispielsweise Hieroglyphen, Hieratisch, Demotisch und Koptisch (Ägypten), Punisch und Numidisch (Tunesien), Tifinaght (Algerien), Nabatäisch (Jordanien), Hethitisch (Türkei), Aramäisch (Syrien und Irak), Sumerisch, Assyrisch, Elamitisch, Babylonisch (Irak), Altpersisch (Iran), die Industal-Schrift (Pakistan) oder Tocharisch (Afghanistan).
Als Beispiel außerhalb Afrikas bzw. des islamischen Kontexts wäre etwa Mexiko zu nennen, wo diverse Emissionen Hieroglyphensteine der Azteken (d.h. der Mexica),13 nicht aber solche der Maya aufweisen, die offensichtlich aufgrund ihres bis nach Guatemala, Belize und Honduras reichenden Siedlungsgebiets innerhalb festgefügter Grenzen als ungeeignetes Instrument zur Vermittlung nationaler Identität empfunden wurden oder möglicherweise Irritationen seitens der Nachbarstaaten ausgelöst hätten. Umgekehrt zeigen sowohl Banknoten aus Belize und Guatemala Schriftdenkmäler der Maya, während jene von Honduras andere spezifische kulturelle Relikte aufweisen.14 Die Brisanz eines solch vordergründig marginalen Details mag ein imaginäres Beispiel demonstrieren. Welche heftigen Reaktionen wären – unter Bedachtnahme der Ideologie des Dritten Reiches – wohl die Folge gewesen, hätte vor Einführung des Euro die Deutsche Bundesbank germanische Runen auf einem Markschein abbilden lassen?
Letztlich ist für unsere Untersuchung die Nominale von 50 Pfund relevant, die in der linken Hälfte unterhalb der Darstellung der Eingangshalle des Sudan National Museum die Säulen aus der Kathedrale von Faras zeigt, welche im Zuge der Aktivitäten der UNESCO-Kampagne zur Rettung der nubischen Altertümer nach Khartoum überführt worden waren (Abb. 3).15 Auch hier werden archäologische Relikte des vorislamischen Sudan zur nationalen Identitätsstiftung herangezogen, wiewohl solche der islamischen Zeit zahlreich zur Verfügung gestanden hätten. Nicht einmal das benachbarte Ägypten, das in seinen Emissionen reichhaltigst auf pharaonische Motive zurückgreift, führt trotz seiner vergleichbaren religionsgeschichtlichen Vergangenheit jemals ein christliches Sujet auf. Es bliebe jedoch im sudanesischen Kontext zu klären, inwieweit hier tatsächlich diese historische Periode dokumentiert oder lediglich das 1971 in Khartoum eröffnete Nationalmuseum repräsentiert werden sollte.
Mit der Währungsreform des Jahres 1992 veränderte sich die Gestaltung der sudanesischen Banknoten grundlegend. An die Stelle des Nationalbankgebäudes als einheitliche Hinter- trat der Präsidentenpalast als durchgängige Vorderseite, während die historischen Darstellungen verschwanden und durch Pflanzen, abstrakte Motive sowie moderne Bauwerke (darunter eine Moschee) oder industrielle Strukturen wie
12 Cuhaj (ed.), Standard Catalogue, 923, Cat. 4. 13 Cuhaj (ed.), Standard Catalogue, 560 ff., Cat. 59, 69, 75, 78, 79, 84, 89 und 95. 14 Cuhaj (ed.), Standard Catalogue, 71 f., Cat. 52-54; 341 ff., Cat. 63, 73 und 87. 15 Cuhaj (ed.), Standard Catalogue, 780 ff., Cat. 36, 43 und 48 (Avers kopfstehend abgebildet).
159
etwa einen Ölbohrturm ersetzt wurden. Unverkennbar sind hier die Parallelen zu den Ausgaben von 1981 und 1983-1984, die eindeutig in ideologischem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Einführung der Shari’a (9. September 1983) durch Präsident Ja’afar Mohammed el Numeiri stehen.
Insgesamt reflektieren die vorgestellten Banknoten ein sehr spezifisches Segment der Identitätsbildung innerhalb des afrikanischen Kontexts, da mit Ausnahme Ägyptens und (bedingt) Zimbabwes kein anderer Staat Afrikas archäologische Relikte durchgehend auf seinen Geldscheinen abbilden ließ.16 Lediglich auf einigen Nominalen zeitlich befristeter Emissionen aus Libyen, Tunesien, Äthiopien, Gambia und Nigeria wurden (oder werden) noch gelegentlich Rückgriffe auf die ältere Geschichte vorgenommen. Für die weitgehende Exkludierung der eigenen Vergangenheit scheint insbesondere das Streben der meisten afrikanischen Staaten verantwortlich zu sein, innerhalb multiethnischer Gesellschaften und zumeist durch die ehemaligen Kolonialmächte gezogener Grenzen die Darstellung von bestimmten Volksgruppen zuordenbaren Monumenten bzw. Objekten zu vermeiden, um keiner davon eine lokal transportierte Prominenz zu gewähren. Dies scheidet zwar für die meroitischen Sujets aus, ließe sich aber – zumindest bedingt – auf das Motiv der Säulen aus der Kathedrale von Faras als Beleg für die ehemalige Dominanz der Nubier im mittleren Niltal anwenden.
Aufgrund des Umlaufverhaltens der sudanesischen Währung, d.h. ihrer auf der hohen Inflationsrate basierenden Inkompatibilität, des Ein- und Ausfuhrverbots sowie des so gut wie nicht vorhandenen Fremdenverkehrs ist auszuschließen, daß deren Gestaltung der externen Selbstdarstellung dienen sollte. Vielmehr war und ist sie für die eigene Bevölkerung gedacht, wiewohl aufgrund der Größe und Multiethnizität des Staates, der weitgehenden Absenz von Geldwirtschaft in manchen Regionen sowie fehlender landesweiter Schulbildung unterschiedliche Zugänge und damit Identifikationsmöglichkeiten mit den dargestellten Motiven voraussetzen lassen müssen. Trotz dieser Einschränkungen reflektieren die spezifischen Emissionen des Sudan eine bemerkenswerte Offenheit gegenüber der eigenen vorislamischen Geschichte, wiewohl deren Ausdrucksmöglichkeiten der den jeweiligen politischen Systemen zugrundeliegenden Ideologien angepaßt wurden.
16 Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß sich sowohl Rhodesien wie auch das moderne Zimbabwe mit den Ruinen von Groß-Zimbabwe vor dem Hintergrund der jeweiligen Staatsideologie desselben Motivs bedienten. Für den Apartheidstaat waren sie das Zeugnis der „weißen Vergangenheit“ des Landes unter pseudolegitimatorischer Bezugnahme auf die angebliche Präsenz von Israeliten und Phöniziern zu Zeiten des Königs Salomon und des Selbstverständnisses der herrschenden Schicht als Nachfolger des legendären biblischen „Goldlandes“ Ophir, während sie nach der Unabhängigkeit 1980 zum (historisch korrekten) Beleg für die lange zurückreichende Geschichte der Bantu in dieser Region wurden.