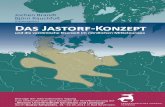Павел Јозеф Шафарик О пореклу Словена по Лоренцу Суровјецком ABKUNFT DER SLAWEN
Wikinger und Slawen auf Rügen – Ein bronzenes Tierköpfchen im Mammen-Stil aus Natzevitz, Lkr....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Wikinger und Slawen auf Rügen – Ein bronzenes Tierköpfchen im Mammen-Stil aus Natzevitz, Lkr....
Bodendenkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern, Jahrbuch 59, 2011 Seite 81–88 Schwerin 2012
Dirk Röttinger
Wikinger und Slawen auf Rügen –Ein bronzenes Tierköpfchen im Mammen-Stil
aus Natzevitz, Lkr. Vorpommern-Rügen
Der Fundplatz
Im Frühjahr 2010 wurde zwischen den Orten Rothenkirchen und Bergen, beide Lkr.Vorpommern-Rügen, eine Biogasleitung verlegt. Da schon vor Beginn der Arbeitenim Trassenverlauf mehrere Bodendenkmale bekannt waren, vereinbarte der Bauherrmit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, Dezernat Archäologie, Schwerin(LAKD) eine archäologische Begleitung der Bauarbeiten.1
Eines der von dem Bau betroffenen Bodendenkmale war der Fundplatz Natzevitz 12(Abb. 1), der erstmals 1975 Lesefunde erbracht hatte.2 2008 kamen beim Ausbaggern
81
1 Die wissenschaftliche Leitung der Arbeiten hatte der Verfasser, der durch C. Schacht, T. Benyskiewicz, M. Bialucha,
A. Schramm und M. Werner unterstütztwurde.
2 KFB 1976, 247.
Abb. 1. Lage des Fundortes.
eines wenige Meter parallel zur Gasleitung verlaufenden Kabelgrabens zwölf Sied -lungsbefunde der jüngeren Bronze- und jüngeren Slawenzeit zutage.3 Bei den bislangvorliegenden Funden handelte es sich überwiegend um Siedlungskeramik, die eineNutzung des Platzes in der jüngeren Bronzezeit, in der römischen Kaiserzeit und in derjüngeren Slawenzeit vermuten ließ. Der Fundplatz erstreckt sich über eine im Durch -messer etwa 250 m große Hügelkuppe, die eine Höhe von 8 m über HN erreichtund damit das Umfeld um etwa 3 m überragt. Umgeben war das dortige Siedlungsarealvon mehreren feuchten, zum Teil heute noch wasserführenden Senken. Abgesehenvon seiner Schutzlage bietet der Ort eine hervorragende Übersicht über die ihn um-gebende Landschaft – soweit diese waldfrei gehalten wurde. Im Umkreis von 1,5 kmgibt es zwei weitere Siedlungen der Bronzezeit4, eine Siedlung der römischen Kaiserzeit5
und vier Siedlungen der jüngeren Slawenzeit6. Etwa 500 m nordöstlich, nahe derheutigen Ortsgrenze zu Samtens, sind ferner slawische Körpergräber nachgewiesen.7
Die Trassenführung der Biogasleitung schneidet die Kuppe im zentralen Bereichund erbrachte beim Mutterbodenabtrag (Breite 3 m) 17 Siedlungsbefunde, die wie-
82
3 KFB 2008, 356 f.; 397.4 Fundplatz Natzevitz 18 (KFB 1998, 591);
Fundplatz Natzevitz 20 (KFB 2001, 442).5 Fundplatz Natzevitz 18 (KFB 1998, 599).
6 Fundplätze Natzevitz 8, 9, 11, 18 (KFB1976, 246 f.; 1998, 619 f.).
7 Fundplatz Natzevitz 4 (CORPUS 1973, 85).
Abb. 2. Natzevitz, Lkr. Vorpommern-Rügen, Fundplatz 12. Vorratsgrube.
derum in die jüngere Bronzezeit und in die jüngere Slawenzeit datieren und sich übereine Trassenlänge von 77 m erstreckten. Es handelte sich um Pfosten- und Sied lungs -gruben sowie eine Hausgrube und eine knapp 2 m tiefe Vorratsgrube (Abb. 2). DasFundmaterial der jungbronzezeitlichen Phase besteht aus Scherben grob gemagerter,unverzierter Gebrauchskeramik. Die jungslawischen Befunde enthielten Keramik derTypen Vipperow, Teterow und Garz, Tierknochen und zehn Eisenfragmente. DasKeramikspektrum spricht für eine Besiedlung während des 10.–12. Jahrhunderts.
Der Fund
Zeitgleich mit der Untersuchung der aufgedeckten Befunde erfolgte die Kontrolle derMutterbodenhalde mittels Metalldetektor. Dabei wurde außer einzelnen Eisen- undBunt metallobjekten ein bemerkenswertes Fundstück skandinavischer Herkunft ge bor -gen. Es handelt sich um ein bronzenes Tierköpfchen (Länge 3,0 cm; Breite 1,1 cm;Höhe 1,3 cm), dessen Oberfläche ehemals offenbar vollständig feuervergoldet war(Abb. 3–4).8
83
8 Inventarnummer: ALM2010/1002, 1.
Abb. 4. Natzevitz, Lkr. Vorpommern-Rügen, Fundplatz 12. Bronzenes Tier -köpfchen im Mammen-Stil, Umzeich -nung. M. 1:1.
Abb. 3. Natzevitz, Lkr. Vorpommern-Rügen, Fundplatz 12. Bronzenes Tier -köpfchen im Mammen-Stil mit Restenvon Feuervergoldung. M. 2:1.
�
Die Darstellung ist annähernd vollplastischausgeführt. Das Halsende wurde als Tülle gestal-tet, wobei die Tüllenöffnung die äußere Konturmit abgeflachter Unterseite nachvollzieht. AnOber- und Unterseite befinden sich Nietlöcher(Durch messer 0,2 cm; Abb. 4). Das am gegen -über liegen den Frontalende befindliche Maul istweit geöffnet, um einem aufrecht stehendenÖsenring Platz zu bieten. Dies deutet darauf hin,dass das Stück ursprünglich an beiden Endenmit weiteren Gegenständen verbunden war.
Stark betont ist der Augenbereich des Tieresmit seinen weit hervortretenden, mandelförmigenAugäpfeln und wulstartigen Orbitalen. Die Brauen -bögen sind weit in Richtung Hals ver längert. DerSchnauzenbereich mit geschwun ge nen Nasenöff -nungen ist vom übrigen Kopf durch eine tiefeKerbe abgesetzt. Die übrigen Flächen bedeckenornamentale Elemente. So sind Unter kiefer undWangenbereich, an denen die Feuer vergoldungam besten erhalten blieb, mit diagonal verlaufen -den Rippen verziert. Die Hals partie weist umlau -fende Punktbänder auf, wobei ein Band mit größeren Punkten von zwei Bändern mitkleinen Punkten eingefasst wird. Über Scheitel und dem vorderen Nackenbereicherstreckt sich ein plastisches Fischgrätmuster, bei dem es sich um ein reptilienhaut -artiges Element oder die Stilisierung einer Mähne handeln könnte.
Eine tierartliche Zuweisung ist nicht möglich; ähnliche Darstellungen werdenallerdings zumeist als Greifen oder Drachen gedeutet.9 Dies resultiert zumindest teil-weise aus dem Bedeutungsgehalt dieser Tiere in der germanischen Mythologie.10
Die Gestaltung des Fundstückes aus Natzevitz und die ornamentale Verzierungder Oberflächen sind typisch für die skandinavische Kunst des frühen Mittelalters, diezahlreiche formale Parallelen bietet (Abb. 5–6). Vergleichsstücke – auch aus demnäheren Umfeld – sind unlängst zusammengestellt worden.11 Erwähnenswert istinsbesondere das Vogelköpfchen aus Nonnendorf, Lkr. Vorpommern-Greifswald, dasdem Natzevitzer Exemplar sehr ähnelt.
Stil und Datierung
Die Verzierung des Natzevitzer Tierköpfchens ist dem Mammen-Stil zuzuordnen undsomit in die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts oder in das beginnende 11. Jahr -hundert zu datieren. Der Mammen-Stil war von den Britischen Inseln bis ins Baltikumverbreitet.12 Er stellt im Grunde genommen die späte Form des Jellinge-Stils dar und
84
9 CAPELLE 1988, 109 ff.10 NEISS 2004; 2007.11 BIERMANN/RAUSCH 2004, 383 ff. Abb. 11, 2.
12 PULSIANO/WOLF 1993, 694; HOOPS 2000, 586; BIERMANN/ RAUSCH 2004.
Abb. 5. Gokstad-Schiff. Ausschnitt ausdem Steuerruder (nach NICOLAYSEN1882, Taf. XI, 1). M. 1:8.
Abb. 6. Gokstad-Schiff, Grabbeigabe.Tierköpfchen mit Tüllenende (nachNICOLAYSEN 1882, Taf. X, 21). M. 1:1.
überschneidet sich zeitlich mit diesem teilweise.13 Die Tierdarstellungen sind jedochvoluminöser und üppiger gehalten.14
Die gedrungene, semi-naturalistische Darstellung und die mandelförmigen Augenmit stark betonten Orbitalen zeigt zum Beispiel ein aus Holz geschnitztes Tierköpfchenaus Wolin, Powiat Kamień Pomorski (Polen).15 Das Natzevitzer Stück wirkt durchseine abgerundeten Formen und die elegant geschwungene Nüsternpartie insgesamtjedoch weicher in der Formgebung.
Exakt diese Merkmale sowie eine „Halskrause“ mit Punktreihen weisen die Tier -protomen des Reliquienschreins von Bamberg16 auf. Die Augenform der BambergerTierköpfchen ähnelt dem Natzevitzer Stück sehr. Auch sind die Brauenbögen weit nachhinten verlängert, allerdings werden sie durch Ohren unterbrochen. Der BambergerSchrein wird dem Mammen-Stil zugeordnet und in die Zeit um 1000 gesetzt.17
Die Verwandtschaft zum älteren Jellinge-Stil zeigt sich besonders deutlich, wennman das Natzevitz-Köpfchen mit dem Tierkopf am Steuerruder des Gokstad-Schiffes18
vergleicht (Abb. 5). Dieser hat eine ähnliche Proportionierung. Die abgesetzteSchnauzenpartie und die gepunktete „Halskrause“ sind ebenso vorhanden, dochunterscheiden sich Augenpartie und Nüstern deutlich. Das Gokstad-Schiff wird in den Zeitraum zwischen 890 und etwa 905 n. Chr. datiert19 und ist mindestens 50 Jahre älter als der Natzevitz-Fund.20
Funktion
Wahrscheinlich bildete das Köpfchen von Natzevitz mit seinem Tüllenabschluss dasEnde einer Schmuckkette, zusammen mit einem heraldischen Pendant am anderenEnde. Durch die Öse im Maul führte vermutlich ein Ring, an dem noch ein Anhängeroder Ähnliches befestigt war. Diese Kombination ist an Vergleichsstücken aus Däne -mark überliefert, zum Beispiel der Halskette des „Mandemark-Schatzfundes“ von derInsel Møn21, dem Goldkreuz von Orø22 oder einer Kette aus dem Schatzfund von Bon -derup23. Denkbar wäre allerdings auch eine ähnliche Verwendung an Gür teln oderSchwertgehängen, wie ein Beispiel aus Satakunta (Finnland) zeigt.24 Auffällig ist jedoch,dass weder an der Öse im Maul des Tierköpfchens noch am Tüllenende Abnutzungs -spuren, die auf einen intensiven oder längeren Gebrauch hindeuten, feststellbar sind.
Bei vielen Objekten skandinavischen Ursprungs wurden derartige Tierdarstel -lungen an prominenter Stelle platziert, beispielsweise an Ketten- oder Reifenenden,an Prestigeobjekten wie Kummetbeschlägen oder Trinkhörnern sowie Prunkkästchenund Reliquienschreinen.25 Allgemein sprechen die Art der Anbringung sowie diekonsequente Betonung der Augenpartie und der Drohgeste eines zähnefletschendenoder aufgerissenen Maules für eine apotropäische Funktion.26
85
13 PULSIANO/WOLF 1993, 694.14 FUGLESANG 2001, 159 f.; PULSIANO/WOLF
1993, 694.15 DUCZKO 2000.16 KAUFMANN 2008, 282.17 KAUFMANN 2008, 282.18 NICOLAYSEN 1882.19 BONDE/CHRISTENSEN 1993.
20 NICOLAYSEN 1882.21 THORVILDSEN 1957, 95 ff.22 ROESDAHL 1992, Nr. 493.23 ROESDAHL 1992, Nr. 37.24 ROESDAHL 1992, Nr. 225.25 BIERMANN/RAUSCH 2004, 385 f.26 EIBL-EIBESFELD/SÜTTERLIN 1992,
409 ff.
Herkunft
Die genannten Vergleichsstücke deuten an, dass der Fund von Natzevitz wohl kaumvon der einheimischen slawischen Bevölkerung gefertigt wurde. Vielmehr haben wirein Objekt aus dem wikingischen Kulturraum vor uns, das vermutlich durch Handeloder als Geschenk beziehungsweise Beutegut nach Rügen gelangte. Ebensogut könntees die Arbeit eines aus dem skandinavischen Raum stammenden Handwerkers sein,der auf Rügen wirkte. Handel mit dem Norden fand beispielsweise in dem nur etwa15 km entfernten Seehandelsplatz Ralswiek statt, doch ist davon auszugehen, dass esauf Rügen noch weitere maritimen Handel betreibende Siedlungen gegeben hat, wasbesonders für den westlichen Teil der Insel zutrifft.27 Um 1000 war sicherlich nichtnur Ralswiek am überseeischen Handel beteiligt, zumal es in jener Zeit allmählich anBedeutung verliert.28 Als hochmittelalterlicher Nachfolger käme beispielsweise deretwa 18 km entfernte Fundplatz Streu 2 bei Schaprode, Lkr. Vorpommern-Rügen,infrage.29 Für das 11. Jahrhundert überlieferte Raubzüge rügischer Slawen nach Däne -mark lassen allerdings ebenso die Deutung als Beutegut zu.30
Kaum zu bestreiten ist, dass das Natzevitzer Köpfchen ein Prestigegut mit hohemSymbolwert darstellt – und das nicht nur für die slawische Bevölkerung. Bemerkens -wert ist es daher, dass es von einem Fundplatz im Inselinneren überliefert ist, der bis-lang nicht durch herausragendes Fundmaterial auffiel. Bislang waren von dem etwa250 x 150 m großen Siedlungsareal am Ortsrand des heutigen Natzevitz’ vornehmlichKeramikfunde bekannt. Die Ergebnisse der beiden kleinflächigen Untersuchungen derJahre 2008 und 2010 erlauben noch keine fundierten Aussagen zur Größe, Bedeu -tung und Dauer der slawischen Ansiedlung. Für eine Deutung des Fundplatzes alsslawischen Herrenhof gibt es – abgesehen von dem hier vorgestellten Fundstück –kaum Anhaltspunkte. Dafür spräche allenfalls, dass im näheren Umfeld vier zeitgleicheFundplätze der jüngeren Slawenzeit vorhanden sind (siehe oben) und zu Beginn des14. Jahrhunderts das Adelsgeschlecht derer „von Natzevitz“ erscheint, dessen Mit -glieder slawische und deutsche Vornamen trugen.31
86
27 RUCHHÖFT 2007, 184.28 RUCHHÖFT 2007, 186; HARCK/LÜBKE
1997, 18.
29 RUCHHÖFT 2007, 193.30 WILSON 1980, 198.31 KLEMPIN/KRATZ 1863, 12; 71.
87
BIERMANN/RAUSCH 2004F. Biermann/K. Rausch, Slawische und skandinavische Funde von Nonnendorf, Lkr. O st vorpommern. – Bodendenkmal -pflege in Meck lenburg-Vorpommern,Jahrbuch 52, 367–395.
BONDE/CHRISTENSEN 1993N. Bonde/A. E. Christensen, Dendro-chro no logical dating of the Viking Age ship burial at Oseberg, Gokstad and Tune,Norway. – Antiquity 67, 575–583.
CAPELLE 1988T. Capelle, Die Wikinger. Kultur- undKunst geschichte. D armstadt.
CORPUS 1973 Corpus archäologischer Quellen zur Früh -ge schichte auf dem Gebiet der DeutschenDemo kratischen Republik (7. bis 12.Jahrhundert). Lfg. 1. Bezirke Rostock(Westteil), Schwerin und Magdeburg. Berlin.
DUCZKO 2000W. Duczko, Obecność skandynawska naPomorzu i słowiańska w Skandynawii wewczesnym średniowieczu. In: Salsa Chol-bergiensis. Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, 23–44.
EIBL-EIBESFELD/SÜTTERLIN 1992I. Eibl-Eibesfeld/C. Sütterlin, Im Banne der Angst. Zur Natur und Kunstgeschichtemenschlicher Abwehrsymbolik. München.
FUGLESANG 2001S. H. Fuglesang, Animal ornament: the late Viking Period. In: M. Müller-Wille/L. O. Larsson, Tiere – Menschen – Götter.Wikingerzeitliche Kunststile und ihre neu-zeitliche Rezeption, 157–194. Göttingen.
HARCK/LÜBKE 1997O. Harck/C. Lübke (Hrsg.), Zwischen Reric und Bornhöved. Die Beziehungen zwischen den Dänen und ihren slawischenNachbarn vom 9. bis ins 13. Jahrhundert.Beiträge einer internationalen KonferenzLeipzig 4.–6. Dezember 1997. Stuttgart.
HOOPS 2000J. Hoops (Hrsg.), Reallexikon der germani-schen Altertumskunde 16. Berlin.
KAUFMANN 2008S. Kaufmann/Historisches Museum der Pfalz Speyer (Hrsg.), Die Wikinger. Begleit -buch zur Ausstellung „Die Wikinger“ imHistori schen Museum der Pfalz Speyer.München.
KFB 1976Kurze Fundberichte 1975. – Bodendenk-
malpflege in Mecklenburg, Jahrbuch 1976,246–247.
KFB 1998Kurze Fundberichte 1998. – Bodendenk-malpflege in Mecklenburg-Vor pommern,Jahrbuch 46, 591; 599; 619–620.
KFB 2001Kurze Fundberichte 2001. – Bodendenk-malpflege in Mecklenburg-Vorpommern,Jahrbuch 49, 442.
KFB 2008Kurze Fundberichte 2008. – Bodendenk-malpflege in Mecklenburg-Vorpommern,Jahrbuch 56, 356–357; 397.
KLEMPIN/KRATZ 1863R. Klempin/G. Kratz, Matrikeln und Ver -zeichnisse der Pommerschen Ritterschaft vomXIV bis in das XIX Jahrhundert. Berlin.
NEISS 2004M. Neiß, Fenrisulv och Midgårdsorm. Två grundmotiv i vendeltidens djurorna-mentik. (Kontinuitetsfrågor i germansk djurorna mentik I.). Mit deutscher Zusam -menfassung. – Fornvännen 99, 9–25.
NEISS 2007M. Neiß, The ornamental Echoe of Oðinn’sCult (Kontinuitetsfrågor i germansk djuror-namentik II). In: U. Fransson (red.), CulturalContacts between East and West, 82–89.Stockholm.
NICOLAYSEN 1882N. Nicolaysen, Langskibet fra Gokstad vedSandefjord. Kristiania.
PULSIANO/WOLF 1993P. Pulsiano/K. Wolf, Medieval Scandinavia:an encyclopedia. New York.
ROESDAHL 1992E. Roesdahl (Hrsg.), Wikinger, Waräger,Normannen. Die Skandinavier und Europa800–1200. Katalog der Ausstellung im Alten Museum Berlin 1992. Berlin.
RUCHHÖFT 2007F. Ruchhöft, Ralswiek, Schaprode und dieAnfänge von Stralsund – Maritime Siedlun -gen auf der Insel Rügen. – Bodendenk -malpflege in Mecklenburg-Vorpommern,Jahrbuch 55, 183–208.
THORVILDSEN 1957K. Thorvildsen, Ladby-skibet. – NordiskeFortidsminder 6. København.
WILSON 1980D. M. Wilson, Kulturen im Norden. DieWelt der Germanen, Kelten und Slawen400–1100 n. Chr. München.
Literaturverzeichnis
Bildautor/BildnachweisGeoBasis-DE/M-V 2012 (Abb. 1)Göttinger Digitalisierungszentrum: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PPN561535841 (Abb. 5–6)Ilona Röpcke, LAKD (Abb. 4)Dirk Röttinger, LAKD (Abb. 2)Sabine Suhr, LAKD (Abb. 3)
Anschrift des VerfassersDirk Röttinger M. A.Landesamt für Kultur und DenkmalpflegeDezernat ArchäologieDomhof 4/519055 SchwerinE-Mail: [email protected]
88