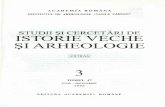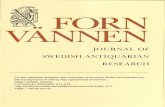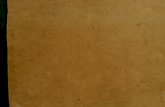Geometrisches Ornament und erster Stil. Bruno Tauts farbige Fassadengestaltung der Siedlung...
Transcript of Geometrisches Ornament und erster Stil. Bruno Tauts farbige Fassadengestaltung der Siedlung...
Geometrisches Ornament und erster Stil. Bruno Tauts farbige Fassadengestaltungen der Siedlung Falkenberg
Robin RehmUniversität Basel
Der vorliegende Beitrag untersucht die konzeptionel-len Voraussetzungen der Farbgebung der 1913-15 nach Plänen von Bruno Taut in Berlin errichteten Garten-stadt Am Falkenberg.1 Die in zwei Bauabschnitten aus-geführte Siedlung zeichnet sich durch einen ungewöhn-lichen Umgang mit der Farbe aus. Einerseits setzte Taut die Wände von Einzelhäusern und Hausgruppen mit intensiven, hellen und dunklen Farbtönen voneinander ab (Abb. 1). Andererseits ließ er einige Fassaden mit far-bigen geometrischen Mustern bemalen. Drei Gesichts-punkte sollen im Folgenden behandelt werden. Erstens ist die an den Fassaden zu beobachtende Gegenüber-stellung heller und dunkler Farbtöne in den Kontext der zeitgenössischen Farbenlehre zu stellen. Zweitens sollen die Voraussetzungen der geometrischen Muster in der damals aktuellen Architekturtheorie beleuchtet werden. Drittens ist nach der Signifikanz eines in der frühen modernen Architektur virulenten Ornament-stils für Tauts Wandgestaltungen zu fragen.
“Schimmern”, “Leuchten” und “Brennen”. Der Farbenkontrast
1913 erschien in der Zeitschrift “Gartenstadt” Adolf Behnes Artikel Die Bedeutung der Farbe in Falkenberg, in welchem der Kunsthistoriker auf verschiedene Krite-rien des Fassadenanstrichs der Gartenstadt Falkenberg aufmerksam machte.2 Laut Behne wird der erste Bauab-schnitt von vergleichsweise zurückhaltenden Farben wie Weiß, lichtes Rot, stumpfes Olivgrün, kräftiges Blau, helles Gelbbraun geprägt. Im zweiten Bauabschnitt
1913/14 konstatierte ein anonymer Autor hingegen eine erhebliche Steigerung der Farbintensität. Zum einen identifizierte er eine Nebeneinanderstellung von sehr hellen und extrem dunklen Fassadenfarben. Über-rascht bemerkte er etwa, dass sich nach “abwechselnd in Hellbraun, Graugrün und Gelb” gestrichenen Rei-henhäusern “am Ende der Gartenstadtstraße […] ein Mehrfamilienhaus ganz in Schwarz, in tiefsten Pechra-benschwarz” erhebt.3 Zum anderen beobachtete er eine Interaktion zwischen der Farbgebung einzelner Fassa-den sowie verschiedener Türen und Fenster. Beispiels-weise “schimmert” eine ganze Flucht von Reihenhäu-sern “abwechselnd in Hellbraun, Graugrün und Gelb”.4 Und an der Fassade des pechrabenschwarzen Mehr-familienhauses, “leuchten […] die Fensterkreuze in Weiß”.5 Schließlich vermeldete er erstaunt: “An einem weißen Haus brennen wie Schwefel hellgelbe Fenster”.6
Abb. 1: Bruno Taut, Einfamilienhäuser, Gartenvorstadt Falkenberg, zweiter
Bauabschnitt, 1914 (Hartmann/Wissenschaftliches Bildarchiv für Architektur).
Abb. 2: Bruno Taut, Mehrfamilienhaus, Gartenvorstadt Falkenberg, zweiter Bauabschnitt, 1914 (M. Speidel, Bruno Taut. Natur und Fantasie 1880-1938,
Ausst.-Kat., Magdeburg Berlin 1995, S. 122).
142
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
143
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
der Grundlage dieser Beobachtungen Chevreul stell-te Überlegungen an, in welcher Weise das Phänomen des Simultankontrasts im Wohnhaus-, Museums- und Theaterbau zu berücksichtigen ist.9 In der Folgezeit er-schienen zahlreiche Publikationen, die sich mit den für die Gestaltungspraxis relevanten Prinzipien des Farben-kontrasts auseinandersetzten.10
In welcher Weise Aspekte des Farbenkontrasts in Falken-berg zum Tragen kommen, sei anhand eines Beispiels erläutert. Der zweite Bauabschnitt weist Einzelhäuser auf, deren Fassaden alternierend in hellen und dunklen Farben gefasst sind. Analoge Kombinationen heller und dunkler Farbtöne wurde in der zeitgenössischen Farben-lehre eine große Aufmerksamkeit geschenkt.11 Chevreul äußerte dazu, dass bei zwei nebeneinander liegenden,
tonal abweichenden Flächen die helle Fläche heller und die dunkle dunkler erscheint (Abb. 2). Werden die Flächen hingegen voneinander abgerückt, so relativiert sich Chevreul zufolge die Helligkeitsdifferenz.12 Ferner untersuchte der Chemiker die Kontrastphänomene ne-beneinander positionierter Farben13 (Abb. 3).Der Anstrich der Falkenberger Siedlung konfrontier-te den damaligen Betrachtenden mit einer mit den geschilderten Kontrasterscheinungen zusammenhän-genden Rezeptionsaufgabe, indem Taut beispielsweise für eine Reihenhausflucht abwechselnd schwarz und orangerot vorsah (Abb. 4). Fragt man nach der zeit-genössischen Betrachtereinstellung, d. h. nach der Grundhaltung, in welcher der damalige Rezipierende die schwarzen und orangeroten Fassaden im Idealfall
Behnes Rede vom “Schimmern”, “Leuchten” und “Bren-nen” der Farben verweist auf ein spezifisches Merkmal des Falkenberger Farbkonzepts. Sowohl die gezielte Ver-knüpfung, als auch die Korrelation bestimmter Farbtöne impliziert, dass es Taut bei der Planung auf die Kombi-nation bestimmter Farben ankam. Denn erst die Verbin-dung bestimmter Farbtönen vermag den Schilderungen Behnes entsprechende Farberlebnisse hervorzurufen.Bei der beschriebenen Steigerung der Farbintensität handelt es sich um Erscheinungen des damals ausführ-lich diskutierten Farbenkontrasts. Spätestens seit Mi-chel-Eugène Chevreuls richtungweisendem Buch De la loi du contraste simultane des couleurs von 1839 avan-cierte der Farbenkontrast nicht nur in der Malerei, son-dern auch in der Architektur und im Kunstgewerbe zu
einem Hauptkriterium der Aufstellung künstlerischer Farbkonzepte.7 Im Mittelpunkt standen dabei der Si-multankontrast, d. h. die wechselseitige Beeinflussung nebeneinander positionierter Farbflächen durch Evo-kation der jeweiligen Gegenfarben im Auge. Chevreul beschrieb entsprechende Kontrasterscheinungen wie folgt: “Wenn man zwei mit der gleichen Farbe un-gleich gefärbte Flächen, oder zwei mit verschiedenen Farben gleich stark gefärbte Flächen betrachtet, wel-che neben einander liegen, d. h. sich mit einem ihrer Säume berühren, so wird das Auge, wenn die Flächen nicht abzubreit sind, Veränderungen wahrnehmen, welche sich im ersten Falle auf die Intensität der Far-be und im andern auf die optische Zusammensetzung der beiden sich berührenden Farben beziehen”.8 Auf
Abb. 3: Michel-Eugène Chevreul, bildliches
Wahrnehmungsinstrument zur Erzeugung
des Simultankontrasts, (links) 1839/1847
und (rechts) 1859 (M.E. Chevreul,
The Laws of Contrast of Colour and their Application to the Arts, London 1859,
dritte Auflage). Abb. 4: Bruno Taut, Mehrfamilienhaus, Gartenvorstadt Falkenberg, zweiter Bauabschnitt, 1914 (Hartmann/Wissenschaftliches Bildarchiv für Architektur).
144
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
145
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
Formengefüges. Eine entsprechende Verschmelzung geometrischer Flächen mit Fassadenelementen war in der Architektur seit der Jahrhundertwende nicht un-gewöhnlich.21 Beispielsweise zeigte die 1904/05 nach Plänen von Peter Behrens in Oldenburg errichtete Kunsthalle im Mezzaningeschoss und an den seitli-chen Pavillons ein schwarzes, aus Rechtecken, Rauten, Trapezen und Dreiecken gebildetes Liniensystem, das sich mit den Türen, Fenstern und sonstigen Bestand-teilen des Aufrisses zu einem in sich geschlossenem Ganzen verband (Abb. 6). Auf die Voraussetzungen des auf der Fassade applizierten Musters machte Fritz Hoeber in seiner 1913 edierten Behrens-Monogra-phie aufmerksam. Nach Hoeber gründete sich dieses geometrische Gefüge auf ein sich aus diagonalen Li-nien konstituierendes Proportionssystem22 (Abb. 7).In der Forschung ist bekannt, dass sich Behrens spezi-ell mit den Proportionssystemen Hendrik Petrus Ber-lages beschäftigt hat.23 Berlages Anwendung geomet-rischer Schemen stieß auch bei anderen Architekten auf großes Interesse, wobei man dem sich aus Diago-nalen, Vertikalen und Horizontalen zusammensetzen-den Liniengefüge der von 1896 bis 1903 ausgeführten Börse in Amsterdam eine besondere Aufmerksamkeit schenkte24 (Abb. 8). Dass sich Taut mit den Proporti-onssystemen des holländischen Architekten auseinan-dergesetzt hat,25 ist durch das erhaltene Exemplar der Grundlagen und Entwicklung der Architektur Berlages seiner persönlichen Bibliothek belegt26 (Abb. 9-10). Das 1908 edierte Buch ist für Tauts Auseinanderset-zung mit den von Berlage diskutierten Proportions-
systemen sehr aufschlussreich. So findet sich in einer von Berlage abgebildeten Triangulatur eine Bleistift-skizze Tauts des 1913 auf der Leipziger Baufachaus-stellung errichteten Monuments des Eisens (Abb. 11). Die in lockeren Strichen ausgeführte Handzeichnung gibt den Baukörper mit den zwischen den einzelnen Stockwerken herrschenden Maßverhältnissen wie-der.27 Die Handskizze des Monuments des Eisens dokumentiert somit, dass die von Berlage behandel-ten Proportionssysteme in Tauts Entwurfspraxis eine gewisse Rolle spielten.28
Aus verschiedenen Marginalien geht ferner hervor, dass Taut die Ausführungen Berlages mit Interesse gelesen hat. Berlages Bemerkungen über das Proporti-onssystem der Amsterdamer Börse verdienen hier eine nähere Beachtung. Wie Taut in Berlages Publikation erfuhr, wurde das Börsengebäude “gänzlich nach dem ägyptischen Dreieck proportioniert”.29 In welcher Weise Berlage die geometrische Figur im Entwurf ver-wendete, konnte Taut folgenden Worten entnehmen: “Zur Herstellung der Zeichnungen für die Börse sind nun Dreiecke mit dem Verhältnisse von 5 : 8 benutzt worden; und da die Führungslinie nun von selbst vor der Hand lag, und die Stileinheit, wie wir gesehen ha-ben, die Durchführung desselben Grundsystems für alle Details wünschenswert macht, kommt man auch von selbst dazu, diese Führungslinie für alle Profile, so wie für die ornamentalen Kompositionen zu gebrau-chen”.30 Berlages Darlegungen gewährten Taut dem-nach die Einsicht, dass die ägyptischen Dreiecke der Amsterdamer Börse nicht nur zur Dimensionierung
Abb. 8: Hendrik Petrus Berlage, Entwurfsschema der Amsterdamer Börse,
1908 (H.P. Berlage, Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich, Berlin 1908).
Abb. 7: Fritz Hoeber, Proportionssystem der Oldenburger Kunsthalle, 1913
(F. Hoeber, Peter Behrens, München 1913).
Abb. 5: Bruno Taut, Mehrfamilienhaus, Gartenvorstadt Falkenberg, zweiter
Bauabschnitt, 1914 (Hartmann/Wissenschaftliches Bildarchiv für Architektur).
Abb. 6: Peter Behrens, Kunsthalle, Oldenburg, 1904/05 (K. Asche,
Peter Behrens und die Oldenburger Ausstellung 1905. Entwürfe Bauten Gebrauchsgraphik, Berlin 1992).
auffasste, so vermögen Chevreuls Ausführungen, die damals unter verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert wurden,14 detailliert Auskunft zu geben. Bei der für uns relevanten Verbindung von Schwarz/Rot bzw. Schwarz/Orange konstatierte Chevreul, dass Rot neben Schwarz den Eindruck einer höheren Sättigung evoziert, d. h. intensiver wirkt. Außerdem stellte er eine Modifikation der mit Schwarz verknüpften Farben fest. Chevreul zu-folge enthält Rot neben einer schwarzen Fläche weniger Braun. Orange tendiert hingegen laut Chevreul zu Gelb sowie zur Erzeugung von Glanzeffekten.15 Unter Be-rücksichtigung der kontemporären Rezeptionsgewohn-heiten kann also davon ausgegangen werden, dass der damalige Betrachtende für vergleichbare Kontraster-scheinungen sensibilisiert war. In diesen Kontext sind jedenfalls die oben erwähnten Äußerungen etwa über das “Leuchten” der “Türen und Fenster in hellem Rot” und mancher “Fensterkreuze in Weiß” des schwarzen Mehrfamilienhauses zu stellen.16 Die Beobachtung des “Schimmern”, “Leuchten” und “Brennen” der Falken-berger Fassadenfarben resultiert demnach aus den von Taut arrangierten Farbkombinationen.17
Tauts geometrische Fassadenmuster und die “ägyptischen Dreiecke” Berlages
Neben den monochromen Hausanstrichen wurden einige Fassaden des zweiten Bauabschnitts der Falken-berger Siedlung mit geometrischen Wandmalereien versehen, die sich aus diagonalen und orthogonalen Strukturen mit farbigen Dreiecken, Rauten, Quad-raten und Rechtecken zusammensetzen. Der Anony-mus erachtete diese abstrakt farbigen Gebilde als be-sondere Merkmale der Siedlung. So beschrieb er etwa die Dekorationen des schwarzen Mehrfamilienhauses als “unregelmäßiges Muster von Weiß und Rot”18 (Abb. 5). Die Flächenstruktur eines zweiten Hauses charakterisierte er als “quergestreiftes Wandmuster in Blau und Gelb”19 (Abb. 22). Beim schräg gegenüber errichteten Mehrfamilienhaus konstatierte er hinge-gen eine Wand “mit orangefarbenen und graugrünli-chen Rechtecken schachbrettartig bedeckt, wozu sich grüne Fensterläden gesellen”20 (Abb. 14).Bei der Betrachtung der Fassaden als Ganzes erwei-sen sich diese ornamentalen Figuren als Bestandteile eines sich über die gesamte Hauswand erstreckenden
146
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
147
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
des Baukörpers, sondern auch zur Situierung sämtli-cher Fassadenelemente dienten.Verschiedene Fassaden der Siedlung in Falkenberg weisen strukturelle Parallelen zu den von Berlage in den Grundlagen behandelten Proportionssystemen auf, wie beispielsweise die Fassade des Mehrfamilien-hauses mit dem farbigen Diagonalmuster (Abb. 12). Blickt man auf die sich aus halbierten, gelben und orangefarbenen Rauten zusammensetzende Wandma-lerei, so kristallisiert sich ein sich über die Tür, Fens-ter und alle übrigen Fassadenelemente ausbreitendes Lineament aus Diagonalen und Senkrechten heraus. Das diagonale Lineament ist mit Berlages Proporti-onssystem der Amsterdamer Börse vergleichbar (Abb. 13). Ein aus Diagonallinien bestehendes Gefüge zei-
gen auch die ornamentalen Applikationen des schwar-zen und orangefarbenen Mehrfamilienhauses (Abb. 5, 14). Vor dem Hintergrund Tauts Lektüre der Publi-kation Berlages und seiner Skizze des Monuments des Eisens in der dort abgebildeten Triangulatur scheint eine Adaption des Proportionssystems der Börse in den Falkenberger Aufrissen nicht unwahrscheinlich. Die Einbindung von Fassadenelementen in ein geo-metrisches Linienschema entsprach den damals ak-tuellen Entwurfspraktiken sowohl der älteren Archi-tekten Peter Behrens und des Lehrers Tauts Theodor Fischer als auch der jüngeren Generation Walter Gro-pius, Adolf Meyer und Le Corbusier.31
Proportionssystem und Ornament
Dass die geometrischen Muster der Fassaden der Fal-kenberger Siedlung Bezüge zum Proportionssystem Berlages besitzen, wird darüber hinaus durch einen weiteren Sachverhalt nahe gelegt. Berlage begrenzte nämlich die Anwendung der ägyptischen Dreiecke bei der Amsterdamer Börse nicht auf die architektonischen Bauglieder, sondern dehnte ihren Einsatz zusätzlich auf Ornamente und Wandmalereien aus. So äußerte er über die Extension des geometrischen Schemas, dass “alle Ornamente, ohne Ausnahme, nach diesem egypti-schen Dreiecksystem entworfen” wurden.32 Ein Beispiel für die Anwendung des Diagonalnetzes bei den Orna-menten des Börsenbaus findet sich an den Pfeilern des
Innenraumes, wo sich über der Basis und unterhalb des Kapitells je ein Rautenband befindet (Abb. 15).Der Kritik, dass die Einbindung jeglicher Gestal-tungselemente zu einer Beschränkung der künstleri-schen Freiheit führte, begegnete er mit dem Hinweis auf die Herstellung einer übergeordneten baukünst-lerischen Geschlossenheit: “man kann bei den heuti-gen Verhältnissen noch nicht alle Künstler für diese Ansichten gewinnen, indem die meisten sich noch für die “freie Kunst” erklären, und eine bestimmte Linienführung tatsächlich als ein Netz betrachten, in welches sie sich verwickeln würden. Sind denn aber nicht Malerei und Skulptur ebenfalls Verzierungen? Und soll diese Verzierung daher nicht ebenfalls stili-siert werden, und zwar nach denselben Gesetzen der
Abb. 9: Hendrik Petrus Berlage, Titelblatt, Exemplar der Bibliothek Bruno Tauts
(Bibliothek Bruno Taut, H.P. Berlage, Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich,
Berlin 1908, Bibliothek des Verfassers).
Abb. 10: Signatur Bruno Taut, persönliches Exemplar der Grundlagen und Entwicklung der Architektur, dat. 1910 (Bibliothek Bruno Taut, H.P. Berlage,
Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich, Berlin 1908, Bibliothek des Verfassers).
Abb. 11: Bruno Taut, Monument des Eisens,
1910-13, Handskizze, in: H.-P. Berlage, Grundlagen und Entwicklung der Architektur, 1908 (Bibliothek
Bruno Taut, H.P. Berlage, Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich, Berlin 1908,
Bibliothek des Verfassers).
Abb. 12: Bruno Taut, Diagonales Fassadenmuster,
Mehrfamilienhaus, Gartenvorstadt Falkenberg,
zweiter Bauabschnitt, 1914 (Hartmann/
Wissenschaftliches Bildarchiv für Architektur).
Abb. 13: Hendrik Petrus Berlage, Diagonalsystem
der Börse in Amsterdam, Ausschnitt, 1908
(H.P. Berlage, Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich, Berlin 1908).
148
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
149
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
sie beherrschenden Architektur?”33 Berlage erachtete Bauwerke, die einen umfassenden Gebrauch analoger Proportionssysteme vermissen lassen, als verfehlt. Im Verzicht auf die konsequente Übertragung geometri-scher Strukturen auf Ornamente und Wandmalereien gründete sich für ihn “eine der prinzipiellen Ursachen der heutigen, künstlerisch ungenügenden Resultate”.34 Die Schaffung einer “Einheit” durch Ausweitung des geometrischen Dreiecknetzes auch auf Dekorationen war für Berlage das entscheidende Merkmal damals aktueller Architektur.35
Berlages Verknüpfung der Proportionssysteme mit Ornamenten und Wandmalereien lässt nach den Vo-raussetzungen der Kolorierung der geometrischen Flä-chenmuster in der Falkenberger Siedlung fragen. Dass sich Taut bei der Auswahl der Farben nicht an der lo-
kalen Wandmalereitradition wie beispielsweise der seit der Renaissance bekannten Diamantquadermalerei anlehnte,36 geht Bemerkungen Behnes über die Farb-gebung der Siedlung hervor: “Meine Ausführungen wären unvollständig, wenn ich nicht mindestens kurz darauf hingewiesen hätte, mit welchem Takt Bruno Taut die Klippen vermieden hat, die den farbigen Häu-sern leicht drohen. Daß er nicht die Farbigkeit nord-deutscher oder süddeutscher Bauernhäuser nachge-ahmt hat und auch die Farbigkeit Alt-Nürnbergs oder einer biedermeierlichen Residenz, ist zwar ein gleich-sam unsichtbarer Wert, aber deshalb kein geringes Verdienst!”37 Eine Kontextualisierung der Falkenberger Ornamentik innerhalb der lokalen Wandmalereitradi-tion kommt demnach nicht in Betracht.
Berlage, Taut und das ägyptische Ornament
An dieser Stelle ist auf Berlages Bezeichnung des Pro-portionsschemas als “ägyptische Dreiecke” zurück zu kommen. Der in dem Namen enthaltene Ägypten-bezug eröffnet einen Bereich, der im Zusammenhang mit Tauts geometrischen Fassadenmustern eine nähere Beachtung verdient. Laut Berlage verweist der Name “ägyptisches Dreieck” auf die Ableitung der geometri-schen Figur vom “Pyramidenschnitt mit dem Verhält-nis von 8 Basislängen zu 5 Höhenlängen”.38 Entspre-chend dieser historischen Situierung, so resümierte er, wird das ägyptische Dreieck zufolge “einer ganzen “archäologischen Schule” sogar als “Schlüssel aller Ver-hältnisse, das Geheimnis aller wirklichen Baukunst” bezeichnet”.39
Angesichts der von Berlage erwähnten Bedeutung des ägyptischen Dreiecks erscheint es nicht überraschend, wenn sich auch Taut dem Thema “Ägypten” zuwand-te. Dass er sich tatsächlich mit dem nordafrikanischen Land beschäftigt hat, geht aus der 1919 edierten Stadt-krone hervor. Dort befindet sich eine Ansicht Kairos, die er, wie seiner Quellenangabe zu entnehmen ist, dem 1846 im Großfolio-Format erschienenen Band Egypte and Nubia von David Roberts entnahm.40 Bei der Abbildung handelt es sich um eine gezeichnete und in Grau- und Ockertönen lavierte Darstellung der Hauptstadt, die aus erhöhter Perspektive den Blick auf Häuser, Moscheen und Pyramiden frei-gibt. (Abb. 16) Taut dürften bei der Durchsicht der in außerordentlich hoher Druckqualität angefertigten Lithographien die zahlreichen Kairoer Hausfassaden
Abb. 16: David Roberts, Ansicht von Kairo, 1846 (D. Roberts, Egypt & Nubia, from drawings made on the spot by David Roberts, with historical descriptions
by George Croly, lithographed by Louis Haghe, London 1846).
Abb. 15: Hendrik Petrus Berlage, Pfeiler mit Ornamentik, Börse in Amsterdam,
1896-1903 (H.P. Berlage, Grundlagen und Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich, Berlin 1908).
Abb. 14: Bruno Taut, Dreieckmuster,
Mehrfamilienhaus, Gartenvorstadt Falkenberg,
zweiter Bauabschnitt, 1914 (Hartmann/
Wissenschaftliches Bildarchiv für Architektur).
150
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
151
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
mit orthogonalen Mustern in Orange und Blau kaum entgangen sein, wie z. B. der Turm mit dem orangeo-ckerfarbenen Viereckmuster (Abb. 17). Bemerkens-werter Weise findet sich eine ebenfalls orangeocker gefasste Rechteckstruktur an den Wandflächen zwei-er Mehrfamilienhäuser in Falkenberg (Abb. 18). Ob diese Fassadengestaltung aus Tauts Beschäftigung mit den Robertschen Lithographien resultiert oder aus ei-nem anderen Kontext stammte, bleibt dahin gestellt.Feststeht jedoch, dass der damalige Betrachtende das von Orangetönen dominierte Schachbrettmus-ter durchaus mit ägyptischen Ornamenten in Ver-bindung bringen konnte. So finden sich in Owen Jones’ bekanntem Werk Grammar of Ornament meh-rere Ägypten gewidmete Tafeln, die orangefarbene Rechteckstrukturen aufweisen (Abb. 19). Nach Jones
handelt es sich dabei um “Muster von Decken, die die Reproduktion von gewobenen Mustern zu sein scheinen”.41 Jones erkannte in diesem Typus des ägyp-tischen Ornaments nichts weniger als einen Ursprung des künstlerischen Schaffens schlechthin.42 Dass das Schachbrettmuster allgemein als ägyptisches Orna-ment angesehen wurde, zeigt mithin das von Gottfried Semper 1860 im Stil abgedruckte Orthogonalmuster in blauer und schwarzer Farbe43 (Abb. 20). Auch für ihn handelte es sich um ein Motiv “rein dekorativer Art”, das seinen Ursprung nicht im Symbol, sondern in der “Weberei und Stickerei” deutlich kundgibt.44
Kehren wir noch einmal zur Sammlung ägyptischer Ornamente von Owen Jones zurück. Verschafft man sich einen Überblick über die von ihm zusammen-gestellten Dekorationen, so lassen sich verschiedene
Muster auch mit dem oben bereits diskutierten Dia-gonalraster des Falkenberger Mehrfamilienhauses in Verbindung bringen (Abb. 12). Generell zeigen nach Jones die geometrischen Dekorationen der Ägypter eine schablonenhafte Struktur aus Dreiecken, Rauten oder Kreisen (Abb. 21). Der Eindruck des Schema-tischen, betont er ferner, wird zusätzlich durch die rhythmische Verteilung heller und dunkler Farbflä-chen erhöht. In der stetigen Wiederholung gleicher Figuren mit alternierenden Farbakzenten ist also ein Vergleichsmoment zwischen dem in Rede stehenden Tautschen Diagonalmuster und den Ornamenten Jo-nes’ zu erkennen.Darüber hinaus scheint die von Taut der gesamten Fassade verliehene Farbgebung in Gelb, Ocker, Oran-ge, Rot und Blau an Ägypten zu alludieren (Abb. 22). Für das kontemporäre Verständnis des ägyptischen Kolorits sind die Schilderungen von Owen Jones über die ägyptische Architektur aufschlussreich. Zufolge Jones waren Bauwerke des Wüstenlandes “durchge-
hends polychromatisch”.45 Jones erachtete die von den Ägyptern entwickelte umfassende Farbgebung sogar als vorbildlich: “sie bemalten alles; wir haben also in dieser Beziehung so manches von ihnen zu lernen”.46 Zu den vorherrschenden Farbtönen in der ägypti-schen Architektur, Malerei und Ornamente merkte er an: “Die am meisten von den Aegyptern gebrauchten Farben waren Roth, Blau und Gelb, nebst der gele-gentlichen Anwendung von Schwarz und Weiss um die verschiedenen Farben zu begrenzen und ihnen die nöthige Deutlichkeit zu verleihen”.47
Auch in der zeitgenössischen Farbenlehre fand das ägyptische Kolorit Beachtung. Wilhelm von Bezold etwa erblickte eine Eigenart des Ägyptischen im um-fangreichen Gebrauch von Gelb sowie in der Kom-bination desselben mit den anderen “reinen” Farben Blau, Rot und Grün.48 Als ein damals allgemein be-kanntes Exempel kann der ägyptische Hof im 1862 fertiggestellten Neuen Museum angesehen werden, der ein Kolorit in Gelb, Ocker, Orange, Rot und Blau
Abb. 17: David Roberts, Kairo, Straßenansicht, Ausschnitt, Turmfassade
mit Schachbrettmuster, 1846 (D. Roberts, Egypt & Nubia, from drawings made
on the spot by David Roberts, with historical descriptions by George Croly,
lithographed by Louis Haghe, London 1846).
Abb. 18: Bruno Taut, Orthogonalmuster, Mehrfamilienhaus, Gartenvorstadt
Falkenberg, zweiter Bauabschnitt, 1914 (Hartmann/Wissenschaftliches
Bildarchiv für Architektur).
Abb. 19: Owen Jones, Grammar of Ornament, Egyptian, Tf. IX, 1856/1868
(O. Jones, Grammatik der Ornamente. Illustriert mit Mustern von den verschiedenen Stylarten der Ornamente in Hundert und Zwölf Tafeln,
London 1868).
Abb. 20: Gottfried Semper, Ägyptisches Ornament, “Der Stil”, Tf. XI, Nr. 2, 1860
(G. Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, Frankfurt
a. M. 1860).
152
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
153
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
zeigte, das der Farbgebung des Falkenberger Mehrfa-milienhauses mit dem Diagonalmuster qualitativ und quantitativ überraschend nahe kommt49 (Abb. 23).
Das geometrische Ornament als erster Stil
Um 1910 besaßen die geometrischen Flächenmus-ter Ägyptens eine bemerkenswerte Aktualität.50 Diese gründete sich vor allem in einem über 50 Jahre wäh-renden Bedeutungswandel des in Rede stehenden Or-naments von der flächigen Zierform als Resultat rein praktischer Gesichtspunkte bis hin zur Betonung sub-jektiver, in der Betrachtung des jeweiligen Musters auf-tretender Wahrnehmungsmomente.51 Ausgangspunkt dieser Revision war die Mitte des 19. Jahrhunderts virulente Auffassung vom geometrischen ägyptischen Ornament als erster Kunststil überhaupt. Während man sich bei der Einstufung der geometrischen De-koration Ägyptens als ersten Stil einig war, herrschten divergierende Ansichten über die Entstehungsbedin-
gungen. Die Meinungsverschiedenheiten entzündeten sich an den von Gottfried Semper im Stil angeführten Voraussetzungen des geometrischen Flächenmusters. Semper äußerte die Meinung, dass das geometrische Ornament im Wesentlichen auf den Herstellungspro-zess, das zur Verfügung stehende Material und den Gebrauch zurückzuführen ist.52 Obgleich er darüber hinaus auch andere Kriterien – wie die symbolische Funktion des Ornaments – geltend machte,53 wurde Sempers Standpunkt in der Folgezeit häufig auf die drei genannten Kriterien reduziert.Alois Riegl vertrat in seinen 1893 edierten Stilfragen bekanntlich eine von Semper dezidiert abweichende Auffassung.54 Der Wiener Kunsthistoriker wandte sich jedoch nicht direkt gegen Semper,55 sondern vor allem gegen die später von verschiedenen Autoren vorgenom-mene Reduktion geometrischer Ornamente auf die Herstellung, das Material und den Gebrauch.56 Riegl opponierte im Wesentlichen gegen zwei Auffassungen, die nach seiner Meinung zu Unrecht den Status allge-mein gültiger Grundsätze besaßen. Beim ersten han-
delte es sich Riegl zufolge um die Annahme, dass der “geometrische Stil […] überall auf der Erdoberfläche spontan entstanden” ist.57 Dieser Standpunkt führte nach Riegl zur Aufstellung des zweiten Grundsatzes, die “einfachsten und wichtigsten Kunstmotive des geometrischen Stils” sind “durch die textilen Tech-niken der Flechterei und Weberei hervorgebracht” worden.58 Riegl monierte, dass das unvermittelte Auf-treten ähnlicher Dekorationen an unterschiedlichen Orten in den beiden genannten Grundsätzen nur mit Hilfe materialbezogener und praktischer Kriterien er-klärt wurde. Nach seinem Dafürhalten war Kunst je-doch nicht als bloße Form oder Wirkung des Materiel-len anzusehen. Vielmehr muss für ihn auch die geistige Konstitution des Menschen berücksichtigt werden.59 Die Auffassung von der “spontanen”, nur von techni-schen Bedingungen abhängigen Entstehung des geo-metrischen Stils stellte Riegl in Zweifel, indem er die historische Verbreitung geometrischer Ornamente in den Ländern des östlichen Mittelmeerraums unter-suchte und die formale Beeinflussung regelmäßiger
Flächenmuster in den fraglichen Gebieten belegte. Am Beispiel Ägyptens machte er deutlich, dass die geome-trischen Ornamente in bestimmten Regionen durch Übernahme bereits vorhandener Ziermuster entstan-den waren.60 Um das Potential des menschlichen Geis-tes mit in die Diskussion einzubeziehen, wies er auf die Bedeutung “psychischer Vorgänge” bei der Entstehung des geometrischen Ornaments hin.61 Riegl erachtete die Einbeziehung psychologischer Komponenten als notwendig, da nach seinem Verständnis die “Kunst als augenscheinlich höhere Potenz einer geistigen Ent-wicklung” von Anfang an bei der Entstehung des geo-metrischen Stils virulent gewesen sein muss. Auf diese Weise wandte er sich gegen die Auffassung, dass sich das geometrische Ornament als Kunst “erst mit stei-gender Entwicklung der Kultur […] entfaltet hätte”.62 Bei der Diskussion um das Auftreten des ägyptischen geometrischen Ornaments als ersten Stil ging es dem-nach um nichts weniger, als die Frage nach dem Ur-sprung der Kunst schlechthin.
Abb. 23: August Stüler, Ägyptischer Hof im Neuen Museum in Berlin, 1855, Aquarell von Eduard Gaertner, 1862 (O. Zorn, Der mythologische Saal, in E. Blauert,
Staatliche Museen zu Berlin (Hgg.), Neues Museum. Architektur Sammlung Geschichte, Berlin 2009, S. 120).
Abb. 21: Owen Jones, Grammar of Ornament, Egyptian, Tafel XI,
Nr. 19, 1856/1868 (O. Jones, Grammatik der Ornamente. Illustriert mit Mustern von den verschiedenen Stylarten der Ornamente in hundert und zwölf Tafeln, London 1868).
Abb. 22: Bruno Taut, Mehrfamilienhaus,
Gartenvorstadt Falkenberg, zweiter Bauabschnitt,
1914 (Hartmann/Wissenschaftliches Bildarchiv
für Architektur).
154
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
155
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
Einfühlung und Genuss. Tauts Ausdruck der “Farbenfreude”
1908 schaltete sich Wilhelm Worringer mit seiner Pu-blikation Abstraktion und Einfühlung in die Diskussi-on ein.63 Worringer stimmte der von beiden Parteien vertretenden Auffassung zu, dass “der geometrische Stil am Anfang aller Ornamentik” stand und sich “die an-dern ornamentalen Gebilde erst langsam aus ihm ent-wickelten”.64 Was die Voraussetzungen geometrischer Ornamente Ägyptens angeht, folgte er der Rieglschen Auffassung und baute das Erklärungsmodell des Wie-ner Kunsthistorikers im Hinblick auf die Rolle des geis-tigen Leistungsvermögens des Menschen aus. So waren auch nach seinem Verständnis hauptsächlich psycho-logische Gesichtspunkte für das Auftreten des ägypti-schen geometrischen Ornaments verantwortlich. Nicht äußere, materialbezogene Faktoren, sondern ein inne-res “Bildungsgesetz” wurde nach Worringer vom Sub-jekt in die Kunst überführt.65 Welche Spielarten diese Gesetzmäßigkeit aufweisen konnte, machte er anhand eines Vergleichs klar. Ebenso wie der geometrische Stil zwar das “Bildungsgesetz der leblosen Materie”, aber nicht die Substanzen selbst in ihrer äußeren Erschei-nung wiedergibt, repräsentiert laut Worringer das vege-tabile Ornamenten ursprünglich weniger die Pflanze, als die “Gesetzmässigkeit ihrer äusseren Bildung”.66 Beide Ornamentstile sind für ihn folglich ohne Natur-vorbild, obgleich ihre Elemente in der Natur existieren. So zeichnet sich Worringer zufolge der geometrische Stil dadurch aus, dass er die “anorganisch-kristallische Gesetzmässigkeit als künstlerisches Motiv” verwendet. Im vegetabilen Stil artikuliert sich hingegen laut Wor-ringer eine organische Gesetzmässigkeit, die sich “am reinsten und anschaulichsten in der Pflanzenbildung” zeigt.67 Für Worringer entstand das Ornament dem-nach aufgrund einer nachträglichen Naturalisierung und nicht, wie Mitte des 19. Jahrhunderts postuliert, einer im Nachhinein vorgenommenen Stilisierung. In dieser Antithese ruhte Worringer zufolge der springen-de Punkt der von geistigen Parametern ausgehenden Herleitung des geometrischen Stils: nicht das “Natur-vorbild”, sondern das vom Menschen “abstrahierte Ge-setz” war für ihn das Wesentliche.68
Der oben erwähnte psychologische Faktor war Wor-
ringer zufolge insofern relevant, als die “organische Struktur” seines Erachtens allein mit Hilfe der Einfüh-lung ermittelt werden konnte. Das Einfühlen zeichnete sich laut Worringer durch ein subjektives “ästhetisches Erleben” aus, das nach seiner Auffassung den Charak-ter eines “aesthetischen Genusses”, bzw. “objektiven Selbstgenusses” besaß.69 Genuss ästhetischer Prägung bedeutete für ihn demnach ein Einfühlen in das Ob-jekt. Ausschlaggebend für die Evokation entsprechen-der Gefühle war von seiner Warte aus nicht das in der Ästhetik des 18. und frühen 19. Jahrhunderts aktuelle Kriterium der Lust und Unlust, sondern eine spezifi-sche “innere Bewegung, das innere Leben, die innere Selbstbetätigung”.70 Im Zentrum stand also für ihn die Unmittelbarkeit des Erlebnisses. Bei der Ausfor-mulierung dieses Standpunkts rekurrierte er auf der von Theodor Lipps in den 1880er und 1890er Jahren entwickelten Einfühlungstheorie.71 Was in ein künst-lerisches Objekt eingefühlt wird, war nach Lipps ganz allgemein das Leben selbst. Das Leben wiederum war für ihn Kraft, inneres Arbeiten, Streben und Vollbrin-gen bzw. “Tätigkeit”. Vor allem in letzterer manifestiert sich Lipps zufolge ein vom Willen freigesetzter “Kraft-aufwand”, der als “Streben in Bewegung” verstanden werden kann.72
Für die in unserem Zusammenhang relevante, damals als “ägyptisch” aufgefasste Ornamentik bedeutet die von Riegl und Worringer herbeigeführte psycholo-gische Wende, dass der zeitgenössische Betrachtende grundsätzlich auf die sinnliche Betrachtung bzw. das vitale Erleben von Flächendekorationen eingestellt war. Dass man im Tautschen Umfeld mit der Diskussion über psychologische Gesichtspunkte der Ornamentik vertraut gewesen ist, legt u. a. ein von Walter Gropius um 1910 verfasstes Manuskript mit dem Titel Über das Wesen des verschiedenen Kunstwollens im Orient und im Occident nahe, in welchem der spätere Bauhausdi-rektor Riegls kunsttheoretische Auffassung ausführlich diskutierte.73 Die in dieser Zeit vielfach artikulierte Vorrangstellung des psychologischen Moments der Kunstentstehung gegenüber der zweckgebundenen Auffassung und die damit einhergehende Aufwertung des subjektiven Erlebnispotentials dürfte auch Taut nicht verborgen geblieben sein. Dass der Aspekt des leiblich gespürten und zugleich Kraft spendenden Er-
lebnisses für ihn in der Tat ein elementarer Gesichts-punkt der Anwendung der Farbe in der Architektur war, geht aus seinen Schriften hervor. Farbe, so äußerte er etwa im Aufruf für farbiges Bauen, war für ihn nichts anderes als “optische Sinnenfreude”.74 Welchen Stellen-wert sie nach seiner Auffassung als eine das innere Le-ben aktivierende Energie besaß, spiegelt sich ferner in der von ihm formulierten Forderung nach mehr “Mut zur Farbenfreude” wider.75 In der Stadtkrone betonte er einen ähnlichen Aspekt. Eine Befreiung lebensfro-her, im Menschen virulenter Kräfte, so schrieb er dort, ist gewährleistet, wenn das in der Architektur vorherr-schende “tote Grau-in-Grau” von der Skala der reinen ungebrochenen Farben abgelöst wird.76
Das von ihm favorisierte vitale Potential der Farbe im-pliziert ein Anliegen, das unmittelbar in seinen archi-tektonischen Farbkonzepten zum Ausdruck kommt. War doch die Farbe für ihn “neben der Form wesent-lichstes Kunstmittel im Bauen”.77 Folgerichtig fungier-te sie in seinen Gestaltungsprogrammen als ein gezielt angewendetes, visuelle Erlebnisse evozierendes Ele-ment. Taut selbst hat auf einige Einsatzmöglichkeiten der Farbe hingewiesen. Aus Platzgründen sei allein je-ner Aspekt seines Farbgebrauchs angesprochen, der eng mit dem oben behandelten Erlebnispotential zusam-menhängt. Ihm zufolge besitzt die Farbe aufgrund “ih-rer besonderen optischen Eigenschaften die Fähigkeit, eine Wandfläche dem Auge sehr angenehm oder auch im Gegenteil sehr abstoßend” erscheinen zu lassen. Verantwortlich dafür ist nach Taut die ihr eigene “Akti-vität oder Passivität”.78 Die aktive Eigenschaft umfasst für ihn die Fähigkeit der Farbe das Auge zu “beunru-higen, blenden usw”.79 Passivität artikulierte sich Taut zufolge hingegen in der dem Auge vermittelten “Ruhe und Erholung”.80 Taut betrachtete also die Animation der Sinne als Haupteigenschaft der Farbe.In Verbindung mit dem von Taut hervorgehobenen Aspekt der durch die Farbe evozierten “Sinnenfreude” ist nun auf die eingangs behandelten Spielarten des Farbenkontrasts zurückzukommen. Der oben bereits diskutierte Verweis auf das “Schimmern”, “Leuchten” und “Brennen” der Falkenberger Fassadenfarben81 lässt sich als Manifestation der für Taut so wesentlichen lebenspendenden Eigenschaften der Farbe begreifen. Sowohl die monochrom aneinander angrenzenden
Wandflächen der Einfamilienhäuser, als auch die geo-metrischen Ornamente der Mehrfamilienhäuser bilden ein Garant für die von Taut geforderte Animation des Visus. Beide Arten der farbigen Wandbehandlung er-füllen Tauts Anliegen jedoch in unterschiedlicher Wei-se. Die unvermittelte Gegenüberstellung monochro-mer heller und dunkler Wandflächen sorgt für eine Intensitätssteigerung der jeweiligen Farbe (Abb. 4). Auf diese Weise wird der Rezipierende unwillkürlich von der Leuchtkraft der Farben als Folge des Komplemen-tärkontrasts eingenommen. Eine vollkommen andere Wirkung entfalten die geometrischen Flächendekora-tionen. Das orangeockerfarbene Diagonalmuster etwa involviert den Blick auf verschiedenen Ebenen. (Abb. 22) Allein die kleinteilige Rautenstruktur vermag die Augen anzuziehen. Ruht der Blick auf den geometri-schen Figuren können die in Orange und Ocker alter-nierenden Farben illusionistische Raumwahrnehmun-gen durch Hervorspringen der helleren Rautenhälften und Zurückweichen der dunkleren erzeugen. Der Betrachtende modifiziert seinen Sehmodus, wenn er die Augen an den Diagonallinien entlang gleiten lässt. Vergleichbare Erscheinungen hatte bereits Owen Jones bei Anblick von Ornamenten beschrieben.82 Der zeit-genössische Betrachtende war somit auf entsprechende Seherfahrungen eingestellt.Analog zur damaligen Diskussion um das geometrische Ornament als ersten Stil können Tauts Wanddekora-tionen programmatisch als Folien für die Rückfüh-rung der Wahrnehmung auf ein ursprüngliches Erle-ben der Farbe aufgefasst werden. Das in der formalen Struktur und im Kolorit an das ägyptische Ornament erinnernde Muster bürgte buchstäblich für diese Un-mittelbarkeit der Farbenwahrnehmung. Im Tautschen Verständnis sind somit die Steigerung der Farbinten-sität, das Vor- und Zurücktreten farbiger Flächen und die Evokation gleißend leuchtender Glanzeffekte keine beiläufigen Erscheinungen. Vielmehr manifestiert sich in diesen Phänomenen die von Taut stets im umfassen-den Sinn geforderte “Farbenfreude”.83
156
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
157
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
Anmerkungen
1. Zur Farbgebung der Siedlung Am Falkenberg: K. Junghanns, Bruno Taut 1880-1838, zweite Auflage, Elefanten Press, Berlin 1983, S. 24-25; F. Bollerey, K. Hartmann, Bruno Taut. Vom phantastischen Ästheten zum ästhetischen Sozial(ideal)isten, in Bruno Taut 1880-1938, Ausst.-Kat., Akademie der Künste, Berlin 1980, S. 15-85, 54-55; M. Speidel, Natur und Fantasie 1880-1938, Ausst.-Kat., Ernst & Sohn, Magdeburg Berlin, 1995, S. 117-124; W. Brenne, Wohnbauten von Bruno Taut. Er-haltung und Wiederherstellung farbiger Architektur, in W. Ner-dinger, K. Hartmann, M. Schirren, M. Speidel (Hgg.), Bruno Taut 1880-1938. Architekt zwischen Tradition und Avantgarde, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart München 2001, S. 275-289, hier S. 280-283; W. Brenne, J. Tomisch, U. Borgert, A. Celâsun, Werkkatalog, in W. Brenne (Hg.), Bruno Taut. Meister des farbigen Bauens in Berlin, S. 56-61; Siedlungen der Berliner Moderne. Eintragung in die Welterbeliste der UNESCO, Landes-denkmalamt Berlin im Auftrag der Senatsverwaltung für Stad-tentwicklung Berlin (Hg.), Projektleitung W. Brenne, Braun, Berlin 2009, zweite Auflage, S. 127-129.
2. A. Behne, Die Bedeutung der Farbe in Falkenberg, in “Garten-stadt”, 7, 1913, Dez., H. 12, S. 249-250, zit. n. Bollerey, Hart-mann 1980 (wie Anm. 1), S. 54-55.
3. Anonym, Kolonie Tuschkasten, in “Berliner Tageblatt”, Nr. 349, 1915, zit. n. Bollerey, Hartmann 1980 (wie Anm. 1), S. 54-55.
4. Ibid.5. Ibid.6. Ibid.7. Die Schrift Chevreuls gehört zu den einflussreichsten Far-
benlehren des 19. Jahrhunderts. Bereits 1840 erschien eine Übersetzung ins Deutsche, der 1847 eine zweite Auflage folg-te. (M.E. Chevreul, Die Farbenharmonie in ihrer Anwendung bei der Malerei, bei der Fabrication von farbigen Waaren jeder Art […], Stuttgart 1847). 1878 publizierte Friedrich Jännicke eine vollständig überarbeitete Fassung, der 1902 eine weitere Edition folgte (F. Jännicke, Die Farbenharmonie mit besonderer Rücksicht auf den gleichzeitigen Contrast in ihrer Anwendung in der Malerei in der decorativen Kunst bei der Ausschmückung der Wohnräume sowie in Kostüm & Toilette. Zugleich als zwei-te, gänzlich umgearbeitete Auflage der Farbenharmonie von E. Chevreul, Stuttgart 1878). Jännicke redigierte Chevreuls Text jedoch so grundsätzlich, dass von einer eigenständigen Schrift gesprochen werden muss. Zur Rezeption der Farbenlehre Che-vreuls im Gebiet der Architektur: R. Rehm, “Man unterscheide zweierlei Farbenkontraste, den instantanen und den nachwir-kenden.” Zum Kontext einiger farbtheoretischer Bemerkungen Gottfried Sempers im Stil von 1860, in “Sudhoffs Archiv für Wissenschaftsgeschichte”, 94, 2010, H. 2, S. 157-177.
8. Chevreul 1847 (wie Anm. 7), S. 7.9. Ibid., S. 197-245.10. Vgl. die Rezeption Chevreuls in den kontemporären farbtheore-
tischen Publikationen: G. Schreiber, Das technische Zeichnen. Für Architekten, Maler, Techniker, Bau- und polytechnische, höhere Ge-werbe- und Realschulen, 3. Theil, Die Farbenlehre, Leipzig 1869, S. 12, 102, 120; W. von Bezold, Die Farbenlehre im Hinblick auf Kunst und Kunstgewerbe, Braunschweig 1874, S. VIII-IX; O. N. Rood, Die moderne Farbenlehre mit Hinweisung auf ihre Benut-zungen in Malerei und Kunstgewerbe, Leipzig 1880, S. 255.
11. Rood 1880 (wie Anm. 10), S. 247-257; E. Berger, Handbuch der Farbenlehre, Leipzig 1909, S. 63-68.
12. Chevreul 1847 (wie Anm. 7), S. 7-12.13. Ibid., S. 14-21.14. Zur Chevreul Rezeption um 1900: Berger 1909 (wie Anm.
11), S. 67, 77.15. Ibid., S. 25.16. Anonym 1915 (wie Anm. 3), S. 249. Dass man in Tauts Um-
feld die Erscheinung des Simultankontrasts kannte, ist nicht zu bezweifeln. Beispielsweise schilderte Behne in seinem 1925 edierten Buch Von Kunst zur Gestaltung, in welcher Weise eine Farbe durch Kombination mit einer anderen in ihrer Wirkungsweise beeinflusst werden kann, wobei er explizit den Begriff des Kontrasts verwendet: “Weiterhin besteht die Möglichkeit, dem Grün einen stärkeren Gegenspieler (Kont-rast) entgegenzusetzen, etwa durch Verstärkung eines im Bilde vorhandenen Rot, sei es in der Größe, sei es in der Intensität oder in der Helligkeit. Es kann aber richtig sein, dass Grün zu dämpfen durch Verminderung der im Bilde vielleicht vorhan-denen Flächen Blau und Gelb, die als die Elemente des Grün natürlich dieses verstärken, auch dort, wo sie getrennt auftre-ten”. A. Behne, Von Kunst zur Gestaltung. Einführung in die moderne Malerei, Arbeiterjugend-Verlag, Berlin 1925, S. 27.
17. Anonym 1915 (wie Anm. 3).18. Ibid.19. Ibid.20. Ibid.21. Als Beispiel ornamental dekorierter Aufrisse kann auf August
Endells Fassaden des ersten Hackeschen Hofes in Berlin von 1906/07 verwiesen werden. Zu August Endells Gestaltung des ersten Hackeschen Hofes: M. Schirren, Bewegter Raum – August Endell Lehre und die Gestaltung der Hackeschen Höfe, in Gesellschaft Hackesche Höfe (Hg.), Die Hackeschen Höfe. Geschichte und Geschichten einer Lebenswelt in der Mitte Berlins, Argon, Berlin 1993, S. 23-33; R. Rehm, “Formgebilde, die ein starkes Gefühl erregen”. August Endells geometrische Ornamentik und die Raumästhetik Theodor Lipps, in N. Bröcker, G. Moel-ler, C. Salge (Hgg.), August Endell 1871-1925. Architekt und Formkünstler, Petersberg 2012, S. 76-89.
22. F. Hoeber, Peter Behrens (= Moderne Architekten, Bd. 1), Mül-ler & Rentsch, München 1913, S. 35, vgl. auch Abbildung in: G. A. Platz, Baukunst der neuesten Zeit (= Propyläen Kunstge-schichte), Propyläen Verlag, Berlin 1927, S. 146; zu den Ol-denburger Ausstellungsbauten: K. Asche, Peter Behrens und die Oldenburger Ausstellung 1905. Entwürfe, Bauten, Gebrauchsgra-phik, Mann, Berlin 1992, S. 35-47.
23. Zum Einsatz entsprechender Proportionssysteme bei Peter Behrens: F. Neumeyer, Zwischen Monumentalität und Moder-ne – Architekturgeschichte eines Wohnhauses, in F. Neumeyer, W. Höpfner (Hgg.), Das Haus Wiegand von Peter Behrens in Berlin-Dahlem. Baugeschichte und Kunstgegenstände eines herr-schaftlichen Wohnhauses, Zabern, Mainz 1979, S. 17-19.
24. Vgl. J. C. Slebos, Grondslagen voor Aesthetiek en Stijl. Archi-tectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid / Fundamentals of ae-sthetics and style. Architecture, the plastic arts, arts and crafts, Ahrend, Amsterdam 1939, S. 37-39. Ich danke Mariël Polman für den Literaturhinweis.
25. Zur Bedeutung Berlages für Bruno Taut: Junghanns 1980 (wie Anm. 1), S. 15-16, 30; Bollerey, Hartmann 1980 (wie Anm. 1), S. 29.
26. H. P. Berlage, Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich, Bard, Berlin 1908, S. 64, persönliches Exemplar von Bruno Taut, Bibliothek des Verfassers. Das Buch trägt auf der Rückseite des Vorsatzpapiers die in Bleistift ausgeführte Signatur “Bruno Taut” mit dem Datum “4.V.10”. Darunter befindet sich der Zusatz “v. Hans Kaiser”. Offenbar erhielt Taut 1910 die Pub-likation von Hans Kaiser, der die Schwägerin des Architekten geheiratet hatte. Zu Hans Kaiser: E. Steneberg, Arbeitsrat für Kunst. Berlin 1918-1921, Düsseldorf 1987, S. 101.
27. Berlage 1908 (wie Anm. 26), S. 29; zur Handskizze Bruno Tauts in seinem ehemaligen Berlage-Exemplar in: R. Rehm, Das Bau-hausgebäude in Dessau. Die ästhetischen Kategorien Zweck Form Inhalt, Gebr. Mann Verlag, Berlin 2005, S. 163-164.
28. Dass Taut das Proportionssystem Berlages sehr schätzte, geht aus einer Bemerkung im 1929 erschienenen Buch Neue Bau-kunst hervor: “So hat Berlage die Theorie des Netzes durch Lehre und Praxis geschaffen und bestätigt, das wie ein dreidi-mensionales Flechtwerk abstrakter, also nur gedachter Natur Grundrisse und Aufrisse des Baues durchzieht und in das alle Grundrisslinien und Ecken ebenso wie diejenigen des Aufris-ses, also der Gesimse, Fenster usw., wie eingespannt hinein-passen” B. Taut, Die Neue Baukunst in Europa und Amerika, Hoffmann, Stuttgart 1929, S. 39.
29. Berlage 1908 (wie Anm. 26), S. 60-61.30. Ibid., S. 61-62.31. W. Nerdinger, Theodor Fischer. Architekt und Städtebauer,
Berlin 1988, S. 96-102. Zur Anwendung eines Proportions-systems aus Diagonalparallelen bei Walter Gropius und Adolf Meyer: A. Jaeggi, Adolf Meyer. Der zweite Mann. Ein Archi-tekt im Schatten von Walter Gropius, Berlin 1994, S. 77; Rehm 2005 (wie Anm. 27), S. 89-93; bei Le Corbusier: F. Passanti, Architecture, Proportion, Classicism, and other Issues, in S. von Moos, A. Ruegg (Hgg.), Le Corbusier before Le Corbusier. Ap-plied Arts Architecture, Painting, Photography 1907-1922, Aus-st.-Kat. Baden u. New York, New Haven London 2002, S. 69-97, hier S. 70-81.
32. Berlage 1908 (wie Anm. 26), S. 62.33. Ibid., S. 63.34. Ibid.35. Zum Einsatz der Farbe in der holländischen Architektur der
Klassischen Moderne: M. Polman, “De kleuren van het nieuwe bouwen tijdens het interbellum in Nederland. Materialisering van een ideaal”, Dissertatie, TU Delft, 2011.
36. Vgl. entsprechende Beispiele von traditionellen Wandmalerei-en: M. Hering-Mitgau, Farbige Fassaden. Die historische Putz-fassung, Steinfarbigkeit und Architekturbemalung in der Schweiz, Frauenfeld Stuttgart Wien 2010, S. 249-285.
37. Behne 1913 (wie Anm. 2).38. Berlage 1908 (wie Anm. 26), S. 20.39. Ibid.40. D. Roberts, Egypt & Nubia, from drawings made on the spot
by David Roberts, with historical descriptions by the Geor-ge Croly, lithographed by Louis Haghe, London 1846. Die Robertsche Lithographie zeigt, dass die Reproduktion in der Stadtkrone wohl aufgrund der unmittelbaren Nachkriegssitu-ation eine erhebliche Einschränkung der drucktechnischen Qualität hinnehmen musste. So sind die im Original sich deutlich vom Horizont absetzenden Pyramiden in Tauts Pu-blikation kaum zu erkennen. Taut bildet neben der Kairoer
Vedute noch eine Ansicht von Hebron ab. Zur Herkunft der Abbildung heißt es in seinem äußerst knapp gehaltenen Abbil-dungsnachweis: “Abb. 24 und 25 nach David Roberts, Egypte and Nubia und Holy-Land”. Vgl. B. Taut, Die Stadtkrone. Mit Beiträgen von Paul Scheerbart, Erich Baron, Adolf Behne, Jena 1919, S. 140.
41. J. Owen, Grammatik der Ornamente. Illustriert mit Mustern von den verschiedenen Stylarten der Ornamente in hundert und zwölf Tafeln, London 1868, dritte Auflage, S. 24, erste Auflage London 1856.
42. Ibid., S. 24.43. G. Semper, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten
oder praktische Aesthetik. Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde, Bd. 1, Die Textile Kunst für sich betrachtet und in Beziehung zur Baukunst, Frankfurt a. M. 1860, S. 405-426.
44. Ibid., S. 415. Doch existierte das schachbrettartige Muster nach Semper – wie in den von David Roberts geschaffenen Ansichten Kairos – auch in der frühesten ägyptischen Bau-kunst als eine von der Verkleidung vormaliger Holzarchitek-tur abgeleitete Zierform, die über Türen angebracht worden war, wie beispielsweise in seiner Rekonstruktion des “Portales aus dem alten Reiche”. Für ihn artikulierte sich in diesem “äl-testen Façadenschmuck Chaldäas […] unwiderleglich dessen Verwandtschaft mit dieser merkwürdigen Holzbekleidungsar-chitektur, ausgeführt in stucküberzogenem Steine.” (Ibid., S. 413) Sempers Verknüpfung kleinteiliger Dekorationen in Ein-gangsbereichen der ägyptischen Architektur liefert uns einen weiteren Hinweis auf einen möglichen Kontext der Fassade mit dem Diagonalmuster des Mehrfamilienhauses in Falken-berg. Zur Vergegenwärtigung dieses Zusammenhangs ist Sem-pers Auffassung von der Entstehung der ägyptischen Fassade als Resultat einer “Holzbekleidungsnachahmung in Stucco” sehr aufschlussreich. Laut Semper ist die ägyptische Gebäu-defront aus der Adaption eines ehemals hölzernen “Füllungs-werks” hervorgegangen, das im Eingangsbereich das Stützen-system sowie die Freiflächen zwischen der Tür und etwaigen Fenstern kaschierte. Dementsprechend sind auch die auf der Semperschen Darstellung wiedergegebenen senkrechten und waagerechten Wandstreifen zu verstehen, die den Eingang, das Schachbrettmuster und die fensterartigen Maueröffnun-gen umgeben. Die Fassadenelemente und Wandmalereien des Falkenberger Mehrfamilienhauses sind einem strukturell ähnlichen Wandgefüge aus schwarzen Linien, schmalen oran-gen Farbstreifen, dem kleinteiligen ornamentalen Rautennetz sowie den blaugrünen senkrechten und waagerechten Wand-flächen eingebettet.
45. Jones 1868 (wie Anm. 41), S. 25.46. Ibid.47. Ibid.48. Wilhelm von Bezold merkte an: “Die Farbengebung mancher
altägyptischer Ornamente scheint freilich noch etwas von dem Wunsche nach möglichst buntem Wechsel beherrscht. Aber die Zahl der Farben bleibt doch immerhin eine so geringe, der Charakter einer jeden ein so entschieden ausgesprochener, daß die Gefahr geschmackloser Zusammenstellungen bei wei-tem nicht so nahe liegt, als bei Anwendung von blassen oder Halbtönen. […] Die benutzen Farben sind die entschiedenen satten, ganzen Farben, Rot, Blau, Grün und Gelb.” Dabei war nach Bezold die ägyptische ornamentale Malerei die einzige,
158
SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
159
LA CONSERVAZIONE DELLE POLICROMIE NELL’ARCHITETTURA DEL XX SECOLO / CONSERVATION OF COLOUR IN 20TH CENTURY ARCHITECTURE
GEOMETRISCHES ORNAMENT UND ERSTER STIL. BRUNO TAUTS FARBIGE FASSADENGESTALTUNGEN DER SIEDLUNG FALKENBERGROBIN REHM
wenn man für ziemlich breite schwarze Umränderung sorgt. Führt man ein Muster in zwei Schattierungen desselben Tones aus, etwa dunkelrot und hellrot oder dunkelblau und hellblau oder grau und schwarz, so scheinen die helleren Partien her-vorzutreten”, W. von Bezold, Die Farbenlehre im Hinblick auf Kunst und Kunstgewerbe, zweite Auflage, vollständig überarbei-tet und ergänzt von W. Seitz, Braunschweig 1921, S. 156, erste Auflage Braunschweig 1874.
83. Taut 1921 (wie Anm. 74), S. 28.
Biography
In 1992-1997 studies of art history, classical archeol-ogy and theory of drama, FU Berlin; Jul 1997 Magister Artium in art history; Feb 2001 Doctorate, Institute of Art History, FU Berlin, subject: “The Bauhausbuilding in Dessau. The aesthetical categories function – shape – contents”; Sep 2000 – Aug 2001 scholarship at the Centre Allemand d’Histoire l’Art in Paris; Oct 2001 – Aug 2005 assistant at the Institute of Art History, University Zürich; from Sept. 2005 – Aug. 2008 ha-bilitation scholarship of the University Zürich; since Apr 2009 Research Assistant at the Institute for His-toric Building Research and Conservation (IDB) ETH Zürich; Dec 2011 Habilitation, Kunsthistorisches Seminar, University Basel, subject: “The world of the eye. Art and science in 1790-1930”.
Colour and contrast. Bruno Taut’s ornamental facade design of the garden city Falkenberg
In 1913/14 Bruno Taut developed for the Gartenvor-stadt Falkenberg in Berlin-Grünau a remarkable facade design. He created a special concept, in which the wall surfaces, doors and shutters are painted with geometri-cal patterns in contrasting colours, so that the single architectural elements melted to a unit with the color-ful ornamental surfaces. The facade design holds crea-tion principles, which are typical for the contemporary modern architecture.The background of Taut’s ornamental patterns is ex-amined in two aspects. On one hand, the relations to comparable facade designs of the architecture between 1900 and 1910. In the centre are standing buildings of Viennese and Berlin architects. Tauts wall creations are to be compared to similiar orthogonal facade structures as, for example, of Otto Wagner and August Endell. For a better understanding, statements of the contem-porary architects about the orthogonal patterns are to be examined with a view to the former comprehension. On the other hand, the relevance of similar contrast patterns in the contemporary chromatics. In the cen-tre stands Owen Jones’ illustrated book Grammar of Ornament (1856), which attracted a big interest in the chromatics of the second half of the 19th century. Jones’ creation principles and ornaments have been discussed in colour-theoretical publications as, for example by Ernst Brücke (1866), Wilhelm von Bezold (1874) and Ernst Berger (1898). Finally, a possible interpretation of Bruno Taut’s ornamental designs facades in the gar-den city Falkenberg is given.The paper delivers a contribution to the abstraction processes in the facade design of the architecture of the early 20th century.
welche dem Gelben keine untergeordnete Ausnahmestellung anweist, “sondern dasselbe genau ebenso wie die anderen Far-ben verwendet” von Bezold 1874 (wie Anm. 10), S. 248-249.
49. Zum Ägyptischen Hof: E. Börsch-Supan, Friedrich August Stü-ler 1800-1865, München Berlin 1987, S. 73, 907, 909; O. Zorn, Der mythologische Saal, in E. Blauert u. Staatliche Mu-seen zu Berlin (Hgg.), Neues Museum. Architektur Sammlung Geschichte, Berlin 2009, S. 115-121.
50. Vgl. kontemporäre Publikationen zur ägyptischen Ornamen-tik und Architektur: L. Borchardt, Die aegyptische Pflanzen-säule. Ein Kapitel zur Geschichte des Pflanzenornaments, Berlin 1897; W. Worringer, Ägyptische Kunst. Probleme ihrer Wertung, München 1927.
51. Zu den theoretischen Voraussetzungen der Architektur Bruno Tauts: R. Prange, Das Kristalline als Kunstsymbol. Bruno Taut und Paul Klee. Zur Reflexion des Abstrakten in Kunst und Kunst-theorie der Moderne, Hildesheim Zürich New York 1991, S. 21-32; M. Schirren, Weltbild, Kosmos, Proportion. Der Theoreti-ker Bruno Taut, in W. Nerdinger, K. Hartmann (wie Anm. 1), S. 91-113.
52. Semper 1860 (wie Anm. 43), S. 415-416.53. Ibid., S. 415.54. A. Riegl, Stilfragen. Grundlegungen zu einer Geschichte der Or-
namentik, Berlin 1893, S. 1-32; zur Position Riegl innerhalb der Kunsttheorie um 1900: L. Wiesing, Die Sichtbarkeit des Bildes. Geschichte und Perspektiven der formalen Ästhetik, Rein-bek bei Hamburg 1997, S. 57-91; zu Riegls Distanzierung von Semper: H. Laudel, Semper im Widerstreit mit der “materiellen Richtung” seiner Zeit. Eine kleine Nachlese zum Jubiläumsjahr 2003, Halle an der Saale 2005.
55. Riegl richtete sich gegen die pauschale Auslegung des Semper-schen Standpunkts über den Ursprung der Kunst: “So vorsich-tig drückte sich der Autor aus, der, Künstler und Gelehrter zugleich, in höherem Maasse als irgend Einer seines Jahrhun-derts die technischen Proceduren des Kunstschaffens in ihrer Gesammtheit und ihren Wechselbeziehungen überblickte und umfasste. Es geht auch aus seinen obcitirten Worten hervor, dass er sich die formenbildende Thätigkeit der “Technik” im Wesentlichen erst in vorgerücktere Zeiten der Kunstentwick-lung verlegt denkt, und nicht in die ersten Anfänge der Kunst-schaffens überhaupt. Und dies ist auch meine Überzeugung”, Riegl 1893 (wie Anm. 54), S. 12.
56. So leitete etwa Wilhelm von Bezold in seiner einflussreichen Farbenlehre mit Hilfe des Semperschen Standpunkts die Ent-stehung von textilen Ornamenten ab: “Man lernt dabei, dass alle Ornamente wesentlich technischen Bedürfnissen ihren Ursprung verdanken. Indem man den Saum, der unbedingt erforderlich ist, um das Gewebe am Rande vor Abnutzung zu schützen, in regelmäßigen Stichen oder gar mit einem anders gefärbten Faden ausführt, wird er bereits zu einem einfachen Zirat. Nimmt man die äußersten Fäden des Gewebes, wie sie sich bei dem ungesäumten Stoffe von selbst durch den Ge-brauch loslösen, absichtlich heraus und verlegt man den bin-denden Saum weiter nach innen, so entsteht ein neues orna-mentales Element, die Fransen. Durch solche höchst einfache Mittel verleihen die Naturvölker den Produkten ihres Kunst-fleißes Schmuck und Zier, und ein genaueres Studium dieser Anfänge der Kunst, wie es besonders von Semper so meisterhaft durchgeführt wurde, zeigt, wie alle Ornamente, deren man sich auch in den Epochen höchster Kunstentwicklung bedient
hat, solch einfachen Anfängen ihren Ursprung verdanken”. von Bezold 1874 (wie Anm. 10), S. 206, Hervorhebung durch von Bezold.
57. Riegl 1893 (wie Anm. 54), S. 4.58. Ibid.59. Ibid., S. 5.60. Zu Riegls Darlegungen über ägyptische Ornamente: F. Jodl,
Ästhetik der bildenden Künste, Stuttgart Berlin 1917, S. 318.61. Riegl 1893 (wie Anm. 54), S. 5.62. Ibid., S. 10.63. Zur Stellung Wilhelm Worringers in der kontemporären
Kunsttheorie: C. Öhlschläger, Abstraktionsdrang. Wilhelm Wor-ringer und der Geist der Moderne, Paderborn 2005.
64. W. Worringer, Abstraktion und Einfühlung. Ein Beitrag zur Stil-psychologie, fünfte Auflage, München 1918, S. 67, erste Auflage München 1908.
65. Ibid., S. 77.66. Ibid.67. Ibid.68. Ibid., S. 78.69. Worringer 1918 (Anm. 64), S. 4; vgl. die Ausführungen von
Theodor Lipps über das Verhältnis der “ästhetischen Einfüh-lung” zum “ästhetischen Genuss”: T. Lipps, Von der Form der ästhetischen Apperception, in “Philosophische Abhandlungen. Gedenkschrift für Rudolf Haym”, 1902, S. 365-406, hier S. 368-369.
70. Ibid., S. 5.71. Vgl. die zeitgenössische Untersuchung der Einfühlungstheorie
von Theodor Lipps: P. Stern, Einfühlung und Assoziation in der modernen Ästhetik, München 1897, S. 8-51.
72. Theodor Lipps zit. n. Worringer 1918 (wie Anm. 64), S. 4.73. W. Gropius, “Über das Wesen des verschiedenen Kunstwollens
im Orient und im Occident”, maschinenschriftliches Manu-skript, Bauhaus-Archiv Berlin, Nachlass Gropius, MS 1.
74. B. Taut, Der Regenbogen. Aufruf zum farbigen Bauen, in “Früh-licht”, 1921, Herbst, S. 28.
75. Ibid.76. Taut 1919 (wie Anm. 40), S. 60.77. Taut 1921 (wie Anm. 74), S. 28.78. B. Taut, Die Farbe, in “Die Farbige Stadt”, 6, 20. Juni 1931,
S. 29-30, zit. n. H. Pitz, W. Brenne, Die Bauwerke und Kunst-denkmäler von Berlin, Bezirk Zehlendorf, Siedlung Onkel Tom Einfamilienhäuser 1929, Berlin 1980, S. 150-156, hier S. 153.
79. Ibid.80. Ibid.81. Anonym 1915 (wie Anm. 3).82. Zum Vorspringen und Zurückweichen der Farben äußer-
te Owen Jones: “In using the primary colours on moulded surfaces, we should place blue, which retires, on the concave surfaces; yellow, which advances, on the convex; and red, the intermediate colour, on the undersides”, O. Jones, The Gram-mar of Ornament. Illustrated by Examples from various Styles of Ornament. One Hundred and Twelve Plates, London 1856, S. 7. Wilhelm von Bezold merkte zu der selben Thematik an: “Ein anderer Punkt, auf den aufmerksam gemacht werden muß, betrifft das Hervortreten und Zurückspringen gewisser Farben. Gesetzt, man habe in einem Muster aus lauter glei-chen Quadraten dieselben abwechselnd rot und blau bemalt, so erscheinen die roten Quadrate dem Auge näher liegend als die blauen, eine Erscheinung, die noch entschiedener auftritt,
La conservazione delle policromienell’architettura del XX secolo
Conservation of colourin 20th Century architecture
a cura di | edited by Giacinta Jean
SUPSI | Nardini EditoreLa conservazione delle policrom
ie nell’architettura del XX
secoloC
onservation of colour in 20th C
entury architecturea cura di | edited by G
iacinta Jean
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Giornate di studio internazionaliLugano-Canobbio, 8-9 febbraio 2012Scuola universitaria professionale della Svizzera italianaDipartimento ambiente costruzioni e designIstituto materiali e costruzioni
Il convegno è stato svolto all'interno del progetto di ricerca Enciclopedia critica per il restauro e il riuso dell’architettura del XX secolo, sezione Strumenti metodologici che coinvolge le scuole di architettura svizzere (Università della Svizzera italiana; École Polythecnique Fédérale, Lausanne; Eidgenös-sische Technische Hochschule, Zürich; Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana), finanziato dalla Confe-renza universitaria svizzera (2008-2012).
Coordinamento redazionaleCarla Burani RuefGiacinta Jean
Impaginazione e fotolitoLaboratorio cultura visiva
In copertinaTeatro San Materno, Ascona (TI), Foto A. Küng
Sul retroP. Bottoni, Progetto di una facciata del nuovo padiglione 34 della Fiera di Milano, 1953P. Bottoni, Palazzo comunale di Sesto San Giovanni, 1961-71. Modello del Laboratorio di Modellistica, Dpa, Politecnico di MilanoLe immagini sono di proprietà dell’Archivio Piero Bottoni, Dpa, Politecnico di Milano che ne ha gentilmente concesso la pubblicazione.
Qualsiasi riproduzione di questo testo, totale o parziale, eseguita con qualsiasi mezzo, anche per uso didattico ed interno, può essere effettuata soltanto con il consenso scritto dell’Editore. Gli autori dei testi hanno verificato e richiesto i diritti di riproduzione delle immagini. Qualora fossero stati involontariamente violati diritti di copyright si prega di segnalarlo a [email protected].
© 2013 Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
La conservazione delle policromienell’architettura del XX secolo
Conservation of colourin 20th Century architecture
a cura di | edited by Giacinta Jean
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
SUPSI | Nardini Editore
SommarioSummary
Introduzione 7Introduction Giacinta Jean
Il ruolo progettuale del coloreColour as part of the design
L’uso del colore nell’architettura 19del XX secolo. Una griglia di lettura in funzione della salvaguardia Bruno Reichlin
The Century of Modern Color in Architecture 41William W. Braham
Theo van Doesburg: 55transformation of colour in architecture Mariël Polman
Die Farbe in der Architektur Le Corbusiers. 73Strategien und Farbreihen 1912-1931-1959 Arthur Rüegg
Il colore della Rivoluzione: 85cromatismo e avanguardie storichenella Russia Sovietica Anna Vyazemtseva
Tutto al mondo deve essere coloratissimo 97Chiara Toscani
The Quest for Colour Standards 107in 20th Century Britain Patrick Baty
Il colore nelle cittàColour in urban spaces
Die Konservierung und Restaurierung 123der Polychromie in der Stadt.Die Siedlungen in Deutschland Winfried Brenne
Geometrisches Ornament und erster Stil. 141Bruno Tauts farbige Fassadengestaltungender Siedlung Falkenberg Robin Rehm
Piero Bottoni: il valore costruttivo del colore 161Graziella Tonon
I materiali e le tecnicheColour technology
La manualistica sul colore 183 ad uso di architetti e imbianchini Giacinta Jean
Synthetic-resin house paints 215from the 1920s-1960s:properties, use and their reception by architects and painters Harriet A.L. Standeven
Silikatfarben 229Thomas Klug
Il secolo sbiadito e quello scintillante 245Ruggero Pierantoni
Studio e conservazione delle policromieArchitectural paint researchand conservation strategy Decision Making: 265that was then but this is now Helen Hughes
Approach for the study of color schemes 273 in 20th Century architecture Francesca Piqué
Identification and translation of 20th Century 291colours to modern industrial paints Katrin Trautwein
Der denkmalpflegerische Umgang 307mit Farbfassungen. Am Beispiel eines Bausder Zwischenkriegszeit Bernhard Furrer
The material is polychrome! 317From interdisciplinary study to practicalconservation and restoration:the wall surfaces of the TugendhatHouse as an example Ivo Hammer
Il colore nelle scuole 333Isabel Haupt
Zwang zur Farbe? 343Zum Umgang mit historischer Farbigkeit in privaten Wohnräumen – Die Restaurierung der Villa Streiff in Küsnacht Roger Strub
Architetture e pitture muraliArchitecture and wall painting
Gli audaci colori di Angiolo Mazzoni 357al palazzo delle Poste di Trento (1929-1934) Fabio Campolongo
Le fonti della policromia. 379Carte d’archivio fra architettura e decorazione Paola Pettenella
Dagli affreschi ai murales: 391problemi di tecniche e di conservazione Paola Iazurlo
Dalle tempere murali di Afro (1936) 409alle architetture dipinte di Tarasewicz (2004):analisi tecnica e problemi di conservazionedelle policromie nell’architettura del XX secolo Marta Melchiorre Di CrescenzoTeresa Perusini
Keith Haring a Pisa. Pulitura e protezione 427di un dipinto acrilico esposto in ambiente esterno Antonio Rava